Berlin und Bonn / Oktober 2025 www.behoerdenspiegel.de
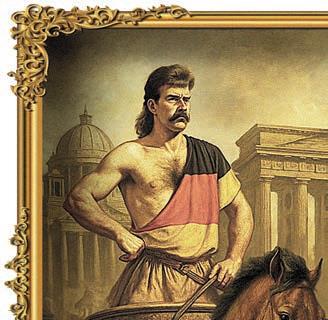
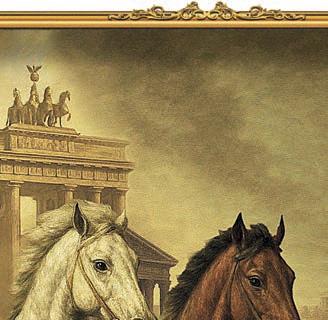
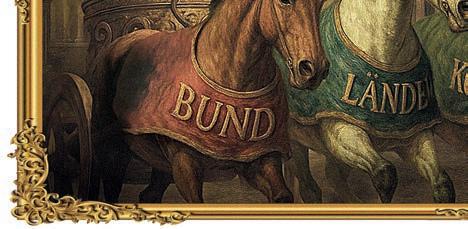

Berlin und Bonn / Oktober 2025 www.behoerdenspiegel.de
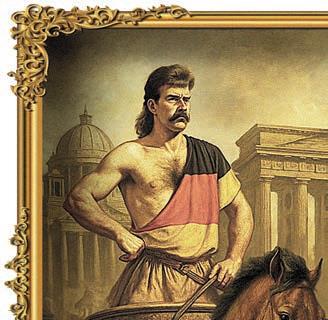
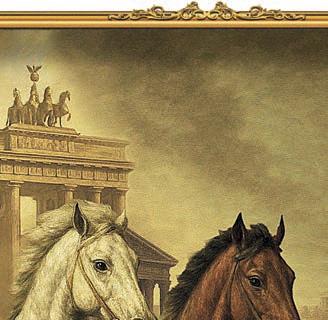
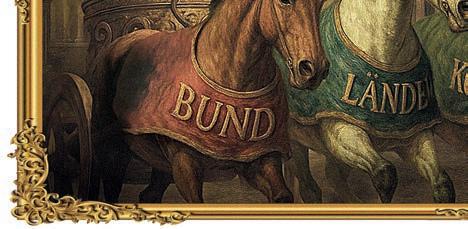
Bund, Länder und Kommunen – um den Sozialstaat und Wirtschaftsstandort Deutschland für die Zukunft sattelfest zu gestalten, ziehen alle drei an einem Strang. So lautet die Idealvorstellung. Doch wie gut funktioniert die föderale Arbeitsteilung im Behördenalltag? Wo liegen die Chancen und Herausforderungen und was muss dringend verbessert werden?



DBB veröffentlicht Befragung zu Gewalt im Öffentlichen Dienst (BS/Anne Mareile Moschinski/Dr. Eva-Charlotte Proll) Polizisten werden beleidigt, Busfahrer beschimpft, Rettungskräfte attackie rt: Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst nimmt zu – das zeigt die aktuelle Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes.
In Krisenzeiten ist der Staat verlässlicher Schutzschirm für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen, dann ist das Vertrauen groß. In normalen Zeiten sinken die Zustimmungswerte mit Blick auf die staatliche Handlungsfähigkeit. Letztere wird aber auch überschätzt. Der Staat kann nicht alles leisten. Er ist kein Heilsbringer. Wenn Politiker dies zugeben, müssten sie Lösungsansätze liefern und die manövrieren den Vollzug meistens noch stärker in Richtung Ohnmacht. Den wachsenden Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit des Staates zeigt sich auch in den Ergebnissen der DBB-Bürgerbefragung. Die Gesellschaft verroht, der Umgang der Menschen untereinander wird rücksichtloser und brutaler: Dieser Meinung sind 84 Prozent der Bevölkerung und damit eine überwiegende Mehrheit. Das hat Folgen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. So ist jeder zweite Mitarbeitende nach eigenen Angaben bereits Opfer eines Übergriffs geworden, weil er oder sie im Dienst behindert, belästigt, beschimpft oder angegriffen wurde. „Das ist ein erschreckendes Ergebnis und diese Verrohung spüren auch die Kolleginnen und Kollegen“, erklärte der DBB-Bundesvorsitzende Volker Geyer bei der Vorstellung der Studie in Berlin.
Gesetze schneller vollziehen
87 Prozent der 2.000 befragten Bürgerinnen und Bürger berichten, bereits Zeuge von Beleidigungen gewesen zu sein. 69 Prozent haben beobachtet, dass Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes angeschrien wurden und jeder Dritte (36 Prozent) hat eine Form von körperlicher Bedrängung beobachtet, zwölf Prozent direkte körperliche Gewalt. „Wir haben zwar ge-
nügend Gesetze“, sagt DBB-Chef Geyer, aber: „Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese schneller vollzogen werden.“ Wie die Bürgerbefragung des DBB zeigt, wünscht sich die Hälfte aller Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mehr Schutz und Unterstützung von ihren Arbeitgebern. „Der Staat darf seine Beschäftigten nicht allein lassen“, fordert Geyer. Auch die aktuellen Ergebnisse des „eGovernment Monitors 2025“ zeigen: das Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung ist beschädigt, lediglich 33 Prozent haben Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.
Respekt vor Beschäftigten tendiert gegen null Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), bestätigt die Zunahme der gewalttätigen Übergriffe gegen die Mitarbeitende des Öffentlichen Dienstes. Doch nicht nur die Zahl der Übergriffe habe zugenommen, sagt er. Auch die Art der Angriffe habe sich verändert. „Es gibt häufiger schwerere Verletzungen, die Krankenhausaufenthalte oder RehaMaßnahmen notwendig machen“, berichtet er. Doch auch die Polizeibeschäftigten selbst stünden immer öfter im Visier der Täter. „Wir haben im Streifendienst immer öfter gegen Messerangreifer vorzugehen“, führt Kopelke weiter aus. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPoIG). „Für die Einsatzkräfte wird der tägliche Dienst auf der Straße zum Weg in die Gefahrenzone, was nicht selten zur lebensbedrohlichen Situation wird“, erklärt DPoIG-Sprecher Marc Franke. Neu sei: „Die Gewalt kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft.“ Der Staat verfüge über keine Autorität mehr, um Regelungen für das Zusammenleben zu erstellen. „Der Respekt vor den Beschäftigten geht gegen null“, so Franke Mit wachsender Respektlosigkeit und zunehmender Gewalt sind ebenfalls die Beschäftigten des Zolls konfrontiert. „Gerade im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung liegt ein Grund in der fortschreitenden Professionalisierung und Brutalisierung der kriminellen Netzwerke“, erklärt der Sprecher der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ), Felix Schirner. Auch im Innendienst erleben Zöllnerinnen und Zöllner Übergriffe. Der BDZ-Bundesvorsitzende Thomas Liebel bringt es auf den Punkt: „Es ist an der Zeit, dass der Schutz derjenigen, die täglich für die Sicherheit unseres Landes eintreten, oberste Priorität erhält.“
Diesen Negativtrend hin zu mehr Wertschätzung für den Öffentlichen Dienst umzukehren, ist Aufgabe der Politik – angefangen vor der eigenen Haustüre (mehr zum Thema Resilienz und Wertschätzung auf S. 39 dieser Ausgabe).


Arbeiten und Auftanken
Workation ist im Öffentlichen Dienst noch nicht sehr verbreitet. Dabei zeigen einige Behörden, dass es funktionieren kann. Seite 3

Geschlossene Gesellschaft
Fehlende Aufzüge, nicht nutzbare medizinische Technik, unpassierbare Ämter und Schulen: Wie barrierefrei sind unsere Kommunen? Seite 15

Falsche Schätzungen
Warum 1,7 Millionen ehrenamtlich Helfende im Katastrophenfall unrealistisch sind, erklärt Dr. Andreas Follmann von der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin. Seite 40


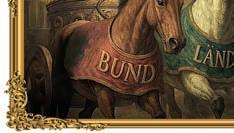
Inventur
Schwerpunktthema der Ausgabe Föderale Trias
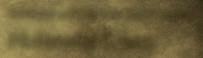
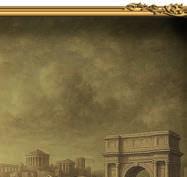
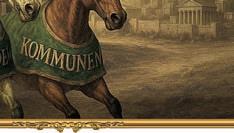


Fließen, stauen, versickern
Zur Verteilung des Sondervermögens
Des Nachbarn Vergaberecht
Niedersachsens Kommunen fordern Entlastung
Staatenlos Zwischen Unsicherheit und Verwaltungsrealität
Registermodernisierung im Aufbruch
Mit dem NOOTS zum Systemwandel in der Verwaltung
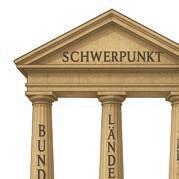



Bildnachweise Seite 1: BS/Kittiphan, stock.adobe.com; BS/Dan Race, stock.adobe.com; Foto: BS/privat
Seite 2: Titel: BS/Hoffmann
Impressum
Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH.
Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll
Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt
Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Moschinski
Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon
Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch
Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser
Digitaler Staat Christian Brecht, Frederik Steinhage, Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky
Sonderkorrespondenten BOS Gerd Lehmann
Online-Redaktion Tanja Klement
Parlamentsredaktion Berlin
Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10
Zentraler Kontakt
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57
Tel. 0228/970 97-0
Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41
Tel. 030/55 74 12-0
Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch
Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch
www.behoerdenspiegel.de
Layout Fabienne Besold, Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, André Offenhammer Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn
Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau
Herausgeber- und Programmbeirat Dr. h.c. Uwe Proll (Vorsitz)
Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent
Für Bezugsänderungen:
Seite 6
Seite 11
Seite 16
Seite 31
Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Föderale Trias“ handelt.
Kommentare
1001
Endlich ist es soweit: Nachdem die elektronische Patientenakte (ePA) für alle schon Anfang 2025 ausgerollt und für die Nutzenden per Opt-out-Verfahren zum Standard erhoben wurde, soll sie ab Oktober auch für die Leistungserbringenden verpflichtend sein.
Bei der Einrichtung der ePA in einer Krankenkassenapp ist es allerdings nicht mit zwei Klicks und einer Anmeldung getan. Denn um die ePA auch nutzen zu können, ist neben der Krankenkassenapp noch eine zusätzliche Identifikationsapp der Krankenkasse nötig, die immer mitgeöffnet werden muss, um an die ePA zu gelangen. Das verbraucht viel zusätzlichen Speicherplatz auf dem Endgerät und sorgt bei der ersten Einrichtung nicht nur für zusätzlichen Frust, sondern auch für eine potenzielle Abbruch-Hürde. Und damit ist die ePA nicht allein. Auch wer einen Antrag digital an die öffentliche Verwaltung stellen möchte, benötigt zunächst ein Bund-ID-Konto. Um das einzurichten, braucht es ebenfalls eine zusätzliche Applikation: die AusweisApp. Und so zieht es sich durch die Prozesse: Wichtige Dokumente oder Anträge werden digitalisiert –was erst mal gut ist. Aber da es für unterschiedliche Nutzungsgebiete auch unterschiedliche Anbieter, in diesem Fall Krankenkassen gibt,
kocht jeder sein eigenes Süppchen und muss damit auch zusehen, dass alles datenschutzkonform geregelt ist. Das Resultat: Tausende eigens für diese eine Sache gedachte Anwendungen, die auf Dauer nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Speicherplatz kosten.
Ein Lichtblick soll hier das geplante EUDI-Wallet bieten. Ein direkter Zugriff auf wichtige Dokumente wie Personalausweis, Reisepass, Immatrikulationsbescheid und auch die ePA soll mit diesem digitalen Safe ermöglicht werden – eine Anwendung, viele Nutzungsmöglichkeiten. Doch so schön das auch klingt, so gut muss es erst einmal umgesetzt werden. Der erste deutsche Test dazu startet Mitte 2026 in Dresden. Zu Beginn sollen Dresden-Pass und die sächsische Ehrenamtskarte darin Platz finden, weitere Anwendungen sind in Planung. Auch Dresdenerinnen und Dresdener können sich an dem Prozess beteiligen. Deutschlandweit soll das EUDI-Wallet Anfang 2027 ausgerollt werden. Aber ob das von Anfang an so laufen wird wie gehofft, ist fraglich, wenn die bisherigen Digitalisierungsvorstöße betrachtet werden. Mehr zum Thema ePA lesen Sie auf Seite 23.
(BS) Eine härtere Gangart gegen diejenigen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern: So hat Finanzminister Lars Klingbeil das Ziel des neuen Gesetzes gegen Schwarzarbeit formuliert. Das ist sinnvoll und angesichts einer durch Schwarzarbeit entstandenen Schadenshöhe von 766 Millionen Euro im vergangenen Jahr ein überfälliger Schritt. Das zeigt sich auch am Resümee des Zolls: 47 Millionen Euro bzw. sechs Prozent des entstandenen Schadens konnten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure wieder eintreiben, eine verschwindend geringe Zahl. Dabei ist auch die Dunkelziffer hoch, unzählige Delikte werden vom Zoll nicht erfasst – Jahr für Jahr.
von Anne Mareile Moschinski
Die verantwortlichen Ministerien indes malen bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs eine rosige Zukunft an die Wand. Sie prognostizieren Mehreinnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro ab dem Jahr 2028. Das schraubt zu Recht die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Zollbeschäftigen hoch. Aber: Reichen die neuen Regelungen für eine „härtere Gangart“ aus und werden sie die
Dunkelziffer in puncto illegaler Beschäftigung senken?
Klar ist: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls sollen verstärkt Zugriff auf die Daten anderer Behörden sowie mehr Kompetenzen bei Überwachungsmaßnahmen erhalten. Das ist eine notwendige Anpassung an äußere Erfordernisse. Als zweite Neuerung wird die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Zukunft Betrugsfälle selbst ahnden können. Damit bewegt sie sich auf Augenhöhe mit anderen Ermittlungsbereichen und dürfte dafür sorgen, dass Taten schneller geahndet und Personen ohne Aufenthaltstitel schneller identifiziert werden. Klar ist aber auch: Besiegen lassen wird sich das Schreckgespenst der Schattenwirtschaft damit nicht. Zu verlockend bleibt die Schwarzarbeit und der damit verbundene Gewinn in den Augen vieler, zu ausgefeilt sind die Betrugstechniken, um gestohlenes Geld und Täter ins Ausland zu schaffen. Es braucht eben nicht nur neue Gesetze, sondern auch: genügend Personal, mehr Kontrollen, eine adäquate technische Ausstattung. An diesen Stellschrauben wird die neue Regierung drehen müssen – angesichts der desolaten Haushaltslage ein kniffliges Unterfangen.
Die Landeshauptstadt München und die IT Baden-Württemberg (BITBW) gehören zu den Vorreitern, die ihren Beschäftigten bereits eine Workation – Arbeit (Work) im Urlaub (Vacation), genauer: am Urlaubsort – ermöglichen. Nachdem sich mobiles Arbeiten in der Coronazeit etabliert hatte, äußerten die Beschäftigten den Wunsch, phasenweise auch aus dem Ausland arbeiten zu dürfen. „Da war schnell klar: Wir brauchen klare Spielregeln, die gleichzeitig Flexibilität geben und Sicherheit schaffen“, erinnert sich der Personal- und Organisationsreferent der Landeshauptstadt München, Andreas Mickisch
Genau wie die Landeshauptstadt hat auch die BITBW den Anspruch auf Workation in die Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten aufgenommen. Diese regelt u. a., dass Mitarbeitende bis zu 30 Tage innerhalb von 12 Monaten im Kalenderjahr Workation in der EU machen dürfen. Außerdem zeigt sie auf, welche Abläufe und Voraussetzungen dabei zu beachten sind. Das Angebot gilt für alle Arbeitsplätze, an denen mobiles Arbeiten möglich ist – unter Beachtung der vorab mitgeteilten Hinweise zu Datenschutz, Informationssicherheit und Arbeitsschutz. Mit frischem Schwung „Für mich war es eine tolle Mischung aus Sonne, Urlaubsatmosphäre und konzentriertem Arbeiten“, berichtet Stefanie Huber, Organisationsberaterin im Personal- und Organisationsreferat der Landeshauptstadt München. Knapp 1.400 km trennen Malta –den Ort ihrer letzten Workation –und München. Trotzdem sei der Arbeitsalltag mit einem normalen Homeoffice-Tag vergleichbar gewesen. Der einzige Unterschied: Huber konnte nicht an spontanen Präsenzterminen teilnehmen. „Das habe ich aber von Anfang an offen kommuniziert“, betont sie. Offenheit und klare Absprachen sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen einer Workation. Außerdem sollte schon vor Reiseantritt überprüft werden, ob am Zielort der Zugang zu einer sicheren Internetverbindung sowie die benötigte technische Infrastruktur vorhanden sind. „Beim nächsten Mal wer-
Die Beamtengesetze der Länder sehen für Beamtinnen und Beamte, die über eine Mindestzeit von 25 Jahren Wechselschichtdienst (bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Justizvollzug) geleistet haben, vor, dass für sie eine um ein Jahr herabgesetzte Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand gilt. Wechselschichtdienst liegt vor, wenn nach einem Schichtplan die tägliche Arbeitszeit regelmäßig zwischen Früh-, Spätund Nachtdienst wechselt. Mit dem vorgezogenen Altersruhestand soll den besonderen gesundheitlichen Anforderungen an die Jahre im Wechselschichtdienst Rechnung getragen werden.
Freigestellt
Eine Polizeibeamtin aus Nordrhein-Westfalen, die über Jahre Wechselschichtdienst geleistet hatte und zwischendurch Mutter geworden war, machte geltend, dass die von ihr genommene Elternzeit von zweieinhalb Jahren auf ihre Dienstzeit im Wechselschichtdienst anzurechnen sei. So hätte sie die
(BS/akh) Dienstrechner aus, Smartphone in die Schublade und raus in die Berge. Workation ist im Öffentlichen Dienst noch nicht sehr verbreitet. Dabei zeigen einige Behörden bereits, dass es funktionieren kann.

Workation auf die EU bzw. den Europäischen Wirtschaftsraum, da in anderen Ländern eigene Regelungen zu Sozialversicherung, Arbeitsrecht etc. greifen können. Foto: BS/Kittiphan, stock.adobe.com
de ich genauer auf die Ausstattung der Unterkunft achten. Vor allem auf ausreichend Steckdosen“, erklärt Huber. Die Ferienwohnung auf Malta hatte zwar genügend Arbeitsplätze für alle Mitreisenden, doch nicht jeder davon verfügte über eine Lademöglichkeit – eine unerwartete Herausforderung, die sich durch gelegentliche Platzwechsel lösen ließ. Huber plant bereits ihre nächste Workation und zeigt sich nach ihrem ersten Selbsttest überzeugt vom Konzept: „Die neue Umgebung hat spürbar frischen Schwung und Motivation gebracht.“
Ausbruch aus dem Alltag „Ein neues Arbeitsumfeld im Grünen oder in einer interessanten Stadt, mit Fernblick, unter Palmen oder am Strand bietet uns Lebensqualität, neue Eindrücke, Erholung und Abwechslung“, so Prof. Dr. Julia Reif. Die Professorin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität der Bundeswehr München bestätigt die positive Auswirkung von Workation
auf die Motivation von Beschäftigten. Auch die erhöhte Flexibilität und Zeitsouveränität könnten die intrinsische Arbeitsmotivation stärken und – durch die erlebte Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse – letztendlich auch die Produktivität und Leistung. Von Workation können verschiedene Gruppen von Beschäftigten profitieren, erläutert Reif: von den jüngeren Generationen, die Flexibilität und digitale Arbeitsweisen erwarten, bis hin zu älteren Beschäftigten, die ggf. nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten. „Es gibt nicht den einen Workationer-Typ“, erklärt sie. Für manche Menschen sei die Leidenschaft für Outdoor-Aktivitäten ein Reiseanlass, für andere das Kennenlernen neuer Leute und für wieder andere die Suche nach außergewöhnlichen Erfahrungen abseits des Mainstreams. „Was ihnen aber vermutlich allen gemeinsam ist, ist ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbstführung, ihr Bedürfnis nach Selbstentfaltung und die Arbeit an
Aufgaben, die so beschaffen sind, dass sie orts- und zeitunabhängig bearbeitet werden können.“
Entscheidend sei bei alldem, Arbeit und Freizeit bewusst zu trennen und die Arbeitszeit unter Palmen kognitiv als ebensolche zu verbuchen, so Reif. Wer Workation als Zwang interpretiere, im Urlaub arbeiten zu müssen, kehre die Ergebnisse um: Zufriedenheit, Motivation und Arbeitsqualität nähmen ab.
Abschalten und entspannen
Inna Fried, Personalsachbearbeiterin bei der BITBW, hat ihre erste Workation gemeinsam mit einer Kollegin gemacht. Die Reise führte die beiden Frauen nach Madrid, Valencia, Barcelona und Madeira. Arbeit und Urlaub voneinander abzugrenzen, fiel ihnen überraschend leicht, berichtet die Personalsachbearbeiterin. „Sobald der Laptop zugeklappt war, schalteten wir automatisch in den Urlaubsmodus.“ Vom Blick aufs Meer bei der ersten Tasse Kaffee am Morgen bis zum Feierabend am Strand – der
Eine Kolumne von Ralph Heiermann
Mindestdienstzeit von 25 Jahren
Wechselschichtdienst erreicht und für sie wäre die Regelung über die besondere vorgezogene Altersgrenze aufgrund des langjährigen Wechselschichtdienstes anzuwenden gewesen. Der Gedanke liegt aus praktischen Gründen nahe. Denn gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes, in denen regelmäßig die Elternzeit stattfindet, bedeuten nicht nur täglichen, sondern regelmäßig auch anschließenden nächtlichen Einsatz. Diese Auffassung teilte der Dienstherr nicht und lehnte eine Anrechnung ab. Auch die Klage beim Verwaltungsgericht blieb erfolglos. Vor dem Oberverwaltungsgericht erhielt die Klägerin im Anschluss mit ihrer Berufung recht. In letzter Instanz hat sich nun am 26. Juni 2025 das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage der Anrechnung der Elternzeit auseinandergesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht musste die Frage beantworten, ob sich eine Verpflichtung zur Anrechnung der Elternzeiten auf die Zeiten im Wechselschichtdienst aus der
Richtlinie 2019/1158/EU ergibt. Diese Richtlinie soll die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige sowie die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz fördern. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass Mütter und Väter, die aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, Bedingungen vorfinden, die für sie nicht weniger günstig sind als die, auf die sie Anspruch gehabt hätten, wenn sie Elternzeit nicht in Anspruch genommen hätten. Das gilt auch für zwischenzeitlich eingetretene verbesserte Arbeitsbedingungen.
Dienstliche Belastung
Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Dienstherrn recht gegeben. Entscheidend ist dabei nicht eine Bewertung der tatsächlichen Belastung von Müttern durch die Kinderbetreuung und eine Vergleichbarkeit mit Wechselschichtdienst gewesen. Das liegt deswegen auf der Hand, weil es sich nicht um eine dienstliche Belastung handelt. Das Gericht hebt vielmehr nach der
Arbeitsort-Wechsel war nicht nur eine besondere Erfahrung, sondern auch gut für die Gesundheit. „Wir waren merklich ausgeglichener und entspannter“, erzählt Fried. „Insgesamt haben wir uns mehr bewegt, sind viel gelaufen und haben uns dank des gesteigerten Wohlbefindens auch bewusster ernährt.“
Nachhaltige Effekte
Von den positiven gesundheitlichen Effekten einer Workation können Beschäftigte auch auf kleineren Reisen im Inland profitieren. In einem Projekt hat CENTOURIS, ein Institut der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau, die ganzheitliche gesundheitsorientierte (Co-)Workation in bayerischen Heil- und Thermalbädern untersucht. Dort herrschen durch bereits bestehende Kurangebote besondere Möglichkeiten, Arbeitszeit mit regenerativen Elementen wie einem Besuch in der Natur oder therapeutischen Angeboten zu kombinieren. Diese Verbindung kann Stressabbau und mentale Entlastung fördern. Zudem können therapeutische, physiotherapeutische und ernährungsbezogene Programme vor Ort dazu beitragen, ungesunde Arbeits- und Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verändern. Die Ergebnisse des Projekts machen deutlich, dass es sich für Arbeitgeber, aber auch für die Kurorte lohnt, entsprechende Konzepte zu fördern und auszubauen. Arbeitgeber können so ihre Attraktivität steigern, ihre Beschäftigten können Arbeit und Gesundheitsvorsorge verbinden, ohne Urlaubstage zu nutzen, und Fehlzeiten werden reduziert. Kurorte können sich neben den klassischen Kurteilnehmenden neue Zielgruppen erschließen, die auch außerhalb der Hochsaison anreisen und durch ihren Besuch die Wirtschaft vor Ort stärken. „Gesundheitsorientierte Workation stellt in Bayern ein vielversprechendes Konzept dar — sowohl aus Sicht der Beschäftigten wie auch der Arbeitgeber und der Kommunen bzw. Kurorte“, erklärt Dr. Stefan Mang, Geschäftsführer von CENTOURIS. Es bestehe bereits ein messbares Interesse und die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Potenziale seien real.
bisher allein vorliegenden Pressemitteilung hervor, dass die besondere Altersgrenze für die durch langjährigen Wechselschichtdienst belasteten Polizeibeamten von diesen Bedingungen nach der Richtlinie 2019/1158/EU nicht erfasst werde. Der Landesgesetzgeber trage vielmehr mit der Regelung über die herabgesetzte Altersgrenze der vorzeitigen Abnahme der Leistungsfähigkeit von Beamtinnen und Beamten Rechnung. Typischerweise folge diese aus den mit dem langjährigen Wechselschichtdienst verbundenen gesundheitlichen Belastungen. Die Entscheidung ist im Hinblick auf die Zielrichtung der EU-Richtlinie überraschend. Das Oberverwaltungsgericht hatte ausführlich be-




gründet, dass die landesgesetzliche Bestimmung unionsrechtskonform mit der Richtlinie 2019/1158/EU ausgelegt werden müsse. Diese verlange in Bezug auf etwaige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Phasen der Elternzeit nach ihrer Beendigung im wiederaufgelebten Beschäftigungsverhältnis so zu behandeln, als wäre es nicht zur Freistellung von der Dienstpflicht gekommen. Was das Bundesverwaltungsgericht der schlüssigen Begründung des Oberverwaltungsgerichts im Einzelnen entgegenhält und warum es die Frage nicht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat, wird erst in dem noch nicht vorliegenden vollständigen Urteil nachzulesen sein.


Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung.
Foto: BS/privat
Nach zähen Verhandlungen konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung im Frühjahr u. a. auf Entgelterhöhungen, verbesserte Arbeitszeitregelungen und eine Anhebung der Sonderzahlungen für Beschäftigte von Bund und Kommunen einigen. Eine Eins-zu-eins-Übertragung der vereinbarten Maßnahmen auf Bundesbeamte im Nachgang zu den Verhandlungen ist üblich, aber auch langwierig. Schließlich ist hierfür ein entsprechendes Anpassungsgesetz erforderlich. Damit die Betroffenen nicht bis zur Verabschiedung des Gesetzes auf ihre Entgelterhöhung warten müssen, hat die Bundesregierung in einer Kabinettssitzung nun Abschlagszahlungen im Vorgriff auf die Übertragung des Tarifergebnisses beschlossen.
Steigerung in zwei Etappen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten des Bundes und auch Versorgungsempfängerinnen und -empfänger profitieren voraussichtlich beginnend mit der Bezügezahlung für Dezember von den geplanten Besoldungsanpassungen. Dann soll im ersten Schritt eine rückwirkende Erhöhung der Entgelte um drei Prozent ab April 2025 erfolgen. Ab Mai 2026 ist eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent geplant. Die Zahlungen erfolgen vorbehaltlich der späteren gesetzlichen Umsetzung durch den Bundestag.
Die Tarifübertragung steht in den Startlöchern
(BS/akh) Ab Dezember sollen Besoldungs- und Versorgungsberechtigte des Bundes mehr Entgelt erhalten. Das ist der erste Schritt, um Beamtinnen und Beamte an der im April erzielten Tarifeinigung für den Öffentlichen Dienst von Bund und Ländern teilhaben zu lassen. Weitere Schritte sollen zeitnah folgen – doch die Umsetzung ist diesmal besonders komplex.

Die Tarifstreiks Anfang des Jahres machen sich bezahlt – nach den Angestellten sollen nun auch die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, die selbst nicht streiken durften, von den erkämpften Entgelterhöhungen profitieren. Foto: BS/vegefox.com, stock.adobe.com
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in dem Kabinettsbeschluss ein Signal der Wertschätzung für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bekommen mit der Abschlagszahlung schnell die notwendigen Besoldungs- und Versorgungserhöhungen“, freut sich GdP-Vize Sven Hüber. „Die Bundesregierung ist jetzt aber auch aufgefordert, sehr zügig die Tarifeinigung vollständig umzusetzen inklusive der neuen Langzeit-Wertkonten und den seit fünf Jahren überfäl-
Total Recruiting
ligen Reformstau bei der amtsangemessenen Besoldung aufzulösen.“
Angemessen und attraktiv Die Bundesregierung will laut eigener Angabe in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, der die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses auf die Bundesbesoldung und -versorgung regelt. Im Verbund damit
Eine Kolumne von Stephan Rotthaus
Neulich erzählte mir eine Personalchefin aus einer großen Behörde von ihrem Messe-Erlebnis: Zwischen hippen Start Ups und Tech-Giganten stand sie mit ihrem Stand – ordentlich, aber irgendwie… grau. Die Bewerberinnen und Bewerber? Zogen vorbei, scannten QR-Codes, landeten auf Karriereseiten, die eher nach Amtsblatt als nach Abenteuer klangen. „Wir bieten Sicherheit und Sinn!“, war ihr Argument. Die Antwort: „Und was noch?“
Die Ansprache entscheidet
Genau hier beginnt die erste Phase des Personalzyklus: die Ansprache. Wer Talente für den Öffentlichen Dienst gewinnen will, muss heute mehr bieten als sichere Jobs und gute Altersvorsorge. Es geht um Haltung, um Storytelling, um Sichtbarkeit – und um die richtigen Kanäle. Klartext: Wer Talente erreichen will, muss raus aus der Komfortzone. Die Generationen Y und Z sind digital unterwegs, informieren sich auf Social Media, vergleichen Arbeitgeber auf Bewertungsportalen und erwarten, als Individuen angesprochen zu werden. Eine Karriereseite im 90erJahre-Stil ist keine Einladung, sondern ein Abschreckungsmanöver.
Mut zahlt sich aus Wie es besser geht, zeigt ein Praxisbeispiel aus dem Buch „Total Recruiting“. Dort wurde in einem christlich geprägten Krankenhaus nicht einfach eine Recruiting-Kampagne gestartet, sondern eine Employer-Branding-Offensive. Das Motto: „Team mit Spirit“: authentische Kommunikation mit

Stephan Rotthaus ist internationaler Experte für Personalstrategie im Öffentlichen Dienst, insbesondere im Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist er Co-Vorsitzender der Gesundheitskommission des Senats der Wirtschaft e. V. Foto: BS/Sebastian Runge
echten Mitarbeitenden und echten Geschichten. „Team mit Spirit“ stand auch auf den Hoodies, die bald überall zu sehen waren. Die Nachfrage war so groß, dass ein Webshop her musste. Das Ergebnis: Die Bewerberzahlen stiegen, obwohl der Markt als extrem anspruchsvoll gilt. Der Rat des Geschäftsführers: „Ruhig mal lauter, krasser, mutig sein. Vielleicht hier und da ein bisschen provozieren. Aber immer authentisch bleiben.“
So punktet die moderne Behörde Positionierung: Was macht Ihre Behörde besonders? Wofür stehen Sie? Entwickeln Sie ein klares Profil, das über „Sicherheit und Sinn“ hinausgeht.
Zielgruppenansprache: Sprechen Sie gezielt die Menschen an, die zu Ihnen passen – und zwar in deren Sprache und auf deren Kanälen. Social Media, kurze Videos, authentische Einblicke in den Arbeitsalltag: Das ist heute Standard, keine Kür.
Karriereseite als Schaufenster:
Ihre Karriereseite ist Ihr digitales Aushängeschild. Sie muss begeistern, nicht nur informieren. Zeigen Sie echte Teams, echte Projekte, echte Entwicklungschancen.
Mitarbeitende als Botschafter: Binden Sie Ihre Leute ein! Wer
könnte glaubwürdiger für Ihre Behörde werben als die, die schon da sind? Empfehlungsprogramme und Mitarbeitende als Botschafter wirken oft stärker als jede Hochglanzbroschüre.
Aktiv werden, sichtbar sein Wer Talente gewinnen will, muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und die Sprache der Zielgruppe sprechen. Es reicht nicht, auf Bewerbungen zu warten – Sie müssen aktiv werden, sichtbar sein und zeigen, was Sie draufhaben.
Webinare zum Thema „Total Recruiting“
• WEBINAR: Total Recruiting im Öffentlichen Dienst am 23.10.2025
https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13153
• WEBINAR: Den gesamten Personalzyklus optimieren am 29.10.2025
https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13155
• WEBINAR: Mitarbeitende als Schlüssel zum Erfolg am 04.11.2025
https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13158
gehören verfassungsrechtlich zusammen“, betont die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG). Die Umsetzung sei komplex und müsse sorgfältig abgestimmt werden. Der Deutsche Beamtenbund (DBB) erhofft sich durch das geplante Gesetz ebenfalls ein Ende des Stillstands im Bereich der amtsangemessenen Alimentation und eine wieder verfassungsgemäß ausgestaltete Besoldung. Ziel sei es, dass der Bund für alle Beamtinnen und Beamten – gerade auch im Sinne der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung – attraktiver und wettbewerbsfähiger werde, so der Bundesvorsitzende Volker Geyer
sei zugleich die Sicherstellung der amtsangemessenen Alimentation auf Bundesebene in Umsetzung der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vorgesehen, heißt es aus dem Bundesministerium des Innern. Gemeint sind die Beschlüsse des BVerfG aus 2020, in denen der Mindestabstand der Besoldung zur Grundsicherung sowie die Alimentation kinderreicher Familien geregelt sind. „Beide Themen – die Übertragung der Tarifeinigung und die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts –
Nach der Verhandlung ist vor der Verhandlung Während an der Übertragung der Tarifergebnisse auf Bundesbeamte gearbeitet wird, befinden sich die Gewerkschaften bereits in der Vorbereitung auf die kommenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. DBB und Verdi befragen derzeit Staatsdienerinnen und Staatsdiener zu ihren Erwartungen. Im November sollen die Forderungen bekanntgegeben werden, im Dezember beginnen dann die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Laut Andreas Hemsing stehen auch hier Verbesserungen bei Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Personalpolitik im Fokus. „Wir sehen, dass Entlastung und Arbeitszeitsouveränität große Themen sind“, so der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des DBB. „In der Einkommensrunde 2025 mit Bund und Kommunen sind wir hier erste Schritte in die richtige Richtung gegangen. Die Landesbeschäftigten haben die klare Erwartung, dass die Länder hier mehr tun und sich als moderne Arbeitgeber präsentieren.“


Schlanker Staat starke Steuerung
5. NOVEMBER 2025
GRAND HYATT BERLIN
www.less-bureaucracy.de
Personalmangel und Budgetnot führen häufig zur Überlastung der verbleibenden Beschäftigten und zur Fluktuation – das ist auch bei der Krise der Kinder- und Jugendhilfe nicht anders. Die schwierige Lage hat dabei zur Folge, dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihnen nicht geholfen wird, wie Dr. Elke Alsago, Bundesfachgruppenleiterin im Bereich Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit Verdi, erklärt. Dies sei besonders schlimm, da sich sowohl die aktuelle Weltlage als auch jetzt noch Folgen der Corona-Pandemie auf die Jugendlichen besonders belastend auswirkten. Aus diesem Grund hat Verdi im Rahmen der Aktion „Wer hilft noch, bevor das Kind in den Brunnen fällt?" an alle Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder sowie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gewendet, um für eine auskömmliche Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe zu sorgen.
Pingpong der Verantwortung Schon das ganze Jahr über ist die schwierige finanzielle Lage der Kommunen ein Thema. Gleichzeitig nimmt die Aufgabenbelastung immer weiter zu. Da die Kinder- und Jugendhilfe zu 80 Prozent von den Kommunen getragen wird, leiden darunter vor allem die Präventivmaßnahmen. Diese werden gerne gekürzt, wenn es um Sparmaßnahmen geht. Dadurch geraten jedoch noch mehr junge Menschen in die Situation, dass sie Hilfe benötigen. Doch Bund, Länder und Kommunen spielen Pingpong, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und mehr in die wichtige soziale Struktur zu investieren.
Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle, bemängelt:
Kinder- und Jugendhilfe in der Krise
(BS/sr) Wenn von Investitionen in die Zukunft die Rede ist, geht es meistens um unsere Infrastruktur oder das Klima. Die eigentlichen Träger der Zukunft – die Jugend – treten jedoch oft in den Hintergrund. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Situation der Kinder- und Jugendhilfe.

Wenn die Kinder- und Jugendhilfe vernachhläsigt wird,
„Statt zusammen Lösungen zu finden, schieben Bund, Länder und Kommunen die Verantwortung für das System Kinder- und Jugendhilfe nur hin und her.“
Acht Forderungen
Dieses Spiel um die Finanzierung müsse aufhören, so lautet eine der acht Forderungen der Gewerkschaft an die Finanzministerinnen und Finanzminister. Denn der Bund sei nach dem Grundgesetz dazu verpflichtet, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. So wird gefordert, dass sich der
Bund zukünftig regelmäßig an den Kosten der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt und die Länder die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich in dem Bereich entlasten. Zudem soll ein nationaler Fonds geschaffen werden, heißt es in den Forderungen. Dieser soll mit zehn Milliarden Euro über zehn Jahre ausgestattet werden und die Grundlage für die Schaffung einer Stiftung bilden, die Projekte zu folgenden Schwerpunkten fördert: Stärkung der kommunalen Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe; Ausbau und Modernisierung
von Einrichtungen; Fachkräfteoffensive von Bund, Ländern und Kommunen für die Kinder- und Jugendhilfe sowie digitale Innovation und Entbürokratisierung. Neben diesen Forderungen gilt es aber auch, wieder eine Qualitätsoffensive für das Angebot zu starten. Denn durch die Jahre der Unterfinanzierung und des Fachkräftemangels sei es besonders im Rahmen des Personals zu einer Deprofessionalisierung gekommen. Um dem entgegenzuwirken, sollen im Bereich der Ausbildung mehr Plätze geschaffen und zudem die
2025 – Deutschland hat sich im Bürokratiedschungel verfangen. Ganz Deutschland? Nein, in einem kleinen, unauffälligen Büro kämpfen drei ungewöhnliche Helden für eine Verwaltung, die Zukunft hat. Tipps bekommen sie von Charly, dem guten Geist der Staatsmodernisierung:
Vera, Effizienz-Queen
weitere Absenkung der Standards gestoppt werden. Darüber hinaus wünscht sich Verdi eine Verbesserung der Ausstattung der Jugendämter und eine Aktualisierung der Personalbemessung. Gleichzeitig sollten die präventiven Maßnahmen wieder deutlich ausgebaut werden, denn nur durch frühzeitige Hilfe könne der komplexen Problemlage, in der sich junge Menschen heutzutage oft wiederfänden, entgegengewirkt werden.
Kälte in der sozialen Arbeit Welche Auswirkungen ein „Weiter wie bisher“ mit den strukturellen Defiziten mit sich bringen kann zeigt eine gemeinsame Studie von Verdi mit der Universität Fulda. Demnach ist eine der Folgen eine zunehmende Kälte in der sozialen Arbeit, sowie ein erhöhtes Gewaltaufkommen. Diese Kälte sei dabei kein Ausdruck von steigender emotionaler Gleichgültigkeit, sondern folge aus der Tatsache, dass Beschäftigte auf ihre funktionale Rolle beschränkt werden und Gewalt als „unvermeidbar“ akzeptiert wird. So fehlt es zum Beispiel am Raum für Reflexion wenn ein Gewaltereignis eintritt. Egal ob es Gewalt gegen oder von Minderjährigen ist. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bräuchten die Einrichtungen pädagogische Handlungsleitlinien mit integrierten Schutzkonzepten. Diese sollten dann den Umgang mit verletzendem Verhalten thematisierten und professionelle Strategien zur Bearbeitung aufzeigten, sowie eine regelmäßige Supervision. Vor allem aber muss die Soziale Arbeit als Berufsfeld aufgewertet werden, heißt es in dem Bericht. Beschäftigte benötigen Zeit für Prävention, Reflexion und Beziehungsarbeit.


BürokratEASY

BürokratEASY
Die größte und glänzendste Büroklammer denkt voraus, hat immer einen Plan – meistens sogar mehrere –und verliert sich manchmal im Perfektionismus.
Alex, Rebell mit Menschenverstand Der Pragmatiker ist klein, clever und immer bereit, Regeln ein wenig flexibel auszulegen, wenn sie dem Fortschritt im Weg stehen.

BürokratEASY

Klara, Madame Regeltreu
Die traditionsbewusste Büroklammer liebt Regeln, Fristen, Formulare, klare Dienstwege und den guten alten Stempel.


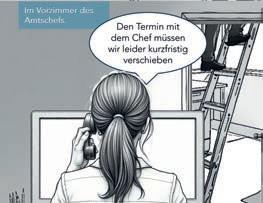






Dass es Unzufriedenheiten mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Gesetz zur Reform der deutschen Krankenhauslandschaft gab, ist noch gelinde ausgedrückt. Denn auch im Bundesrat hatten sich einige Länder gegen eine Verabschiedung des Gesetzes gestellt. Die Uneinigkeit blieb mit den aktuellen Änderungsbestrebungen bestehen, die eigentlich Anfang September im Bundestag beschlossen werden sollten. Diese Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition war letztlich ausschlaggebend dafür, dass Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die geplanten Anpassungen kurzfristig verschieben musste. Dabei handele es sich nach Aussagen aus dem Gesundheitsministerium jedoch nur um eine kurzfristige Aufschiebung, um regierungsintern abzustimmen, wie man den Koalitionsvertrag umsetze. Für den Bundestagsabgeordneten Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen), zuständig im Gesundheitsausschuss für die Themen Krankenhaus und ambulante und sektorübergreifende Versorgung, ist die Blockierung durch die SPD ein Zeichen dafür, dass der aktuelle Gesetzesentwurf ein Rückschritt für die zukunftsfeste Krankenhausversorgung sei.
Fatales Signal
Die Verschiebung selbst wird von den Spitzenverbänden und den Ländern unterschiedlich aufgefasst. Auf der einen Seite besteht so noch einmal die Möglichkeit etwaige Streitpunkte anzusprechen, die an dem bisherigen Entwurf des Anpassungsgesetzes kritisiert wurden. Doch die negativen Folgen einer ungewissen Verzögerung könnten ka-
Fatale Wochen für die Krankenhausreform
(BS/sr) Es ist schon beinahe ein Jahr vergangen, seit die letzte Bundesregierung die Krankenhausreform auf den Weg gebracht hat. Seitdem ist viel Wasser den Rhein runter geflossen und viel Geld im Gesundheitswesen verloren gegangen. Doch bis zum endgültigen Vollzug wird noch einiges passieren, denn die Reform selbst soll noch einmal angegangen werden.

Während Gesetzesanpassungen diskutiert werden, steigt die finanzielle Not der Krankenhäuser weiter. Foto: BS/Andy Dean, stock.adobe.com
tastrophal sein. Zumindest sendet die Verschiebung um mindestens drei Wochen ein fatales Signal für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Gerald Gaß Schließlich sei im Koalitionsvertrag eine gemeinsame Linie festgeschrie-
Lootboxen-Initiative im Bundesrat
(BS/sr) Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese hat gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (LAKOST), Birgit Grämke, eine Bundesratsinitiative zu glücksspielartigen Mechanismen in Videospielen auf den Weg gebracht.
Im Kern der Initiative zum Schutz von Kindern und Jugendlichen finden sich dabei die sogenannten Lootboxen wieder. Nach deutschem Recht handelt es sich bei diesen weder um Glücksspiel noch sind sie bislang im Jugendschutz reguliert. Da die digitalen Spiele nicht mehr aus dem Leben junger Menschen wegzudenken seien, müsse auch dafür gesorgt werden, dass diese ein sichereres Umfeld böten. „In der digitalen Welt ist weitestgehend akzeptiert, dass glücksspielähnliche Mechanismen zum Spielerlebnis dazugehören,“ erklärte Drese. Ein Verhalten, dass später leider eine erhöhte Gefahr für Verhaltensweisen wie Spielsucht und Überschuldung mit sich bringt.
Rund um die Uhr Grämke hält insbesondere die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit des, wie sie sagt, jugendgerecht verpackten Glücksspiels für problematisch. „Insbesondere Jugendliche durchschauen das perfide Spiel der Industrie am schwierigsten und
glauben schneller als Erwachsene, dass das Glück mit dem nächsten Kauf zum Greifen nah ist“, erklärt Grämke
Da die Entwicklung des Gehirns erst nach Erreichen der Volljährigkeit abgeschlossen sei, regt sie an, Belgien und den Niederlanden als Vorbild zu nehmen, wo Lootboxen seit 2018 als illegales Glücksspiel gelten und die Gamingbranche ihre Spiele entsprechend anpasst.
Recht harmonisieren
Bisher war in der Diskussion rund um das Thema Lootboxen häufig die Frage nach dem Regulierungsrahmen nicht eindeutig. Ist das Glücksspielrecht anzupassen oder übernimmt der Jugendschutz diese Aufgabe? Drese möchte mit der Initiative nun erreichen, dass das Glücksspielrecht mit dem Jugendschutzrecht harmonisiert wird. Dadurch könnten Lootboxen im Sinne des Kinder- und Jugendrechts regulieren werden. Zur Regulierung schlägt die Initiative zwei konkrete Wege ein. Erstens soll eine Offenlegung der Gewinnchancen und Inhalte von Lootboxen verpflichtend werden. Gleiches soll für Warnhinweise und eine verbindliche Altersverifikation ab 18 Jahren für Spiele, welche die digitalen Schatzkisten enthalten, gelten.
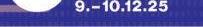
Zweitens sollen diese restriktiven Maßnahmen durch bessere Aufklärungsmaßnahmen der Minderjährigen ergänzt werden. Beispielsweise könnten Lehrpläne zur Medienbildung über Lootboxen und andere Mechaniken aufklären.
ben worden, und auch die Länder hätten sich geschlossen positioniert. Unter der Uneinigkeit im Bundeskabinett würden vor allem die Krankenhäuser leiden, da sie auf klare Vorgaben angewiesen seien. Ohne das verschobene Gesetz sei die mittelfristige Planung der Kliniken ungewiss. Auch die Länder kritisieren die
kurzfristige Verschiebung und fühlen sich in ihrem Handeln ausgebremst. So erklärte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi, dass die Verschiebung weitreichende Folgen haben werde. Denn die größten Ambitionen des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes müssten zeitnah eingeleitet werden. Den Ländern bleibe biswei-
len nichts übrig, als beispielsweise die Prüfung der Leistungsgruppen unter den bestehenden Rahmenbedingungen zu starten. Diese würden sich jedoch absehbar im kommenden Jahr unter neuer Gesetzeslage wiederholen und somit eine Zuweisung von Leistungsgruppen bis 2027 unwahrscheinlich machen. Daher sagte Philippi: „Die Nachbesserungen an der Krankenhausreform dürfen nicht länger aufgeschoben werden.“
Finanzierungshaken
Neben den ernsthaften Sorgen um die Auswirkungen der Verschiebung bestehen von Seiten der kommunalen Spitzenverbände weiterhin Bedenken, ob die Krankenhausreform die Unterfinanzierung der Kliniken beheben könne. Burghardt Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, sieht insbesondere darin ein Problem, dass weiterhin 40 Prozent der Finanzierung über Fallzahlen geregelt werden und das neue Finanzierungsmodell statt einer Entbürokratisierung zusätzliche Bürokratie schafft. Auch die vier Milliarden Euro an Soforthilfe aus dem Sondervermögen Infrastruktur seien nur eine kurzfristige Entlastung. Nach Aussage von Jung unterstützen die Kommunen die kommunalen Krankenhäuser ohnehin bereits jährlich mit vier Milliarden Euro. Es braucht also eine schnelle und tiefgreifendere Veränderung in der Krankenhausreform, wenn die Bundesregierung die Forderungen einiger der Beteiligten und Betroffenen umsetzen und den Zeitplan der Krankenhausreform nicht gefährden möchte.
Zur Verteilung des Sondervermögens
(BS/sr) Seit dem Beschluss des Infrastruktursondervermögens waren die Rufe nach einem Verteilungsschlüssel und einer schnellen, bürokratiearmen Ausgabe der Gelder deutlich. Besonders die Kommunen und ihre Spitzenverbände mahnten eine schnelle Abwicklung an, da die finanzielle Lage vor Ort problematisch ist.

Lange Zeit bestand die Befürchtung, dass die Gelder es nicht oder nur in geringem Anteil in die Kommunen schaffen. Foto: BS/rangizzz, stock.adobe.com
Mit dem Länder- und KommunalInfrastrukturfinanzierungsgesetz liefert der Bund nun auch den gesetzlichen Rahmen, mit dem die Länder und Kommunen die Ihnen angedachten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen nutzen können.
Welches Land wie viel erhält, wird dabei nach dem Königssteiner Schlüssel festgelegt. Aus den ihnen zugeteilten Mitteln dürfen die Länder dann entscheiden, wie viel sie an die Kommunen weitergeben. Angesichts ihrer zentralen Rolle in der Daseinsvorsorge und der zahlreichen Infrastrukturaufgaben wäre es folgerichtig, dass die Länder einen Großteil des Sondervermögens an die Kommunen weitergeben.
Keine halben Sachen
Mehrere Länder haben bereits zugesagt, dass sie den Kommunen den Großteil der zur Verfügung ge-
stellten Gelder überlassen werden. So will das Saarland 60 Prozent der Mittel aus dem Sondervermögen an seine Kommunen weitergeben. Niedersachsen plant mindestens 60 Prozent, und auch Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt sowie Rheinland-Pfalz haben Ähnliches angekündigt. Sollten diese Anteile auch bei den Kommunen ankommen, so kann von einem Versickern in den Länderhaushalten keine Rede sein. Doch damit dies gelingt, muss auch die Verteilung gut und im besten Fall einfach gestaltet werden.
Auf Rechnung bitte
In Sachsen-Anhalt sollen 1,568 Milliarden Euro der dem Land zur Verfügung gestellten 2,61 Milliarden Euro direkt an die Kommunen fließen. Davon erhalten die kreisfreien Städte 310 Millionen Euro, die Landkreise 550 Millionen Euro und die kreisangehörigen Gemeinden und
Verbandsgemeinden 708 Millionen Euro.
Zusätzlich wird das Land auch seinen Anteil am Sondervermögen für kommunale Maßnahmen wie den Straßenbau verwenden. Sowohl die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände des Landes als auch die Landesregierung zeigen sich mit dem Ergebnis ihres Vertrages mehr als zufrieden. Durch das bürokratiearme Verfahren zur Beantragung von Projektgeldern schenkt das Land seinen Kommunen zusätzlich mehr Vertrauen und Handlungsspielraum. Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Dr. Lydia Hüskens erklärte diese Freiheit auch damit, dass die Kommunen am besten wüssten, wo die Gelder zu investieren seien. Voraussetzung für die Projekte ist lediglich, dass sie in den im Bundesgesetz festgelegten Rahmen des Infrastruktursondervermögens passen. Eine mögliche Investition wäre beispielsweise die Restaurierung oder Modernisierung einer Klinik beziehungsweise Pflegeeinrichtung.
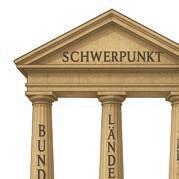


Lehrkräftemangel ist in vielen Teilen Deutschlands ein weit verbreitetes Problem, auch in Baden-Württemberg verschärft sich die Situation in einigen Punkten bereits seit mehreren Jahren. Umso wichtiger ist die schnelle Reaktion der Landesregierung auf die 1.440 nicht ausgeschriebenen Lehramtsstellen. Gleichzeitig hat Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/ Die Grünen) auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche die Ursachen für die falsch ausgewiesenen Stellen im Personalverwaltungssystem erarbeiten soll. Die Gruppe soll konkret drei Themenkomplexe untersuchen und ihren Ergebnisbericht noch vor Weihnachten 2025 vorlegen. Drei Schulformen gewinnen Den Forderungen von Eltern, Lehrkräften und ihren Gewerkschaften entsprechend wurden die gefundenen Stellen zügig mit einer verlängerten Frist ausgeschrieben. Dabei sollen vor allem die Lücken in Lehrplänen verkleinert werden, um den Schülern wieder eine bessere Unterrichtsversorgung zu bieten. Die meisten Stellen wurden dabei mit 485 Stellen den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugeteilt. Grundschulen und Gymnasien erhielten mit jeweils 350 Stellen ebenfalls einen beachtlichen Anteil. Allerdings werden von den Stellen für Gymnasien 300 Lehrkräfte befristet an andere Schularten abgeordnet. Dieses Kontingent ist eine Vorsorge für die Mehrbedarfe infolge der Umstellung auf G9. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert jedoch, das der Zusatzbedarf an Lehrkräften aus G9 nicht aus den ‚verschwundenen Stellen‘ gedeckt wird, sondern dass diese aus einem eigenen Topf gewonnen werden, wie die Landesregierung es zugesagt hatte.
Noch viele offene Stellen
Insgesamt galt es, in diesem Jahr 6.100 Stellen zu besetzen, von denen im September bereits 4.900 vergeben waren, das sind etwa 500 Stellen mehr, als im letzten Jahr besetzt werden konnten. Schopper sagte dazu: „Wir gehen gut gerüstet in das neue Schuljahr.“ Dennoch bleiben 1.159 offene Stellen, deut-
Dabei hatte Keilmann bereits vor seinem Amtsantritt in Darmstadt zentrale Rollen. Im Bundesministerium der Finanzen war er schon früh Referent in der Haushaltsabteilung und Mitautor des „Piduch“, eines Standardwerks unter den Kommentaren zum Bundeshaushaltsrecht. Im Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz leitete er das Grundsatzreferat für die Personalausgabenbudgets aller Ressorts sowie für die Einführung Neuer Steuerungsmodelle. Im Hessischen Ministerium der Finanzen in Wiesbaden realisierte er schließlich die pragmatische Umsetzung der Konjunkturprogramme und entwickelte die bislang bundesweit einzige doppische Schuldenbremse, den kommunalen Schutzschirm in Hessen. Nicht zuletzt damit wurde er zu einer zentralen Stimme im doppischen Reformprozess. Die Verbindung von Verwaltungspraxis, konzeptioneller Stärke und analytischer Tiefe war schon damals prägend für sein Wirken. Mit dem Wechsel zum Rechnungshof im Jahr 2013 übernahm Keilmann Verantwortung für die systematische Weiterentwicklung der Überörtlichen Prüfung. In bislang sechzehn Kommunalberichten und wegweisenden Sonderberichten gelang es ihm in den zurücklie-
Trotz deutlichem Einstellungsplus bei Lehrern
(BS/sr) Es war durchaus ein Aufreger, als in der Sommerpause bekannt wurde, dass durch einen Softwarefehler knapp 20 Jahre lang 1.440 Lehrerstellen in Baden-Württemberg nicht besetzt wurden. In der Landesregierung reagierte man schnell mit Bemühungen, die Stellen zu besetzen und die Fehler aufzuarbeiten. Doch liefern die neuen Stellen tatsächlich eine Entlastung für das Schulwesen in Baden-Württemberg oder sind die „frei“ gewordenen Lehrerstellen nur eine Lehre?
werden. Ein Grund dafür sind unter anderem die hohen Mieten in der Stadt“, erklärt Stein Für eine faire Bildung der Zukunft Es bleiben also nach wie vor einige Probleme zu lösen, auch wenn es besonders im Bereich der Grundschulen schon deutliche Fortschritte bei der Lehrerausstattung gibt. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch mehr Bewerber für die verbliebenen freien Stellen finden lassen oder diese weiter verwaist bleiben. Die GEW macht jedenfalls klar, dass es mit einer Ausschreibung der Lehrerstellen nicht getan konstatiert: „Wir erwarten bis Weihnachten ein transparentes Konzept, wie alle eingesparten Gelder für die verschwundenen Stellen für Lehrkräfte den Schulen zurückgegeben werden.“ Kurzum: Gemeinsam mit der Aufarbeitung des Fehlers soll auch bekannt gegeben werden, wie die in den letzten 20 Jahren eingesparten Gelder in das Schulwesen investiert wer-

Trotz der vielen neuen Stellen mussten Schülerinnen und Schüler schon am ersten Schultag mit Unterrichtsausfall rechnen. Foto: BS/ImageFlow, stock.adobe.com
lich mehr als noch im Vorjahr: Hier waren es gerade einmal 250 Stellen. Mit dem verlängerten Einstellungszeitraum bis zum 31. Oktober kann sich hier aber noch einiges tun. Monika Stein, Landesvorsitzende GEW Baden-Württemberg, erklärte auf Rückfrage, dass es besser sei, die Stellen im laufenden Schuljahr nachzubesetzen als gar nicht. Sie ergänzte: „Für eine gute Unterrichtsversorgung müssten alle Stellen besetzt werden. Leider wird dies bei den SBBZ und manchen Schulen in Mangelregionen erneut nicht gelingen und die Lehrkräfte müssen jonglieren, um jeden
Tag dafür zu sorgen, dass Unterricht stattfinden kann.“
Die meisten, der noch nicht vergeben, Stellen finden sich gerade in dem Bereich, der die meiste Unterstützung nötig hätte: bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, sodass die Lage hier trotz der vielen bereitgestellten Stellen weiterhin angespannt bleibt. Nach Aussage des Kulturministeriums gibt es jedoch nur noch wenige Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen für diese offenen Positionen, weil der stetige Zuwachs an Stellen in diesem Bereich dazu geführt habe, dass
sich die Bewerberinnen du Bewerber ihre Wunschregionen bei der Jobsuche auswählen konnten. Dadurch kommt es gerade im ländlichen Raum häufig zu einem Mangel an Fachpersonal, sodass in diesen Regionen erneut geeignete Personen ohne Lehramtsqualifikation befristet beschäftigt werden müssen.Nicht nur bei den sonderpädagogischen Einrichtungen ist schwierig, Lehrkräfte zu gewinnen. Auch abseits des Rheins ist der ländliche Raum häufig schlechter versorgt. „[…] aber auch in der Landeshauptstadt Stuttgart können nicht alle freien Stellen besetzt
Ulrich Keilmann prägt seit zwölf Jahren die Überörtliche Prüfung (BS/gg) Wenn man in den vergangenen zwölf Jahren über Überörtliche Prüfung in Deutschland sprach, fiel immer wieder ein Name: Dr. Ulrich Keilmann. Als Leiter der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof hat er nicht nur ein neues Niveau in der Finanzkontrolle etabliert, sondern auch weit über Hessen hinaus Debatten angestoßen – über Steuerung, Transparenz und Zukunftsfähigkeit kommunaler Finanzen.
„Wir gehen gut gerüstet
ins neue Schuljahr.“
Theresa Schopper Kultusministerin Baden-Württemberg
Mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Jahr 2026 möchte die GEW sich zudem dafür einsetzen, die Bedingungen im Bildungssystem des Landes weiter zu verbessern. Daher hat die Gewerkschaft zehn Forderungen an die nächste Bundesregierung. Dazu gehört auch eine langfristige Lehrkräftebedarfsplanung. Hier ist vor allem die Schaffung neuer Studienplätze relevant. Denn die Ausweitung der Studienplätze z. B. in Freiburg macht noch einmal deutlich, dass mehrere Jahre vergehen, bis diese Bemühungen Früchte tragen. Schopper zeigte sich aufgrund der geschaffenen Plätze optimistisch: „Die Erhöhung der Studienplatzkapazitäten macht sich hier bemerkbar, sodass wir in weiten Teilen eine gute Abdeckung sicherstellen können.“
Dr. Ulrich Keilmann, Leiter der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof, ist auch fachlicher Leiter des Haushalts- und Finanzgipfels am 23./23. Oktober auf dem Petersberg.
Foto: BS/privat

twicklung des Mehrkomponentenmodells (MKM 2.0) zur Bestimmung finanzieller Leistungsfähigkeit oder die Nachhaltigkeitssteuerung via Haushalt sind nur zwei Beispiele für seine Handschrift. Zahlreiche Kommunen in Hessen konnten mithilfe dieser Instrumente ihre Haushaltsführung nachhaltig verbessern.
Doch Keilmann ist nicht nur Prüfer und Konzeptionist, sondern auch einer der aktivsten Autoren auf dem Feld der Kommunalfinanzen. Mit fast 100 Aufsätzen in relevanten Fachzeitschriften und Sammelbänden hat er eine beachtliche Wirkung entfaltet – und nicht zuletzt kommentiert er seit 2016 regelmäßig in einer Kolumne in dieser Zeitung in mittlerweile weit über 100 Beiträgen das kommunale Verwaltungsgeschehen; pointiert, kritisch und breit gefächert. Von der Weiterentwicklung der Doppik, der Steuerung mit SDG-Kennzahlen, interkommunaler Zusammenarbeit, Digitalisierung, Risikomanagement bis hin zur Rolle kommunaler Unternehmen und Krankenhäuser – kaum ein Thema blieb unbeleuchtet. Dabei verfolgt er stets einen praxisorientierten Ansatz. Seine Texte sind auf Umsetzbarkeit bedacht und stärken den kommunalen Handlungsspielraum. In seinen Beiträgen verknüpft er rechtliche Analyse mit wirtschaftlicher Perspektive und strategischem Denken. Als Behördenleiter mit klarer Linie bleibt er immer im Gespräch mit den Kommunen. Die Überörtliche Prüfung unter seiner Leitung ist nicht als Endstation gedacht, sondern als Ausgangspunkt für Verbesserungen. Seine Devise: Prüfen heißt auch beraten und Veränderungen möglich machen. Dr. Ulrich Keilmann hat die Art, wie über Haushaltskonsolidierung, Steuerung, Transparenz und Effizienz kommunaler Leistungen gedacht wird, nachhaltig geprägt. Sein Werk steht für kluge Analyse, kreative Konzepte und vor allem eine tiefe Verbundenheit mit dem kommunalen Auftrag. Er ist ein öffentlich sichtbarer, fachlich herausragender und in der Verwaltung hoch anerkannter Reformer und das wird er auch weiterhin bleiben.
Nationale
Gleichstellungsbeauftragte Ruth Heinke -1339 Personalrat: Dr. Uwe Lehmpfuhl -1232

Foto: BS/Gelowicz
Bundesinstitut für Berufsbildung
Forschungsdirektor/Ständiger Vertreter des Präsidenten
Präsident
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Prof. Dr. Hubert Ertl -2000
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
Bonn
53113
Büro des Forschungsdirektors
Heidi Möhker -2823
Forschungskoordination: Dr. Sandra Liebscher -1234
Büro des Präsidenten Elzona Iseni -2833
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen: Thomas Borowiec -2324
Jugendund Auszubildendenvertretung: Jacqueline Schäfer -2138 Vertrauensperson gute wissenschaftliche Praxis Dr. Normann Müller -1022
Leitungsstab Kommunikation Pressesprecher, Chef vom Dienst: Andreas Pieper -2801 Digitale Kommunikation, Wissensmanagement: Ute Zander -1308 Personalentwicklung Aida Mansour Al Masri -2931 Rechnungsprüfungsstelle, Interne Revision Klaus Michalczak -2908
Graduiertenförderung: Dr. Judith Offerhaus -2803 Nachwuchsgruppen
Segmentierung (RISA): Dr. Katarina Weißling -2723
Weiterbildung (BeKomingDigital): Jun. Prof. Dr. Laura Naegele -1802
Berufsorientierung (BOR 3 ): Jun. Prof. Dr. Alexandra Wicht -1270
Publikationen und wissenschaftliche Informationsdienste
Dr. Bodo Rödel -2411
Agentur „Bildung für Europa“ Berthold Hübers -1657 Vertretung: Julia Lubjuhn Erwachsenenbildung, Erasmus+, Lernmobilität | Europäische Agenda für Erwachsenenbildung Claudia Laubenstein -1338 Erwachsenenbildung: Erasmus+ Kooperationsprojekte | EPALE Dr. Christine Bertram -1698
Innovation und Kooperation in der Berufsbildung, Europass Julia Lubjuhn -1810 Mobilität, Internationalisierung der Berufsbildung Friederike Wiethölter -1613 Öffentlichkeitsarbeit und Information Dr. Gabriele Schneider -1641 Finanzen und Informationstechnologie Bahram Kazemkhani -1609 Finanzielle und vertragliche Projektbegleitung Susanne Ludwig -1631 Stärkung der Auslandsmobilität | AusbildungWeltweit Stefan Metzdorf -1062
Abteilung
4 Initiativen für die Berufsbildung
Prof. Dr. Michael Heister -1332 (1406)
Vertretung: Klaus Weber Koordinierungsstelle „Dekade für Alphabetisierung“: Sigrid Meiborg-Tausch -1010
Abteilung 3 Berufsbildung International Birgit Thomann -1922 (1921) Vertretung: Michael Wiechert
Abteilung
2 Struktur und Ordnung der Berufsbildung
Arbeitsbereich
3.1 Berufsbildung im internationalen Vergleich, Forschung und Monitoring Isabelle Le Mouillour -1602
Dr. Monika Hackel -2406 (1674) Vertretung: Gunther Spillner Berufliche Bildung behinderter Menschen: Kirsten Vollmer -2326
Abteilung 1 Berufsbildungsforschung und Berufsbildungsmonitoring Prof. Dr. Robert Heimrich -1132 (1317)
Vertretung: Prof. Dr. Agnes Dietzen
Berufe und Kompetenzradar: Prof. Dr. Robert Heimrich -1132 (1317)
Arbeitsbereich
Arbeitsbereich 4.1 Fachstelle für Übergänge, Grundsatzfragen Klaus Weber -1340
Arbeitsbereich 3.2 Internationale Beratung, Kooperation mit Partnerinstitutionen Michael Wiechert -1604
2.1 Personenbezogene Dienstleistungsberufe, Querschnittsaufgaben Christian Hollmann -1346
BIBB-Betriebspanel zu Qualifizierung und Kompetenzentwicklung: Dr. Sabine Mohr -1136
Sonderforschungsbereich A 1: Dr. Holga Alda -2031
Arbeitsbereich 4.2 Innovative Weiterbildung, Durchlässigkeit, Modellversuche Barbara Hemkes -1517
Arbeitsbereich 4.3 Überbetriebliche Berufsbildungsstätten Alexandra Kurz -1208 Arbeitsbereich 4.4 Stärkung der Berufsbildung Katharina Kanschat -2024
Arbeitsbereich 3.3 Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen Claudia Moravek -1542 Arbeitsbereich 3.4 Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungskooperation (GOVET)
Arbeitsbereich 2.2 Kaufmännische Berufe, Berufe der Medienwirtschaft und Logistik Gunther Spillner -2722
Arbeitsbereich 1.1 Berufsbildungsangebot und -nachfrage, Bildungsbeteiligung Bettina Milde -1063
Arbeitsbereich 2.3 Gewerblich-technische Berufe Torben Padur -1718
Dr. Ralf Hermann -1509
Arbeitsbereich 2.4 Elektro-, ITund naturwissenschaftliche Berufe Dr. Stephanie Conein -1142
Arbeitsbereich 1.2 Qualifikation, berufliche Integration und Erwerbstätigkeit Dr. Michael Tiemann (m. d. W. G. b.) -1235 Dr. Tobias Maier (m. d. W. G. b.) -2043
Arbeitsbereich 4.5 Berufsorientierung, Bildungsketten Guido Kirst -1933
Arbeitsbereich 3.5 iMOVE Training Made in Germany
Dr. Andreas F. Werner (Universidade de São Paulo, Brasilien) -1770
Arbeitsbereich 2.5 Lehren und Lernen, Bildungspersonal Michael Härtel -1013
Arbeitsbereich 1.3 Ökonomie der Berufsbildung Prof. Dr. Harald Pfeifer -1335
Arbeitsbereich 2.6 Pflegeberufe, Geschäftsstelle der Fachkommission nach dem Pflegeberufegesetz Dr. Lena Dorin -1532
Arbeitsbereich 1.4 Kompetenzentwicklung
Prof. Dr. Agnes Dietzen -1125
Arbeitsbereich 1.5 Forschungsdatenzentrum N.N.
Telefon: 0228/107-0 Fax: 0228/107-2967
E-Mail: zentrale@bibb.de Homepage: www.bibb.de
Abteilung Z Zentralabteilung
Johanna Mölls -2914 (1690)
Vertretung: Stefan Weiler
Datenschutzbeauftragte: Annette Fischer-Peters -2237
Informationssicherheitsbeauftragter: Andre Noel Zabbai -1551
Referat Z1 Personal, Ausbildungsleitung Ralf Gerber -2921
Referat Z2 Haushalt, Digitalisierung, Controlling Stefan Weiler -2128
Referat Z3 Recht, Organisationsentwicklung, Büro Hauptausschuss Dr. Christoph Junggeburth -2950 Büro Hauptausschuss: Dr. Thomas Vollmer -1725
Referat Z4 Innerer Dienst, Betriebliches Gesundheitsmanagement Christof Held -1004 Referat Z5 Informationstechnik Tim Jänick -1705
(BS/amm) In der Geschichte der Bundesrepublik hat die Staatsverschuldung eine stattliche Kurve nach oben genommen: Von knapp zehn Milliarden Euro im Jahr 1950 hat sich die Schuldenhöhe des Öffentlichen Gesamthaushalts auf 2,5 Billionen Euro im Jahr 2024 summiert. Damit ist die Staatsverschuldung na ch Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Zum öffentlichen Gesamthaushalt gehören die Haushalte von Bund, Ländern, den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
Mrd. Euro
im internationalen Vergleich in Prozent des BIP Veränderung der Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts in Deutschland in Mrd. Euro
Schwarzarbeit soll in Zukunft zielgerichteter bekämpft werden –das ist das Ziel des Referentenentwurfs, den das Bundeskabinett kürzlich beschlossen hat. Konkret bedeutet das: Es soll mehr Befugnisse für die Kontrolleure geben, auch effektivere digitale Prozesse sowie ein optimierter Datenaustausch sind vorgesehen. „Wir legen eine härtere Gangart ein, um gegen diejenigen vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit und auf dem Rücken von illegal beschäftigen Arbeitskräften bereichern“, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Ermittlungsergebnisse direkt ans Jobcenter übermitteln
Geplant ist zudem, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) „schlagkräftiger, moderner und digitaler“ aufgestellt wird, um die „Menschen besser vor Ausbeutung und widrigen Arbeitsbedingungen zu schützen, die Einnahmen des Staates zu sichern und fairere Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu gewährleisten, die sich an die Regeln halten.“
Der Zoll soll künftig die Befugnis erhalten, seine Ermittlungsergebnisse unverzüglich an die Jobcenter zu übermitteln, konkretisiert das Bundesarbeitsministerium (BMAS) die vorliegenden Pläne. „So kann Sozialleistungsmissbrauch früher erkannt werden und die Jobcenter können Entscheidungen, beispielsweise über Rückforderungen zu viel gezahlter Leistungen, schneller treffen“, erläutert Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Wie groß das Problem der Schattenwirtschaft tatsächlich ist, zeigt sich an folgenden Zahlen: Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) haben im vergangenen Jahr mindestens 3,3 Millionen Menschen schwarzgearbeitet. Die vom Zoll registrierte Schadenssumme belief sich auf 766 Millionen Euro, davon entfielen allein 369 Millionen auf die Baubranche.
Bund plant härtere Gangart gegen Schwarzarbeit
(BS/Anne Mareile Moschinski) Ein neuer Gesetzesentwurf aus dem Finanz- und Arbeitsministerium soll für einen verbesserten Datenaustausch zwischen Zoll, Finanzämtern und weiteren Behörden sorgen. Von den Gewerkschaften gibt es Lob,
werden. Auch fordert der BDZ eine Generalsanierung der IT-Infrastruktur sowie eine „Sicherheitsmilliarde“ vom Bund, um den vorherrschenden Investitionsrückstau abzubauen. Als weiteres Problem für die Schwarzarbeitsbekämpfung sieht er den mangelnden Datenaustausch mit den Finanzämtern der Länder. „Ohne eine grundlegende Änderung in der Kooperationsbereitschaft auf Länderebene und eine entsprechende politische Weichenstellung wird die Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung an dieser Stelle nur oberflächlich bleiben“, erklärt Schirner. Bislang fehle hierzu aber eine eindeutige Positionierung der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG).
Nagel- und Kosmetikstudios sowie Barbershops sollen in Zukunft verstärkt auf Schwarzarbeit kontrolliert werden. Foto: BS/Jacob Lund, stock.adobe.com

trolle Schwarzarbeit 2023 insgesamt 42.631 Prüfungen durch – vor allem in risikoreichen Branchen wie Baugewerbe und Gastronomie. Daraus resultierten mehr als 100.000 Strafverfahren und knapp 50.000 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Mit dem geplanten neuen Gesetz soll der Staat ab 2028 zwei Milliarden Euro Mehreinnahmen erhalten.
FKS auf Augenhöhe mit Polizei und Steuerfahndung Neben illegal Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Bau sowie in Privathaushalten sollen künftig auch Nagel- und Kosmetikstudios sowie Barbershops verstärkt
anderen Ermittlungsbereichen wie Polizei, Zoll- und Steuerfahndung zu agieren. Im Referentenentwurf heißt es dazu: „Damit kann sie Kriminelle oder Personen, die sich in Deutschland ohne Aufenthaltstitel aufhalten, selbst identifizieren – genauso zügig wie die Polizei. Das wird die Verfahren erheblich beschleunigen.“ Geplant sind außerdem erweiterte Befugnisse bei der Telekommunikationsüberwachung.
Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) begrüßt die Neuerungen. Es würden damit viele langjährige Forderungen erfüllt, erklärt BDZ-Sprecher Felix Schirner
auf Anfrage des Behörden Spiegel. So seien insbesondere die Stärkung der Ermittlungsbefugnisse, die Teilnahme am polizeilichen Inorientierte Prüfungsansatz nach dem Grundsatz „Qualität vor Quantität“ positive Entwicklungen. Auch die Kompetenzerweiterung der FKS, die damit zu einer „Kleinen Staatsanwaltschaft“ werde, befürwortet der BDZ. „Dies steigert die Effektivität der Ahndung und entlastet die Justiz“, so Schirner.
Forderung nach „Sicherheitsmilliarde“ vom Bund Nachbesserungsbedarf gebe es dennoch – insbesondere, was die Umsetzung der neuen rechtlichen Regelungen angeht. Sowohl personell wie technisch sei die FKS hierfür nicht ausreichend ausgestattet. Vor allem der Anteil der im gehobenen Dienst Beschäftigten müsse erhöht
Die DStG indes äußert sich in einem Pressestatement zu dem geplanten Gesetz aus den Reihen von BMF und BMAS. Darin bringt sie zum Ausdruck: Die Digitalisierung der FKS sei ein längst überfälliger Schritt. Jedoch müssten die Beschäftigten entsprechende Schulungen und Fortbildungen erhalten – ein Punkt, der bislang im Entwurf nur unzureichend berücksichtigt wurde. Die geplanten erweiterten Ermittlungsbefugnisse ringen der Gewerkschaft auch Skepsis ab. Ohne Aufstockung der Personalressourcen und gezielte Entlastungsmaßnahmen prognostiziert die DStG eine erhebliche Überlastung in den Landesfinanzverwaltungen.

24. NOVEMBER 2025 2025 www.zolltage.de
ie Finanzverwaltung ist am Limit. In vielen Bereichen hat sie ihre Grenzen bereits überschritten“, konstatierte Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft kürzlich in einer Bundestags-Anhörung. Noch vor eineinhalb Jahrzehnten brachten
Prüfungen der Finanzämter bei Betrieben rund 16 Milliarden Euro im Jahr ein. 2023 waren es nach dem vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Bericht über die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 13,2 Milliarden Euro, davon 10,2 Milliarden Euro durch Prüfungen von Großbetrieben.
Vergleichende Angaben zur Effektivität der Steuerverwaltung, die jeweils in der Zuständigkeit der Länder liegt, werden traditionell nicht gemacht.
Die Zahl der Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer für 2023 hat die Bundesregierung in ihrem Bericht mit 12.394 angegeben. Zwar liegt der offizielle Bericht des Bundes für 2024 noch nicht vor, doch nach Medienberichten soll das Er-
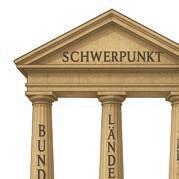


Massiver Personalmangel bei Betriebsprüfungen
(BS/Hans-Jürgen Leersch) Das Problem ist seit Jahren bekannt, doch gegengesteuert wurde nicht: In den Finanzämtern bestehen erhebliche Personalengpässe in der Betriebsprüfung. Dabei ist die Zahl der Prüfer so rückläufig wie das finan-
Das Ergebnis der Betriebsprüfungen soll im Jahr 2024 von 13,2 auf knapp elf Milliarden Euro gesunken sein. Foto: BS/grafikplusfoto, stock.adobe.com

gebnis der Betriebsprüfungen von 13,2 auf knapp elf Milliarden Euro zurückgegangen sein.
Lückenlose Prüfung von Großbetrieben
Nach Angaben des Bundes existierten im Jahr 2023 insgesamt 196.211 Großbetriebe, von ihnen wurden 34.899 (17,8 Prozent) geprüft. Von den 820.020 Mittelbetrieben nahmen die Prüferinnen und Prüfer 35.980 (4,5 Prozent) unter die Lupe und von den 1,25 Millionen Kleinbetrieben bekamen 2,3 Prozent (28.415) Besuch vom Finanzamt. Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Angestellten werden im Schnitt nur alle 150 Jahre mit einer Betriebsprüfung konfrontiert. Bei größeren Betrieben ist die Taktung dichter. Großbetriebe werden nach Angaben des bayerischen
Finanzministeriums lückenlos und für jeden Besteuerungszeitraum geprüft. Bei Klein- und Mittelbetrieben erfolgen Prüfung und jährliche Veranlagung zunächst im Innendienst. „Eine Außenprüfung findet hier vor allem dann statt, wenn Angaben in der Steuererklärung darüber hinausgehend aufklärungsbedürftig sind.“
Das heißt: Steuerprüfer stehen erst dann vor der Tür, wenn es schon einmal Auffälligkeiten gab. Und sie wählen zuerst die Betriebe aus, wo der höchste Steuerschaden vermutet wird. Wenn zudem noch Verdacht auf Schwarzarbeit und Geldwäsche besteht, dann kommt die Steuerfahndung zusammen mit dem Zoll.
Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) sieht die Steuerprüfer des Freistaats auf der
Erfolgsspur. „2024 erwirtschafteten die bayerischen Betriebsprüfer mit 2.357 Milliarden Euro rund 22 Prozent des bundesweiten Gesamtmehrergebnisses“, heißt es in der Jahresbilanz seines Ministeriums. Wenn man als Vergleich den Anteil Bayerns am gesamten deutschen Steueraufkommen (14,8 Prozent beziehungsweise 140 Milliarden Euro von insgesamt 948 Milliarden Euro) heranzieht, dann ist ein Anteil von 22 Prozent am bundesweiten Mehrergebnis durch Steuerprüfungen überdurchschnittlich. Besonders hervor hebt Bayern den Anteil seiner Prüfer im Lohnsteuerbereich. 2024 habe jeder bayerische Prüfer bei der Lohnsteuerprüfung 610.000 Euro Mehrsteuern ermittelt, was 36 Prozent über dem bundesweiten Durchschnittswert gelegen habe.
In Großkonzernen sind Betriebsprüfer Dauergäste Andere Bundesländer sind mit statistischen Angaben wesentlich zurückhaltender oder haben aktuell noch gar nichts veröffentlicht. Baden-Württemberg etwa beziffert das steuerliche Mehrergebnis der Lohnsteuer- und Umsatzsteuerprüfungen für 2024 auf 396,8 Millionen Euro, zusammen mit den Ergebnissen der Steuerfahndung kam man auf 2,13 Milliarden Euro. Aus Hessen heißt es, Betriebsprü-
fung und Steuerfahndung hätten im letzten Jahr ein Mehrergebnis von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Berlin kommt bei Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer zusammen auf rund 381 Millionen Euro. Thüringen meldet bei Steuerprüfung und -fahndung 130 Millionen Euro für 2024. Würden mehr Prüfer mehr Geld für die Staatskasse bringen? Die bisherige Faustregel lautet, dass jeder Steuerprüfer pro Jahr für eine Million Euro Steuermehreinnahmen sorgt. Dagegen spricht, dass die für Steuerhinterziehung besonders auffälligen Branchen ohnehin intensiv geprüft werden und dass Großkonzerne, in denen das meiste Geld zusammenkommt, die Prüfer als Dauergäste im Haus haben.
Doch zusätzliches Personal ist schwer zu gewinnen. Köbler weist darauf hin, dass im Öffentlichen Dienst in Deutschland und somit auch in der Finanzverwaltung in den nächsten 20 Jahren rund 55 Prozent der Beschäftigten in Rente gehen. Die müssten erst einmal ersetzt werden, ehe an zusätzliche Einstellungen zu denken sein. „Der wachsende Wunsch nach Teilzeitarbeit und einer guten Work-LifeBalance verstärkt den Personalmangel zusätzlich“, so Köbler Eine Lösung sieht er in der Digitalisierung. Unternehmen, Steuerberater und Steuerverwaltung müssten cloudbasiert an den gleichen Daten arbeiten: „Eine solche Plattform würde nicht nur die Kommunikation erleichtern, sondern auch Fehlerquellen minimieren und Prozesse beschleunigen.“
► LIEFERAUFTRAG
Container keine Bauleistung
Tiefbauarbeiten nur optional
Im Vergabenachprüfungsverfahren ging es um die Frage, ob der EU-Schwellenwert von 221.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen einschlägig ist oder der für Bauleistungen von 5,538 Millionen Euro. Die ausgeschriebene Leistung zeichnete sich dadurch aus, dass Container geliefert und aufgestellt werden sollten. Das Liefern und Aufstellen dieser Container umfasste ca. 85 Prozent des Gesamtauftragswertes. Die Vergabekammer prüfte, ob die vorgenommene Ausschreibung rechtskonform ist. Sie gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die Ausschreibung dem Liefer- und Dienstleistungsvergaberecht zuzuordnen ist, geknüpft an den Schwellenwert von 221.000 Euro. Für diese Einordnung spricht nach Auffassung der Vergabekammer insbesondere ein Hinweis im Leistungsverzeichnis, der eine als „Nebenangebot“ bezeichnete „Option“ enthielt: „Weiterhin sind die Tiefbauarbeiten wie Fundament, Plattierung, Zaun und Zuwegung sowie [...]. Es wäre wünschenswert, wenn die Anbieter hierzu ein Nebenangebot abgeben.“ Diese Optionalität der Bauleistungen und die Kostenschätzung bestärken die Vergabekammer darin, hier keine Bauleistung anzunehmen. Sie stellt fest: „Die Kostenschätzung des Auftraggebers wies für die Bereiche Bauvorbereitung, Elektroinstallationen und Blitzschutz insgesamt einen Nettowert von ca. 75.000 Euro aus, während die Bereiche der Lieferung der Rechenzentrumscontainer, der Schranksysteme, der Kühlungsanlagen und der USV-Systeme einen Nettowert von ca. 700.000 Euro auswiesen.“ Damit war vergaberechtlich der Auftrag recht eindeutig dem Bereich der Liefer- und Dienstleistungen zuzuordnen.
VK Berlin, Beschl. v. 04.04.2025, VK-B1-03/25
► RÜCKVERSETZUNG
Bindung der Auftraggeberin?
Zurechenbare Gründe
Die Auftraggeberin hatte eine sog. „Rückversetzung des Verfahrens“ bewirkt, mit der eine produktspezifische Ausschreibungen Leistungspositionen korrigiert werden sollte. Hinzu kam, dass ihr klar wurde, dass sie eine produktspezifische Ausrichtung vorgenommen hatte, die den Wettbewerb potenziell einengt.
Die Vergabekammer misst die Gründe für die Entscheidung der Rückversetzung an den Aufhebungsgründen des Paragrafen 17 VOB/A. In der Sache geht es um die Befugnis, die Leistungsbeschreibung als Grundlage des Vergabeverfahrens zu ändern. Vergaberechtlich besitzt die Auftraggeberin nicht die Berechtigung, eine Rückversetzung zu bewirken. Im Gegenteil: Hat kein teilnehmender Bieter diese und weitere Aspekte der Ausschreibung gerügt, so ist die öffentliche Auftraggeberin an die Vorgaben der von ihr veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen gebunden.
Die von der Vergabekammer herangezogenen offiziellen Aufhebungsgründe greifen deshalb nicht, weil die Ursachen für die gewollte, aber letztendlich vergaberechtlich nicht zulässige Rückversetzung – und damit quasi einer Aufhebung bzw. Teilaufhebung – aus der Risikosphäre der öffentlichen Auftraggeberin stammen. Eine (vergaberechtliche) Befugnis, die Grundlagen der Ausschreibung zu verändern, besitzt sie im Nachhinein nicht mehr. Nimmt sie hingegen tatsächlich eine Rückversetzung vor, so kann sie sich schadensersatzpflichtig machen. Aus dem Blickwinkel des Vertragsrechts muss sie jedenfalls keineswegs einen Vertrag abschließen, den sie in der ursprünglich ausgeschriebenen Form nicht mehr wünscht. VK Nordbayern, Beschl. v. 12.02.2025 (RMF-SG21-3194-9-45)
► RECHTSDIENSTLEISTUNG
Begleitung von Vergabeverfahren
Rechtsanwälten vorbehalten?
Eine Kommune benötigt Planungsleistungen. Die dazu notwendige EU-weite Ausschreibung sollte von einem Dienstleister in enger Abstimmung mit der Kommune konzipiert und begleitet werden. Der Aufgabenhorizont war sehr weit gefasst: Ermittlung der Grundlagen für die Ausschreibung, Zusammenstellung der Vergabeunterlagen, Entwurf einer Bewertungsmatrix, Festlegung der Eignungskriterien, rechtssichere Vertragsgestaltung zu den einzelnen Losen, Gestaltung der EU-weiten Bekanntmachung, Organisation von Präsentationen und Auswertung inklusive eines Wertungsvorschlags.
Auf Basis des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (Paragrafen zwölf, acht) in Verbindung mit dem Paragrafen drei des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) wurde der Versuch der Stadt gestoppt, den Auftrag an einen Dienstleister zu vergeben, dessen Verantwortliche über keine Zulassung zur bundesdeutschen Rechtsanwaltschaft verfügen. Das Landgericht erließ eine einstweilige Verfügung des Inhalts, dass im Falle der Zuwiderhandlung und Bezuschlagung eines anwaltlich nicht zugelassenen Dienstleisters ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft festzulegen sei. Das Gericht begründet die Entscheidungsfindung recht knapp, jedoch mit der erkennbaren Würdigung, dass insbesondere die zur Vergabe anstehenden Leistungen der Erstellung der Vertragsunterlagen für die einzelnen Lose, die Mitwirkung beim Vertragsbeschluss, sowie die gesamte Vertragsabwicklung durch den Dienstleister inklusive der rechtsicheren Prüfung der Rechtsanwaltschaft zur Wahrnehmung vorbehalten seien. LG Gießen, Beschl. v. 21.03.2025 (3 O 95/25)
► NIEDRIGE ANGEBOTSPREISE
Bestätigung der Auskömmlichkeit
Positionsgenaue Aufklärung Im Zusammenhang mit einer Ausschreibung betreffend die Ausstattung mit Innentüren gemäß den Vorschriften der VOB/A entwickelte sich ein Streit um die Frage, inwieweit die Vergabestelle eine fundierte Aufklärung hinsichtlich der Angemessenheit der Preise vornehmen musste. Tatsache ist, dass sich die ausschreibende Stelle im Zuge der Angebotsaufklärung die Preiskalkulationsblätter 221 bis 223 hat vorlegen lassen. Offensichtlicher Hintergrund war, dass sie Zweifel an der Auskömmlichkeit bzw. Angemessenheit der offerierten Preise hatte.
Jedoch ist es nach Auffassung der Vergabekammer nicht konsequent gewesen, dass keine wirkliche preisliche Aufklärung betrieben wurde. Diese muss sich gemäß ihren Ausführungen auf einzelne Positionen beziehen. Keinesfalls darf sich die Vergabestelle mit einer unkonkreten Anfrage an den Bieter begnügen. Es reicht nicht aus, wenn er sich dann mit einem „Einzeiler“ rückäußert und seine Angebotspreise für auskömmlich erklärt. Die Vergabekammer betont, dass eine solche Selbstbestätigung ohne substanzielle Aussage zu seiner Preisbildung ohne Wert ist und damit potenziell die Rechte der anderen Bieter beeinträchtigt. Richtigerweise muss sich die preisliche Angemessenheitsprüfung gemäß dem Ersuchen gegenüber dem Bieter bereits auf bestimmte Positionen oder sonstige vermutete besondere Umstände der Leistungserbringung beziehen, die möglicherweise bei diesem Bieter zu einer sehr günstigen Kalkulation geführt haben. Sodann muss der Bieter in substanzieller Art und Weise erklären, was die Ursachen seiner niedrigen Preise sind. VK Nordbayern, Beschl. v. 28.07.2025 (RMF – SG21 – 3194-10-28)
► ANGEBOTSWERTUNG
Qualitätsbewertung
Plausibilität der Notenvergabe Im Zuge der Ausschreibung eines Klinikums ergab sich ein Rechtsstreit um die Frage der Angebotsbewertung. Die antragstellende n und beigeladenen Parteien, also die konkurrierenden Bieter, sind beide Einkaufsgemeinschaften von Leistungen für das Gesundheitswesen. Die Antragstellerin fühlte sich nicht in angemessener Weise und nicht in der rechtlich vorgesehenen Form korrekt bewertet. Das Zuschlagskriterium Preis rangierte mit 70 Prozent und die Servicequalität mit 30 Prozent. Streitgegenständlich ist die Bewertung der Servicequalität gewesen. Die Servicequalität war noch einmal in Unterkriterien wie Digitalisierung, innovative Produkte, Lieferengpass-Management sowie Umstellungsprozess untergliedert.
Diesbezüglich wurden Schulnoten vergeben. Die Antragsgegnerin hatte eine Bewertungsmatrix zur Verfügung gestellt. Sie vermag im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer und vor allem vor dem Vergabesenat ihr Vergabeverfahren weitgehend zu verteidigen. Der Vergabesenat stellt in seinem Beschluss die Grundsätze für eine rechtskonforme Bepunktung von Konzept- bzw. Qualitäts- und Serviceangeboten heraus. Insbesondere hebt er die Notwendigkeit der Dokumentation für die vergebenen Notenpunktwerte hervor. Außerdem ist es grundsätzlich erforderlich, die Angebote im Hinblick auf alle ausgeschriebenen Zuschlagskriterien hinsichtlich des Leistungsangebotes untereinander zu vergleichen. Sofern insbesondere die Voraussetzungen eines Vergleichs der Angebote untereinander und eine sorgfältige Dokumentation der Punktevergaben erfüllt sind, kann dies ohne Beanstandungen bleiben.
BayObLG, Beschl. v. 07.05.2025, Verg 08/24
Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Kanzlei Dr. Noch) jeden Monat im Behörden Spiegel ◄
Niedersachsens Kommunen fordern Entlastung (BS/sr) Nordrhein-Westfalen hat im Juli weitreichende Änderungen vor allem an der Gemeindeordnung beschlossen. Weitere Änderungen sollten u. a. das Vergaberecht für Kommunen erleichtern und die Unterschwellenvergabe freigeben. Diese Änderung wünschen sich auch andere Bundesländer wie Niedersachsen.
In einem offenen Brief wandte sich der niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) an seine Landesregierung. Darin brachte der NSGB seine Enttäuschung über die Auswirkungen der Änderungen an der niedersächsischen Wertgrenzenverordnung zum Ausdruck. Diese blieben nicht nur deutlich hinter den Erwartungen zurück, während die Kommunen durch die Verschärfung des Tariftreue- und Vergaberechts stattdessen mit zusätzlicher Bürokratie belastet werden. Kritik wird eben-
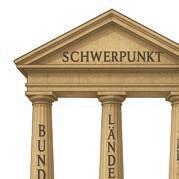


falls an einer Besserstellung der Schulen geübt: Dort seien Direktaufträge bei Liefer- und Dienstleistungen bis 100.000 Euro möglich, bei Kommunen nur bis 20.000 Euro. Daher appelliert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund dafür, eine Freigabe der Unterschwellenwerte umzusetzen, wie es unter anderem in NordrheinWestfalen erfolgt ist. Damit könne die Landesregierung die immer wieder versprochenen Maßnahmen zur Entbürokratisierung umsetzen. Mit den Änderungen erhielten nordrhein-westfälische Kommunen vergaberechtlich ebenso viel Handlungsfreiheit wie Gesellschaften, die in ihrem Eigentum stünden oder an denen sie mehrheitlich beteiligt seien heißt es im Gesetzesentwurf aus Nordrhein-Westfalen. Geplant ist die Aufhebung der Verordnung dort ab 2026. Gleichzeitig wird mit der Regelung eines neuen Paragrafen 75a in der Gemeindeordnung sichergestellt, dass die Kommunen vergaberechtliche Grundprinzipien einhalten. In
diesem heißt es: „Die Gemeinde hat die Vergabe von öffentlichen Aufträgen vorbehaltlich anderweitiger Rechtsvorschriften wirtschaftlich, effizient und sparsam unter Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung und Transparenz zu gestalten.“ Weitere Vorschriften aus dem Europa-, Bundes- oder anderen Landesrechten müssen von den Kommunen weiterhin beachtet werden. Trotz der starken Lockerung des Rechtsrahmens sind weiterhin Grundsätze in Kraft, die verhindern, dass die Kommunen auf Willkür oder Vetternwirtschaft setzen. Im Gegenteil würden durch die Anpassung die heimische Wirtschaft allen voran lokale Handwerksbetriebe und Dienstleister –gestärkt. Mit den Änderungen wird den Kommunen deutlich mehr Vertrauen entgegengebracht. Wohingegen die bereits erwähnten Ausnahmen für Schulen eher ein Bild des Misstrauens gegenüber den Kommunen zeichneten, wie es im NSGB-Brief heißt.
Ausschreibungen · Submissionen

Passender. Einfacher. So geht Ausschreibung heute.


Jetzt Ihre Vorteile entdecken






Berliner Gespräch mit dem griechischen Botschafter
(BS/Peter Slama) Alexandros Papaioannou ist Botschafter eines Landes, das jenseits aller aktuellen Irrungen und Wirrungen immer noch als philosophische Wiege Europas gilt: Griechenland. Mit seinen über 3.000 Inseln, etwa einem Viertel seiner Gesamtfläche, ist es wahrhaft mehr als das. Wenn die Sonne über dem ägäischen und ionischen Meer aufgeht und die Satellitenschüsseln auf den Dächern der Städte und Dörfer ins Morgenrot taucht, so ist das die Sonne Homers, von der Friedrich von Schiller schwärmte: „Siehe, sie lächelt auch uns!“


als antike Stätten und malerische Landschaften: Griechenland gilt als Wiege der modernen Demokratie. Foto:
Der Schwabe und Wahl-Weimarer Schiller bewunderte, wie sein Dichterfreund Goethe und Heerscharen von Studienräten danach, die Antike, ihre Mythen, die schöne Gegend, die mediterrane Küche, Spitzenweine und das gute hellenische Wetter. Das hatte es im Jahr 1832 auch Otto, dem Sohn von Bayernkönig LudwigI., angetan. Da dieser mit einer Affäre mit der Tänzerin Lola Montez beschäftigt war, musste sein 17-jährige Filius als „Teenie-Kini“ auf den griechischen Thron. Otto I. führte Biergärten ein, ließ Blasmusik aufspielen, zog viele Akademiker, Handwerker und Unternehmer wie den Bierbrauer Karl Johann Fuchs – dessen FIXBier immer noch gebraut wird – sowie den Weinhändler Clauss nach Athen, der seit 1834 neuen Metropole. Das 136 km südwestlich auf dem Peloponnes gelegene Navplion ist nun Alt-Hauptstadt. Die nicht unbemühte, aber glücklose Regentschaft des Wittelsbachers beenden seine Untertanen 1862 freundlich-nachdrücklich und schicken ihn zurück nach Bayern. Wenn wir der Ilias Homers glauben, so dürfte auch diesmal „ein unermessliches Lachen erschollen sein aus dem Munde der
ren Himmel schallend gelacht wird!
Doch das könnte ihnen auf dem Olymp, wegen der sehr weltlichen Vorgänge auf Erden, heute vergangen sein. Diese Vorgänge in Berlin diplomatisch zu ordnen, weiterzureichen, Initiativen zu ergreifen oder gar Paukenschläge der Staatsmänner in zarte Harfenklänge zu verwandeln, ist Alexandros Papaioannou (51) im Januar 2025 an der Spree angetreten. Nach seinem Studium in London und Brügge kommt er 1997 in den diplomatischen Dienst und die nächsten zwei Jahrzehnte u. a. an die Botschaften in Italien, Russland, zum Heiligen Stuhl, als Botschafter, ständiger Vertreter Griechenlands zu den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Genf. In Deutschland ist er erstmals als Botschafter. Für diese Premiere hat er sich einiges vorgenommen. Das Themenspektrum auf seiner Agenda reicht von Politik, Wirtschaft, Presse, Bildung, Kultur und Energie über Migration bis hin zum Tourismus.
Verbesserte Beziehungen „Ich möchte während meiner Zeit in Deutschland dazu beitragen, die bilateralen Beziehungen auf all diesen Gebieten zu verbessern. Nicht nur auf der offiziellen und politischen, sondern vor allem auf der persönlichen Ebene, indem wir miteinander sprechen. Das ist für mich das größte Ziel“, so Papaioannou. Diesem sind Athen und Berlin nach der Krise des griechischen Staatshaushalts 2010 schon sehr viel nähergekommen. Anfang Mai reiste der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis zum Kollegen , was „symbolisch sehr wichtig für uns war. Die Turbulenzen, die
wir in der Schuldenkrise hatten, sind natürlich Teil unserer Geschichte, aber kein Problem mehr. Im Gegenteil, die Deutschen sagen, schaut, wie vorbildlich sich Griechenland wirtschaftlich entwickelt hat. Kurzum, die Beziehungen sind viel, viel besser.“
Es gibt nicht mehr so viele emotionale Kontroversen wie früher, als auf deutsches Drängen die EU Athen drastische Sparmaßnahmen auferlegte. Man mag sich wieder. „Als Alt-Kanzlerin Angela Merkel Mitte Juli in Athen war, um ihr Buch ,Freiheit‘ vorzustellen und dabei viel über die schwierigen Jahre zwischen 2010 und 2019 sprach, brachte ihr das zahlreiche Publikum ohne jegliche Feindseligkeit großes Interesse entgegen“, berichtet Papaioannou. „Ich meine, die Menschen betrachten all diese Ereignisse als in der Vergangenheit passiert. Und die muss nicht immer gegenwärtig sein.“
„Jetzt blicken die Menschen nach vorne, nicht zurück“, zeigt sich der Botschafter entschlossen. „Wir haben dieses sehr dramatische, sehr schwierige Jahrzehnt hinter uns gelassen und suchen nach Möglichkeiten, die Dinge zu verbessern.“ Dabei sei Deutschland einer der größten, wenn nicht sogar der größte Partner. „Ich denke, das sagt schon einiges über unsere Beziehungen aus.“
wozu ich momentan keine Zeit habe.“ Eine Sache, die er liebt, ist das Reisen. Deshalb lernt er u. a. Deutsch, um dieses schöne Land „besser kennen und verstehen zu lernen“ und die deutsche Kultur zu entdecken. Zudem würde er gerne mehr lesen und sich mit Geschichte befassen. „Zu guter Letzt habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich nicht mehr arbeite, auch gerne etwas für wohltätige Zwecke tun möchte.“
Nach vorne schauen Auch der Groll auf die Austeritätspolitik Brüssels gegen Griechenland habe zu keiner Anti-EUHaltung der Hellenen geführt. „Es gibt keine echte Diskussion über den Austritt aus der Europäischen Union“, bestätigt Papaioannou Selbst in den schlimmsten Zeiten ab 2015, als es das Referendum darüber gab, ob Griechenland in der EU und Eurozone bleiben wird, „waren wir für den Verbleib, der immer als selbstverständlich angesehen wurde und wird.“

Alexandros Papaioannou möchte die „vielen Gemeinsamkeiten zwischen Griechenland und Deutschland“ nutzen, um die beiden Länder noch näher zusammenzubringen. Foto: BS/Griechische Botschaft
Dakos
Verbreitete kretische Vorspeise aus Tomaten, Kräutern und Feta auf Paximadi (mehrfach gebackenes, sehr lange haltbares Brot) oder Zwieback.
Zutaten für 2 Portionen: Vier große Stücke Gerstenzwieback, vier reife Tomaten, 100 ml Olivenöl, zwei Esslöffel zum Servieren, 150 g Mizithra (Weichkäse) oder zerbröckelter Feta, griechischer Oregano, ein paar Kapern oder Oliven, Salz und Pfeffer nach Geschmack.
Also alles vergeben und vergessen? Die Ägide, in der Deutschlands ehemaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble den währungspolitischen Hardliner gab, wohl eher nicht. „Als ich ihn 2020 traf, da war er Bundestagspräsident, sagte unser Außenminister Nikos Dendias zu ihm: ,Sie haben uns zur Privatisierung gedrängt, aber dann kam niemand, um bei uns zu investieren, sodass die Chinesen zu einem sehr niedrigen Preis in den griechischen Markt eintraten und den Hafen Piräus zu einem Spottpreis kauften‘“, erzählt Papaioannou Schäuble habe darauf etwas sehr Interessantes erwidert: „Das war ein Fehler.“ Es habe Größe gehabt, zuzugeben, dass nicht alles, was Deutschland und die Europäische Union getan hätten, immer richtig gewesen sei.
Zubereitung:
Zwei der Tomaten schälen, in Würfel schneiden, die anderen beiden reiben und beiseitestellen. Halten Sie Gerstenzwieback schnell unter fließendes Wasser und lassen Sie ihn eine Minute lang rehydrieren. Ölen Sie die Zwiebäcke, und wenn Sie möchten, können Sie sie entweder in Stücke brechen oder ganz lassen. Würzen Sie die geriebenen Tomaten nach Belieben mit Salz und Pfeffer und bedecken Sie die geölten Zwiebäcke. Fügen
Weniger einig sind sich Griechenland und die Türkei in der Zypernfrage. Die Insel ist seit 1974 geteilt, der nördliche Teil türkisch besetzt und eine Wiedervereinigung nicht in Sicht. Papaioannou sieht „leider nicht viel Bereitschaft der türkischen Seite, die Teilung zu beenden. Das ist traurig, aber wahr.“
Reisen, und Kultur entdecken Wahr ist auch, dass Papaioannou nach 27 Jahren oder über der Hälfte seines Lebens im diplomatischen Dienst darüber nachdenkt, was er in seinem Leben noch macht. „Ich sehe den Beruf des Diplomaten als einen Job, in dem ich Botschafter bin und meist viel zu tun habe. Aber sobald ich nicht mehr im Dienst bin, werde ich alles das tun,
Zuvor kommt Papaioannou noch mal auf sein Verhältnis zu Deutschland zu sprechen. „Solange ich hierbleibe, möchte ich meine Spuren hinterlassen“, kündigt er an. Damit meine er nicht seine persönlichen Spuren, sondern seine Beiträge, „unsere beiden Völker zusammenzubringen“. Es gebe viele Gemeinsamkeiten, Berührungspunkte und eine lange positive Geschichte. Auf der griechischen Seite sehe er, dass wir immer „die negativen Elemente unserer Geschichte betonen, sei es der Zweite Weltkrieg oder die Krise in jüngerer Zeit“. Was er hierzulande langsam, aber sicher entdecke, sei, dass es unter dem Philhellenismus in Deutschland so viele Verbindungen zwischen Griechen und Deutschen gebe – „zwischen Deutschen, die in Griechenland gelebt haben und Griechen, die in Deutschland leben“. Viele Dinge also, „die uns verbinden und niemand hebt das hervor.“
Dabei sei es doch so einfach. „Also warum machen wir es dann nicht?“ Genau das versuche er zu tun. „Ich möchte wirklich einen Beitrag leisten und eine Dynamik schaffen, die hoffentlich von denen, die nach mir kommen, aufgegriffen wird.“
Dies dürfte auf dem Olymp mit großem Wohlgefallen zur Kenntnis genommen werden.

Sie die gewürfelten Tomaten hinzu. Den Myzithra- oder Feta-Käse grob hacken und über den Gerstenzwieback streuen. Fügen Sie die Kapern oder Oliven, den Oregano und die 2 Esslöffel Olivenöl hinzu und Ihre Dakos sind fertig. Dazu passt vorzüglich Retsina, da der frische Charakter des Weins die Tomaten, das Olivenöl und die Kräuter ideal ergänzt. Ouzo eher nicht, da sein Anisgeschmack die feinen Aromen des Dakos überdeckt. Trinken Sie ihn als Verdauungsschnaps nach dem Essen. Yamas! Foto:
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Oktober 2025

(BS/Julian Faber) Das Haus des Föderalismus bröckelt – vor allem am Fundament, den Städten und Gemeinden. Marode Schulen, geschlossene Bäder, wachsende Schuldenberge – die Horrormeldungen aus den Rathäusern reißen nicht ab. Reichen Forderungen nach einer Verstetigung kommunaler Einnahmen aus oder braucht es eine dritte Föderalismusreform, um das fragile Staatsgebilde nachhaltig zu stabilisieren?

Über 24 Milliarden Euro beträgt das Finanzierungsdefizit deutscher Kommunen.
Dieses werde schrittweise „auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen“, prognostiziert Dr. Markus Mempel vom Deutschen Landkreistag (DLT): „Mit diesem Defizit gehen massive Liquiditätsprobleme einher, die Kassenkredite explodieren und Investitionen brechen weg. In so großer Not waren Städte, Landkreise und Gemeinden noch nie.“
Dauerbaustelle Föderalismus
Bereits zweimal hat sich die föderale Ordnung der Bundesrepublik innerhalb der vergangenen zwei Dekaden einem Umbau unterzogen. 2006 sollten die endlosen Blockaden zwischen Bundestag und Bundesrat gelockert werden. Die Föderalismusreform I entlastete den Bund von Zustimmungspflichten und stärkte die Länder – das führte einerseits zu mehr politischer Handlungsfähigkeit, andererseits zu einem Flickenteppich in Bereichen wie den Studiengebühren oder dem Strafvollzug. 2009 folgte mit der Schuldenbremse im Rahmen der Föderalismusreform II ein tiefgreifender finanzpolitischer Eingriff. Länderhaushalte sollten ab 2020 keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Die jüngsten Krisen aber haben zentrale Konstruktionsfehler entlarvt. Anfang dieses Jahres wurde die Schuldenbremse teilreformiert, auch um dringend benötigte Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen. Die kommunale Finanznot indes wurde nie direkt adressiert, obwohl sie in den meisten Regionen Deutschlands das eigentliche Grundproblem darstellt. 16 Jahre später stehe die öffentliche Daseinsvorsorge – so Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes (DStGB), André Berghegger – „am Rande des Zusammenbruchs“.
„Deutschlands Städte brauchen mehr finanzielle Freiheit statt kurzfristiger Milliardenpakete. “ Dirk Assmann, Friedrich-Naumann-Stiftung
Eine Frage des Geldes?
Dass ein einmaliges Sondervermögen die strukturellen Probleme der Kommunen nicht nachhaltig löst, darin herrscht jedenfalls Einigkeit: „Deutschlands Städte brauchen mehr finanzielle Freiheit statt kurzfristiger Milliardenpakete,“ stellt Dirk Assmann, Referent für Regionalentwicklung bei der FriedrichNaumann-Stiftung klar. Kommunen übernehmen Aufgaben auf Weisung von Bund und Ländern, oft aber ohne eine ausreichende Finanzierung. Folgerichtig konzentrieren sich die Forderungen der Verbände auf eine Erhöhung und Verstetigung der kommunalen Einnahmebasis. Der DLT fordert eine Verdreifachung des kommunalen Umsatzsteueranteils auf sechs Prozent – nach Berechnungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ein Plus von 11,5 Milliarden Euro. Zudem müsse der Bund eine vollständige Kostenübernahme der Unterkunftsund Heizkosten für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund leisten, welche allein im letzten
Jahr 3,41 Milliarden Euro betragen hätten. Zudem müssten Landkreise endlich auch Steuergläubiger werden. Der DST fordert die Bundesregierung außerdem dazu auf „die unfairen Wettbewerbspraktiken inländischer Gewerbesteueroasen entschlossen zu bekämpfen.“
Ob diese Forderungen aber ausreichen oder vielmehr die föderale Aufgabenverteilung selbst in den Blick genommen werden sollte, ist umstritten. DLT-Präsident Achim Brötel fordert immerhin eine „drastische Verwaltungsreform“.
Föderale Arbeitsteilung neu denken Sofern über weitreichendere Reformen diskutiert wird, beziehen sie sich bislang nur auf spezifische Bereiche, statt die Handlungsfähigkeit des Staates als Ganzes in den Blick zu nehmen: 2021 formulierte der DST beim Fachkongress des IT-Planungsrats die Dresdner Forderungen, die 2024 nochmals aktualisiert wurden. Das Ziel war und ist eine beschleunigte Verwaltungsdigitalisierung. Darin heißt es: „Die digitale Transformation des Staates braucht eine Neuinterpretation des gelebten Föderalismus.“
Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) geht noch weiter. Anfang des Jahres argumentierte er in einem Gutachten, die derzeitige Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung sei angesichts multipler Krisen an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß. Staatliche Aufgaben seien verstreut, mehrfach geregelt oder übermäßig dezentralisiert. Doppelstrukturen, Überlastung, hohe Kosten und Ineffizienz prägten den deutschen Föderalismus. Der NKR schlägt deshalb eine stärkere Bündelung von Aufgaben vor: Diese sollen dort konzentriert werden, wo räumliche Nähe Vorteile bringt, beispielswei-
se durch gemeinsame Behörden. Statt viele verschiedene Stellen mit selten anfallenden Aufgaben zu betrauen, sollen spezialisierte Verwaltungseinheiten geschaffen werden. Weiterhin werden die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, standardisierte Verfahren, Systeme sowie der Abbau von Parallelstrukturen angeregt. Diese Bündelungen seien nicht mit Zentralisierung zu verwechseln, könnten Verwaltungsverfahren aber deutlich beschleunigen – von der Erteilung der Fahrerlaubnis bis hin zur Einkommensprüfung. Viele dieser Vorschläge seien „ohne grundlegende föderale Umwälzungen“ umsetzbar. Andere bringen hingegen eine Verfassungsänderung ins Spiel, z. B. bei besonderen Zuständigkeiten.
Politische Bereitschaft fraglich Union und FDP zeigten sich im vergangenen Bundestagswahlkampf vermeintlich offen für ein solches Vorhaben, SPD und Grüne hatten Gesprächsbereitschaft bekundet. In den Koalitionsverhandlungen wurde das Vorhaben dann aber abgeräumt: „Wir waren uns einig, dass wir so viele große Refomen vor uns haben, dass wir eine dritte Föderalismuskommission nicht hinkriegen,“ erklärte Finanzminister Lars Klingbeil dem ZDF. Der größte Nettozahler Bayern bringt regelmäßig eine Reform des Länderfinanzausgleichs oder Länderfusionen ins Spiel. Dr. Hendrik Scheller vom Difu-Institut zweifelt allerdings an der tatsächlichen Bereitschaft der politischen Akteure: „Die Erfahrungen der ersten beiden Reformkommission sind ambivalent: aufwendige Verhandlungen, suboptimale Ergebnisse und diverse Reformmaßnahmen, die entweder bereits wieder rückabgewickelt wurden oder zumindest stark in der Kritik stehen, weil sie
sich als wenig zielführend erwiesen haben.“ Er zieht den Begriff Staatsreform vor. Um die Strukturkrise nachhaltig zu lösen, „müssen alle drei Ebenen an einen Tisch – egal wie man dieses Format dann am Ende nennen will“. Um die kommunale Finanzausstattung dauerhaft zu verbessern, brauche es ein Gesamtpaket – „von einer Altschuldenlösung über eine Vereinfachung der Finanzierungsströme bei den Sozialausgaben bis hin zu einer Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatz- oder Einkommensteuer“. Die strukturelle Krise der Kommunen ist keine Nebensächlichkeit. Wo das Fundament bröckelt, gerät die gesamte föderale Ordnung ins Wanken. „Ohne einen Einstieg in eine kommunale Kostenentlastung ist zu befürchten, dass die große Unzufriedenheit vor Ort verstärkt und auf das Konto antidemokratischer Kräfte eingezahlt wird“, warnt Mempel. Auch die stellvertretende NKR-Vorsitzende Prof. Dr. Sabine Kuhlmann konstatiert, immer mehr Bürgerinnen und Bürger „verlieren das Zutrauen in die Fähigkeiten von Staat und Verwaltung», und unterstreicht die Notwendigkeit für mutige Reformen: „Demokratie lebt davon, dass ihre Institutionen wirksam steuern und ihre Aufgaben erfüllen können.“
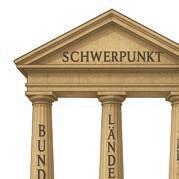









Foto: BS/Hameln
Behörden Spiegel: Hameln gilt als Vorreiterstadt in Sachen Klimaanpassung. Mit Projekten wie der „Klima-Kiste“ setzen Sie sichtbare Zeichen. Was war der entscheidende Impuls für diesen Weg – und welche Wirkung erhoffen Sie sich kurzfristig?
Claudio Griese: Der entscheidende Impuls war die spürbare Notwendigkeit, unsere Stadt aktiv auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten – nicht erst morgen, sondern heute. Extremwetter, Hitzeperioden, Trockenheit und die damit verbundene Belastung für Mensch und Infrastruktur zeigen deutlich: Klimaanpassung ist keine abstrakte Zukunftsfrage, sondern eine konkrete kommunale Aufgabe. Mit Projekten wie unserer kühlenden Nebelanlage haben wir sichtbare Schritte gemacht, um Lösungen zu bieten und das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken. So erhoffen wir uns eine spürbare Verbesserung der Aufenthaltsqualität in stark versiegelten Bereichen und das klare Signal: Klimaanpassung beginnt direkt vor der eigenen Haustür. Vielleicht können wir mit unseren Projekten auch weitere Ideen anstoßen und neue Investitionen ins Thema Klimaanpassung in der Region bekräftigen.
Behörden Spiegel: Der kommunale Hitzeaktionsplan ist ein zentrales Instrument, um Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Welche Maßnahmen haben Sie bereits umgesetzt, und wo sehen Sie noch die größten Herausforderungen für Hameln?
Griese: Vor einem Jahr wurde unser umfassendes Klimaanpassungskonzept verabschiedet. Es reagiert gezielt auf die Herausforderungen
Mehr Raum für den Bau von Fahrradparkhäusern, Seniorenwohnheimen und Wohnungen: Damit solche Vorhaben für Kommunen künftig zu realisieren sind, beschlossen Bundesrat und Bundestag kürzlich eine Änderung des geltenden Eisenbahngesetzes und setzten damit eine Gesetzesänderung der Vorgängerregierung wieder außer Kraft. So hatte die Ampel zuletzt beschlossen, ungenutzte Bahnflächen nicht mehr für den Wohnungsbau umzuwidmen, sondern sie stattdessen für einen eventuellen späteren Ausbau des Bahnverkehrs zu reservieren.
Mehr als 170 blockierte kommunale Projekte Der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Björn Simon, erklärte dazu: „Mit unserem Gesetzesentwurf schaffen wir eine dringend benötigte Erleichterung für Städte und Gemeinden.“ So habe die bisher geltende Regelung bundesweit mehr als 170 kommunale Projekte für Wohnungsbau und Quartiersentwicklung blockiert. Auf Anfrage des Behörden Spiegel schränkte Simon zwar ein: „Der Schienenverkehr ist und bleibt ein wichtiger Schlüssel für nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in Deutschland. Viele Bahnflächen, die heute nicht mehr benötigt werden, können in Zukunft wieder eine wichtige Rolle spielen.“ Doch gleichzeitig müsse auch mehr gebaut werden, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit
Interview mit Claudio Griese, Oberbürgermeister der Stadt Hameln
Innovative Lösungen aus der Rattenfängerstadt (BS) Hameln stellt sich aktiv den Folgen des Klimawandels: Mit Nebelanlage, „Klima-Kiste“ und Begrünungsprojekten schafft die Stadt erste Coolspots. Doch begrenzter Raum, hohe Kosten und der Schutz vulnerabler Gruppen bleiben zentrale Herausforderungen. Oberbürgermeister Claudio Griese zeigt ihre Lösungen auf. Die Fragen stellte Julian Faber.

Die Klimakiste bringt Schatten, Pflanzen und Frische in die Innenstadt. Foto: BS/Fokuspokus Media
durch Hitze, Trockenheit und Starkregen und wird über zehn Jahre schrittweise umgesetzt. Konkrete Pilotmaßnahmen wie Entsiegelung, Begrünung und Umgestaltung im Innenstadtbereich – etwa am Rathausplatz, im Bürgergarten und am 164er Ring – sowie Förderprogramme für private Begrünung sind bereits angestoßen. Umsetzen konnten wir die beliebte „Klima-Kiste“ als temporären, begrünten Coolspot, einen öffentlichen Trinkwasserspender in der Fußgängerzone und eine temperaturgesteuerte Hochdruck-Nebelanlage, die an heißen Tagen für
spürbare Abkühlung sorgt. Herausforderungen bestehen im hohen Versiegelungsgrad und der geringen Anzahl stadtklimatisch wirksamer Grünflächen – insbesondere in der historischen Innenstadt. Eine schnelle Entsiegelung und Begrünung ist hier erschwert, da der Raum begrenzt ist. Auch die Finanzierung und der dauerhafte Unterhalt technischer Anlagen sowie baulicher Umgestaltungen sind kostenintensiv und erfordern langfristige Sicherung. Besonders herausfordernd ist zudem der gezielte Schutz vulnerabler Gruppen wie älterer Menschen,
chronisch Erkrankter und Alleinlebender, die verlässliche Informationsketten und niedrigschwellige Angebote benötigen.
Behörden Spiegel: Nachhaltigkeit in der Kommune bedeutet auch Teilhabe. Wie binden Sie die Hamelner Bevölkerung in Klimaanpassung und Hitzeschutz ein – und wie gelingt es, besonders vulnerable Gruppen zu erreichen?
Griese: Wir setzen gezielt auf Beteiligung, Transparenz und digitale Kommunikation. Online sowie offline haben wir stets ein offenes Ohr für unsere Bürgerinnen und Bürger und geben auf Plattformen wie unserer Homepage und Social Media regelmäßige Updates zu unseren Projekten – etwa zur Förderung von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen oder zur Aktion Klimabäume, bei der wir Bäume verschenken. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Tag der Umwelt in der Hamelner Innenstadt sind wir präsent, um zu informieren, ins Gespräch zu kommen und Ideen aufzunehmen. Durch Beteiligung an bundesweiten Hitzeaktionstagen und lokalen Kampagnen – wie „Hameln. Komm wie Du bist: Das heißeste Thema der Stadt.“ wird die Bevölkerung aktiv für Hitzeschutz sensibilisiert. Um auch die junge Generation einzubinden, arbeiten wir eng mit Schulen
Novelle des Eisenbahngesetzes
(BS/Anne Mareile Moschinski) Ungenutzte Bahnflächen sollen in Zukunft leichter für den Wohnungsbau und die Quartiersentwicklung freigegeben werden. Der Beschluss geht den Kommunen nicht weit genug.

Stillgelegte Bahngrundstücke dürfen künftig bebaut werden. BS/Sinousxl, pixabay.com
der nun beschlossenen Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes gebe es einen klaren rechtlichen Rahmen, der dafür sorge, dass „eine Entwidmung nur dann erfolgt, wenn sie wirklich keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung
der Schieneninfrastruktur hat“. Auch die kommunalen Spitzenverbände beurteilen die Gesetzesänderung, die die Ampelregierung 2023 auf den Weg brachte, als Hemmschuh für die Stadtentwicklung und begrüßen die nun
„Das neue Gesetz definiert weiterhin nur enge Ausnahmen für eine Freistellung der Flächen für städtische Bauprojekte.“
Christian Schuchardt Hauptgeschäftsführer, Deutscher Städtetag
erfolgte Lockerung der Regelung. Allerdings gibt es aus ihren Reihen auch Kritik. So hatte die Ampel vor zwei Jahren beschlossen, dass grundsätzlich für den Bahnbetriebszweck eines Grundstücks „ein überragendes öffentliches Interesse“ gelte, das nur durch ein gesetzlich festgelegtes „überragendes öffentliches Interesse“ überboten werden kann. Neu ist nun, dass stillgelegte Bahngrundstücke auch ohne ein „überragendes öffentliches Interesse“ zur Bebauung umgewidmet werden können – vorausgesetzt, es liegt „kein Verkehrsbedürfnis“ vor
zusammen und unterstützen schulische Klimaprojekte. Für vulnerable Gruppen setzen wir stark auf unser Quartiersmanagement.
Behörden Spiegel: Welche weiteren Schritte plant die Stadt Hameln, um sich langfristig als „nachhaltige Kommune“ aufzustellen – und welche Unterstützung wünschen Sie sich dabei von Land, Bund oder auch von den Bürgerinnen und Bürgern?
Griese: In den kommenden zehn Jahren haben wir einen klaren Fahrplan: Wir wollen naturbasierte Lösungen wie Straßen-, Dach- und Fassadenbegrünungen, zusätzliche Baumpflanzungen und Entsiegelung forcieren. Zudem möchten wir das Wasser- und Regenmanagement stärken und unsere Starkregenund Hochwasservorsorge ausbauen. Geplant ist auch, mehr Coolspots bereitzustellen und an bestimmten Stellen für gezielten künstlichen Sonnenschutz zu sorgen. Um unsere Ziele umzusetzen, ist breite Unterstützung unerlässlich. Von Land und Bund wünschen wir uns langfristige Finanzierungssicherheit, eine Entbürokratisierung der Förderprogramme und fachliche Unterstützung bei komplexen Vorhaben. Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, wenn es um die aktive Mitwirkung bei der Begrünung und Entsiegelung privater Flächen geht. Wichtig ist auch Engagement in der Nachbarschaftshilfe, etwa durch einen fürsorglichen Blick auf ältere oder alleinlebende Mitmenschen. Diese gemeinsame Verantwortung – zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung – bildet das Fundament für eine klimaresiliente und lebenswerte Stadt Hameln.
und ein „langfristiger Nutzungsbedarf“ ist nicht absehbar. Die kommunalen Spitzenverbände halten jedoch diese Sonderregelung nicht für erforderlich. Christian Schuchardt , Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, erklärt dazu: „Die für die Städte problematische Änderung des Gesetzes aus dem Jahr 2023 wird auch mit dem neuen Gesetzentwurf nicht komplett korrigiert. Das Gesetz definiert weiterhin nur enge Ausnahmen für eine Freistellung der Flächen für städtische Bauprojekte.“ Auch fordere der neue Gesetzentwurf, dass eine Freigabe der Flächen eine mögliche Wiederinbetriebnahme nicht verhindern darf. „Wie das zukünftig ausgelegt wird, ist unklar“, so Schuchardt weiter. Das Gesetz sorge für neue Unsicherheiten. Wünschenswert sei aber eine Gesetzesänderung gewesen, die „allen Beteiligten wieder Rechts- und Planungssicherheit gibt“.
Zustimmung für die neue Regelung kommt auch vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Sprecher Andreas Schichel weist jedoch darauf hin: „Es besteht auch immer die Gefahr, dass freigewordene Flächen später wieder für die Bahnnutzung benötigt werden. Die Verantwortlichen für die Stadtentwicklung in Berlin sagen voraus, dass sich Berlin ‚sonnenförmig‘ entlang der Bahnachsen nach Brandenburg hinein entwickeln wird.“
Was für eine Person ohne Einschränkungen nach einer lästigen Unannehmlichkeit klingt, macht für viele Menschen in Deutschland das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast unmöglich. Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderung, welcher Natur auch immer, sind schnell auf der Verliererseite. Rampen für Rollstuhlnutzende müssen häufig vorab angemeldet werden – und selbst mit Anmeldung ist das keine Garantie für das Vorhandensein der Rampe. Entweder, weil das Personal am Zielbahnhof fehlt, um die Rampe zu platzieren, oder weil der Lockführer schon mal vergisst, die Rampe am gewünschten Zielbahnhof auszuklappen. Auch technisches Versagen spiele hier oft eine Rolle, betonen die beiden Selbstvertreterinnen Claudia Franke und Gracia Schade Franke ist erste Vorsitzende im Rat behinderter Menschen der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. und Schade Inklusionsmanagerin der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Beide Frauen sind Rollstuhlnutzerinnen, die sich als selbst Betroffene für Barrierefreiheit einsetzen. Beide wollen sich nicht mehr auf den ÖPNV verlassen müssen.
„Die Community ist begeistert und kann Bedarfe niedrigschwellig mitteilen.“
Dr. Daria Lutschnikova, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, Stadt Leipzig
Doch nicht nur bei der Nutzung des ÖPNV seien Barrieren ein Problem. Häufig stießen betroffene Personen auch im Gesundheitssystem auf schwer zugängliche Strukturen. Bspw. kann sich der Gynäkologiebesuch schwierig gestalten, wenn allein der Gynäkologenstuhl zur Hürde wird. Natürlich gibt es ein paar Praxen, die hier eine barrierefreie Lösung anbieten, diese sind aber rar gesät. Und auch technische Neuerungen, die das Leben erleichtern sollen, bringen Ausgrenzungspotenzial mit. Viele Menschen mit Behinderung täten sich schwer mit der Nutzung von Selbstbedienungskassen oder dem Scannen von QR-Codes, erklärt Schade. Viele
…ist noch lang
(BS/Scarlett Lüsser) Stellen Sie sich vor, Sie möchten mit dem Zug verreisen, haben entsprechend große Gepäckstücke und z. B. einen Kinderwagen dabei und müssen – wie das bei der Deutschen Bahn schon mal passieren kann – an einem kleineren Bahnhof umsteigen. Und dann stellen Sie fest: kein Aufzug weit und breit. Und die Rolltreppen (wenn überhaupt vorhanden) sind außer Betrieb.

Treppen sind eine der häufigsten Barrieren in Deutschland. Und selbst, wenn günstige oder kostenfreie Lösungen präsentiert werden, lehnen manche Menschen diese für ihr Etablissement ab – oft aus Desinteresse, wie Gracia Schade meint. Foto: BS/Dan Race, stock.adobe.com
kleine Neuerungen, die sich aber immer weiter durchsetzen, grenzen unbewusst viele Menschen aus, ob Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Behinderung. „Ich würde mir wünschen, Barrierefreiheit und Brandschutz hätten den gleichen Stellenwert, dann würden wir an vielen Stellen nicht wieder diskutieren müssen. Aber sie schließen sich manchmal gegenseitig aus“, so Schade. Sie verweist z. B. auf nicht elektrische Brandschutztüren.
Zudem: Das System nachträglich anzupassen, bringt immer mehr Kosten mit sich, als wenn Barrierefreiheit von vornherein mitgedacht wird. Das weiß Regine Laroche, die Leiterin des Referats „Bundesinitiative Barrierefreiheit“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Daher sei es wichtig, dass angehende Stadtplanerin-
nen und -planer sowie werdende Architektinnen und Architekten direkt in ihrer Ausbildung schon mit den besonderen Bedarfen verschiedener Menschen mit Behinderung vertraut gemacht würden, führt Laroche aus. Franke ergänzt, dass es hierbei besonders wichtig sei, in den direkten Austausch mit Selbstvertretenden zu gehen, damit die unterschiedlichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt werden könnten.
Realitätscheck
Aber wie fortgeschritten ist die Barrierefreiheit in Kommunen wirklich? In einem dreijährigen Kooperationsprojekt des Zentrums für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen und der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte (DIMR) wurde eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen für Inklusions- und Barrierefrei von deutschen Kommunen durchgeführt. Der Hintergrund: Bereits seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland gesetzlich verankert. Kommunen müssen ausreichend barrierefreie Wohnungen bereitstellen, Ämter und Schulen müssen für alle, wirklich alle, frei zugänglich sein und außerdem flexible Unterstützungsdienste anbieten, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wie das im Juni erschienene zentrale Ergebnispapier des bundesweiten Forschungsprojekts zeigt, haben jedoch gerade einmal 41 Prozent der untersuchten Städte und Kreise mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern einen strukturierten Planungsprozess begonnen oder abgeschlossen.
Dabei seien Selbst- und Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung häufig der Anstoß solcher Planungen. Oft seien sie an der Planungsphase beteiligt, aber selten an den Entscheidungsprozessen. Es fehle insgesamt an Verbindlichkeit und eine stärkere Verschränkung mit anderen Planungsbereichen wie Verkehr, Bauen oder Schulen sei wünschenswert. Dabei seien politischer Rückhalt und Ressourcen für den Planungsprozess wichtige Erfolgsfaktoren, diese seien häufig aber nicht ausreichend vorhanden. Ein Gegenentwurf Trotz dieser Ergebnisse gibt es natürlich auch positive Beispiele. Beim Stichwort ÖPNV berichtet Dr. Daria Lutschnikova, Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Leipzig, von Schulungen für Fahrerinnen und Fahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe durch Selbstvertretende mit unterschiedlichen Bedarfen. Diese Schulungen würden euphorisch aufgenommen. Gerade der Perspektivwechsel helfe den Fahrenden ungemein. „Auch die Community selbst ist sehr begeistert und kann da wirklich eigene Bedarfe sehr einfach und niederschwellig mitteilen“, ergänzt Dr. Lutschnikova. Zusätzlich habe die Stadt ein Gremium, bei dem sowohl Selbstvertretende als auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Mobilitäts- und Tiefbauamt sowie von den Verkehrsbetrieben vertreten seien. Auch hier geht es um Sensibilisierung für das Thema, gerade bei neuen Bauplanungen. Selbst bei der Abnahme bestimmter Objekte seien Menschen mit Behinderung mit von der Partie. Letztendlich muss in Deutschland noch viel mehr passieren, damit alle Menschen mitgenommen werden. Denn Barrierefreiheit von vornhe-rein mitzudenken, bedarf zwar einer Umstellung, es schränkt aber niemanden ein – im Gegenteil, es kommt allen zugute. Nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Senioren, Personen aus bildungsferneren Schichten und anderssprachige Menschen profitiert sowohl von physischer als auch technischer Barrierefreiheit. Und auch wenn es für einen jungen, gesunden Menschen aktuell schwer nachvollziehbar sein kann – spätestens im Alter sind wir froh, wenn wir alle Strukturen angepasst haben.
… sah ich mir den Talk von Markus Lanz an. Es ging um Sondervermögen. Diese sind ja die neuen Feigenblätter der Politik. Während Berlin und die Länder ihre milliardenschweren Schattenhaushalte feiern, bleiben am Ende die Kommunen auf der Strecke – und mit ihnen jede Chance auf wirkliche Nachhaltigkeit.Denn Sondervermögen können eins sehr gut: Verantwortung kaschieren und Haushalte entlasten; aber nur auf dem Papier. Sie taugen perfekt als Selbstbetrug und Placebo für die Wählerinnen und Wähler.
Pump
Seit Schröders Agenda 2010 versucht Deutschland, jedes Problem mit Geld zu lösen. Das ist fatal, vor




allem dann, wenn man es nicht hat. Jeder private Haushalt weiß, dass er sich nur so viel leisten kann, wie viel im Gelbeutel ist. Ein Leben auf Pump ist alles andere als nachhaltig. Und nun setzen die Sondervermögen dieser politischen Feigheit die Krone auf. So werden politisch kalkuliert Probleme verschoben und Verantwortung auf Kosten der Nachhaltigkeit ignoriert. Könnte sich der kommunale Raum auch ein Sondervermögen für Nachhaltigkeit gönnen? Am besten gleich in Milliardenhöhe? Klingt nach Tatkraft, nach Strategie, nach Aufbruch. Aber zugleich wäre es das perfekte Alibi, um die eigentliche Verantwortung auf ein anonymes Konto im Haushalt ab-
Rolf Hartmann war von 2004 bis 2020 Bürgermeister der Gemeinde Blankenheim. Foto: BS/privat
zuschieben. Nachhaltigkeit wird damit zur Buchungszeile, nicht zur Haltung. Eine Haltung, die sich durch Miteinander auszeichnet. Ehrliche Nachhaltigkeit in all ihren Facetten muss ein Lebensgefühl sein. Was nützt der beste Finanztrick, wenn Bürger sich übergangen fühlen? Wenn Projekte von oben verordnet und nicht gemeinsam entwickelt werden? Ein echter nachhaltiger Erfolg ist nicht die Eröffnung eines Prestigeprojekts, sondern der Moment, wenn Anwohner, Verwaltung und Politik merken: Wir ziehen zusammen an einem Strang.
Ohne Rechentricks Wer Nachhaltigkeit will, braucht eine verlässliche Haushaltsführung, keine Geldtöpfe mit ImageEtikett. Sie entsteht nicht aus einem Sondervermögen, das in fünf Jahren versiegt. Sie ist eine Aufgabe von Jahrzehnten – und genau das können Sondervermögen nie leisten. Nachhaltigkeit lebt vom Streit im Gemeinderat um die richtige Rei-
henfolge: Sanieren wir zuerst die Grundschule oder das Rathaus? Investieren wir mehr in Bäume gegen die Hitze oder in neue Parkhäuser? Das sind keine Fragen für ein Sondervermögen, sondern für Anstand, Augenmaß und Mut. Mut, auch mal Nein zu sagen: z. B. zu dem neuen Neubaugebiet im Rhein-Erft-Kreis, welches angeblich hochwassersicher gebaut wurde, um dann durch den Starkregen im September dieses Jahres überschwemmt zu werden. Manchmal ist eben weniger Baugebiet auch mal mehr. Nein sagen können, ist nachhaltige Politik, die das Wahlvolk allerdings nicht immer goutiert.
Mut zur Wahrheit
Die wahre Sonderleistung ist, wenn eine Kommune sich ehrlich fragt: Was ist uns wichtig – und was lassen wir lieber bleiben? Nachhaltigkeit für eine ausgewogene Daseinsvorsorge beginnt im Kleinen, beim gemeinsamen Pflanzprojekt im Quartier, beim Repair-Café im Gemeindehaus oder beim Entschluss, lieber alte Bausubstanz zu
nutzen, als neue versiegelte Baugebiete zu erschließen.
Zukunftsfähigkeit erfordert Politik mit klarer Kante und die Bereitschaft, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Wer dafür erst Milliardenfonds erfinden muss, der zeigt nur: Er hat das Prinzip nicht verstanden. Eine nachhaltige Kommune heißt nicht: weniger Leben; sie heißt: intensiveres Leben. Mit mehr Miteinander, mehr Resilienz und weniger Sondervermögen, damit auch unsere Enkelkinder noch Freude an diesem Planeten haben werden.
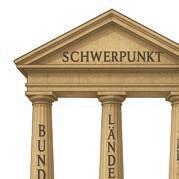


Ende 2024 lebten in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 123.530 Menschen ohne anerkannte Staatsangehörigkeit. Davon sind 28.815 offiziell als staatenlos anerkannt, während 94.715 mit ungeklärte Staatsangehörigkeit geführt werden. Bis heute existiert jedoch kein standardisiertes Verfahren zur Feststellung von Staatenlosigkeit –was sowohl für Staatenlose als auch für Beamtinnen und Beamte eine erhebliche Unsicherheit bedeutet. Staatenlosigkeit ist nicht ausschließlich Ergebnis individueller Lebensläufe, sondern entsteht häufig durch komplexe rechtliche und administrative Schnittstellen. Fehlende Verfahrensstandards, uneinheitliche Zuständigkeiten und restriktive gesetzliche Regelungen erschweren den Alltag der Betroffenen und stellen Beamte in Ausländerbehörden, Standesämtern oder Einbürgerungsstellen vor Herausforderungen. Internationale Standards und Empfehlungen, etwa von UNHCR, fordern seit Jahren ein klar geregeltes Verfahren zur Feststellung von Staatenlosigkeit. Während mehrere europäische Länder Instrumente eingeführt haben, steht Deutschland noch am Anfang.
Uneinheitliche Verwaltungspraxis
Staatenlosigkeit bedeutet, dass für die Betroffenen kein nationales
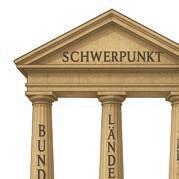


Zwischen Unsicherheit und Verwaltungsrealität
(BS/Margarida Farinha) Jursitische Heimatlosigkeit stellt Betroffene und Behörden vor Herausforderungen. Um ein praxistaugliches Verfahren zu entwickeln, führt Statefree e. V. Interviews mit Mitarbeitenden aus Ausländerbehörden, Standesämtern und Einbürgerungsstellen. Ihre Erfahrungen sind entscheidend für die Gestaltung eines wirksamen Verfahrens.

Die ungeklärte Staatsangehörigkeit stellt einen Arbeitsbegriff dar, der Betroffene und Behörden vor große Herausforderungen stellt. Foto: BS/YarikL, stock.adobe.com
Recht uneingeschränkt gilt. Reisefreiheit, Bildung, Berufszugang oder Gesundheitsversorgung sind häufig eingeschränkt oder nicht zugänglich. Fehlende Dokumente erschweren oder verhindern Auslandsreisen, Ausbildungs- oder Studienplätze. Dabei ist Staatenlosigkeit kein einheitlicher Status, der mit stets gleichen Einschränkungen und Erfahrungen einhergeht. Vielmehr hängen die damit verbundenen konkreten Rechtseinschränkungen und Auswirkungen von weiteren Faktoren ab, zum Beispiel davon, ob die Staatenlosigkeit offiziell anerkannt wurde und ob die Anerkennung der Staatenlosigkeit mit der Ausstellung eines Reiseausweises für Staatenlose – und somit einem Ausweisdokument –einhergeht.
Während die anerkannte Staatenlosigkeit ein Rechtsstatus ist und mit gewissen Rechten einhergeht, stellt die ungeklärte Staatsangehörigkeit lediglich einen Arbeitsbegriff dar. Obwohl dieser Arbeitsbegriff temporär verwendet werden soll, erstreckt sich diese Kategorisierung oft über Jahre, Jahrzehnte oder sogar Generationen. Eine staatenlose Person berichtet: „Ich wusste, in meinem Ausweis stand, ich darf Deutschland nicht verlassen, aber da stand nichts dazu, dass ich keine Beamtin werden durfte, dass ich keine hohen Berufschancen bekomme oder überhaupt faire Berufschancen.” Weitere Einschränkungen umfassen sowohl alltägliche Hürden, wie das Eröffnen eines Bankkontos, das Kaufen von SIM-Karten, Online-Registrie-
Regen speichern, Zukunft sichern
(BS/Mascha Overath) Wenn Straßen glühen, Grünflächen vertrocknen und Keller überfluten, zeigt sich: Der Klimawandel ist längst Realität. Städte und Gemeinden müssen kreative Lösungen entwickeln und die Anpassung entschlossen anzugehen.
Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigt eine Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) aus dem Jahr 2024: 71 Prozent von 276 Kommunen sehen in den kommenden zehn Jahren einen hohen Handlungsbedarf zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Bereich Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft.
Trockenstress im Stadtgrün
Die Folgen von längeren und häufigeren Trockenperioden machen sich in den Städten bemerkbar und führen zu einem zunehmenden Bewässerungsbedarf für städtisches Grün. Zwar können Bäume und Pflanzen Phasen mit geringerem Niederschlag ausgleichen, indem sie auf die im Boden gespeicherten Wasserreserven zurückgreifen – doch sind diese infolge vorheriger Trockenzeiten bereits stark erschöpft, reichen schon kurze regenarme Zeiträume aus, damit das Stadtgrün zunehmend unter Stress gerät. Besonders problematisch ist dies in dicht bebauten und stark versiegelten urbanen Räumen, wo Regenwasser nur schwer den Weg zum Baum findet. Als zentrales Gegenkonzept gilt in der Stadtplanung das Schwammstadt-Prinzip. Dabei soll Regenwasser nicht einfach über die Kanalisation abgeleitet, sondern zwischengespeichert, vor Ort versickert oder verdunstet werden. Umgesetzt wird dies durch eine Vielzahl dezentraler Maßnahmen: die Entsiegelung von Flächen, die
Schaffung und Sicherung von Grünflächen, Gründächern und -fassaden, straßenbegleitende Tiefbeeten oder Zisternen. Dieses Konzept einer Stadt, die wie ein Schwamm Wasser aufnimmt, wenn viel da ist, und zeitverzögert wieder abgibt, wenn es benötigt wird, ist nicht neu. Doch zwischen dem identifizierten Handlungsbedarf und der tatsächlichen Umsetzung klafft noch eine große Lücke. Während sich neue Quartiere und Gebäude vergleichsweise leicht nach Schwammstadt-Prinzipien gestalten lassen, sind bestehende Stadtstrukturen schwerer umzugestalten. Viele Stadtbilder sind noch geprägt vom Ideal der autogerechten Stadt mit breiten Straßen, versiegelten Flächen und wenig Rücksicht auf Klima oder Aufenthaltsqualität. Es gibt also großen Nachholbedarf, um Kommunen widerstandsfähiger gegen Extremwetter zu machen.
Von der Theorie zur Praxis Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für vorausschauendes Handeln und Mitdenken der Klimawandelfolgen im kommunalen Alltag. Vorreiterstädte wie Bochum zeigen, wie das gelingen kann und entwickeln praxisnahe Lösungen. Die Stadt gilt mittlerweile etwa als BaumrigolenHauptstadt: Unterirdische Wasserspeicher unter Bäumen sorgen dort für ein optimiertes Wasserangebot im verdichteten Stadtraum. Denn die erwünschte und notwendige Durchgrünung der Städte geht auch mit einem steigenden Wasserbedarf
einher. Regenwasserspeicherung und -nutzung werden daher künftig noch stärker als zentrale Bausteine der Schwammstadt in den Vordergrund rücken. Dass dies nicht nur als Aufgabe der öffentlichen Hand verstanden werden muss, sondern auch als gemeinschaftliches Projekt mit bürgerschaftlichen Initiativen gelingen kann, zeigen sogenannte Wassertanken nach Berliner Vorbild. Dabei werden schlanke Regentonnen auf Bürgersteigen über Fallrohre an Dächern angeschlossen. Was in privaten Gärten längst gut funktioniert, ist im öffentlichen Raum noch besonders. Das gespeicherte Regenwasser können die Anwohnenden abzapfen, um damit Pflanzen vor der eigenen Tür zu bewässern.
Kostenloses Regenwasser ist zu wertvoll, um es ungenutzt abzuleiten. Kommunen, die heute auf Zisternen und Regentonnen setzen, machen sich fit für die Zukunft. Und gleichzeitig eröffnet sich die Chance, unsere Städte und Gemeinden mit cleveren Lösungen lebenswerter und resilienter zu gestalten.

Mascha Overath ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin im Bereich Klimaanpassung und Stadtökologie am Difu-Institut in Köln. Foto: BS/Difu
rungen, Unterschreiben von Mietverträgen, als auch grundlegende Lebensentscheidungen wie Familien- und Zukunftsplanungen. Das Fehlen eines eigenen Verfahrens zur Feststellung von Staatenlosigkeit führt zu erheblichen Unterschieden: Je nach Bundesland, Behörde oder sogar Sachbearbeiter variieren Anforderungen, Bewertungen von Dokumenten und Entscheidungen zur Anerkennung von Staatenlosigkeit. In einigen Fällen wird Staatenlosigkeit anerkannt, in anderen mit nahezu identischer Beweislage nicht.
Betroffene berichten von langjährigen Verfahren, wechselnden Auflagen und widersprüchlichen Einschätzungen. Eine in Deutschland geborene staatenlose Person, die im Kindesalter einen jugoslawischen Pass hatte und nun als Erwachsene immer noch mit dem Status der ungeklärten Staatsangehörigkeit kämpft, beschreibt: „Ich war dann bei jemand anderem und der sagte mir: Sie müssen sich jetzt darum kümmern, dass Sie einen Pass haben. Die eine sagt mir dann aber: Sie müssen jetzt eigentlich lieber nachweisen, dass Sie nirgendwo Staatsangehörige sind. Das sind ja zwei komplett verschiedene Ansätze.“ Diese Arten der Unklarheit erzeugen nicht nur Frustration, sondern auch Rechtsunsicherheit – für Antragsteller wie für Verwaltungsmitarbeiter. Ein standardisiertes, rechtsstaatliches Verfahren würde hier die Entscheidungspraxis stützen, die Verwaltung professionalisieren und Rechtsunsicherheit reduzieren.
Ihre Perspektive zählt Staatenlosigkeit führt bereits im Kindesalter zu einem Gefühl der Ausgeschlossenheit. Hinzu kommen diskriminierende Erfahrungen, die mit Staatenlosigkeit häufig einhergehen. Eine Person beschreibt: „Es spielen mehrere Sachen herein, dass die meisten staatenlosen Leute entweder Flüchtlinge oder Minderheiten sind, die global international nicht anerkannt werden.“ Eine Weitere erklärt: „Mein Problem teile ich auch mit niemandem, weil ich einfach Angst davor habe, diskriminiert zu werden.“ Gesetzliche Verfahrensstandards bieten hier einen entscheidenden Hebel: Sie schaffen klare Handlungsoptionen für Behörden und reduzieren die Gefahr diskriminierender Behandlung. Um ein praxisnahes Verfahren zu entwickeln, führt Statefree e. V. Interviews mit dem Beamtentum aus Ausländerbehörden, Standesämtern und Einbürgerungsstellen durch. Ziel ist, Ihre Erfahrungen im Umgang mit Staatenlosigkeit und ungeklärter Staatsangehörigkeit systematisch zu erfassen und in die Entwicklung eines digitalen Feststellungsverfahrens einzubeziehen. Ihre Perspektive ist entscheidend –wir laden Sie herzlich dazu ein, sich einzubringen. Bei Interesse oder Rückfragen erreichen Sie uns unter margarida@statefree.world.

Margarida Farinha ist Co-Gründerin von Statefree e. V. und leitet dort ein Forschungsprojekt zum behördlichen Umgang mit Staatenlosigkeit.
Debatte über Sozialstaat und Beamtenstatus
(BS/jf) Der Deutsche Städtetag (DST) hat bei seiner Präsidiumssitzung in Potsdam mehrere Baustellen der Kommunalpolitik adressiert. Im Mittelpunkt standen die wachsenden Sozialkosten und die Zukunft des Beamtentums.
DST-Präsident Burkhard Jung warnte vor einem weiteren Finanzkollaps der Kommunen: „Die kommunalen Haushalte kollabieren gerade. Das Rekorddefizit der Kommunen von 25 Milliarden Euro im letzten Jahr wird nach unserer Prognose bereits in diesem Jahr mit einem neuen Rekorddefizit von über 30 Milliarden Euro getoppt werden. Die Städte haben keine Zeit mehr für Trippelschritte.“ Haupttreiber seien nicht das Bürgergeld, sondern insbesondere steigende Kosten in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Jung forderte, dass Bund, Länder und Kommunen diese Aufgaben künftig gemeinsam und fair finanzieren sollten.
Modernisierung als Schlüssel Darüber hinaus plädiert der Städtetag für eine stärkere Zentralisierung standardisierter Verwaltungsprozesse wie Kfz-Zulassung, Wohngeld- oder BAföGAnträge. Durch konsequente Digitalisierung ließen sich Ressourcen sparen und Bürgerinnen und Bürger entlasten. Auch bei der Pflege sieht der Verband akuten Handlungsbedarf: Steigende Eigenanteile führten immer häufiger dazu, dass Kommunen einspringen müssten. Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt verlangte, die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung auszubauen.
Parallel dazu mahnten die Städte zu einer sachlichen Debatte über den Beamtenstatus. Uwe Conradt, DST-Vizepräsident, betonte: „Unsere Beamtinnen und Beamten in den Städten verdienen Respekt und Anerkennung. Sie dürfen nicht zu Sündenböcken für die Defizite der kommunalen Haushalte gemacht werden.“ Die Ursachen für die Finanzkrise lägen vielmehr in der strukturellen Unterfinanzierung und den steigenden Sozialausgaben. Die Städte seien bereit, gemeinsam mit Bund und Ländern an Reformen zu arbeiten – von einer Entlastung bei Sozialleistungen über eine Modernisierung der Verwaltung bis hin zu einer Weiterentwicklung der Beamtenversorgung. Nur mit entschlossenen Schritten lasse sich verhindern, dass kommunale Handlungsfähigkeit und damit die Daseinsvorsorge vor Ort ernsthaft gefährdet werden, schloss Conrad
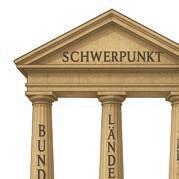


Rechtlich ist nachhaltige Beschaffung schon seit Jahren möglich: Qualitative, soziale und umweltbezogene Kriterien dürfen in Leistungsbeschreibung, Eignungsund Zuschlagskriterien sowie in Ausführungsbedingungen verankert werden. Der Zuschlag ist dem wirtschaftlichsten Angebot im Sinne eines Preis-Leistungs-Verhältnisses zu erteilen.
Vergabe zu 70 Prozent nach Anschaffungspreis
In der Praxis bleibt die Nutzung jedoch verhalten: Laut Vergabestatistik enthielten im Jahr 2021 nur elf Prozent der kommunalen Vergaben Nachhaltigkeitskriterien; in den Zuschlagskriterien wurde bei knapp 70 Prozent ausschließlich nach dem Anschaffungspreis vergeben.
Zudem zeigt eine Auswertung der TED-Datenbank für die Jahre 2011 bis 2023 einen deutlichen Rückgang der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei kommunalen Vergaben von 42 Prozent. Umweltaspekte dominieren dabei die Vergaben – soziale, gesundheits- und kreislaufwirtschaftliche Kriterien werden deutlich seltener gewichtet.
Die Diskrepanz zwischen politischer Ambition und gelebter Praxis lässt sich systematisch erklären. Eine Metaanalyse qualitätsgesicherter Studien identifiziert 16 Defizite, gebündelt in vier Aktionsfelder: Recht und Regulierung, Management und Steuerung, Strukturen und Prozesse sowie Märkte und Anspruchsgruppen. Besonders gravierend sind fehlende Kompetenzen, zu wenig Rückenhalt von Führungskräften und knappe Ressourcen.
Fünf sofort wirksame Hebel
• Führung & Verbindlichkeit herstellen: Nachhaltigkeit braucht einen klaren Führungsauftrag mit messbaren Zielen – nicht als „vergabefremde“ Zusatzaufgabe, sondern als Bestandteil von Wirtschaftlichkeit (Lebenszykluskostenrechnung). Wo rechtlich möglich, sollten fachlich begründete MussVorgaben für ausgewählte Produktgruppen gesetzt und dokumentiert werden.
• Kompetenzen systematisch aufbauen: Beschafferinnen und Beschaffer benötigen handhabbare Leitfäden, Schulungen zu Lebenszykluskosten, rechtssichere Formulierungen und die Fähigkeit, soziale und ökologische Kriterien wirksam zu gewichten. Kontinuierliche Fortbildung, Praxisnetzwerke und interne „Green Teams“ zahlen unmittelbar auf Qualität und Rechtssicherheit ein.
• Standards & Routinen verankern: Wiederverwendbare Textbausteine, Positiv-Negativlisten, Vergabe-Checklisten und einheitliche Bewertungsmatrizen senken die Transaktionskosten. Zertifizierungen und belastbare Nachweise (wie zum Neispiel Umweltzeichen) erleichtern die Eignungsprüfung; regelmäßige Nachverfolgung und Wirksamkeitskontrolle schaffen Lernschleifen statt Einzelfall-Heldentaten.
• Marktdialog und Wettbewerb um Nachhaltigkeit: Frühzeitige Markterkundung, offene Fragenkataloge und Pilotvergaben helfen, Angebotsdefizite zu überwinden und Innovationen sichtbar zu machen. Wichtig: Nachhaltigkeit gehört in die Zuschlagskriterien –sonst entsteht kein Wettbewerb um das bessere, sondern nur um das billigste Angebot.
Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung
(BS/Marc Wolinda) Die öffentliche Hand in Deutschland kauft jedes Jahr Güter und Dienstleistungen im Wert von bis zu 550 Milliarden Euro ein. Wer dieses Einkaufsvolumen konsequent auf Klima, Umwelt und Sozialziele ausrichtet, kann
Leitmärkte schaffen, Innovationen anreizen und gesamtwirtschaftliche Folgekosten senken. Doch zwischen politischem Anspruch und Umsetzung klafft weiter eine Lücke.
• Klimakosten bepreisen: CO2Schattenpreise anwenden. Das geltende Recht erlaubt die Berücksichtigung externer Umweltkosten in der Lebenszykluskostenrechnung – einschließlich CO2-Schattenpreisen. Die AVV Klima verlangt auf Bundesebene die Berücksichtigung einer CO2-Prognose über
den Lebenszyklus in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; CO2Schattenpreise können zudem als Zuschlagskriterium wirken. Empfohlen wird, die Höhe mindestens an den vom Umweltbundesamt ermittelten Klimafolgekosten auszurichten und den Anwendungsbereich schrittweise zu erweitern. Die
nachhaltige Beschaffung ist rechtlich möglich, wirtschaftlich sinnvoll – und in vielen Warengruppen machbar. Was fehlt, sind Verbindlichkeit, Professionalität, standardisierte Routinen und klare Preissignale für die Klimawirkungen. Wer als Behörde heute anfängt, Ziele festzulegen und zu berichten, Mit-
arbeitende zu qualifizieren, standardisierte Nachhaltigkeits und Lebenszykluskosten-Bausteine in jede Vergabe einzubeziehen, den Marktdialog zu verstetigen und CO2-Schattenpreise konsequent anzuwenden, schließt den Intention-Action-Gap. So wird aus dem „Ob“ der Nachhaltigkeit in der Beschaffung ein „Wie" – jeden Tag.

Marc Wolinda ist Senior Project Manager im Wirtschaftsprogramm der Bertelsmann Stiftung. Foto: BS/D. Güthenke

Die Wasserwirtschaft in Deutschland gerät immer mehr unter Druck: Viele Anlagen liegen abgelegen, mit langen Anfahrtswegen und schlechter Netzanbindung, müssen aber regelmäßig kontrolliert werden. Mitarbeitende verbringen oft Stunden in Kontrollrunden, verursachen damit CO2-Emissionen – oft nur, um zu bestätigen, dass tatsächlich alles in Ordnung ist. Gleichzeitig steigen Umweltanforderungen und Dokumentationspflichten. Das erhöht die Prüfzyklen – und damit die Belastung für die verbleibenden Teams. Und die werden in den nächsten Jahren spürbar kleiner, da viele Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Bei Hamburg Wasser sind es etwa 40 Prozent bis 2030. Auch andere Betriebe melden eine vergleichbare Altersstruktur. Gerade im ländlichen Raum wird es schwierig, alle Aufgaben mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen.
Edge Computing für effiziente
Auswertung
Hier setzt ARIKI an: Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Technologieprogramms „Edge Datenwirtschaft“ geförderte Projekt hat ein System zur automatisierten Ferninspektion wasserwirtschaftlicher Anlagen entwickelt.
Im Unterschied zur reinen Videoaufzeichnung analysiert ARIKI Bilder automatisiert vor Ort. Intelligente Kamerasysteme erkennen mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) relevante Veränderungen wie ungewöhnliche Wasserstände, Ablagerungen oder bauliche Veränderungen vor Ort. Dabei erfolgt die Auswertung der Bilddaten nicht zentral in einer Cloud, sondern direkt am Entstehungsort durch sogenanntes Edge Computing. Nur relevante Befunde wandern weiter in eine bereitgestellte Plattform. Das reduziert die Datenmengen, erhöht den Datenschutz und ermöglicht auch dort einen Einsatz, wo keine stabile Netzverbindung besteht.
„Es bedarf weniger Routinefahrten, dafür können in kritischen Fällen mehr gezielte Inspektionen vorgenommen werden.“
Digitale Inspektionen als Antwort auf Fachkräftemangel und Kostendruck
(BS/Dr. Agnetha Flore) Kommunale Wasserbetriebe kämpfen mit Personalengpässen, steigendem Prüfaufwand und einem wachsenden Sanierungsstau. Mit dem Forschungsprojekt ARIKI entsteht ein intelligentes Fernüberwachungssystem, das Lösungen für diese Herausforderungen bietet.


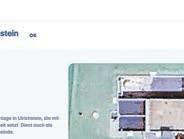


zeigen, dass Kommunen durch Monitoring entlegener Anlagen jährlich mehrere Tausend Euro an Betriebskosten sparen können: durch geringeren Treibstoffverbrauch, weniger Personaleinsatz und frühzeitig vermiedene Reparaturen. Die Akzeptanz technischer Lösungen wächst mit klaren Zugriffsregeln. ARIKI setzt daher auf rollenbasierte Rechte. So sehen Betreiber beispielsweise nur die für sie relevanten Livebilder und Ereignismeldungen und Verwaltungen nur aggregierte Übersichten, während Administratorinnen und Administratoren Systemeinstellungen vornehmen können. Der Umgang mit Daten ist per Design auf Datensparsamkeit ausgelegt: Bilddaten bleiben nach Möglichkeit lokal; zentrale Systeme erhalten nur vergangenheitsrelevante Nachweise und Metadaten. Die Architektur von ARIKI unterstützt so kommunale Vorgaben zur Datenminimierung und erleichtert zugleich Prüf- und Berichtspflichten.
Erste Erfolge aus der Pilotierung In Pilotprojekten wurde die Lösung unter realen Bedingungen an mehreren kommunalen Standorten geprüft. Entscheidende Kriterien waren die Robustheit der Hardware (Witterung, Vandalismus), die Verlässlichkeit der Erkennung und eine einfache Bedienung mit dem Ziel, den Betrieb spürbar zu entlasten.
Ein weiterer Vorteil: Die Plattform bleibt modular – Kameras, Auswertemodul, Dashboard und Schnittstellen lassen sich an Pumpwerke, Kläranlagen oder komplexe Netze anpassen. Bei Bedarf können die Anlagenbetreiber weitere Sensorik, beispielsweise für Audio, Vibration oder Leckage, ergänzen, ohne die Grundarchitektur zu verändern. Was sich für den Betrieb ändert ARIKI liefert priorisierte, handlungsrelevante Hinweise statt Rohmaterial, das vom Personal zuerst noch gesichtet werden muss. Betriebsteams sehen gezielte Alarme und Einschätzungen zur Dringlichkeit. Dadurch verschieben sich Einsatzpläne: Es bedarf weniger Routinefahrten, dafür können in kritischen Fällen mehr gezielte Inspektionen vorgenommen werden. Die Plattform trägt so zur Arbeitsentlastung bei. Erste Schätzungen
Die Erfolge sind ermutigend: So konnten beispielsweise Kontrollfahrten zu einem schwer zugänglichen Regenüberlaufbecken deutlich reduziert werden. Das System erkannte einen drohenden Rückstau frühzeitig und meldete diesen automatisch. Auch Ablagerungen im Zulaufbereich wurden identifiziert, bevor es zu Störungen kam. Neben dem Effizienzgewinn durch die Automatisierung zielt ARIKI auch auf mehr Nachhaltigkeit ab. Weniger Fahrten bedeuten weniger Emissionen. Gleichzeitig wird das Risiko für das Betriebspersonal verringert, etwa bei Starkregenereignissen. So leistet das Projekt einen Beitrag zum Klima- und Bevölkerungsschutz.
Skalierung und Ausblick
Die Architektur erlaubt einen schrittweisen Roll-out: Pilotierung an kritischen Punkten, dann sukzessive Ausweitung. Diese

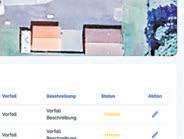



Skalierbarkeit macht das System von ARIKI besonders attraktiv für Kommunen. Ob einzelne Pump-
werke oder komplexe Netze: Die Plattform kann an unterschiedliche Gegebenheiten angepasst werden,

Ob Kommunen oder kommunale Unternehmen: Wir fördern Ihre nachhaltigen Ideen rund um neue Energien.
auch unter einfachen Bedingungen und mit begrenzten Mitteln. Technisch ist eine Übertragung auf andere Kritische Infrastrukturen möglich, seien es Rückhaltebecken, Deichanlagen oder Anlagen der Energieversorgung. ARIKI entwickelt ein digitales Betriebskonzept mit Referenzarchitektur für die Fernüberwachung dezentraler Infrastruktur. ARIKI zeigt, wie digitale Technologien konkrete Lösungen für kommunale Herausforderungen bieten können. Die intelligente Ferninspektion ist ein innovativer Ansatz, um Fachkräftemangel, Kostendruck und steigenden Sicherheitsanforderungen in der Wasserwirtschaft zu begegnen. Kommunen gewinnen so Zeit, Ressourcen und mehr Sicherheit.

Dr.-Ing. Agnetha Flore ist Director des Center for Digital GreenTech am August-Wilhelm Scheer Institut. Sie befasst sich mit der Digitalisierung Kritischer Infrastrukturen und bringt langjährige Erfahrung in Forschung, Management und der strategischen Innovationsberatung ein.


Neugierig? Wir beraten Sie gerne persönlich.



Nehmen Sie eine zentrale Rolle in der Stadtentwicklung Wülfraths ein!
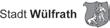
Wülfrath im Kreis Mettmann – idyllisch gelegen mit rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – vereint Natur und Stadtleben, zentral zwischen Düsseldorf, Essen und Wuppertal.
Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen die hohe Wohnqualität: die historische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, attraktive Ortsteile in ruhiger Umgebung, ein gutes Angebot an Schulen und Kindergärten sowie eine lebendige Gemeinschaft mit vielfältigen aktiven Vereinen machen Wülfrath besonders attraktiv für Familien. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine gestaltungsmotivierte Führungspersönlichkeit als
Baudezernentin / Baudezernent (w/m/d)
Diese verantwortungsvolle Position wird nach Besoldungsgruppe A 15 LBesG NRW bzw. Entgeltgruppe 15 TVöD vergütet und bietet: Großen Gestaltungsspielraum: Bringen Sie Ihre eigenen Ideen ein. Entwickeln und gestalten Sie gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Bürgerschaft die Zukunft für Wülfrath.
Attraktives Arbeitsumfeld:
Ein engagiertes Team, kurze Entscheidungswege und eine Verwaltung, die die großen Themen anpacken will.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Sanny Martinez, Gianna Forcella oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Baudezernent_Wuelfrath_10-2025.indd 1 18.09.25 11:58
Zukunft aktiv steuern: Für einen starken, modernen und serviceorientierten Landkreis Lörrach.

Das Landratsamt liegt mitten in der Innenstadt von Lörrach – eingebettet zwischen Weinbergen, dem Rhein- und Wiesental. Rund 1.500 engagierte Mitarbeitende setzen sich hier täglich für das Gemeinwohl ein. Sie gestalten aktiv die Zukunft der Region mit. Vor diesem Hintergrund übernehmen Sie die Verantwortung für zentrale strategische Querschnittsaufgaben in folgenden Bereichen: Finanzen, Personal & Service, Digitalisierung, IT & Organisation, Planung & Bau, Bildung & Kultur, Kliniken und Eigenbetriebe Diese Aufgabenfelder bieten Ihnen die Möglichkeit, die Zukunft des Landkreises und des Landratsamtes an maßgeblicher Stelle mitzugestalten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der Landkreis eine ambitionierte, gestaltungsmotivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als Dezernatsleitung für Finanzen, Zentrales Management und Bildung (w/m/d)
Die Position wird nach B 2 LBesGBW bzw. im Rahmen eines außertariflichen Vertrags vergütet. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Yanna Schneider oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Ihre Expertise für Hamburgs Stadt von morgen!

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) verantwortet die Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik in Hamburg. Unser Ziel ist es, Hamburg zu einer lebenswerten, nachhaltigen und modernen Stadt mit einem ausreichenden und bezahlbaren Wohnraumangebot zu entwickeln. Gelebte Werte wie Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Offenheit machen uns zu einer geschätzten Partnerin und Arbeitgeberin.
Mit viel Engagement und fachlicher Expertise schafft das Amt für Bauordnung und Hochbau mit seinen fast 300 Mitarbeitenden in der BSW die planerischen Voraussetzungen für eine nachhaltige und soziale Stadtentwicklung Hamburgs. Dabei agiert die Behörde als Schnittstelle zwischen Senat und Bezirksämtern und steuert Bauabläufe vielfältiger Bauprojekte von herausragender und baukultureller Bedeutung in einer der lebenswertesten Städte der Bundesrepublik. Zum 01.02.2026 suchen wir eine innovative Führungspersönlichkeit als Leitung (w/m/d) des Amtes für Bauordnung und Hochbau Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Die Vergütung erfolgt für Beschäftigte außertariflich in Anlehnung an die Besoldungsgruppe B4. Bei Beamtinnen und Beamten erfolgt sie in der Besoldungsgruppe B4 (Senatsdirektorin bzw. Senatsdirektor).
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Gianna Forcella und Julia Schwick gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_AL-Bauordnung_Hamburg_10-2025.indd 1

Bauen Sie mit uns an der Zukunft
Bornheims!

Genau zwischen Köln und Bonn gelegen, direkt am Rhein und umgeben von wunderschöner Landschaft, ist Bornheim mit knapp 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis und zählt zu den Städten in der Region, die am stärksten wachsen. Bornheim steht für zukunftsorientierte Stadtentwicklung, nachhaltiges Bauen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit öffentlicher Infrastruktur. Als Amtsleitung für das Bauamt und die Gebäudewirtschaft tragen Sie die Gesamtverantwortung für die Abteilungen Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz, Hochbau sowie die kaufmännische und technische Gebäudewirtschaft. Sie haben die Chance, die bauliche Entwicklung der Stadt Bornheim aktiv mitzugestalten. Wir suchen idealerweise spätestens zum 01.03.2026 eine engagierte und visionäre Führungspersönlichkeit als
Leitung (w/m/d) Bauamt und Gebäudewirtschaft
Diese verantwortungsvolle Position ist nach Entgeltgruppe 15 TVöD bewertet. Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld mit gelebter Vielfalt, gegenseitiger Wertschätzung und respektvollem Miteinander.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Sanny Martinez oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Lt-Bauamt_Bornheim_09-2025.indd 1 20.08.25 15:11
Als Interimsmanager*in schaffen Sie in kurzer Zeit einen Mehrwert.
Vieles ist aktuell in Bewegung. Der demographische Wandel fordert von öffentlichen Verwaltungen und kommunalen Unternehmen neue Herangehensweisen und Lösungsansätze für anstehende Aufgaben.
Für Kundenprojekte in allen Funktionsbereichen des öffentlichen Sektors suchen wir erfahrene und ambitionierte Persönlichkeiten als
Interimsmanagerin / Interimsmanager (w/m/d)
Als Interimsmanager*in übernehmen Sie bei unseren Kunden kurzfristig Verantwortung, um dringende Aufgaben und Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen.
Was Sie mitbringen sollten:
Erfahrung: Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in verantwortungsvoller Position, idealerweise im öffentlichen Sektor oder in projektnahen Aufgabenstellungen.
Flexibilität: Bereitschaft, sich schnell in neue Themenfelder und Organisationen einzuarbeiten.
Kompetenz: Fundiertes Wissen in den Bereichen Verwaltung, Prozessoptimierung, Digitalisierung oder strategisches Management.
Persönlichkeit: Ausgeprägte Kommunikations- und Führungskompetenz sowie eine hohe soziale und interkulturelle Sensibilität.
Verfügbarkeit: Offenheit für zeitlich befristete Einsätze mit wechselnden Aufgabenstellungen.
Interessiert?
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 0178 8894251 zfm-Geschäftsführer Edmund Mastiaux zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
V iele Krankenhäuser haben in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Defizite verzeichnet, jedoch konnten zwei Kliniken in Hessen 2021 positive Ergebnisse ausweisen: das Sana Klinikum Offenbach (5,7 Millionen Euro) und die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden (7,9 Millionen Euro). Dies ist bemerkenswert, da beide Häuser – wie nahezu alle Krankenhäuser – in den Pandemiejahren erhebliche Fallzahlenrückgänge zu verkraften hatten.
Ein gemeinsames Merkmal beider Einrichtungen ist ihre Einbindung in eine private Trägerschaft. Damit stellt sich auch die Frage, ob und inwiefern strukturelle Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Kliniken deren Wirtschaftlichkeit beeinfl ussen und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Vier Kriterien sind hier besonders bedeutsam: Finanzierung, Investitionen, Organisation und Leistungsspektrum.
Finanzierung und Investitionen
Öffentliche Krankenhäuser sind stark auf Landesfördermittel angewiesen. Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen in der Regel nur über Kredite der kommunalen Körperschaften oder über Eigenmittel, die aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden müssen. Private Betreiber hingegen können neben staatlichen Zuschüssen das konzernweite Cash-Pooling
Dr. Ulrich Keilmann
leitet die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof in Darmstadt. Foto: BS/privat
nutzen und einzelne Häuser damit quer subventionieren sowie leichter Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt einwerben. Diese zusätzlichen Finanzierungsquellen verschaffen ihnen Spielräume, die kommunalen Häusern oft fehlen.
Die unterschiedliche Finanzkraft schlägt sich unmittelbar in den Investitionsmöglichkeiten nieder. Während öffentliche Häuser Investitionen meist aufschieben oder von langwierigen Förderverfahren abhängig machen müssen, können private Betreiber schneller in moderne Bauinfrastruktur, Medizintechnik und digitale Systeme investieren. Gleichwohl investieren die öffentlichen Häuser gezielt dort, wo es der breiten Versorgung dient – selbst in (ländlichen) Regionen, die für private Anbieter bislang kaum attraktiv wären.
Organisation und Leistung
Die Organisation öffentlicher Häuser ist eng mit den jeweiligen Gebietskörperschaften verbunden – häufig als Eigenbetrieb oder GmbH und stark geprägt durch politische Vorgaben. Dies kann zwar die Entscheidungsprozesse verlangsamen, wahrt aber zugleich die Gemeinwohlorientierung der Kliniken. Dennoch können kommunale Häuser von den privaten Betreibern noch lernen. Private Kliniken sind häufig Teil größerer Verbünde oder Konzernstrukturen. Hierdurch entstehen zentrale Verwaltungs-

Petersberger Haushalts- und Finanzgipfel
22.–23. Oktober 2025 | Königswinter
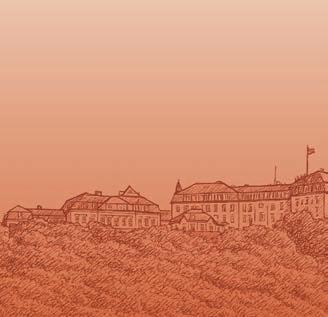


Kriterium
Finanzierung
Investitionen
Organisation
Leistungsspektrum
Vergleich öffentlicher und privater Krankenhausträger
Öffentliche Träger (Städte, Gemeinden, Länder) Private Träger (Unternehmen, Konzerne)
Landesfördermittel; ggf. Kredite der kommunalen Körperschaften; Eigenmittel aus laufendem Betrieb
Abhängig von staatlicher Förderung und Eigenmitteln; oft eingeschränkt bei klammen Kommunen
Kommunale Verwaltung, häufig als Eigenbetrieb oder GmbH; stark an politische Vorgaben und Gemeinwohlorientierung gebunden; zunehmend Kooperation und regionale Arbeitsteilung notwendig
Breites Angebot zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge; auch defizitäre Bereiche müssen vorgehalten werden.
Landesfördermittel plus Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt
Höhere Investitionsfähigkeit durch Kapitalmarkt und Reinvestition von Gewinnen in Infrastruktur, Medizintechnik und IT
Teil größerer Klinikverbünde oder Ketten; zentrale Strukturen (Shared Services, Einkauf, Verwaltung)
Fokussierung auf rentable, planbare und gut abrechenbare Leistungen (z. B. Orthopädie, Kardiochirurgie)
Nach aktuellen Studien liegt die Umsatzrendite privater Krankenhäuser im Median bei 4,6 Prozent, während kommunale Kliniken lediglich 0,3 Prozent erreichen.
und Serviceeinheiten (z. B. Einkauf, Labor, Buchhaltung), die Effizienzgewinne ermöglichen und Kosten senken. Übertragen auf die kommunalen Kliniken, müssten sie ihre Prozesse noch weiter verschlanken und etwa durch regionale Arbeitsteilung und abgestimmte Spezialisierung viel enger kooperieren. Öffentliche Träger sind in besonderem Maße der Daseinsvorsorge verpflichtet. Sie stellen deshalb ein breites medizinisches Leistungsspektrum sicher. Das gilt auch dann, wenn einzelne Bereiche dauerhaft defizitär wirtschaften. Damit übernehmen sie Verantwortung für die flächendeckende Versorgung und gewährleisten wohnortnahe Gesundheitsleistungen, die nicht allein nach Wirtschaftlichkeitskriterien
gesteuert werden. Gleichwohl müssen aber auch sie wirtschaftlich arbeiten und dürfen nicht dauerhaft rote Zahlen schreiben. Insofern wird nicht jede einzelne medizinische Leistung flächendeckend und in voller Breite angeboten werden können. Private Krankenhäuser dagegen können ihr Portfolio stärker auf planbare, gut abrechenbare und wirtschaftlich tragfähige Leistungen ausrichten, etwa in der Orthopädie oder Kardiochirurgie.
Bundesweite Datenlage
Die Beispiele aus Offenbach und Wiesbaden verdeutlichen, dass Kliniken in einer privater Trägerschaft unter gleichen äußeren Bedingungen wirtschaftlich bessere Ergebnisse erzielen können. Die vier genannten struk-
Abbildung: BS/Keilmann
turellen Faktoren (Finanzierung, Investitionskraft, Organisation und Leistungsspektrum) tragen maßgeblich dazu bei. Öffentliche Kliniken haben dagegen eine doppelte Aufgabe. Sie sichern die flächendeckende Versorgung (Daseinsvorsorge) und müssen dennoch wirtschaftlich arbeiten. Die Zukunft für kommunale Kliniken liegt in einer deutlich stärkeren Optimierung durch enge Kooperation, Arbeitsteilung und abgestimmte Spezialisierungen in den Regionen.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Klinikbericht 2024, Hessischer Landtag, Drucksache 21/1147 vom 11. Oktober 2024. Der vollständige Bericht ist kostenfrei unter rechnungshof.hessen.de abrufbar.
Zwischen Konsolidierungserfolg und Investitionsdruck
(BS/Martin Murrack) Duisburg steht exemplarisch für viele Kommunen, die sich nach tiefgreifenden Strukturwandelprozessen auf dem Weg zu finanzieller Stabilität befinden. Doch der Weg ist noch weit.
Den Höhepunkt erreichte die finanzielle Krise der Stadt 2014, als Duisburg ein negatives Eigenkapital in Höhe von 447 Millionen Euro und Kassenkredite in einer Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro verzeichnete. Erst der Stärkungspakt der rot-grünen Landesregierung in NRW leitete die Trendwende ein. Seitdem gelingt es Duisburg, finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen – z. B. in Form erfolgreicher Reduzierung der Liquiditätskredite um rund eine Milliarde Euro. Aktuell verfügt die Stadt über ein Eigenkapital in Höhe von 324 Millionen Euro. Mit der Duisburger Infrastrukturgesellschaft und der Schulbaugesellschaft Duisburg wurden effiziente Einheiten zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten geschaffen. Daneben sind Investitionen in das neue Straßenverkehrsamt und zwei neue Feuerwachen bereits umgesetzt. Auch der Ausbau von Umgehungsstraßen trägt zur Verbesserung der Verkehrs- und Lebensqualität bei. Trotz dieser Erfolge hat Duisburg seit 2025 erneut mit einer verschärften finanziellen Situation zu kämpfen. Insbesondere die Soziallasten steigen kontinuierlich und
belasten den Haushalt spürbar. Zwischen 2015 und 2024 sind die Kosten für Unterkunft um 26 Prozent, für Hilfe zur Erziehung um 127 Prozent, für die Eingliederungshilfe um 46 Prozent sowie die Personalkosten um 55 Prozent gestiegen. Dies führt dazu, dass die Mittel für dringend notwendige Investitionen in kommunale Infrastruktur und für Dienstleistungen nicht ausreichen. Investitionsrückstände, gerade in den Bereichen Schulbau, Kitas, Verkehrswege und Verwaltungsgebäude, bergen Risiken für die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich erschweren komplexe Förderprogramme und bürokratische Hürden die zeitnahe Umsetzung von Investitionsmaßnahmen. Ohne eine spürbare Entlastung und vereinfachte Zugänge zu Fördermitteln droht der Investitionsstau weiter zu wachsen.
Hemmnisse und ihre Ursachen Vor diesem Hintergrund setzt sich Duisburg gemeinsam mit anderen Kommunen für eine schnelle, unbürokratische und auskömmliche Finanzierung der kommunalen Auf-
gaben ein. Besonders wichtig sind Bundeszuschüsse, eine auskömmliche Finanzierung der Sozialleistungen und eine Altschuldenlösung. Duisburg hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass es auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt. Die aktuellen Herausforderungen machen jedoch deutlich, dass die Kommunen ohne eine angemessene Finanzausstattung aus Bundes- und Landessteuern nicht in der Lage sein werden, notwendige Investitionen in die Infrastruktur und Zukunftsfähigkeit umzusetzen. Duisburg steht deshalb stellvertretend für viele Kommunen, die auf eine solidarische, verlässliche und nachhaltige Finanzpolitik angewiesen sind, um die Lebensqualität ihrer Bürger auch in den kommenden Jahrzehnten zu sichern.

Martin Murrack ist seit 2019 Stadtdirektor und Kämmerer der Stadt Duisburg. Foto: BS/Wardeski
Das Pilotprojekt KIRA („KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre“) von RMV und Deutscher Bahn (DB) testet die selbstfahrende Technologie für den öffentlichen Nahverkehr. Damit gehen wir einen wegweisenden Schritt in Richtung Zukunft. KIRA ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg hin zu autonomen Mobilitätsangeboten im Regelverkehr, die der RMV perspektivisch in der Fläche – ergänzend zum Linienverkehr –anbieten wird.
Den ländlichen Raum autonom erschließen
Zwei von drei Menschen in Hessen leben im ländlichen Raum. Für sie wird sowohl die Nutzung des ÖPNV und damit auch der ländliche Raum als Wohnort mit autonomen Shuttles enorm an Attraktivität gewinnen. Das ist in aktuellen Zeiten ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie, aber auch notwendig, um den Wohndruck in den Ballungsräumen zu mindern. Denn da, wo heute nur eine Handvoll Mal am Tag ein Bus fährt, können fahrerlose, flexibel buchbare Shuttles Mobilität zu jeder Tagesund Nachtzeit gewährleisten. Ein Gedankenspiel: Wenn wir von den heute im RMV eingesetzten 4.500 Bussen die Hälfte bis zwei Drittel herausnehmen und stattdessen 10.000 bis 15.000 autonome Fahrzeuge mit je nach Ort bis zu 20 Plätzen einsetzen, dann lässt sich für insgesamt vergleichbare Kosten wie bisher ein bedarfsgerechteres, flexibleres und damit besseres Angebot für deutlich mehr Menschen als heute machen. Schon jetzt ist ein fast leer fahrender Linienbus im
Seitder Änderung der StVo Ende 2024 ist es für Städte und Kommunen einfacher, Verkehrsversuche zu planen und durchzuführen. Denn seither können diese auch mit Klimaschutz oder Stadtentwicklung begründet werden. Vor der Gesetzesänderung waren diese Gründe noch nicht zulässig, wie z. B. die Universitätsstadt Gießen schmerzlich feststellen musste. Der Verkehrsversuch im Anlagenring wurde noch 2023 geplant und durchgeführt. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof diesen allerdings für rechtswidrig befunden hatte, musste alles zurückgebaut werden. Die Stadt hat sich dennoch nicht unterkriegen lassen und hat andere Wege gefunden, um fahrradfreundlichere Infrastrukturen auf den Straßen einzuführen. Und während Gießen diese Änderungen schon fest umgesetzt hat – diese aber laut Aussage einer Sprecherin der Stadt noch beobachtet – sind in anderen Städten Deutschlands weitere Versuche gestartet, um autofreie Strukturen zu testen.
Myriaden an Möglichkeiten Möchte eine Stadt die aktuellen Strukturen ihrer Innenstadt überdenken und Teile Klima- und aufenthaltsfreundlicher gestalten, gibt es verschiedene Varianten. Ob Verkehrsberuhigung oder vollständige Umleitung, Einschränkung oder Umgestaltung von Plätzen: Für jede Ecke gibt es ein passendes Konzept. So wurde z. B. erst über den vergangenen August hinweg im Wiesbadener Stadtteil Biebrich am Rheinufer ein Verkehrsversuch durchgeführt. Über die Wochenenden hinweg wurde von freitags 18 Uhr bis sonntags 22 Uhr ein Teil der Rheingaustraße vor dem Biebricher Schloss für den Autound Busverkehr gesperrt und zu einer Fahrradstraße erklärt. „Das Ziel des autofreien Rheinufers ist die Erhöhung der Aufenthalts- und
RMV treibt autonomes Fahren im ÖPNV voran
(BS/Prof. Knut Ringat) Seit Mai dieses Jahres fahren im Kreis Offenbach im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) erstmals in Deutschland autonome Fahrzeuge auf Automatisierungsstufe Level 4 mit Passagieren On-Demand, also nach Bedarf. Zum September wurde das Betriebsgebiet um nördliche und westliche Stadtteile von Darmstadt erweitert.

Das KIRA-Shuttle erwartet seine Fahrgäste auch bereits am Bahnhof und verkürzt Wartezeiten für die Weiterreise. Foto: BS/RMV/DB/Oliver Lang
Betrieb auf den Fahrgast gerechnet teurer als ein On-Demand-Shuttle – selbst mit Fahrpersonal hinter dem Steuer. Große Elektro- oder Wasserstoffbusse kosten in der Anschaffung um ein Vielfaches mehr als Kleinbusse. Außerdem wirken selbstfahrende Fahrzeuge, die aus einer Leitzentrale gebündelt fernüberwacht werden, dem anhaltenden Personalmangel entgegen, mit dem Verkehrsunternehmen bundesweit ringen.
Fortschrittliche Gesetzgebung
Voraussetzung für diese Vision ist eine ausgereifte autonome Technologie. An verschiedenen Orten in der Welt funktioniert diese be-
reits. Deutschland hat eines der fortschrittlichsten europäischen Gesetzgebungen für autonomes Fahren. Das bietet die Chance, die Technologie effizient, sicher und gesellschaftlich attraktiv für den ÖPNV zu nutzen. Wenn das gelingt, sind im RMV bereits im Laufe der 2030er-Jahre autonome Mobilitätsangebote realistisch, die im Regelverkehr Bahn und Linienbus ergänzen und jeden Ort auch zu nachfragearmen Zeiten mit dem Nahverkehr anbinden.
Mit Fahrpersonal am Steuer sind im RMV bereits seit 2020 flexibel buchbare elektrische On-DemandShuttles unterwegs. Was der RMV als Projekt gestartet und jedes Jahr
mit kommunalen Partnern um lokale Angebote und Bediengebiete vergrößert hat, ist zum Jahresbeginn 2025 mit allen bis dato zehn lokalen Angeboten und insgesamt mehr als 150 Fahrzeugen in den Regelverkehr übergegangen. Wir können bereits weit mehr als drei Millionen Fahrgäste verzeichnen und stetig kommen neue Nutzerinnen und Nutzer dazu.
KIRA als Trendtester Ein breites Angebot autonomer Verkehre alleine reicht allerdings nicht aus, um die Menschen in großer Zahl zum Umstieg vom privaten Pkw zum ÖPNV zu bewegen. Entscheidend ist, wie bei jeder Innovation, dass sie den Nutzen erkennen und sich damit wohlfühlen. Daher verfolgt der RMV mit Projekten zum autonomen Fahren gleich mehrere Ziele: KIRA erprobt die autonome Fahrtechnologie und stellt der Branche die Erkenntnisse in einem Leitfaden zur Verfügung. Gleichzeitig sammeln wir gemeinsam mit den wissenschaftlichen Projektpartnern Feedback und Anregungen der Passagiere, beispielsweise zur Wahrnehmung der Fahrweise. Stand Juli 2025 sind mehr als 1.000 Nutzerinnen und Nutzer im KIRA-Projekt als Test-Fahrgäste angemeldet und zugelassen – und
Verkehrsversuche laden zum Verweilen ein
(BS/Scarlett Lüsser) Ein Rheinufer-Stück und ein Stiftsmarkt ohne Pkw-Verkehr oder ganze Straßenblöcke, die für den Fuß- und Radverkehr optimiert sind und so für eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen: Das ermöglichen Verkehrsversuche, denn so können Städte und Kommunen neue Verkehrskonzepte ausprobieren.
Lebensqualität am Ufer, vor allem auch die Reduzierung der Lärmund Luftbelastung durch den Pkwund Lkw-Verkehr“, so ein Sprecher der Stadt Wiesbaden.
Nach dem Abschluss seien die ersten Eindrücke positiv, die Evaluation dauere aber noch an. Und auch wenn der Verkehr auf den Umleitungsstrecken unproblematisch verlaufen sei und es keine Rückstaus gegeben habe, hätte es viele Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot gegeben, die möglicherweise durch stärkere Kontrollen hätten verhindert werden können. Ein längerer Verkehrsversuch wurde beispielsweise in Stuttgart u. a. in der Augustenstraße durchgeführt. Der Superblock, der zehn Häuserblocks in Stuttgart-West umfasst, lässt nur Tempo 30 zu und wurde über anderthalb Jahre getestet. Wie eine Stuttgarter Sprecherin erklärte, sei es durch den versuchsweisen Aufbau möglich gewesen, die Auswirkungen auf den fließenden und ruhenden Verkehr zu beobachten, „ohne dafür hohe Baukosten zu verursachen“. Ziel sei es gewesen, eine breite Diskussion zur Nutzung von öffentlichen Räumen anzustoßen und die Akzeptanz für ein solches Projekt zu testen. „Neben der Skepsis vor Veränderungsprozessen, gab es vor allem Kritik an zu wenig „Grün“ im Quartier“, gibt die Sprecherin an. In diesem Herbst soll der Verkehrsversuch ausgewertet werden, um dann dem Gemeinderat im ersten Quartal 2026 Vorschläge für das weitere Vorgehen vorzulegen. Selbst in der Bevölkerung habe sich das Bild vom Verkehrsversuch

samt Sandkasten bietet während des Verkehrsversuchs auf dem Stiftsmarkt in Warendorf echte Auszeit zum Verweilen für Familien. Foto: BS/Stadt Warendorf
gewandelt. Wo zu Beginn noch über die Sinnhaftigkeit des Projekts debattiert wurde, habe sich mit der Fortdauer der Fokus auf eine inhaltliche Diskussion verschoben und die kritischen Stimmen seien zurückgegangen, erläutert die Sprecherin. „Vor allem die Themen Ausstattung mit Möblierungselementen und Begrünung, Entwicklung für Gewerbetreibende und Auswirkungen auf den Verkehr standen im Vordergrund.“
Vom Auto zum Sandkasten Ein weiterer Versuch wurde im nordrhein-westfälischen Warendorf durchgefüht. Dazu sollte seit September 2024 für ca. ein Jahr der Stiftsmarkt in Freckenhorst verkehrsberuhigt werden und mit der Installation von Stadtmobiliar wie Bänken, Begrünungselementen, einem Sandkasten und einer Spieleisenbahn zum Verweilen einladen. Denn wie ein Pressesprecher von Warendorf erläutert, habe es auf dem Platz an räumlicher Gliederung im „Aufenthalts-, Park- und Bewegungsbereich“ gefehlt. Die bisherige Gestaltung habe dazu geführt, dass viele Pkw-Nutzenden den Stiftsmarkt als Abkürzung und Parkfläche genutzt hätten. Daher sollte die Aufenthaltsqualität erhöht und die Zufahrt für die Nutzergruppen aufrechterhalten bleiben. Ermöglicht worden sei die Realisierung durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Im August 2025 konnten Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Formate an der Evaluierung des Verkehrsversuchs teilnehmen. Wie der Sprecher erklärt, sei die Beteiligung gut und konstruktiv gewesen. Insgesamt sei er positiv bewertet worden und besonders die Spielangebote seien regelmäßig genutzt worden. Auch wurde „der Abkürzungsverkehr unterbunden und hat den Stiftsmarkt wesentlich ruhiger werden lassen“. Die Anregungen und Wünsche zum Stifts-
melden fast einstimmig zurück, dass sie die Fahrten als sehr sicher und angenehm empfinden. Neben KIRA forscht der RMV in weiteren Kooperationen zu autonomem Fahren. Beispielsweise haben das Industriedesign-Büro neomind, der japanische Materialhersteller Toray und der RMV 2024 das Innenraummodell-Mock-up APURE [Autonomus Vehicle for a Public [Premium] Urban RidingEcosystem] zur Visualisierung des Innenraumes eines autonomen ÖPNV-Fahrzeuges entwickelt.
Weitblick und Offenheit dafür, wie sich die Mobilität als Daseinsvorsorge und als zentrales Element unseres gesellschaftlichen Alltags und Miteinanders in der Zukunft entwickeln wird, sind essenziell. Nur wenn wir Chancen frühzeitig erkennen und nutzen, können wir die Potenziale für den ÖPNV optimal freisetzen: mit einem für Fahrgäste preislich attraktiven Tarif wie dem Deutschland-Ticket und dazu einem Angebot, dass mit autonomer Technologie rund um die Uhr schnelle, direkte und für jeden Menschen zugängliche Mobilität ermöglicht.

Prof. Knut Ringat ist seit 2008 Geschäftsführer und seit 2023 Vorsitzender der Geschäftsführung des Rhein-MainVerkehrsverbundes. Daneben ist er Vizepräsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
Foto: BS/RMV, Holger Peters
markt seien ebenfalls geprüft und für eine mögliche dauerhafte Fortführung berücksichtigt worden, so der Sprecher.
Aber wie anfangen?
Hat sich eine Kommune für einen Ort der Umgestaltung entschieden, gibt es dennoch viel zu beachten. Die Stadt Gießen hat ihre Lehren aus dem gescheiterten Verkehrsversuch gezogen und erklärt: „Nach unserer Erfahrung mit dem Scheitern des sehr groß angelegten Verkehrsversuchs sind kleinere, klar abgegrenzte Verkehrsversuche eher erfolgversprechend. Sie ermöglichen es nach unserer Wahrnehmung, konkrete Wirkungen sichtbar zu machen, Erfahrungen zu sammeln und exemplarisch Grundlagen für spätere, größere Umgestaltungen zu schaffen.“ Es sei außerdem wichtig, den gesamten Prozess von Beginn an transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Die Gründe und Ziele sollten klar kommuniziert und es sollte auch betont werden, dass es sich dabei um eine „ergebnisoffene Testphase handelt, in der Erfahrungen gesammelt und Anpassungen vorgenommen werden können“, ist die Sprecherin der Stadt überzeugt. Zusätzlich sei es gut, wenn von vornherein alle relevanten Akteursgruppen wie Anwohnende, Verkehrsbetriebe oder Schulen miteinbezogen würden.

Bundeskongress Öffentliche Infrastruktur 2026

21. – 22. Januar 2026 Hotel Adlon, Berlin
www.oeffentliche-infrastruktur.de
Besonders strikt geht die Stadt München mit dem Thema um. In der bayerischen Landeshauptstadt setzen die Behörden auf ein Genehmigungsverfahren, das bereits bei der Zulassung ansetzt. Musikerinnen und Musiker müssen ihr Können in einem Vorspiel nachweisen, bevor sie eine Sondernutzungserlaubnis erhalten. Die Stadtverwaltung berichtet auf Anfrage des Behörden Spiegel, dies habe „sich in den vergangenen Jahren als wirk sames Instrument bezüglich der Qualität der Straßenmusik“ erwie sen. Auf diese Weise soll sicherge stellt werden, dass ein Mindestmaß an Qualität vorliegt und nicht ein einzelnes Stück in Endlosschleife gespielt wird. Die Stadt begrenze die Zahl der Genehmigungen auf zehn pro Tag, aufgeteilt in Vor- und Nachmittagskontingente. Wer eine Genehmigung erhält, darf jeweils nur eine Stunde an einem Standort spielen und muss diesen anschlie ßend wechseln. Die Verwaltung sieht hierin eine wirksame Maßnah me zur Konfliktvermeidung, da An wohner und Geschäftsleute so nie länger als drei Stunden pro Woche der Darbietung desselben Künstlers ausgesetzt sind.
Der Umgang der Kommunen mit Straßenmusik
(BS/lm) In den vergangenen Jahren ist es in vielen Städten und Kommunen zu einer zunehmenden Regulierung von Straßenmusik gekommen. Die Erfahrungen aus verschiedenen deutschen Städten zeigen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen ausfallen können und welche Modelle sich in der Praxis bewährt haben.

Berlin bleibt tolerant Ganz anders geht der Berliner Bezirk Mitte vor, wo Straßenmusik als Teil des Gemeingebrauchs gilt und daher grundsätzlich erlaubnisfrei ist. Voraussetzung ist die Einhaltung klar definierter Regeln, etwa der Verzicht auf Verstärker, die Einhaltung von Mindestabständen zu Wohnhäusern, Krankenhäusern oder Schulen sowie die Beachtung bestimmter Spielzeiten. Beschwerden sind nach Angaben des Bezirksamtes selten und würden in der Regel durch direkte Ansprache gelöst. Die Verwaltung sieht hierin ein funktionierendes Beispiel für
Megafone? Kaum wirksam, wenn wichtige Durchsagen nicht alle erreichen. Telefonketten? Viel zu langsam. Und die Polizei? Die darf nicht übernehmen, denn die Verantwortung für die Besuchersicherheit liegt allein beim Veranstalter, eine Tatsache, die viele immer noch unterschätzen.
Wenn Straßenmusiker die nötige Qualität nicht mitbringen, können die vermeintlichen Künstler zum Ärgernis für anliegende Geschäfte und Anwohner werden. Viele Städte und Kommunen verschärfen daher ihre Regeln. Foto:BS/Akbarz, stock.adobe.com
Selbstregulierung, das auf klar kommunizierten Vorgaben und auf einer aktiven, aber verhältnismäßigen Ansprache basiert. Im Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelten ebenfalls die Regelungen des Landesimmissionsschutzgesetzes, doch das Ordnungsamt wird häufiger tätig, insbesondere an stark frequentierten Orten wie der Warschauer Brücke oder der East Side Galle ry. Beschwerden entstehen hier dadurch, dass der Schall über die Spree verstärkt wird und so auch
Anwohnerinnen und Anwohner auf der gegenüberliegenden Uferseite erreicht. Verstärker sind nur mit Sondernutzungserlaubnis erlaubt, bei Beschwerden schreitet die Verwaltung konsequent ein. Weimar hat sich für ein Steuerungsmodell über Anzeigepflichten entschieden. Seit 2024 müssen Musikerinnen und Musiker eine Berechtigungskarte beantragen,
sorgt und Konflikte reduziert. Zwar gab es zunächst vereinzelt Kritik seitens der Musiker, die den bürokratischen Aufwand bemängelten, insgesamt überwiegen aber die Vorteile. Die Verwaltung verweist insbesondere auf die Abnahme von
Dresden wiederum hat ein digitales Steuerungssystem eingeführt, das auf einer App basiert. Musikerinnen und Musiker können sich dort für bestimmte Standorte und Zeitfenster einbuchen. Pro Standort ist nur eine Buchung pro Tag und Musiker möglich, sodass Doppelbelegungen ausgeschlossen werden. Die Verwaltung berichtet, dass die Plätze regelmäßig ausgebucht seien, was als Zeichen für die Akzeptanz des Systems gewertet wird. Ob sich die Zahl der Beschwerden seit Einführung der App reduziert hat, lässt sich allerdings noch nicht abschließend feststellen. Der Vorteil des Systems liegt aus Sicht der Verwaltung darin, dass es eine faire Verteilung der Flächen ermöglicht und zugleich Verwaltungsaufwand reduziert.
Münster verfolgt einen pragmatischen Ansatz, indem die Stadt Straßenmusik grundsätzlich duldet, solange bestimmte Regeln eingehalten werden. Auch hier gibt es Zeitfenster für bestimmte Orte und
fall drohen Bußgelder oder sogar die Sicherstellung von Instrumenten. Die Verwaltung betont, dieses System sei sparsam, praktikabel und mit überschaubarem Kontrollaufwand verbunden.
Bei der Bevölkerung beliebt Laut einer Umfrage des MDR im Jahr 2024 sehen drei Viertel der Befragten in der Straßenmusik einen positiven Beitrag zum Stadtleben, während 16 Prozent die Musik als störend empfinden. Häufigster Kritikpunkt ist die Lautstärke, insbesondere dann, wenn dieselben Stücke über längere Zeit gespielt oder Verstärker eingesetzt werden. Damit bestätigt sich das Bild, das auch in den Rückmeldungen vieler Kommunen erkennbar ist: Straßenmusik ist grundsätzlich erwünscht, erfordert aber klare Grenzen. Aus den Erfahrungen der Kommunen lassen sich mehrere Erfolgsfaktoren ableiten. Zunächst sind klare und transparente Regeln entscheidend, die den Rahmen genau abstecken und eine weitgehende Selbstregulierung ermöglichen. Digitale Steuerungsinstrumente wie in Dresden können zusätzlich für eine faire Verteilung sorgen und entlasten die Verwaltung. Qualitätskontrollen wie in München tragen zur Akzeptanz bei, indem sie die Qualität sichern. Schließlich zeigt Berlin-Mitte, dass auch eine vertrauensbasierte Selbstregulierung mit klaren Grenzen funktionieren kann, solange die Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner in vertretbarem Rahmen bleiben. An touristischen Hotspots oder in akustisch sensiblen Lagen hingegen ist eine enge Abstimmung mit Polizei, Ordnungsdiensten und Anrainern empfehlenswert. So kann Straßenmusik auch künftig ein lebendiger Bestandteil des öffentlichen Raums bleiben.
Advertorial
(BS) Es ist ein sonniger Samstag, der Marktplatz ist voll. Tausende Menschen strömen zum Stadtfest, Familien mit Kindern, Touristen, Einheimische. Alles läuft wie geplant, bis plötzlich eine Unwetterwarnung eingeht. Innerhalb weniger Minuten
Genau hier beginnt das Problem. Nach wie vor existiert die Erwartung, dass Polizei oder Ordnungsbehörden im Ernstfall nicht nur präsent sind, sondern die operative Sicherheit für die Besucher übernehmen. Doch das ist ein Irrtum. Die Polizeigesetze verbieten es, dass die Polizei die Sicherheit der Veranstaltung organisiert und damit Aufgaben des Veranstalters erfüllt.. Genauso wenig darf die Polizei ihre Videodaten für die operative Steuerung einer Veranstaltung freigeben. Selbst im Notfall ist der Zugriff rechtlich ausgeschlossen. Veranstalter, die sich darauf verlassen, riskieren ein gravierendes Sicherheitsdefizit. Hinzu kommt ein weiteres strukturelles Problem: Event-Sicherheit wird traditionell fast ausschließlich mit Personal assoziiert. Sicherheitsdienstleister, Ordner, Streifen, das sind die klassischen Elemente, an die Kommunen denken. Technische Systeme gelten als Zusatz, nicht als Grundpfeiler. In vielen Verwaltungen fehlt das Know-how, was moderne Event-Sicherheitstechnik ist, welche Vorgaben sie erfüllen sollte und wie sie Sicherheit effizienter macht. Diese Wissenslücke führt dazu, dass technische Möglichkeiten ungenutzt bleiben und Event-Sicherheit unnötig teuer, personalintensiv und fehleranfällig ist. machen Sicherheitskonzepte auch lagen: robust, autark und unabversorgung. Sie funktioniert dort, wo Event-Technik nicht greift: auf Parkplätzen, in Zuwegungen, an MOVETOS ist ein System, welches ständig kabellos und netzautark, was nicht nur Montagepersonal reduziert, sondern auch den Auf-
bau beschleunigt und Risiken wie Stolperfallen oder Verkehrseinschränkungen vermeidet. Ein weiteres Schlüsselelement ist die Informationslage. Echtzeit-Lagebilder ermöglichen schnelle und fundierte Entscheidungen, sind aber nur dann verfügbar, wenn der Veranstalter eigene Systeme betreibt. Die weit verbreitete Annahme, die Polizei könne ihre Kameradaten einfach teilen, ist falsch. Der Datenschutz und die Polizeigesetze schließen das aus gutem Grund aus.
Auch bei der Notfallkommunikation muss neu gedacht werden. Megafone oder improvisierte Lautsprecherlösungen entsprechen längst nicht mehr dem Stand der Technik. Nur zentrale, strom- und netzautarke Durchsagesysteme bieten die notwendige Sicherheit, um im Ernstfall alle Besucher gleichzeitig und verlässlich zu erreichen. Die Erfahrungen zeigen: Wenn Kommunen auf technische, vernetzte Systeme setzen, profitieren Verwaltung, Sicherheitsdienste, Polizei und Rettungskräfte gleichermaßen. Entscheidungen werden schneller getroffen, Maßnahmen greifen früher und das Sicherheitsniveau steigt, ohne steigende Personalkosten.
Die Event-Sicherheitstechnik von MOVETOS funktioniert vollständig kabellos und netzautark und bietet dabei die nötige Robustheit für das direkte Umfeld von Events. Foto:BS/Movetos

Die Zukunft der Event-Sicherheit liegt nicht im Ausbau des Personals, sondern in der Kombination von Mensch und Technik. MOVETOS hat passende Lösungen, die speziell für die Anforderungen im öffentlichen Raum konzipiert und praxiserprobt sind. So sind Veranstaltungen auch in Zeiten von Fachkräftemangel und wachsender Bedrohungslage sicher, effizient und gesetzeskonform!
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Oktober 2025
3.–4. März 2026
www.behoerdenspiegel.de

Der bisherige Weg der ePA begann mit ihrem Beschluss im Rahmen des Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das ein Opt-out-Verfahren vorsah. Alle gesetzlich Versicherten erhielten automatisch eine eigene Akte, sofern sie nicht aktiv widersprachen. Für Konzeption, Betrieb und Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin (gemantik) zuständig. Zunächst erfolgte der Rollout in Modellregionen wie Hamburg, Franken und NordrheinWestfalen, ehe seit Frühjahr bundesweit Krankenhäuser, Apotheken und Praxen auf die Akte zugreifen und Inhalte einstellen können. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) sprach von einem „Meilenstein“, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) von einem „großen Sprung“. Bereits zu Beginn wurde jedoch auf die Notwendigkeit sorgfältiger Tests hingewiesen. Millionen Dokumente – von Befundberichten über Laborwerte bis zu Medikationsplänen – sind inzwischen in die Akten eingestellt. Dennoch zeigt sich: Während die Einführung in manchen Bereichen reibungslos läuft, bleibt die Akte z.B. in Praxen in ländlichen Regionen ein Stolperstein im Alltag.
Die ePA in der Praxis Positive Effekte zeigen sich vor allem in städtischen Einrichtungen. Ein Allgemeinmediziner aus NRW berichtet, dass durch den automatischen Import von Laborwerten und Arztbriefen Doppeluntersuchungen vermieden und Abläufe beschleunigt werden. Auch die Möglichkeit, sofort die Krankengeschichte neuer Patientinnen und Patienten einzusehen, erleichtere die Arbeit
erheblich. Ganz anders ist die Lage in ländlichen Regionen. Ein Internist aus dem niedersächsischen Wendland erklärt, dass instabile Verbindungen zur Telematikinfrastruktur den Praxisbetrieb belasteten. Dokumente ließen sich oft erst nach mehreren Minuten öffnen, teils nur nach wiederholten Versuchen. Zudem sei die Kombination mit bestehenden Praxisverwaltungssystemen umständlich, was laufende Sprechstunden verlangsame. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen auf dem Land berichteten ähnlich: Gespräche mit Patienten stocken, Termine ziehen sich, Frustration wachse.
Akzeptanz solide, Bekanntheit schwächelt
Auf Patientenseite zeigt sich ein gemischtes Bild. Laut GKV-Spitzenverband haben nur fünf Prozent der Versicherten der Einrichtung ihrer Akte widersprochen – weit weniger als erwartet. Doch Umfragen deuten darauf hin, dass die niedrige Quote nicht automatisch Zustimmung bedeutet. Eine Civey-Erhebung im Auftrag von Pharma Deutschland ergab, dass rund 15 Millionen Versicherte gar nicht wussten, dass ihnen eine Akte eingerichtet wurde. Laut einer YouGov-Studie für die Siemens-Betriebskrankenkasse haben zudem nur neun Prozent bisher mit ihrem Arzt über die Nutzung gesprochen. Die Zahlen legen nahe: Die geringe Zahl an Widersprüchen ist häufig Ausdruck mangelnder Information.
Sicherheitsarchitektur im Fokus
Die sicherheitstechnischen Aspekte sind seit Einführung der ePA immer wieder ein zentraler Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Schließlich handelt es sich bei den gespeicher-
ten Informationen um hochsensible Daten – von Befundberichten über Medikationspläne bis hin zu psychiatrischen Gutachten.
„Der Stand der Sicherheit der ePA lässt sich bestenfalls als provisorisch geflickt bezeichnen.“
IT-Sicherheits-Expertin aus dem Umfeld des CCC
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschreibt die ePA auf Anfrage des Behörden Spiegel als „auf modernsten Sicherheitsarchitekturen“ basierend und verweist darauf, dass sowohl Spezifikation als auch Implementierung eng begleitet worden seien. Die eingesetzten kryptografischen Verfahren entsprächen dem Stand der Technik und Schwachstellen würden im laufenden Betrieb gemeinsam mit der gematik bewertet und behoben. Zertifiziert sind zentrale Komponenten wie Konnektoren, Kartenterminals oder die Apps der Krankenkassen, die nach klaren Prüfkriterien zugelassen werden. Auch internationale Standards wie ISO/IEC 27001 und Protokolle wie OpenID Connect sind, laut BSI, Teil der Architektur. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) betont auf Anfrage, dass die Sicherheitsanforderungen eng mit dem BSI abgestimmt und durch unabhängige Gutachter regelmäßig
(BS/Frederik Steinhage) Sie gehört zu den zentralen Säulen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen – die elektronische Patientenakte (ePA). Zu Beginn des Jahres wurden alle gesetzlich Versicherten mit der ePA ausgestattet, im Frühjahr begann dann der bundesweite Rollout und seit Oktober ist ihre Nutzung für sämtliche Leistungserbringer verpflichtend. Dabei stellt sich die Frage, ob die ePA für diesen Schritt bereit ist und welche technischen sowie datenschutzrechtlichen Risiken nach wie vor Bestand haben.
überprüft würden. Zugriffe auf die Akten würden protokolliert, sodass Versicherte jederzeit nachvollziehen könnten, wer Dokumente eingesehen oder verändert habe. Gleichzeitig verweist das Ministerium auf Fortschritte in der Weiterentwicklung: Mit dem nächsten Release sollen neue Funktionen wie Volltextsuche und Forschungsdatenausleitung hinzukommen. Kritische Stimmen, etwa von Verbraucherzentralen oder Kryptografie-Forschenden, die auf mögliche technische Spuren und eine indirekte Nachverfolgbarkeit hingewiesen haben, weist das Ministerium zurück. So sei die Kryptografie der ePA mehrfach von verschiedenen unabhängigen Sicherheitsgutachtern geprüft und zugelassen worden. Erkannte Schwachstellen, wie sie etwa der Chaos Computer Club hervorgehoben hatte, seien in enger Zusammenarbeit mit der gemantik und dem BSI aufgearbeitet und technisch gelöst worden.
Kritik an Zugriffskontrollen und Datenhaltung
Das Team aus dem Umfeld des CCC, welches sich mit der Sicherheitsarchitektur der ePA beschäftigt hat, bewertet die Sicherheitsarchitektur hingegen deutlich kritischer. „Der Stand der Sicherheit der ePA lässt sich am besten als provisorisch geflickt bezeichnen“, lautet die kritische Einschätzung der Forschenden. Zwar seien gravierende Lücken geschlossen worden, jedoch oft nur notdürftig. Besonders die Authentifizierung über die elektronische Gesundheitskarte habe sich wiederholt als anfällig erwiesen. Im Frühjahr zeigte der CCC, dass eine als behoben geltende Schwachstelle erneut umgangen werden konnte – ein Beispiel für
nach Ansicht der Organisation mangelhafte und intransparente Entwicklungsprozesse. Auch altbekannte Probleme wie das Erlangen von Karten über Social Engineering seien nicht ausgeschlossen. Als größtes Risiko sehen die Experten die weitreichenden Zugriffsrechte aller Leistungserbringer: „Das System ist nur so sicher wie die am schlechtesten gesicherte Praxis oder Klinik.“ Hinzu komme die zentrale Datenhaltung, bei der ein Fehler potenziell maximalen Schaden verursachen könne. Auch Metadaten und mögliche Bewegungsprofile blieben ein ungelöstes Problem.
Eine Frage der Transparenz Die elektronische Patientenakte tritt kurz vor ihrer verpflichtenden Einführung in eine entscheidende Phase, in der nicht nur Stabilität und Akzeptanz, sondern auch die Weiterentwicklung im Fokus stehen. Schon jetzt laufen Vorbereitungen für Funktionen wie eine Volltextsuche oder die kontrollierte Nutzung von Forschungsdaten, die das BMG in Aussicht gestellt hat. Parallel wird auf EU-Ebene am Europäischen Gesundheitsdatenraum gearbeitet, in den die deutsche ePA künftig eingebettet sein soll. Damit steigen auch die Anforderungen an Interoperabilität und internationale Standards, etwa beim sicheren Datenaustausch über Ländergrenzen hinweg. Während BMG und BSI hier auf kontinuierliche Anpassung der Kryptografie und künftige Quantenresistenz verweisen, mahnen Kritiker unabhängige Prüfungen und offene Entwicklungsprozesse an. Ob die ePA zu einer stabilen Infrastruktur reift, hängt also nicht nur von technischen Fragen ab, sondern auch von der Transparenz der Weiterentwicklung.
„Magdeburg ist eine Sportstadt“, so Dr. Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, in ihrer Eröffnungsrede. Die Champions-League-Siege der Handballer des SC Magdeburg oder die Erfolge der Schwimmerin Antje Buschschulte – mittlerweile passenderweise Digitalreferentin in der Staatskanzlei – untermauern diese These. Sportlich und ambitioniert jedenfalls werde in der Landeshauptstadt auch die Digitalisierung angegangen. Hüskens will erfolgreich sein, erklärt sie, in der inoffiziellen Digitaltabelle der Bundesländer nach oben klettern. Momentan befinde sich Sachsen-Anhalt „im Mittelfeld“. Bei den Netzen verzeichne das Land Erfolge, beim Breitbandausbau wie beim Mobilfunk. In der Verwaltungsdigitalisierung gehe es ebenfalls voran. Ein Beispiel ergänzt Landes-CIO Bernd Schlömer (FDP): die Energiepreispauschale, die als 200-Euro-Einmalzahlung an Studierende „Ende-zu-Ende-digitalisiert“ ausgezahlt und von anderen Bundesländern nachgenutzt worden sei.
Kleine, einfache Lösungen Nachnutzung ist ohnehin eines der großen Themen zwischen den Ländern. Dabei müssen es nach Meinung von Sven Thomsen, CIO von Schleswig-Holstein, nicht immer die hochkomplexen Projekte sein, bei denen zusammengearbeitet wird. Vielmehr sei er „ein Fan von kleinen, einfachen Lösungen“. Alles, was „nervig ist, wenn man nur dafür aufs Amt gehen muss“, solle bei der Digitalisierung priorisiert werden –etwa die Beantragung eines Anwohnerparkausweises. Der Chief Digital Officer des nördlichsten Bundeslandes wird noch deutlicher: „Wir müssen keine Prozesse definieren, die ein- oder zweimal im Leben eines Bürgers relevant sind, sondern uns fragen: ‚Wo ist die längste Schlange im Bürgerbüro?‘ Dort müssen wir ansetzen.“ Lange Schlangen waren und sind auch in Kfz-Zulassungsbehörden keine Seltenheit. Abhilfe schafft die Online-Kfz-Zulassung, die in Baden-Württemberg als EfA-Projekt (Einer für Alle) umgesetzt wurde. Nur das Nummernschild müsse noch physisch besorgt werden, erklärt Landes-CIO Stefan Krebs, der damit einen entscheidenden, auch die Bundesebene betreffenden Aspekt anführt. Die Nutzungsquote der besagten iKfz4-Lösung liegt laut
Digitale Kooperationen treffen in Magdeburg aufeinander (BS/cb/fst) Gemeinsam digital – so das Motto des diesjährigen Nordl@nder-Kongresses – wollen die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie die Flächenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt agieren. Die bekannten Probleme der Digitalisierung machen auch vor dem Norden der Republik nicht Halt. Doch Kooperationen, Wissenstransfer und Nachnutzung tragen Früchte.

Dr. Lydia Hüskens, Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, sieht den Digitalisierungsfortschritt der Länder kompetitiv und zugleich kooperativ.
Krebs nämlich bei nur zehn Prozent. Als Grund dafür sieht der CIO des „Ländles“ den Zeitpunkt, an dem ein Großteil der User den Online-Vorgang abbreche: bei der Anmeldung per eID, also mit elektronischem Personalausweis oder BundID. Ein Problem, das nicht neu, aber nach wie vor elementar ist. Ohne die flächendeckende bundesweite Nutzung eines elektronischen Identitätsnachweises wird es jede noch so gute digitale Verwaltungslösung schwer haben, in die Fläche zu kommen.
Föderalreform dank Technologie
In Mecklenburg-Vorpommern wiederum gebe es ein anderes „Highlight“: den digitalen Bauantrag, der „mit der Hilfe des Bundes end to end“ digitalisiert worden sei, berichtet Marco Anschütz, Abteilungsleiter Digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur und Geoinformation im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung. Anschütz prognostiziert, dass das technologische Zusammenwirken der Länder in naher Zukunft etwas bewirke, das meist auf rechtlicher Ebene diskutiert

Foto: BS/Bildschön
werde: eine organisch wachsende Reform des föderalen Systems –eine „technologiebasierte Föderalreform“.
Eigentlich nicht offizieller Teil des Panels, erweiterte Bremens CIO Carola Heilemann-Jeschke ebendieses spontan und nutzte die Chance, um dem digitalen "Geben-und-nehmen-Shop" ein weiteres Produkt hinzuzufügen. Ihren Kolleginnen und Kollegen bot sie die Leistung ELFEconnect zur Nachnutzung an. Der von Bremen aufgesetzte Dienst kombiniert diverse Anträge wie Elterngeld, Kindergeld und Geburtsurkunde in einer digitalen Lösung.
Bedürfnisse erkennen, Orientierung geben
Am Ende des Tages müssen die digitalen Synergien zwischen den Ländern in deren Kommunen ankommen. Das wird im öffentlichen Sektor immer wieder betont. Die Hauptaufgabe der Länder liege darin, „die spezifischen Bedürfnisse der Kommunen zu erkennen und gezielt Unterstützung zu bieten“, formuliert es Sven Czekalla, Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt
„Wo ist die längste Schlange im Bürgerbüro? Dort müssen wir ansetzen.“
Sven Thomsen, CIO von Schleswig-Holstein
pulation – daraus wiederum ergebe sich immer wichtiger werdender Datenschutz. Dieser werde gerade in den Kommunen oft als Hemmschuh wahrgenommen, wo die Anforderungen als komplex und schwer umsetzbar gälten. Maria Christina Rost, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt, stellt klar, dass dieser Eindruck nicht verfangen dürfe: „Datenschutz ist ein natürlich hineingewachsener Aspekt der Digitalisierung. Es gilt, ihn den Verantwortlichen nahezubringen, zu erklären und ihnen die Angst davor zu nehmen“, betonte sie. Der Schutz der Daten müsse von Anfang an mitgedacht werden anstatt Projekte an fehlendem Wissen scheitern zu lassen.
Analoger Demokratieschutz
und digitalpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Dazu gehöre auch eine umfassende Kompetenzoffensive für Mitarbeitende in Verwaltungen. Ebenso müsse bei jedem Prozess kritisch geprüft werden, wie viele Daten tatsächlich erforderlich seien, nicht zuletzt, weil mit wachsendem Datenvolumen auch die Risiken stiegen. Die Kommunen dürften zudem nicht das Gefühl bekommen, dass ihnen „zentral entwickelte Konzepte übergestülpt“ würden, so Sebastian Striegel, digitalpolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt. Konstantin Pott wiederum, FDP-Abgeordneter im Landtag und Mitglied des Ausschusses für Infrastruktur und Digitales, mahnt, dass Parlamente und Regierungen als Vorbilder auftreten müssten: „Wir kriegen es teilweise selbst nicht einmal hin, Dokumente digital zu signieren und einzureichen. So können wir keine Guidance für unsere Kommunen schaffen.“ Für Pott ist klar: Nur wenn die Länder selbst digitale Arbeitsweisen konsequent vorleben, könnten sie überzeugend Orientierung für Kommunen und Verwaltungen geben.
Datenschutzängste nehmen Mehr und sensiblere Daten bedeuten mehr Angriffsfläche für Mani-

Prof. Dr. Jana Dittmann, Leiterin der Arbeitsgruppe Advanced Multimedia und Security (AMSL) an der Fakultät für Informatik der Universität Magdeburg, ordnet aktuelle Cyber-Angriffsmuster aus wissenschaftlicher Perspektive ein.
Bernd Schlömer, neben seiner Rolle als CIO Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales sowie Co-Gastgeber der Veranstaltung, machte klar, dass die klassische analoge Verwaltung auch in Zeiten dringlicher Digitalisierung noch eine Rolle spiele. Sachsen-Anhalt wolle bei der Digitalisierung bewusst nicht alles zentralisieren. Der Grund sei kein technischer, sondern ein politischer. Denn es gebe in Deutschland „Parteien, die davon profitieren, zu sagen: Seht her! Es kümmert sich keiner mehr um euch, alles wird in Berlin gemacht“. Daher sei es wichtig, ausgewählte Verwaltungsservices weiterhin analog im Amt vor Ort anzubieten – für das „demokratische Erleben“ der Bürgerinnen und Bürger. Dass alle Mittel da seien, um „bürgernah zu zentralisieren“, betonte Marco Anschütz ebenso wie Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender des Dienstleisters Dataport, der für die IT-Infrastruktur der sechs „Nordl@ nder“ essenziell ist. Auf Sicht muss beides möglich sein, in der Verwaltung von morgen koexistieren wie kombiniert werden können. Kooperation sei der Weg dorthin und dürfe durchaus als eigener Erfolgsfaktor betrachtet werden, wie Martin Schallbruch, CEO der Genossenschaft govdigital und laut eigener Aussage „im Backoffice der Verwaltung“ tätig, erklärte. Bei „800 Kunden, die Mitglied in der Deutschen Verwaltungs-Cloud sind“, sei die Erfolgsfrage „Wie gut wird kooperiert?“ maßgeblich und wertvoll. „Wir müssen gemeinsam digitalisieren“, so Schallbruch, der damit das Motto von Nordl@nder 2025 noch mal auf den Punkt brachte.

Im Rahmen des Presseabends vor dem Kongress wurden digitale Innovationen – und deren kluge Köpfe dahinter – mit einem Innovationspreis geehrt.

Janine Werner, Landeskoordinatorin für Registermodernisierung in Rheinland-Pfalz, betont die zentrale Bedeutung einer einheitlichen Governance bei der Umsetzung der RegMo.
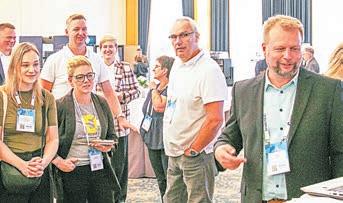
Netzwerken und informieren: Die neuesten Tools und Services für die digitale Verwaltung sind in der Fachausstellung zu begutachten.

Wie KI gegen Fachkräftemangel helfen kann, erläuterten Patrick Schubert (rechts) und Nicolas Mertens von Google Cloud.
„Das Geld fließt vom Bund zu den Ländern und ganz am Schluss zu den Kommunen“, beschreibt Prof. Dr. Ariane Berger , Geschäftsführerin des Landkreistages Sachsen-Anhalt, die föderale Logik der Mittelvergabe. Dieses Top-down-Prinzip verhindere, dass Städte und Gemeinden gezielt in dringend notwendige Bereiche investieren könnten. Kommunen müssten deshalb stärker befähigt werden, eigenständig Schwerpunkte zu setzen. Als einen vielversprechenden Ansatz nennt Berger das Infrastruktursondervermögen, aus dem Anteile von den Ländern an die Kommunen weitergegeben würden. Dabei werde auf die örtlichen Bedürfnisse geschaut, sodass Mittel dort ankämen, wo sie am dringendsten gebraucht würden. Gleichzeitig wachse für die kommunalen Spitzenverbände die Aufgabe, sich enger miteinander abzustimmen. Nur wenn gemeinsame Standards in zentralen Bereichen entwickelt würden, könnten Geldanlagen nachhaltig wirken. „Investitionen können nur im Zusammenspiel mit klar definierten Leitlinien effektiv greifen“, betont Berger
Zunächst einmal muss die Kirche im Dorf – genauer gesagt: in der Kommune – gelassen werden. In der öffentlichen Verwaltung gehe es nämlich „um Automatisierung, nicht um KI“. Das machte Sachsen-Anhalts CIO Bernd Schlömer klar. Automatisierung wiederum funktioniere vor allem dann, wenn „keine Sachbearbeitung“ vonnöten und „keine Ermessensspielräume“ vorhanden seien. Als Beispiel nannte Schlömer die automatisierte 200-Euro-Einmalzahlung an Studierende.
Ein echter Paradigmenwechsel wäre „echte KI“, also eine lernende und sich selbst kontrollierende, wie Patrick Brauckmann, Bereichsleiter Portfoliomanagement bei msg Public Sector, betonte. Ob automatisierter Prozess oder HochleistungsKI, entscheidend sei ohnehin die „Geschwindigkeit der Leistung“, so Brauckmann. Geschwindigkeit
Von Investitionsklima bis Wissensaustausch
(BS/Frederik Steinhage/Scarlett Lüsser) Die digitale Transformation stellt Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt vor tiefgreifende Veränderungen. Verwaltung, Bürgerbeteiligung und Infrastruktur müssen neu gedacht werden, um den Anforderungen einer modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Doch vielerorts stockt der Prozess – nicht zuletzt, weil Investitionen in digitale Projekte oft zu spät oder an den Bedürfnissen der Kommunen vorbei erfolgen.

Prof. Dr. Ariane Berger, Geschäftsführerin des Landkreistages Sachsen-Anhalt, möchte ein gesundes Investitionsklima in den Kommunen fördern.
Entscheidend sei daher eine Balance: ausreichendes Investitionsvolumen, Vertrauen seitens der Länder und eine bessere Koordination zwischen den Kommunen.
So könne ein Klima entstehen, das den bisherigen Ansatz von oben nach unten ablöse und stattdessen auf Skalierbarkeit und Praxistauglichkeit setze. Digitalisierung auf
kommunaler Ebene werde damit nicht nur planbarer, sondern auch wirksamer. Da sei Kommunikation aber ein wichtiger Faktor, erklärt Steven Kiewert , der im Landkreis Harz als Leiter der Stabsstelle Digitalisierung tätig ist. Diese müsse reibungslos „sowohl horizontal, also zwischen den Kommunen untereinander, als auch vertikal zwischen den Kommunen und dem Land“ funktionieren. Zudem müsse das EfA-Prinzip auch auf Landesebene angewendet werden. Von konkreten Erfolgen und Herausforderungen berichtet Claudia Thiele, die Referentin für Digitalisierung im Landkreis Wittenberg. Durch das Projekt Gemeinsam Digital für Sachsen-Anhalt (GDST) sei ein starkes Netzwerk zwischen Land und Kommunen für einen regen Austausch entstanden. Thiele
Kommunale KI als Gemeinschaftsaufgabe
(BS/sl/cb) Während die Wirtschaft weltweit Milliarden in die Forschung und Entwicklung von KI investiert, müssen sich die Kommunen anders behelfen – in Sachsen-Anhalt sowie bundesweit. Dabei können fehlende Budgets zu mehr Kreativität, Austausch und Kooperation führen. Von strengen Datenschutzregeln befreit dieser Ansatz selbstredend nicht.
führe nicht nur zu mehr Effizienz in der Verwaltung, sondern auch zu mehr Vertrauen seitens der Bürgerinnen und Bürger in ebendiese.
Goldschatz Datensatz
Dr. Christian Ege, Staatssekretär für Wirtschaft und CIO der Landesregierung des Saarlands a. D. sowie Gründer der Bürokratieabbauinitiative BürokratEASY, verfolgt pragmatische und konsequente Ansätze. Bevor man über den konkreten Einsatz von KI nachdenke, müsse man die Menschen in der Verwaltung einfach fragen: „Was braucht ihr?“ – und davon

Niels Kohrt, Prozessmanagement-Experte bei Picture, erklärt, wie man durch eine effektive Modellierung, Analyse und Austausch gängige Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, eindämmen kann.
ausgehend versuchen, Bürokratie abzubauen und zu digitalisieren. Eges Credo, das auch in seinen Verwaltungs-Comics immer wieder zu Tage tritt ( siehe Seite 5 ): „Rechtlich verzichtbar ist amtlich überflüssig.“
Klar ist: Ohne Daten geht in Sachen KI nichts. Daten, die Sprachmodelle trainieren und in diesem Prozess auf „kommunale Bedürfnisse“, welche sich regional unterscheiden können, angepasst werden müssten, wie Prof. Dr. Karin Küffmann , Professorin für Wirtschaftsinformatik bei URBAN.KI, erklärt. Ihrer Erfahrung nach
sind die Kommunen bei der Entwicklung von KI-Lösungen sehr engagiert, aber eben auf Datensätze angewiesen – die sie untereinander austauschten.
Wo Daten sind, muss Datenschutz sein. Maria Christina Rost, Landesbeauftragte für den Datenschutz in ST, hört dabei Stöhnen aus der Verwaltung. Oft hieße es: „Datenschutz ist zu kompliziert, stoppt Innovationen und verhindert den Fortschritt.“ Dabei ist Rost sicher, dass Datenschutz und Fortschritt zusammengehen können und müssen. An die Umsetzenden richtete sie einen Appell: Datenschutz sei

Registermodernisierung bei der FITKO, moderiert einen Workshop zu Deutschlands digitalem Großprojekt.
kennt ihre „Pendants aus anderen Landkreisen“ und kann so schnell erfahren, woran andere arbeiten oder um Hilfe bei den eigenen Problemen bitten. Auch der direkte Draht zum Land sei hilfreich, um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben und eine effektive Nachnutzung von erfolgreichen Projekten zu ermöglichen. Damit biete das GDST eine gute Wissensgrundlage für die Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung in SachsenAnhalt.
Was aber auch nicht fehlen dürfe, seien Innovationen. Doch gerade bei innovativen Ideen, die vielleicht an der klassischen Verwaltung vorbeigehen, sei es schwierig, die zumeist klammen Kommunen von einer Finanzierung zu überzeugen. Dafür seien Fördertöpfe unabdingbar, findet Dr. Tim Hoppe, Leiter des Amts für Statistik, Wahlen und Digitalisierung der Stadt Magdeburg. „Ich bin ein großer Freund von Prove of Concepts; dass man einfach in einem kleinen Rahmen testen kann, ob etwas wirklich Erfolgsaussichten hat, bevor man es im großen Stil einführt.“ So könnten auch Kommunen zeigen, dass sie fähig sind, innovative Projekte umzusetzen.
eine „Chance für KI“. Wichtig sei Datentransparenz. Wer mit KI wie Chat-GPT arbeite, habe mit Sicherheit schon Fehler entdeckt, so Rost. Hier müssten sich Nutzende im ÖD erklären, wie das Programm etwas hergeleitet habe, damit Fehler behoben werden können. Den Beweis, dass datenschutzkonforme KI-Modelle in der Verwaltung funktionieren, lieferte Frank Becker, Rechtsreferent und Datenschutzbeauftragter der Senatskanzlei Hamburg. Becker demonstrierte LLMoin, den KIAssistenten aus Hamburg, der z. B. Recherche oder Zusammenfassungen bietet. Dabei sorgten getrennte Verantwortlichkeiten, nicht SaaS, für vereinfachte Verträge und weniger Sorgen bei der Nachnutzung. Wer Strukturen nicht mitaufgebaut habe, übernehme ungern Verantwortung, so Becker

Symbolisch übergibt Sachsen-Anhalts CIO Bernd Schlömer (rechts) den Staffelstab-Leuchtturm an
Behörden Spiegel: Frau Dr. Dylakiewicz, wie fließt die Expertise aus Ihrer vorherigen Position in Ihre aktuelle Rolle ein?
Dr. Daniela Dylakiewicz: Aus meinen bisherigen Tätigkeiten bringe ich viele Erfahrungen aus den Bereichen Organisation, Personal, Haushalt und IT mit und nutze sie, um die Verwaltung zukunftsfest zu machen und so das Vertrauen in den Staat, sein Handeln und letztlich in die Demokratie zu stärken. Organisation, Personal, Haushalt und IT gehören in einer Zentralabteilung untrennbar zusammen. Dieses Modell habe ich auf den CIO-Bereich der Sächsischen Staatskanzlei übertragen und die Themen Verwaltungsmodernisierung und Digitale Verwaltung in einer Abteilung gebündelt.
Behörden Spiegel: Der Satz „Mach was Wichtiges“ ziert Ihr LinkedInProfil. Was ist für Sie das Wichtigste, damit Länder und Bund digital vorankommen?
Dylakiewicz: Die digitale Transformation der deutschen Verwaltungen wird oft als Marathonlauf beschrieben. Das ist zutreffend, aber auch bei einem Marathon will man irgendwann mal ins Ziel kommen. Ich bewerte hier viele Ansätze von Bundesdigitalminister Dr. Wildberger positiv: Deutschland-Stack, Blaupausen für Digitalisierungsprojekte, mehr gemeinsame Standards – das sind alles signifikante Signale, dass der Bund mehr digitalpolitische Verantwortung übernehmen will. Ich unterstütze das.
Behörden Spiegel: Welche Rolle spielen die sächsischen Kommunen dabei?
Dylakiewicz: Auch in Sachsen setzen wir auf Geschwindigkeit und Flächendeckung bei digitalen Leistungen. Der Schlüssel sind hier unsere sächsischen Kommunen: Wir unterstützen sie weiterhin organisatorisch, technisch und finanziell – etwa durch die Bereitstellung von EfA-Diensten, bei der Ende-zu-EndeDigitalisierung kommunaler Dienste, der Anbindung von Fachverfahren und der Registermodernisierung.
Sachsens CIO setzt auf Geschwindigkeit und Flächendeckung (BS) Sie leitete die Abteilung Verwaltung und Recht im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft – und hat ihrem Erfahrungsschatz noch das Digitale hinzugefügt: Dr. Daniela Dylakiewicz ist die Amtschefin der Sächsischen Staatskanzlei und die Beauftragte für Informationstechnologie (CIO) des Freistaates Sachsen. Im Interview erklärt sie die Bedeutung der Kommunen für die Digitalisierung, warum das Land Cyber-Sicherheitsrichtlinien übererfüllt und nach welchen Kriterien über Nachnutzung entschieden wird. Das Interview führte Dr. Eva-Charlotte Proll.

Behörden Spiegel: Sachsen nutzt den Service Wohnanmeldung aus Hamburg. Wie sieht für Sie ein sinnvolles Verhältnis von Nachnutzung und Eigenentwicklung aus?
Dylakiewicz: Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) galt für uns von Anfang an der Leitsatz: Die beste Lösung kommt zum Zug – unabhängig davon, ob es EfA-Dienste, Herstellerlösungen oder Eigenentwicklungen sind. Wir wägen nach folgenden Kriterien ab: Gibt es überhaupt einen EfADienst? Was bietet ein Dienst bzw. eine Anbieterlösung? Welche Verwaltungsleistungen sind umfasst? Wie sieht es mit den Schnittstellen bzw. der Anbindung an vorhandene Fachverfahren aus? Welche Kosten







entstehen – auch langfristig? Klar ist: Wenn verschiedene Lösungen nach diesen Kriterien gleichwertig sind und sich gut in die bestehende kommunale Verfahrenslandschaft integrieren lassen, ist die EfA-Lösung zu bevorzugen.
Behörden Spiegel: Wo steht das Land Sachsen bei der Nutzung von KI?
Dylakiewicz: Der Freistaat hat sich bereits Ende 2021 als eines der ersten Bundesländer eine umfassende KI-Strategie gegeben. Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung ist hierbei ein Schwerpunkt. Wir haben bereits grundlegende, ressortübergreifende Regelungen zur Nutzung von KI in der Verwaltung getroffen sowie entsprechende Strukturen geschaffen.
Dazu gehört beispielsweise die Kompetenzstelle KI in der Digitalagentur Sachsen (DiAS), um Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander zu vernetzen.
Zudem haben wir einen KI-Stammtisch initiiert, der dem fachlichen Austausch dient. Einzelne Behörden testen bereits KI-Lösungen, die auf unterschiedliche fachliche Einsatzgebiete ausgerichtet sind, wie etwa im Dokumentenmanagement, bei der Bild-/Mustererkennung sowie bei Chatbots und Assistenzsystemen.
Behörden Spiegel: Wie prognostizieren Sie die KI-Entwicklung in den kommenden Jahren – in Sachsen und generell?
„Wenn verschiedene Lösungen (…) gleichwertig sind, ist die EfA-Lösung zu bevorzugen.“
trauen aufbauen. Konkret bedeutet das: Wir erwerben entsprechende Infrastruktur und schreiben einen Rahmenvertrag zur Beschaffung von externen Beratungsleistungen für Konzepte, Schulungen, Anwendungsentwicklungen aus, den alle Ressorts nutzen können. Wir bauen ein KI-Verzeichnis der in der sächsischen Verwaltung eingesetzten KI-Systeme auf, um Synergien zu schaffen. Wir stärken Vertrauen und Transparenz, indem wir KIAnwendungen so gestalten, dass sie erklärbar, nachvollziehbar sowie rechts- und wertekonform sind. Zudem sorgen wir für die nötigen Kompetenzen in der Verwaltung, beispielsweise durch digitale Schulungsangebote.
Behörden Spiegel: Welche Fortschritte hat Sachsen in den vergangenen Jahren mit Blick auf ITSicherheit gemacht?
Dylakiewicz: Rückblickend profitieren wir weiterhin von der klugen Entscheidung, im Jahr 2019 ein Sächsisches Informationssicherheitsgesetz in Kraft gesetzt zu haben, lange bevor die NIS-2-Richtlinie der EU das Thema in das öffentliche Bewusstsein gerückt hat. Damit haben wir die Organisation der Informationssicherheit im Land sowie in den Kommunen nachhaltig professionalisiert. Die Einführung hauptamtlicher IT-Sicherheitsbeauftragter in allen großen Behörden, auf Landkreisebene und in großen Städten hat die IT-Sicherheit entscheidend gestärkt. In unserem gemeinsamen Behördennetz haben wir die Schutzmaßnahmen kontinuierlich erweitert, z. B. durch ein zentrales SOC/SIEM und durch Verstärkung unseres zentralen Computernotfallteams SAX.CERT. Damit sind wir den erweiterten Anforderungen aus der NIS-2-Richtlinie zuvorgekommen.
Behörden Spiegel: Mit oder ohne NIS-2 – die Cyber-Bedrohung wird in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Wie sind Sie vorbereitet?


Dylakiewicz: Für die kommenden Jahre ist es unser Ziel, den Einsatz von KI fest in der Verwaltung zu verankern. Die Erwartungen sind hoch: Richtig eingesetzt kann KI das Verwaltungstempo erheblich steigern. Sie hat das Potenzial, Routinen zu automatisieren, Beschäftigte zu entlasten und datenbasierte Entscheidungen zu unterstützen. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen können von schnelleren, rund um die Uhr verfügbaren Antworten profitieren. Allerdings ist der Weg dorthin kein Selbstläufer. Wir müssen parallel Infrastruktur, Wissen und Ver-
Dylakiewicz: Den Blick nach vorn haben wir vor allem mit der Cyber-Sicherheitsstrategie Sachsen geschärft, die wir im Mai im Kabinett verabschiedet haben. Sachsen bündelt erstmals alle Aktivitäten zum Schutz vor digitalen Bedrohungen. Die Ziele sind, die Angriffsfläche zu reduzieren, die digitale Resilienz zu erhöhen und das Sicherheitsbewusstsein zu stärken.
Behörden Spiegel: Was brauchen die sächsischen Kommunen mit Blick auf die IT-Sicherheit am dringendsten und wie unterstützen Sie diese dabei?
Dylakiewicz: Die Digitale Verwaltung kann nur dann Erfolg haben, wenn die IT sicher organisiert ist und dort funktioniert, wo Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen davon profitieren und dadurch einen Mehrwert spüren. Und da spielen die Kommunen eine zentrale Rolle: Hier laufen die mit Abstand meisten Verwaltungsleistungen und Austauschbeziehungen. Deshalb ist mir die IT-Sicherheit von Kommunen besonders wichtig. Auch und gerade weil es hier keine Lösungen gibt, die für alle passen, weil die Kommunen sehr unterschiedlich aufgestellt sind, ist es unser Ansatz, viele unterschiedliche Pakete an Unterstützung zu schnüren. Die Unterstützung besteht aus drei Säulen: klare Regeln, starke Infrastruktur und praktische Hilfen. Wir verbinden Wissen, Technik und Schutz in einem Netzwerk.
Behörden Spiegel: Wie stellt sich das konkret dar?
„Die Unterstützung der Kommunen besteht aus drei Säulen: klare Regeln, starke Infrastruktur und praktische Hilfen.“
Dylakiewicz: Durch das Sächsische Informationssicherheitsgesetz ist jede Kommune verpflichtet, einen Beauftragten für Informationssicherheit zu benennen. Damit ist das Thema verankert, es wurden Ansprechpartner geschaffen und Menschen, die sich persönlich für Informationssicherheit einsetzen. Damit besteht ein Netzwerk an Expertise, mit dem sich das Sicherheitsniveau in der Verwaltung spürbar weiterentwickelt hat. Die sichere Basis-Infrastruktur besteht aus dem Sächsischen Verwaltungsnetz und Kommunalen Datennetz, welche von der Kommune bis zur Staatskanzlei allen dieselben technischen Schutzmaßnahmen bereitstellen. Diese Maßnahmen werden vom Freistaat gemeinsam mit der kommunalen Seite fortwährend optimiert. Zur Unterstützung der Kommunen zählen die Sicherheitsservices des SAX.CERT – vom Webseitenscan, Warn- und Informationsdienst bis hin zu spezielleren Diensten wie dem Leak-Checker oder dem digitalen Einbrucherkennungssystem HoneySens – die alle Kommunen kostenlos beziehen können. Zudem bieten wir als Staatsverwaltung Sensibilisierungs- und OnlineSchulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit an, die auch von den Bediensteten der Kommunen kostenlos genutzt werden können.
Die Cyber-Sicherheitsstrategie umfasst neun Handlungsfelder und bindet alle Beteiligten in Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft ein. Neben langfristigen Zielen enthält sie auch konkrete Maßnahmen, an denen sich die Staatsregierung messen lassen möchte. So sollen staatliche Einrichtungen jährlich Sensibilisierungsmaßnahmen für 5.000 Bürgerinnen und Bürger durchführen oder unterstützen. Darüber hinaus führen die Behörden des Freistaates Sachsen und der Kommunen jährlich Veranstaltungen oder ELearning-Angebote zur Informationssicherheit durch, die mindestens 10.000 Bedienstete erreichen sollen.
Geese sprach im Rahmen des Informatik Festivals 2025 in Potsdam. Die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik (GI) stand unter dem Motto „The Wide Open: Offenheit von Source bis Science“. Offen demonstriert auch Russlands Präsident Wladimir Putin seine völkerrechtswidrigen Machtansprüche und seine Provokationen gegen den Westen – jüngst mit russischen Drohnen über Polen, was Geese zufolge einmal mehr zeige, wie sehr sich Europa zwischen Russland und den USA, die nicht mehr der Bündnispartner früherer Tage seien, „in der Zange befindet“.
„Die Rolle der Tech-Giganten: Daten sammeln und überwachen.“
Alexandra Geese, Mitglied im Europäischen Parlament
Diesen Umstand rechnet die Europa-Parlamentarierin nicht nur der Trump-Administration und deren Politik zu, sondern vor allem auch „den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley“. Dass etwa Freiheit und Demokratie nicht kompatibel seien, führt sie als Zitat des deutschstämmigen US-Tech-Milliardärs Peter Thiel an. Thiel gilt als einer der engsten Vertrauten des US-Präsidenten und Drahtzieher der rechtskonservativen Agenda, welche die
Digitale Infrastruktur soll Europas Sicherheit gewährleisten
(BS/cb) „Wir stehen an einem Scheideweg“, sagt Alexandra Geese (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied im Europäischen Parlament und u. a. im Sonderausschuss für den Europäischen Schutzschild für die Demokratie. Um diese Demokratie sowie Europas Datensouveränität zu schützen, habe die EU eine klare Strategie: „Buy European“.

Globale Offenheit in Sachen digitaler Infrastruktur bei eigener IT-Produktion und Vergabe: Europas Weg zu digitaler Souveränität und Sicherheit ist ein Balanceakt.
Vereinigten Staaten derzeit prägt und den libertären Tech-Unternehmen, deren CEOs sich jüngst zum Lobeshymnen- und DanksagungsDiner mit Trump versammelten, in die Karten spielt. Die Rolle dieser Unternehmen ist Geese nach klar: „Daten sammeln und überwachen.“
Wut kreieren, Macht erhalten Diese Rolle sei jedoch nicht die einzige, die den Betreibern der VLOPs (Very Large Online Platforms) zufalle, erklärt Geese
KOMPETENZZENTRUM ÖFFENTLICHE IT (ÖFIT)
Digitalisierung:
kommunaler
(BS/Dorian Wachsmann*) Nachhaltigkeit kommt mit einem umfassenden Anspruch daher. Wie sich dieser Anspruch ganz konkret bei Digitalisierungsprojekten adressieren lässt, zeigen Beispiele aus der kommunalen Praxis. Nachhaltigkeit ist dabei nicht mehr nur eine "überbordende" Zusatzanforderung, sondern wird zum handlungsleitenden Prinzip.
Digitalisierung macht auch vor Insektenvölkern nicht halt: Im Kreis Recklinghausen wurde das Projekt „digitaler Bienenstock“ durchgeführt, um gegen das Bienensterben angehen zu können. Über Sensorik werden Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Bewegung im Bienenstock digital erfasst – ein spannender Ansatz, um Biodiversität und Umweltmonitoring zu verbinden. Darüber hinaus wird durch die Zusammenarbeit mit einem Berufskolleg ein Lernort für Umweltthemen geschaffen. Als außerschulischer Lernort für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung zahlt das Projekt so gleich auf zwei Nachhaltigkeitsziele (SDGs) ein: „Gute Bildung“ und „Leben an Land“. Die Erfahrungen sollen jetzt auf Nachbarkreise übertragen werden.
Nachhaltigkeits-Canvas für Digitalprojekte
Der digitale Bienenstock ist eins von fünf kommunalen Digitalprojekten,
das für den neuen ÖFIT-Impuls „Nachhaltigkeit in kommunalen Digitalprojekten – eine qualitative Perspektive“ untersucht wurde. Mithilfe des von ÖFIT entwickelten Nachhaltigkeits-Canvas wurde in Workshops mit Projektmitarbeitenden analysiert, welche Nachhaltigkeitskriterien für die Projekte relevant sind und wie sie besser berücksichtigt werden können. Das Canvas greift 21 Kriterien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit auf wie etwa Rückbaufähigkeit, Barrierefreiheit, Datenschutz oder Energieverbrauch (siehe Abbildung). Zusätzlich zu den Kriterien wurde mit den Projekten eine Folgenabschätzung vorgenommen und es wurden mögliche Key-Performance Indikatoren zur Messung des Fortschritts erörtert. Im Falle des digitalen Bienenstocks wurde mit dem Nachhaltigkeits-Canvas etwa geprüft, wie ressourcenschonend die eingesetzte Technik ist, ob die Software nachhaltig gepflegt werden kann, wie Dokumentation und Datenschutz gesichert sind und
Über die Sozialen Medien manifestierten die Social Networks den „Konsens für Trump“. Laut einer vom ZDF-Magazin Frontal und einem Forschungsteam aus Dublin durchgeführten Studie betreibt etwa Elon Musk eine „direkte Algorithmen-Beeinflussung“, die auch auf User und somit Wählende in Deutschland abziele. Im Vorfeld der letzten Bundestagswahl habe sich auf Musks Online-Plattform X die Reichweite der AfD, die der Milliardär öffentlich unterstützt,
vervierfacht – wohingegen die SPD nur noch auf ein Zwölftel ihrer vorherigen Reichweite gekommen sei. Auch bei der Art der Inhalte sieht Geese eine klare Aufmerksamkeitsökonomie: „Empörung und Wut sichern Reichweite. Sonst nichts.“ In X eingebettet ist auch das von Musks KI-Start-up xAI entwickelte Sprachmodell Grok. Nach der „größten Gefahr unserer Zeit“ befragt, habe Grok nicht etwa Klimawandel oder Kriege angegeben, sondern „mangelnde Fruchtbarkeit“, erklärt Geese. Dass es sich bei derartigen, nicht verifizierten Informationen um keine KI-Halluzinationen oder technische Fehler handeln muss, sondern bewusste Desinformation sein kann, zeigt Geese an einem aktuellen Beispiel, bei dem Musk aus der bewussten Beeinflussung seiner Tools gar keinen Hehl gemacht habe: Als sich Anzeichen verdichteten, dass sich der mutmaßliche Charlie-Kirk-Attentäter Taylor Robinson in konservativen Kreisen bewegt habe, sei Musks Kommentar gewesen: „Bullshit. We fix it.“ (sinngemäß: „Schwachsinn. Wir kümmern uns darum.“) Gesagt, getan.
Das Narrativ der US-Regierung ist eindeutig: Robinson ist ein Linker und wer das infrage stellt, be-
kommt Probleme. Late-Night-Talker Jimmy Kimmel kann ein Lied davon singen.
Gesetzeskonforme Infrastruktur
Die dritte wesentliche Tech-Funktion sei die „Erpressung Europas“, so Geese . Technologische Abhängigkeiten von KI-Tools oder Cloud-Strukturen würden „erbarmungslos als Waffe eingesetzt“, wie es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formulierte. Eine Lösung sind für Geese daher „eigene LLMs (Large Language Models, d. Red.) für mehr Souveränität“ und eine „digitale Infrastruktur in europäischer Hand, für die es selbstverständlich ist, unsere Gesetze zu achten und Steuern zu zahlen“.
Der EU-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) habe einen Bericht zu europäischer Souveränität angestoßen. Auf das Projekt EUROSTACK, das ebendiese gewährleisten soll, seien viele Unternehmen mit Begeisterung aufgesprungen. Technik müsse diversifiziert gebaut und beschafft werden können, führt Geese weiter aus. Der Ansatz sei „Buy European“ – das Vergaberecht müsse mehr Anreize bieten, um „gerade im Cloud-Bereich Planungssicherheit zu schaffen“. Eine Reform der EU-Vergaberichtlinie soll Ende 2026 kommen.
Um Abschottung gehe es bei alldem nicht, betont Geese. Internationale Kooperationen mit Staaten wie Indien seien in Planung – mit „Staaten, die offene Infrastruktur wollen“, schränkt die Europapolitikerin vielsagend ein.

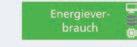
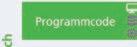
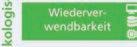




Oktober 2025

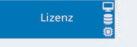


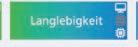











Die 21 Nachhaltigkeitskriterien entlang der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit Grafik: BS/ÖFIT
welche Vorteile für die kommunale Umweltarbeit entstehen.
Zentrale Erkenntnisse auf einen Blick
So unterschiedlich die Projekte auch sind, über alle hinweg lassen sich drei Erkenntnisse für die Nachhaltigkeit (kommunaler) Digitalprojekte festhalten.
Nachhaltigkeit nicht als zusätzliche Last begreifen: Ein gezielter Reflexionsmoment wie ein thematischer Workshop kann helfen, um Nachhaltigkeit weniger als zusätzliche Belastung, sondern als integrati-
ve Dimension von Digitalvorhaben zu betrachten. Wenn Nachhaltigkeitsaspekte und -überlegungen in die tägliche Arbeit eingehen und Entscheidungsprozesse mitprägen, lässt sich ein pragmatischer, aber wirkungsvoller Schritt in Richtung nachhaltiger Digitalisierung gehen. Die Summe kleiner Verbesserungen führt zu spürbarem Fortschritt.
Indikatoren und lokale Messgrößen etablieren: Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sollten – wie es teilweise bereits geschehen ist – in Landes- und Kommunalstrategien aufgegriffen und für den eigenen Kontext konkretisiert
und mit konkreten Messgrößen wie Key-Performance-Indikatoren hinterlegt werden. Das ermöglicht eine bessere Anwendbarkeit der Ziele für die Projekte sowie eine nachvollziehbare Wirkungsmessung.
Nachhaltigkeitskriterien bei Vergabeverfahren (stärker) berücksichtigen: Nachhaltigkeitskriterien sind auf unterschiedliche Weise nutzbar – unter anderem auch in der öffentlichen Beschaffung, die einen großen Hebel in der Beeinflussung des gesamten Marktes darstellt. Insbesondere ökologische Aspekte wie Energieverbrauch, Langlebigkeit oder Recycling sind hier vielversprechend. Alle Ergebnisse sind kompakt in dem Impuls aufbereitet und können als Inspiration und Vernetzungsangebot verstanden werden. Der Impuls bietet somit einen pragmatischen Einstieg in das Thema und die Anwendung des Nachhaltigkeits-Canvas. Das Vorgehensmodell via Canvas ist leicht adaptierbar und, wie der Impuls zeigt, flexibel einsetzbar. Die Methodik des Nachhaltigkeits-Canvas ist kostenlos über die Website von ÖFIT nachnutzbar.
Der Impuls steht kostenlos zur Verfügung unter: https://www.oeffentliche-it.de/ publikationen/nachhaltigkeit-inkommunalen-digitalprojekten/.
Das Nachhaltigkeitscanvas findet sich kostenlos unter: https://nachhaltigkeitscanvas.oeffentliche-it.de/.
*Dorian Wachsmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut FOKUS.
Wir feiern Geburtstag: fünf Jahre DigitalService! Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge: Alles begann mit unseren FellowshipProgrammen Tech4Germany und Work4Germany. 2020 folgte der entscheidende Schritt: Der Bund übernahm uns und im Oktober desselben Jahres starteten wir mit dem Aufbau einer bundesinternen Produkt-Entwicklungseinheit. Seitdem ist das Ziel klar: eine digitale, moderne Verwaltung, die Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen das Leben erleichtert.

Christina Lang ist Chief Executive Officer (CEO) des DigitalSer vice. Foto: BS/DigitalService
D ie Verwaltungsdigitalisierung steht vor entscheidenden Weichenstellungen: Registermodernisierung (RegMo), sichere Datenübertragung, digitale Identitäten und die künftige EUDI-Wallet sind zentrale Bausteine, die Verwaltung und Gesellschaft nachhaltig verändern werden. Governikus be gleitet und leistet seit mehr als 25 Jahren mit IT-Bausteinen, die Sicherheit, Rechtssicherheit und Praxistauglichkeit miteinander verbinden, einen Beitrag. Am Stand zeigen Expertinnen und Experten, wie sich zentrale Herausforderungen mit erprobten Produkten und fundierter Exper tise praxisnah und rechtssicher umsetzen lassen. Dabei rücken sie vor allem drei Aspekte in den Fokus: Registermodernisierung: Wie ge lingt der Anschluss an das NOOTS mit etablierten Standards?
Digitale Identitäten: Welche Rol len spielen eID, RegMo und die künftige Wallet in der Verwaltung? Vertrauenswürdige Nachweisda ten: Wie werden aus reinen Daten belastbare, rechtsverbindliche In formationen?
Live-Demo: DATA Sign in Aktion Am Gemeinschaftsstand können sich Besucherinnen und Besucher über eine Live-Demo des Produkts DATA Sign freuen: Eine Lösung für das sichere Signieren, Siegeln und Validieren von Nachweisdaten. Hier wird gezeigt, wie Daten mit Siegeln und Signaturen rechtssi cher aufbereitet werden.
Die Lösung wird zusammen mit dem Bank-Verlag präsentiert, einem der qualifiziertesten Vertrauensdiensteanbieter, die an DATA Sign angebunden sind. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir erlebbar machen. Während das Bremer Unternehmen die technische Umsetzung verantwortet, bringt der BankVerlag seine Expertise im Bereich qualifizierter Vertrauensdienste und regulatorischer Anforderungen ein.
Über kurz oder Lang
Eine Kolumne von Christina Lang
Fünf Jahre DigitalService – das sind für mich fünf Jahre Mut. Fünf Jahre darum kämpfen, Dinge anders zu machen. Unser Leitmotiv dabei lautet: Veränderung kommt vom Machen! Denn echte Veränderung entsteht nicht durch Konzepte und Strategiepapiere, sondern erst, wenn wir Ideen vom Papier holen und in die Wirklichkeit bringen.
Fünf Jahre Umsetzungspower Seit fünf Jahren zeigen wir, was das bedeutet. Mit der digitalen und schnell verständlichen Grundsteuererklärung haben wir fast eine Million Menschen erreicht. Der digitale Elterngeldrechner wird in der Verwaltung aktiv empfohlen, weil er Familien nutzerorientiert unterstützt. Und mit den Angeboten, die wir gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium entwickeln, erleichtern wir nicht nur den Zugang zum Recht, sondern stärken auch das Vertrauen in den Staat. Diese Beispiele machen deutlich: Digitale
Verwaltung ist keine abstrakte Zukunftsvision. Sie kann schon heute den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern erleichtern. Digitalisierung lässt sich nicht über Jahre bis in die Details vorausplanen. Dafür entwickeln sich Technologien zu schnell und mit ihnen verändern sich die Erwartungen und Präferenzen der Nutzenden. Entscheidend ist deshalb ein Vorgehen, das Raum für Anpassungen lässt: klein anfangen, schnell in die Praxis gehen, Feedback einholen und darauf basierend die Lösung weiterentwickeln. Iterative Entwicklung und Nutzerzentrierung machen das greifbar. Die Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung übertragen wir zudem auf die strukturelle Ebene: Wir arbeiten an Standards und daran, dass Gesetze gut digital umsetzbar sind. Und wir sehen: Für die Zukunft braucht es gemeinsame Infrastrukturen und bessere Abstimmung, damit wir schneller mehr
Lösungen in die Fläche bekommen.
Das Machen ernst nehmen
Seit unserer Gründung hat sich viel bewegt. Immer mehr wird erkannt: Ohne digitale Transformation funktioniert es nicht. Initiativen, wie die für einen handlungsfähigen Staat, haben Jahr für Jahr gute Vorschläge für die digitale Verwaltung vorgelegt. Und mit dem neuen Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung gibt es in Berlin eine klare politische Verankerung. Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wo können wir in Zukunft stehen, wenn wir das Machen wirklich ernst nehmen?
Gesetze könnten dann direkt so formuliert sein, dass sie digital umsetzbar und praxistauglich sind. Standards würden Rahmen und Orientierung geben, weil sie die Arbeit erleichtern – nicht, weil sie verordnet werden. Moderne Infrastrukturen und Cloud-native Be-
Governikus auf der Smart Country Convention 2025
(BS) Vom 30. September bis 2. Oktober 2025 findet erneut das führende Event rund um die Themen Smart City, Smart Region und E-Government statt. Auf der Smart Country Convention kommen Teilnehmende aus der Digitalwirtschaft, Wissenschaft, der öffentlichen Verwaltung sowie Verbände, Vereinigungen und Unternehmen zusammen – und Governikus ist auch wieder dabei. Gemeinsam mit dem Bank-Verlag präsentiert der Bremer IT-Sicherheitsspezialist am
triebsmodelle wären etabliert. Und Verwaltungsmitarbeitende haben den Freiraum und die Skills, die sie brauchen, um die Digitalisierung mitzugestalten. Wir hätten einen echten digitalen Staat und die Verwaltung wäre vor allem eines: eine spürbare Erleichterung im Alltag der Menschen. Kommen wir dagegen nicht ins Machen und bleiben wir im Denken stecken, riskieren wir, weiter Anschluss und Vertrauen zu verlieren.
Hätte ich einen Geburtstagswunsch frei, dann wäre es dieser: Lasst uns die Umsetzung in den Fokus nehmen. Echte Veränderung entsteht nie durch Ankündigungen und selten durch den einen großen Wurf. Sie wächst aus vielen kleinen Schritten, die gemeinsam eine klare Richtung ergeben. Niemand kann diesen Weg allein gehen. Aber wenn Verwaltung, Politik und Tech-Expertise zusammenwirken, dann ist ein spürbarer Wandel möglich.

Governikus bietet auf der SCCON ein vielfältiges Informations- und Kommunikationsangebot.
reiches Programm aus Lightning Talks, die an allen drei Tagen mehrmals stattfinden. In fünf kurzen, prägnanten Vorträgen geben Governikus-Experten und Gäste Einblicke in aktuelle Entwicklungen, praxisnahe Lösungen und strategische Perspektiven: 1. Nutzung etablierter Infrastrukturen in der Registermodernisierung
Lightning Talks: Kompaktwissen direkt am Stand
Neben der Ausstellung erwartet die Messegäste ein abwechslungs-
OSCI und XTA sind etablierte Standards für die sichere Datenübertragung in der öffentlichen Verwaltung. Diese bekannten und erprobten Standards können auch im Kontext der Registermoderni-
sierung eingesetzt werden. Governikus zeigt, wie mit COM Adeona (Register-Adapter) der einfache Anschluss an das NOOTS gelingt. 2. Registermodernisierung trifft EUDI-Wallet: zwei Säulen einer modernen Verwaltungsidentität Wie gelingt die Verbindung von eID und Registermodernisierung mit dem entstehenden Wallet-Ökosystem? Der Talk verknüpft die Potenziale der Registermodernisierung mit den kommenden europäischen Wallet-Technologien – sowohl für Bürger/-innen als auch für Unternehmen.
3. Das Peppol-Netzwerk – wie kann die europäische Infrastruktur für die RegMo genutzt werden? Mit Peppol gibt es ein in Europa gestartetes internationales Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur, die derzeit für die Digitalisierung der Beschaffung eingesetzt wird. Kann nicht eine etablierte Infrastruktur wie Peppol auch im Kontext der RegMo genutzt werden, anstatt neue Systeme aufzubauen? Aktuell prüfen europäische Mitgliedsstaaten, ob Peppol als (Q) ERDS nach eIDAS ist.
4. Digitale Nachweise mit Signaturen und Siegel – wie aus
Daten belastbare Entscheidungen werden Registermodernisierung braucht mehr als Datentransport: Sie erfordert vertrauenswürdige Nachweise. Erfahren Sie, wie behördliche Daten mit Siegeln/Signaturen versehen werden können, um ihre Herkunft und Integrität nachweisbar zu machen, bspw. für das NOOTS, für Fachverfahren oder perspektivisch die Wallet. 5. Digitale Souveränität heißt selbst entscheiden, wie betrieben wird – DATA Sign, die Signatur- und Siegelplattform für die öffentliche Verwaltung
Digitale Souveränität entsteht, wenn öffentliche Verwaltungen selbst bestimmen können, wie sie Software betreiben. Die Signaturund Siegelplattform setzt auf modulare Architektur und macht so souveräne Betriebsentscheidungen in der öffentlichen Verwaltung möglich.
Einladung: Governikus auf der SCCON 2025 treffen
Seit 25 Jahren sorgt Governikus für den Schutz personenbezogener Daten. Dabei sind sichere Identitäten, rechtssichere Kommunikation und der Schutz sensibler Daten zentrale Aspekte der Lösungen. Denn Governikus bietet IT-Bausteine für die Digitalisierung, die Bund, Länder, Kommunen und die Justiz bei der Umsetzung ihrer Strategien unterstützen.
Ob Live-Demo, Lightning Talk oder persönliches Gespräch: Das Team von Governikus freut sich auf einen Besuch auf der SCCON 2025 am Stand hub27/312. Der Besuch lohnt sich für alle, die die digitale Verwaltung von morgen aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen zu Governikus
Erschiene morgen eine KI, die alle der Menschheit bekannten Sprachen simultan und fehlerfrei übersetzen könnte – etwa wie der Droide C3-PO aus Star Wars –, es würde kaum noch jemanden überraschen. Die Wissensnetzwerke von KI-Lösungen sind bereits heute hochkomplex, die Phase der gesetzlichen Regularien und der Suche nach vertrauenswürdiger Hardware und Datensätzen läuft auf Hochtouren.
Auch der sprechende Supersportwagen K.I.T.T. aus der TV-Kultserie Knight Rider ist annähernd Realität und nennt sich – das Offensichtliche herausstellend – Autonomes Fahren. Unternehmen wie Figure AI, das bis vor kurzem mit dem Sprachmodell-Branchenprimus OpenAI kollaborierte, interagieren derweil mit humanoiden Robotern und stellen die Resultate ins Netz, was marketingtechnisch perfekt editiert, jedoch nicht minder beeindruckend ist.
Unsichere Freunde
Dass ein Großteil der KI-Forschung von der Wirtschaft und nicht von Staatsseite vorangetrieben wird,
Wo Humanoide Roboter zukünftig wirklich helfen können
(BS/cb) Während Sprachmodelle von Künstlicher Intelligenz (KI) auch in der Verwaltung auf dem Weg zum Standard sind, blickt die Forschung voraus: Menschenähnliche Roboter könnten in Zukunft fester Bestandteil der Gesellschaft werden und in diversen Feldern Unterstützung leisten. Die neuesten Modelle sind bereits weiter als in so mancher Science Fiction. Doch welche Einsatzformen sind in den kommenden Jahren realistisch?

Der übermenschlich starke Roboter, der Einsatzkräfte unterstützt und etwa die blockierte Tür eines Unfallwagens herausreißt, ist noch eine Wunschvorstellung. Technologisch möglich ist es.
liegt in der Finanznatur der Sache, könne bei Forschenden und in der Zivilgesellschaft aber „für Unsicherheit sorgen“. Das gab Dr. Sirko
Foto: BS/Mian, stock.adobe.com
Straube, Leiter am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Robotics Innovation Center, im Rahmen einer vom Netz-
Ein Mandat der Verantwortung und Führung
(BS/Dr. Dirk Günnewig) Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist kein optionales Zusatzinstrument, sondern integraler Bestandteil moderner Verwaltungen. Ziel ist es, die Servicequalität zu erhöhen, Beschäftigte zu entlasten und staatliches Handeln effektiver, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.
Die Finanzverwaltung NordrheinWestfalen nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein: Sie erprobt und integriert KI in konkrete, skalierbare Anwendungsfälle und steht damit exemplarisch für eine moderne und zukunftsorientierte Verwaltung im digitalen Zeitalter.
KI als strategischer Hebel Der KI-Einsatz ist eingebettet in das Modernisierungsprogramm Finanzverwaltung für NordrheinWestfalen. Leitprinzip ist die Verbindung von Effizienzsteigerung, Serviceorientierung und digitaler Resilienz. KI fungiert als Ermöglicher und Beschleuniger: Sie soll bei Routinetätigkeiten unterstützen, große Datenmengen strukturieren und so personelle Ressourcen für anspruchsvolle, nicht standardisierbare Aufgaben freisetzen. Gleichzeitig erhöht sie durch automatisierte Analysen die Qualität von Entscheidungen und ermöglicht schnellere Antworten für Bürgerinnen und Bürger. Die Verantwortung bleibt klar geregelt: KI wird als assistierendes Werkzeug eingesetzt – nicht als Ersatz für fachliche Expertise. Entscheidungen werden weiterhin von qualifizierten Beschäftigten getroffen. Dieses Human-in-theLoop-Prinzip ist Kern der nordrhein-westfälischen Leitlinien, die außerdem Technologieoffenheit, Datenschutz und Skalierbarkeit in den Mittelpunkt stellen. Statt einzelne Leuchtturmprojekte umzusetzen, setzt die Finanzverwaltung auf übertragbare Lösungen für die Breite mit dem Gemeinwohl im Vordergrund. Zentrale Themen wie KI und Cloud wurden in einem eigens eingerichteten Referat im Ministerium gebündelt. Im Rechenzentrum der Finanzverwaltung (RZF) wurde ein KI-Cloud-Inkubator aufgebaut, der neue Technologien erprobt und in den Alltag überführt. Am RZF-Standort Kaarst entsteht eine eigene KI-Infrastruktur, die sensible Daten unabhängig von externen Plattformen verarbeiten kann – ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der digitalen Souveränität.
Für die rund 33.000 Beschäftigten der Finanzverwaltung sind seit
Anfang 2025 generative KI-Systeme wie ChatGPT, Copilot oder Gemini nutzbar. Der Einsatz ist ausschließlich in nicht-personenbezogenen Kontexten gestattet. Ergänzt wird dies durch NRW. Genius, eine von IT.NRW entwickelte Lösung, die langfristig eine datenschutzkonforme Lösung für den verwaltungsweiten Einsatz bieten soll. Auch im Steuerrecht werden neue Wege beschritten: Über das Fachportal Juris steht den Beschäftigten eine KI-gestützte Recherchefunktion zur Verfügung, die präzise Antworten ohne halluzinierte Inhalte liefert.
KI gegen Finanzkriminalität
Die Einführung von KI in der Steuerverwaltung erfordert neben technischen und organisatorischen Voraussetzungen auch klare Leitplanken. Die KI-Strategie der Finanzverwaltung setzt diese Grenzen und schafft mit einem ministeriellen Erlass verlässliche Rahmenbedingungen für den verantwortungsvollen Einsatz. Dieser legt fest, welche Funktionen erlaubt sind – etwa Funktionen zur Rechercheunterstützung, Formulierungshilfe und Textanalyse. Strikt untersagt ist hingegen jede Verarbeitung personenbezogener oder vertraulicher Daten. Die Einhaltung des Datenschutzes und des Steuergeheimnisses haben höchste Priorität.
Auf dieser Grundlage können innovative Projekte sicher erprobt werden – etwa im Risikomanagementsystem (RMS). NordrheinWestfalen testet als erstes Bundesland ein KI-Modul, das anhand vergangener Veranlagungsdaten Prognosen erstellt und risikoarme Fälle für die automatisierte Bearbeitung identifiziert. Nach einer Pilotphase in vier Finanzämtern soll das System landesweit ausgerollt und anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.
Auch bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität spielt KI eine wachsende Rolle. Das 2024 gegründete Landesamt zur Bekämpfung
der Finanzkriminalität (LBF) setzt sie zur Analyse digitaler Asservate und zur Aufdeckung verdächtiger Finanzströme ein – zunächst im Bereich Terrorismusfinanzierung, perspektivisch ist eine Ausweitung auf weitere Deliktsbereiche wie Geldwäsche oder organisierte Kriminalität geplant. Damit KI verantwortungsvoll genutzt werden kann, setzt NRW die auf die KI-Kompetenz der Beschäftigten. Gemeinsam mit GovTech Deutschland und Microsoft wurde eine landesweite Schulungsinitiative gestartet, die allen Beschäftigten praxisnahe E-Learnings und modulare Lernsysteme bereitstellt. Dies ist Ausdruck moderner Personalentwicklung – und zugleich rechtlich vorgeschrieben nach Artikel 4 der EU-KI-Verordnung. Ziel ist es, Kompetenzen aufzubauen und die reflektierte Nutzung moderner Werkzeuge dauerhaft in der Verwaltung zu verankern.
Innovation und Kontrolle
KI ist in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen längst gelebte Realität. Dabei zeigt sich: Innovation und Kontrolle sind kein Widerspruch. Die KI-Strategie Nordrhein-Westfalens verbindet technologiepolitische Souveränitätsziele mit konkretem operativem Mehrwert. Sie schafft Tempo, entlastet Beschäftigte und verbessert den Service. Die menschliche Fachkompetenz wird immer das Rückgrat einer leistungsfähigen Finanzverwaltung bilden. Das Gleichgewicht zwischen Innovation und öffentlicher Verantwortung macht den nordrhein-westfälischen Ansatz zu einem Modell für die Verwaltung der Zukunft.

Dr. Dirk Günnewig ist Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes NordrheinWestfalen.
Foto: BS/Land NRW/ Ralph Sondermann
werk D21 und der Initiative MISSION KI organisierten Panel-Reihe zu bedenken. Auf welcher Software ein Roboter läuft und welche wirtschaftlichen Interessen hinter seiner Produktion stecken, sind gerade in geopolitisch angespannten Zeiten drängende Fragen, die Dr. Isabella Hermann, Politikwissenschaftlerin und Science Fiction-Forscherin, ergänzte. In der Kommunikation mit KI-Sprachassistenten sage Hermann weder „bitte“ noch „danke“, so die Wissenschaftlerin und Autorin, die KI als reines Werkzeug betrachtet –nicht „als Freund“.
Die elektronische Fachkraft Andererseits könne Freundlichkeit sich durchaus auszahlen, da die KI möglicherweise bessere Ergebnisse liefere, wenn sie Dankbarkeit registriert. Diesem Ansatz ließ Tim Brauckmüller, Vorstandsmitglied bei D21, konkrete Einsatzmöglichkeiten der Humanoiden im öffentlichen Sektor folgen. Brauckmüllers erste Wahl: die Pflege. Dass Fachkräftemangel Pflegeeinrichtungen belastet und die physisch wie mitunter seelisch belastende Arbeit – bei vergleichsweise geringer Bezahlung – viele potenzielle Nachwuchskräfte abschreckt, ist seit Jahren kein Geheimnis. Zumindest bei der körperliche Arbeit könnten Roboter unterstützen, so Brauckmüller, und den menschlichen Pflegerinnen und Pflegern mehr Raum für die empathischen Teile ihrer Arbeit schaffen. Immerhin sei es nicht deren Hauptaufgabe, „Pflegebedürftige von einem Bett ins andere zu hieven“, sondern eben gerade in der zwischenmenschlichen Kommunikation für ältere, kranke oder Menschen mit Behinderungen da zu sein. Auch Sprachbarrieren und sogar medizinische Diagnosen
durch die KI hält Brauckmüller für möglich.
Der gute Terminator Ein weiterer denkbarer Einsatz für Humanoide Roboter sind für das D21-Vorstandsmitglied Verkehrsunfälle. Ein Roboter mit „entsprechend starkem Motor“ und mechanischer Kraft könnte „wie der Terminator“ die Tür eine Unfallwagens herausreißen und die Person im Innern befreien. Das Tragen schweren Materials beim THW und das Löschen von Bränden bei Feuerwehreinsätzen sind genauso vorstellbar. Der Roboter als schmerzunempfindlicher Helfer ist Katastrophenszenarien wäre bei allen dystopischen Visionen, die bei der KI-Forchung stets mit einhergehen, eine wahrlich schöne Utopie.
Eine Stufe weniger heldenhaft, jedoch ebenso vorstellbar wie nützlich seien Roboter in Diensten der Polizei oder des Ordnungsamtes, erklärt Brauckmüller. Das Kontrollieren minder schwerer Vergehen und das Überprüfen der öffentlichen Ordnung gilt als realistisches Szenario.
Soziale Gerechtigkeit schaffen Dass viele weitere Debatten mit den Gedankenspielen um Humanoide Roboter zusammenhängen, macht Straube deutlich. Hochkomplexe und hochleistungsfähige Roboter, deren Prototypenentwicklung er –Stand jetzt – auf „zwischen drei und vier Millionen Euro“ beziffert, seien selbst bei einer potenziellen günstigeren Serienproduktion noch teuer: Ergo: Nur Wirtschaftsunternehmen und die wohlhabendsten Teile der Gesellschaft könnte sich derartige Modelle leisten. Soll die Technologie aber gerade den schwächeren Teilen der Gesellschaft zugutekommen – siehe Pflegesektor –, müsse man auch über eine „Umverteilung des Wohlstands“ diskutieren. Bis sich diese Debatten konkretisieren, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. Bei der Frage, wie viele humanoide Roboter wir in fünf Jahren im Alltag sehen werden, sind sich die drei Panelisten einig: „Sehr wahrscheinlich noch keine“, so Hermann.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in der Metropolregion München eine
ABTEILUNGSLEITUNG (W/M/D)
ZENTRALE SERVICES (ZS)
AT/A 16 BBesO | Voll- oder Teilzeit
Zufriedene Mitarbeitende erzeugen die beste Arbeitsatmosphäre. Unser Ziel ist deshalb, ein gesundes, flexibles und inspirierendes Umfeld zu schaffen. Dafür wurden wir bereits mit den Awards „Top Company“ und „Open Company“ ausgezeichnet. Wir, als Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI), sind so agil und reaktionsschnell wie möglich. Deshalb gehen wir viele Dinge anders an, als man es von einer klassischen Behörde erwarten würde.
IHRE AUFGABEN SIND U. A.:
͡Leitung der Abteilung Zentrale Services (mit aktuell den Referaten Grundsatz Personal, Organisationsentwicklung, Innerer Dienst, Recht & Finanzen sowie Beschaffung & Vergabe) sowie ggf. weiterer Projektgruppen und Themenbereiche
͡Wahrnehmung der Funktion des Beauftragten (w/m/d) für den Haushalt
͡Beratung der Hausleitung in Fragen der inneren Verwaltung
͡Entwicklung strategischer Leitlinien für die Abteilung Zentrale Services
͡Verantwortung für die personelle und finanzielle Ressourcenplanung in der Abteilung Zentrale Services
DIESE QUALIFIKATIONEN SIND EIN MUSS:
͡abgeschlossenes wissenschaftliches Studium (Master/Diplom univ.), das in einem engen Bezug zu den Aufgabenschwerpunkten der Abteilung steht (z. B. Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, Wirtschafts- oder Verwaltungswissenschaften) oder ͡Laufbahnbefähigung für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst oder ein anderweitig abgeschlossenes wissenschaftliches Studium (Master/Diplom univ.), sofern mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Leitungsfunktion zu den Aufgabenschwerpunkten der Abteilung nachgewiesen wird
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf www.interamt.de unter der Stellen-ID 1355455 Weitere Informationen unter www.zitis.bund.de
Entsprechend sinkt das Vertrauen in den Staat weiter – von 38 Prozent im Jahr 2022 über 35 Prozent 2023 auf nunmehr 33 Prozent.
Studienleiterin Sandy Jahn, Referentin Strategic Insights & Analytics bei der Initiative D21, fasste es in einem Pressegespräch zu den Ergebnissen so zusammen: „Vertrauen basiert auf Leistungsfähigkeit. Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht spüren, dass die Verwaltung ihr Leben erleichtert, wirkt sich das unmittelbar auf das Vertrauen aus.“
Kluft zwischen Erwartung und Realität
Die Erwartungen sind hoch. Zwei Drittel der Bevölkerung wollen Verwaltungsleistungen so einfach nutzen wie private Online-Dienste, ebenso viele erwarten gezielten Technologieeinsatz für mehr Effizienz und proaktive Informationen über verfügbare Angebote. Doch erfüllt sehen nur 15 Prozent ihre Erwartungen, während es in Österreich 36 und in der Schweiz 46 Prozent sind. Viele scheitern schon an unvollständigen Abläufen. „Ein Knackpunkt ist, dass Verfahren oft nicht durchgängig digital sind. Irgendwo muss man doch wieder analog werden, und das hält viele davon ab, den digitalen Weg überhaupt zu gehen“, erklärte Jahn
Das zeigt sich besonders am Online-Ausweis, welcher der zentrale Zugang zu digitalen Diensten sein



Hohe Digitaloffenheit, sinkendes Vertrauen
(BS/fst) Der eGovernment Monitor 2025 der Initiative D21 in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München zeigt: Die Digitalisierung der Verwaltung stößt auf große Offenheit, ihre Wirkung bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Zwar sehen 61 Prozent der Menschen Vorteile in digitalen Angeboten gegenüber analogen Verfahren, doch nur jeder Zehnte nahm in den vergangenen Jahren eine deutliche Verbesserung wahr.

Der eGovernment Monitor 2025 zeigt: Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist offen für eine rein digitale Verwaltung – doch spürbare Verbesserungen und Vertrauen bleiben bislang aus. Foto:
soll. 25 Prozent der Ausweisbesitzenden nutzen ihn mittlerweile, drei Viertel bleiben jedoch bei der Plastikkarte. Die Hürden sind nicht nur technische Komplexität, sondern auch mangelnde Bekanntheit: „Viele wissen gar nicht, dass sie damit Dokumente signieren oder auf die elektronische Patientenakte zugreifen können“, so Jahn. Ähnliche Probleme gibt es beim Bundesportal








verwaltung.bund.de, das trotz seiner Rolle als zentrale Anlaufstelle nur zwölf Prozent der Menschen nutzen. Digital Only: ja, aber… Dass die Offenheit für digitale Verfahren dennoch groß ist, zeigt die wachsende Zustimmung zu Digital Only. 68 Prozent können sich vorstellen, ab 2030 alle Anträge ausschließlich online einzureichen, ein



Drittel hält das bereits für selbstverständlich. Entscheidend bleibt, dass die Verfahren spürbar schneller werden. „Unsere Studie zeigt deutlich, dass eine rein digitale Verwaltung auf Zustimmung stößt, wenn sie mit echter Beschleunigung einhergeht“, betonte Jahn. Für Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, liegt darin ein doppelter Nutzen: „Digital Only kann dafür sorgen, dass in den Verwaltungen Ressourcen frei werden, um Skeptiker in der Bevölkerung effektiver mitzunehmen.“ In Berlin lassen sich diese Effekte bereits beobachten. „Wir haben eigentlich immer freie Termine in unseren Bürgerämtern, weil immer mehr Leistungen keine Anwesenheit erfordern“, berichtete Martina Klement, Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung des Landes Berlin. Dennoch müsse der Nutzen konsequenter beworben werden. Die Erfahrungen mit dem Online-Wohnsitzantrag hätten gezeigt, dass selbst gute Dienste erst durch groß angelegte Kampa-
gnen Reichweite erlangten. Besonders sensibel ist der Zusammenhang von digitaler Leistungsfähigkeit und Vertrauen. Nur 16 Prozent der Menschen halten Behörden für so effizient wie Unternehmen, lediglich zwölf Prozent sagen, der Staat mache ihr Leben leichter. Ann Cathrin Riedel, Geschäftsführerin des Vereins NExT, verweist darauf, dass sich Vertrauen in Schlüsselmomenten entscheide: „Bei der Geburt eines Kindes, beim Wohngeld oder bei der Ummeldung – in solchen Situationen erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat verlässlich funktioniert.“ Dorothea Störr-Ritter, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats, betonte zudem die Perspektive der Beschäftigten: „Was wir immer im Blick behalten müssen, ist die Entlastung der Mitarbeitenden. Nur wenn das gelingt, können wir die Erwartungshaltung an schnellere Arbeit erfüllen.“ Damit macht der Monitor deutlich: Deutschland will Digitalisierung –ein Drittel der Bevölkerung ist schon heute bereit für Digital Only, während nur neun Prozent noch strikt auf analogen Angeboten bestehen. Doch solange spürbare Fortschritte ausbleiben, bleibt die Kluft zwischen Offenheit und Erfahrung groß. Beschleunigte, durchgängige Verfahren, bessere Auffindbarkeit und eine stärkere Kommunikation digitaler Leistungen sind deshalb entscheidend, um Vertrauen zu schaffen.







Neue Kräfteverhältnisse im Smart-City-Ranking (BS/Frederik Steinhage) Die Smart-City-Reife deutscher Großstädte hat etwas mit der Fußball-Bundesliga gemeinsam: München ist schon wieder vorne. Der aktuelle „Smart City Index“ verrät, wer die Verfolger sind, wer im Mittelfeld landet – und wer absteigt.

Der Index des Bitkom untersucht alle deutschen Großstädte ab 100.000 Einwohnern – insgesamt 83 – und misst deren Fortschritt in der Digitalisierung anhand von fünf Kategorien: Verwaltung, IT & Kommunikation, Mobilität, Energie & Umwelt sowie Gesellschaft & Bildung. Grundlage sind 13.529 Datenpunkte aus 163 Parametern, die zu 37 Indikatoren verdichtet werden.
Spitzenplätze und Aufsteiger

















In der jüngst erschienenen Gesamtwertung liegt erneut die bayerische Landeshauptstadt vorn: München erreicht 90,2 von 100 Punkten. Gastiert der Hamburger SV beim FC Bayern, gibt es für die Hanseaten meistens nicht viel zu holen. Beim Smart City Index ist es deutlich knapper: Hamburg sichert sich mit 89,6 Punkten den zweiten Platz. Stuttgart erreicht mit 88 Punkten Platz drei und verdrängt damit Köln, das auf 87,9 Punkte kommt. Bochum folgt auf Rang fünf, Düsseldorf gelang der Sprung auf Platz sechs.
Bemerkenswert sind die Bewegungen unter den Top Ten: Hannover ist der Aufsteiger des Jahres mit einem Sprung um 34 Plätze auf Rang sieben; Leipzig (neun), Heidelberg (zehn) und Düsseldorf konnten sich ebenfalls stark verbessern. Demgegenüber verabschieden sich Dresden, Ulm, Freiburg und Lübeck aus den ersten zehn Rängen.
Die weiteren digitalen Topverwalter sind Bochum (97,3) und Heidelberg (97,0). User-freundlicher Bürgerzugang zu Online-Angeboten, Verwaltungsmodernisierung im Allgemeinen sowie Entbürokratisierungsvorhaben sind entscheidende Faktoren. In der Kategorie Mobilität dominiert wiederum München, das mit umfassenden Angeboten im Bereich smarter Verkehrssteuerung und Sharing-Dienste die Maximalpunktzahl erreicht.
IT-Hochburg Hamburg
Bei IT und Kommunikation liegt Hamburg an der Spitze, eng gefolgt von München und Kiel. Bewertet werden hier unter anderem die Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsnetzen, digitale Kommunikationskanäle und offene Datenportale. In Sachen Energie und Umwelt führen Ingolstadt, Osnabrück und Stuttgart das Feld an – ein Hinweis darauf, dass auch kleinere und mittlere Städte mit innovativen Konzepten zur Energieversorgung und zum Umweltschutz punkten können. In Gesellschaft und Bildung überzeugt München abermals mit 96,2 Punkten, gefolgt von Hamburg sowie Leipzig, Potsdam und Nürnberg mit starken digitalen Bildungsangeboten.
Top-Leistungen nach Kategorien Ein weiteres deutliches Ergebnis: Die Anforderungen steigen. War im Jahr 2024 noch etwa ein Indexwert von 79,8 Punkten nötig, um unter die besten zehn zu gelangen, so liegt diese Schwelle 2025 bei 84,7 Punkten. Auch der Abstand zwischen den Spitzenplätzen schrumpft: Zwischen Platz eins und drei liegen lediglich 2,2 Punkte, zwischen Platz eins und zehn nur etwa 5,5. Die individuellen Stärken der Städte werden in den Einzelkategorien sichtbar. Neben der Gesamtplatzierung zeigen sich dort deutliche Spezialisierungen und regionale Unterschiede. In der Kategorie Verwaltung etwa führt Nürnberg mit herausragenden 97,5 Punkten. Die für ihre Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen bekannte Bundesagentur für Arbeit (BA) mit ihrem Nürnberger Hauptsitz dürfte daran einen wesentlichen Anteil haben.
Z
iel ist das „Once-Only“-Prinzip, das auch prominent im Koalitionsvertrag verankert ist: Die Verwaltung soll ihre Daten rechtssicher, datensparsam und digital austauschen können, damit Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen Nachweise in Anträgen nicht immer wieder übermitteln müssen. Technisch ermöglicht wird dies durch das Nationale Once-Only Technical-System (NOOTS).
Die Herausforderungen liegen weniger im technischen Betrieb als in fachlicher, organisatorischer und rechtlicher Abstimmung, insbesondere bei dem ressort- und ebenenübergreifenden Datenmanagement. Mit dem Start der NOOTS-Umsetzungsorganisation im Juli 2025 ist das Vorhaben in die operative Phase eingetreten. Ende des Jahres wird die erste Version des NOOTS als Minimal Viable Product (MVP) bereitstehen, 2026 skalierbar anschlussfähig sein und perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen und auch Unternehmen ermöglichen.
Heute: Das NOOTS in der Umsetzung
Die Gesamtverantwortung für die Registermodernisierung liegt beim IT-Planungsrat, dem zentralen politischen Steuerungsgremium von Bund und Ländern für die Verwaltungsdigitalisierung. Mit dem NOOTS-Staatsvertrag wurde die operative Umsetzung neu geordnet: In der NOOTS-Umsetzungsorganisation liegt die fachliche Koordination nun bei der FITKO (Föderale IT-Kooperation). Die technische Umsetzung sowie die Bereitstellung des Identitätsdatenabruf-Verfahren (IDA) und des Datenschutzcockpits (DSC) verantwortet das Bundesverwaltungsamt (BVA). Als zentrales Gremium löst die NOOTS-Steuerungsgruppe den bisherigen Lenkungskreis Registermodernisierung ab und bildet für den IT-Planungsrat das Gremium für strategische Abstimmungen. Damit wurde die Struktur geschaffen, um das NOOTS bereitzustellen und das System in Zusammenarbeit mit verschiedenen Anschlussvorhaben zu erproben.
Im Fokus der derzeitigen Umsetzungsphase steht das Minimum Viable Product (MVP) – eine initiale Version des NOOTS, mit der produktiv Nachweisdaten föderal ausgetauscht werden können. Die

Mit dem NOOTS zum Systemwandel in der Verwaltung
(BS/Michael Pfleger) Die Registermodernisierung in Deutschland schreitet voran. Mit dem Registermodernisierungsgesetz, der Einführung der Identifikationsnummer (IDNr) und zuletzt dem NOOTS-Staatsvertrag sind wichtige Weichen gestellt. Meilensteine 2025/2026

Inbetriebnahme erster produktiver Anwendungen ist schon für das vierte Quartal 2025 geplant: Der Datenabruf für die Gewerbeanmeldung aus dem Handelsregister und zur Beantragung von Bewohnerparkausweisen aus dem Zentralen Fahrzeugregister.
Datengovernance dringend benötigt
Eine Hürde für die Umsetzung des Once-Only-Prinzips ist der bisherige Mangel an durchgängiger Datengovernance der öffentlichen Verwaltung. Für das NOOTS ist eine einheitliche Governance zur Herstellung der semantischen, aber auch rechtlichen Interoperabilität ein kritischer Erfolgsfaktor. Daher hat sich die NOOTS-Umsetzungsorganisation das Ziel gegeben, neben der reinen technischen Infrastruktur auch ein Datenmanagement inklusive übergreifender Governance, Tooling und eines Metadatenrepositories umzusetzen.
Das Datenmanagementkonzept des NOOTS wird auf dem in Großkonzernen erfolgreich angewendeten Prinzip des „Data Mesh“ aufbauen und sowohl die föderale Verfasstheit als auch den hohen Standardisierungsdruck beachten und fördern. Ein Konsultationsver-

fahren sowie die Zusammenarbeit mit relevanten Gremien und Arbeitsgruppen des IT-Planungsrats sollen Transparenz sichern und alle Initiativen abholen.
Mit dem NOOTS-Staatsvertrag und der darin enthaltenen Nutzungspflicht erreicht auch das Datenmanagement des NOOTS eine Verbindlichkeit, welche früheren Initiativen fehlte.
Lösungsangebot: Cloudregister als strategischer Hebel Im föderalen Raum trifft das NOOTS auf eine heterogene ITLandschaft mit erheblichem Modernisierungspotenzial. Die dezentrale Struktur unserer Verwaltung ist Ausdruck des Föderalismus und somit schützenswert, stellt jedoch eine Herausforderung für eine effiziente und moderne Verwaltungs-IT dar.
Zu lange wurde in historisch gewachsene Infrastrukturen investiert, ohne ressort- und ebenenübergreifende Lösungen zu schaffen. Ein Mangel an zentral bereitgestellten Basiskomponenten hat diesen Zustand verstärkt. Die Registermodernisierung bietet nun Anlass, diese strukturellen Defizite durch die Verbindung von strukturellen Veränderungen und
digitalen Lösungen zu beheben. Ein Beispiel: Kommunen stehen auch durch die Registermodernisierung vor hohen Herausforderungen hinsichtlich der Informationssicherheit und den Kosten der dezentralen Infrastrukturen. Gleichzeitig müssen sie bei knappen Haushalten ihre IT deutlich effizienter gestalten.
Eine Zentralisierung ist weder verfassungsrechtlich noch aus Gründen der Resilienz die Antwort auf alle Fragen. Stattdessen braucht es eine moderne Interpretation von föderaler IT: Die föderale Struktur der Verwaltungs-IT sollte nicht mehr durch die physische Verteilung auf verschiedene Betriebsorte, sondern durch logische Mandantentrennung auf modernen und souveränen Cloudinfrastrukturen umgesetzt werden.
Diese Form föderaler IT ermöglicht es Kommunen, ausschließlich auf eigene Daten zuzugreifen – abgesichert durch moderne Verschlüsselung, Zero-Trust-Prinzip und Confidential Computing. Dadurch ergeben sich Sicherheitsund Effizienzgewinne dank Standardisierung in Architektur und Datenstrukturen. Das Konzept des „register-as-aservice“ oder einfach Cloudregister


setzt dieses Prinzip um und schafft einen Lösungsansatz für kommunale Herausforderungen: Mit der Trennung der Datenhaltung von der Datenbearbeitung durch einen API-Only-Ansatz und mit einer cloudbasierten Infrastruktur bei gleichzeitiger logischer Mandantentrennung können Register effizient und föderalismuskonform modernisiert werden. Die konkreten Lösungsansätze werden derzeit entwickelt.
„Die Registermodernisierung ist kein isoliertes IT-Projekt, sondern ein Großvorhaben von langfristiger Bedeutung für die Staatsmodernisierung.“
Michael Pfleger, Gesamtleiter NOOTS bei der FITKO.
Was jetzt zählt: Umsetzen im Verbund
Mit der erfolgreichen Umsetzung des NOOTS, der Diskussion um Cloudregister und der Konzeption eines verbindlichen föderalen Datenmanagements stehen wir an einem Wendepunkt. Die Registermodernisierung ist kein isoliertes IT-Projekt, sondern ein Großvorhaben von langfristiger Bedeutung für die Staatsmodernisierung. Die Verfügbarkeit des NOOTS ist dabei mehr als ein technischer Meilenstein – sie markiert einen wichtigen Schritt hin zum Kulturwandel. Die Registermodernisierung zeigt: Nur wenn technische Lösungen mit strukturellen Veränderungen Hand in Hand gehen, werden wir die Verwaltung nachhaltig modernisieren können.

Michael Pfleger ist Gesamtleiter NOOTS (Nationales Once-Only-Technical-System) bei der FITKO.
Foto:BS/FITKO








Register sind das Fundament des Verwaltungshandelns. Was früher Papierakten waren, sind heute Datenbestände. Sie sichern fast jede Verwaltungsleistung ab, von der Baugenehmigung bis zur Unternehmensgründung. Die Registermodernisierung knüpft daran an, nutzt digitale Mittel und verbindet sie mit einem institutionellen Reformanspruch.
Kernziel ist das Once-Only-Prinzip: Nachweise, also amtliche Bestätigungen wie Zulassungen oder Registereinträge, müssen Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen nur einmal vorlegen. Danach werden sie automatisiert und rechtssicher zwischen Behörden ausgetauscht. Damit wird deutlich: „Registermodernisierung“ bedeutet nicht, einzelne Register technisch aufzurüsten, sondern sie zu vernetzen und eine neue Kultur des Datenumgangs zu etablieren. Grundlage dafür sind das E-Government-Gesetz mit seinen Generalklauseln (§§ 5, 5a EGovG), das Identifikationsnummerngesetz und der NOOTS-Staatsvertrag. Erst wenn diese Bausteine zusammenwirken, können Nachweise effizient und rechtssicher abgerufen werden.
Lehren aus den bayerischen Erprobungsprojekten
Die technische Anbindung an das NOOTS ist lösbar. Der eigentliche Kraftakt liegt in der rechtlichen, organisatorischen und prozessualen Umsetzung. Fünf Felder haben sich
Ein erster Schritt, um die Registermodernisierung in die Breite zu tragen, liegt in der Identifikation der eigenen Rolle. „Der wichtigste Schritt bei der Vorbereitung ist sich darüber klar zu werden, was ich eigentlich wissen möchte“, erklärte Michael Pfleger, Gesamtprojektleiter für Registermodernisierung bei der FITKO. Der von seiner Organisation entwickelte Umsetzungsnavigator bietet dafür einen strukturierten Einstieg. In einem Selbstcheck können Kommunen, Behörden oder IT-Dienstleister prüfen, ob sie fachlich verantwortlich, betrieblich verantwortlich oder Softwarezulieferer sind. Diese Unterteilung ist keineswegs eine theoretische Spielerei, sondern hat direkte Konsequenzen für die praktische Arbeit.
„Auch zu den einzelnen Rollen bietet der Navigator jeweils eine Erläuterung dazu, was explizit der eigene Aufgabenbereich ist.“
Michael Pfleger, Gesamtprojektleiter Registermodernisierung, FITKO
Registermodernisierung ist Verwaltungsreform
(BS/Stephan Löbel) Unter der Leitung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales wird derzeit die praktische Umsetzung der Registermodernisierung im Rahmen von drei Erprobungsprojekten in den Bereichen Bau, Energie und Umwelt erprobt.
dabei als herausfordernd erwiesen:
• Definition und rechtliche Einordnung von Nachweisen Welche Informationen gehören zu einem Nachweis? Welche Rechtsgrundlage erlaubt den Abruf – und in welchen Verfahrenskonstellationen? Schon diese Grundfragen führten in der Praxis zu erheblichen Abstimmungsprozessen. Ohne klare fachrechtliche Zuordnung entsteht Rechtsunsicherheit, die Projekte ausbremst.
• Authentifizierung und Rollenvielfalt
Besonders herausfordernd war die Identifizierung der Beteiligten: Darf nur der Antragsteller einen Nachweis abrufen oder auch ein bevollmächtigter Vertreter, ein Rechtsanwalt oder ein Architekt im Auftrag? Gerade im Bauwesen sind solche Konstellationen üblich. Da Nachweise personenbezogen sind, ihre Einbringung aber regelmäßig durch Dritte erfolgt, entsteht ein Spannungsfeld zwischen Rechtssicherheit und praktischer Handhabbarkeit.
• Anpassung von Fachverfahren und Online-Diensten
Ein Nachweisabruf entfaltet seinen Mehrwert erst dann, wenn er Ende-zu-Ende in die Verwaltungsprozesse integriert ist. Dazu müssen Fachverfahren angepasst werden – etwa Formularlogiken, Workflows oder Schnittstellenstandards (XÖV). Auch Online-Dienste sind so zu gestalten, dass Nachweise unmittelbar weiterverarbeitet werden können. Andernfalls bleibt es bei einer digitalen Kopie des Papierdokuments – ohne Effizienzgewinn. • Datenqualität und Datenverständnis
Eine unterschätzte Herausforderung betrifft die Datenbestände selbst. Register enthalten Dubletten, widersprüchliche Felder oder schlicht veraltete Einträge. Doch das Problem reicht tiefer: Häufig ist gar nicht eindeutig definiert, welche fachrechtliche Bedeutung ein bestimmtes Feld überhaupt hat. Unter welchen Bedingungen darf ein Status geändert werden? Welche rechtlichen Folgen hat eine bestimmte Ausprägung? Die Registermodernisierung zwingt Verwaltung, diese Fragen zu beantworten und ihre Daten semantisch zu fundieren.
Föderale Vielfalt und kommunale Realität
Die föderale Struktur ist Chance und Herausforderung zugleich. Zentrale Register sind rasch anschlussfähig. Aber vor allem auch die kommunalen Register müssen von Anfang an mitgedacht werden. Kommunen sind oft stark von Softwareanbietern abhängig und verfügen selten über die Ressourcen, ihre Verfahren umfassend umzustellen. Ohne Referenzprozesse, Standards und Unterstützung droht eine strukturelle Überforderung.
Ausblick: Registermodernisierung als Reformchance
Entscheidend ist den Blick zu weiten und Registermodernisierung nicht als lästige Zusatzaufgabe, sondern als Reformchance zu begreifen. Sie zwingt dazu, Fachrecht zu klären, Prozesse zu standardisieren und Datenqualität als gemeinsame Verantwortung zu verstehen. Damit wird die Registermodernisierung zum Modernisierungsmotor: – weil Verfahren einfacher, schneller und transparenter werden. – weil klare Datenstrukturen und
So wichtig ist die Orientierung
(BS/fst) Die Registermodernisierung gilt als einer der zentralen Bausteine der digitalen Verwaltung in Deutschland. Während politische und rechtliche Rahmenbedingungen wie der NOOTS-Staatsvertrag den Weg ebnen, zeigt sich die eigentliche Herausforderung im praktischen Vollzug.

Die Registermodernisierung gilt als Schlüsselprojekt der digitalen Verwaltung – klare Rollen, Pilotprojekte und Nachnutzbarkeit sollen den Weg in die Praxis ebnen. Foto: BS/Andrii Yalanskyi, stock.adobe.com
Ende-zu-Ende-Prozesse Effizienzgewinne ermöglichen. – weil gemeinsame Standards Vielfalt nicht beschneiden, sondern handhabbar machen. Verwaltungswissenschaftlich markiert die Registermodernisierung den Schritt von einer dokumentenzentrierten zu einer datenbasierten Verwaltung. Praktisch bedeutet dies, dass öffentliche Stellen ihre Leistungen konsequent aus Sicht des Nachweisbedarfs denken – und damit stärker vernetzt, kooperativ und nutzerorientiert arbeiten. Registermodernisierung ist keine stille Nebenaufgabe, sondern eine grundlegende Verwaltungsreform im Hintergrund. Wer Registermodernisierung als dauerhafte Infrastrukturaufgabe versteht – vergleichbar mit Haushalt oder Personalmanagement – erkennt ihren wahren Wert: Sie schafft die Grundlage dafür, dass Verwaltung auch im 21. Jahrhundert leistungsfähig, rechtssicher und bürgernah handeln kann.

Löbel ist Geschäftsführer des SHI Stein-Hardenberg Instituts, ist fachlicher Berater für die bayerischen Erprobungsprojekte für die Umsetzung der Registermodernisierung.
Strukturen schaffen, Praxis erproben
Die abstrakte Systematik wird besonders dann greifbar, wenn erste Pilotprojekte in die Umsetzung gehen. Janine Werner, Landeskoordinatorin für Registermodernisierung in Rheinland-Pfalz, macht deutlich, wie wichtig dabei eine verbindliche
Wer die betrieblichen Verantwortlichkeiten trägt, muss vor allem die technische Basis sichern, also Themen wie IT-Sicherheit, Verfügbarkeit, Rechenzentrumskapazitäten und Notfallvorsorge im Blick behalten. Die fachlich Verantwortlichen konzentrieren sich hingegen auf den Umgang mit den Daten, stellen die Einhaltung rechtlicher Standards sicher und achten darauf, dass die Qualität und Logik der Schnittstellen gewahrt bleibt. Die Softwarezulieferer schließlich liefern den technischen Rahmen, indem sie neue Schnittstellen entwickeln, bestehende Fachverfahren anpassen und die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Systemen möglich machen. „Auch zu den einzelnen Rollen bietet der Navigator jeweils eine Erläuterung dazu, was explizit der eigene Aufgabenbereich ist“, betont Pfleger Für ihn ist entscheidend, dass nach der Identifikation der Rolle schnell ins konkrete Handeln übergegangen wird. Erst wenn klar sei, in welchem Verantwortungsbereich eine Organisation steht, könnten die Details zum eigenen Aufgabenbereich geklärt und die Umsetzung vorangetrieben werden.
Steuerung ist. „Wir setzen uns mit den einzelnen Fachbereichen auseinander, dienen als Ansprechpartner für Fragen aller Art und wir begleiten alle Pilotprojekte“, erläutert sie die Aufgaben ihrer Abteilung.
Pilotierung ist es zwangsläufig notwendig, genau zu analysieren, welche bestehenden Online-Dienste und OZG-Leistungen sich für die Anbindung eignen“, stellt sie klar. Damit sind vor allem Verfahren ge-
„Ziel ist es jetzt, Stück für Stück die anderen notwendigen Register ebenfalls direkt an den Online-Dienst digitaler Bauantrag anzuschließen.“
Dr. Karin Glashauser, Bayerisches Staatsministerium für Digitales
Governance-Strukturen seien unabdingbar, um das Nebeneinander unterschiedlich weit fortgeschrittener Behörden und IT-Dienstleister zu koordinieren und dabei eine gemeinsame Linie zu gewährleisten. Besondere Bedeutung misst Werner der Auswahl geeigneter OnlineDienste zu. „Für eine erfolgreiche
meint, die bereits heute Registerdaten abfragen und deshalb durch eine automatisierte Anbindung sofort spürbare Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger schaffen.
Pilot-Projekte als Orientierung Wie sich dies in der Praxis gestaltet, schildert Dr. Karin Glashauser
aus dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Am Beispiel des digitalen Bauantrags habe man getestet, wie Nachweise aus einem Register automatisiert abgefragt werden können. „Wir haben uns erstmal nur auf einen Nachweis innerhalb dieses Online-Dienstes konzentriert, nämlich den Nachweis der Bauvorlageberechtigung“, erklärt sie. Dafür wurden sowohl aufseiten des Registers als auch im Online-Dienst sichere Schnittstellen eingerichtet. Über das National-Once-Only-Technical-System (NOOTS) konnte der benötigte Nachweis direkt abgerufen werden, sodass die Antragstellenden diesen nicht noch einmal einreichen mussten. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies eine spürbare Entlastung, für die Verwaltung eine effizientere Bearbeitung. Glashauser zeigt sich überzeugt, dass dieser technische Ansatz auf andere Bereiche übertragbar ist. „Rein technisch ist das keine große Herausforderung. Ziel ist es jetzt, Stück für Stück die anderen notwendigen Register ebenfalls direkt an den Online-Dienst digitaler Bauantrag anzuschließen.“ Damit werde es möglich, langfristig weitere Online-Dienste mit den jeweils passenden Registern zu verknüpfen, wobei die Priorität in erster Linie auf OZG-Leistungen liegt. In dieser schrittweisen Erweiterung läge das Potenzial, das Prinzip der Registermodernisierung nach und nach im Verwaltungsalltag zu verankern.
Nachnutzbarkeit schaffen Abschließend betonten sowohl Werner als auch Pfleger, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung nicht nur Pilotprojekte, sondern vor allem eine sorgfältige Dokumentation brauche. Nur so könnten die Erfahrungen für andere Vorhaben nutzbar gemacht werden. „Es gibt bereits jetzt an verschiedensten Stellen spannende Projekte und Ansätze“, hält Pfleger fest. Doch die wenigsten davon stünden problemlos zur Nachnutzung bereit, was sich zeitnah ändern müsse.

Römer. Foto: BS/ZITiS
B
ehörden Spiegel: Dr. Römer, Sie sollen insbesondere die strategische Nutzung von KI weiterentwickeln. Was bedeutet das konkret für Ihre Rolle und Ihre Verantwortungsbereiche?
Dr. Jens Römer: Meine Hauptaufgabe ist, die vielfältigen KI-Aktivitäten innerhalb der ZITiS zu bündeln, zu professionalisieren und strategisch auf die Ziele der deutschen Sicherheitsbehörden auszurichten, damit unsere hohe KI-Expertise optimal genutzt wird. Ein paar konkrete Beispiele: Aus einer Analyse der zahlreichen bestehenden KI-Vorhaben wurde gemeinsam mit dem Führungsteam die KI-Strategie für die gesamte Organisation geformt. Diese Strategie definiert klare Ziele, Prioritäten und den Weg, wie wir KI für die Sicherheitsbehörden Deutschlands nutzbar machen wollen. Meine Aufgaben sind auch die aktive Förderung der geschäftsübergreifenden Zusammenarbeit und die Bereitstellung einer leistungsfähigen, zentral nutzbaren technischen Infrastruktur für KI-Entwicklungen. Darüber hinaus bin ich dafür verantwortlich, Vorgaben und Rahmenbedingungen zu schaffen, die unseren Experten ermöglichen, kreative und effektive KI-Lösungen zu entwickeln, die die Vorgaben der KI-Verordnung und des Datenschutzes erfüllen.
„Die ZITiS beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Training von KI-Modellen“
Behörden Spiegel: Das Bundesinnenministerium (BMI) hat ein KILeitbild als Richtlinie für Behörden herausgegeben. Wie fließt dieses in die Gestaltung der ZITiS-eigenen KI-Strategie ein?
Römer: Die von uns entwickelte KI-Strategie ist natürlich fest in den übergeordneten politischen und rechtlichen Rahmen eingebettet. Das vom BMI herausgegebene KI-Leitbild bildet dabei eine zentrale Leitplanke für unser Handeln. Insbesondere die dort definierten Handlungsfelder und Prinzipien geben uns eine klare Richtung vor. Sie stellen sicher, dass unsere technologischen Entwicklungen im Einklang mit den Werten und Zielen der öffentlichen Verwaltung stehen. Darüber hinaus haben wir die Rahmenbedingungen der europäischen KI-Verordnung von Anfang an in unsere strategische Ausrichtung integriert.
ZITiS will KI für Sicherheitsbehörden bestmöglich aufstellen
(BS/cb) Dr. Jens Römer, Vizepräsident und CTO der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS), hat eine ganze Reihe von Herausforderungen. Er will Künstliche Intelligenz-Lösungen für Deutschlands Sicherheitsbehörden nutzbar machen, muss sich dabei an KI- und Datenschutz-Richtlinien halten – und nicht zuletzt seinen Mitarbeitenden Zukunftsängste nehmen. Wie er all das vereint, verrät er im Interview mit Christian Brecht.
Wichtig ist: Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zur freien Wirtschaft. Wir setzen dort an, wo es für die spezifischen und hochsensiblen Anforderungen der Sicherheitsbehörden keine verfügbaren Produkte gibt. In diesen technologischen Nischen entwickeln wir maßgeschneiderte KI-Lösungen direkt für die Sicherheitsbehörden des Bundes. Zum einen entwickeln wir diese selbst, um konkrete operative Herausforderungen unserer Bedarfsträger zu lösen. Zum anderen beraten wir die Behörden, wenn diese eigene KI-Projekte aufsetzen und begleiten sie mit dem Team Vertrauenswürdige KI (VKI) bei der Umsetzung. Unsere Strategie sieht explizit vor, in Zukunft auch Projekte im Bereich der Hochrisiko-KI durchzuführen. Gerade hier können wir unsere Expertise einbringen, um den Sicherheitsbehörden zukunftsfähige und gesetzeskonforme Werkzeuge an die Hand zu geben. ZITiS-intern berät uns hierfür die neu eingerichtete KI-Koordinierungsstelle und schafft für uns den notwendige Governance- und Compliance-Rahmen.
Behörden Spiegel: Wie begegnet die ZITiS der Herausforderung, ausreichende, aber datenschutzkonforme Trainingsdaten für KI zu generieren?
Römer: Als Bundesbehörde unterliegen wir der Kontrolle durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Wir wurden bereits geprüft und stehen in einem regelmäßigen Austausch. Dabei wurde auch das Thema des datenschutzkonformen Trainings von KI-Systemen intensiv und konstruktiv diskutiert. Für uns ist diese Thematik nicht so neu, wie man vielleicht vermuten mag. Die ZITiS beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Training von KI-Modellen. Dabei halten wir uns konsequent an die strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – hier gibt es für KI-Trainings keine Ausnahme. Es ist unbestreitbar, dass die hohen Anforderungen des Datenschutzes einen gewissen Mehraufwand erzeugen. Daher ist es besonders wichtig, dass wir die bislang immer konstruktive und enge Zusammenarbeit mit unserem eigenen Datenschutzbeauftragten und der BfDI fortsetzen.
Behörden Spiegel: Wie begegnen Sie möglichen Ängsten vor KI in Ihrer Behörde und welche Maßnahmen fördern die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden?
Römer: Das ist ein enorm wichtiges Thema und dazu haben wir auch Umfragen unter unseren Mitarbeitenden durchgeführt. Dabei stellten sich vor allem zwei Haupt-Ängste heraus: Die KI macht meine Arbeit und dadurch mich überflüssig und die Sorge vor einer Arbeitsverdichtung durch die KI. Diese Punkte nehmen wir sehr ernst. Durch proaktive, ehrliche und regelmäßige Kommunikation auf unseren verschiedenen Kanälen vermitteln wir die Ziele und Chancen. Es geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern ZITiS zukunftsfähig zu machen. Die KI dient dem Menschen, nicht umge-
kehrt. KI ist keine magische Lösung für alles, sondern ein Werkzeug, das die Arbeit der Mitarbeitenden unterstützt. Sie wird sehr bald so selbstverständlich als Werkzeug genutzt werden wie der Akkuschrauber. Wir bieten unseren Mitarbeitenden gezielte Schulungsprogramme zur Weiterentwicklung an und haben zahlreiche Feedback Kanäle, um Ängste rechtzeitig zu identifizieren und aufgreifen zu können.
Behörden Spiegel: Gibt es konkrete KI-Meilensteine oder eine Roadmap?
Römer: Das Thema KI verlangt eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit. Keiner kann heute genau voraussagen, welche KI-Entwicklungen in einem Jahr verfügbar sind und welche Auswirkungen das für unsere Sicherheitsbehörden hat. Das bedeutet, dass wir offen und flexibel agieren müssen. Organisatorisch wurde die
ZITiS durch flache Hierarchien und Bündelung der Expertise in den Fachreferaten dafür bereits sehr gut aufgestellt. Das Thema KI ist mittlerweile in allen Geschäftsfeldern fest verankert, wie beispielsweise unser KI-Promotionsprogramm zeigt. Hier werden in allen Geschäftsfeldern relevante KI-Vorhaben für die Bedarfsträger vorangetrieben.
Hinweis
Im Interview mit Christina Baldermann in der September-Ausgabe hieß es, die an der Übung Locked Shields teilnehmenden Nationen hätten „in Tallinn Angriffs- und Abwehrszenarien“ trainiert. Korrekt ist, dass die Übung von Tallinn aus koordiniert wurde. Die teilnehmenden Nationen allerdings waren auf der ganzen Welt verteilt und online mit der Übung verbunden.
Der nächste Schritt mit dem SecurePIM WorkSPACE (BS) Als das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Jahr 2022 mit indigo (iOS Native Devices in Government Operation) erstmals die Nutzung nativer Apple-Geräte im vertraulichen Behördenumfeld bekannt gab, begann ein wichtiger Wandel: Behörden können seither iPhones und iPads in Kombination mit dem dazugehörigen indigo-Sicherheitskonzept offiziell für den Umgang mit VS-NfD-eingestuften Informationen einsetzen.

Seitdem entsteht rund um indigo ein wachsendes Ökosystem für sicheres mobiles Arbeiten, das zunehmend an Reichweite, Akzeptanz und praktischer Umsetzbarkeit gewinnt. Für Behörden ergeben sich daraus deutlich mehr Möglichkeiten, digitale Souveränität auch auf mobilen Endgeräten umzusetzen. Die vertraute AppleNutzungserfahrung verbindet sich dabei mit hohen Sicherheitsstandards – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum hochmobilen Behördenarbeitsplatz.
Der nächste Schritt: SecurePIM WorkSPACE
Auf dieser Basis stellt Materna Virtual Solution nun den SecurePIM WorkSPACE vor. Er erweitert die bekannten indigo-Grundfunktionen – E-Mail, Kalender und Kontakte – um ein umfangreiches Set an Modulen für das sichere ultramobile Arbeiten. Dazu gehören Aufgaben, Notizen, ein sicherer Browser, eine geschützte Kamera sowie die Möglichkeit, öffentliche Postfächer und Kalender für teamübergreifende Zusammenarbeit einzubinden. Zudem können behördenspezifische Fachanwendungen via Webzugriff einfach angebunden werden.
Der WorkSPACE ist modular aufgebaut und lässt sich individuell an die Anforderungen einzelner
Behörden anpassen – von der schlanken Lösung bis zur Arbeitsumgebung mit voller Funktionsbreite. So entsteht ein flexibler Arbeitsplatz, der Sicherheit mit effizienter Kollaboration verbindet.
Ein Plus an Sicherheit
Der WorkSPACE bietet dabei ein zusätzliches Plus an Sicherheit, da mögliches Nutzungsfehlverhalten weitgehend durch technische Schutzmechanismen abgefangen wird – sensible Informationen bleiben jederzeit geschützt. Gleichzeitig profitieren Mitarbeitende von einer intuitiven Nutzungserfahrung, die sich an ihrem gewohnten Arbeitsalltag orientiert.
Enge Abstimmung mit Apple und BSI
Als erster Apple Managed Service Provider für den öffentlichen Sektor arbeitet Materna Virtual Solution eng mit Apple zusammen. Ebenso besteht eine kontinuierliche Abstimmung mit dem BSI, insbesondere im Hinblick auf die Rahmenbedingungen der Verschlusssachenanweisung (VSA) und die offizielle Nutzung neuer Anwendungen im indigo-Umfeld. Dieses Know-how fließt direkt in die Weiterentwicklung des Ökosystems ein – für Lösungen, die heute schon halten, was morgen gefordert wird.
Flexibel zwischen stationär und mobil
Der SecurePIM WorkSPACE unterstützt zudem den nahtlosen Übergang vom stationären zum ultramobilen Arbeiten. Aktuelle iPads erreichen heute die Leistungsfähigkeit klassischer Notebooks und lassen sich über eine Dockingstation im Handumdrehen in eine Desktop-Umgebung verwandeln. Mitarbeitende nutzen damit ein Gerät für alle Szenarien – unterwegs, im Homeoffice oder im Büro – und behalten stets dieselbe Arbeitsumgebung und denselben Sicherheitsstandard.
Fazit
Mit der etablierten ContainerLösung SecurePIM wurde bereits der Grundstein für sicheres ultramobiles Arbeiten gelegt. Indigo und das darum entstehende Ökosystem bieten Behörden nun eine weitere Möglichkeit, ultramobiles Arbeiten sicher umzusetzen, Akzeptanz zu fördern und den Ansatz in die Breite zu tragen. Der SecurePIM WorkSPACE entwickelt diese Option konsequent weiter und liefert die Werkzeuge für eine moderne, kollaborative und hochmobile Arbeitswelt – ultramobil, ultrasicher, ultraeinfach. Made & Secured in Germany.
Die Risiken und Folgen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten werden bisher im Diskurs nicht oder lediglich unzureichend berücksichtigt. Cyber-Angriffe haben (in)direkte Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Beschäftigungsbedingungen. Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in ihrer Publikation „Cyber-Angriffe – Folgen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ darlegt, werden im Falle eines Cyberangriffs Arbeitsprozesse gestört und vor allem die Aufrechterhaltung des Betriebs sowie die Sicherstellung der Versorgung oder der Aufgabenerfüllung einer Institution stehen im Mittelpunkt. Demzufolge verschieben sich Gefährdungslagen und -konstellationen und führen zu neuen bzw. veränderten Risiken und Belastungen im Arbeitskontext. Manipulationen von Maschinen, Robotern, Drohnen, Autos oder Baumaschinen können Unfälle oder Havarien verursachen (z. B. im öffentlichen Nah-/Fernverkehr). Die externe Übernahme von Gebäudeautomatisierungen oder Temperatursystemen (z. B. das Ausschalten der Heizung im Winter) sind für jede Behörde denkbar und vermögen sich auf die Gesundheit sowie die Unfallgefahr im Büro auszuwirken. Im Bereich der Kritischen Infrastruktur können z. B. Unterbrechungen von Kühlketten temperatursensibler Stoffe oder mutwillige Manipulationen von
Risiken, Auswirkungen,
(BS/Jamie-Lee Campbell/Peter Biniok) Arbeitsplätze werden zunehmend digitaler und automatisierter. Damit bieten sich neue Möglichkeiten von und Gefahren durch Cyberangriffe. Davon sind längst nicht nur Großkonzerne betroffen. Auch kleine und mittlere Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen, staatliche Behörden sowie besonders Institutionen im Bereich der Kritischen Infrastruktur werden Ziele von Cyber-Angriffen.
(explosionsgefährdeten) Stoffgemischen Gefahren für die Belegschaft darstellen. Stress, Belastung und Übermüdung über längere Zeiträume sowie umständliche Arbeitsprozesse aufgrund von Cyber-Angriffen und diesbezüglichen Shutdowns können die Unfallgefahr durch menschliches Versagen erhöhen. Solche Auswirkungen sollten nicht nur zum Zeitpunkt des Angriffs, sondern auch in ihren mittel- bis langfristigen Folgen für das Unternehmen oder die Behörde betrachtet werden.
Cyber-Sicherheit und Arbeitsschutz verknüpfen Hinzu kommt, dass Cyberangriffe bislang kaum mit dem Arbeitsschutz verknüpft werden. So liegen nach wie vor keine systematischen Daten darüber vor, wie sich Attacken auf Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten oder Fehlzeiten auswirken. Eine Folge davon ist, dass viele Gefährdungen zwar theoretisch erkennbar, aber bislang nicht messbar sind. Erste Überlegungen sehen vor, in Unfall- oder Krank-
ADVERTORIAL
Das Fundament für echte Cloud-Souveränität
(BS) Im Interview mit dem Behörden Spiegel spricht Norbert Müller, Chief Strategy Officer des Berliner Unternehmens enclaive, über ein neues Level an Datensicherheit in der Cloud.

B ehörden Spiegel: Herr Müller, warum gewinnt Confidential Computing gerade im öffentlichen Sektor an Bedeutung?
Norbert Müller: Der Staat verfügt über die sensibelsten Daten seiner Bürger und Unternehmen, von Melderegistern über eingestufte, sicherheitsrelevante Informationen bis hin zu Gesundheitsdaten. Wie sich diese Daten effizient und sicher in der Cloud verwalten lassen, ist für Behörden ein bisher ungelöstes Problem.
Behörden Spiegel: Und Confidential Computing ist die Lösung?
Müller: Genau. Daten werden jetzt auch während der Verarbeitung in sogenannten „Enklaven“ verschlüsselt und vor unbefugtem Zugriff geschützt – selbst in Hyperscaler- oder Multi-Cloud-Umgebungen. Damit ist Confidential Computing das Fundament für echte Cloud-Souveränität.
Entscheidend ist, dass die Krypto-Schlüssel unter der Kontrolle des Anwenders bleiben. Dann haben weder Cloud-Provider noch Administratoren Zugriff auf die Daten. So können Cloud- und KITechnologien souverän genutzt werden. Voraussetzung ist ein eigenständiges Key Management und eine ausfallsichere MultiCloud-Architektur – genau das ermöglicht enclaive.
Behörden Spiegel: Stichwort KI: Auch hier bietet Confidential Computing Schutz?
Müller: Absolut. Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz eröffnen sich enorme Chancen, gleichzeitig steigen die Anforderungen an den Datenschutz. Mit Confidential AI können Behörden KI-Tools sicher einsetzen, ohne dass sensible Informationen gefährdet werden. Idealerweise wird dabei eine sogenannte GenAI-Firewall genutzt, die sensible Daten automatisch erkennt und aus den Analysen herausfiltert. So können große Datenbestände effizient analysiert, Prozesse beschleunigt und Entscheidungen fundierter getroffen werden – und das alles ohne das Risiko eines Datenlecks.
Behörden Spiegel: Sind die heterogenen IT-Landschaften in der Verwaltung ein Problem?
Müller: Nicht für enclaive. Unsere verschlüsselten Enklaven lassen sich ohne Anpassungen am Code in jede Infrastruktur integrieren. Das bedeutet: Behörden und andere öffentliche Einrichtungen können sofort in ihre digitale Zukunft starten – sicher und souverän.
heitsmeldungen eine eigene Kategorie „in Verbindung mit einem Cyber-Angriff“ einzuführen, um dadurch ein empirisches Fundament zu schaffen. Dies könnte helfen, besonders gefährdete Branchen wie Gesundheitswesen, Energieversorgung oder Transport gezielter zu erfassen und Risiken realistisch einzuschätzen.
Neue Herausforderung für Gefährdungsbeurteilung Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, Gefährdungen systematisch zu beurteilen und Schutzmaßnahmen abzuleiten. Doch Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigen bislang kaum Risiken, die durch Cyberangriffe entstehen. So können etwa Manipulationen an Sensoren, Notabschaltungen oder längere IT-Ausfälle völlig neue Belastungen hervorrufen, die in klassischen Szenarien nicht vorgesehen sind. Fachleute fordern daher, Gefährdungsbeurteilungen um mögliche Folgen von Cyberangriffen zu erweitern Auch die psychischen Belastungen dürfen nicht unter-
schätzt werden. Während eines Cyber-Angriffs befinden sich Beschäftigte in einer Ausnahmesituation: Verantwortliche in Krisenstäben arbeiten häufig unter Zeitdruck und mit extremen Überstunden, während Beschäftigte in der Linie auf manuelle Prozesse umsteigen müssen. Untersuchungen zeigen, dass die Belastung sogar Monate nach einem Vorfall anhalten kann – etwa wenn aufgrund polizeilicher Ermittlungen über Wochen keine gewohnten Systeme zur Verfügung stehen. Solche Langzeitfolgen wirken sich auf Konzentration, Arbeitszufriedenheit und Unfallrisiken aus. Im Bereich des Arbeitsschutzes beschäftigt sich die Fachgruppe „Arbeitsstätten, Maschinen- und Betriebssicherheit“ der BAuA mit der Frage, wie zuverlässig KI-Anwendungen sind und wie sie in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden können, ohne das bestehende Schutzniveau für Beschäftigte zu senken. Auch im bestehenden Regelwerk zum Arbeitsschutz gewinnt das Thema Cyber-Angriffe an Relevanz. Die Technische Regel für
Betriebssicherheit TRBS 1115 enthält Empfehlungen zum Umgang mit Risiken durch Angriffe auf die Cyber-Sicherheit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regel-Einrichtungen. Neben den Aktivitäten der BAuA verweist auch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen auf die genannten Zusammenhänge hin und bietet erste Anregungen zur Umsetzung an. Um den zukünftigen Herausforderungen von Cyber-Angriffen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz gerecht werden zu können, ist im Bereich der Verwaltung ein Awareness-Aufbau zu den Risiken und Gefährdungen wichtig, um die richtigen Weichen zu stellen und den Arbeitsschutz mitzudenken.


Jamie-Lee Campbell ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Sicherheit und Gesundheit.
Foto: BS/BAuA-Bund
mit G DATA Managed Extended Detection and Response (BS) Cyber-Angriffe nehmen rasant zu und damit auch die Herausforderungen für Kommunen. Viele IT-Verantwortliche sind mit der effektiven Absicherung ihrer IT-Systeme überfordert. Es mangelt an Zeit, Personal und tiefgreifendem Fachwissen. IT-Sicherheit ist unter diesen Bedingungen kaum leistbar. Die Lösung für das Problem ist G DATA 365 | MXDR (Managed Extended Detection and Response).

Cyber-Attacken sind heute oft individualisiert und dateilos. Angreifer nutzen ungeschlossene Sicherheitslücken in Anwendungen oder Betriebssystemen aus oder sie setzen auf Phishing, um an Zugangsdaten zu kommen. Als Resultat sind Städte über eine lange Zeit arbeitsunfähig. Ein hundertprozentiger proaktiver Schutz vor Attacken ist kaum möglich. Es kommt daher darauf an, die Vorgänge im Netzwerk zu überwachen, schädliche Aktivitäten aufzuspüren und sofort richtig darauf zu reagieren. Genau dies leistet die deutsche Security-OperationsCenter-Lösung (kurz SOC): G DATA 365 | MXDR.
24/7-Rundumschutz
Ein erfahrenes Analystenteam überwacht bei G DATA 365 | MXDR das Netzwerk rund um die Uhr. Die Managed-SOC-Expertinnen und -Experten haben alle Vorgänge im Blick und betreiben Threat Hunting: Sie analysieren verdächtige Aktivitäten und Unregelmäßigkeiten, um schädliche
Vorgänge aufzudecken. Für die Analyse von Aktionen steht den Fachleuten eine moderne Sensorik zur Verfügung. Handelt es sich um einen Angriff, erfolgt eine umgehende Reaktion, um diesen zu beenden – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hierdurch wird eine Attacke in der Anfangsphase gestoppt, bevor der Schaden groß ist.
IT-Verantwortliche werden über Vorfälle informiert und finden in der Webkonsole zusätzlich alle relevanten Informationen. Sie können auch nachvollziehen, welche Maßnahmen ergriffen wurden. Zusätzlich führt das Analystenteam Root-Cause-Analysen (RCA) durch, um die Ursachen von Sicherheitsvorfällen zu identifizieren und daraus fundierte und für Kundinnen und Kunden verständliche Handlungsempfehlungen in deutscher Sprache abzuleiten. Starke technologische Basis G DATA 365 | MXDR basiert auf selbst entwickelten SecurityKomponenten. Diese werden kon-
tinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand der ITSicherheit sind. Städtischen IT-Verantwortlichen stehen persönliche Ansprechpartner zur Seite, unterstützt von einem preisgekrönten deutschsprachigen 24/7-Support. G DATA setzt bei seiner Managed-SOC-Lösung auf eine direkte persönliche Betreuung. Beim Onboarding berät das Cyberdefense-Unternehmen individuell und thematisiert dabei aktiv das Thema Datenschutz. Dabei wird unter anderem festgelegt, auf welchen Endpoints welche spezifische Response stattfinden soll. Das Onboarding erfolgt wahlweise durch G DATA oder gemeinsam mit einem IT-Security-Dienstleister. Deutscher Cyberdefence-Partner Die Bedeutung der digitalen Souveränität in Europa nimmt stetig zu. Kommunen können sich heute nicht mehr voll auf außereuropäische Anbieter verlassen. Daher sind die Themen Vertrauen und Souveränität bei der Wahl des passenden Managed-SOC-Anbieters sehr wichtig. G DATA Cyberdefence ist in Deutschland ansässig und unterliegt damit den strengen deutschen Datenschutzrichtlinien.
G DATA ist der einzige Anbieter, der einen SOC-Service vollständig aus Deutschland bietet: Analysten, Support, Entwicklung und Server sind am Unternehmenssitz angesiedelt. Dieses umfassende deutsche Komplettpaket gewährleistet hochwertigen Schutz vor Cyber-Bedrohungen – echte Cyber-Defense „Made in Germany“.
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Oktober 2025
www.behoerdenspiegel.de


(BS/Lars Mahnke) In den vergangenen Monaten machten immer wieder Angriffe und Attentate mit Messern Schlagzeilen. So fielen erst im September die Urteile gegen die Täter der islamistischen Terroranschläge in Solingen und Mannheim. Sie wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch sind solche medienwirksamen und geplanten Terrorakte nur die Spitze des Eisbergs – die viel größere Gefahr lauert im Alltag.
Denn eine Vielzahl von Messerangriffen hat ihren Ursprung in Auseinandersetzungen im Rahmen von Nachbarschafts-, Beziehungs- und Familienstreitigkeiten oder im Freizeit- und Ausgehbereich. Dabei handelt es sich selten um geplante Taten, sondern meist um eine Eskalation im Affekt. Sie geschehen häufig unter Einfluss von Alkohol und Drogen.
Zunehmend ist ein Trend zum Messer festzustellen. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Berichtsjahr 2024 insgesamt 29.014 Straftaten als „Messerangriff“ erfasst, davon 15.741 im Bereich der Gewaltkriminalität. In Berlin zählt die Polizei inzwischen fast zehn Fälle täglich, in Niedersachsen durchschnittlich acht. Nordrhein-Westfalen verzeichnete 2023 insgesamt 3.540 Messerangriffe im öffentlichen Raum. Dies entspricht einem Anstieg von 43 Prozent innerhalb eines Jahres. In besonderem Fokus stehen dabei Verkehrsmittel und öffentliche Plätze. Die Bundespolizei registrierte 2023 fast 800 Messerangriffe in Bahnhöfen und Zügen, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2019. Junge Männer als Haupttäter Messerkriminalität ist vor allem ein Phänomen junger Männer. Bis zu 90 Prozent der Tatverdächtigen sind männlich, fast die Hälfte jünger als 21 Jahre, ein kleiner, aber wachsender Anteil sogar Kinder unter 14. Auch die Opfer sind überwiegend männlich. Das Messer dient dabei häufig als Statussymbol, Ausdruck von Stärke. Auch zum Selbstschutz bewaffnen sich viele Jugendliche. Sie begründen das Mitführen von Messern mit dem Wunsch nach Selbstverteidigung. Dieses Motiv
hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Doch gerade dieser Schutzgedanke ist gefährlich. Denn wer ein Messer bei sich trägt, setzt es im Konfliktfall eher ein. Kriminologen sprechen von einem gefährlichen Kreislauf: Je mehr Menschen Messer mitführen, desto unsicherer fühlen sich andere – und bewaffnen sich ebenfalls. Soziale Faktoren verstärken diesen Trend. Gewalterfahrungen, Armut und Perspektivlosigkeit oder der Konsum von Alkohol und Drogen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Gewalthandlungen. Hinzu kommen Männlichkeitsbilder, die Härte und Dominanz verherrlichen. Psychische Erkrankungen und Belastungen spielen ebenfalls eine wachsende Rolle. Aus Sicht von Fachleuten kann auch die mediale Dynamik das Messertragen unter Jugendlichen normalisieren und so selbst Teil der Gewaltspirale werden.
Repression und Prävention
Seit 2024 können bundesweit Waffenverbotszonen in Bussen, Bahnen, Bahnhöfen oder auf Volksfesten eingerichtet werden, was vielerorts bereits umgesetzt wird. Kriminologen betonen jedoch, dass Repression allein nicht ausreiche. Waffenverbotszonen könnten zwar die lokale Sicherheit verbessern, doch sie verlagern das Problem häufig in private Räume. Nachhaltig wirksam seien nur präventive Ansätze: Frühzeitige Aufklärung in Schulen, Stärkung sozialer Kompetenzen, gezielte Betreuung von Intensivtätern und Hilfen im Bereich psychischer Gesundheit. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte vergangenes Jahr einen Zehn-PunktePlan vor: Dazu zählen Maßnahmen wie Waffentrageverbote für Inten-
sivtäter, großangelegte Kontrolltage, Videoüberwachung an Brennpunkten, konsequente persönliche Vernehmungen sowie Präventionsarbeit in Flüchtlingsunterkünften. Unter dem Motto „Besser ohne Messer“ wird in mehreren Sprachen für Verzicht und Deeskalation geworben.
„Behörden müssen sich auf die Mehrfachtäter fokussieren und alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um deren kriminelles Handeln und Aktionsradius zu begrenzen“
Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG)
Ein zentrales Argument für entschiedene Maßnahmen ist die Letalität von Messern. Anders als Schusswaffen sind sie leicht verfügbar, billig und legal von jedem zu erwerben. Selbst kleine Klingen können lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Dies gilt umso mehr, als dass Konflikte im öffentlichen Raum häufig unter Alkoholeinfluss eskalieren. Die Folgen des Einsatzes eines Messers sind nur schwer zu kalkulieren. Und wer das Messer tatsächlich gezielt einsetzen möchte, um möglichst schwere Verletzungen zu verursachen, der findet im Internet mit Leichtigkeit Anleitungen, wie er größtmöglichen Schaden verursachen kann.
Auch die Polizei sieht sich zunehmend gefährdet. Angriffe mit Stichwaffen gehören für viele Einsatzkräfte inzwischen zum Alltag. Gewerkschaften fordern daher neben stichsicherer Schutzkleidung bessere Einsatzmittel wie Distanz-Elektro-Impuls-Geräte (DEIG). Erst im September hat das Bundesinnenministerium den Abschlussbericht zum Einsatz der Geräte vorgelegt, in dem diese aus „einsatztaktischer und technischer Sicht“ als „sehr geeignetes“ Führungs- und Einsatzmittel bezeichnet werden.
Strafmaß und Abschreckung Ein weiterer Diskussionspunkt ist das Strafrecht. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte bereits im Mai angekündigt, Messerangriffe sollten zukünftig nicht mehr nur als Vergehen, sondern als Verbrechen gelten und mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem statt einem halben Jahr geahndet werden. Es gibt aber auch Experten, die zu bedenken geben, dass harte Strafen allein nicht abschrecken. So zeigen empirische Untersuchungen, dass ein höherer Strafrahmen nicht zwangsläufig abschreckend wirkt – bedeutender sei die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Gleichwohl setzen Politiker und Polizeigewerkschaften auf konsequente Strafverfolgung, insbesondere gegen Mehrfach- und Intensivtäter. In Nordrhein-Westfalen sollen Wiederholungstäter im Rahmen des Zehn-Punkte-Plans an die Straßenverkehrsbehörden gemeldet werden, um ihnen den Führerschein zu entziehen. Umgekehrt plädieren Kriminologen für differenziertere Reaktionen: Nicht jeder Jugendliche mit einem
Taschenmesser sei ein potenzieller Gewalttäter. Wichtig sei, früh zu erkennen, wo aus jugendlicher Unsicherheit reale Gefahren entstehen –und wo pädagogische Ansätze mehr bewirken als strafrechtliche Härte. Die Polizeigewerkschaften sehen in Messerangriffen ein Dauerproblem. Daher fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) klare Regeln, wirksame Waffenverbotszonen, deren konsequente Durchsetzung und eine bessere Ausrüstung der Polizei. Zudem müsse sich die Polizei verstärkt auf Mehrfachtäter fokussieren. Die DPolG Berlin plädiert sogar für eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters auf zwölf Jahre, um frühzeitig eingreifen zu können. Den bundesweiten Einsatz von DEIGs unterstützt sie ausdrücklich. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht von einem „Messerproblem“, das längst Alltag im Polizeidienst sei. Um des Problems Herr zu werden, fordert sie mehr Personal, moderne Technik wie KIgestützte Bedrohungserkennung und ein umfassendes Präventionskonzept, das vor allem junge Männer erreicht. Auch sie befürwortet ein strengeres Waffenrecht, warnt aber gleichzeitig: Gesetze nützten wenig, wenn sie nicht durchgesetzt werden könnten.
In einem Punkt sind sich beide Gewerkschaften einig: Messerangriffe sind keine Randerscheinung mehr, sondern eine ernsthafte Bedrohung für Sicherheit und Ordnung. Ohne mehr Personal, bessere Ausrüstung und entschlossenes Handeln werde sich das Problem weiter verschärfen – mit fatalen Folgen für Bürgerinnen, Bürger und Einsatzkräfte. Daher sei die zielgruppengerechte Präventionsarbeit mit Jugendlichen von zentraler Bedeutung.
Gleich zwei aktuelle Lagebilder des Bundeskriminalamts (BKA) zeigen ein deutliches Bild: Verbrechen an Kindern und Jugendlichen bleiben auf einem hohen Niveau. In mehr als 200 Verfahren erfasste das BKA im vergangenen Jahr Kinder und Jugendliche als Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung. Insgesamt wurden 576 Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Das sind die Ergebnisse des Bundeslagebilds „Menschenhandel und Ausbeutung 2024“. Als Grund für diese Zahlen nennt das BKA fehlende Schutzmechanismen auf vielen Online-Portalen. Dies begünstige die Ausbeutung Minderjähriger über das Internet. In zwei Fällen seien Kinder sogar im Internet zum Kauf angeboten worden. Laut BKA ging es zudem in 195 Fällen um kommerzielle sexuelle Ausbeutung. Auch zum gesamten Deliktsbereich „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2024“ veröffentlichte die Sicherheitsbehörde Ende August ein Lagebild. Das zeigt zwar keinen Anstieg, aber auch keinen echten Abstieg. Die Delikte gegen Kinder und Jugendliche blieben nahezu konstant, lagen damit jedoch weiterhin über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt. Im vergangenen Jahr erfassten die Behörden 16.354 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs und 1.191 Fälle des Missbrauchs von Jugendlichen. Verglichen mit dem Vorjahr sanken beide Zahlen um 0,8 Prozent. Der Fünf-Jahres-Durchschnitt von Missbrauchstaten an Kindern liegt laut dem BKA-Bericht bei 15.670 und an Jugendlichen bei 1.155. Insgesamt wurden 19.344 Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Missbrauchstaten – 430 weniger als 2023. Einen Höchstwert erreichten die Fälle von Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Inhalte. Im Berichtsjahr 2024 verzeichnete das BKA hier 9.601 Fälle. Verglichen mit dem Jahr zuvor entspricht das einem Anstieg von 8,5 Prozent. Nach Angaben des BKA haben sich die Fallzahlen seit dem Jahr 2020 damit mehr als verdreifacht.
Der Fokus ist gesetzt „Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Hinweisen auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bleibt deren Bekämpfung ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden in Deutschland“, erklärte BKA-Präsident Holger Münch. So habe das BKA inzwischen die personellen Kapazitäten in diesem Phänomenbereich erhöht. Mit einem Ausbau der technischen Fähigkeiten wolle die Behörde zudem die Täter „noch schneller und effektiver“ identifizieren und kriminelle Strukturen zerschlagen. „Dazu gehen wir gemeinsam mit den Polizeien der Länder regelmäßig gegen Betreiber von Plattformen im sogenannten Darknet vor, auf denen Abbildungen und Videos von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen verbreitet werden“, sagte Münch weiter.
Kinder- und Jugendschutz bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe
(BS/Mirjam Klinger) Kinder und Jugendliche stehen bei Fragen der Sicherheit im Fokus. Sie sind in vielen Bereichen des Lebens auf Schutz angewiesen und zugleich zunehmend Risiken ausgesetzt. Behörden, Politik und Hilfsorganisationen arbeiten seit Jahren daran, Schutzmechanismen zu verbessern. Doch wie wirksam sind die bisherigen Maßnahmen zum Schutz der Kleinsten tatsächlich?

falen heißt es: „Auch Aufgaben des Opferschutzes und der Kriminalprävention nimmt die Polizei wahr. In Bezug auf den Kinderschutz verfolg die Polizei das Ziel, dass Anzahl und Ausmaß von Straftaten gegen Kinder und Jugendliche reduziert werden.“ Die Maßnahmen der Polizei im Kinderschutz seien vielfältig und die Beamtinnen und Beamten handelten nicht erst bei aktuellen Gefährdungslagen, sondern kontinuierlich. Konkret informiert die Polizei, klärt auf und vermittelt Opfer an örtliche Beratungs- und Hilfsangebote.
In Bremen startete im September das Präventionsprojekt „#Aufgeklärt! Wissen schützt Kinder im Netz“. Die Polizei Bremen entwickelte das Projekt gemeinsam mit der Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD), und dem Senator für Inneres und Sport, Ulrich Mäurer (SPD). Ziel des Projekts ist es, Kinder im Grundschulalter frühzeitig für Risiken im Netz wie Cybergrooming, Fake News und digitale Belästigung zu sensibilisieren und ihre Medienkompetenz zu stärken. Das neue Präventionskonzept stützt sich auf drei Säulen: Schülerarbeit mit altersgerechten Unterrichtseinheiten wie „Flizzy in Gefahr“ und geplanten Puppenspie-
„Die Zeit für isolierte Pilotprojekte ist vorbei.“
Denis Wieser, Mitglied der Kinderschutzallianz
Neben der bundesweiten Strafverfolgung mit dem BKA spielt in den Ländern zudem kontinuierliche Präventionsarbeit eine zentrale Rolle. Die Polizei Sachsen-Anhalt bezeichnet Kinderschutz als „sehr wichtigen Teil der polizeilichen Präventionsarbeit“. In Nordrhein-West-
len zum Thema Cybergrooming, Elternarbeit in Form von Infoabenden zu Gefahren wie Sexting – also dem Senden und Empfangen von sexuell eindeutigen Text-, Sprachnachrichten, Fotos oder Videos über digitale Geräte wie Smartphones oder Computer – oder Pornografie sowie
Lehrkräftequalifizierung durch gezielte Fortbildungen. Geplant ist ein Start der Maßnahmen nach den Herbstferien in diesem Jahr. Schulen, Eltern und Polizei sollen dabei eng zusammenarbeiten, um Kindern ein sichereres digitales Umfeld zu bieten.
Das Werkzeug liegt auf dem Tisch 2012 und damit vor über zehn Jahren trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft – die immer noch geltende Gesetzgebung zum Kinderschutz. Das Gesetz beinhaltet sowohl den vorbeugenden Schutz von Kindern als auch das Eingreifen bei Verletzungen des Kinderschutzes. Das damalige Ziel: Den Kinderschutz in Deutschland verlässlicher und wirksamer zu machen. Außerdem schuf das Bundeskinderschutzgesetz die rechtliche Grundlage für die Gründung der Bundesstiftung Frühe Hilfen, die ihre Arbeit Anfang 2018 aufnahm. Aufgabe der Stiftung: Die Förderung Früher Hilfen sowie die psychosoziale Unterstützung von Familien mit Kinder bis drei Jahren. Alle Akteure im Kinderschutz – wie Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – sollen dabei miteinander vernetzt und miteingebunden werden. Nach Einschätzung der Kinderschutzallianz besteht der größte Verbesserungsbedarf weniger in der Kooperationsbereitschaft, sondern in den strukturellen Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit auf operativer Ebene sei grundsätzlich von großem Vertrauen und Respekt geprägt. „Der dringendste Handlungsbedarf liegt in der konzertierten Umsetzung der bereits vorhandenen, systemischen Lösungen“, erklärt Denis Wieser, Mitglied der Kinderschutzallianz gegenüber dem Behörden Spiegel. Mit Sorge blicke die Allianz auf die Entwicklung,
dass immer mehr Kinder und Jugendliche als Opfer von Verbrechen registriert würden. Die Situation erfordere einen Paradigmenwechsel. „Die Zeit für isolierte Pilotprojekte ist vorbei“, so Wieser. Stattdessen müsse präventive Sicherheitsbildung als fester Bestandteil der Bildungslandschaft anerkannt werden. Zudem sollten politische Rahmenbedingungen für eine bundesweit nachhaltige Umsetzung geschaffen werden. Darüber hinaus brauche es ein qualitätsgesichertes, skalierbares System wie den „Sicheren Hafen“ als nationalen Standard. „Anstatt das Rad neu zu erfinden, ermutigen wir Behörden auf Landes- und Kommunalebene, auf bewährte Strukturen zurückzugreifen und die Einführung des ‚Sicherer Hafen‘-Konzepts in den Schulen, Kitas und Vereinen ihres Zuständigkeitsbereichs zu koordinieren und fördern.“ Das Konzept des Sicheren Hafens wurde von der Kinderschutzallianz entwickelt. Das System ist darauf angelegt, bundesweit genutzt zu werden – qualitätsgesichert und dauerhaft tragfähig. Zertifizierte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren machen ihre Einrichtung, sei es Schule, Kita oder Verein, zu einem „Sicheren Hafen“. Dort werden Kinder in Basiskompetenzen wie Notruf, Wahrnehmung des eigenen Bauchgefühls und dem Setzen von Grenzen geschult. Zudem werden Arbeitsgemeinschaften (AGs) angeboten, die nach den Vorgaben der Kinderschutzallianz konzipiert sind. „Alle notwendigen Konzepte, digitalen Werkzeuge und praxiserprobten Schulungen liegen auf dem Tisch. Der dringendste Handlungsbedarf ist nun das entschlossene, gemeinsame Handeln aller Akteure“, sagt Wieser
Gefährliche Lücken
Für mehr Kinderschutz fordern die Grünen-Politikerinnen Denise Loop und Anna Lührmann im Umgang
mit sozialen Medien eine „Zeitenwende“. Klare Regeln mit Fokus auf Kinderrechte seien nötig – Verbote allein reichten nicht aus. Damit stellen sie sich gegen ihren Parteikollegen Cem Özdemir, der kürzlich ein Verbot von Plattformen wie TikTok oder Instagram für unter 16-Jährige ins Gespräch brachte. Auch die Bundesregierung prüft strengere Vorgaben. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) präsentierte Anfang September die neue Expertenkommission „Kinderund Jugendschutz in der digitalen Welt“, die eine Strategie mit konkreten Empfehlungen für Bund, Länder und Zivilgesellschaft erarbeiten soll. Themen sind ein sicheres digitales Umfeld, gesundheitliche Folgen von Medienkonsum und die Stärkung der Medienkompetenz. Neben Ländern und Fachleuten sollen auch Jugendliche selbst eingebunden werden. Die Kinderschutzallianz warnt vor dem nahezu unbegrenzten Zugang zu riskanten Inhalten im Netz, der junge Nutzer häufig überfordere. Kinder seien technisch versiert, es fehle ihnen aber an Risikokompetenz und Resilienz. Der Kinderschutzbund verfolgt einen anderen Ansatz. Er lehnt pauschale Altersgrenzen ab und betont das Recht von Kindern und Jugendlichen auf digitale Teilhabe. Vizepräsident Joachim Türk fordert daher mehr sichere Räume im Netz, die speziell auf junge Nutzer zugeschnitten sind. Zwar gebe es bislang nur wenige kindgerechte Angebote, doch diese müssten dringend ausgebaut werden – etwa durch altersgerechte Plattformen mit klaren Schutzmechanismen und Unterstützungssystemen. Ein generelles Verbot hingegen würde Jugendliche unvorbereitet in die Erwachsenenwelt entlassen und ihnen zugleich wichtige Chancen zur Teilhabe nehmen. Aus Sicht des BKA stellt vor allem das Dunkelfeld weiterhin eine große Herausforderung für die Polizei dar. Viele Fälle, insbesondere im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs, blieben unentdeckt. Laut einer im Juni veröffentlichten Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit nennen Betroffene vor allem Scham und die Sorge, ihnen werde ohnehin nicht geglaubt, als Gründe für ihr Schweigen. Das BKA betont deshalb, Aufgabe der Polizei sei es, dieses Dunkelfeld „aufzuhellen“. Dazu solle die Arbeit weiter intensiviert werden. Nach Angaben der Behörde wurde hierfür in den vergangenen Jahren die Zahl der Mitarbeitenden in den Polizeibehörden von Bund und Ländern, die sich mit Fällen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen befassen, deutlich erhöht.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass der Polizei in diesem Bereich Befugnisse fehlen, zum Beispiel bei Mindestspeicherfristen von IP-Adressen oder bei der Telekommunikationsüberwachung. So seien der Polizei bei Ermittlungen häufig die Hände gebunden. Wie die GdP fordert auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Online-Durchsuchungen. In einem Positionspapier hatte die DPolG in einem Positionspapier betont, dass hierfür schnellstmöglich eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden müsse. Die Polizei müsse in der Lage sein, nicht nur den Technik- und Zeitvorsprung krimineller Täter im Netz auszugleichen, sondern künftig auch mit der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung Schritt zu halten. „Der Staat sollte sich im Interesse seiner Bürger nicht seiner eigenen Verfolgungsund Aufklärungsmittel berauben.“
Im Jahr 2024 verzeichnete das polizeiliche Informationssystem INPOL 48.254 Pkw-Fahndungsnotierungen. Dies entspricht einem Minus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Rückgang erklärt das BKA vor allem mit verstärkten polizeilichen Kontrollen. Immer häufiger gelingt es, betrügerisch erlangte Miet- oder Leasingfahrzeuge bereits vor Verkauf oder Verschiebung ins Ausland sicherzustellen. Gleichzeitig stieg die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Pkw leicht auf 16.129 Fälle (plus1,3 Prozent). Besonders betroffen sind Fahrzeuge der Hersteller VW, Audi, Mercedes-Benz und BMW. Bezogen auf die sogenannte „Belastungszahl“ (Entwendungen pro 100.000 Fahrzeuge) weisen allerdings Land Rover und Jeep die höchsten Werte auf.
Anstieg der Unterschlagungen Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Unterschlagungen: Fast ein Viertel aller dauerhaft verschwundenen Pkw wurde 2024 auf diesem Weg entzogen. Dies entspricht einem Zuwachs von über 31 Prozent. Täterinnen und Täter nutzen dabei gefälschte Ausweise, Scheinfirmen oder manipulierte Einkommensund Wohnungsnachweise, um Fahrzeuge über Kredite oder Mietverträge zu erlangen. Anschließend werden diese rechtswidrig weiterveräußert, wobei das Darknet zunehmend eine zentrale Rolle einnimmt. Auch die Zahl der dauerhaft entwendeten Lkw stieg 2024 um 6,3 Prozent. Am stärksten betroffen waren Fahrzeuge von Renault, Mercedes-Benz und VW. Wohnmobile verzeichnen mit 473 Fällen erneut hohe Werte, besonders häufig betroffen sind Modelle von Fiat. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten verursachen diese Fälle besonders hohe Schadenssummen. Darüber hinaus bleibt der Teilehandel ein lukratives Feld: Airbags,
Autoschieber sind zunehmend international vernetzt
(BS/lm) Das aktuelle Bundeslagebild zur Kfz-Kriminalität des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt insgesamt leicht rückläufige Fahndungsnotierungen. Es offenbart aber auch, dass Autodiebstahl und Kfz-Betrug dynamische Kriminalitätsfelder mit hoher internationaler Vernetzung bleiben. Für die Sicherheitsbehörden bedeutet dies eine weiterhin anspruchsvolle Lage.

Diebe greifen immer häufiger zu technischen Werkzeugen wie Code-Grabbern zum Kopieren von Funksignalen oder Jammern zum Blockieren von GPS-Trackern ein, um die elektronischen Sicherheitssysteme der Hersteller zu überwinden.
Scheinwerfer, Multimedia-Systeme oder Sensoren werden gezielt entwendet und in der Folge mit hohen Gewinnmargen über Online-Marktplätze verkauft. Dabei zerlegen Tätergruppen gestohlene Fahrzeuge professionell in vornehmlich osteuropäischen Werkstätten in ihre Einzelteile – durch anonymisierte Verkaufswege und fehlende Identifikationsmerkmale einzelner Bauteile ist das Entdeckungsrisiko für die Täter gering. Beim klassischen Diebstahl bedienen sich die Täter vor allem technischer Manipulationen. Sie
Foto: BS/Александр
verschaffen sich Zugang über den sogenannten CAN-Bus, nutzen Code-Grabber zum Kopieren von Funksignalen oder setzen Jammer ein, um GPS-Tracker zu blockieren. Besonders das Keyless-Go-System bleibt eine Schwachstelle: Fahrzeuge können mit Funkstreckenverlängerern blitzschnell geöffnet und gestartet werden, wenn sich der Schlüssel in der Nähe befindet. Nach wie vor verbreitet sind Dubletten: Gestohlene Fahrzeuge werden mit den Daten baugleicher Modelle versehen und mit gefälschten Papieren in Verkehr gebracht. Allein
182.000 Blanko-Dokumente sind derzeit im Fahndungsbestand. Täter beschaffen sich die notwendigen Daten über Online-Anzeigen oder nutzen Unterlagen von Unfallfahrzeugen. Spätestens bei der Anmeldung bei der Zulassungsbehörde fällt der Betrug auf – bis dahin haben die Fahrzeuge jedoch häufig mehrfach den Besitzer gewechselt.
Internationale Absatzmärkte
In der internationalen Dimension der Kfz-Kriminalität bleibt Osteuropa die wichtigste Transit- und Absatzregion, wobei insbesondere Polen eine zentrale Rolle spielt. Die Türkei fungiert als Drehscheibe für Transporte in den Nahen und Mittleren Osten sowie nach Zentralasien. Besonders attraktiv sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier besteht eine hohe Nachfrage nach Luxusfahrzeugen und Kfz-Teilen. Nach Nordafrika gelangen gestohlene Fahrzeuge vor allem über spanische und italienische Häfen. Westafrika, darunter Länder wie Ghana, Senegal oder die Elfenbeinküste, wird zunehmend über west- und südeuropäische Häfen beliefert. Eine besondere Herausforderung stellt für die Strafverfolgungsbehörden die Verschiebung per Container dar, weil die Fracht oft falsch deklariert ist. Frankreich gewinnt zudem als Transit- und Zielstaat zunehmend an Bedeutung. Dort erleichtert das rein digitale Zulassungssystem Tätern die Registrierung der Fahrzeuge.
2024 registrierte die Polizei 22.330 Tatverdächtige im Bereich KfzKriminalität, was einen Zuwachs von 13,6 Prozent bedeutet. Rund die Hälfte hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Besonders stark stieg der Anteil rumänischer Tatverdächtiger, vor allem im Zusammenhang mit Anmiet- und Leasingbetrug. Die Tätergruppierungen agieren in der Regel arbeitsteilig: vom Ausspähen geeigneter Fahrzeuge über den technischen Diebstahl bis hin zu Transport, Verschleierung und Absatz. In Einzelfällen werden dabei auch Minderjährige eingebunden. Die Kfz-Kriminalität passt sich kontinuierlich an neue Sicherheitsstandards und Marktbedingungen an. Während klassische Diebstähle durch Technik erleichtert werden, gewinnen betrügerische Erlangungen wie Unterschlagungen stark an Bedeutung – ein Feld, das ohne besonderes technisches Know-how auskommt und daher eine niedrige Zugangsschwelle für Täter bietet. Für die Sicherheitsbehörden ergeben sich daraus mehrere Handlungsfelder. So sollten über verstärkte Kontrollen, insbesondere an Grenzen, Häfen und Transitstrecken, Fahrzeuge bereits vor der Verschiebung sichergestellt werden. Zudem rücken technische Manipulationen wie Keyless-Go oder CAN-Bus-Angriffe zunehmend in den Fokus. Auch die Bekämpfung von Online-Kriminalität gewinnt an Bedeutung, da Absatzwege sich zunehmend über das Darknet und andere Internetplattformen etablieren. Durch eine intensivere Zusammenarbeit mit Kfz-Herstellern können technische Sicherheitslücken geschlossen werden. Zusätzlich muss den grenzüberschreitenden organisierten Strukturen durch internationale Kooperationen, insbesondere mit Transit- und Absatzstaaten, begegnet werden.
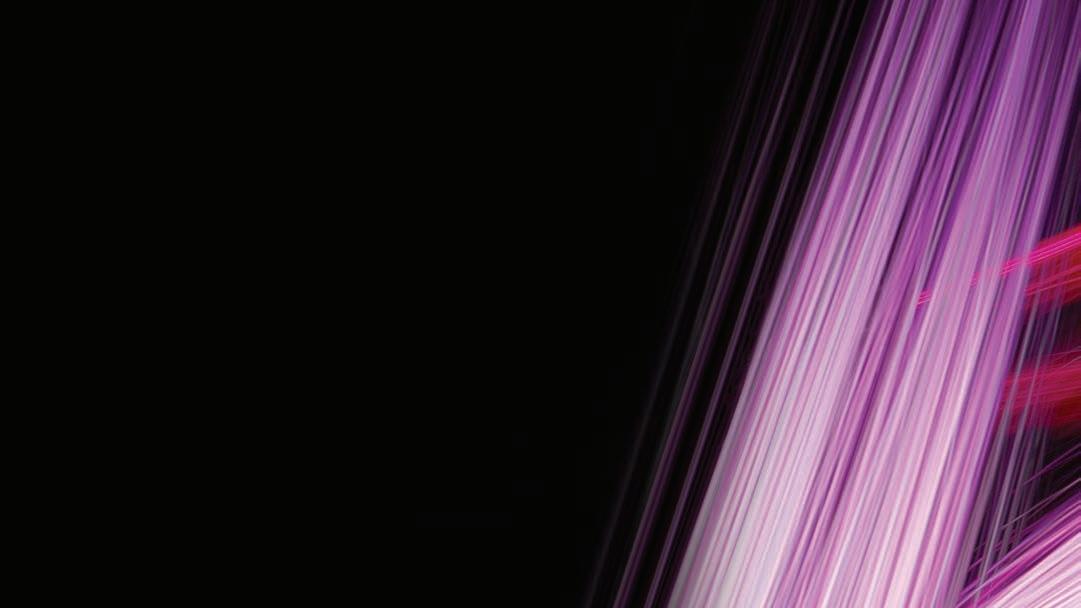
Von VS-NfD bis GEHEIM. Erfahren Sie mehr.
Hinter der großen Schlagzeile
„Neuer Wehrdienst“ ist eine weitere gesetzliche Anpassung – obwohl am selben Tag beschlossen –ohne nennenswerte Beachtung geblieben. Zu Unrecht, denn mit dem Gesetzentwurf „Militärische Sicherheit“ und der darin enthaltenen Neufassung des Gesetzes über den Militärischen Abschirmdienst (MAD) reagiert die Bundesregierung auf die zunehmende Bedrohung durch Sabotage in Deutschland. Außerdem schließt sie eine Gesetzeslücke. Hauptanliegen der Regierung ist, dem MAD und der Bundeswehr mehr Möglichkeiten zur Abwehr von Cyber- und Drohnenangriffen einzuräumen. Darüber hinaus nimmen sie sich der 4.800 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten an, die bis 2027 in Litauen stationiert werden sollen.
Das Drohnen-Problem löst sich nicht von selbst
Insbesondere für die Drohnenabwehr stellten Kompetenzverteilungen bisher eine Herausforderung dar. So zeichnete die Bundeswehr vor der Novellierung ausschließlich für die Drohnenabwehr über ihren eigenen Liegenschaften verantwortlich. Verlässt ein unbemanntes Luftfahrzeug den Luftraum unmittelbar über dem Gelände der deutschen Streitkräfte, obliegt der Polizei die Verfolgung und Bekämpfung. Das führte in der Vergangenheit zu Problemen. Denn die Kompetenzgrauzone war den Drohnenpilotinnen und -piloten scheinbar bekannt. Häufig kreisten die unbemannten Luftfahrzeuge auf Höhe der Zäune, welche das militärische Hoheitsgebiet der Bundeswehr vom zivilen Verantwortungsbereich der Polizei abgrenzt. Dieses Problems möchte die schwarz-rote Regierung Herr werden. Fortan sollen insbesondere die Feldjäger im Nahebereich außerhalb von Militärstandorten Drohnenpilotinnen und -piloten überprüfen. Sollte deren Identität nicht festgestellt werden können, ist es der Militärpolizei erlaubt, verdächtige Personen festzusetzen und zur nächsten Dienststelle der Bundeswehr oder der Polizei zu bringen. „Die Feststellung der Identität von
Mehr Kompetenzen für den MAD
(BS/jb) Sabotage und Spionage nehmen in Deutschland seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu. Die Bundesregierung möchte dem stärker entgegentreten. Eine Kompetenzerweiterung des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) soll das leisten. Das betrifft auch einen Bereich, den es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nicht gab.
Verfassungstreue der Soldatinnen und Soldaten an. Das Gesetz zur Stärkung des personellen Schutzes (BwSchutzG) gibt dafür den Rahmen. Für einige Truppenangehörige könnte das die Urlaubsplanung verhageln. Denn unter Paragraf 8 „Reiseanzeigen, Zustimmungsvorbehalt, Reiseverbot“ ist zu lesen, dass „Privatreisen in

Die Soldatinnen und Soldaten der Brigade Litauen stehen verstärkt im Fokus nachrichtendienstlicher Aufklärung fremder Mächte. Foto: BS/Bundeswehr, Mario Bähr
Personen auch außerhalb von militärischen Sicherheitsbereichen soll durch Absatz zwei neu geschaffen werden, um der veränderten hybriden Bedrohungslage wirksam begegnen zu können“, heißt es im Gesetzentwurf. Dafür gibt es aber Voraussetzungen. Es müssen An-
haltspunkte vorliegen, „dass durch das Verhalten der Person die Einsatzbereitschaft, Schlagkraft oder Sicherheit der Truppe gefährdet werden könnte“. Das Mitführen bestimmter Gegenstände kann darauf hindeuten. Neben den bereits erwähnten unbemannten Luftfahrzeugen zählen dazu Waffen, Einbruchswerkzeuge und Beobachtungshilfen.
Schutz für die Soldatinnen und Soldaten in Litauen
Die neue Rolle der Dienste
Zwischen weltpolitischen Paradigmen und realweltlichen Bedrohungen
In diesem Jahr mit:
Torsten Voß, Leiter Landesamt für Verfassungsschutz, Behörde für Inneres und Sport Hamburg
Thomas Krense, Leiter Verfassungsschutz, Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Elmar May, Leiter Verfassungsschutz, Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz
Arndt Freytag von Loringhoven, Botschafter a.D., ehemaliger Vizepräsident BND

keiten der Kommunikationsüberwachung geht der Gesetzentwurf hingegen ins Detail.
cherheitsüberprüfung der Stufe 1 (SÜ1) für alle Rekrutinnen und Rekruten als Voraussetzung für die Ausbildung an der Waffe durchzuführen. Für das Amt stellte das eine Belastung dar. Mit dem neuen System soll der Aufwand der Überprüfung abnehmen. Auszüge aus dem Bundeszentralregister, eine Abfrage im Nachrichtendienstlichen Informationssystem NADIS und die Auswertung „allgemein zugänglicher Quellen“ – darunter fallen zum Beispiel die Aktivitäten in den Sozialen Medien – geben mit der neuen Regelung Ausschlag für die Entscheidung.
15. – 16. OKT 2025 Hotel Adlon Kempinski Berlin






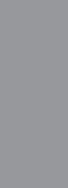
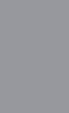




Die dauerhafte Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen ist Neuland für die Bundesregierung. Die Premiere erfolgt unter herausfordernden Bedingungen. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten in Litauen werden naturgemäß im besonderen Interesse russischer Sabotage und Spionage stehen. Bisher fehlten allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen, um darauf zu reagieren. Dem Abschirmdienst war es bislang nicht erlaubt, im Ausland bei deutschen Staatsbürgern aktiv zu werden. Mit der Gesetzesanpassung ist jetzt Abhilfe geschaffen. Fortan ist es dem militärischen Geheimdienst erlaubt, zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten der Panzerbrigade 45 und deren Angehöriger in Litauen Ermittlungen anzustellen. Im Gesetzentwurf klingt das folgendermaßen:
„Die Tätigkeiten des Militärnachrichtendienstes im Ausland richten sich künftig auf die Landes- und Bündnisverteidigung aus.“ Dieser Fokussierung werde der Gesetzentwurf gerecht und ermögliche damit zum Beispiel eine verbesserte Abschirmung der Brigade in Litauen, heißt es im Text weiter. Konkretes, wie das vonstattengehen soll, lässt der Gesetzentwurf allerdings vermissen. Bei den neuen Möglich-
Der MAD hört mit Der Dienst darf sowohl bei klassischen als auch bei neuen Medien aktiv werden. Artikel 18 des Gesetzentwurfs erlaubt die Überwachung der Telekommunikation sowie des Brief- und Postverkehrs. Um im digitalen Raum aufzuklären, ist es dem MAD fortan erlaubt, besondere Auskunftsverlangen an Telekommunikationsunternehmen zu stellen. Das gilt auch, wenn fremde Mächte Cyber-Angriffe auf die Bundeswehr und das BMVg durchführen. Abgefragt werden dürfen IP-Adressen, Standortdaten und gespeicherte Kommunikationsverbindungen. Zusätzlich kann der MAD fortan seine Auskunftsersuche an digitale Dienstleister stellen, die nur indirekt den Telekommunikationsunternehmen zuzurechnen sind. Das betrifft zum Beispiel Anbieter vernetzter Fahrzeuge oder von Plattformdiensten. Insbesondere die Fahrzeugüberwachung ist für die geheimdienstliche Nutzung attraktiv, weil sensor- und GPS-bestückte Kraftfahrzeuge Auskunft über den Standort und zurückgelegte Strecken der zu überwachenden Person geben. „Die aktiven Fahrzeugvernetzungen ermöglichen den Herstellern eine Fernabfrage und Fernüberwachung von Standortdaten […] über eine Person, ohne an die Fahrzeuge heranzutreten“, heißt es im Gesetzesvorschlag.
Der Sotschi-Urlaub ist vorerst gestrichen
Allerdings richtet die Novellierung den Blick nicht nur nach außen: Der Gesetzgeber geht gleichsam die Maßnahmen zur Prüfung der
Für den Fall der Fälle Der Neuausrichtung auf die Bedürfnisse der Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) entsprechend schaffen die Gesetzesanpassungen erstmals klare Vorschriften dafür, welche Kompetenzen für den MAD im Bündnis- und Verteidigungsfall freigeschaltet werden. Der Gesetzentwurf spricht von „vom Normalfall abweichenden Sondervorschriften, die den Notwendigkeiten einer mit einem Spannungs- und einem Verteidigungsfall einhergehenden Ausnahmesituation angemessen gerecht werden“. Konkret handelt es sich bei den angestrebten Maßnahmen um Vereinfachungen, um Prozesse zu beschleunigen.Dahinter verbirgt sich die mit dem erheblichen Bedarf an personellem Aufwuchs begründete Außerkraftsetzung der Herausgabefristen für Systeme der Informationstechnik und die unabhängige Datenschutzkontrolle. Darüber hinaus sind Mitteilungs- und Auskunftspflichten bis zum Ende des Konfliktes vertagt und die Hürden für das Übermitteln personenbezogener Daten gesenkt. Der Wegfall dieser Verfahren soll bisher in den Prozessen gebundene Personalressourcen für die zwingenden Aufgaben der Verteidigung urbar machen.
Das Ausmaß der Ahr-Kata strophe als Nichtbetroffener zu erfassen, ist auch vier Jahre nach den Ereignissen kaum möglich. Auf einer Schneise von 40 bis 50 Kilometern zerstörten gewaltige Wassermassen Hab und Gut, rissen Infrastruktur mit sich und kosteten 135 Menschen das Leben. „Solche Katastrophen haben unsere bisherigen Konzepte des Katastrophenschutzes an ihre Grenzen geführt“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) auf dem Polizeitag des Behörden Spiegel und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mainz. Es habe geradezu apokalyptische Züge gehabt. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass solche oder ähnliche Lagen künftig häufiger auftreten“, so Ebling weiter. Die ersten Schritte zu mehr Resilienz seien bereits unternommen worden. Das Katastrophenschutzgesetz wurde novelliert, Definitionen wurden geschärft und Zuständigkeiten klarer zugeordnet. Zudem wurde das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) gegründet, das über ein 24/7-Lagezentrum verfügt. Ziel sei es, das LfBK zu einem umfassenden Kompetenzzentrum auszubauen, so Ebling. Schließlich will die Landesregierung auch die kommunale Gefahrenabwehr stärken – durch zusätzliche Mittelzuweisungen, Ausbildungsoffensiven für Einsatzkräfte und eine Stärkung des Ehrenamts. „Es ist ein langer Weg zur Neuaufstellung des Katastrophenschutzes. Mit einer großen Rede allein ist es nicht getan“, betonte Ebling
Liebesgrüße aus … Zeitgleich sehen sich die Sicherheitsbehörden im Land mit einer neuen Bedrohung konfrontiert: Hybride Angriffe nehmen zu. „Die Welt hat sich seit dem russischen Angriffskrieg verändert“, konstatiert Ebling. Deutschland sei ein Ziel geworden. Zwar gebe es keine direkten Angriffe, aber es würden „Nadelstiche“ gegen Infrastrukturen gesetzt. Sabotageakte, Drohnenüberflüge und Desinformationskampagnen seien immer wieder zu beobachten. „Wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden“, warnt der Innenminister. Rheinland-Pfalz sei dabei besonders exponiert – wegen der Stationierungen und militärischen Infrastrukturen der US-Armee sowie der ansässigen Pharmaindustrie. Dadurch verschwimmen die Gren-
Alte und neue Gefahrenlagen auf dem Polizeitag Mainz diskutiert
(BS/bk) Die Flutnacht vom 15. Juli 2021 und der monatelange Einsatz von Polizei, Katastrophenschutz und Verwaltung beschäftigen die Verantwortlichen bis heute. Neben den Lehren aus der Katastrophe treten neue Bedrohungen hinzu, die nicht minder herausfordernd sind. Alte Mechanismen wie die Zivil-Militärische Zusammenarbeit sind wieder an der Tagesordnung. Klar ist: Die Sicherheitsbehörden wollen krisenfester werden – auch wenn das gewohnte Abläufe infrage stellt.

Auf dem Polizeitag Mainz stand die Krisenresilienz der Sicherheitsbehörden im Vordergrund. Die Ahr-Katastrophe war allgegenwärtig. Impulse lieferten u. a. die GdP-Landesvorsitzende Aline Raber, Innenminister Michael Ebling und Behörden Spiegel-Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll. Foto: BS/Biskup-Klawon
die Fragen nicht gestellt werden, bekommen wir auch keine“, so der Minister. Insgesamt sei mehr Resilienz in den Sicherheitsbehörden erforderlich.
Flexible Haushaltsmittel gefordert
Damit rennt Ebling bei der Landesvorsitzenden der GdP RheinlandPfalz, Aline Raber, offene Türen ein. „Im Bundesvergleich stehen wir gar nicht schlecht da“, so Raber. Es seien große Fortschritte erzielt worden, etwa bei der Einführung der E-Akte, beim Einsatz von Tasern, bei der Persönlichen Schutzausrüstung sowie bei der Modernisierung der Fahrzeugflotte.
Doch es gibt auch ein „Aber“: Vor allem die IT-Infrastruktur sei überlastet – teilweise dauere es Minuten, bis eine einfache PDF-Datei geöffnet werde. Raber fordert leistungsfähigere Netze, redundante Strukturen und eine sichere Notstromversorgung. Digitalisierung müsse konsequenter gedacht werden: leistungsstarke Leitstellen, sichere Funk- und Datennetze, Echtzeit-Lagedarstellungen und perspektivisch auch der Einsatz von KI, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Besonders kritisch

Katastrophen dürften nicht isoliert betrachtet werden, sagte Polizeipräsident Jürgen Süs. Foto: BS/Biskup-Klawon
zen zwischen innerer und äußerer Sicherheit zunehmend, so Ebling Daraus ergäben sich schwierige Fragen: Wer ist in Deutschland zuständig, wenn äußere Bedrohungen die innere Sicherheit berühren? Dabei gehe es nicht nur um unmittelbare Gefahrenabwehr, sondern um Kompetenzverteilung. Wie schließen Bund, Ländern, Polizei, Nachrichtendiensten und Bundeswehr die Fähigkeitslücken, die aktuell noch bestehen? All dies erfordere engere und agilere Formen der Zusammenarbeit – zivil wie militärisch, ist Ebling überzeugt. „Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wenn
sieht Raber die Beschaffungsprozesse, die viel zu langsam seien. Technik, die heute noch topaktuell sei, könne morgen schon überholt sein. „Unsere Haushaltsstrukturen halten mit dieser Geschwindigkeit nicht Schritt. Pandemie und Flut haben gezeigt: Wir brauchen flexiblere Verfahren und Haushaltsmittel, die im Krisenfall sofort zur Verfügung stehen“, fordert Raber Größer denken
Ähnliche Mängel bestätigt auch Jürgen Süs, Präsident des Polizeipräsidiums Koblenz. In der Retrospektive auf die Ahr-Katastrophe
hält er fest, dass die Verantwortlichen weder ein Erkenntnis- noch ein Motivations- oder quantitatives Problem hätten, sondern dass die Vernetzung zwischen verschiedenen Einsatzorganisationen verbessert werden sollten. „Wir müssen solche besonderen Einsatzlagen wie die Ahr-Katastrophe in größeren Zusammenhängen denken“, fordert Süs. Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Flutkatastrophe meistens isoliert betrachtet werde, obwohl es zeitgleich Einsatzlagen in Belgien mit 41 Toten und in Trier mit einem Toten gegeben habe. Die Frage, die sich stelle, ist laut Süs, ob die momentanen Verwaltungsabläufe noch zeitgemäß seien. Es seien neue Kooperationen nötig.
Neue Probleme, neue Strukturen? Die Aufgabenliste bleibt lang: Bei künftigen Lagen müsse der Lageüberblick verbessert werden. Die Krisenkommunikation, auch mit der Bevölkerung, müsse klar und konsistent nach innen und nach außen vollzogen werden. Dazu zählten auch ein Social-Media-Monitoring sowie die Bereitstellung von Informationen für die Bürgerinnen und Bürger. Vor allem im Zusammenhang mit Staatslegitimierenden, die in Zukunft wahrscheinlich häufiger in solchen Einsatzlagen auftreten, brauche es eine bessere Kommunikation und Vorbereitung. Ebenso müsse eine Vorplanung mit Spontanhelfern umgesetzt werden.
Als polizeiinterne Probleme identifizierte Süs, dass es im Ahrtal Probleme bei der Leichenidentifi-
zierung gegeben habe. Hier brauche es eine Vereinheitlichung zwischen den Landespolizeien und dem Bundeskriminalamt (BKA). Zudem habe es ein länderübergreifendes Problem bei der Datenerhebung von Personenanfragen und Vermisstenmeldungen gegeben. So seien die Datensätze von NRW und Rheinland-Pfalz in der Anwendung
richten. Im Unterschied zu anderen Einsätzen sei die Ahr-Katastrophe kein täternaher Einsatz gewesen, sondern ein opfernaher Einsatz. Diese Besonderheit habe z. B. die Folge gehabt, dass die eingeübten Verarbeitungsmechanismen nicht funktioniert hätten. Außerdem sei bei der Katastrophenlage weniger eine polizeitypische Ermittlungsarbeit gefordert gewesen. Zudem habe die Möglichkeit einer Distanzierung gefehlt, wie sie bei einem täterfokussierten Einsatz möglich sei. Der lange Einsatz habe für die psychische Belastung sein Übriges getan.
Laut Schwaab muss es nicht immer eine psychosoziale Beratung sein, um den seelischen Wunden entgegenzuwirken. Besonders die zwischenmenschlichen Beziehungen zu Familie und Freunden stünden dabei im Vordergrund – auch wenn es nur die Polizei-Familie sei. Dennoch sei es optimaler, wenn die Möglichkeit der Sozialberatung in der Polizei schon vorher bekannt gemacht werde.
Lehre aus Ramstein Ein besonderes Problem stellte Schwaab bei der Betreuung von Fremdkräften fest, da diese nicht immer erfasst wurden. Hier müsse die Abstimmung verbessert werden. Aber nur weil der Einsatz abgeschlossen gewesen sei, heiße dies nicht, dass seine Arbeit beendet sei, so Schwaab. Die Nachsorge nehme immer noch einen hohen Stellenwert ein. „Die Ahr-Katastrophe beschäftigt die Einsatzkräfte immer

Martin Schwaab kritisiert die fehlende Wertschätzung der Polizeibediensteten nach der Ahr-Katastrophe durch die Politik. Foto: BS/Biskup-Klawon
GSL.net nicht aufeinander abgestimmt gewesen. Schlussendlich kritisiert er die fehlende Wertschätzung und Anerkennung der polizeilichen Leistungen in der medialen und politischen Diskussion. Übliche Mechanismen funktionieren nicht mehr Welche Leistungen die Polizeibeamtinnen und -beamten vollbracht haben und welche seelischen Wunden davongetragen wurden, weiß Martin Schwaab, Sozialberater des Polizeipräsidiums Koblenz, zu be-

noch“, sagt der Sozialberater. Er weiß, dass sich z. B. Traumata langsam über Monate und Jahre entwickeln können. Das habe beispielsweise das Ramstein-Unglück gezeigt. Deswegen sei eine Dokumentation hinsichtlich eines möglichen späteren Dienstausfalls wichtig.
Aber auch Schwaab zeigt sich über die politische Auseinandersetzung nach der Katastrophe enttäuscht: „Der Untersuchungsausschuss verdrängte den Arbeitseinsatz der Kollegen“, so Schwaab

Behörden Spiegel: Was war der Auslöser Ihrer Studie?
Dr. Andreas Follmann: Der Auslöser geht ein Stück weit in die Vergangenheit zurück. Auf dem letzten DGKM-Forum haben wir mit Generalarzt Dr. Bruno Most von der Bundeswehr darüber gesprochen, dass dort eine Umfrage zur Verfügbarkeit von Reservistinnen und Reservisten durchgeführt wurde. Es ging darum, wie einsatzbereit sie unter bestimmten Umständen wären – sei es für den militärischen Einsatz, sei es in Doppelfunktionen, etwa im Bevölkerungsschutz oder in der Kritischen Infrastruktur. Schon damals war vielen von uns klar, dass dieses Problem nicht nur die Bundeswehr betrifft, sondern genauso den Katastrophen- und Zivilschutz. In den vergangenen Wochen ist das Thema auch zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wir sind deshalb froh, dass die Ergebnisse nun veröffentlicht werden konnten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ich selbst habe zahlreiche Doppelrollen. Ich arbeite als Anästhesist an der Uniklinik, bin Notarzt für die Stadt Aachen, gleichzeitig leitender Notarzt, und darüber hinaus auch in Katastrophenschutzkonzepten aktiv – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Rheinland-Pfalz. Damit gibt es sogar einen überregionalen Anteil, der bislang kaum berücksichtigt wird. Das Problem ist: Diese Doppelrollen werden nirgendwo systematisch erfasst. Viele Kolleginnen und Kollegen stehen – genauso wie ich – in unterschiedlichen Konzepten als verfügbar auf dem Papier. Aber tatsächlich kann man nur eine dieser Rollen gleichzeitig ausfüllen. Genau das ist die Herausforderung und wir haben versucht, dieses Missverhältnis erstmals mit Zahlen greifbar zu machen.
Behörden Spiegel: Können Sie kurz die Ergebnisse skizzieren?
Dr. Follmann: Wir haben insgesamt knapp 4.000 Rückmeldungen erhalten. Befragt wurden nicht nur bereits aktive Ehrenamtliche, sondern auch Menschen, die ein Interesse am Ehrenamt haben. Im Mittelpunkt
Der neue Entwurf ähnelt in großen Teilen dem Vorgängerentwurf der Ampel-Regierung. Mit dem Gesetzesvorhaben soll die Richtlinie (EU) 2022/2557 über die Resilienz kritischer Einrichtungen (sog. CER-Richtlinie) in nationales Recht umgesetzt werden. Durch bundeseinheitliche Regelungen für den physischen Schutz Kritischer Infrastrukturen sollen die Resilienz der Wirtschaft und dadurch auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gestärkt werden, heißt es vonseiten des BMI. Länder- und Verbändestellungnahmen würden noch angefordert.
Anpassungen bei Betreibern und BBK-Aufgaben
Der neue Entwurf erweitert die Zahl der betroffenen Betreiber kritischer Anlagen von 1.400 auf 1.700 und benennt erstmals explizit die abgedeckten Sektoren. Dazu zählen neben Energie, Transport und Verkehr, Finanzwesen und Sozialversicherung auch Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gesundheitswesen, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Weltraum sowie die Siedlungsabfallentsorgung.
Damit werden nicht nur klassische Infrastrukturen, sondern auch neue Bereiche systemrelevant definiert. Die Zuständigkeiten der Bundesbehörden bleiben weitgehend unverändert, jedoch wurden Fristen für die Benennung der Lan-
Das Problem der Doppelverpflichtungen (BS) Deutschland setzt im Katastrophenfall auf mehr als 1,7 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Eine aktuelle Studie der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin (DGKM) weckt Zweifel, ob diese Zahlen verlässlich sind. Im Gespräch erklärt DGKM-Präsident Dr. Andreas Follmann, welche Gefahren Doppelverpflichtungen bergen und welche Lösungen es gibt. Die Fragen stellte Bennet Biskup-Klawon.

DGKM-Präsident Dr. Andreas Follmann fordert u. a. eine bessere Helfergleichstellung.
Foto: BS/privat
stand die Frage nach Doppelrollen im Bevölkerungsschutz, aber auch nach hauptberuflicher Tätigkeit in der Kritischen Infrastruktur. Wir wollten Verfügbarkeiten erfassen und verstehen, welche Hinderungsgründe bestehen. Was hält die Menschen im Ernstfall davon ab, in den Einsatz zu gehen? Ist es die Familie, die Betreuung von Kindern oder sogar die Verantwortung für Haustiere?
Das Ergebnis: Rund 20 Prozent aller Befragten gaben an, mindestens zwei Doppelrollen zu haben – beispielsweise gleichzeitig in der Feuerwehr und in einer Hilfsorganisation. Insgesamt haben wir 3.680 verwertbare Antworten ausgewertet. Dabei ging es einerseits um die Zahl der Doppelrollen, andererseits um die Frage, wie viele Personen mit Blick auf die letzten Alarmierungen tatsächlich an Einsätzen teilnehmen konnten. Und das Ergebnis ist in gewisser Weise erschreckend: Nur etwa 44 Prozent der Kräfte sind tatsächlich verfügbar.
Besonders deutlich wird das bei denjenigen, die im Bereich der Kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. Hier ist zu erwarten, dass sie im Zweifel ihrem Hauptarbeitgeber
Vorrang geben – und genau das haben wir auch abgefragt. Hinzu kommen weitere Hinderungsgründe, die verhindern, dass eine Einsatzkraft im Katastrophen- oder Zivilschutz verfügbar ist. Wenn man das auf die Gesamtheit hochrechnet, heißt das: Von den 1,7 Millionen Ehrenamtlichen, die wir in unseren Bevölkerungsschutzkonzepten erwarten, können wir realistisch nur mit etwa der Hälfte rechnen.
Diese Zahlen sind gravierend. Ein wesentlicher Teil lässt sich darauf zurückführen, dass viele Ehrenamtliche gleichzeitig in der Kritischen Infrastruktur tätig sind – besonders Ärztinnen und Ärzte. Sie sind in Kliniken oder Praxen gebunden und damit für den Bevölkerungsschutz kaum einsetzbar. Aber auch familiäre Strukturen spielen eine Rolle, zum Beispiel fehlende Betreuungskonzepte für Kinder. Im nächsten Schritt wollen wir die Ergebnisse noch gezielter auswerten, insbesondere im Hinblick auf Geschlechterunterschiede. Es könnte sein, dass weibliche Einsatzkräfte aufgrund zusätzlicher familiärer Verpflichtungen noch häufiger eingeschränkt sind als männliche. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass wir im Bevölkerungsschutz schon lange alte Rollenmuster hinter uns lassen und inzwischen auch einen deutlich höheren Frauenanteil haben – was wir ausdrücklich begrüßen.
Behörden Spiegel: Welche Gefahren ergeben sich daraus?
Dr. Follmann: Die große Gefahr ist: Wir alarmieren – und es kommt niemand. Das müssen wir uns ganz nüchtern vor Augen führen. Schon bei Übungen, die realistisch alarmiert werden, sehen wir, wie schwierig es ist. Vielleicht müssen wir solche Übungen auch häufiger durchführen, um die
tatsächliche Verfügbarkeit besser zu erfassen. Denn wenn wir von unseren 3.680 Antworten ausgehen, die wir durchaus für bundesweit valide halten, heißt das: Im Ernstfall kommt nur die Hälfte der Einsatzkräfte. Ein weiteres Problem ist die Überlastung der immer gleichen Personen. Wenn bei Einsätzen immer dieselben Ehrenamtlichen herangezogen werden, droht „Burnout“ im Ehrenamt. Deshalb sind Nachwuchsgewinnung und Attraktivität des Ehrenamts zentrale Zukunftsaufgaben. Wir dürfen uns nicht auf den 1,7 Millionen Ehrenamtlichen „auf dem Papier“ ausruhen, wenn effektiv nur die Hälfte verfügbar ist, zumal viele in Doppelrollen stehen und sich dann zwischen Feuerwehr, Hilfsorganisation oder anderer Verpflichtung entscheiden müssen.
Hier ist auch die Politik gefragt: Wir brauchen Strategien, wie wir das Ehrenamt attraktiver machen und müssen auch über Entschädigungsmodelle nachdenken. Nur so können wir dauerhaft sicherstellen, dass im Ernstfall genügend Einsatzkräfte bereitstehen.
Behörden Spiegel: Was empfehlen Sie den Organisationen selbst?
Dr. Follmann: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass – wenn wir jetzt Empfehlungen aussprechen – jede Hilfsorganisation für sich losläuft und ihr eigenes Ding macht. Genau das dürfen wir nicht zulassen. Das gilt ebenso für die Länder. Wir brauchen ein bundeseinheitliches Register, das alle relevanten Funktionen erfasst: Ehrenämter mit Bezug zum Bevölkerungsschutz, Doppelrollen, Prioritäten. Idealerweise wäre das an einer neutralen Stelle wie den Meldeämtern verortet. Dort könnten Ehrenamtliche selbst angeben, welche Rollen sie besetzen und in welcher
Der zweite Anlauf eines KRITIS-DachG
(BS/fst/bk) Auf ein Neues: Das Bundesinnenministerium (BMI) hat einen neuen, noch nicht im Bundeskabinett abgestimmten Referentenentwurf zum Schutz von Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf der Vorgängerbundesregierung wurde zwar schon im November kurz vor dem Scheitern der Ampel-Regierung verabschiedet, doch aufgrund der Diskontinuität im Bundestag konnte das Dachgesetz nicht verabschiedet werden.

desbehörden und die Meldung an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) flexibler gestaltet. Das BBK übernimmt darüber hinaus zusätzliche Aufgaben kostenlos, darunter die Abnahme branchenspezifischer Resilienzstandards, die Bereitstellung von Leitlinien, Mustervorlagen, Schulungen und Beratungsleistungen. Für Betreiber kritischer Anlagen sind verpflichtende Resilienzpläne vorgesehen,
die nicht nur organisatorische Maßnahmen wie Risiko- und Krisenmanagement umfassen, sondern auch physische Schutzmaßnahmen wie Zäune, Notstromaggregate oder Hochwasserschutz sowie die Einrichtung ständig erreichbarer Ansprechstellen und Alternativpläne für Lieferkettenausfälle. Meldungen über Vorfälle müssen binnen 24 Stunden erfolgen, andernfalls drohen empfindliche Bußgelder. Anders als im vorheri-
Reihenfolge sie verfügbar wären. Erste Berufsfeuerwehren beginnen zwar bereits, Doppelrollen intern zu erfassen – aber das reicht nicht. Wir brauchen eine flächendeckende, einheitliche Lösung. Dieses „Helferregister“ wird seit Jahren von vielen Verbänden gefordert – und auch wir als DGKM schließen uns hier an.
Behörden Spiegel: Was wäre noch möglich?
Dr. Follmann: Ein zweiter Lösungsweg liegt in der Entlastung der Ehrenamtlichen. Es gibt Überlegungen zu Rentenpunkten, finanziellen Entschädigungen oder anderen Unterstützungsangeboten, etwa bei der Kinderbetreuung. Ebenso wichtig ist die Nachwuchsgewinnung: Das Ehrenamt muss attraktiver werden. Möglicherweise gelingt das nicht allein mit Entschädigungen. Vielleicht müssen wir schon in den Schulen ansetzen – mit gezielter Aufklärung über Bevölkerungsschutz. Immer wieder wurde die Idee eines Schulfachs „Leben“ ins Spiel gebracht, in dem auch Themen wie Katastrophenschutz vermittelt werden. So könnten wir früh junge Menschen für das Ehrenamt gewinnen. Drittens müssen wir medizinische Kompetenz kompensieren, die vor Ort fehlt. Ich habe Telemedizin bereits erwähnt – aber auch andere Forschungsansätze, die aktuell vom BMBF oder BBK gefördert werden, bieten interessante Optionen. Diese gilt es ernsthaft zu prüfen und in die Konzepte zu integrieren. Viertens gehört zwingend die bundeseinheitliche Helfergleichstellung dazu. Es ist nicht akzeptabel, dass Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben, ob und wie Ehrenamtliche für ihren Einsatz freigestellt und entschädigt werden. Hier braucht es dringend eine einheitliche Lösung. Die 3.680 Rückmeldungen, die wir ausgewertet haben, sind eine gute Grundlage – aber sie reichen nicht aus. Ein zentrales Register wäre der nächste Schritt, um Doppelrollen transparent zu machen und Konzepte gezielt anzupassen. Hier ist die Politik gefragt, und wir als DGKM stehen bereit, diesen Prozess zu begleiten.
gen Entwurf verzichtet das BMI auf konkrete Kostenschätzungen und verweist auf künftige Haushaltsverfahren, wobei betont wird, dass Resilienzmaßnahmen langfristig Kosten einsparen, die durch Ausfälle entstehen würden.
Die sektorspezifischen Mindestvorgaben können die zuständigen Ministerien erst ab 2030 erlassen, um den Unternehmen ausreichend Zeit für die Umsetzung zu geben, während für das Auswärtige Amt gesonderte Verwaltungsvorschriften erarbeitet werden.
Kritik von der AG KRITIS
Manuel Atug, Gründer und Sprecher der AG KRITIS, erklärte zum Entwurf: „Die wesentlichen Paragrafen Paragraf 11 Nationale Risikoanalysen und Risikobewertungen; Verordnungsermächtigung, Paragraf 12 Risikoanalyse und Risikobewertung des Betreibers kritischer Anlagen; Verordnungsermächtigung und Paragraf 13 Resilienzpflichten der Betreiber kritischer Anlagen; Resilienzplan sind unverändert geblieben. Alle Defizite aus vorherigen Entwürfen bleiben daher
weiterhin bestehen, sodass die Forderungen der AG KRITIS, sie abzustellen, ebenfalls aufrechterhalten werden. Die EU hat Vorgaben zu defensiver physischer und CyberResilienz aufgestellt; Deutschland bleibt mit dem aktuellen KRITISDachgesetz-Referentenentwurf weit hinter diesem Ziel zurück.“ Lobend hervorzuheben sei, dass die branchenspezifischen Resilienzstandards öffentlich beim BBK abrufbar sein werden. Froh, dass es überhaupt kommt, ist zumindest Dr. Hans-Walter Borries, stellvertretender Vorstandsvorsitzer des Bundesverbands Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSK). „Wir hätten gehofft, dass es schon Ende 2023, dann haben wir gehofft, dass Ende 2024 das KRITIS-Dachgesetz kommt. Wir haben mitbekommen, dass ab dem 07.11.2024 mit Platzen der Ampelregierung das Thema erst mal nicht mehr mit der höchsten Priorität verfolgt wurde. Jetzt wird es wahrscheinlich 2026 kommen“, so Borries. Dennoch blieben viele Fragen offen. „Wir wissen derzeit nicht, ob bestimmte Kategorien KRITIS-Hauptsektoren überhaupt noch beibehalten werden. Z. B. der Bereich Medien und Kultur. Wie sieht es mit der Verwaltung aus? Endet Verwaltung auf Ebene der Bundeseinrichtungen und geht es nicht auf Landeslandkreise, Kreise, kreisfreie Städte runter?“, fragt sich Borries. Es gebe noch viele Fragezeichen.
Über die Zeit der friedlichen Entwicklung Europas, die keiner habe beklagen wollen, seien im Zuge der sogenannten Friedensdividende auch der rechtliche Rahmen angepasst und die wahrgenommenen Notwendigkeiten entsprechend reduziert worden, so Hansen. Jedoch sei das Bedrohungsumfeld nun ein anderes. Man müsse sich auf Angriffe mit nichtkonventionellen Waffen oder hybride Bedrohungen, Sabotageakte, CyberAngriffe sowie Desinformationskampagnen vorbe reiten. Zudem sei Deutschland als logistische Drehscheibe im Rahmen der Bündnisverteidigung besonders gefordert.
Digitaler Katastrophenschutzkongress zeigte Bedarfe
(BS/bk) Das Motto der Zeit könnte auch „Zurück in die Zukunft“ lauten – eine Feststellung, die von Dierk Hansen, Vizepräsident des Technischen Hilfswerks (THW), auf dem Digitalen Katastrophenschutzkongress und von allen Referentinnen und Referenten geteilt wurde. Die neuen und alten Aufgaben sowie die interne Neuaufstellung betreffen dabei nicht nur

Generalleutnant a. D. Martin Schelleis fordert eine neue Sicherheitsstrategie.
Verlässliche Kommunikation ist ein Muss
(BS/sr) Der Informationsfluss ist im Katastrophenfall entscheidend – sowohl für die Kommunikation innerhalb und zwischen der Sicherheitsbehörden als auch für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Fehler können schnell schwerwiegende Folgen haben.

„Unser Ziel ist es, die Zivilschutz fähigkeit bis 2030 zu optimieren. Dazu gehört beispielsweise die Här tung des THW – sowohl in der realen Welt als auch im virtuellen Raum. Wir brauchen dafür eine stabilere ITInfrastruktur mit stärkerem Fo kus auf ServiceEngineering und weniger auf reiner Nutzerbetreuung. Ziel ist eine leistungsfähigere IT, die auch im Einsatz funktioniert – mit einer Einsatzunterstützungssoft ware, die es den Einheiten vor Ort ermöglicht, ihre Einsätze effektiv zu koordinieren und zu steuern“, so Hansen. Zudem wurde ein Lagedienst aufgebaut, der ein tägliches Lagebild für den Zivilschutz erstellt. Zukünftig müsse im Hinblick auf die neue Lage eine mögliche Veränderung des Zivilschutz und Katastrophenhilfegesetzes in Betracht gezogen werden. „Insbesondere mit Blick auf die derzeitige Unterstellung des THW unter die Landkreise, die wir für die Zukunft nicht mehr als zielführend ansehen“, so Hansen Lernen aus der Ukraine Auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat der Wandel Einzug gehalten. „Natürlich schauen wir auf die Ukraine und ziehen Bilanz für uns unsere Lessons Learned“, sagt Kathrin Stolzenburg, Leiterin des Bereiches Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung beim BBK. Die sicherheitspolitische Lage habe sich in Europa fundamental geändert. Hybride Bedrohungen seien schon lange nicht mehr nur theoretisch. Dennoch zeigt sich Stolzenburg optimistisch: „Wir wissen, wie stark unsere Welt vernetzt ist. Wir verstehen, was systemische Risiken sind – und dass sie den Bevölkerungsschutz künftig prägen werden. Vorsorge gelingt nur, wenn wir dieses Wissen konsequent in Planung und Übungen überführen. Das bedeutet: Wir brauchen keine Glaskugel, sondern mehr Mut, bekannte Risiken und Megatrends – etwa die Digitalisierung – aktiv in unsere Vorsorge und Zivilschutzstrategien einzubeziehen.“ Klar sei aber auch, dass man nicht mehr die Zeit habe, um aus Krisen und Katastrophen zu lernen. „Vor Corona, vor der Flutkatastrophe, vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten wir in Deutschland und auch in Europa vielleicht noch das Mindset, Krisen nacheinander abzuarbeiten: Eine Krise kommt, wir bewältigen sie, wir
lernen daraus und übertragen die Erkenntnisse auf die nächste. Spätestens der Krieg in der Ukraine hat uns jedoch gezeigt: So funktioniert es nicht. Wir müssen die Gleichzeitigkeit von Krisen akzeptieren – die Überlagerung von Ereignissen,“ so Stolzenburg
Ein neues Konzept ist nötig Für einen neuen Zugang zur Krisenvorbereitung wirbt auch Martin Schelleis, Generalleutnant a. D. und Bundesbeauftragter für Krisenresilienz beim Malteser Hilfsdienst (MHD). Gerade das Konzept der Gesamtverteidigung müsse weiterentwickelt werden. Aus seiner Sicht bildet diese nicht mehr alle Elemente in den vier Säulen der zivilen Verteidigung ab, die für die Resilienz einer Gesellschaft entscheidend seien. „Deshalb muss dieses Konzept weiterentwickelt werden. Es muss Risiken berücksichtigen, die über den militärischen Bereich hinausgehen. Gesamtverteidigung suggeriert einen Angriff von außen – wir wissen aber, dass Großschadenslagen auch aus nichtmilitärischen Gründen entstehen können“, so Schelleis Es brauche daher einen breiteren Ansatz, der politisch initiiert werde und in eine neue Sicherheitsstrategie münde. Auf deren Ausarbeitung dürfe man jedoch „nicht zwei Jahre warten“, sondern müsse sofort praktisch arbeiten – initiiert durch die Bundesregierung, im Zusammenwirken mit den Ländern sowie den für die Sicherheit verantwortlichen Kommunen und Regionen. „Konkret heißt das: Wir müssen uns zusammensetzen und aus der Vielzahl möglicher Risiken die wirklich entscheidenden identifizieren und priorisieren. Jedes dieser Krisenszenarien muss einzeln untersucht werden – mit Blick auf den Bedarf an Personal, Material, Infrastruktur und Organisation. Daraus ergibt sich eine SollVorgabe, die gesamtgesellschaftlich einzulösen ist“, sagt Schelleis. Die Hilfsorganisationen brächten dafür bereits zahlreiche Fähigkeiten mit, doch müsste diesen mitgeteilt werden, welche Erwartungen an sie gestellt werden.
Satellitenbasierte Kommunikationssysteme wie Starlink sind zwar gute Ergänzungen, über deren Verfügbarkeit jedoch Nutzung private Konzerne entscheiden. Foto: BS/Vendula, stock.adobe.com
Nicht zuletzt die AhrKatastrophe hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Kommunikation und verlässliche Daten sind. Dort seien, so Simon Schäberle, Leiter der Fachgruppe Information und Kommunikation beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Tübingen e. V., alle gewohnten Kommunikationswege zunächst gar nicht oder nur eingeschränkt nutzbar gewesen. Je mehr Informationen jedoch vorliegen, desto besser können Einsatzkräfte reagieren und die Bevölkerung informieren. In genau diese Richtung zielt auch das Projekt NPGeoKat der Vereinigung zur
Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb), das Sven Dunkel, Leiter des Referats Kommunikation der vfdb, auf dem digitalen Katastrophenschutzkongress vorstellte.
Nationale Geodatenplattform Ziel des Projekts ist es, Feuerwehren untereinander zu vernetzen, indem eine zentrale Plattform bereitgestellt wird, in die möglichst viele Daten eingespeist werden können. Dabei soll jedoch kein Ersatz für die feuerwehreigenen GISSysteme entstehen. Die abrufbaren Informationen lassen sich zur Kartenerstellung und zur Analyse nutzen.
Quellen beschafften. Rudloff plädiert deshalb für die Einführung einer zentralen, leicht einprägsamen Telefonnummer für ganz Deutschland. Ein Anruf dort soll automatisch zur jeweils zuständigen Zentrale weitergeleitet werden. Für die Zukunft könnte dieses Konzept zudem durch automatische Auskünfte und KIUnterstützung erweitert werden. Generell gibt es viele kreative Ansätze, die Kommunikation im Ernstfall auszubauen oder zu ergänzen. Spontane Lösungen funktionieren jedoch nur bedingt. Auch eine zentrale Rufnummer oder der Einsatz von Hobbyfunkern und deren Technik müssten im Vorfeld geplant, verbreitet und erprobt werden – denn im Ernstfall bleibt kaum Zeit für Experimente.
Nicht weniger als eine tektonische Veränderung in der IT versprach Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling, Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr, während der BWI Industry Days in Berlin. Was sie damit meint, ist, dass sich mit den wachsenden digitalen Möglichkeiten militärische Verfahren und Abläufe grundsätzlich ändern – Digitalisierung sei weit mehr als nur ein Add-on. Um das zu verdeutlichen, bediente sich Schilling eines Vergleichs aus ihrer Profession. Bestimmte Untersuchungen, die sie in ihrer medizinischen Ausbildung noch erlernt habe, seien heute durch bildgebende Verfahren längst überflüssig. Das sei nicht weniger als eine Revolution. Genauso verhalte es sich mit der Digitalisierung bei den deutschen Streitkräften. IT sei das Nervensystem für die Innovations- und Führungsüberlegenheit. Um diese für die angestrebte Kriegstüchtigkeit im Jahr 2029 zu härten, bestehe dringender Handlungsbedarf. „2029 ist in unseren bisherigen Entwicklungszyklen vorgestern“, mahnte Schilling
„Die bisher eher Hardware-zentrierte Architektur ist eine Herausforderung für uns und die Industrie.“
Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter Cyber- und Informationsraum im BMVg
Gleichzeitig dürfe sich die Planung nicht auf die drängenden Gefahren zum Ende des Jahrzehnts versteifen. Es gelte gleichermaßen, die technologischen Grundlagen –welche die Streitkräfte der Zukunft bestimmen werden – nicht aus dem Blick zu verlieren. Um diesen Spagat zu bewältigen, schuf das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) im Rahmen seiner jüngsten Umstrukturierung die Abteilung Information und Cyber (IC), wie Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter Cyber- und Informationsraum im BMVg, erläutert. Sie ist dafür verantwortlich, die Integration zwischen den klassischen Plattformabteilungen und der IT sicherzustellen. Außerdem soll sie als wesentliche Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit dem Generalinspekteur dienen. Die Unterabteilungen Forschung und Innovation/KI, Fähigkeiten Cyber/IT sowie Strategische Steuerung/Planung sind ihr entsprechend eingegliedert. Mit diesem engen Draht zwischen strategischer Führung und der Fachabteilung strebt das Verteidigungsministerium an, die strategischen Zielsetzungen des planungsverantwortlichen Generalinspekteurs durch die IC möglichst zeitnah in Fähigkeitsziele zu übersetzen. Leitgedanke der Umstrukturierung ist, die materiellen Lösungsanteile der Fähigkeitsziele in Zusammenarbeit mit der Rüstungsabteilung kurzfristig umzusetzen. Darüber hinaus schafft das BMVg neue Posten für Schlüsselthemen. Über einen Chief Data Officer verfügt die Abteilung Innovation und Cyber bereits. Zusätzlich soll diesem ein Chief AI Officer zur Seite gestellt werden. Wer den neuen Posten bekleiden wird, ließ Vetter allerdings noch offen.
Ganz gleich, wer den Posten am Ende besetzt: Die Aufgabe für die Abteilung Innovation und Cyber ist klar. Auf der einen Seite muss die Bundeswehr im Industrial Age, in
Neue BMVg-Abteilung gegen Digitalisierungsrückstände
(BS/Jonas Brandstetter) Die Bundeswehr will bis 2029 kriegstüchtig werden. Ohne Digitalisierung aller militärischen Strukturen kann das nicht gelingen. Eine eigene Abteilung Innovation und Cyber (IC) im BMVg und ein neuer Chief AI Officer sollen das sicherstellen – allerdings muss die Industrie mitziehen.

dem sie sich noch befindet, bis 2029 kriegstüchtig werden. Das Auffüllen von Lücken und Marktverfügbarkeit müsse hierbei das Primat sein. Gleichzeitig sind diese Fähigkeiten mittelfristig für die Zeit nach 2029 durch Technologien des Post-Industrial-Paradigmas zu ergänzen und zu ersetzen. Dafür gelte es bereits heute, die Weichen zu stellen, betonte der Abteilungsleiter. Ohne neues Denken, neue Methoden und vor allem eine deutlich andere Geschwindigkeit sei das nicht zu erreichen. Die Strukturanpassung ist ein Teil dieses neuen Denkansatzes. Vetter gibt allerdings zu, dass die Umsetzung kein Selbstläufer ist. Viele Schnittstellen seien bisher offen und prozessuale Übergangspunkte noch zu definieren. „Es gibt noch einige Dinge, die wir im Detail in verdammt kurzer Zeit umsetzen müssen“, mahnte der Abteilungsleiter. Der Industrie empfiehlt er daher, während der Übergangsphase neben der Dienstadresse ihrer Kontaktpersonen zusätzlich auch das persönliche Postfach zu adressieren.
Daten als neuer Treibstoff
Der Treibstoff der angestrebten digitalen Streitkräfte sind Daten. „Daten sind das Öl der Zukunft“, fasst es Generalmajor Armin Fleischmann, Abteilungsleiter Planung CIR und Digitalisierung der Bundeswehr im Kommando Cyber- und Informationsraum (Kdo CIR), zusammen. Vorbild bei dieser Entwicklung sei die Ukraine. Dank ihres progressiven Blicks auf die Erfassung, die Auswertung und die Nutzung von Daten gelinge es ihr, sich gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner zu behaupten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Ohne die digitalen grauen Zellen sind die Datenmengen moderner Sensorik nicht länger zu bewältigen – ein Themenfeld, in dem die Ukraine erneut ihre Vorreiterrolle unter Beweis stelle. Ein Blick auf die Gefechtsstände im größten Flächenstaat Kontinentaleuropas verdeutliche das. Ein Livefeed informiert im Gefechtsstand über das Geschehen. Sollten die digitalen Leitungen abbrechen, stehe eine Rückfallebene mit bewährter Analogtechnik zur Verfügung, erläutert Fleischmann
Eine derart zukunftsgewandte Vorgehensweise kann den deutschen Streitkräften als Vorbild dienen. Der Istzustand ist aber ein anderer. Wie gut die Truppe im Umgang mit ihren Daten aufgestellt ist, unterscheidet sich laut Vetter von Fall zu Fall. In einigen Datenräumen, insbesondere bei strukturierten Daten im EAW-System, sei die Truppe bereits versiert. An anderer Stelle – zum Beispiel bei den Nachrichtendiensten – gebe es allerdings Nachholbedarf, räumt Vetter ein. „Hier haben wir strukturierte und unstrukturierte Daten, die wir irgendwie so zusammenführen müssen, dass ein Algorithmus etwas damit anfangen kann“, so der Abteilungsleiter.
Die Industrie muss mitziehen Um das langfristig und nachhaltig in der Bundeswehr zu etablieren, bedarf es laut Vetter eines Mentalitätswandels, wie Rüstungsprojekte in den deutschen Streitkräften gedacht und umgesetzt werden. Von dem bisher dominierenden Denken von der Plattform aus gelte es abzukommen. Die Antwort der Bundeswehr, um in den Konflikten der Zukunft die Eskalationsdominanz zu wahren, verlange das. Software Defined Defence (SDD) – also die Idee, nicht spezialisierte Hardware, sondern einen flexibleren und effizienteren Einsatz von Software in den Mittelpunkt der militärischen Pla-
nung zu stellen – soll die deutschen Streitkräfte für künftige Konflikte fit machen. Wie sich das in der Praxis gestalten könnte, verdeutlichte der Abteilungsleiter anhand des Beispiels einer Fregatte. Die Dienstzeit eines solchen Schiffes belaufe sich auf bis zu fünf Jahrzehnte. Die Systeme auf der Fregatte haben wiederum eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren. Die Software hingegen ist nur für wenige Monate auf einem aktuellen Stand. Für Aktualität könnten nur Updates sorgen. Um diese regelmäßig und fortlaufend möglich zu machen, bedürfe es einer modularen und standardisierten Architektur. Prozesse müssten hoch agil sein und automatisiert ablaufen. Unter den gegenwärtigen Realitäten der Beschaffung ist die glaubwürdige Umsetzung von SDD aber kaum denkbar. „Software Defined Defence fordert ein Denken in Ökosystemen“, stellt Vetter klar. Er mahnte, dass das etablierte Denken in den verfestigten Kategorien des Auftragnehmers und Auftraggebers einer Partnerschaft weichen müsse. Dabei ist nach Ansicht des Abteilungsleiters Cyber die Industrie gleichermaßen wie die Truppe gefordert, sich eine Ökosystem-Logik zu eigen zu machen. Dass das aber kein Selbstläufer ist, verschweigt auch Vetter nicht: „Die bisher eher hardwarezentrierte Architektur ist eine Herausforderung für uns und
die Industrie.“ Optimistisch gibt sich der Abteilungsleiter aber dennoch. Denn seiner Ansicht nach gibt es zwischen Bundeswehr und Industrie bereits etablierte Partnerschaften, die dem geforderten Zielbild ähneln und eine Vorbildfunktion einnehmen könnten. Das Systemunterstützungszentrum Eurofighter (SUZ EF), betrieben von Airbus und der Luftwaffe, könne hier als Beispiel dienen.
Trendthema digitale Souveränität So sehr der Wunsch nach digitalen Streitkräften drängen mag, eine Tatsache lässt sich in der Debatte nicht wegdiskutieren: Deutschland und Europa fehlt es schlicht an den technischen Möglichkeiten, um die Digitalisierung der Streitkräfte ohne die großen Unternehmen aus den USA zu bewältigen. Das gilt insbesondere für die Hightech-Felder mit den größten Potenzialen – allen voran KI. Im Umgang mit der Silizium-Intelligenz verlangt die stellvertretende Generalinspekteurin deshalb nach einer Debatte. Sie soll Antworten auf die Frage finden, wie viel Abhängigkeit von ausländischen Systemen die Bundeswehr zulassen kann und welche harten Kompetenzen innerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik verbleiben müssen. Vetter sieht dabei insbesondere die BWI gefordert. Sie sei der Provider einer vertrauenswürdigen IT einschließlich sicherer Lieferketten. Dabei nehme sie allerdings nicht selbst den Lötkolben in die Hand oder tippe Programmcodes. Vielmehr schaffe sie die Verbindung zwischen den Streitkräften und der Industrie. Einer der großen Player in dieser ist Wolfgang Wendt, General Manager IBM Deutschland, Österreich und Schweiz. Sein Unternehmen bietet KI-Systeme in Containern an. Auf diese Weise seien die Anwender von den Hyperscalern abgekoppelt und bewahrten die Hoheit über die eigenen Daten. Gleichzeitig zum Schulterschluss mit den großen internationalen Playern investieren die Streitkräfte in die militärische Innovationslandschaft der Bundesrepublik. So bemüht sich das BMVg derzeit darum, die Förderung für das Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (dtec. bw) über das Jahr 2027 mit Ablauf der EU-Förderung hinaus zu verstetigen. Außerdem arbeitet das BMVg gegenwärtig an seiner Forschungsund Innovationsstrategie. Sie sieht eine ganzheitliche technische Weiterentwicklung vor. Das geplante Innovationslabor Erding soll ein Teil davon werden. Allen großen Plänen zum Trotz kann sich auch Vetter dem vorauseilenden Ruf der Bundeswehrbürokratie nicht entziehen. In Berlin betonte er explizit, dass in Erding keine Innovationsagentur entstehe.

Für die 10. Panzerdivision als multinationaler, mechanisierter Großverband des Heeres bedeutet dies eine konsequente Ausrichtung am Auftrag zur Abschreckung und Verteidigung an der NATO-Ostflanke bereits aus der Grundgliederung heraus. „Wir gehen, wenn wir müssen und zwar so, wie wir sind“, betont Generalmajor Jörg See, Kommandeur der 10. Panzerdivision. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Logistik als wesentliche Voraussetzung und zentraler Gestaltungsrahmen für Operationen und Operationsplanung auf Divisionsebene. Der logistische Prozess muss gemessen am möglichen Kriegsbild der Landes und Bündnisverteidigung (LV/BV) neu gedacht werden. Kapazitätsberechnungen, Transportraumplanungen und Leistungserprobungen müssen mit Blick auf die Neuorientierung und Interoperabilität geprüft, erprobt und angepasst werden.
Logistik binational
Die 10. Panzerdivision ist, zusätzlich zu der besonderen Gestaltungsform der Deutsch-Französischen Brigade, bereits in ihrer Grundgliederung binational aufgestellt. Mit der Unterstellung der niederländischen 13. Leichten Brigade im April 2023 wurde die Zusammenarbeit mit den niederländischen Streitkräften intensiviert. Ziel sind umfassend integrierte Großverbände der Landstreitkräfte. Wesentliche Herausforderung für die Logistik sind hierbei die beiden unterschiedlichen logistischen Systeme der beiden Nationen. Dies hat unmittelbar zur Folge, dass bei einem Einsatz der 10. Panzerdivision die Einsatzsowie die Basislogistik den multinationalen Ansprüchen genügen muss. Der Grundsatz, Logistik ist „National Business“, wird den Anforderungen im NATO Force Model nicht mehr gerecht und stellt die logistische Leistungserbringung vor neue Herausforderungen. Um diesen angemessen zu begegnen, haben das deutsche und das niederländische Verteidigungsministerium vereinbart, im Rahmen der Integration der 13. Leichten Brigade in die 10. Panzerdivision die logistische Interoperabilität zu steigern. Dabei verantworten jedoch beide Nationen unverändert die jeweilige logistische Unterstützung national, mit dem Ziel, dass die gemeinsamen Anstrengungen den er-
Sicht einer multinationalen Einsatzdivision
(BS/Hauptmann Andreas Schaub*) Im Zuge der Zeitenwende und der damit einhergehenden Neuorientierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) werden dauerhaft einsatzbereite Streitkräfte benötigt, welche sich insbesondere quantitativ deutlich von den Kontingenten der Stabilisierungseinsätze unterscheiden. Ausgerichtet sind die neuen Anforderungen am NATO Force Model als ein Rahmenwerk, um nationale Streitkräfte für den gemeinsamen Einsatz verfügbar zu machen.

forderlichen Unterstützungsbedarf decken sollen.
Einsatzlogistik
Die deutsche Einsatzlogistik zeichnet sich durch jeweils ein Versorgungsbataillon auf der Brigadesowie ein Versorgungsbataillon auf der Divisionsebene zur Versorgung der Divisionstruppen aus. Die nationale Folgeversorgung der Division wird durch die mobilen Logistiktruppen der Basislogistik unter Einsatz eines Logistikregiments sichergestellt. Das niederländische logistische System sieht auf der Ebene der Brigade nur ein logistisches Element in Kompaniestärke vor. Zur logistischen Unterstützung stellt das niederländische Versorgungs- und Transportkommando logistische Kräfte bereit, die spezifisch für den konkreten Einsatz zugeschnitten sind. Die Durchhaltefähigkeit der Brigade wird durch die Einrichtung mehrerer Supply Center gewährleistet.
Damit ist die Bewertung der Folgeversorgung durch den G4 der Division nur unter Einbeziehung von Verbindungselementen deutscher Basislogistik sowie des niederlän-
dischen Versorgungs- und Transportkommandos innerhalb der G4 Abteilung möglich. Für die Zusammenführung der jeweiligen logistischen Versorgungsketten ist die einheitliche Nutzung standardisierter, IT-basierter logistischer Führungssysteme eine zentrale Grundlage. Daher greift die 10. Panzerdivision bereits im Grundbetrieb sowie für Übungen auf das NATO-standardisierte Führungsinformationssystem „Logistic Functional Area Services“ (LogFAS) zurück. Die Teilnahme der Division an der US-amerikanischen Übung „Warfighter 25“ unter dem III. USA Korps bestätigte LogFAS als wesentlichen Eckpfeiler zur Sicherstellung der Interoperabilität in Bezug auf Integration, Verwaltung sowie Darstellung logistischer Informationen in Echtzeit. Weiterhin wird das derzeit geplante, gleichzeitige Ausrollen der Software SAPS/4 HANA in den deutschen sowie niederländischen Streitkräften unmittelbar zur umfassenden Standardisierung der Logistik innerhalb der 10. Panzerdivision beitragen. Dadurch werden operationell notwendige binationale Anforderungswege implementiert, sodass ein
deutsches Versorgungsbataillon bei Bedarf in der Lage sein wird, Bedarfsforderungen niederländischer Kräfte direkt beim niederländischen Supply Center nachzufordern. Damit wird ein weiterer, wesentlicher Schritt hin zu einer robusten, durchhaltefähigen und multinational flexiblen Einsatzlogistik gegangen, um für den Einsatz der Division in der LV/BV dem Divisionskommandeur die höchstmögliche Flexibilität in der Operationsführung zu gewährleisten.
Besondere Herausforderungen Insbesondere bei einer möglichen Anpassung der Truppeneinteilung, beispielsweise im Zuge der Verstärkung der niederländischen 13. Leichten Brigade mit deutschen Verbänden, ist die logistische Unterstützung derzeit nicht standardisiert geregelt. Die größte logistische Herausforderung ist dabei derzeit, dass ein deutscher Kampftruppenverband nur über seine eigene logistische Ebene 1 verfügt und beim Einsatz in der 13. Leichten Brigade keine deutsche logistische Ebene 2 innerhalb der Brigade vorhanden ist. Um dennoch eine Versorgung dieses deutschen Kampftruppenverbandes innerhalb der 13. Leichten Brigade sicherzustellen, bedarf es einer vom konkreten Kriegsszenario abgeleiteten, angepassten Denkweise, aktualisierter Planungen und neuer Regelungen sowie einer flexiblen, pragmatischen und dynamischen Durchführung. Es liegt auf der Hand, dass für eine belastbare Kriegstauglichkeit die unterschiedlichen nationalen Prozesse und Verantwortlichkeiten nicht zu Einschränkungen der Handlungsfreiheit führen dürfen. Bereits jetzt werden auf Divisionsebene durch die dauerhafte Integration eines niederländischen Stabsoffiziers die möglichen Synergien in den bestehenden logistischen Einsatzgrundsätzen genutzt. Gleichzeitig werden mit Blick auf das wahr-
scheinlichste Kriegsszenario weitere Interoperationalitätsbedarfe in den logistischen Systemen identifiziert. Für eine möglichst friktionsfreie Andockfähigkeit bedarf es einer engen Zusammenarbeit mit Elementen des Unterstützungskommandos der Bundeswehr und dem niederländischen Versorgungs- und Transportkommando. Dazu verfügt das Logistikkommando der Bundeswehr in der Abteilung Planung über ein Dezernat Multinationale Logistik, welches sich mit der Koordinierung der multinationalen Zusammenarbeit befasst. Dieses nimmt auf Ebene des Unterstützungskommandos an der deutsch/niederländischen Joint Support Steering Group teil, um für den Bereich der Folgeversorgung die Interoperabilität nachhaltig zu erhöhen. Dazu wird in der Arbeitsgruppe Logistik das Themenfeld Versorgungslinien hinter der Division gemeinsam untersucht. Wesentliche Inhalte sind die gemeinsame Nutzung von Transportkapazitäten über unterschiedliche Binnenländer bis in das Einsatzland und in die Division sowie der gemeinsame Rückgriff auf Ressourcen im jeweiligen Einsatzland. Ein weiterer, grundsätzlicher Schritt für eine nachhaltige Steigerung der logistischen Interoperabilität sowie für eine integrierte Versorgung liegt in gemeinsamen Beschaffungsprozessen, insbesondere von Großgerät. Hier bietet die Army Steering Group auf Ebene Kommando Heer und Niederländisches Heereskommando weiteres Potenzial.
Die logistische Versorgung der 10. Panzerdivision im Zuge einer multinationalen Operation ist auch multinational zu denken. Die bestehenden Bemühungen auf den unterschiedlichen Ebenen zeigen, dass der Bedarf erkannt ist, über die aktuellen Grundlagen hinaus weitere Schritte in der multinationalen Logistik einzufordern und voranzutreiben.
Der daraus erwachsende logistische Mehrwert, die Nutzung von Synergieeffekten durch gegenseitige Unterstützung sowie die mögliche Schonung eigener Ressourcen leisten im Ergebnis einen wichtigen Beitrag zur Flexibilität in der Sicherstellung der Versorgung in der 10. Panzerdivision.
*Hauptmann Andreas Schaub ist Teil der Generalstabsabteilung 4, Stab 10. Panzerdivision.



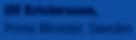

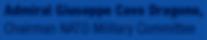


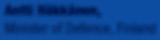


überzeugt, dass Krisenmanagement nur gesamtgesellschaftlich gelingen kann.
Es ist ein Ritual, seit er Uniform trägt. Zum Tagesbeginn kommt Neitzer in ziviler Kleidung zum Dienst Arbeit und zieht erst im Büro seine Uniform an. Der Arbeitstag bei einer Blaulichtbehörde beginnt. Eigentlich, ja eigentlich wollte Neitzer gar nicht in den Blaulichtbereich, wie er selbst sagt. Statt der Farben Blau und Rot wollte er lieber die Farbe Grün. Ursprünglich plante er nach dem Abitur Forstwirtschaft zu studieren. Doch wie so oft hatte das Leben andere Pläne. Neitzer hatte nach dem Abitur schon eine Zivildienststelle bei einem Naturpark. Aber dieser Park verlor, bevor er die Stelle antreten konnte, seine Zulassung. Nun war eine schnelle Lösung gefragt. Über einen damaligen Mitschüler kam er zu einer Zivildienststelle beim Rettungsdienst.
Ausbildung im Ehrenamt. Dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Dieses Sommermärchen blieb und bleibt trotz der späteren juristischen Wolken den meisten wohl in schöner Erinnerung. So auch Neitzer. Nicht direkt wegen des sportlichen Wettkampfs, sondern weil der rote Faden in seinem Leben – das Mitgestalten an Strukturen – weiterging. Im Nachgang der Weltmeisterschaft kam das Bestreben im Innenministerium auf, die Katastrophenschutzstrukturen im Bereich der Hilfsorganisationen in Rheinland-Pfalz zu vereinheitlichen.
Über den DRK-Landesverband erhielt Neitzer den Auftrag, an der Konzeptentwicklung mitzuwirken.
Dieses Konzept musste selbstverständlich auch mit dem Land abgestimmt werden – einerseits mit dem Innenministerium, andererseits mit



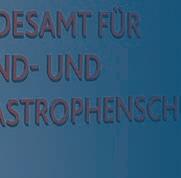

(BS/Bennet Biskup-Klawon) Das Amt gibt es erst seit neun Monaten und doch ist ihm die Arbeit dort nicht neu. Als Abteilungsleiter beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) prägt Christian Neitzer den Aufbau mit.


deutlich mehr Infrastruktur im Hintergrund. Viele Dinge, die man beim DRK selbst erledigen musste, liefen hier automatisch“, hebt Neitzer vor. Jedoch war er einer von zwei Ausbildern, die keine feuerwehrtechnische Ausbildung hatten. Er sei schon ein bisschen ein Exot gewesen. Nichtsdestotrotz sei er willkommen gewesen und dieser Unterschied habe sich schnell gelegt. Nun ist er 17 Jahre am Standort in Koblenz.
Strukturen können immer besser sein

Geschichte über Schilder: das LfBK und seine Vorgängerorganisationen Foto: BS/Biskup-Klawon
„Ich brauchte schnell was, bevor ich irgendwo in die Pampa verschickt werde“, erzählt Neitzer lachend. Das war der Beginn seiner Karriere im BOS-Bereich. „Das hat mir dann tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.“ Gerade die Abwechslung der Tätigkeit und das kollegiale Umfeld hätten ihn beeindruckt. Er sagt über sich selbst, dass die Tätigkeit für ihn als hilfsbereiter Mensch sehr sinnstiftend war.
„Ich habe dann auch kurzfristig überlegt, Medizin zu studieren“, erinnert sich der 43-Jährige. Dies habe er dann aber letztendlich wieder verworfen. Stattdessen habe er über eine Zeitschrift einen neuen Studiengang gefunden: Rescue Engineering. Dieser wurde an der Fachhochschule Köln, heute die Technische Hochschule Köln, angeboten.
Exot bei den Feuerwehrkräften
Nach dem Bachelor-Studiums begann Neitzer als Ausbilder beim DRK-Landesverband in Mainz in Rheinland-Pfalz. Es folgte der Aufstieg bei der dortigen Rettungsdienstschule zum Ressortleiter für die Führungs- und Leitungskräfte-
der damaligen Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule am Standort Koblenz. „So habe ich schließlich einige Kolleginnen und Kollegen hier kennengelernt“, erklärt Neitzer Und wieder – wie so oft im Leben – ergab sich die ungeplante Möglichkeit eines Jobwechsels. Vom DRK ging es zur Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule – einer Vorgängereinrichtung des jetzigen LfBK (die Schule wechselte, bevor es das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz wurde, noch einmal die Bezeichnung und wurde Akademie, um der Akademisierung der Ausbildung Rechnung zu tragen).
Die Tätigkeit blieb ähnlich. Seine erste Aufgabe war die Ausbildung für Führungskräfte im Bereich Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst. Während die Tätigkeit ähnlich blieb, war doch das Umfeld ein anderes. „Das behördliche Umfeld unterscheidet sich natürlich etwas von der administrativen Ebene einer Hilfsorganisation – zumindest war das damals so. Inzwischen liegen beide Bereiche, denke ich, gar nicht mehr so weit auseinander. Damals gab es hier an der Schule
Seit Anfang 2025 existiert das neue Amt. Auch dieses ist geboren aus dem Willen zur Erneuerung. Die Ahr-Katastrophe führte zu einer Neuaufstellung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz, die immer noch nicht komplett abgeschlossen ist. Natürlich war Neitzer auch im Ahtal im Einsatz. Einen solchen Einsatz hatte er bisher noch nie erlebt. „Man spricht immer vom Ahrtal, dort lag später auch der Fokus, aber tatsächlich war es ein Ereignis, das mehrere Landkreise betroffen hat“, sagt der Abteilungsleiter. Diese Katastrophe hat ihn, wie viele andere auch, geprägt. Er ist fest davon überzeugt, dass alle Einsatzkräfte an ihr Limit gegangen sind. „Jedenfalls haben wir vor Ort gesehen, dass sich aus fachlichen Gründen gewisse Strukturänderungen anbieten. Und ich meine das auch genau so: Ich bin fest überzeugt – und würde das jederzeit unterschreiben –, dass alle Einsatz- und Führungskräfte damals ihr absolut Bestes gegeben haben. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber manchmal zeigt sich im Nachgang eben, dass Strukturen verbesserungswürdig sind“, unterstreicht Neitzer
Das LfBK ist ein Baustein dieser Neuaufstellung mit dem Ziel die Gefahrenabwehrmaßnahmen im Land zu stärken und zu bündeln. Deswegen wurden die Feuerwehrund Katastrophenschutzakademie (LFKA) und das Referat 22 der ADD zusammengefasst. Laut Projektkonzeption soll der Personalkörper bis 2030 auf etwa 300 Vollzeitäquivalente ansteigen. Dies ist mehr als eine Verdopplung der alten Personalstruktur.
Im neuen Amt wurde Neitzer Leiter der Abteilung P. Die Abteilung ist mit den Themen Risikomanagement und Vorplanung betraut. Hier werden Verfahren zur Risikoanalyse entwickelt und gleichzeitig die kommunale Gemeinschaft unterstützt sowie die Aufsicht über die Bedarfs- und Entwicklungspläne übernommen. In Zukunft werden Feuerwehrbedarfspläne und Katastrophenschutzbedarfspläne in den
Gemeinden und Kreisen erstellt, die fachlich abgestimmt werden müssen. Dazu gehören auch die Zivilschutzplanung, die Beratung zu Kritischer Infrastruktur und die Sensibilisierung der Bevölkerung. Darüber hinaus entwickelt die Abteilung auch die Fähigkeit, Ereignisse auszuwerten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen – und das nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch überregional. Besonders stolz ist Neitzer auf das Referat „Lessons Learned“. Es stelle ein Alleinstellungsmerkmal bundesweit in dieser Form dar. Schlussendlich sollen sechs Referate rund 50 Mitarbeitenden entstehen. Bisher sind 16 Stellen besetzt. Der Aufbaus dauert an.
Klassische Flusshochwasser sind in den letzten Jahren in RheinlandPfalz zwar etwas seltener geworden, werden Gesellschaft und BOS aber auch künftig begleiten – und

Nur gemeinsam Der Aufbau, die internen Abläufe und die Aufgabenschärfung nehmen viel von Neitzers Arbeitstag ein. „Es gibt keinen klassischen Tag für mich“, betont er. Neben Besprechungen oder Dienstreisen (mindestens einmal die Woche möchte der Abteilungsleiter zudem in der Regionalstelle in Trier sein) rücken die konzeptionelle Arbeit sowie die Abteilungsleiterarbeit, sprich die Überprüfung, ob die Zielrichtung noch stimmt, in den Fokus. „Ich bin kein Typ, der alles umwirft.“ Der Austausch mit den Kollegen vor der Schaffung des Amtes und während des Arbeitsalltags nimmt für ihn einen besonderen Stellenwert ein. Er will zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Prozesse optimieren und die Aufgaben schärfen. Das Potenzial und die Kraft des Amtes liegen bei den Kollegen, zeigt Neitzer sich überzeugt. „Ich brauche den Input der Kolleginnen und Kollegen. Sie sollen mir auch einen Hinweis geben, wenn ich mal falsch abbiege und es bessere Varianten gibt“, reflektiert der Abteilungsleiter. „Ich habe bei weitem nicht in allen Bereichen Detailkenntnisse. Dafür gibt es Kolleginnen und Kollegen, die in einzelnen Fachbereichen deutlich tiefer drin sind. Nichtsdestotrotz habe ich selbstverständlich jederzeit den Anspruch, sprachfähig zu sein. Daran messe ich mich auch selbst.“
Die Aufgaben und Herausforderungen an das LfBK und an den Katastrophenschutz generell könnten in den kommenden Jahren nicht größer sein. Gefahren ließen sich in die drei Bereiche Natur-, technische und menschengemachte Gefahren einteilen.
Der Klimawandel steht aktuell medial vielleicht nicht mehr so stark im Fokus, doch die Folgen sind nach wie vor spürbar. Weiterhin finden jedes Jahr Waldbrände und Starkregenereignisse statt.
Naturgefahren wie Überschwemmungen werden zunehmen. Zusammen mit Partnern in den Kommunen müssen Pläne erstellt werden. Foto: BS/Biskup-Klawon
in ihrer Heftigkeit wahrscheinlich sogar zunehmen. „Dabei geht es nicht nur um die Phänomene, die wir bereits beobachten. Wir müssen uns ebenso auf Dürre und extreme Hitze einstellen – das ist die nächste große Herausforderung“, sagt Neitzer. Hinzu komme: Besonders kalte, langanhaltende Phasen könnten wieder auftreten und ganz eigene Probleme mit sich bringen. All das seien Herausforderungen, auf die sich Staat und Gesellschaft vorbereiten müssten. Hier setzt seine Arbeit – sein tägliches Brot, wie er es nennt – an: Preparedness schaffen. Dies beginne damit, Risiken zu erkennen und zu beschreiben. Daraus folge die Vorbereitung: Materialbeschaffung, Baumaßnahmen, Wissen. Dazu leistet Neitzer mit seiner Abteilung in Kooperation mit Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden und Hilfsorganisationen einen Beitrag. Technische Gefahren wie Stromausfall und Gasmangellagen seien durch die letzten Jahre in den Fokus gerückt, aber in Zukunft müsse man sich auch beispielsweise über Wasserknappheit Gedanken machen. „Bei den menschlichen Gefährdungen und Risiken ist uns allen bewusst, dass wir in einer globalen Sicherheitslage leben, die sehr volatil ist. Entsprechend muss sich der Bund – und wir auf Landesebene ebenso – auf neue Szenarien vorbereiten. Diese reichen von hybriden Bedrohungen bis hin zu Fragestellungen der Zivilverteidigung“, erklärt Neitzer seinen Anspruch für die Zukunft. Am Ende des Tages schließt das Ritual an den Morgen an. Das Ablegen der Dienstkleidung beendet den Arbeitstag. Morgen fängt der Tag wieder mit dem Anlegen der Dienstkleidung an.