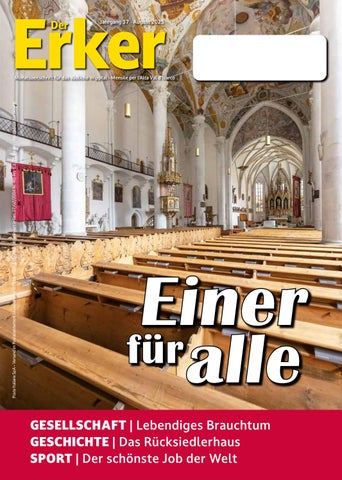Erker
DEN AUFSTAND TENTARE
PROBEN UNARIBELLIONE
25/07- 31/10

ERÖFFNUNG 25 / 07 17 •30 ~NAUGURAZIONE •
STADT-UNDMULTSCHERMUSEUMSTERZING MUSEOCIVICO E MUSEOMULTSCHERDI VIPITENO
MIT WERKENVONICON OPEREDI
AUSSTELLUNG MOSTRA
ßpr•y Sku1>0 r1,1ar ·umal, Chrlstlan Falsr1aes, Fluoro Fteece l\unstkot•ek\lv, Franz Plrnll?r', lngrld l-lora.Jakob De ~t-iirico,Jasmlne Deport:a, Karl Platt:ner. Leander Schwazer, Maria C. HI ber, Oil mar WlnHer, Peter Kc.ser, Peter Lorenz, '(aron Guerrero Santos
Liebe Leserin, lieber Leser,
jedes Problem hat seine Lösung. Ob sie vorausschauend genug gewählt wurde, offenbart sich oft erst im Laufe der Zeit – sobald Konsequenzen, neue Chancen oder Grenzen sichtbar werden, die einem anfangs gar nicht bewusst waren. Manchmal wird generationenlang darüber diskutiert, ob eine getroffene Entscheidung sinnvoll war oder ob eine andere nicht klüger gewesen wäre. Erst recht bei Prestigeprojekten, die zeitlos ganze Epochen überdauern sollen. In der aktuellen Ausstellung „Brücken durch die Zeit – Architektur des Unsichtbaren“ verknüpft Fotograf Gregor Sailer in der Franzensfeste Geschichten von Menschen, die einst die historische Festung errichtet haben, mit jenen, die heute den Brennerbasistunnel, die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt, graben. Beide Bauten sind umstritten, beide haben Spuren hinterlassen: in der Natur, in der Gesellschaft, in der Geschichte. Ganz im Sinne des Euregio-Museumsjahrmottos 2025 „Weiter sehen“ offenbaren die ausgestellten Fotografien auch so manchen blinden Fleck in unserer Wahrnehmung. Der Mensch von heute kreiert die Welt von morgen, Tag für Tag, bewusst oder unbewusst, ob er will oder nicht, mit seinem Tun und Nichtstun. Und doch bleibt die Zukunft am Ende unvorhersehbar und unberechenbar, mag er sie noch so akribisch vorausdenken.
Apropos gezielt in die Ferne schauen: In der Wipptaler Seelsorge tut sich gerade ein neuer Horizont auf, weil die Diözese kurzfristig Kurs geändert hat. Die Segel sind schon gesetzt: Ab 1. September wird ein einziger Pfarrer alle 16 Pfarreien gesetzlich vertreten. Ein Novum, das Laien vor Ort noch stärker in die Verantwortung rücken soll – angesichts der schrumpfenden Priesterzahl. Ob der Plan auch aufgehen wird, kann zum heutigen Zeitpunkt niemand mit Gewissheit sagen. Die Diözese hofft es, vertraut auf Gott und engagierte Menschen vor Ort in den Pfarreien. Mehr darüber in unserer Titelgeschichte.
In dieser Ausgabe werfen wir auch einen Blick auf den hart umkämpften Bezirksposten im Rat der Gemeinden und die geplanten Vorhaben der Wipptaler Gemeinden. Ihre Leitbilder werden in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus die lokalpolitische Entwicklung im Bezirk prägen. Wir berichten u. a. über wiederentdecktes altes Kunsthandwerk, die Landshuter Europahütte, deren Zukunft in der Vergangenheit schon mehrfach auf der Kippe stand, das Rücksiedlerhaus in Sterzing und den „schönsten Job der Welt“: Die beiden Bergführer Stefan Fassnauer und Fabian Bacher überwinden mit Kundschaft und Karabiner Hindernisse und Grenzen und finden auf jedem gemeinsam zurückgelegten Weg, mag er noch so anstrengend gewesen sein, sprichwörtliche Weitsicht.
Gute Lektüre!
IN EIGENER SACHE

NUOVA DIREZIONE EDITORIALE
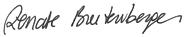
- Redakteurin -

Chiara Martorelli, alla guida della redazione italiana dell’Erker dal 2020, è stata eletta nel Consiglio comunale di Vipiteno e nominata Assessora.
In seguito a questo nuovo incarico, passa il testimone della direzione a Silvia Martorelli aveva assunto la responsabilità della redazione in lingua italiana dopo la scomparsa di Alberto Perini, storico collaboratore. La redazione desidera ringraziare Chiara per gli anni di preziosa direzione editoriale. Continuerà a collaborare con noi come freelance.
A Silvia vanno i nostri migliori auguri per il nuovo incarico.
Der Erker erscheint monatlich in einer Auflage von über 7.200 Exemplaren. Eintragung am Landesgericht Bozen am 20.09.1989, Nr. 22/89 R.St., Eintragung im ROC: Nr. 005454
Bürozeiten: 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr Freitagnachmittag geschlossen
Eigentümer und Herausgeber: WIPP-Media GmbH
Redaktionsanschrift: Der Erker
Neustadt 20 A, 39049 Sterzing Tel. 0472 766876 I info@dererker.it www.dererker.it facebook.com/erker.sterzing/ Instagram: dererker_zeitschrift_wipptal
Presserechtlich verantwortlich: Renate Breitenberger (rb)
Chefredakteur: Ludwig Grasl (lg) ludwig.grasl@dererker.it
Redaktion: Barbara Felizetti Sorg (bar) barbara.felizetti@dererker.it Renate Breitenberger (rb) renate.breitenberger@dererker.it
Sportredaktion & Lektorat: Barbara Felizetti Sorg (bar) sport@dererker.it
Redaktion italienischer Teil: Silvia Pergher (sp) silvia.pergher@dererker.it
Sekretariat & Werbung: Barbara Fontana barbara.fontana@dererker.it
Grafik & Layout: Alexandra Martin grafik@dererker.it
Mitarbeiter dieser Nummer: Heinrich Aukenthaler, Alois Karl Eller, Paul Felizetti (pf), Lorenz Grasl (log), Karl-Heinz Sparber, Clara Trocker, Bruno Maggio (bm), Chiara Martorelli (cm), Dario Massimo (dm)
Titelseite: © Martin Schaller
Druck: Tezzele by Esperia, Bozen
Preise: Einzelnummer 0,75 Euro; Jahresschutzgebühr Wipptal 5 Euro; Jahresabo Inland 44 Euro; Jahresabo Ausland 75 Euro.
Im Sinne des Art. 1 des Gesetzes Nr. 903 vom 9.12.1977 wird eigens darauf aufmerksam gemacht, dass sämtliche in dieser Zeitung veröffentlichten Stellenangebote, sei es im Kleinanzeiger wie auch in Formatanzeigen, sich ohne jeden Unterschied auf Personen sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtes beziehen. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Anzeigen und Beiträge unter Umständen zu kürzen, abzuändern oder zurückzuweisen. Für den Inhalt von Anzeigen gewerblicher Art zeichnet die Redaktion nicht verantwortlich. Eingesandte Bilder und Texte verbleiben im Eigentum der Redaktion. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber wieder und sind von der Redaktion nicht in allen Einzelheiten des Inhalts und der Tendenz überprüfbar. Nachdruck sowie Vervielfältigung jeder Art ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
La redazione


bist raus!“
14 Sterzing: 1,1 Millionen Euro für Investitionen
18 Ratschings: Weichen für die Zukunft gestellt
Wirtschaft
10 Gossensaß: Fortschritte und Perspektiven für Umfahrung
10 A22: Konzessionsvergabe erneut verzögert
92 Handwerk: Lebendiges Brauchtum auf der Alm
Gesellschaft & Umwelt
24 Titelgeschichte: „Es ist der einzige Weg, den wir zurzeit gehen können“
32 Pfitsch: Straße des Todes
34 Jubiläum: 150 Jahre Feuerwehr Sterzing
Redaktionsschluss: 15.08.25


Bodypainting: Sterzing als lebendige Kunstgalerie
44 Musik: 15. Orfeo Music Festival
56 Geschichte: Das Rücksiedlerhaus in Sterzing
Pagine italiane
60 Consiglio comunale di Vipiteno
62 Intervista al sindaco di Fortezza
64 Le vie ferrate della Wipptal
66 Rassegna cori georgiani
Sport
68 Porträt: „Der schönste Job der Welt“
71 Radsport: Tour-Transalp-Sieg für Thomas Gschnitzer
75 Wiesen: Reitsporttage setzen neue Maßstäbe
Extra 78

Rubriken
3 Impressum
5 Leserbriefe
8 Aufgeblättert ...
15 Laut §
36 Kinderseite
38 Jugendseite Whats Upp?!
74 Sportpsychologie
98 Sportmedizin
100 Veranstaltungen
102 Jahrestage
105 Aus der Seelsorgeeinheit
106 Unterhaltung
108 Kleinanzeiger
108 Sumserin
110 Gemeinden
111 Vor 100 Jahren
Oh je, oh je ...

Leider leider muaß i eppas tian, wos i gor nit gern tua ... Jo, man glab‘s kaum, ober heinte muaß i amol LOBEN. Wia mir olle, tu i sell gonz wianig oft und noar a nou ungern.
Ober wia gsogg, heinte weard gelob. Zwor woaß i nit, wen, ober is Resultat isch wunderbor. Vielleicht muaß man die Gemeinde-Orbater, -Referenten, -Ratsmitglieder und am End a in Birgermeister a a bissl loben für ihren Entschluss so eppas zuazulossn. Gonz sicher muaß man die Gitschn und Herren Gärtner loben, de wos des derrichtet hobn, dass mir in der Stodt Sterzing so schiane Wildblumen und Gräser hobm. A Wohltot für die Bienen und fürs Auge! Zin Beispiel bei der Ompl ausn oder unten ban Kreisverkehr ba der Feuerwehrhalle. Eppas Schians – nit so oigemahnte griane Stroafn. Na – wunderschiane verschiedene Bluamen. Sauber und bravo! Wia gsogg, i honn‘s nit a so mitn Lobn, ober wos sein muaß, muaß sein.
Welko Unterthiner, Sterzing
Trotzdem an den Frieden glauben
In ihrem Buch „An den Frieden glauben“ lese ich diese bemerkenswerten Sätze der deutschen Schriftstellerin Luise Rinser, vor fast 80 Jahren
geschrieben: „In diesem Jahr hundert wird unendlich viel geredet ... Aber Worte und Ereignisse klaffen auseinander ... Rüstungen sind nicht nur Sache der Regierungen und der Munitionsfabriken. Sie sind auch Sache des Volkes und haben eine psychologische Seite. Es gibt eine stimmungs mäßige Rüstung des Volkes: Die BEREITSCHAFT des Volkes zum Krieg! ... Die Uranfänge eines jeden Krieges liegen in dem JA, das der Einzelne zum Krieg sagt. Ist dieses JA einmal ausgesprochen, so gibt es der stofflichen Rüstung jenes fürch terliche Gewicht, das den Krieg unaufhaltsam macht.“
Die Rede dieser klugen Frau, im September 1946 bei der inter nationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit in Stuttgart gehalten, lässt mich fragen, warum die mahnenden Stim men der Nachkriegsliteratur (Böll, Brecht, Kästner, Grass, Borchert, Mann, Zweig, Wolf, Bachmann) uns Heutige nicht mit mehr Engagement für den Frieden auftreten lassen, als wir es tun.
Ich weiß, wie auch schon Rinser, dass blutige Kriege Grundspannungen niemals aus der Welt schaffen werden und dass es einen paradiesischen Stand spannungsloser Unschuld und Einheit nicht gibt. Warum aber sollten die Völker der Erde nicht in Widersprüchen leben können und sie durch Verträge mildern, statt sie zu vernichten?
Die Rede endet mit dem Satz: „Wer der Zukunft dienen will, wird es nicht mehr können als Patriot, sondern einzig und allein als Mensch in der Ge meinschaft aller Menschen dieser Erde.“
Haben wir zu viel Angst?
Martha Fuchs Haller, Sterzing
Wir geben Ihrem Leben Raum. Dl mo spazio all Vos r
Eil'llge.nc:htete2-Z.-Wmlt jglkon& überdachtemStellplatz~nkhtk.onwnlioniertl Br1oca/o:tmedatocon balr::onee posro aur:ocopeno non convenzionarof
Gut eingeteilte 'JrZ.wmlt Balkon,Garage& Dachboden~ntcht konventlonlertl Trilocafeben5!.ldd/visoco.ri bak:one.ga1age-b0Kesoffl~a~noncon~ntionarol
Bar-Bistrot miflerrasse 1nhochf,req uentlert:er & gut $lchtbarer Lage! Bar-bistrm con tetrllZZa in µositione molto frequeniäta e oen v,sibilel
PFITSCHl VAL Dl VIZZE

Wohnen& Al'be'lten In Panoramalage:visionäresProjektfür moderneGewerbehai AbitoreekM:lmfeinposiziooep(J'(IO«]rnm~"'5iboorioperun ~modemri
1mm blllenvetTI'llttl un te.t M iatorl e Con ufen l lmma illarl 3.9049StcirzJ-nq-Vtp t no Neustadt 26 Gtt.i Nu va
Riflessione sulla
rimozione di Don Giorgio
Con questa lettera desidero esprimere, a nome mio e di molti altri parrocchiani, il profondo dispiacere per la recente e inaspettata rimozione di Don Giorgio, parroco della nostra comunità italiana.
Chi conosce davvero Don Giorgio sa quanto sia stata ingiusta l’ombra gettata su di lui in passato. Ma ancora più importante è ciò che ha costruito con costanza, umiltà e dedizione in questi anni a Vipiteno: una comunità unita, viva e realmente bilingue, dove non c’è stata distinzione tra “italiani” e “tedeschi”, ma solo tra persone di buona volontà.
Don Giorgio è stato, ed è, un instancabile lavoratore. La sua presenza non si è limitata al ruolo liturgico: ha saputo essere vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai più fragili. Le sue omelie, profonde e sentite, hanno toccato cuori e coscienze. In tempi di crescente disinteresse verso la fede, specialmente tra le nuove generazioni, la sua guida rappresentava un punto fermo, un esempio raro di coerenza, calore umano e spiritualità autentica.
La sua sostituzione, oltre a la-
sciare un vuoto evidente, rischia di segnare una frattura pericolosa tra la Chiesa e una parte significativa della popolazione. Soprattutto tra i giovani, che faticano già a sentirsi ascoltati e coinvolti.
Purtroppo, questa decisione non è revocabile. Ma non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che rappresenta. Scelte di questo tipo - calate dall’alto, senza dialogo, senza confronto - rischiano di ferire profondamente il tessuto spirituale e umano di una comunità. Ancora più doloroso è constatare che, nel prendere questa decisione, non siano stati realmente ascoltati i parrocchiani che vivono e partecipano attivamente alla vita della Chiesa locale. Sembra, invece, che il giudizio sia stato influenzato da voci esterne, da persone che – pur risiedendo a Vipiteno – non sono parte integrante della nostra comunità parrocchiale, non frequentano la Messa con regolarità e, per questo, non hanno potuto cogliere appieno il valore profondo del cammino condiviso con Don Giorgio. È difficile comprendere come si possa valutare l’operato di un parroco senza conoscerne l’impegno quotidiano, la presenza costante, la capacità di accompagnare con discrezione e amore ogni fase della vita della
comunità. La Chiesa dovrebbe essere prima di tutto madre, non struttura. Dovrebbe conoscere i suoi figli e camminare accanto a loro, non voltarsi altrove. Quando un parroco viene allontanato nonostante abbia dimostrato negli anni bontà, dedizione e capacità di costruire unità, ci si chiede se lo spirito del Vangelo - che è amore, misericordia, ascolto e giustizia - sia ancora il metro con cui si guidano certe scelte. La fede non può ridursi a una gestione amministrativa o gerarchica: è relazione viva con il popolo, è presenza, è incarnazione quotidiana. E questo Don Giorgio lo ha dimostrato con la sua vita.
Per questo, oggi più che mai, è doveroso interrogarsi su che tipo di Chiesa vogliamo essere. Una Chiesa chiusa nei palazzi o una che abita tra le persone? Una che impone o una che si mette in ascolto? Una che divide o una che unisce? Se vogliamo che la fede resti viva - soprattutto per le generazioni future - dobbiamo imparare a riconoscere il valore di chi serve con amore e a difendere ciò che costruisce comunità, non distruggerla. Con rispetto e sincero dolore,
Margherita Casalini, Vipiteno
Beschämend!
ERGEBNIS JULI
Reichen die Verkehrskontrollen auf unseren Passstraßen aus?
DIE AUGUST - FRAGE
Besuchen Sie regelmäßig den Gottesdienst?
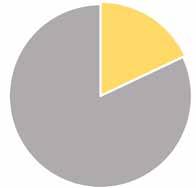
Es ist schon traurig genug, wenn eine Beerdigung stattfindet. Noch trauriger ist es aber, wenn bei dieser ein Arbeitsinspektor erscheint – wegen angeblicher Schwarzarbeit. So geschehen am 16. Juli auf dem Friedhof von Sterzing. Der Grund: Das beauftragte Bestattungsinstitut wurde von einem Konkurrenzunternehmen ausspioniert, das dann dem Arbeitsinspektorat eine Schwarzarbeit meldete, da beim Entladen des Sarges ein Messdiener der Pfarrkirche geholfen
hat. Wird man also fürs Helfen auch schon bestraft? Ich frage mich, ob ähnliche Aktionen auch schon früher erfolgt sind und ob dies in Zukunft weiterhin so fortgesetzt wird.
Ich bin der Meinung, wenn man in einem Einzugsgebiet mit 20.000 Einwohnern keine Konkurrenz verträgt, sollte man sich nicht nur schämen, sondern den Beruf wechseln. Eine Trauerfeier ist bereits ein trauriger Anlass, dieses Verhalten steigert aber alles ins Unermessliche.
Günther Wieland, Sterzing
Wo ein Wille, da ein Weg

Im Zuge eines Workshops des KVW im Herbst 2024 wurden Ideen für Aktionen gesammeltgegen Einsamkeit im Alter, aber auch für das dörfliche Zusammenleben. Eine konkrete Aktion in Wiesen zeigt, dass manches ganz einfach und unbürokratisch umgesetzt werden kann. Im Auftrag des Seniorenbeirates der Gemeinde wurde Sonja Hofer, Besitzerin des „Dorfladele“ in Wiesen, gefragt, ob sie sich im Eingangsbereich ihres Geschäftes eine kleine Sitzecke für Jung und Alt vorstellen könne. Kurze Zeit später wurde der Vorschlag umgesetzt und wird seither gerne für eine kurze Stärkung oder einen lockeren Plausch genutzt. Vielleicht eine Anregung, auch andernorts Momente des Innehaltens und des Verweilens zu ermöglichen.
Karl Leiter, Wiesen
Sehr geehrter Herr
Chefredakteur,
zunächst danken wir Ihnen, dass Sie unseren Leserbrief veröffentlicht und kommentiert haben. Erlauben Sie uns allerdings eine grundlegende Klarstellung:
Unsere Kritik richtete sich nicht gegen einzelne Inhalte, sondern gegen den Stil der politischen Berichterstattung, wie er sich zuletzt in Ihrem Blatt gezeigt hat. Der sogenannte „horse race journalism“ – das Zuschneiden von Politik auf Gewinner und Verlierer – mag anderswo gängige Praxis sein. Doch gerade deshalb sollte man diesem Trend nicht auch noch auf lokaler Ebene Vorschub leisten. Solche Darstellungsformen sind nicht nur wenig konstruktiv, sondern auch respektlos gegenüber engagierten Menschen, die sich politisch einbringen – ohne gleich auf Sieg oder Niederlage reduziert werden zu wollen. Diese Art der Zuspitzung leistet der Politikverdrossenheit Vorschub – und zwar messbar
Verwundert hat uns zudem Ihr Hinweis, einige Ratsmitglieder hätten nicht den gewünschten oder geforderten Ton getroffen. Da Sie selbst bei den betreffenden Sitzungen nicht anwesend waren, stellt sich die Frage: Worauf stützt sich dieses Urteil? Wenn Sie politische Bewertungen auf dieser Basis formulieren, wird Meinung als Fakt verkauft –ein Vorgehen, das dem Anspruch an seriösen Journalismus nicht gerecht wird.
Dass Sie Ihre Deutung mit einem Zitat von Rudolf Augstein untermauern, wirkt da fast zynisch. Denn was Augstein tatsächlich gefordert hat, war journalistische Zurückhaltung – nicht Zuspitzung, nicht Einfärbung, sondern das sorgfältige Ausbalancieren von Information. Neutralität –nicht Meinungsmache. Genau hier verläuft die Trennlinie: zwischen einer Presse, die Meinungen abbildet, und einer,
die sie macht. Es wäre bedauerlich, wenn sich Ihre Redaktion zunehmend Letzterem verschriebe.
Evi Frick, Ingrid Pichler, Lydia Untermarzoner, SVP Sterzing
Keine Sorge, wenn ich Rudolf Augstein zitiere, weiß ich schon, wovon ich spreche. Und: Dass der Tonfall einiger Ratsmitglieder, im Übrigen nicht nur Ihrer Fraktion, in der Vergangenheit in den altehrwürdigen Gemäuern unserers Rathauses gelinde gesagt alles andere als angemessen war, ist weitum bekannt, war mehrfach Thema bei unseren Redaktionssitzungen und hat auch öfters Eingang in unsere Berichterstattung gefunden.
Zudem: Unsere gut 25-seitige Wahlanalyse erneut auf eine aufund absteigende Grafik zu reduzieren, greift entschieden zu kurz.
Ludwig Grasl
Souvenirs, Souvenirs
Schau wie sie strahlen um die Wette die hl. Jungfrau und die Bernadette mittendrin der Leo –der Papst der Nette wenn ich doch auch so ein Mannsbild hätte
Ein Teller strahlt mit Meghans Gesicht ist ja ganz nett –nur beliebt ist sie nicht mitbracht hab ich auch edle Gerüche Und den Trump aufgehängt in meiner Küche
Maria Schumann
Der Skatepark als Symbol
(Erker 07/2025)
Mit großer Aufmerksamkeit haben wir den Leserbrief von Daniel Tock in der letzten Ausgabe des Erker gelesen und möchten dafür ausdrücklich danken. Es braucht junge Stimmen wie diese, um wachzurütteln und aufzuzeigen, wo die Politik zu lange zu wenig bewegt hat. Er spricht vielen Jugendlichen aus dem Herzen, wenn er schreibt, dass ein funktionierender Skatepark mehr ist als nur ein Sportplatz – er ist ein Zeichen der Wertschätzung und Teilhabe für alle, die sich jenseits klassischer Sportvereine bewegen wollen.
Als gewählte Vertreter im Gemeinderat Sterzing haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder intensiv mit der Situation in der Sportzone auseinandergesetzt. Gerade der Skaterplatz ist ein Symbol dafür geworden, wie dringend wir einen modernen, umfassenden Sportstättenentwicklungsplan brauchen. Einen Plan, der nicht nur Bestehendes saniert, sondern die gesamte Zone zukunftsfähig macht – für Breitensport, für Vereinsleben, für Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.
Wir möchten an dieser Stelle deutlich machen: Die SVP Sterzing hat in den letzten Jahren mehrere konkrete Initiativen gesetzt, um Verbesserungen anzustoßen: Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Sport und Naherholung für Kinder und Jugendliche (2021), Antrag zur Beauftragung eines Urbanisten für die Raumplanung der Sportzone (2021), Antrag zur Ausarbeitung eines Sportstättenentwicklungsplans mit Masterplan für die gesamte Sportzone (2022).
Bereits im Jahr 2018 wurde ein Projekt für den Skateplatz mit Gesamtkosten in Höhe von 179.750 Euro ausgearbeitet.
Die Zusage für den 50-prozentigen Landesbeitrag wurde am 13. November 2019 vom Amt für Jugendarbeit der Gemeinde Sterzing schriftlich übermittelt. Leider konnte dieser Beitrag aufgrund mangelnder Umsetzung seitens der Stadtregierung nicht genutzt werden. Das ist bedauerlich.
Weiters gibt es einen Stadtratsbeschluss vom 7. September 2022 für den „Bau eines Skateplatzes und eines Tennisplatzes an der Stelle des ehemaligen Skateparks in Sterzing“. Leider wurde dieser Beschluss in dieser Form nicht umgesetzt. Wir stehen heute vor der Möglichkeit, mit dem geplanten Wiederaufbau der Eishalle endlich umfassend zu denken: Neben Eishockey und Fußball braucht es öffentlich zugängliche Flächen –einen Skatepark, Basketballplätze, Beachvolleyballfelder – Orte, an denen Kinder und Jugendliche Sport erleben können, ohne Vereinsbindung, ohne Eintritt, einfach draußen, gemeinsam, kreativ – und auch nutzbar für unsere Schulen.
Die Asphaltierung des Skateparks ist derzeit im Haushalt vorgesehen und muss nun zügig realisiert werden. Aber das darf nur der erste Schritt sein. Dafür sollten wir uns alle einsetzen – mit den Jugendlichen gemeinsam.
Evi Frick, im Namen der Gemeinderatsfraktion SVP Sterzing
Schreiben sie uns
Schreiben Sie uns an info@dererker.it oder bringen den Leserbrief zu Bürozeiten in der Redaktion vorbei.
Scriveteci a info@dererker.it o consegnate una lettera in redazione durante l'orario d'ufficio.
Auf
vor 30 Jahren im Erker
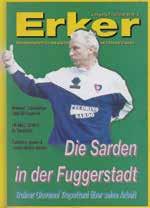
08/1995
Der Erker spricht mit StarTrainer Giovanni Trapattoni, der mit dem Fußballclub US Cagliari in Sterzing die Trainingszelte aufgeschlagen hat, über seine Trainerlaufbahn, die italienische Meisterschaft und die Bundesliga – und über Sterzing als Trainingsdomizil.
Schwieriger Start
Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates von Brenner zweifeln fünf Räte die Wählbarkeit des neuen Bürgermeisters Christian Egartner an.

Tolle

Jagdmuseum nimmt Gestalt an
Schloss Wolfsthurn in Mareit wird von Grund auf saniert: 1996 soll hier ein Jagdmuseum eingerichtet werden.
Marathon-Bilanz
Die Sterzinger Brüder Werner (2:37.11; Platz 33) und Reinhard Steindl (2:57.51; Rang 235) setzen sich beim Wien-Marathon – trotz sengender Hitze – hervorragend in Szene.


Endlich wieder Tennis
„… und raus bist du!“
Ende Juli wählten die Bürgermeister ihre Vertretung im Rat der Gemeinden. Im Wipptal fiel die Wahl nicht auf die Bürgermeisterin der Gemeinde Freienfeld, sondern auf die Vize-Bürgermeisterin der Gemeinde Pfitsch.
Wird um einen Posten gekämpft, ist er bedeutend. Der Rat der Gemein-

Der Tennisclub Sterzing, gegründet im Jahr 1946, eröffnet in der Sportzone zwei neue Sandplätze.
• Erinnerungen an Alexander Langer
• Achtes Sterzinger Stadtfest
• Der Zwock – ein Wipptaler Original
• Vierte Ridnauner Musikwoche
• Juvenilia: I suoni delle Dolomiti
Verena Überegger: „Hatte die besten Voraussetzungen für dieses Amt.“
sich für das Amt zur Verfügung, doch zur Abstimmung kam es nicht, da die SVP-Bürgermeister Sebastian Helfer (Ratschings), Martin Alber (Brenner) und Stefan Gufler (Pfitsch) eine Unterbrechung und nach interner Beratung eine Vertagung beantragten, um die Möglichkeit zu prüfen, mit einem Bezirk Quote zu tauschen, damit dieser eine Frau und das Wipptal einen Mann entsenden kann. Bis zum neuen Wahltermin zwei Tage später

Maria Rabensteiner: „Nehme diese ehrenvolle Aufgabe gerne an.“
das Frauennetzwerk Rücktritte zugunsten von Frauen forderte, wurde vor dieser Wahl eine Frauenquote eingeführt. Um im Rat das Gemeinderatswahlergebnis widerzuspiegeln, hatten diesmal Bozen, Meran, Salten/Schlern, das Wipptal, der Vinschgau und die italienische Sprachgruppe eine Frau zu nominieren. Am 21. Juli lud Gemeindeverbandspräsident Andreas Schatzer die fünf Wipptaler Bürgermeister (Franzensfeste, vertreten im Rat der Kleingemeinden, ist nicht stimmberechtigt) zur Wahl in die Bezirksgemeinschaft Wipptal. Verena Überegger stellte
germeisterin Maria Rabensteiner (Pfitsch). Verena Überegger erhielt zwei Stimmen (jene des Sterzinger Bürgermeisters Peter Volgger und ihre eigene). „Ich hatte die Motivation und besten Voraussetzungen für dieses Amt, da bei der letzten Wahl proklamiert wurde, Bürgermeister und nicht Vize-Bürgermeister zu nominieren“, so Überegger enttäuscht. Vor den Kopf gestoßen habe sie Albers Aussage, Bürgermeister seien auch Parteimenschen, weshalb die Bürgermeisterin der Freien Liste nicht die Richtige für dieses Amt sei. „Der Bürgermeister hat die Aufgabe, alle Bürger zu vertreten. Der Rat der Gemeinden ist kein Parteigremium und sollte nicht als solches zweckentfremdet werden, auch Parteikarten sollten nicht ausschlaggebend sein. Hiervon müsste sich der Rat
der Gemeinden klar distanzieren.“
Menschlich enttäuscht hätten sie die drei SVP-Bürgermeister. „Es war offenkundig, dass es nicht um die Sache, sondern um den Postenerhalt ging – mit allen erdenklichen Mitteln. Das ist ein Armutszeugnis.“ Dieser Meinung sind laut „Neuer Südtiroler Tageszeitung“ auch Soziallandesrätin Rosmarie Pamer („Die Mander hinten herum richten es sich, wie es ihnen passt!“) und Roselinde Gunsch, Bezirkspräsidentin im Vinschgau („Ein klarer Verstoß gegen den Geist der Spielregeln.“)
Bürgermeister Martin Alber, bisheriges Ratsmitglied, ist sich keiner Schuld bewusst. Er habe Stefan Gufler als kompetenten, geeigneten Nachfolger gesehen – Wochen vor Einführung der Frauenquote, gegen die er sich aus Prinzip wehrte: Sie benachteilige Gemeindegruppen mit vielen Frauen, da sie Frauen entsenden müssen, und Gemeindegruppen mit wenigen Frauen belohne, da sie weiterhin Männer entsenden können. Da die Wipptaler Minigemeindegruppe mit vier Bürgermeistern und einer Bürgermeisterin 20 Prozent der Frauen repräsentiert, musste eine Frau nominiert werden, was legitim sei. „Es muss aber auch erlaubt sein, sich diese selbst mehrheitlich auszusuchen“, so Alber. Da Gufler nicht entsandt werden konnte, einigte man sich auf die Vize-Bürgermeisterin von Pfitsch. „Maria Rabensteiner ist eine kompetente und engagierte Frau“, so Alber. Ihre Nominierung sei keine Aktion gegen Überegger, deren Parteizugehörigkeit oder Frauen in der Politik. Dass Parteipolitik eine Rolle spiele, sei offensichtlich, weil es im Landtag, wo Gesetze gemacht werden, genauso sei. Die Vertagung sei notwendig gewesen, um u. a. zu klären, wie eine mögliche Vereinbarung genau abzuschließen wäre, da diese Frage nicht beantwortet werden konnte. Er habe auch niemanden bekniet, sondern lediglich einen Bürger-
meister im Passeiertal gefragt, wie sie es in ihrem Bezirk handha ben, so Alber. SVP-Bezirksobmann Sebastian Helfer sagt, erst auf der ersten Sitzung mit dem Gemeinde verband erfahren zu haben, dass Überegger am Amt interessiert sei. „In solchen Angelegenheiten kann, muss man mich aber nicht anrufen.“ Für ihn war klar, in Ab sprache mit den beiden SVP-Bür germeistern eine der zwei SVP-Vi ze-Bürgermeisterinnen (Brenner oder Pfitsch) zu nominieren. Laut Wahlbestimmungen dürfen Bür germeister oder ihre Stellvertreter das Amt ausüben. „Ich frage mich also, was an unserer Entscheidung und der demokratisch durchge führten Abstimmung falsch sein soll“, so Helfer.
Maria Rabensteiner freut sich über ihre Wahl. „Das zuständige Organ hat mich mehrheitlich no miniert. Ich nehme diese ehren volle Aufgabe gerne an und werde im Auftrag des gesamten Bezirks arbeiten“, so Rabensteiner. Auch Verena Überegger gratulierte ihr. „Ich bin froh, dass eine Frau im Rat sitzt und es den Männern nicht ge lungen ist, die Frauen im Wipptal komplett auszubooten. Nicht gut finde ich, wenn Frauen sich von Männern instrumentalisieren las sen und Frauen sich gegenseitig ausbooten“, so Überegger.
„Es geht keineswegs um gegen seitiges Ausbooten. Ich habe auch nicht das Gefühl, instrumentalisiert worden zu sein“, so Rabensteiner. Da die SVP keine Bürgermeisterin stellt und die beiden Vize-Bürger meisterinnen die einzigen wären, die dieses Amt übernehmen könn ten, habe sie nach Bedenkzeit zuge sagt - ohne zu wissen, wie gerne Ve rena Überegger das Amt bekleidet hätte. Die entstandene Polemik sei nicht in ihrem Sinne und Interesse. 2020 führten Proteste zur Einfüh rung der Frauenquote. Vielleicht führt auch die aktuelle Debatte dazu, gängige politische Praktiken zu hinterfragen und zu überdenken.
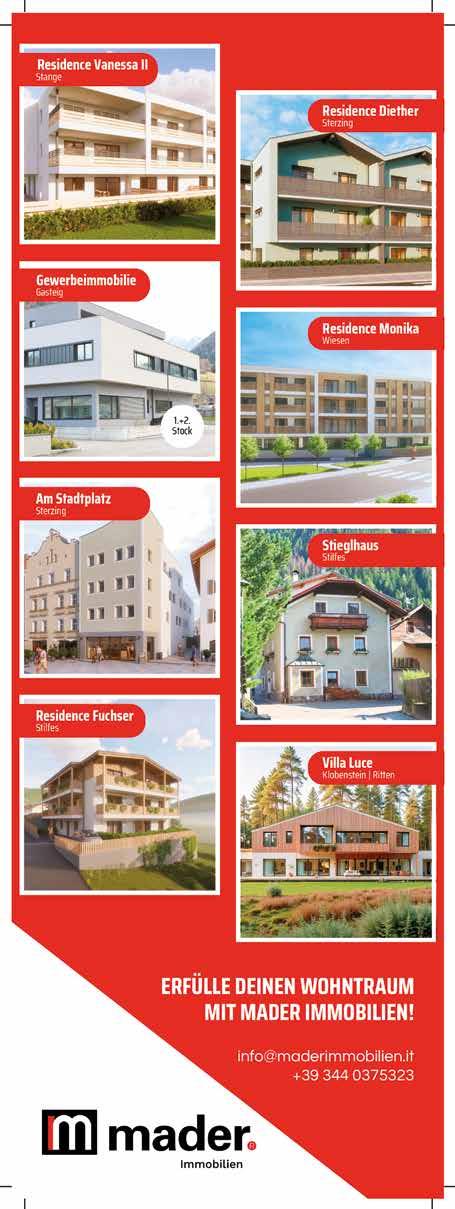
ResidenceFuchser Sfilrt!'5.
Gestoppt
A22: Konzessionsvergabe erneut verzögert

Eine unendliche Geschichte: Da die Europäische Kommission erneut Zweifel am Vorkaufsrecht für die Vergabe der Autobahnkonzession durch die Brennerautobahngesellschaft geäußert hat, wurde die Ausschreibungsfrist erneut verschoben. Die Frist, die Ende Juni ausgelaufen wäre, wurde vom Infrastrukturministerium bis Ende November gestoppt. Bei der A22 gibt man sich weiterhin zuversichtlich, bei der Vergabe ein Vorzugsrecht zu erhalten.
Die bereits seit elf Jahren verfallene und immer wieder verschobene Konzession wird für 50 Jahre vergeben und ist ein überaus lukratives Geschäft. Es gibt zahlreiche Interessenten, da die Brennerautobahn AG in den vergangenen Jahren – auch wegen des ständig steigenden Verkehrs auf der Brennerachse – stets satte Gewinne geschrieben hat. Die Region Trentino-Südtirol und die beiden Provinzen Bozen und Trient halten knapp die Hälfte des Aktienpakets und sind die größten Anteilseigner.
2024 wies die AG einen Gewinn von knapp 98 Millionen Euro aus. Der Umsatz belief sich auf über 405 Millionen Euro; 125 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr investiert.
Umfahrung Gossensaß: Fortschritte und Perspektiven

Nachdem die R von Gossensaß seit Jahren gefordert wird, um die Lebensqualität der Bevölkerung von Lärm, Abgasen und Feinstaub des Durch zugsverkehrs zu verbessern, hat das Team K vor kurzem eine Landtagsanfrage gestellt, um in Erfahrung zu bringen, wie es um das Projekt steht. Landesrat Daniel Alfreider hat darauf geantwortet.
Bereits im August 2016 wurde die Planung der Umfahrung von Gossensaß durch den damaligen Landesrat für Mobilität initiiert. Aufgrund urbanistischer Entwicklungen wurde die ursprünglich in einer Machbarkeitsstudie untersuchte Lösung verworfen. Stattdessen wurde eine neue Trassenführung ausgearbeitet, die östlich der Autobahn A22 verlaufen wird. „Diese neue Trasse ist bereits im Bauleitplan der Gemeinde Brenner eingetragen und somit öffentlich einsehbar“, so Landesrat Alfreider.
Die Planungsarbeiten sind weit fortgeschritten. Nach der Änderung der Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Brenner sollen die technischen und wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien der neuen Trasse bis zum Spätsommer vorgelegt werden. Im Anschluss daran muss die Genehmigung von Seiten der Dienststellenkonferenz erteilt werden. Danach folgen die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauarbeiten.
„Die Finanzierung des Umfahrungsprojektes wird, wie bei allen Bauvorhaben, im Zeitver-
lauf im Dreijahresplan berücksichtigt, sobald ojekt detailliert ausgearbeitet und die aktualisierten Kosten festgelegt sind. Derzeit beläuft sich die Kostenschätzung für das Bauvorhaben auf 41.965.750 Euro, wobei diese Schätzung mit der Weiterentwicklung des Projekts noch aktualisiert werden muss. Erfreulich ist, dass mit einer zusätzlichen Querfinanzierung durch die Autobahngesellschaft A22 gerechnet werden kann, da die Ortschaft indirekt durch die A22 belastet wird“, so Alfreider.
Aus technischer Sicht könnte das Projekt im Laufe des Jahres 2027 ausgeschrieben werden, unter Berücksichtigung der standardmäßigen Verfahren. Die Bevölkerung von Gossensaß kann also hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, auch wenn die finanzielle Verfügbarkeit neben den technischen Zeiten eine entscheidende Rolle spielen wird.
Einen Seitenhieb konnte sich Alfreider nicht verkneifen. „Nachdem sich das Team K immer wieder gegen Gelder für Straßenprojekte ausspricht, verwundert das Interesse an diesem Projekt“, stellte er fest. Das kann das Team K so nicht stehenlassen. „Diese Bemerkung empfinde ich persönlich beleidigend und degradierend für einen Landesrat, der für einen gepflegten Umgangston stehen müsste und nicht in einer Form der Arroganz und Überheblichkeit fragende Kollegen abkanzeln muss. Dies zeugt von einem entarteten Politikerstil“, so Landtagsabgeordneter Dr. Franz Ploner.
• KOMMENSIE VORBEI UNO FINDEN SIE DAS, WAS SIE SUCHEN!
ELEKTROHALLER
IHR GESCHÄFTFÜR ELEKTROGERÄTE. HAUSHALTSGERÄTE.TELEFONDIENSTLEISTUNGEN UND ELEKTROINSTALLATIONEN
Seit dem 1. Mai 2025 hat sich bei Elektro Haller viel Neues getan. Im Geschäfl in der Bahnhofstraße befindet sich nun auch die Telefonabteilung (das frühere TIM Geschäft im Lokal nebenan). Meinrad, Christian und Monika sind gerne für Sie da und beraten Sie gerne.

In der Telefonabteilungfinden Sie Handys.Drucker mit den passenden Druckerpatronen und viele weitere Artikel M,1guter Beralung stehen wir Ihnenbei folgendenAnbietern zur Seite:
:: TIM O Mobile f:AS1JJ,.IED
Haben Sie ein Gerät zu reparieren? Kein ProbWir bieten eme große Auswahl an Elektroar• lern! Unsere M1tarbeitersmd bemuht Ihre Geratikeln und Haushaltsgeräten wie Waschma• te anzusehen und falls eme Reparatur machbar schinen Trockner Gefrienruhen Kaffeevoll- ist. diese zu reparieren automaten und Kteingerate We,ters beraten und liefern wir fur Sie gerne Einbaugerate wie Gefnerschranke, Geschirrspüler. Backofen und Herde mit unlersch,edlichen Kochfeldern der verschiedenenMarken.
Für Etoktroinstatlationon m Ihrem Gebaude steht Ihnen Atexander zur Seite und zeigt Ihnen die verschiedenen neuen digitalen Moglichke,ten
WippEnergy –
starke Gemeinschaft für grüne Energie
Photovoltaik-Förderung bis 2025 verlängert – jetzt 40 % Förderbeitrag sichern!
Mit der Gründung der neuen Energiegemeinschaft WippEnergy geht das Wipptal einen wichtigen Schritt in Richtung lokale Energiezukunft. Ziel der Genossenschaft ist es, saubere Energie lokal zu erzeugen, intelligent zu nutzen und in der Gemeinschaft zu teilen.
„WippEnergy steht für Zusammenarbeit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Wir
zung von Energie oder Förderzugänge. Ein attraktiver Förderanreiz erleichtert den Einstieg: Förderansuchen können noch bis spätestens 30. November 2025 eingereicht werden. Der Investitionszuschuss beträgt 40 %. Die Förderung gilt für Anlagen bis zu 1 Megawatt – ohne Mindestgröße – in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern.

wollen Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Landwirte dabei unterstützen, aktiv Teil der Energiewende zu werden“, erklärt Paul Eisendle, Präsident der frisch gegründeten Genossenschaft.
Die EEG wurde in enger Kooperation mit lokalen Betrieben aus verschiedenen Sektoren – darunter Elektrounternehmen, Energieberater und engagierte Wirtschaftsakteure sowie Private – ins Leben gerufen. Diese breite fachliche Aufstellung sorgt für eine solide Grundlage und professionelle Begleitung bei allen technischen und organisatorischen Schritten.
Als nicht gewinnorientierte Genossenschaft verfolgt WippEnergy ausschließlich den Zweck, ihren Mitgliedern einen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Vorteil zu verschaffen, etwa durch günstige Stromkosten, gemeinsame Nut-
Darüber hinaus wird der eingespeiste Strom für die nächsten 20 Jahre zu erhöhten Tarifen vergütet. Dies macht den Umstieg auf Sonnenenergie langfristig wirtschaftlich attraktiv.
Voraussetzung für die Förderung ist die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft. Mit WippEnergy steht nun eine neue lokale Möglichkeit offen, die auf Kooperation, Transparenz und lokale Wertschöpfung setzt. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und offen für alle Interessierten – ob Privathaushalt, Betrieb oder Landwirtschaft.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Partnern begleitet WippEnergy den gesamten Prozess: von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Antragstellung und Umsetzung.
Wissenswertes rund um WippEnergy
Welches Ziel verfolgt die EEG WippEnergy?
Als erneuerbare Energiegemeinschaft verfolgt die EEG WippEnergy das Ziel, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen (Sonne, Wasser, Wind) und gleichzeitig auch deren lokalen Verbrauch zu fördern, um einen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen ohne Gewinnabsicht zu schaffen. Konkret gelingt dies vor allem durch eine möglichst hohe stündliche Deckung zwischen
der Stromproduktion und dem Stromverbrauch von Mitgliedern der WippEnergy – und das auf lokaler Ebene innerhalb derselben Primärkabine. Dadurch wird die Höhe des auszuzahlenden Betrags für alle Mitglieder (Produzenten und Verbraucher) maximiert. Außerdem setzt sich WippEnergy für die Energiewende durch die Dezentralisierung des Energiesystems, die einhergehende Entlastung der Stromnetze und vor allem die Sensibilisierung der Verbraucher (load shifting) ein.
Wie kann ich Mitglied bei WippEnergy werden? Ist die Mitgliedschaft kostenpflichtig?
Um Mitglied zu werden, bitte einfach online den Antrag stellen – das dauert eine Minute. Anschließend werden wir deine Daten prüfen und dir die Bestätigung zusenden. Das Zivilgesetzbuch sieht für Genossenschaften generell vor, dass jedes Mitglied Geschäftsanteile zeichnen muss. Der Mindestbetrag beträgt dabei 50 Euro, und daher muss jedes Mitglied von WippEnergy einmalig 50 Euro einzahlen. Die Auszahlung an die Mitglieder erfolgt einmal im Jahr.
Kann ich jederzeit Mitglied von WippEnergy werden oder gibt es dafür eine Fälligkeit?
Mitglied kannst du ab sofort jederzeit werden – allerdings nur noch bis zum 31. Dezember 2027. Anschließend wird es aus gesetzlichen Gründen nicht mehr möglich sein, Mitglied bei einer EEG zu werden. Die zur Fälligkeit bereits eingetragenen Mitglieder von WippEnergy können 20 Jahre lang Mitglied bleiben und von den Fördertarifen profitieren.
Jetzt informieren, Teil der Energiegemeinschaft werden und die Förderung bis 30. November 2025 sichern!
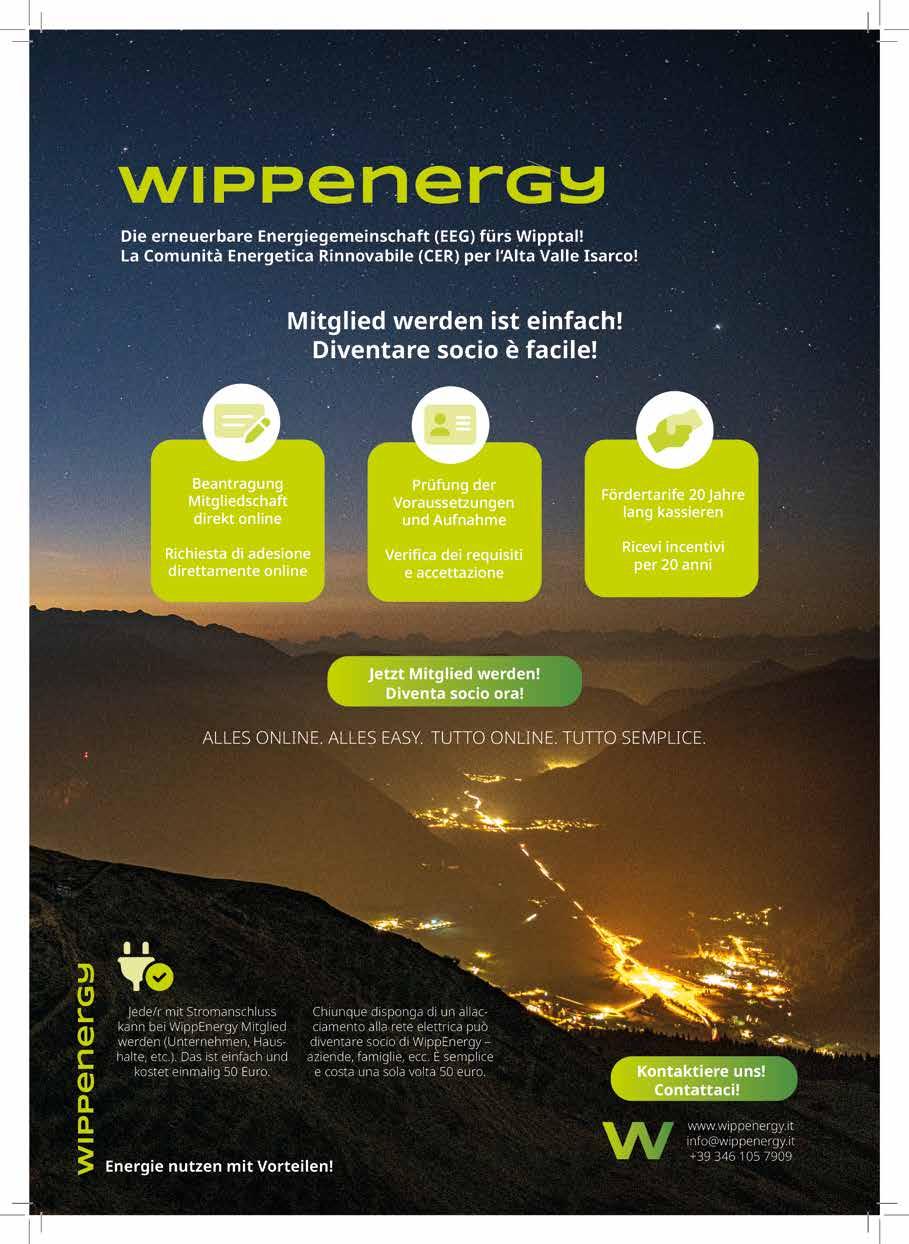
1,1 Millionen Euro für Investitionen
Auf seiner Juli-Sitzung hat der Sterzinger Gemeinderat u. a. den Entwurf des einheitlichen Strategiedokuments (DUP) zur Kenntnis genommen und mehrere Kommissionen besetzt.
Im Rahmen des einheitlichen Strategiedo kuments für den Dreijahreszeitraum 2026 – 2028 stehen der Gemeinde 1.127.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Diese wurden u. a. für einen Investitionsbeitrag an die Bezirksgemeinschaft für den Neu bau des Seniorenwohnheimes (285.348 Euro), die außerordentliche Straßeninstand haltung von Straßen (149.659 Euro), den
KOMMISSIONEN BESETZT
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
Bürgermeister Peter Volgger, Johannes Nie derstätter, Martina Pecher, Nicola Marangoni, Michela Luciani, Hannes Kofler und Marianna Erlacher (Ersatz: Vize-Bürgermeister Fabio Cola, Hannes Ladstätter, Rosa Sigmund, Fabio Palmeri, Roberta Sommavilla, Manuel Pasto re, Ursula Sulzenbacher)
Landeskommission für landschaftsrechtliche Genehmigungen
Kathrin Kral (Ersatz: Dominik Kinzner)
Gemeindekommission für Unbewohnbarkeitserklärungen
Ankauf von Selfin-Aktien (102.109 Euro), die außerordentliche Instandhaltung der deutschen Mittelschule (45.000 Euro) und des E-Werks (40.000 Euro) zweckgebunden. 35.000 Euro fließen in die außerordentliche Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung, 32.000 Euro in einen Investitionsbei
Eissporthalle, die außerordentliche Instandhaltung der Sportzone und der Parkanlagen, den Ankauf neuer Trinkwasserzähler und die außerordentliche Instandhaltung der Kanalisierung sowie den Ankauf von Fahrzeugen im Bereich Straßenwesen und in die Straßenbeschilderung. 10.000 Euro erhält auch die

In die Instandhaltung der deutschen Mittelschule fließen 45.000 Euro.
Thomas Sigmund, Kathrin Kral (Ersatz: Klemens Hitthaler, Dominik Kinzner)
Gemeindeleitstelle für Zivilschutz
Bürgermeister Peter Volgger, Peter Kahn, Kathrin Kral, Egon Bernabè, Francesco Lorenzi, Martin Fischer, Christian Seiwald, Emanuele Malfatti, Christian Geyr, Helmut Markio, Thomas Steiner (Ersatz: Vize-Bürgermeister Fabio Cola, Christoph Gschnitzer, Andreas Neumair, Ruggero Grassi, Paolo D’Angelo, Florian Siller, Maurizio Camillo, Nicolas Zanarotto, Stefano Fontana, Alberto Novelli)
für Anlagen und Maschinen im E-Werk wurden je 30.000 Euro vorgesehen. Der Investitionsbeitrag für die Bezirksgemeinschaft für die Errichtung einer Halle für Müllsammelfahrzeuge beläuft sich auf 29.280 Euro. Je 20.000 Euro wurden für die Heizung und die außerordentliche Instandhaltung des Balneums und des Wasserwerks bereitgestellt, je 15.000 Euro für den Ankauf von Hardware in den Gemeindeämtern, die außerordentliche Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude und des italienischen Schulzentrums, die Ausstattung der Kinderspielplätze, die Stadtbildpflege, den Ausbau von Müllsammelstellen und das ländliche Wegenetz. 16.000 Euro gehen an die Feuerwehr Sterzing für Investitionen. Je 10.000 Euro fließen in den Ankauf von Geräten und Hardware für die Stadtpolizei, die außerordentliche Instandhaltung des Kindergartens „Löwenegg“, des italienischen Kindergartens und der Grundschule „Dr. J. Rampold“, die
ner, Paul Eisendle und Evi Frick (SVP) sowie Jonas Gasser (STF) zur Kenntnis genommen. Im Zuge einer Haushaltsänderung wurden durch Umbuchungen zudem 12.000 Euro für den Ankauf von Hardware für die Gemeindeämter sowie 10.000 Euro für die außerordentliche Instandhaltung des Balneums (Wasseraufbereitung) freigemacht.
In Kürze
Der Gefahrenzonenplan im Bereich des Hotels „Zoll“ auf der Bauparzelle 22/1 der Katastralgemeinde Ried in der Brennerstraße wurde einstimmig abgeändert, ebenso in der Örtlichkeit Lurx, da die Gefahr nach der Errichtung einer Mauer von Rot auf Blau zurückgestuft worden war.
Ebenfalls einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, 34 m2 der Grundparzelle 137/1 der Katastralgemeinde Sterzing an Andreas Ralser zu verkaufen.
Aussetzung von Tieren
Tiere sind empfindungsfähige Wesen – also fähig, tiefere Empfindungen zu haben – und werden als solche im Art. 13 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union definiert. Darin heißt es: „Die Union und die Mitgliedstaaten tragen den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung.“ Sie sind also Lebewesen, die Gefühle wie Liebe, Besorgnis, Schmerz, Wut oder Langeweile empfinden können, die schützenswert sind und Recht auf Achtung haben. Dieses Recht auf Achtung wird in Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Rechte der Tiere vom Jahre 1978, verkündet in Paris am Sitz der UNESCO, anerkannt. Zu den Rechten der Tiere gehört auch das Recht, nicht ausgesetzt zu werden, da genannte Erklärung in Art. 3 klarstellt, dass kein Tier Grausamkeiten ausgesetzt werden darf; das Aussetzen von Tieren wird in Art. 6 der genannten Erklärung als „grausame und erniedrigende Handlung“ bezeichnet.
Eine Handlung wird somit als Aussetzung betrachtet, wenn dem Tier keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Aussetzen eines Tieres an einem Ort, der weit von der Wohnung, in der es gehalten wurde, entfernt liegt, hat den offensichtlichen Zweck, das Tier an der Rückkehr zu hindern; der Mensch ist sich folglich dessen bewusst, dass das Tier unfähig ist, sich selbst zu versorgen. Genau in dem Moment, in dem es ausgesetzt wurde, wird ihm das Recht auf Existenz verweigert. Das Gesetz Nr. 281/1991 hat sich mit der Notwendigkeit des Tierschutzes befasst und in Art. 1 vorgesehen, dass der Staat den Schutz von Haustieren fördert, Grausamkeiten gegen sie verurteilt und sie gegen Misshandlungen und ihr Aussetzen schützt. Auch wurde durch das Verfassungsgesetz Nr. 1/2022 in Art. 9 der Verfassung ein neuer Absatz eingefügt, der besagt: „Die Gesetzgebung des Staates regelt die Art und Weise des Tierschutzes.“ Ein wirksamer Schutz für Tiere findet sich nun in Art. 727 StGB mit dem Titel „Aussetzen von Tieren“ wieder. Darin wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von 1.000 bis 10.000 Euro jeder bestraft, der Haustiere aussetzt. Art. 2 des Gesetzes Nr. 177/2024 (Maßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit) hat am Art. 727 StGB noch folgende Absätze eingefügt: Wenn die im ersten Absatz genannte Handlung auf der Straße geschieht, wird die Strafe um ein Drittel erhöht. Wird genannte Straftat mit einem Fahrzeug begangen, so wird die zusätzliche Verwaltungsstrafe der Entziehung der Fahrerlaubnis für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr verhängt. Änderungen wurden auch an den Artikeln 589bis und 590-bis StGB vorgenommen. Art. 589-bis StGB über Tötungsdelikte im Straßenverkehr sieht nun folgendes vor: Wer schuldhaft den Tod eines Menschen unter Verletzung der Straßenverkehrsvorschriften herbeiführt, wird mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis zu sieben Jahren bestraft; die gleiche Strafe wird gegen denjenigen verhängt, der Haustiere auf der Straße zurücklässt, wenn das Zurücklassen zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge führt. Art. 590-bis StGB über schwere oder sehr schwere Körperverletzung im Straßenverkehr wurde wie folgt integriert: Wer unter Verletzung der Vorschriften über den Straßenverkehr einem anderen schuldhaft eine Körperverletzung zufügt, wird bei schwerer Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und bei besonders schwerer Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu drei Jahren bestraft. Die gleichen Strafen werden gegen denjenigen verhängt, der Haustiere auf der Straße zurücklässt, wenn das Zurücklassen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden führt. Diese Regelungen dienen einerseits dem Schutz der Tiere, sollen aber auch menschliche Grausamkeiten bestrafen. Die Aufnahme eines Tieres ist eine Entscheidung, die bewusst getroffen werden muss, denn ein Tier ist Teil der Familie, die es aufgenommen hat, auch wenn diese in den Urlaub fährt.

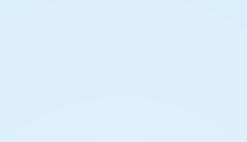
KOMMT BESTIMMT! Kaufen Sie SOFORT zu Sonderkonditionen!

Manuel D’Allura Rechtsanwalt – Kanzlei D’Allura & Gschnitzer

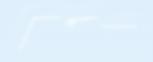

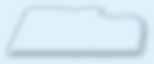



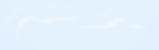

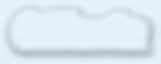
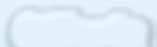


„Zukunft gestalten“
Auf der Gemeinderatssitzung im Juli präsentierte Bürgermeis ter Martin Alber sein program matisches Dokument für die Gemeinde Brenner für die Ver waltungsperiode 2025 – 2030. Es wurde zwar mehrheitlich ge nehmigt, stieß aber auch auf Kritik. Das Fehlen klarer Aussa gen und konkreter Maßnahmen bemängelte etwa die „Freie Lis te Gemeinde Brenner“.
„Wir wollen nicht nur verwalten, sondern gestalten“, betonte Bür germeister Martin Alber bei der Präsentation des programmati schen Dokuments. Die vergangenen Jahre seien von Projekten wie der neuen Kneippanlage, der ElKi-Initiative oder der Seniorenmensa geprägt gewesen, doch der Blick gehe klar nach vorne.

Die Gemeinde wolle sich den Herausforderungen des demografischen Wandels, des Arbeitskräftemangels und des Klimawandels offensiv stellen.
Ein zentrales Anliegen ist die Stärkung der Bürgerbeteiligung. Regelmäßige Sprechstunden,

Bürgerversammlungen und eine verstärkte Kommunikation über soziale Medien sollen den Dialog mit der Bevölkerung fördern. Auch das Ehrenamt wird besonders hervorgehoben: „Ohne die Vereine wäre unsere Gemeinde nicht denkbar – sie verdienen unsere volle Unterstützung“, so der Bürgermeister.
Die Realisierung der lang gefor-
Brigitta Schölzhorn ist Vize-Bürgermeisterin
Martin Alber, Bürgermeister der Gemeinde Brenner, hat Ende Juni seine Stellvertretung ernannt. Brigitta Schölzhorn wurde der Auftrag erteilt, den Bürgermeister bei Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung zu vertreten.
derten Umfahrung Gossensaß ist das zentrale Infrastrukturprojekt. Doch auch die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, die Umgestaltung des Widums in Pflersch sowie ein neues Konzept für das Dorfzentrum am Brenner stehen auf der Agenda. Im Bildungsbereich ist der Umbau der Turnhalle Gossensaß zur Mehrzweckhalle geplant – ein Impuls für das kulturelle Leben. Ein neuer Kleinkindbetreuungsplatz in Gossensaß, eine bessere Sommerbetreuung und mehr Spielplätze sind konkrete Maßnahmen zugunsten junger Familien. Auch für Senioren wird geplant: Betreutes Wohnen und neue Wohnangebote für Pflegepersonal sollen die Pflegeversorgung verbessern. Die Seniorenmensa wird als Treffpunkt beibehalten.
Die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein und der Erhalt der Nahversorgung in allen Orts-
teilen sind ebenso geplant wie ein Zusammenschluss der Skigebiete Ladurns und Roßkopf, der als mögliches Zugpferd für den Wintertourismus gehandelt wird. Auch das „Brenner Outlet“ soll weiter unterstützt werden, um Arbeitsplätze zu sichern und Einnahmen zu stärken.
Mit dem Beitritt zum Transitforum Austria/Tirol soll Nachhaltigkeit kein bloßes Lippenbekenntnis bleiben. Besonders das Pflerschtal soll unter strenger ökologischer Beobachtung weiterentwickelt werden. Maßnahmen zur Lärmschutzverbesserung, Luftqualität und Wasserwirtschaft sind ebenfalls vorgesehen.
Zentral ist die geplante Umfahrung von Gossensaß, die Lebensqualität im Hauptort soll dadurch wesentlich verbessert werden. Daneben plant die Gemeinde neue Rad- und Fußwege, die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Realisierung eines teilunterirdischen Parkhauses zur Entlastung des Ortskerns.
„Es fehlen klare Aussagen“ Das Programm wurde mehrheitlich angenommen, stieß aber auch auf Kritik. Während sich Sandra Pederzini (Fratelli d’Italia) der Stimme enthielt, stimmten die Gemeinderäte der „Freien Liste Gemeinde Brenner“ Armin Keim und Franz Kompatscher gegen das Dokument, David Röck enthielt sich nach ausgiebiger Diskussion und Kritik am Programm und nach dem Versprechen von Bürgermeister Alber, weitere Punkte in das Programm aufzunehmen (etwa die Aus-
Brenner
Brenner
Durch die geplante Umfahrung von Gossensaß soll die Lebensqualität im Hauptort Gossensaß wesentlich verbessert werden
arbeitung eines Klimaplans), der Stimme. Gemeinderat Keim kritisierte dem Erker gegenüber nicht nur die mangelnde Einbindung seiner Fraktion bei der Ausarbeitung, sondern auch inhaltliche Schwächen. „Obwohl der Bürgermeister angekündigt hatte, das Programm gemeinsam mit allen Fraktionen zu entwickeln, haben wir es erst auf eigene Anfrage kurz vor der Sitzung erhalten. Eine inhaltliche Mitgestaltung war faktisch nicht möglich“, so Keim.
Auch der Inhalt selbst sei aus Sicht der Freien Liste in vielen Teilen zu allgemein und wenig greifbar formuliert. „Es fehlen klare Aussagen und konkrete Maßnahmen“, so Keim. Als Beispiel nennt er den Bereich Mobilität, in dem im Programm zwar von Verkehrsberuhigung gesprochen wird, jedoch keine sofort umsetzbaren Schritte benannt werden. Die Freie Liste hatte hierzu konkrete Vorschläge gemacht, etwa eine Verkehrsberuhigung im Zentrum von Gossensaß, ein Verkehrskonzept für den Ortsteil Gänsbichl, das auch ohne den Abschluss des Gemeindeentwicklungsprogramms rasch realisiert werden könne, sowie den Bau eines Gehsteiges entlang der Pflerscher Straße vom Bräuhaus bis zur Kreuzung mit der Romstraße. Auch im Bereich Infrastruktur gebe es Nachholbedarf: Die Freie Liste hatte sich für eine umfassende Neugestaltung des Bahnhofsareals in Gossensaß eingesetzt (inklusive einer Neugestaltung des Busbahnhofs) sowie für die Aufwertung des Mobilitätszentrums und der Bahnhöfe
in Gossensaß und Brenner. Besonders am Brenner sei ein barrierefreier Zugang, etwa durch einen Aufzug, längst überfällig. Im Bildungsbereich fordert die Freie Liste eine konkrete Erweiterung der Schule in Gossensaß und die Einführung eines Mittagstisches für Schüler an Unterrichtstagen – zwei Maßnahmen, die Familien konkret entlasten würden. Auch die Idee, das Dorfzentrum in Gossensaß mit neuen Wohn- und Freizeitstrukturen aufzuwerten, bleibe im Programm zu vage formuliert.
Die Unterstützung für das Skigebiet Ladurns wird von der Freien Liste grundsätzlich mitgetragen, jedoch fordert sie mehr Transparenz bei den Förderungen und einen klaren Gegenwert für die Gemeinde. Denkbar wären etwa Vergünstigungen für Einheimische bei Einzelfahrten oder der Erwerb von Parkflächen durch die Gemeinde.
Im Bereich Nahversorgung fordert die Freie Liste über bloße Absichtserklärungen hinaus einen detaillierten Maßnahmenplan, wie die Grundversorgung in allen Fraktionen nachhaltig gesichert werden kann. Schließlich fehle dem Programm ein umfassender Klimaplan, der konkrete Strategien zur Energieeinsparung, CO₂-Reduktion und Förderung erneuerbarer Energien enthält. „Gerade in Zeiten der Klimakrise darf man sich nicht mit allgemeinen Formulierungen begnügen“, so die Räte der Freien Liste.
In Kürze
Die Verwendung des freien Teiles
des Verwaltungsüberschusses 2024 in Höhe von 924.000 Euro wurde einstimmig genehmigt. Damit wurden Gelder u. a. für die Sanierung des Kindergartens am Brenner (230.000 Euro), für Zuweisungen an das Bezirksseniorenwohnheim und die außerordentliche Instandhaltung von Straßen (je 80.000 Euro), die außerordentliche Instandhaltung von kulturellen Gebäuden (61.000 Euro), für die energetische Sanierung des Vereinshauses in Pflersch (60.000 Euro), für Zivilschutzmaßnahmen in Ladurns (50.000 Euro), die außerordentliche Instandhaltung von Schulen (45.000 Euro), die Errichtung von Grillstellen (32.000 Euro), für Sportplätze und die außerordentliche Instandhaltung von Vermögens- und Demanialgütern (je 25.000 Euro) sowie die außerordentliche Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und von Immobilien (je 20.000 Euro) vorgesehen. Diese Maßnahme wurde mit neun Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen von Franz Kompatscher, Armin Keim und David Röck (Freie Liste Gemeinde Brenner) sowie Sandra Pederzini (Fratelli d’Italia) genehmigt.
Bei einer weiteren Bilanzänderung wurden einstimmig u. a. 554.100 Euro für die Sanierung des Kindergartens am Brenner reserviert, 50.000 Euro für die außerordentliche Instandhaltung von Straßen und 30.000 Euro für technische Spesen (Wasserleitungen). Einstimmig gutgeheißen wurde auch die Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.
Kommissionen
Der Gemeindeleitstelle für den Zivilschutz gehören Bürgermeister Martin Alber, der amtsführende Polizeikommissar von Brenner, die amtsführenden Kommandanten der Carabinieristationen von Brenner und Gossensaß, die Feuerwehrkommandanten Markus Mayr (Gossensaß) und Marco Schölzhorn (Pflersch), Thomas Windisch als Vertreter der Forstbehörde, der Vorsitzende der La winenschutzkommission und Tobias Zössmayr als Vertreter des Weißen Kreuzes an. Der Lawinenschutzkommission gehören Hubert Eisendle, Thomas Windisch, Reinhard Holzer, Peter Thaler, August Seidner, Markus Pittracher und Stefano Bertoldi an. In die Gemeindewahlkommission wurden Sandra Pederzini, Tommaso Feminella und Stefanie Heidegger (Ersatz: Verena Marcassoli, Edeltraud Zössmayr, Benjamin Plattner) entsandt. Bürgermeister Martin Alber (Ersatz: Peter Mair) vertritt die Gemeinde im Konsortium der Gemeinden für das Wassereinzugsgebiet der Etsch Im Verwaltungsrat der Fernheizwerk Gossensaß Gen.m.b.H. wird die Gemeinde durch Armin Keim vertreten.
März 2025, mit dem ein Teil des Grundparzelle 1184/5 der Katastralgemeinde Pflersch entdamanialisiert wurde, um den Wiederaufbau der „Fluener Brücke“ zu ermöglichen. Da der Teilungsplan annulliert worden war, war eine erneute Beschlussfassung notwendig geworden. Damit kann die Autonome Provinz Bozen eine Fläche von 33 m2 im Enteignungswege erwerben. bar
Ratschings
Weichen für die Zukunft gestellt
Die Gemeinderäte von Ratschings haben auf der jüngsten Sitzung Mitte Juli das programmatische Dokument von Bürgermeister Sebastian Helfer für die Verwaltungsperiode 2025 –2030 genehmigt, das die Leitlinien für die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden fünf Jahren festlegt. Aufbauend auf das Gemeindeentwicklungskonzept, zielt das Programm darauf ab, den attraktiven Lebensraum zu erhalten und die Lebenschancen für die Bürger zu sichern, zu fördern und auszubauen, auch im Sinne des Klimaplans. Das Programm setzt dabei auf Gemeinschaftssinn, Ehrenamt, Effizienz und die Entscheidungsfähigkeit der Verwaltung.
Ein zentrales Anliegen in der kommenden Verwaltungsperiode ist die Förderung und Entlastung von Familien. Die Gemeindeverwaltung strebt an, Tarife und Gebühren nicht über die gesetzlichen Vorgaben und die Inflation hinaus zu erhöhen. Entlastungen sollen auch durch Einsparungen im Ausgabenbereich erzielt werden, etwa bei der Müll-, Trinkwasser- und Abwassergebühr sowie bei der Gemeindeimmobiliensteuer und Abgaben bei Bautätigkeiten. Die Kindergartengebühren sollen weiterhin zu den günstigsten im Land gehören, wobei das zweite Kind einer Familie im Kindergarten befreit bleiben soll. Auch der Kindergartentransport soll zu günstigen Tarifen ermöglicht werden. Für Familien und Bauinteressierte werden Rahmenbedingungen für leistbares und gemeinnütziges Wohnen geschaffen.
Zur besseren Vereinbarkeit von

Familie und Beruf wurde die Kita in Stange auf 30 Plätze erweitert. Das Betreuungsangebot soll bei Bedarf weiter ausgebaut werden, bewährte Projekte wie der Sommerkindergarten werden gefördert. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Sicherheit auf Schulwegen.
„Die Jugend ist die Kraft und die Zukunft der Gemeinde“, so Bürgermeister Helfer. „Ihre Mitwirkung an der Gestaltung der Gemeinde soll gefördert werden, unterstützt durch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in Vereinen.“ Junge Menschen sollen an Problembereiche herangeführt werden und eigene Lösungsvorschläge einbringen können. Geplant sind der Aufbau von Jugendtreffpunkten, die Organisation von Events und die Reaktivierung des Nachtbusdienstes. Für die Senioren, die den Grundstein für den heutigen Wohlstand gelegt haben, wird ebenfalls ge-
sorgt. Das Bezirksaltenheim wurde kürzlich eröffnet. Bei Bedarf sollen weitere Altenwohnungen in den Fraktionen gebaut werden, logistisch günstig gelegen in der Nähe vorhandener Strukturen. Alleinstehende Senioren mit Mindestpensionen sollen bei Gebühren entlastet werden. In der Wirtschaft liegt der Fokus weiterhin auf der Landwirtschaft, die in einer Tourismusgemeinde wie Ratschings ein Kernpunkt der Entscheidungen bleibt. Die Gemeinde wird die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft verbessern, u. a. bei Zufahrtswegen, Trinkwasser-, Stromund Abwasserversorgung sowie Breitbandanschlüssen. Handwerk und Handel haben einen hohen Stellenwert. Es sollen Mischzonen für einheimische Handwerker und Handelstreibende ausgewiesen werden, um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Die Nahver-
sorgung in allen Fraktionen soll durch geeignete Maßnahmen in Absprache mit den Wirtschaftstreibenden sichergestellt werden.
Der Tourismus wird weiterhin gefördert und entwickelt, jedoch ortsverträglich und unter Berücksichtigung des sozialen Gefüges der Bevölkerung. Auch Urlaub auf dem Bauernhof wird unterstützt.
Ein wichtiger Baustein ist die Energieversorgung. Die Sicherheit der Stromversorgung hat Priorität, Freileitungen sollen unterirdisch verlegt werden. Ein Programm zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden ist in Ausarbeitung. Zudem soll der Handyempfang in „schwarzen Zonen“ verbessert werden.
Die zahlreichen Vereine und ehrenamtlich engagierten Bürger sind das Fundament der Dorfgemeinschaften. Ihre Arbeit wird
Die Kita in Stange wurde auf 30 Plätze erweitert.
gewürdigt und durch die Bereitstellung, Erhaltung und Errichtung notwendiger Strukturen sowie durch die Förderung ihrer Tätigkeit unterstützt.
„Mit diesem umfassenden Programm blickt die Gemeinde Ratschings optimistisch auf die kommenden fünf Jahre, um die Lebensqualität der Bürger weiter zu verbessern und die Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten“, so Bürgermeister Sebastian Helfer.
Kritik der Opposition
Kritik kam erwartungsgemäß aus den Reihen der Opposition. Klaus Keim von der Süd-Tiroler Freiheit bezeichnete etwa die formulierten Ziele des Bürgermeisters – die „Sicherstellung, die Förderung und den Ausbau der Lebenschancen für die Bürger“, als „sehr, sehr große Worte“ und bezweifelte, ob eine Gemeindepolitik diese in diesem Ausmaß überhaupt beeinflussen kann. „Mit dem vorliegenden Dokument ziemlich sicher nicht, das dürfte wohl klar sein“, so Keim. Er bemängelte zudem, dass im programmatischen Dokument auffallend oft das Wort „weiterhin“ verwendet würde, was auf einen Mangel an innovativen Ideen hindeute und eher einer Selbstlobeshymne für die Arbeit der letzten Jahre gleiche. Konkrete und innovative Maßnahmen fehlten demnach sowohl im Bereich der Jugendförderung, wo nur allgemeingültige Aussagen getroffen würden, als auch bei der Seniorenarbeit, die über die Schaffung von Altersheimplätzen hinausgehen müsse. Beim Thema Wohnen würden insbesondere die Wohnbaureform und das gemeinnützige Wohnen nur am Rande erwähnt, die konkrete Umsetzung hingegen fehle im Programm. Zusammenfassend stellte Klaus Keim fest, dass das Dokument „viel Allgemeingültiges, aber wenig Konkretes und Innovatives“ enthalte.
Nach der Diskussion wurde das programmatische Dokument mehrheitlich genehmigt. Klaus Keim von der Süd-Tiroler Freiheit enthielt sich der Stimme.
Strategiedokument genehmigt
Einstimmig genehmigt wurde der Entwurf des einheitlichen Strategiedokuments für die Jahre 2026 – 2028. Einstimmig genehmigt wurde auch die Verordnung über die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene.
In Kürze
Der Gemeindewahlkommission gehören Albin Volgger, Andreas Rainer und Klaus Keim an. In der Gemeindekommission für die Aufstellung der Verzeichnisse der Laienrichter sitzen Bürgermeister Sebastian Helfer, Andrea Hellweger und Thomas Schwazer. Als Gemeindevertreter im Konsortium der Gemeinde der Provinz Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch wurde Bürgermeister Sebastian Helfer (Ersatz: Vize-Bürgermeister Thomas Strickner) namhaft gemacht. Im Jugenddienst Wipptal wird die Gemeinde von Thomas Strickner (Erwachsenenvertreter) und Jonas Sparber (Jugendvertreter) vertreten. Zu Gemeindevertretern in den Bildungsausschüssen wurden Albin Volgger (Ridnaun), Christoph Siller (Mareit/Außerratschings) und Jonas Sparber (Jaufental/Gasteig) bestimmt. Paul Gschnitzer (Mareit), Matthias Braunhofer (Ridnaun), Norbert Haller (Telfes) und Sonja Ainhauser (Stange) vertreten die Gemeinde im Beirat der örtlichen Landeskindergärten. Der Kommission für die Unbewohnbarkeitserklärung gehören Alessandro Mascarello und Christian Hafner (Ersatz: Romina Valt, Karl Benedikter) an. In der Gemeindekommission für Raum und Landschaft sitzen Bürgermeister Sebastian Helfer, Barbara Psenner, Johann Wild, Miriam Rieder, Johannes Kofler, Johannes Niederstätter und Marianna Erlacher (Ersatz: Thomas Strickner, Ursula Unterpertinger, Hermes Vigna, Sigrid Mairhofer, Manuel Pastore, Hannes Ladstätter, Ursula Sulzenbacher).
bar
Geplante Investitionen 2025 – 2030
Für die einzelnen Fraktionen sind umfassende Investitionen geplant:
• Mareit: Erneuerung Hofmannsteg, Austausch Heizungsanlagen öffentlicher Gebäude, Neubau ehemalige FF-Halle, Ankauf Grundstück für Kindergarten, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.
• Ridnaun: Neubau Sporthütte am Fußballplatz, Adaptierungsarbeiten Biathlonstadion, Friedhofsplatz, Lösung Recyclinghof-Problematik, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen, Übernahme „Erzweg“.
• Gasteig: Erweiterung Vereinshaus und FF-Halle, Neubau Gemeindebauhof, Vereinshausparkplatz, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.
• Außerratschings: Gestaltung Gemeindeplatz/Dorfplatz, Außengestaltung Sportzone, Kreisverkehr, Sanierung Kunstrasenplatz, Infrastrukturverbesserungen, Umsetzung Wohnbaureformgesetz.
• Jaufental: Friedhofserweiterung, energetische Sanierung Schule und Vereinshaus, Fertigstellung Naturrodelbahn, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.
• Telfes: Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen, weitere Hausanschlüsse an die Hauptkanalisierung.
• Innerratschings: Bau Brücke FF-Halle, energetische Sanierung Schule und Vereinshaus, Verbesserung Recyclinghof, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Verbesserung der Infrastrukturen und des Zufahrtswegs „Binter-Mucher“.
In allen Fraktionen sind zudem Maßnahmen im Sinne des Gefahrenzonenplanes sowie Katastereintragungen von Zufahrtswegen vorgesehen.
Franzensfeste
BBT bleibt große Herausforderung
Anfang Juli hat der Gemeinderat Franzensfeste das programmatische Dokument 2025 –2030 einstimmig gutgeheißen. „Wir müssen den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen, damit unsere Gemeinde lebensfähig bleibt“, so Bürgermeister Thomas Klapfer.
Die finanzielle Situation der Gemeinde Franzensfeste hat sich laut Bürgermeister Klapfer in den vergangenen Jahren gebessert –dank der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Vahrn und Natz-Schabs im Bereich Verwaltung, der gestiegenen Zahl der Einwohner (über 1.000) und der getätigten Investitionen, die dazu beitragen, Ausgaben zu reduzieren oder Einnahmen zu generieren. Steuern und Gebühren sollen nach Möglichkeit auch in Zukunft nicht we -
Trotz des Baues der Riggertalschleife soll der Bahnhof Franzensfeste ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Nah- und Fernverkehr bleiben.

sentlich erhöht werden. Der Bau des Brennerbasistunnels, der 2032 und damit mehrere Jahre später als ursprünglich vorge-
4,17 Millionen Euro für
Investitionen
sehen fertiggestellt wird, bleibt für die Gemeinde eine große Herausforderung. Um Belastungen wie Lärm und Staubentwicklung
Der Gemeinderat hat Einnahmen aus dem Haushaltsüberschuss 2024 (Beiträge Wiederaufbaufonds, Land, Wassereinzugsgebiet WEG) zweckgebunden: Die größten Posten entfallen auf die energetische Sanierung des Rathauses (1,54 Millionen Euro), die Errichtung des Schutzwalles „Thaler Stadel-Erler“ (1,46 Millionen Euro), den Bau des Hauses der Begegnung (411.000 Euro), die Projektierung für die Gestaltung des Eisackufers in Mittewald (152.962 Euro) sowie eine Studie zur Erweiterung des Fernheizwerkes (114.925 Euro). Weitere Investitionen: Asphaltierungsarbeiten, Beschilderungen (80.000 Euro), außerordentliche Arbeiten an Schulen und Kindergärten (78.100 Euro), digitale Dienste (rund 60.000 Euro), die Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes (58.000 Euro), Trinkwasserleitungen in Grasstein (38.610 Euro), die Instandhaltung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen (24.000 Euro), einen Gehweg am Eisackufer (24.300 Euro), Defibrillatoren (20.000 Euro), Maschinen und Geräte im Bauhof (18.000 Euro), Beiträge für Pfarrei Mittewald (18.000 Euro), Sportgeräte fürs Mehrzweckhaus (11.000 Euro), Projekte „Schutzwald und Kastanienhain“ (10.900 Euro), Beiträge für Feuerwehren, öffentliche Beleuchtung, Einrichtung im Jugendraum (jeweils 10.000 Euro), Klimaplan (9.600 Euro), Studie für Abfallbewirtschaftung (4.880 Euro), Einzäunung Calcetto-Platz (3.600 Euro), ANA-Sitz (2.500 Euro), Bergrettung (2.500 Euro), Heizregler im Mehrzweckhaus (2.300 Euro), Glasfaser-POP Rathaus (1.400 Euro). Weitere 869.000 Euro aus dem frei verfügbaren Haushaltsüberschuss 2024 werden in den Austausch der Böden in Grundschulen und Kindergärten, Enteignungen, die Erneuerung Trinkwasserleitung „Flagger“, die Neugestaltung des Freiheitsplatzes in Mittewald und den Neubau der Brücke in Mittewald investiert. Die Projekte sind derzeit in Planung.
durch den Bau der Zulaufstrecke, des Nordportals, des Bahnhofs und der Tunnelausstattung einzudämmen, möchte die Gemeinde mit Beobachtungsstelle, BBT-Gesellschaft und Baufirmen eng zusammenarbeiten und den Baustellenverkehr kritisch im Auge behalten. Auf dem ehemaligen Baustellengelände zwischen Oberau und Mittewald möchte sie die Wiederherstellung des Fußballplatzes und eine Naherholungszone schaffen. Zunächst muss abgeklärt werden, ob der Verlauf der Staatsstraße beibehalten werden darf; es besteht nämlich die Auflage, sie nach Fertigstellung wieder an den ursprünglichen Standort zurückzubauen. Da sich die neue Straßenführung gut bewährt hat, möchten sie Gemeinde, Land Südtirol, BBT-Gesellschaft und Autobahngesellschaft beibehalten. Das Einverständnis des Verkehrsministeriums steht noch aus. Trotz der Belastungen
durch den Tunnelbau gelte es, den BBT nach Fertigstellung als Chance zu nutzen, so Klapfer, zumal sich die Gemeinde dann auf einer der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen befindet. „Franzensfeste muss wieder zu einem der wichtigsten Bahnhöfe in Südtirol werden und als Dreh- und Angelpunkt für den Nah- und vor allem Fernverkehr dienen. Dafür setzen wir uns ein.“
Vom Bahnhof Franzensfeste aus soll auch eine Seilbahn ins Skigebiet Jochtal führen. Franzensfeste wäre der einzige Bahnhof zwischen Verona und München an der Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einem solchen Angebot. „Für unsere Gemeinde würde das einen großen wirtschaftlichen Aufschwung bedeuten“, so Bürgermeister Klapfer. Noch ist die „Kaiserbahn“ eine Vision, da es schwierig ist, eine Finanzierung aufzutreiben und bis heute weder Fachleute und noch Politiker verbindlich sagen können, wie der Bahnhof genutzt wird und ob und wie viele BBT-Züge in Franzensfeste halten werden. Trotzdem will die Gemeinde diese Chance im Auge behalten.
Kritisch sieht die Gemeinde nach wie vor die sich im Bau befindliche Riggertalschleife, die direkte Verbindung zwischen dem Pustertal und der Brennerbahn, wodurch Fahrgäste in Brixen
PERSONALIEN
und nicht mehr in Franzensfeste umsteigen. „Der Bau beeinträchtigt die internationale Anbindung an die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke und hat negative Folgen für das Wipptal sowie das Eisack- und Pustertal“, so Klapfer.
Eine große Chance für die Gemeinde sei die Festung Franzensfeste, das zehnte Landesmuseum, das – wie der Landeshauptmann sagt – das „Trauttmansdorff des Ostens unseres Landes“ werden soll. Das Ziel, Franzensfeste durch die Festung wirtschaftlich zu stärken, verfolgt die Gemeinde weiter, etwa durch eine attraktive Fußverbindung zwischen Römerweg und Festung. Zwei Baulose sind fertiggestellt, für das dritte wird noch die nötige Finanzierung gesucht.
Um den Bedürfnissen von älteren Mitbürgern, Jugend und Familien gerecht zu werden, versucht die Gemeinde durch gezielte Maßnahmen die Lebensbedingungen zu verbessern. Auch öffentliche Dienste (Postamt, Schulen, Kindergärten, ärztliche Betreuung im Ort, Verwaltungsautonomie, Verkehrsverbindungen …) sowie private Dienste (Lebensmittelgeschäfte, Metzgerei, Bäckerei, Friseur …) werden versucht aufrecht zu erhalten.
Den neuen Seniorenbeirat bilden Vize-Bürgermeister Richard Amort (Vorsitzender), Gemeinderätin Giovanna Summerer, Cristina De Lorenzo Gardinal, Rosa Murari und Sandro Bellorio. Thomas Kerschbaumer vertritt die Gemeinde im Beirat des deutschsprachigen Kindergartens von Mittewald. Bürgermeister Thomas Klapfer (Ersatzvertreter: Thomas Kerschbaumer) vertritt die Gemeinde in der Vollversammlung des Konsortiums der Gemeinden der Provinz Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch.
Das Programm
Bis 2030 sollen folgende Vorhaben in Angriff genommen werden:
Öffentliche Arbeiten: Fertigstellung Haus der Begegnung, 3. Baulos des Verbindungsweges Dorf-Festung, Gestaltung einer Naherholungszone an der ehemaligen Baustelle Eisackquerung, Erweiterung bzw. Neubau der Feuerwehrhalle Mittewald, Sanierung des Widums in Mittewald, Neubau der Brücke in Mittewald. Leader-Projekte: Neugestaltung des Dorfplatzes und des Freiheitsplatzes in Mittewald, Neugestaltung des Marconi-Platzes und des Rathausplatzes in Franzensfeste.
Umwelt: Ausbau des Fernwärmenetzes, Verschönerung der Dörfer, energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, Überwachung der BBT-Baustellen und Zulaufstrecke, zeitgemäße Müllsammlung, modernes Trink- und Abwassermanagement.
Urbanistik: Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogrammes, Implementierung des Gesetzes Raum und Landschaft, Abgrenzung der Ortskerne.
Wohnbau: Unterstützung verschiedener Initiativen zur Schaffung von neuem Wohnraum.
Wirtschaft: Förderung der Ansiedelung von Betrieben, Erhalt bestehender Dienstleistungen, Prüfung alternativer Energiequellen.
Sport und Freizeit: Wiedererrichtung des Fußballplatzes, Verbesserung der Sport- und Freizeitanlagen, Pflege und Instandhaltung der Rad- und Spazierwege und Erholungszonen.
Zivilschutz: Förderung der Feuerwehren, Umsetzung notwendiger Maßnahmen für die Absicherung der roten Zonen laut Gefahrenzonenplan.
Verkehr und Mobilität: Mitsprache bei zukünftiger Entwicklung des Bahnhofs Franzensfeste, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der bestehenden Verkehrsverbindungen.
Familie, Jugend, Schule und Kultur: Erhalt von Schulen und Kindergärten, Mensa und Nachmittagsbetreuung, Entwicklung der Festung, Instandhaltung Römerweg, Denkmäler und Schau-E-Werk.
Gesundheit, Soziales und Senioren: Erhalt der Dienste im Sozialbereich, Errichtung eines pharmazeutischen Dienstes.
Landwirtschaft: Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Gemeindepartnerschaft und Europa-Angelegenheiten: Initiativen im Rahmen der Gemeindepartnerschaft, Europapreise.
Vereine: Unterstützung der Vereine, Förderung des Ehrenamtes.
Verschiedenes: Förderung des friedlichen Zusammenlebens aller Volksgruppen, Öffentlichkeitsarbeit.
„Wir wollen sichtbar sein“
Die Menschen werden immer älter. Entsprechend groß ist die Herausforderung, diesem demografischen Wandel und den damit einhergehenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Gerade deshalb seien Organisationen wie der Seniorengemeinderat Sterzing von großer Bedeutung, sagt Präsidentin Ruth Achammer.
Sterzing hat seit 2014 einen Seniorengemeinderat – neben Bruneck als zweite Gemeinde in Südtirol. Dieser ist „die offizielle Stimme“ der Sterzinger Senioren. Deshalb sucht er den direkten Kontakt zu den Senioren und überlegt sich, wie er sie auf verschiedenste Wege ins gesellschaftliche Leben einbinden und vertreten kann. Der Seniorengemeinderat macht die Gemeindeverwaltung auch regelmäßig auf Probleme im Gemeindegebiet aufmerksam und unterbreitet konkrete Vorschläge, um Dienstleistungen für Senioren zu verbessern.
„Wir haben schon vieles ange-
NEUWAHLEN

Der scheidende Seniorengemeinderat, bestehend aus Präsidentin Ruth Achammer Jäger, Stellvertreter Rosario Coppola (nicht im Bild) sowie den Räten Loredana Gazzini Marazzo, Franca Kaswalder Wwe. Schiavo, Helmut Erspamer, Ulrich Gruber, Elisabeth Larcher, Renate Staudacher, Helga Pedri Überegger, Maria Antonietta Todeschini Armanini sowie Gemeinderat Ciro Coppola und Stadträtin Christine Eisendle Recla bei einem Treffen mit Bürgermeister Peter Volgger
regt“, sagt Ruth Achammer, die dem Gremium seit 2014 als Präsidentin vorsteht: Spazierwege in der Talsohle, ein Zebrastreifen nach Maibad, Fitnessgeräte in der Sportzone, Gratisschwimmen im Balneum sowie Gratis-Bergund Talfahrt auf den Roßkopf für Senioren ab 80 Jahren, Parkbän-
Der Seniorenausschuss sucht Interessierte, die sich bereit erklären, im Seniorengemeinderat mitzuarbeiten. Nähere Infos bei Präsidentin Ruth Achammer (Tel. 380 5197021) und bei Karin Recla in der Gemeinde Sterzing (Tel. 0472 723700). Kandidieren darf jeder Wipptaler ab 60 Jahren, wählen darf jeder ab 65 Jahren, der in die Wählerlisten der Gemeinde Sterzing eingetragen ist. Sobald die Kandidatenlisten erstellt sind, wird die Gemeinde allen Wahlberechtigten einen Brief mit Informationen über die zur Wahl stehenden Kandidaten und den Ablauf der Wahl zusenden. Dieser Brief gilt als Stimmzettel, der ausgefüllt in die entsprechenden Urnen geworfen werden kann. Der neue Seniorengemeinderat bleibt fünf Jahre lang im Amt.
ke für Senioren, neue CitybusHaltestellen, eine Seniorenmensa an jedem Freitag, ein Filmclub für Senioren und Interessierte an jedem ersten Freitag im Monat von Oktober bis Mai um 16.00 Uhr, einen Kaffeetreff ab 60+ am ersten Mittwoch im Monat im Saal der Stadtbibliothek, wo in geselliger Runde Themen und Anliegen besprochen werden, eine neue Buslinie Sterzing über den Jaufen bis St. Leonhard in Passeier (6x täglich) vom 15. Juni bis zum 12. Oktober, gemeinsam mit der Gemeinde die Organisation der runden und halbrunden Geburtstagsfeiern ab 70 Jahren.
In den vergangenen Jahren fanden in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen Turn- und Tanzkurse, Yoga, Theateraufführungen des Seniorentheaters „Überholspur“ von Senioren für Senioren, Vorträge etwa über die Patientenverfügung und vieles mehr statt. Stolz
sei sie auf diese gemeinsam erreichten Erfolge, so Achammer. Die Wunschliste wäre noch viel länger, angefangen beim barrierefreien Bahnhof Wiesen-Pfitsch mit Aufzug und erhöhten Bahnsteigen, eine fixe Haltestelle für Interreg- und internationale Züge am Bahnhof, mehr CitybusHaltestellen, die Abstimmung des Fahrplanes, ein öffentlich zugänglicher Enzenberg-Garten, günstige Seilbahntickets für Senioren ab 65, überdachte Radständer u. a. in der Stadt und vor dem Schwimmbad, eine bessere Beleuchtung und eine Informationstafel über laufende Veranstaltungen vor dem Stadttheater. „Einige dieser Vorschläge kommen nicht nur Senioren zugute, sondern der gesamten Bevölkerung. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Anliegen noch mehr Gehör finden,
denn eine altersfreundliche Gesellschaft ist eine lebenswerte Gesellschaft für alle“, so Achammer.
„Der Seniorengemeinderat ist sehr wichtig für die Gemeinde Sterzing“, betont Bürgermeister Peter Volgger auf Nachfrage des Erker. Die Gemeinde, vertreten durch die beauftragten Gemeindereferenten, seien bei jeder Sitzung dabei, hören die Anliegen der Senioren an und versuchen sie zu verwirklichen. „Wir haben schon einiges erreicht“, so Volgger. Dass es hin und wieder Dinge gebe, die nicht so schnell umsetzbar seien, liege nicht immer an der Gemeinde, sondern auch an der Landesregierung. Beispiel: Fahrpläne oder Fahrrouten von Bussen, deren Änderung nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung liegt.
Der Start sei schwierig gewesen und es habe viel Kraft und Ausdauer gebraucht, so die Seniorenreferentin Christine Eisendle Recla. „Da uns die Anliegen der Senioren aber sehr wichtig sind, sind wir am Ball geblieben. Wir haben immer an uns geglaubt und deshalb auch vieles geschafft.“ Durch das Gremium hätten die Se
nioren heute mehr Sichtbarkeit als früher. „Die Senioren von heute sind diejenigen, die unser Land mit wenig Geld wiederaufgebaut haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sollten wertschätzen, was sie geleistet haben.“
Die laufende Amtsperiode des Seniorengemeinderates neigt sich dem Ende zu. Bis Jahresende – innerhalb sechs Monaten nach Ernennung des Stadtrates – muss ein neuer gewählt werden. Der scheidende Ausschuss hofft, dass sich für die nächste Amtsperiode viele Kandidaten zur Verfügung stellen. Bereits heute sind 22 Prozent und damit ein Fünftel der Bevölkerung der Gemeinde Sterzing älter als 65 Jahre. Wie die Lebenserwartung wird auch dieser Prozentsatz Jahr für Jahr weiter steigen. „Unsere Erfahrungen und Bedürfnisse dürfen kein Randthema sein“, sagt Präsidentin Achammer. „Die Senioren haben ein Leben lang für die Gemeinschaft gewirkt. Sie wollen auch im Alter nicht aus der Mitte der Gesellschaft verschwinden. Ganz im Gegenteil. Wir müssen noch sichtbarer werden.“
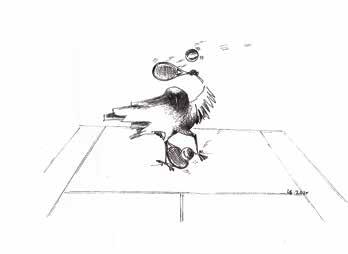
UNTERWEGS MIT WIPPOLINO
Zum Obernberger See

Gemütlich paddeln das Eichhörnchen Wippolino und seine Rabenfreundin Rita auf einem Baumstamm über das türkisblaue Wasser des Obernberger Sees. Dieser zauberhafte Bergsee in Tirol ist ein ideales Ziel für einen Familienausflug in die Natur.
Hinter der Brennergrenze bei Gries am Brenner führt eine Straße ins Obernbergertal. Am Talende befindet sich ein ge bührenpflichtiger Parkplatz, von dem aus die Wanderung startet.
Zunächst geht es auf einem breiten Wirtschaftsweg bis zu einer kleinen Brücke.
Dahinter besteht die Wahl zwi schen zwei Routen:
• dem Wies der über sonnige Almen führt,
• oder dem F mütlich ansteigend direkt zum See v
Oben angekommen eröffnet sich der Blick auf den zauber haften Obernberger See, der je nach Lich smaragdgrün schimmert. Ein einfacher Rundweg führt um
den See und eignet sich gut für Familien mit Kindern. Etwas versteckt entdeckt man entlang des Weges das malerische Seekirchlein „Maria am See“.
Das ehemalige Gasthaus am See ist nicht mehr bewirtschaftet. Daher empfiehlt es sich,

„Es ist der einzige Weg, den wir zurzeit gehen können“

Die Seelsorgeeinheit Wipptal steht vor grundlegenden Veränderungen. Ab dem 1. September gibt es nur noch einen Pfarrer, der die 16 Pfarreien gesetzlich vertritt. Was bedeutet dieser Schritt für die Pfarreien, Mitarbeiter und Gläubigen zwischen Brenner und Mauls? Nachgefragt bei Generalvikar Eugen Runggaldier.
Erker: Herr Generalvikar, im Wipptal gibt es seit 15 Jahren eine Seelsorgeeinheit. Hat sich dieses Modell bewährt?
Eugen Runggaldier: Die Seelsorgeeinheiten sind aus einer Not heraus entstanden. Der Priestermangel hat uns dazu gezwungen, sie einzuführen. Ursprünglich wollten wir in der Diözese 70 Einheiten aus jeweils drei bis vier Pfarreien bilden. Die ersten entstanden 2008, das Wipptal folgte 2010. Während des Entwick-
lungsprozesses, den Dekan Josef Knapp und Berater begleiteten, schlugen die Menschen in den Pfarreien selbst vor, alle 16 Pfarreien einzubinden und damit die größte Seelsorgeeinheit der Diözese zu bilden – ein weitsichtiger Schritt, denn inzwischen bilden wir überall größere Einheiten. Große Seelsorgeeinheiten sind also ein Modell für die Zukunft.
Die Zusammenlegung benachbarter Pfarreien zu Seelsorgeeinheiten hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass ein Pfarrer weniger präsent ist, da er für mehrere Pfarreien zuständig ist. Früher hatte jedes Dorf seinen eigenen Pfarrer, jeder kannte ihn. Heute kommt der Pfarrer nur noch zu Messen oder Sitzungen und hat deshalb nicht mehr einen so engen Kontakt zu den Gläubigen vor Ort. Der Vorteil ist, dass sie das Kirchturmdenken aufbricht und den Austausch
und die Zusammenarbeit unter den Pfarreien fördert. Ich würde sagen, dass sich das Modell der Seelsorgeeinheiten generell bewährt hat.
Der Priestermangel setzt der Kirche und auch den Gläubigen stark zu.
Fakt ist, dass zurzeit keine Südtiroler das Priesterseminar besuchen. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren auch kein Südtiroler zum Priester geweiht wird. Jährlich versterben rund 20 Priester. Um Personallücken zu füllen, arbeiten die meisten Priester über das Rentenalter hinaus weiter, solange es ihre Gesundheit erlaubt. Natürlich sind wir für jede Hilfe dankbar. Wir sind uns aber auch bewusst: Fallen sie als Unterstützung weg, wird sich dies massiv auf die Seelsorge auswirken.
Warum wird nun ausgerechnet im Wipptal ein neues Versuchsmodell getestet?
In den kommenden fünf bis sieben Jahren wird es wahrscheinlich in jeder Seelsorgeeinheit nur noch einen Pfarrer geben. Diese Tendenz zeichnet sich schon seit längerem ab. Manchmal entwickeln sich Dinge aber noch schneller als erwartet. Über die Personalangelegenheiten berät eine zehnköpfige Kommission. Sie besteht aus Priestern, die von den Priestern gewählt werden und somit ihr Vertrauen hat, dem Seelsorgeamtsleiter und mir. Die Kommission hat die Aufgabe, den Bischof in Personalentscheidungen zu beraten. Bereits vor Beginn eines jeden Jahres verschaffe ich mir einen Überblick, wo neue Pfarrer benötigt werden und wer sein Amt abgeben möchte. Auf der ersten Sitzung des Jahres 2025 stand das Wipptal noch nicht auf der Tagesordnung, da keine Änderung geplant war. Dekan Christoph Schweigl, selbst Mitglied
der Personalkommission, bat dann aber den Bischof, die Pfarrei Stilfes abzugeben. Die Kommission und dann der Bischof haben entschieden, den Antrag anzunehmen. Wir versuchten eine Lösung zu finden, überlegten lange, fanden aber keine. So trat ein, was sich schon seit längerem in unserer Diözese abzeichnet: Stilfes war kurz davor, die erste Pfarrei ohne Pfarrer zu werden. Niemand trägt Schuld an dieser Situation, es mangelt schlicht an Priestern für so viele Pfarreien. Es folgten viele Sitzungen, um zu klären, was dies nun bedeutet. Rechtlich gesehen könnten der Bischof oder der Generalvikar die Pfarrei vertreten, ohne vor Ort sein zu müssen. Für die Verwaltung muss ein Pfarrverwalter ernannt werden. Pastoral gesehen gibt es keinen anderen Weg, als dass die Pfarreien enger zusammenrücken und die vorhandenen Ressourcen miteinander teilen. Alles komplizierte Notlösungen. Im Weiterdenken kam deshalb die Idee, einen Pfarrer für die gesamte Seelsorgeeinheit einzustellen, da sich eine Seelsorgeeinheit ohnehin Pfarrdienste teilen muss.
Warum müssen für diese Neuerung Priester das Wipptal verlassen, warum wurden neue hergeholt? Wir haben nichts überstürzt, ganz im Gegenteil. Wir haben mit allen Beteiligten vorab gesprochen und ihnen einen Monat Bedenkzeit gegeben. Hätte jemand nein gesagt, hätten wir eine andere Lösung gesucht. Es war ein Prozess. In der Kommission war man der Meinung, dass sich jemand von außen mit dem neuen Modell leichter tut als diejenigen, die das bisherige System gewohnt sind. In der entscheidenden Sitzung, welcher der Dekan aus persönlichen Gründen fernblieb, haben wir schließlich beschlossen, das Modell umzusetzen, und Dekan Schweigl zu fragen, ob er die Leitung der 16 Pfarreien übernehmen wolle. Dies vor allem deswegen, weil wir mitbekommen haben, dass er ungern geht und im Wipptal bleiben möchte. Nachdem der bisherige Dekan mitgeteilt hat, dass er sich für einen Wechsel entschieden hat, und der neue Dekan sich bereit erklärt hat, ins Wipptal zu wechseln, war klar, dass das neue Modell zur Anwendung kommt und der neue Dekan alle 16 Pfarreien leiten wird.
Ein Pfarrer für 16 Pfarreien – ist diese Herausforderung überhaupt zu bewältigen? Es ist in der Tat eine große Aufgabe. Um sie meistern zu können, sollte er nicht zu alt und nicht zu jung sein und Erfahrung in der Leitung einer Pfarrei haben. Die Gruppe der Priester, die diese Voraussetzungen erfüllen, wird in unserer Diözese immer kleiner. Der Pfarrer kann sich nicht mehr in allen Pfarreien einbringen, wie er es tun konnte, als er nur eine einzige Pfarrei betreut hat. Wir müssen deshalb erst Erfahrungen sammeln und eine lebbare, funktionierende Form finden, die auch Zukunft hat. Wenn junge Leute sehen, dass ein Pfarrer nur gestresst ist und nach wenigen Jahren ein Burnout hat, wird gar keiner mehr Pfarrer werden wollen.
„Uanfoch
lei schode“
Ein vertrauter Blick in die Kirchenbänke, eine warme Stimme, die Trost spendet, Gesichter, die seit Jahren miteinander verbunden sind … Geistliche, die viele Gläubige als Wegbegleiter und Stütze im Leben geschätzt haben, verlassen die Pfarreien. Neue treten ihre Nachfolge an. Für viele Wipptaler ist das ein schmerzlicher Abschied. Manche taten dies auch öffentlich kund, u. a. auf der Facebook-Seite des Erker: „Wozu braucht es diese Verschiebungen?“, Wem ist damit gedient?“, „Uanfoch lei schode“, „Keine Worte!“, „Kaum seinse eine Zeit ba ins und fühlen sich wohl, so müssen sie wieder gehen und uns mit Tränen verlassen“, „Do miaßat man dagegen protestieren, des konn‘s jo net sein“, „Wer auch immer hinter dieser Entscheidung steht: ein klassisches Eigentor“.
„Die Versetzungen haben bei vielen Gläubigen Unverständnis ausgelöst“, schreibt Walter Bresciani in einem Leserbrief in der Tageszeitung „Dolomiten“: „Die Entscheidung, Dekan Christoph Schweigl nach Neumarkt und Pfarrer Corneliu Berea nach Innichen zu versetzen, kam für viele überraschend. Man fühlt sich von den zuständigen diözesanen Gremien regelrecht überrumpelt (…) Offenbar fehlt es an Einfühlungsvermögen für die gelungene Zusammenarbeit sowie die gewachsene Harmonie zwischen Gläubigen, Mitarbeitern und Priestern in unserer Seelsorgeeinheit. Die Begründung mit Priestermangel allein reicht nicht aus, genauso nicht wie der Hinweis auf den priesterlichen Gehorsam als Rechtfertigung, um die Bedenken der Gläubigen zu zerstreuen. Eine frühzeitige Ankündigung von etwa einem oder zwei Jahren würde vieles leichter machen. Dann wäre die zu erwartende Stimmung gewiss nicht so gedrückt und aufgeheizt.“
In einem Interview mit stol.it kündigte Generalvikar Eugen Runggaldier an, den Kommunikationsfluss zu den engsten Mitarbeitern des Pfarrers verbessern zu wollen. Sie direkt in Personalentscheidungen einzubinden, würde die Situation in den meisten Fällen allerdings noch komplexer und schwieriger machen.
Der Erker hat Dekan Christoph Schweigl auf seinen bevorstehenden Abschied angesprochen. „Es liegen bewegte Monate und Wochen hinter mir und hinter vielen Gläubigen in der Seelsorgeeinheit“, so Schweigl. „Die sieben vergangenen Jahre hier in der Seelsorgeeinheit Wipptal waren eine sehr schöne und erfüllende Zeit für mich, die ich in guter Erinnerung behalten werde. Jetzt ist es mir ein Anliegen, dass ich meinen Dienst hier gut abschließen, dem neuen Dekan und den neuen Seelsorgern einen guten Übergang vorbereiten und Anfang September meine neue Aufgabe gut beginnen kann.“ Eine weitere Stellungnahme über die Veränderungen in der Seelsorgeeinheit wollte er nicht abgeben. „Ich hatte in den vergangenen Monaten nahezu täglich die Gelegenheit, mit Gläubigen in den Pfarreien über die Veränderung zu sprechen und mich bei ihnen zu bedanken. Ebenso wird in den letzten Wochen in den Pfarreien bei den Gottesdiensten noch Gelegenheit dazu sein“, so der Dekan.
Trotz der anstehenden Neuorientierung blickt auch Pfarrer Corneliu Berea optimistisch nach vorne. „Ich bin überzeugt, dass die neuen Pfarrseelsorger, die ins Wipptal kommen, gute und erfahrene Priester sind. In diesem Sinne schaue ich mit viel Vertrauen auf die Zukunft. Das gegenseitige Gebet kann auch sehr viel Vertrauen zwischen uns schaffen.“
Auch Don Giorgio wird Ende August die Seelsorgeeinheit Wipptal verlassen. „Ich möchte allen, die sich in diesen 15 Jahren Dienst mit mir auf den Weg des Evangeliums Jesu gemacht haben, danken, verbunden mit einem großen Vergelt‘s Gott und mit der Bitte, im Gebet verbunden zu bleiben“, so der Kooperator.
Personalwechsel
Diözesanbischof Ivo Muser hat mit Wirkung zum 1. September eine Reihe von Personalentscheidungen getroffen. Wer geht, wer bleibt, wer kommt.
Christoph Schweigl, Dekan des Dekanates Sterzing, Leiter der Seelsorgeeinheit Wipp tal, Pfarrer von terzing, Pfarrseel sorger von Ried, elfes, Ratschings, Jaufental, Mauls und Stilfes, wird von seinen Auf trägen entpflichtet

des Dekanates
zing und als Koordinator für die Pastoral in italienischer Sprache im Dekanat Sterzing entpflichtet. Er wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Oberes Pustertal ernannt. Er bleibt weiterhin Geistlicher Assistent für die Ständigen Diakone.

Neumarkt, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Unterland sowie zum Pfarrer von Neumarkt und zum Pfarradministrator von Montan ernannt.

Pfarrer von Gossensaß, Pfarrseelsorger von Brenner, Pflersch, Wiesen, Außerpfitsch und Innerpfitsch, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum an von Innichen, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Pustertal, zum Pfarrer von Innichen und Toblach, arradministrator von Wahlen sowie zum Pfarrseelsorger von Vierschach, Win-

gio Carli Kooperator von Sterzing und Ko ordinator für die astoral in italieni scher Sprache im Dekanat Sterzing, Pfarrseelsorger von Trens sowie Geist licher Assistent für die Ständigen Diakone, wird von seinen Aufträgen als Pfarrseel sorger von Trens, als Kooperator von Ster-
Andreas Seehauser, Dekan von Innichen, Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Pustertal, Pfarrer von Innichen, Pfarrseelsorger von Vierschach, Winnebach und Sexten, Seelsorger von Toblach, Wahlen, Niederdorf und St. Veit in Prags, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Dekan des Dekanates Sterzing, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Wipptal sowie zum Pfarrer von Sterzing, Stilfes, Trens, Mauls, Wiesen, Außerpfitsch, Innerpfitsch, Ried, Pflersch, Gossensaß, Brenner, Telfes, Mareit, Ridnaun, Ratschings und Jaufental ernannt.

Thomas Stürz, Pfarrseelsorger von Mareit und Ridnaun, Referent für Pilgerfahrten und Tourismuspastoral am Bischöflichen Ordinariat sowie Prodekan des Dekanates Sterzing, wird von seinem Auftrag als Pfarrseelsorger von Mareit und Ridnaun entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.
Pfarrer Walter Prast ist seit 2021 Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal.
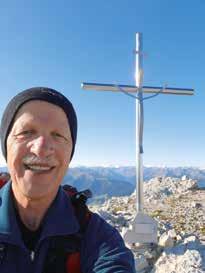

ef Gschnitarrer von Toblach, Wahlen, Niederdorf und St. Veit in Prags, Seelsorger in Innichen, schach und Winnebach, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seels

P. Vincent Baltazary Safi ALCP/ , Kooperator in Toblach, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.
Auch Karl Oberprantacher hilft als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal aus.

Am 21. Juli diskutierte der Pfarreienrat, der aus den Priestern und Vertretern der 16 Pfarreien besteht, bei einer gemeinsamen Sitzung über den neuen priesterlichen Dienst und die Verteilung der Aufgaben. Sobald die einzelnen Pfarrgemeinderäte über die Details und die Umsetzung informiert sind, wird der Erker über die genauen Neuerungen berichten.
Was ändert sich ab dem 1. September konkret?
Bisher nahm der Pfarrer in jeder Pfarrei an jeder monatlichen Pfarrgemeinderatssitzung teil, künftig ist er noch einmal im Jahr dabei. Seinen Schwerpunkt wird er auf die Seelsorgeeinheit und den Pfarreienrat legen. Große Entscheidungen, etwa darüber, in welchem Alter das Sakrament der Erstkommunion gespendet wird und wie die Vorbereitung abläuft, trifft dieser Pfarreienrat. Da die Umstellung für die Mitarbeitenden vor Ort groß sein wird, begleitet Judith Bertagnolli als Beraterin den Prozess.
Sind die Mitarbeitenden in den Pfarreien auf ein Leben mit einem sporadisch anwesenden Pfarrer ausreichend vorbereitet?
Wir arbeiten schon seit Jahren in diese Richtung. Mit größeren Umbrüchen tun sich Laien oft leichter als die Priester selbst. Das habe ich öfter beobachtet. Selbst bei großen Entscheidungen, die getroffen wurden, sagten Laien oft: Wir wussten ja alle, dass es einmal soweit kommen wird. Wir müssen alle nach vorne schauen und uns für morgen öffnen. Auch wenn sich manche die Vergangenheit zurückwünschen: Alte Modelle können für

die Zukunft nicht funktionieren. Theologisch könnte man es auch so formulieren: Gott führt die Kirche. Er hat sicher einen Plan. Gott baut die Kirche um. Und effektiv zeichnet es sich immer deutlicher ab: Eine Pfarrei ist weit mehr als nur der Pfarrer.
Hat die Diözese keine Bedenken, dass Mitarbeitende in den Pfarreien abspringen könnten?
Diese Dynamik gibt es fast bei jedem Pfarrerwechsel. Wenn gute Beziehungen gewachsen sind, ist die Enttäuschung über den Abschied natürlich groß. Aber gleichzeitig ist auch zu sagen, dass es einen Nachfolger gibt, der auch gut arbeiten wird.
Generalvikar Eugen Runggaldier: „Es ist ein Experiment, das wir in unserer Diözese noch nirgends probiert haben.“
Man vertraut darauf, dass sich der Unmut legen wird. Ich verstehe jeden, der sagt: „Wenn dieser Priester geht, dann lass ich es auch.“ Mehr Bauchweh hätte ich, wenn ich hören würde: „Endlich geht er weg. Wäre er nicht gegangen, hätte ich es gelassen.“ Enttäuschung über einen Abschied ist auch ein Zeichen dafür, dass der Pfarrer gute Arbeit geleistet hat, dass er geschätzt wird.
Was werden die Gläubigen selbst vom neuen Konzept spüren?
Für die Gläubigen selbst ändert sich wenig. Die Sonntagsgottesdienste finden weiterhin statt, vermutlich auch zu den gleichen
Zeiten. Alle Einzelpfarreien bleiben bestehen und werden von einem einzigen Pfarrer geleitet und von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Pfarrgemeinderäten unterstützt. Es gibt auch gleich viele Priester wie bisher. Sie konzentrieren sich auf Eucharistiefeiern und Sakramente und teilen sich untereinander Aufgaben auf. Um das Organisatorische kümmern sich die Menschen in den Pfarreien. Sie werden also noch mehr Verantwortung übernehmen müssen als bisher.
Die Leute vor Ort sind bereits seit Jahren Mitarbeitende und Mitverantwortliche und werden durch das neue Konzept noch stärker in die Verantwortung für das Dorf und die Pfarrei eingebunden.
Wird auch überlegt, Pfarreien zusammenzulegen?
Im Herbst 2026 finden Pfarrgemeinderatswahlen statt. Nicht in jeder Pfarrgemeinde gibt es einen Rat. Wir wollen nichts erzwingen oder Druck ausüben, sehen aber verschiedene mögliche Modelle: Wenn sich in einer Pfarrei nicht genügend Kandidaten melden, könnte sie mit einer benachbarten Pfarrei einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat oder Verwaltungsrat bilden. Es ist auch möglich, dass Pfarreien

Trens
Abschied von Pfarrer Paul Neumair
Es war eine beeindruckende Trauerfeierlichkeit für Pfarrer Paul

ischof Ivo, welcher der Feier vorstand, ging auf den Sterbe- und Begräbnistag ein: „Welche zwei schönere und würdigere Tage des Heimgangs kann es geben, als an einem Sonntag, am Tag der Apostelfürsten Petrus und Paulus – dem Namenstag des Verstorbenen, noch dazu am Tag seiner Priesterweihe vor 65 Jahren zu sterben? Und heute am Tag Maria Heimsuchung begraben zu werden?“ Bischof Ivo erinnerte an einen Satz des Verstorbenen, der 30 Jahre in der Wallfahrtspfarrei Maria Trens seelsorglich gewirkt hatte: „Wo die Mutter ist, ist immer auch der Sohn. Wer also zur Mutter Maria pilgert, der wird ihren Sohn Jesus finden.“ Regens Markus Moling zeichnete in der Predigt das Leben des Verstorbenen nach: Pfarrer Paul ist 1936 auf dem Oberwaidacherhof in Moos oberhalb von St. Lorenzen geboren. Er verbrachte dort seine Kindheit und studierte dann im Vinzentinum und im Priesterseminar in Brixen. Nach seiner Priesterweihe wirkte er als Kooperator und Pfarrer an verschiedenen Orten in unserer Diözese. Seinen Lebensabend verbrachte er im Priesterseminar und dann im Sanatorium von Brixen. Begleitet von lieben Menschen, allen voran von seinem treuen Bruder Hubert, hat er auch in der Zeit des Alterns und der Gebrechlichkeit seinen Humor nicht verloren.
In seinem kurzen Testament steht ein Satz, der von seinem Primizbild stammt und der auch auf dem Partezettel und dem Sterbebild abgedruckt wurde. „Mein Gott und Vater, sei jetzt und immerdar gepriesen. Dein ist alles, was Du mir gegeben hast und getan hast. Heilige Maria, nimm alle Priester unter Deinen besonderen Schutz.“ Bei seiner Primiz im Jahr 1960 wird er wohl nicht geahnt haben, dass er selbst einmal einen Marienwallfahrtsort leiten und an diesem Ort auch begraben werden wird. Bürgermeisterin Verena Überegger und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Waltraud Steiner würdigten den Altpfarrer als einen sehr leutseligen Menschen, der die Gemeinschaft mit den Menschen schätzte, der immer einen Spaß auf Lager hatte und sich auf einen guten Kaffee und ein gesundes Likörchen freute. Im Namen der Gemeinde und der Pfarrgemeinde dankten sie ihm herzlich für sein 30-jähriges Wirken im Wallfahrtsort Maria Trens. Der Kirchenchor, verstärkt mit Sängern aus der Umgebung und aus Pfunders, wo Pfarrer Paul 14 Jahre gewirkt hatte, die Musikkapelle sowie Fahnenabordnungen der Schützen und der Feuerwehr gaben dem geschätzten Altpfarrer die letzte Ehre. Ein Männerviergesang verabschiedete ihn mit dem Lied: „Trogt‘s mi umme übern Onger, pfiat enk Gott, pfiat enk Gott.“
Martin Ellemunt
zusammengelegt werden. Dieses Modell soll nicht als Strafe verstanden werden. Wenn sich langfristig niemand für die Pfarrgemeinde zuständig fühlt, wäre eine Zusammenlegung von Vorteil, weil sich wieder ein Pfarrgemeinderat und ein Verwaltungsrat um sie kümmert.
Eine Zwischenlösung?
Werden Pfarreien fusioniert, bleibt es dabei. Deswegen machen wir diesen Schritt auch nicht so schnell. In Norddeutschland ist die Strategie, Pfarreien großräumig aufzulösen. Das Wipptal wäre dort schon längst eine einzige Pfarrei. Es ist nachvollziehbar, dass sich die Gläubigen dagegen wehren. Vor allem in Dörfern ohne Schule, Geschäfte und Gasthäuser ist der Pfarrgemeinderat die einzige Institution, die noch präsent ist. Er ist wie ein kleiner Gemeinderat im Dorf und sorgt auch dafür, dass Menschen noch Kontakt zueinander haben.
Ein Pfarrer für alle Pfarreien. Hat dieses Konzept mehr Vorteile als Nachteile?
Es wird auf jeden Fall anders werden. Es ist ein Experiment, das wir in unserer Diözese noch nirgends probiert haben. So wie das Wipptal die erste große Seelsorgeeinheit ist, ist es jetzt auch die erste mit einem einzigen Pfarrer. Das Wipptal bietet sich als Pilotprojekt an, weil es bereits einen längeren Weg als große Seelsorgeeinheit hinter sich hat. Sterzing befindet sich geographisch in der Mitte der Seelsorgeeinheit und hat eine sehr große Pfarrkirche. Das ist optimal. Das Wipptal hat einen sehr guten Weg zurückgelegt, zuerst mit Dekan Josef Knapp, dann mit Dekan Christoph
Schweigl. Hier kann man gut anknüpfen und weiterbauen. Ob der Plan aufgehen wird, ist aber noch unklar. Es ist derzeit der einzige Weg, den wir sehen. Vielleicht zeichnet sich in drei Jahren eine andere Lösung ab. Das Modell hat Chancen, wird aber auch Armut zutage bringen.
Welche?
Wenn es in einer Pfarrei zu wenige Menschen gibt, die mitarbeiten können oder wollen, wird sich dies noch stärker zeigen als in Zeiten, in denen der Pfarrer noch präsenter war und diese Lücke aufgefangen hat. Es kann aber auch sein, dass sich die Leute vor Ort aufraffen und die Ärmel hochkrempeln, ganz nach dem Motto: Jetzt erst recht!
Ihre Worte klingen sehr optimistisch.
Der Glaube an Gott, der seine Kirche leitet, lässt optimistisch sein. Wir wissen, dass dieses Modell irgendwann überall eingeführt wird. Es ist eine Möglichkeit, mit den vorhandenen Ressourcen an Priestern und Laien weiterzuarbeiten. Ich vertraue auch stark auf die Menschen in den Wipptaler Pfarreien. So wie sie ihre mutige Vision, alle 16 Pfarreien zu einer Seelsorgeeinheit zusammenzuschließen, tatkräftig umgesetzt haben, traue ich ihnen auch diesmal wieder zu, Ressourcen zu finden. Wenn sie uns mitteilen, was gut funktioniert, werden wir ihre Erfahrungen auch gerne als Best-Practice-Beispiel an andere Pfarreien und Seelsorgeeinheiten weitergeben.
Interview: rb
Aus der Geschichte der Seelsorgeeinheit Wipptal
Mit einer Sternwallfahrt pilgerten am 5. Juni 2010 Priester, die Pfarrgemeinderatspräsidenten und zahlreiche Gläubige aus allen 16 Pfarreien des südlichen Wipptales zusammen mit Bischof Karl Golser zur Sterzinger Stadtpfarrkirche „Unsere Liebe Frau im Moos”. Dem feierlichen Dankgottesdienst folgte die Verlesung des Dekretes zur Errichtung der Seelsorgeeinheit Wipptal durch Seelsorgeamtsleiter Eugen Runggaldier, woraufhin dieses allen Vorsitzenden der 16 Pfarrgemeinderäte in Vertretung ihrer Pfarrei überreicht wurde. Es war die vierte – und die bei weitem größte – Seelsorgeeinheit der Diözese.

Der Rückgang der Priester- und Ordensberufungen war auch im Dekanat Sterzing schon lange ein nicht mehr zu übersehendes Phänomen. Waren beispielsweise im Jahr 1970 noch 25 Priester im Dekanat tätig, so standen 2009 noch zehn Priester für die Seelsorge in den 16 Pfarreien zur Verfügung. Um den damit einhergehenden veränderten Bedingungen der Seelsorge Rechnung zu tragen, hatte das Seelsorgeamt der Diözese bereits unter dem im Jahr 2008 verstorbenen Bischof Wilhelm Egger einen Raum- und Personalplan vorgesehen, der eine strukturelle Zusammenarbeit der 281 Pfarreien in der Diözese Bozen-Brixen vorsah. Dabei kristallisierte sich mit der Zeit das Modell „Seelsorgeeinheit“ heraus, wobei mehrere Pfarreien in der pastoralen und seelsorglichen Tätigkeit zusammengeschlossen werden sollten.
Laien übernehmen Verantwortung
Für das Dekanat Sterzing waren anfangs drei kleinere Seelsorgeeinheiten im Gespräch. Die Seelsorgeeinheit 1 sollte die Pfarreien Sterzing, Telfes, Ried, Gossensaß, Pflersch und Brenner umfassen, die Seelsorgeeinheit 2 Wiesen, Außerpfitsch, Innerpfitsch, Trens, Mauls und Stilfes, während zur Seelsorgeeinheit 3 Mareit, Jaufental, Ratschings und
Ridnaun gehören sollten. Relativ schnell zeichnete sich allerdings ab, dass sowohl die Seelsorger als auch die Vertreter der Pfarrgemeinderäte einer einzigen Seelsorgeeinheit für das gesamte Wipptal eindeutig den orzug gaben. Alle 16 Pfarreien sollten dabei in ihrer gewachsenen Identität erhalten bleiben mit eigenem Pfarrgemeinde- und Vermögensverwaltungsrat. Als Teile der Seelsorgeeinheit sollten sie einander in der Planung und Durchführung der verschiedenen seelsorglichen Aufgaben unterstützen. Die geplante Seelsorgeeinheit sollte aber nicht nur eine Reaktion auf den immer deutlicher spürbar werdenden Priestermangel sein, sondern auch eine Anpassung an das geänderte Verständnis einer Pfarrei, in der neben dem Seelsorger vermehrt auch engagierte Laien Verantwortung übernehmen.
Der Vorbereitungsprozess zog sich über zwei Jahre hin, in der sich alle Beteiligten mit viel Enthusiasmus und Einsatz mit der Zukunft der Kirche in den Pfarreien auseinandersetzten. Zu besonders wichtigen Arbeitsschwerpunktthemen wurden eigene Arbeitsgruppen eingesetzt: Glaubensvertiefung, Diakonie, Caritas, Kinder- und Jugendpastoral, Mitarbeiter, Verwaltung, Sonntagsgottesdienste.
„Mutiger Aufbruch“
Zum Leiter der Seelsorgeeinheit Wipptal wurde Dekan Josef Knapp ernannt, der in seiner Ansprache sagte: „Unsere Seelsorgeeinheit steht für einen mutigen Aufbruch in die Zukunft, für das Bemühen, die Kirche im Dorf zu behalten, auch dafür, die Gaben und Fähigkeiten der Gläubigen zu entdecken und zu entfalten und den Blick über den pfarrlichen Tellerrand hinaus zu wagen.“ Bischof Karl Golser betonte in seiner Predigt, dass eine rein äußerliche Strukturerneuerung der Pfarreien eine reine Symptombehandlung wäre. Noch wichtiger sei die Bewegung nach innen, die unaufhörliche Erneuerung und
Stärkung des Glaubens als Einzelne und als Gemeinschaft. „Die Errichtung einer Seelsorgeeinheit kann nicht eine bloß administrative Maßnahme sein. Seelsorge steht im Dienst des Aufbaus der Kirche, und Kirche ist zuerst eine Gabe, ein Geschenk von oben“, betonte der Bischof. Mit der offiziellen Gründung der Seelsorgeeinheit hatte ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hingezogen hatte, ihren Abschluss gefunden.
Loyale Zusammenarbeit
Bereits zwei Tage nach der offiziellen Gründung der Seelsorgeeinheit erfolgte in Wiesen die konstituierende Sitzung des Pfarreienrates, dem beschlussfassenden Gremium der Seelsorgeeinheit. Er setzt sich zusammen aus Priestern, Diakon und Pastoralassistenten sämtlicher Pfarreien, die zur Seelsorgeeinheit gehören. Bei der Wahl des Ausschusses wurde Alfred Dalla Torre zum Vorsitzenden gewählt. Dem Ausschuss gehörten weiters Dekan Josef Knapp und Don Giorgio Carli, Toni Puner als stellvertretender Vorsitzender, Josef Plank als Schriftführer, Christine Wieser als Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit und Tiziana Mollica als Vertreterin der italienischen Pfarrgemeinden an.
Wenngleich es auch galt, die eine oder andere Schwierigkeit zu überwinden, konnten viele Ziele in guter Zusammenarbeit Schritt für Schritt umgesetzt werden. Die loyale Zusammenarbeit der Mitarbeiter der Pfarreien und die Bereitschaft, auch über die Grenzen der eigenen Pfarrei hinaus zu helfen, wurde bald zu einer Selbstverständlichkeit.
Neues Kapitel
15 Jahre sind seit der Sternwallfahrt am 5. Juni 2010 vergangen. Mit Wirkung zum 1. September hat Bischof Ivo Muser umfassende personelle Änderungen in der Diözese Bozen-Brixen vorgenommen, die grundlegende Auswirkungen auf Aufbau und Organisation der Seelsorgeeinheit Wipptal mit sich bringen werden. Für die 16 Pfarreien wird damit ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Und es wird wohl nicht das letzte sein … Paul Felizetti
Die Goldammer
„Meine Brüder Vögel, in höchsten Tönen müsst ihr euren Schöpfer loben und ihn immer lieben, ihn, der euch Federn zur Kleidung, Flügel zum Fliegen, und was immer euch nötig war, gab. Vor nehm machte euch Gott unter seinen Geschöpfen, und in der reinen Luft gab er euch Wohn statt, weil er selbst euch, ob wohl ihr weder sät noch erntet, dennoch schützt und leitet, ohne dass ihr etwas dazu tun müsst.“
So predigte der hl. Franziskus, als er mit seinen Mitbrüdern durch das Spoletotal wanderte und dort eine Schar von Vögeln antraf. Die Episode ist unzählige Male auf Gemälde gebannt wor den. Eine der berühmtesten und schönsten Wiedergaben ist das von Giotto di Bondone gemalte Fresko in der Basilika San Fran cesco in Assisi. Das Original an dächtig zu betrachten, sei jedem Assisi-Besucher ans Herz gelegt. Der hl. Franziskus wurde nicht nur zum Schutzheiligen Italiens erkoren. Papst Johannes Paul II. hat ihn zudem zum Patron des Umweltschutzes erhoben.

In Gegenden mit traditionell betriebener Landwirtschaft zählen die Goldammern immer noch zu den häufig vorkommenden Vogelarten.
Der Umweltschutz ist zu einem ernst empfundenen Anliegen großer Teile der Menschen geworden. Wir achten auf die Zeichen von Veränderungen in unserer Umwelt, auf die Möglichkeiten, die uns Mutter Erde bietet und bieten wird, auf die Reinheit der Luft, die Güte des Wassers, auf das Kommen und Gehen der Arten. Zu diesem letztgenannten Geschehen bietet uns unsere Vogelwelt die eine und andere Erkenntnis an.
Die Goldammer etwa zieht sich
zusehends in höhere Lagen zurück. Sie war vor wenigen Jahrzehnten noch in den Talniederungen anzutreffen. Im unteren Waldrandbereich, in der Übergangszone von Wald und Wiese, hat sie lange Zeit gute und vom Menschen geschaffene und geförderte Lebensräume vorgefunden. Kulturfolger nennt man solche Arten. Das Reh, der Fuchs, der Sperling, die Schwalbe und andere mehr gehören dazu. Wer vor nicht allzu langer Zeit im Sterzinger Talkessel unterwegs war, zu den Burgen wanderte, von Trens den schönen mit Trockenmauern gesäumten Weg nach Valgenäun spazierte, rings ums Sterzinger Moos an buschgesäumtem Weideland entlang ging, die Seitentäler mit ihren schönen Böden erkundete, der
hörte den unverwechselbaren anhaltend vorgetragenen Gesang der Männchen den ganzen Frühling hindurch bis weit in den Sommer hinein. Die Gründe, warum wir hier kaum mehr eine Goldammer entdecken, liegen auf der Hand. So wie die traditionelle Landwirtschaft einer zunehmend industrialisierten weichen musste, die Landschaft mehr und mehr ausgeräumt erschien, fühlten sich die Goldammern nicht mehr in ihren vitalen Bedürfnissen befriedigt und sie suchten Gebiete auf, die den ursprünglich bewohnten und genutzten noch in etwa gleichen. Heute finden wir sie im halboffenen oberen Waldrandbereich, etwa unter dem Pfitscher Joch und in anderen von Büschen durchsetzten Grashängen. Auch im Winter sind
sie noch bei uns, denn sie gehören zu den Standvögeln, die kein Wegziehen vonnöten haben, sondern sich brachliegende Feldfluren, schneefreie Ackerböden, ja auch Vogelfütterungen suchen, um die nahrungskarge Zeit zu überstehen. Hier bietet sich ein kleiner Exkurs an, um auf ähnliche, aber nicht so einfach deutbare Veränderungen in unserer Vogelwelt hinzuweisen. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Nur eine kleine Auswahl wollen wir uns zumuten. Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts, also vor rund siebzig Jahren, gab es den Sommer über keine Wacholderdrosseln in unserem Land. Sie kamen zur Zugzeit im Herbst, fraßen die Vogelbeeren von den Bäumen und flogen weiter.

Dann, zu Beginn der 1970er Jahre, fielen hierzulande die ersten Bruten auf. Die geselligen und in Kolonien lebenden Vögel besiedelten Feldgehölze, waren emsig auf den gemähten Wiesen mit der Futtersuche beschäftig, und wir hörten ihren lärmenden Gesang, wenn man denn von Gesang sprechen kann. Auch im Obstbaugebiet vollzog sich eine Veränderung. Hier waren es die Singdrosseln, die den für sie attraktiven Raum und die zum Nestbau einladenden Bäume für sich beanspruchten. Ihr melodischer Gesang mit den zwei- bis fünfmal wiederholten kurzen Motiven wurde zur dominierenden Vogelstimme in den „Gütern“, wie die Obstbauern ihre wertvollen Anbaugebiete nennen. Ehedem waren die Singdrosseln fast ausschließlich Waldbewohnerinnen. In den letzten Jahren haben sie sich wieder in ihre früheren Brutund Streifgebiete zurückgezogen. Wir hören sie nun vermehrt in unserer Gegend bis hinauf an die obere Waldgrenze. Ein anderes Beispiel bietet uns der Birkenzeisig. Als sein bevorzugter Lebensraum gilt die Krummholzzone und dort vor allen der Grünerlengürtel, der auf saurem Untergrund den Übergang vom Wald zum alpinen Grasland markiert. Wie staunten die Vogelbeobachter, als die kleinen braunen Vögelchen mit der roten Stirn plötzlich in die Talböden einflogen, auch hier wieder
bevorzugt ins Obstanbaugebiet. Sie sind von dort aber letzthin wieder weggezogen in ihre ursprüngliche Heimat im Almbereich.
Aber zurück zur Goldammer. Naturfotograf Christian Kofler fand sie letzthin am Haider See, auf der Seiser Alm und im hinte ren Vals, wo es zur Fane hinaufgeht. Wie so oft ist der Vinschgau besonders ergiebig. Am Matscher Ackerwaal hat Kofler ein knappes Dutzend dieser einst überall häufigen Vögel entdeckt.
Einzigartige Stimme
Der Goldammergesang ist so auffallend und ein fach-einprägsam, dass er in keiner Beschrei bung der Art fehlt, auch weil sich die Strophe mit leicht zu merkenden Wör ten und rhythmisch stim mig wiedergeben lässt. „Wie wie wie hab‘ ich dich lieb!“ So ähnlich klingt das „ZÍzi-zí-zi-zí-zi-düüh“. Wer hört eine solche Botschaft nicht gerne! Weniger romantisch verklärt ist eine andere Wortwiedergabe, die den Landmann, der früh am Morgen hinter dem Pfluge geht, als Empfänger des GoldammerLiedes im Auge hat: „Es ist, es ist ja noch viel zu früh.“
wig van Beethoven vom Goldammergesang zum Eingangsthema seiner 5. Symphonie angeregt worden sei. Drei hämmernden
„Wie wie wie hab ich dich lieb“ So in etwa klingt, in leicht zu merkende Worte gekleidet, das kurze Lied des Goldammermännchens.
finden war, nun aber kaum mehr auffindbar ist. Fast völlig verschwunden ist mittlerweile die Zaunammer. Es bleibt noch die Rohrammer zu nennen, die, wie ihr Name andeutet, im Röhricht von Seen und Sumpfgebieten ihren Platz zum Brüten findet. Auch von ihr wurden letzthin nur mehr vereinzelte Exemplare und Paare entdeckt.

Etwas kühn erscheint die doch verbreitete Vermutung, dass Lud-
falt unserer heimischen Ammern zu. Neben der Goldammer, die im Südtiroler Dialekt auch als „Gruina“ bezeichnet wird, kommt in unserem Land die Zippammer, eine mediterrane Art, vor. Sie ist im Westen und Süden Südtirols ein zwar regelmäßiger, aber seltener Brutvogel. Ähnliche Lebensraumansprüche hat der Ortolan, der vorwiegend an den Vinschger Steppenhängen zu
Wir wollen uns am Ende der Rückkehr zur diversitätsfreundlichen und nachhaltig betriebenen Nutzung unserer Ressourcen der Wanderungstrend dieser wunderbaren Vögel einmal wieder umkehrt und sie unsere Felder und Fluren, die Waldränder und Wiesen wieder besiedeln und uns täglich zurufen: „Wie wie wie hab ich dich lieb!“
Die Goldammern-Weibchen haben weniger leuchtendes Gelb im Gefieder.


Straße des Todes
Das stille Krötensterben in Pfitsch und was jetzt passieren muss
In der Gemeinde Pfitsch spielt sich jedes Frühjahr ein Drama ab, das vielen Verkehrsteilnehmern womöglich gar nicht bewusst ist. Entlang der Straße beim ehemaligen Gasthof Elefant, direkt neben dem Stausee, verwandelt sich der Asphalt zur tödlichen Barriere für unzählige Erdkröten und Frösche. Was dort passiert, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems: Unsere vielbefahrenen Straßen sind für wandernde Amphibien nämlich ein kaum überwindbares Hindernis – mit fatalen Folgen.


Dabei ist das Prinzip ihrer Lebensweise recht einfach: Amphibien wie die Erdkröte sind auf verschiedene Lebensräume angewiesen. Sie überwintern geschützt in frostfreien Erdverstecken oder unter Totholz. Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen und es feucht wird, brechen sie – teils in großer Zahl – zu ihren Laichgewässern auf. Sie kehren dabei oft genau zu jenem Tümpel zurück, in dem sie selbst geboren wurden. Im Sommer wandern dann die Jungtiere in die Umgebung aus, im Herbst machen sich schließlich viele Tiere wieder auf den Rückweg in ihr Winterquartier. Diese regelmäßigen saisonalen Wanderungen bringen sie zwangsläufig mit dem Menschen in Konflikt – vor allem dort, wo Straßen zwischen den Lebensräumen liegen. Und genau das ist in Pfitsch der Fall. Die vielbefahrene Straße entlang des Stausees durchschneidet ein wichtiges Amphibiengebiet, das in der Frühjahrszeit besonders stark frequentiert wird. In nur wenigen Wochen versuchen tausende Tiere die Straße zu queren – viele
von ihnen schaffen es jedoch nicht. Ein Facebook-Posting mit eindrücklichen Bildern brachte das Thema in den letzten Monaten wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein. Anwohner ergriffen daraufhin die Initiative, kontaktierten verschiedene Stellen und organisierten gemeinsam mit Gemeinderatsmitgliedern und interessierten Bürgern einen ersten Lokalaugenschein. Mit dabei war auch Ivan Plasinger, Präsident des Südtiroler Herpetologenvereins „Herpeton“.
Wirksame Methode
Plasinger beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Amphibien- und Reptilienschutz in Südtirol. Ihm ist es sehr wichtig, dass die Menschen zunehmend verstehen, wie wichtig Amphibien und Reptilien für das gesamte Ökosystem sind. Gewiss wären sie schon nur ihrer selbst wegen schützenswert, doch sie spielen auch für andere Tiere eine wichtige Rolle. „Ein einzelnes Erdkrötenweibchen produziert rund 3.000 Eier. Die allermeisten davon überleben nicht, sie werden von anderen Tieren gefressen und bilden damit eine wichtige Nahrungsgrundlage“, erklärt er. Amphibien übernehmen so eine zentrale Rolle im Ökosystem – ihr Rückgang hat Auswirkungen weit über ihre eigene Art hinaus.
Angesichts der dramatischen Lage in Pfitsch ist nun endlich ein erster konkreter Schritt geplant: Bereits im kommenden Frühjahr soll ein mobiler Amphibienschutzzaun entlang der betroffenen 600 m errichtet werden. Dieser Zaun – rund einen halben Meter hoch – zwingt die wandernden Tiere
dazu, am Rand entlangzulaufen, bis sie in eingegrabene Eimer fallen. Diese Eimer müssen morgens und abends kontrolliert werden, dann werden die Tiere über die Straße getragen und auf der anderen Seite wieder (sicher) freigelassen. Dieses sogenannte „Eimer-System“ ist eine einfache, aber wirksame Methode, die andernorts bereits erfolgreich praktiziert wird. Doch die Umsetzung steht und fällt mit der Beteiligung der Bevölkerung. Denn das tägliche Leeren der Eimer kann nicht von außen organisiert werden – hier braucht es Freiwillige vor Ort, die sich die Arbeit teilen. Beim Lokalaugenschein war der Wille zur Unterstützung jedenfalls bereits spürbar vorhanden.
Am 10. Juni fand in unmittelbarer Nähe des alten Gasthofs „Elefant“ ein weiteres Treffen statt – diesmal mit Bürgermeister Stefan Gufler, Vertretern der Forstbehörde, des Forstinspektorats, des Landesamtes für Naturschutz, des Straßendienstes sowie freiwilliger Helfer und des Vereins „Herpeton“. Dabei wurde ein wichtiger nächster Schritt vereinbart: Der Verein wird gemeinsam mit dem Amt für Naturschutz mit den betroffenen Anrainern Kontakt aufnehmen, um die Genehmigungen für das Aufstellen der mobilen Amphibienschutzzäune zu erhalten. Parallel dazu wird das Landesamt gemeinsam mit dem Straßendienst die nötigen bürokratischen Verfahren klären. Positiv zu vermerken ist außerdem: Die Forstbehörde prüft die Möglichkeit, über ihren Jahreshaushalt die Finanzierung von 600 m Schutzzaun zu übernehmen. Auch der Aufbau könnte durch die Forstarbeiter erfolgen. Die freiwilligen Helfer vor Ort zeigten sich erfreut über die geplanten Maßnahmen und auch von der Gemeindeverwaltung wurde das Projekt ausdrücklich begrüßt. Ein gelungener erster Schritt ist damit getan.
Mobiler Schutz als erster Schritt
Langfristig braucht es, wie Plasinger klar gemacht hat, fixe Unterführungen, die den Tieren dauerhaft ein sicheres Queren der Straße ermöglichen. Solche Tunnel gibt es bereits in anderen Gemeinden und ihre Wirkung ist erwiesen. Aber: Fixe bauliche Maßnahmen sind teuer und müssen gezielt eingesetzt werden. Deshalb braucht es vor Ort zunächst systematisch erhobene Daten: Wie viele Tiere wandern wirklich? Wo genau queren sie? In welchen Zeitfenstern ist das Wanderaufkommen am höchsten? Der Verein „Herpeton“ wird in den kommenden Jahren genau diese Daten erheben, über das Monitoring der Eimerfallen, aber auch durch weitere gezielte Beobachtungen. Erst auf dieser Grundlage kann später eine Unterführung geplant und gerechtfertigt werden. Plasinger betont: „Solche Lösungen müssen am richtigen Ort umgesetzt werden –dort, wo sie wirklich etwas bewirken. Einfach irgendwo einen Tunnel zu bauen, bringt nichts.“ Auch die Finanzierung spielt dabei eine Rolle. Unternehmen sollen gezielt auf die Möglichkeit hingewiesen werden, Umweltoder Kompensationsgelder in solche nachhaltigen Schutzmaßnahmen zu investieren. Genau dafür seien diese Gelder nämlich gedacht – und genau hier könnten und sollten sie schließlich Wirkung entfalten. In Pfitsch entsteht also hoffentlich bald ein beispielhaftes Projekt – getragen von engagierten Bürgern, unterstützt von fachlicher Expertise. Wenn es gelingt, dieses Engagement zu bündeln, Bewusstsein zu schaffen und gemeinsam eine langfristige Lösung auf den Weg zu bringen, dann könnten die Frühjahre in Pfitsch bald nicht mehr vom massenhaften Tod, sondern vom gezielten Schutz der Amphibien geprägt sein.
Lorenz Grasl
Bayernland trifft Sterzing: Genusstheke im Poli-Geschäft
Bayerische Genusskultur in Sterzing: Da hochwertige Bayernland-Produkte im Angebot der lokalen Geschäfte nur vereinzelt zu finden sind, wird im Verkaufspunkt von Poli an einer eigenen Theke eine breite Auswahl an Bayernland-Produkten angeboten.
Bayernland-Produkte sind im Wipptal längst eine feste Größe. In den Hotels im Bezirk haben Gäste schon seit Jahren die Gelegenheit, die hochwertigen Milchprodukte zu genießen – ermöglicht durch eine Kooperation mit dem Milchhof Sterzing. „Immer wieder werden wir darauf angesprochen, wo es unsere BayernlandProdukte zu kaufen gibt“, so die Geschäftsleitung. „Viele von ihnen haben sie in einer leckeren Picknick-Box, die wir Vereinen gerne als Sachpreis zur Verfügung stellen, kennengelernt. Durch das Angebot im Poli können alle Wipptaler eine vielfältige Auswahl an Bayernland-Produkten entdecken und erwerben.“ Vereine können weiterhin Bayernland kontaktieren, wenn sie eine Picknick-Box als beliebten Sachpreis benötigen.

Im Angebot sind folgende Produkte:
• Bayernland Butter 250 g: Bayerische Markenbutter für Genießer.
• Bayernland Käsescheiben: Diverse Käsesorten in praktischen Scheiben in wiederverschließbaren Packungen. Besonders kundenfreundlich, da diese Käsescheiben sowohl in der klassischen Variante als auch laktosefrei für noch mehr Wahlfreiheit im Kühlregal erhältlich sind.
• Bayernland Mozzarella: Die Mozzarella-Kugel von Bayernland wurde vor kurzem von der renommierten Konsumentenschutzvereinigung „Altroconsumo“ zu einer der besten Mozzarellas in Italiens Regalen gekürt. Ein Beweis für die Qualität der bayrischen Milch und der erstklassigen Arbeit der Käsemeister der Bayernland.
• Mozzarella in Sfoglia und Mozzarella Julienne: Beide Mozzarella-Sorten sind in Italien sehr beliebt, die Nachfrage steigt. Sie sind ebenfalls im Poli-Regal in Sterzing zu finden.
An der Poli-Genusstheke in Sterzing gibt es ein Stück bayerischer Genusskultur – für alle Liebhaber qualitätsvoller BayernlandProdukte.
Infos unter www.bayernland.it
Gute Platzierungen

Nach dem Vorbereitungswettbewerb in Lüsen kämpften die Wipptaler Jugendfeuerwehren Ende Juni bei den Feuerwehrleistungsbewerben in Deutschnofen erneut um gute Platzierungen. Auch wenn es nicht für einen Stockerlplatz reichte, holten sie sowohl in den U12-Bewerben als auch in den Mannschaftskategorien erneut gute Ergebnisse. Bestes Wipptaler Team war die Jugendgruppe aus Mauls (im Bild), die in der Kategorie Bronze unter rund 100 Teilnehmern den 10. Platz erzielte. Stärkste Wipptaler Teilnehmer bei den U12 waren Bastian Haller, Madleen Gschliesser und Nico Gschliesser (Ratschings).
Im Amt bestätigt

Franz Seehauser (Bezirk Wipptal) bleibt für die kommenden fünf Jahre Landesjugendreferent der Feuerwehr. Der Maulser wurde Ende Juni auf der Landesversammlung der Feuerwehrjugendbetreuer einstimmig in seinem Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Philipp Forcher (Bezirk Meran) gewählt.
150 Jahre Feuerwehr Sterzing
Ein Fest der Kameradschaft und des Engagements

Ein stolzes Jubiläum, eine gelebte Tradition und eine bewegende Feier: Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing beging Mitte Juli ihr 150-jähriges Bestehen – mit einem vielseitigen Festprogramm, das den Einsatz, die Kameradschaft und den Fortschritt der letzten eineinhalb Jahrhunderte in den Mittelpunkt stellte.
Der Auftakt erfolgte im eigens errichteten Festzelt mit Musik, Tanz und geselligem Beisammensein. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war der große Festumzug, der vom Nordpark bis zur Sportzone führte. Angeführt von der Bürgerkapelle Sterzing, marschierten neben der Feuerwehr Sterzing auch die Feuerwehrjugend und zahlreiche Abordnungen befreundeter Organisationen, begleitet von historischen Fahrzeugen und Spritzpumpen. Unter den Ehrengästen befanden sich AltLandeshauptmann Luis Durnwalder, Senator Meinrad Durnwalder, Landesrätin Rosmarie Pamer sowie die Bürgermeister der Gemeinden Sterzing, Freienfeld und Ratschings Peter Volgger, Verena Überegger und Sebastian Helfer. Auch Delegationen aus Kitzbühel und Innsbruck, Vertreter der Blaulichtorganisationen und viele Ehrenmitglieder erwiesen der Feuerwehr Sterzing die Ehre.
Kommandant Peter Kahn begrüßte die Festgemeinde mit herzlichen Worten, während Ehrenmitglied und langjähriger Kommandant Peter Heidegger einen historischen Rückblick auf die Entwicklung der Wehr präsentierte.
In ihren Grußworten würdigten Landesrätin Pamer und Senator Durnwalder das Engagement der Feuerwehr, bevor Bürgermeister Peter Volgger die Bedeutung der Wehr für die Sicherheit der Bevölkerung hervorhob. „Unsere Feuerwehr steht Tag und Nacht bereit, oft unter Einsatz des eigenen Lebens – das verdient tiefsten Respekt und Dankbarkeit“, so Volgger.
Ein Zeichen der Freundschaft kam aus der Partnerstadt Kitzbühel: Die dortige Feuerwehr überreichte der Sterzinger Wehr eine Erinnerungsplakette sowie das Wahrzeichen Kitzbühels: eine Gams-Statuette.
Eine besondere Ehrung konnte Hansjörg Eisendle entgegennehmen: Für seine 40-jährige Dienstzeit wurde er mit dem Verdienstkreuz in Gold ausgezeichnet.
Der feierliche Fassanstich durch Landesfeuerwehr-Vizepräsident Peter Hellweger markierte den Abschluss des offiziellen Teils. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bürgerkapelle Sterzing, Entertainer Franz sowie die Jungfelder Böhmische und ein DJ.
Ein besonderer Dank der Feuerwehr Sterzing galt allen Mitwirkenden, Unterstützern und Sponsoren sowie den Bäuerinnen des Bezirks, die 800 Kirchtagskrapfen unentgeltlich zubereitet hatten. Die 150-Jahr-Feier war nicht nur ein Rückblick auf eine bewegte Geschichte, sondern auch ein lebendiges Bekenntnis zu gelebter Solidarität und Gemeinschaft.
bar
Hansjörg Eisendle
Besondere Ehrung: Hansjörg Eisendle wurde für 40-jährige Dienstzeit ausgezeichnet.
Kräuter- und Bastelmarkt in Maria Trens
Am 15. August findet auf dem Festplatz in Maria Trens wieder ein Kräu-

ter- und Bastelmarkt statt. Zwischen 10.30 und 13.00 Uhr erwartet die Besucher ein liebevoll gestalteter Markt
mit handgefertigten Bastelarbeiten und natürlichen Kräuterprodukten. Der gesamte Erlös kommt dem Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen“ zugute, der sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einsetzt. Projektleiterin Petra Theiner bedankt sich schon im Voraus bei allen Helfern und Unterstützern. „Ein tausendfaches Vergelt’s Gott an alle fleißigen Hände, die diesen Markt möglich machen“, so Theiner.
Spende für „Trotzdem reden“
Im Rahmen der Spezialitätenwoche „Eisacktaler Kost“ des HGV-Bezirkes Eisacktal/Wipptal zeigten die 18 teilnehmenden Gastbetriebe zwischen Sterzing und Villanders nicht nur kulinarisches Können, sondern auch soziales En gagement. Jeder Betrieb spendet pro verkauftes Ge richt zwei Euro an die Beratungsstel le für unterstützte K ommunikation „Trotzdem reden“ der Lebenshilfe

Südtirol. Angelika Stafler, Florian Fink und Michael Huber (Arbeitsgruppe „Eisacktaler Kost“) übergaben kürzlich die gesammelten Spenden von 2.800 Euro in Form eines symbolischen Schecks an Lebenshilfe-Präsident Roland Schroffenegger.
Seit sieben Jahren unterstützt die
Arbeitsgruppe die Beratungsstelle „Trotzdem reden“. Diese hilft Menschen, die nicht oder nur schwer verständlich sprechen können, und deren Angehörige, achpersonen und Betreuungspersonen, geeignete Kommunikationsformen finden – von körpereigenen Signalen über Symbolkarten bis hin zu elektronischen Hilfsmitteln – und begleitet Betroffene individuell und praxisnah auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe.
Im Bild (v. l.) Roland Schroffenegger, Präsident der Südtiroler Lebenshilfe, Angelika Stafler, Michael Huber und Florian Fink, Arbeitsgruppe der „Eisacktaler Kost“, sowie HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber.
Sterzing Veronika Stötter ist neue HGV-Ortsobfrau

Bei der Ortsversammlung der Ortsgruppe Sterzing des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) wurde der bisherige Obmann Philipp Obermüller vom Restaurant „Zoll Bowls & Burger“ von Veronika Stötter vom Hotel „Haus am Turm“ abgelöst. Dem Ausschuss gehören zudem Thomas Stuefer („Schwarzer Adler Tagesbar“), Thomas Volgger (Hotel „Engels Park“), Sonja Plank (Hotel „Sterzinger Moos“), Michael Strickner (Bar Restaurant Pizzeria „Biwak“), Michael Messner (Sporthotel „Zoll“), Thomas Hofmann (Hotel „Goldenes Kreuz“) und Sara Mader (Restaurant Pizzeria „Nepomuk“) an.
Im Bild (v. l.) HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber, HGV-Ortsobfrau Veronika Stötter, Bürgermeister Peter Volgger, HGV-Gebietsobmann Manfred Volgger und Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV.
Brenner

Vor kurzem wurde Günter Strickner vom Gasthaus „Moarwirt“ in Gossensaß als Obmann der Ortsgruppe Brenner des Hoteliers– und Gastwirteverbandes HGV bestätigt. Der Ortsausschuss setzt sich zudem aus Fabian Bernmeister (Hotel „Brenner24“), Tobias Mair („Hotel „Gudrun“), Thomas Mühlsteiger (Pension „Knappenhof“), Vivian Plank (Hotel „Schuster“), Vera Mair (Gasthaus „Wolf“) und Alexandra Windisch (Hotel „Panorama“) zusammen.
Im Bild (v. l) Martin Mair, Gebietsobmann Manfred Volgger, Thomas Mühlsteiger, Bürgermeister Martin Alber, Vera Mair, Ortsobmann Günter Strickner, Tobias Mair, Vivian Plank und Fabian Bernmeister.
Kinderseite
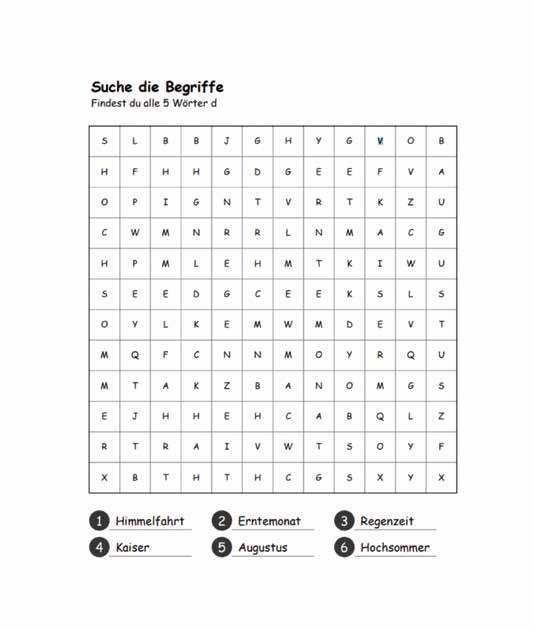
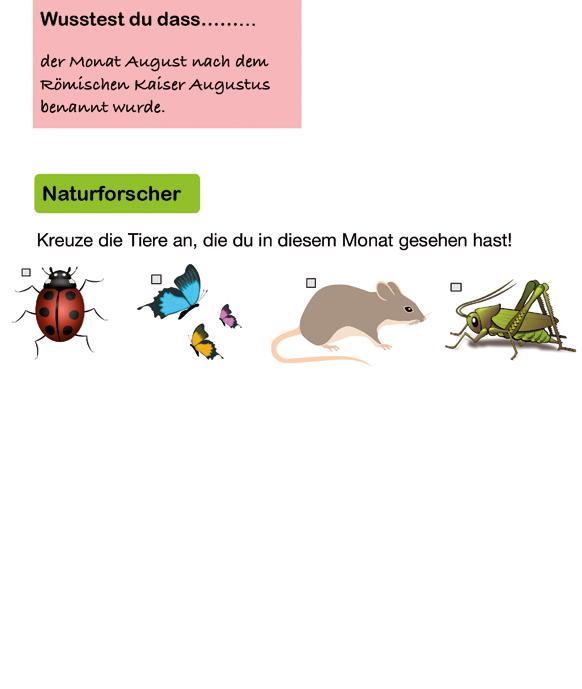
Suche die Begriffe
Findest du alle 5 Wörter? 1 2 3 4 5 6
Wusstest du, dass ... ... der Monat August nach dem römischen Kaiser Augustus benannt wurde?
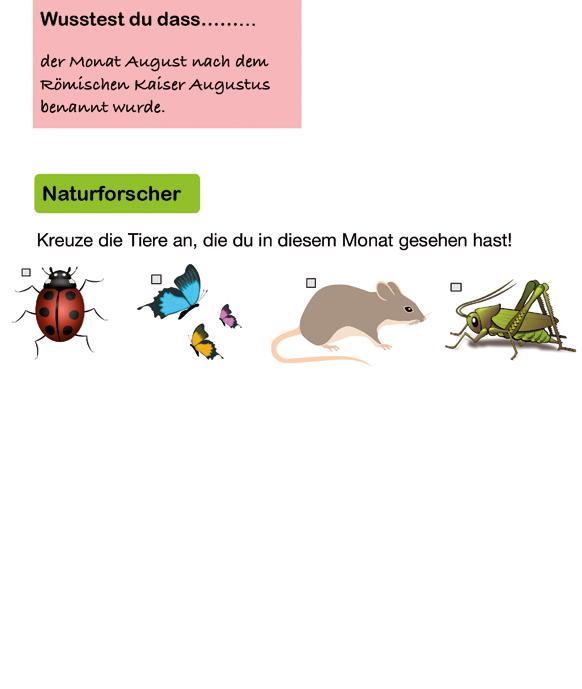
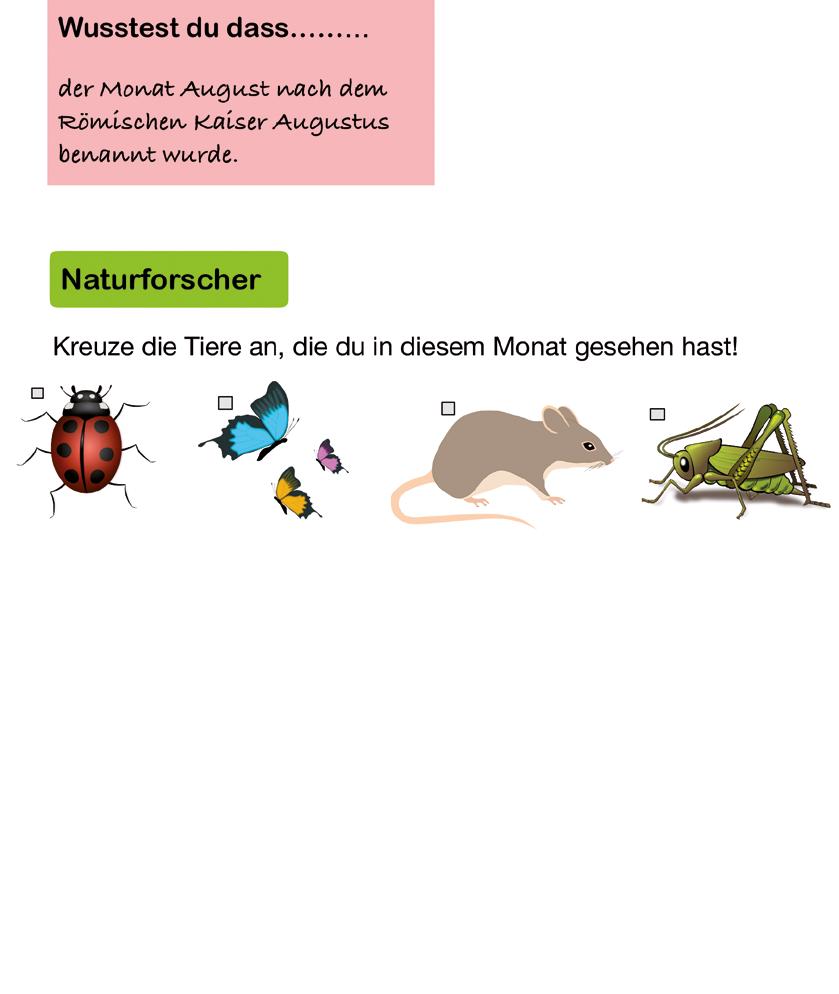
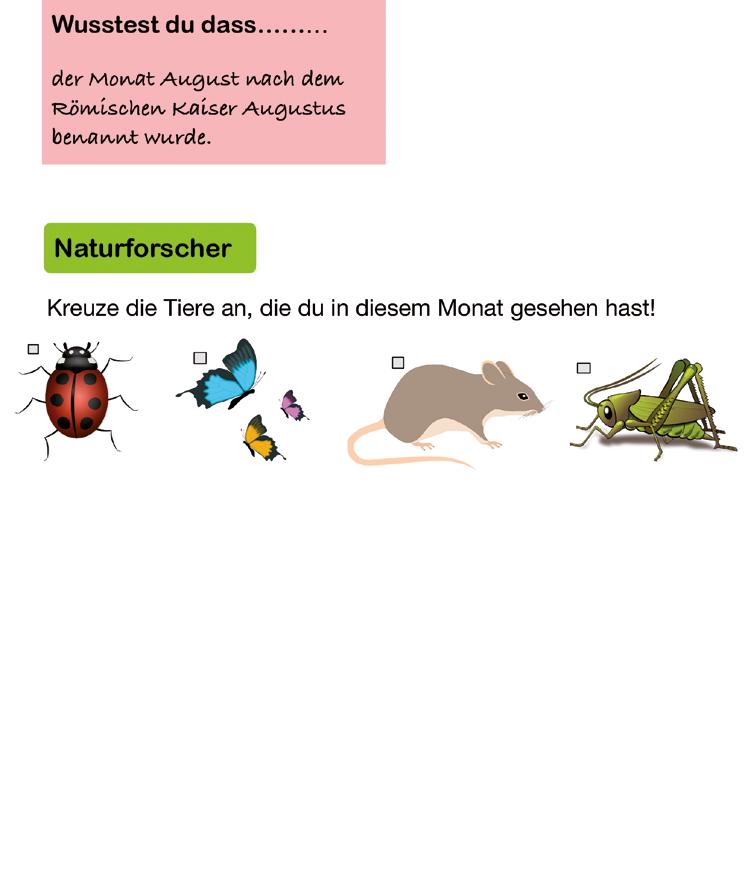
Ottone-Nigro-Preis geht ins Wipptal

Mitte Juli hat die Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) den „Ottone-Nigro-Preis“ an drei Preisträger verliehen, die sich durch ihr konkretes und kontinuierliches Engagement für die Inklusion von Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung ausgezeichnet haben: die Initiative „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“, das Projekt „Inklusives Brixen“ sowie den Raiffeisenverband Südtirol.
Die Initiative „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“ ist auch unter dem Namen „Zeit schenken“ bekannt. Das Projekt besteht seit über fünf Jahren und wird von zehn Personen geleitet. Eines der Ziele der Gruppe ist es, Barrieren abzubauen – nicht nur architektonische, sondern auch menschlicher Natur. Ein besonderer Erfolg konnte mit der Sensibilisierungskampagne „Bahnhof Pfitsch“ erzielt werden, die den Baubeginn des lang erwarteten Projekts eines Aufzugs an der Bahnhaltestelle ermöglichte. Die diesjährigen Veranstaltungen umfassen u. a. den „FünfUhr-Tee“, gemeinsame Kochkurse, Wanderungen und Theaterstücke, um Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammenzuführen.
„Zeit ist eines der wertvollsten Güter, das der Mensch zur Verfügung hat“, betont Christian Schölzhorn, Gründer der Initiative. „Umso mehr ist das Zeitschenken und das Verbinden der verschiedenen Realitäten ein ungemein wichtiger gesellschaftlicher Mehrwert für alle Beteiligten. Für die Mitglieder der Steuerungsgruppe ist dieser Mehrwert auch eine wertvolle persönliche Bereicherung: Die Welt gemeinsam mit Menschen mit Behinderung zu erleben, ist unglaublich bereichernd und lehrreich. Man kann so viel lernen – vor allem über sich selbst. Diesen besonderen Menschen ab und zu eine Bühne, das Licht eines Scheinwerfers und vor allem Zeit zu schenken, sehe ich als unsere zentrale Aufgabe.“
Im Bild (v. l.) Verbandsobmann Herbert von Leon, Petra Öhler (Raiffeisenverband Südtirol), Fritz Karl Messner und Josef Turin (Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen), Giulia Ferrarese und Präsident Thomas Aichner (ANMIC Südtirol), Christian Schölzhorn (Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen), Stadträtin Bettina Kerer, Stadträtin Sara Dejakum, Elisabeth Fulterer, Hermann Popodi (Gemeinde Brixen).
Sterzing Ein Nachmittag voller Lebensfreude

Mit guter Musik, herzlichen Gesprächen und bester Laune feierten zahlreiche Teilnehmer Anfang Juli den gelungenen „Fünf-Uhr-Tee“-Nachmittag, zu dem die Initiative „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“ geladen hatte, und verwandelten das gesellige Beisammensein kurzerhand in eine kleine Disco. Der Nachmittag begann gemütlich bei erfrischenden Getränken und regen Gesprächen, doch spätestens, als die Disco-Musik erklang, war die Stimmung nicht mehr zu bremsen: Ausgelassen wurde gelacht, getanzt und gefeiert, niemand blieb auf seinem Platz sitzen. Damit auch in Zukunft möglichst viele mitfeiern können, findet der nächste „Fünf-Uhr-Tee mit Disco-Fieber“ nicht wie gewohnt im Juli, sondern künftig am ersten Freitag im August statt. So können alle, die im Juli verreist sind, im August mit neuer Energie dabei sein – und mit viel Herz das Leben feiern.
Sterzing Treffsicherheit bewiesen
Beim Landesjägerschießen in Taufers im Münstertal stellten Südtirols Jäger Ende Juni ihre Zielgenauigkeit, Treffsicherheit und sichere Handhabung ihrer Jagdwaffe unter Beweis. Innerhalb von 15 Minuten gaben die Teilnehmer auf eine Entfernung von 200 m drei Wertungsschüsse auf verschiedene Zielscheiben ab. In der Mannschaftswertung holte der Bezirk Meran den ersten Platz, dicht gefolgt vom Bezirk Vinschgau und dem Bezirk Sterzing mit seinen fünf besten Schützen Christoph Gschnitzer, Kurt Fleckinger, Luca Volpe, Florian Leitner und Wilfried Inderst. Insgesamt erlangten 87 Schützen das Leistungsabzeichen des Jagdverbandes in Gold, 141 in Silber und 103 in Bronze.

Whats Upp?!
im Wipptol
von Tobi vom Jugenddienst und Erker-Praktikantin
Clara Trocker
1. Welche Playlist könnte von dir stammen?
A: Sommer Banger 2025
B: Meine Playlist Nr. 46
C: traurig
D: It´s a good day to have a good day
BIST DU? WELCHER MUSIKTYP
Ankreuztest mit Auswertung
4. Welche Aussage passt zu dir?
A: „Meine Lieblingssongs sind laut und machen Stimmung.“
B: „Ich höre verschiedenste Lieder, um zu entspannen.“
C: „Musik hilft mir dabei, meine Gefühle auszudrücken.“
D: „Ohne Musik kein Leben!“
2. Zu deinen Lieblingskünstlern zählen …
A: Charli XCX, Lady Gaga, Lorde
B: Fleetwood Mac, Die Beatles, Billy Joel
C: Billie Eilish, Tom Odell, Coldplay
D: Taylor Swift, One Direction, Olivia Rodrigo
3. Wo hörst du am liebsten Musik?
A: Beim Jammen mit Freunden
B: Ganz nebenbei, während ich was anderes mache
C: Im Bett mit Kopfhörern in den Ohren
D: LIVE natürlich
5. Wie reagierst du, wenn dein Lieblingsartist endlich wieder eine Tour ankündigt?
A: Konzerte interessieren mich nicht, Festivals sind mein Ding!
B: Ich versuche, Tickets zu ergattern.
C: Ich verfolge alles online, dabei sein werde ich aber nicht.
D: Ich muss gehen, egal um welchen Preis, und am besten zu so vielen Shows wie möglich!
Am meisten D? Typ „Pop-Ikone“: Du liebst Musik nicht einfach – du lebst sie! Du lernst Songtexte im Handumdrehen auswendig und würdest alles dafür tun, um dein Idol live zu hören.
Dein Musikgeschmack ist nachdenklich, tiefgründig und authentisch – genau wie du!
Am meisten C? Typ „Melancholiker“: Von Folk, LoFi bis Indie ist bei dir alles dabei.
offen für alles. Es gibt keine Musikrichtung, die dir nicht gefällt, und so probierst du dich einmal quer durch alles durch.
Typ „Chiller“: Bei dir läuft immer Musik im Hintergrund. Du bist
Am meisten B?
besten soll sie alle zum Tanzen bringen. Rhythmus ist dir ganz besonders wichtig.
Typ „Partymaus“: Musik muss bei dir laut und energetisch sein, am
Am meisten A?
Auswertung:
SommerfilmEmpfehlungen:
Mamma Mia
Call me by your name
Luca
Die wilden Hühner
Moonrise Kingdom
Rio
Little miss sunshine
Stand by me
Don‘t worry darling
The Florida Project

30 Jahre Lions Club Sterzing
Vor kurzem fand im „Genusshaus“ in Ridnaun die Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Lionsclubs Sterzing-Vipiteno-Wipptal (vormals

Brenner-Europabrücke) statt. Präsident Karl Benedikter begrüßte die Mitglieder und Ehrengäste, darunter Bezirkspräsidentin Monika Reinthaler, die Zonenpräsidentin der Südtiroler Lionsclubs Claudia Longi, eine Abordnung des Partnerclubs Gallneukirchen bei Linz sowie die Präsidenten der Clubs von Stubai Wipptal, Brixen, Bo-
zen Host und Meran Host. Der ehemalige Präsident Fritz Karl Messner gab einen Überblick über die wichtigsten Serviceleistungen, Unterstützungen und Programmschwerpunkte der letzten 30 Jahre. Gründungspräsidentin Emma Agreiter erinnerte an das Zustandekommen des Clubs, der von Anfang an Mitglieder aus drei Sprachgruppen sowie aus Nord- und Südtirol hatte. Allen bisherigen Präsidenten wurde eine Dankesurkunde überreicht.
Im Bild (v. l.) Karl Marmsoler (Stubai Wipptal), Andrea Grata (Bozen Host), Christian Ossanna (Brixen), Claudia Longi (Zonenpräsidentin), Karl Benedikter (Sterzing Wipptal), Wolfgang Reisinger (Gallneukirchen OÖ) und Walter Unterthurner (Meran Host).
65 Jahre Segelfluggruppe Sterzing
Ein besonderes Jubiläum steht bevor: Am Wochenende des 23. und 24. August feiert die Segelfluggruppe Sterzing ihr 65-jähriges Bestehen mit einem großen Flugfest auf dem Segelfluggelände in Sterzing. Unter dem Motto „Fliegen hautnah erleben“ erwartet die Besucher an beiden Tagen ab 10.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für alle Flugbegeisterten, interessierte Nachwuchspiloten und Familien.
Geboten werden zahlreiche Flugvorführungen, u. a. mit Modellfliegern, Paragleitern, Oldtimern und Segelkunstflugmaschinen. Wer selbst abheben möchte, hat bei Rundflügen mit Motor- und Segelflugzeugen sowie Hubschrauberrundflügen ab 14.00 Uhr die Gelegenheit dazu.
Ein besonderes Highlight ist
die große Lotterie mit vielen tollen Preisen. Die Verlosung findet am Sonntag um 15.00 Uhr statt. Für Stimmung sorgt am Samstagabend ab 20.00

Sterzing/Gossensaß
Bereits seit vier Jahren besteht nun das Repair Cafè in Sterzing, das von Mai bis Oktober an jedem zweiten Donnerstag im Monat in Sterzing und Gossensaß angeboten und dankbar angenommen wird. Die ehrenamtlichen Helfer, denen großer Dank gebührt, können fast jedes Problem lösen: Hubert

sorgt für eine scharfe Klinge auf den Küchenmessern, Irma für eine weitere Verwendung von Kleidungsstücken und verschiedenen Utensilien, Walter ässt die Fahrräder wieder rund laufen, Andreas elt an defekten Elektrogeräten und haucht ihnen neues Leben ein. Man ann den fleißigen Handwerkern im Garten des Margarethenhauses über die Schulter schauen und es ergeben sich interessante Gespräche. Der 14. August und der 11. September sind die nächsten Termine für Sterzing, der 9. Oktober für Gossensaß.
Uhr DJ Ricci bei der Fliegerparty mit freiem Eintritt. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – Speis und Trank sind reichlich vorhanden. Die Segelfluggruppe Sterzing freut sich auf zahlreiche Besucher und zwei unvergessliche Tage ganz im Zeichen des Flugsports. ab10Uhr
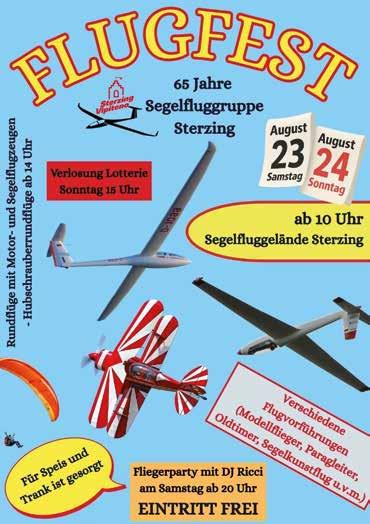
Täuschend echt
Bodypainting-Festival verwandelt Sterzing in lebendige Kunstgalerie
Der Körper als Leinwand, die Altstadt als Bühne: Beim World Bodypainting Festival wurde Mitte Juli Sterzing zum Zentrum täuschend echter Körperkunst. Was wie Magie wirkt, ist das Ergebnis stundenlanger Präzisionsarbeit: In der Kategorie „Camouflage Bodypainting“ verschmolzen bemalte Körper nahezu unsichtbar mit den historischen Fassaden und faszinierten Schaulustige wie Jury gleichermaßen.




Erstmals machte das Festival, das als inoffizielle Weltmeisterschaft des Bodypaintings gilt, in Sterzing Station. Die Veranstaltung zog rund 20 internationale Künstler an, die ihre Modelle vor beeindruckenden Kulissen wie

dem Zwölferturm, dem Stadtplatz oder entlang der Altstadtgassen bemalten – so exakt, dass sie beinahe mit dem Stein oder Mauerwerk verschmolzen. Selbst eine Person in traditioneller Südtiroler Tracht wurde zur
Projektionsfläche.
Kunst, die Geduld fordert, auch von den Modellen: Etwa drei Stunden dauert es, bis ein Körper vollständig bemalt ist. Manche Künstler reisten mit eigenen Modellen an, andere arbeiteten
mit spezialisierten Agenturen zusammen. Unterstützung kam auch von zahlreichen freiwilligen Helfern vor Ort, die mit Organisation, Logistik und Betreuung zum Gelingen des Festivals beitrugen.
Im Zentrum stand der Wettbewerb in der Kategorie „Camouflage“, der erstmals über zwei Tage ausgetragen wurde. Die historische Kulisse von Sterzing bot dafür ideale Bedingungen: Insgesamt 15 Orte wurden in lebendige Installationen verwandelt, ergänzt durch eine offene „Creative Bodypainting Jam Session“, bei der freies künstlerisches Arbeiten im Stadtraum möglich war.
Den Höhepunkt bildete die feierliche Präsentation und Preisverleihung auf dem Stadtplatz: Zur neuen Weltmeisterin kürte die hochkarätig besetzte Jury – da-
1. Platz Florine Colledara
2. Platz Nicola Loda
3. Platz Vanessa La Mouche des Marquises
4. Platz Viljia Vikute
5. Platz Federica Rigozzo







runter der Sterzinger Bodypainting-Star Johannes Stötter, die Bulgarin Bella Volen und Orena Semenes aus der Ukraine – die Französin Florine Colledara, deren Werk fast spurlos mit der Umgebung verschmolz. Platz
zwei ging an Nicola Loda aus Italien, Platz drei an Vanessa La

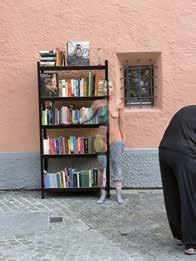





Mouche des Marquises (Frankreich). Den Publikumspreis sicherte sich Christine Hüttner aus der Schweiz – ein Werk, das nicht nur mit technischer Raffinesse, sondern auch mit emotionaler Wirkung überzeugte.
Bereits im Vorfeld hatte ein vielfältiges Rahmenprogramm mit
Workshops, Künstlergesprächen und Begegnungen das Festival eingeleitet. Der kreative Austausch, das Miteinander von Kunst, Publikum und Stadt – all das machte Sterzing an diesem Wochenende zu mehr als nur einer Kulisse: zu einem lebendigen Zentrum internationaler Körper-

kunst.
Veranstaltet wurde das Festival von der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld gemeinsam mit dem Organisator Alex Barendregt von „WB Production GmbH“.
Fotos
© Martin Schaller,
Stefano
Orsini, Daniel Janesch
Ridnaun Unwetter hinterlassen
deutliche Spuren

Anfang Juli wurde Ridnaun mehrmals von schweren Unwettern heimgesucht. Neben außergewöhnlich intensiven Niederschlagsmengen sorgte vor allem ein ungewöhnlich lang anhaltender Hagelschlag für erhebliche Schäden. Begleitet wurden die Wetterextreme von heftigem Blitzschlag und ohrenbetäubendem Donner, der die Bewohner in Angst und Schrecken versetzte. Garagen und Kellerräume mehrerer Hotels und Privathäuser wurden überflutet. Die Landesstraße von Mareit nach Ridnaun war zeitweise unpassierbar. Besonders betroffen war auch die auf einem Hügel thronende St. Laurentiuskapelle: Erst Tage nach den Unwettern, bei den Vorbereitungen für eine Messe, wurde festgestellt, dass ein Blitz in das Bauwerk eingeschlagen hatte. An der Nord- und Westseite der Kapelle zeigen sich mehrere Risse in den Mauern. Eine der alten Kreuzwegstationen wurde aus ihrer Verankerung gerissen, der Rahmen dabei stark beschädigt. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit noch erhoben.
Sterzing Mahlers „Tragische“

Im Rahmen des Sommerfestivals der Stiftung Musik Brixen gastiert am 8. August das Bayerische Landesjugendorchester unter der Leitung von Vitali Alekseenok mit der Sinfonie Nr. 6 von Gustav Mahler in der Pfarrkirche von Sterzing. Mahlers „Tragische“ in a-Moll ist äußerst persönlich und gefühlsintensiv. Sie kreist
um existenzielle Themen: Liebe im privaten und universellen Sinn, den Sinn des Lebens, Mensch und Natur – Themen, die auch junge Menschen tief bewegen. Das Orchester besteht aus Musikern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr.
Kirchenkonzerte in Mareit
Brass’n Sax & Erzählkunst
Am 7. August treffen in der Pfarrkirche von Mareit vier Musiker (Chris Haller, Saxophon;

Walter Plank, Trompete; Peppi Haller, Posaune; Toni Pichler, Tuba) auf eine Erzählerin (Heike Vigl). Das Ergebnis ist eine vergnügliche, pulsierende und verwegene Verbindung zwischen Geschichten und Musik. Auf dem Programm stehen Werke von alten Meistern, Jazz-Swing und Blues und die eine und andere Überraschung. Das Ensemble Brass’n Sax besteht zu einem Teil aus Musikern der Joe Smith Band und seinem Kopf Peppi Haller alias Joe Smith.
Bozen Brass
Einen Abend voller Klang, Tiefe und musikalischer Ausdruckskraft bietet am 21. August die

Musik sität, Tiefe und feinsinniger Klangkunst bringt das Ensemble mit seinem einzigartigen Stil – einer Mischung aus Klassik, Jazz, Filmmusik und Südtiroler Charme – die Mauern der Pfarrkirche von Mareit zum Klingen.
Beide Konzerte beginnen um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos (Freiwillige Spende).
Vewa: Immobilienverwaltung mit Zukunft und Mehrwert
Die Südtiroler Immobilienverwaltung Vewa verbindet digitale Lösungen mit persönlicher Betreuung – und ist jetzt auch in Sterzing vertreten.
Neu: Standort in Sterzing
Seit kurzem ist Vewa auch mit einem Büro in Sterzing in der Ralsergasse 8 präsent. Damit ist das Unternehmen noch näher an den Kunden im Wipptal – und steht ihnen auch dort mit Kompetenz und Engagement zur Seite.
Vewa steht für moderne, zukunftsorientierte Immobilienver waltung in Südtirol und am Gardasee. Ziel ist es, Immobilien nicht nur zu betreuen, sondern aktiv weiterzuentwickeln –digital, effizient und individuell. Mit durchdachten Instandhaltungsstrategien, persönlicher Beratung und vorausschauender Planung trägt Vewa dazu bei, den Wert von Immobilien langfristig zu erhalten und zu steigern. Ein zentrales Element ist die Digitalisierung: Über eine OnlinePlattform, die Vewa App, erhalten Eigentümer jederzeit Zugriff auf Abrechnungen, Verträge und Protokolle. Das schafft Transparenz, reduziert Papierkram und erleichtert die Zusammenarbeit.

Trotz aller digitalen Prozesse setzt Vewa bewusst auf persönlichen Kontakt. Klare Kommunikation und direkte Ansprechpartner stärken das Vertrauen der Kunden.
Mehr unter: www.vewa.it

„So ein kleiner Ort und so ein lebendiges Musikprogramm“
15. Orfeo Music Festival in Sterzing
Gemeinsam Musik machen - das ist seit der Gründung im Jahr 2003 das Motto des Orfeo Mu sic Festivals. Und das trifft es genau. Beim jährlichen Festival für klassische Musik geht es um Zusammenarbeit und um die Teilhabe an klassischer Musik. Jedes Jahr treffen bekannte Mu siker, namhafte Professoren und internationale Studenten aufein ander, um miteinander spielen, proben und auftreten zu können, eben um gemeinsam zu musizie ren.

Das Orfeo Music Festival, kurz OMF, wurde in diesem Jahr zum 15. Mal in Folge in Sterzing ausgetragen. Mit 13 Konzerten im Zeitraum vom 2. bis zum 11. Juli bot das Festival Klassikliebhabern die Möglichkeit, den Unterrichtsstunden der Künstler, den hochwertigen Kammerund Studentenkonzerten und der großen Eröffnungs- und Abschlussgala teilzuwohnen.
Hinter jeder Darbietung steckt eine Menge Arbeit, Vorbereitung und Probezeit. Mit Beginn eines jeden Jahres geht es los: Alle Teilnehmer, die Fakultät und die Organisatorin Larisa Jackson arbeiten und fiebern auf die Sommerabende in der Fuggerstadt hin. Auch während des Aufenthalts in Sterzing liegt der Fokus bei den Proben. So verbringen die Musikbegabten die meiste Zeit vor ihren Auftritten
mit Üben. Doch die ganze Mühe und das Abwarten zahlen sich aus: Wer als Zuhörer im Publi kum saß, konnte das von Glück


erfüllte Strahlen und Lachen der Künstler bestätigen und die Leidenschaft der jungen Nachwuchstalente und ihrer Professoren in ihren Stücken förmlich hören.
füllten sich die leeren Plätze langsam, ein aufmerksames Schweigen trat in den Raum und die ersten Musiker wurden aufgerufen. Mit Beethovens Streichquartett Werk Nr. 18, Nr. 1., vorgetragen
vom Bravo String Quartett aus Florida, begann das Konzert. Es folgten Stücke von Mozart, Chopin, Brahms und vielen weiteren Komponisten, dargeboten von den verschiedenen Studenten. Mit einigen von ihnen hat der Erker nach dem Konzert gesprochen. Die vier Anfang 20-jährigen US-Amerikanerinnen Val Haas, Daniela Baker, Bridgett Baker und Anna Cannito stammen aus unterschiedlichen Teilen der Vereinigten Staaten und teilen sich einen Traum: Sie wollen professionelle Opernsängerinnen werden. 2025 sind sie deshalb erstmals beim Orfeo Music Festival dabei. „Wir sind hier wegen der Musik. Wir wollen in der Oper groß rauskommen“, sagt Val Haas (22) aus Nashville, Tennessee. Als fortgeschrittene Pianistinnen und Studentinnen feierten die Musikerinnen Melissa Murphy, Alexandra Flint und Julianne DiTommaso ihren erfolgreichen ersten Auftritt im Rahmen des Orfeo Music Festivals. Melissa Murphy aus Kalifornien berichtete über ihre Eindrücke: „Es hat mich überrascht, wie viele verschiedene Stücke wir in kurzer Zeit spielen. […] Das ist herausfordernd, aber bereichernd.“
Clara Trocker
Elf intensive Probetage und 13 hochklassige Konzerte beim Festival für Klassikliebhaber
(v.l.): Val Haas, Daniela Baker, Bridgett Baker und Anna Cannito
(v.l.): Melissa Murphy, Alexandra Flint und Julianne DiTommaso

4. Musikfestival im Sterzinger Nordpark
Ende Juli hat der Jugenddienst Wipptal wieder ein Festival bei freiem Eintritt, gutem Essen und unterhaltsamer LiveMusik auf die Beine gestellt. Für Stimmung sorgten fünf Bands aus dem Wipptal.
Die Rockband The Fuel besteht aus Michael Keim (Gitarre), Michael Gschnitzer (Gesang und Bass), Peter Holzmann (Keys und Gesang) sowie Simon Gschnitzer (Schlagzeug). Die Musiker konnten bereits eine Menge an Bühnenerfahrung sammeln. Auch beim Nordparkfestival 2024 hatten sie die Gelegenheit, das Publikum von sich zu überzeugen.
Das akustische Trio Mahroots besteht aus den Gitarristen Patrick „Ricky“ Zelger (Gesang, Gitarre) und Jörg „Joe“ Mahlknecht (Gitarre) sowie der Sängerin Laura Frick. Seit 2023 treten sie gemeinsam auf und spielen sowohl authentische Eigenkompositionen als auch besondere Interpretationen von Songs verschiedener Genres. Durch ihre Live-Auftritte bauen sie eine enge Bindung zum Publikum auf.
Georg Hafner (Gitarre), Hannes Holzmann (Gesang), Benedikt Leitner (Schlagzeug), Klaus Holzmann (Gitarre und Gesang) und David Leitner (Bass) bilden die fünfköpfige Band Exocore, die sich auf
Alternative Metal und Hard Rock fokussiert. Kennzeichen ihrer Musik ist die Kombination von schweren Riffs mit symphonischen Melodien.
Bita ist der Name der Band der gleichnamigen Singer und Songwriterin Bita Abdollahi sowie des Schlagzeugers Tobias Pfeifhofer und des Gitarristen und Produzenten Lorenzo Scrinzi. Gemeinsam durften sie bereits für Max von Milland in Kufstein und Toblach die Bühne eröffnen. Seit Sommer 2024 wird ihr Song „Halfway“ regelmäßig im Radio gespielt.
Abschließen durfte den Abend Cauchella, das Bandprojekt des Jugenddienstes. Die Band besteht aus sechs Mitgliedern: Mirja, Greta und Lena (Gesang), Katarina (Klavier), Judith (Schlagzeug) sowie Tobias als Organisator und gelegentlich am Schlagzeug. Neben dem Covern bekannter Pop- und Rock-Hits komponiert die junge Gruppe neuerdings auch eigene Lieder und tritt bei diversen lokalen Veranstaltungen auf.
Clara Trocker




The Fuel
Trio Mahroots
Exocore
Bita
Cauchella
Reifenstein
Gelungene Rittertage
„Brücken durch die Zeit“

Ein voller Erfolg war die Premiere der Reifensteiner Rittertage, die im Juli am Fuße der Burg Reifenstein stattfanden. Drei Tage lang verwandelte sich das Burggelände in eine lebendige Zeitreise ins Mittelalter und lockte zahlreiche Besucher an.
Insgesamt 21 Mittelaltervereine aus dem In- und Ausland errichteten ihre Lager unterhalb der Burg. Dort lebten und nächtigten sie wie in längst vergangenen Zeiten, bereiteten ihre Speisen über offenem Feuer zu, präsentierten traditionelle Handwerkskunst und gaben den Besuchern faszinierende Einblicke in das Lagerleben.
Zu den Höhepunkten zählten der historische Umzug, spannende Lanzenund Geschicklichkeitsturniere sowie ein beeindruckender Schaukampf. Auf der Marktbühne sorgten Livebands für die passende musikalische Untermalung. Zahlreiche Stände boten eine vielfältige Auswahl an Handwerk, Speis und Trank.
Aufgrund des großen Erfolgs und der positiven Resonanz wurde der Wunsch geäußert, die Reifensteiner Rittertage auch im kommenden Jahr wieder auszutragen. Das vielversprechende Debüt lässt auf eine Fortsetzung dieses einzigartigen mittelalterlichen Spektakels hoffen. bar
Der Bau von Großprojekten wie der Festung und dem Brenner Basistunnel (BBT) hinterlässt deutliche Spuren in Landschaft und Gesellschaft. Sie sind technische Meisterwerke, aber auch Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels und des menschlichen Eingriffs in Natur und Umwelt – mit langfristigen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Die Ende Juni in der Festung Franzensfeste eröffnete Ausstellung „Brücken durch die Zeit: Architektur des Unsichtbaren“ lädt dazu ein, über die Geschichte und Zukunft des Alpenraums nachzudenken und genauer hinzuschauen, auch auf das, was oft übersehen wird: die Arbeit im Verborgenen, Landschaften, die sich verändern, Spuren, die bleiben, Menschen, die im Schatten stehen.
Die Erzählung des BBT übernimmt der Tiroler Fotograf Gregor Sailer. Seine Bilder und eine Videoinstallation beleuchten die gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Dimensionen des Projektes. Sie sind kühl und menschenleer, lenken den Blick auf Strukturen und ihre Wirkung und erzählen von architektonischer Ästhetik. Sailer erklärt, er sei mehr an den Spuren und Zeichen des Menschen interessiert als an dessen Abbild. Oft würde die surreale Atmosphäre, die den Aufnahmeorten ohnehin anhaftet, durch das Nichtzeigen des Menschen weiter gesteigert. Dem gegenüber steht die Festung als Symbol imperialer Macht, errichtet von vielen, meist namenlosen Arbeitern. Bis zu 4.500 Menschen aus dem gesamten Habsburgerreich sollen an ihrem Bau beteiligt gewesen sein, auch Frauen. Rund 670 Fachkräfte stammten aus Tirol, der Großteil waren Militärangehörige aus dem Habsburgerreich. Zum Vergleich: Heute sind rund 1.500 Arbeiter beim BBT im Einsatz, auf Südtiroler Seite stammen viele aus Kalabrien. Migration ist also ein gemeinsames Merkmal der beiden Bauvorhaben.
Gemeinsam haben sie auch die Kontroversen, beide Bauwerke waren umstritten: Hielten im 19. Jahrhundert Militärs die Franzensfeste für überholt, sind es heute vor allem Umweltverbände, Bürgerinitiativen und politische Stimmen, die vor hohen Kosten, unklarem Nutzen, Eingriffen in Landschaften und sensible Ökosystemen sowie Risiken für das Trinkwasser warnen.

In puncto Sicherheit gibt es hingegen Unterschiede: Beim Bau der Franzensfeste gab es kaum Schutz. Unfälle, Epidemien und fehlende Absicherung bestimmten den Alltag. Erst Jahrzehnte später wurden die ersten Arbeitsschutzgesetze eingeführt. Beim Bau des BBT hat die Sicherheit hingegen höchste Priorität: Bereits in der Planungsphase wurden Notfallsysteme wie eine Laser-Branderkennung und Spezialfahrzeuge für Einsätze bei schlechter Sicht oder Sauerstoffmangel integriert. Dennoch bleibt der Tunnelbau riskant. Hinzu kommen psychische Belastungen: Schichtarbeit stört den Schlafrhythmus und die Isolation sowie die Dunkelheit führen oft zu Erschöpfung oder Angstzuständen. Viele leben monatelang fernab ihrer Familien.
Die Ausstellung wurde von Esther Erlacher, Stefan Graf und Patrick Moser kuratiert und findet im Rahmen des Euregio Museumsjahres 2025 „Weiter sehen“ statt. Zu sehen ist sie bis Anfang November.
© Luca Guadagnini
Jagd – Hund – Mensch
Die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund ist das Thema der neuen Ausstellung „Jagd – Hund – Mensch. Eine erfolgreiche


Beziehungsgeschichte“ auf Schloss Wolfsthurn, dem Landesmuseum für Jagd und Fischerei in Mareit.
Im Mittelpunkt stehen die Instinkte und Fähig-
„Was
keiten der Vierbeiner, ihre Rolle bei der Jagd sowie ihre Bedeutung für Kultur und Gesellschaft. Die Ausstellung erzählt Geschichten, in denen Jäger und Hundehalterinnen von den einzigartigen Fähigkeiten ihrer tierischen Begleiter und den gemeinsamen Erlebnissen berichten. Darüber hinaus informiert sie über die Jagdkultur und die entscheidende Rolle von Jagdhunden bei der Nachsuche sowie in neuen, nichtjagdlichen Aufgabenbereichen. Außerdem wird der Frage nachgegangen, was einen guten Jagdhund ausmacht.
Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2026 zu sehen und zwar von Dienstag bis Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr sowie sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr.
kriegt der Bauer?“
„Was kriegt der Bauer?“ Dieser Frage spürt Elisabeth Frei in ihrer Kunstausstellung nach, die bis zum 9. November auf Schloss Tirol zu sehen ist.

© Peter Daldos
Die Arbeiten – Bilder und Objekte –der Künstlerin mit Sterzinger Wurzeln befassen sich mit paradoxen, gegensätzlichen Situationen, g esellschaftspolitischen Absurditäten, Lobby-Einflüssen in der Landwirtschaft, ausgeklügelter Hochleistungsmaschinerie und der Entfremdung des naturnahen Wirtschaftens.
Zentrales Gestaltungselement sind jenseits aller Klischees und immer auch mit einer Por-
tion Ironie versehen übermalte Printprodukte, die in ihrer ursprünglichen Form ausgedient haben und nun als Spiegel der Vergangenheit die Entwicklungen der Landwirtschaft kritisch reflektieren. Elisabeth Frei versteht ihre Kunst nicht als Dekorationskunst. Vielmehr möchte sie mit ihren Arbeiten das Publikum zum Denken animieren. Die Künstlerin arbeitet auch gerne mit Wortspielen: Die Doppelbödigkeit des Verbs „kriegen“ ist im Jubiläumsjahr der Bauernkriege bewusst gewählt: Was bekommt der Bauer, was bleibt?
Sterzing
Den Aufstand proben
Ende Juli wurde im Rathaus von Sterzing mit einer partizipativen Performance und einem Protestmarsch die Ausstellung „Den Aufstand proben“ eröffnet.
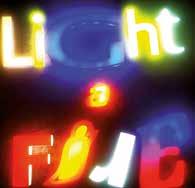
Im Stadt- und Multschermuseum von Sterzing trifft bis Ende Oktober nun zeitgenössische Kunst auf Geschichte: Die Ausstellung verknüpft aktuelle künstlerische Positionen mit den Räumen und Objekten des Museums und fragt, wie wir heute über Macht, Teilhabe und Widerstand sprechen. Im Zentrum stehen Arbeiten, die Unterdrückung, Geschlechterverhältnisse und soziale Kämpfe neu imaginieren – spielerisch, kritisch, poetisch.
Ausgehend vom Tiroler Bauernkrieg 1525 und der Figur Michael Gaismairs spannt die Ausstellung einen Bogen bis in die Gegenwart und fragt: Wie entsteht Gemeinschaft? Wie zeigt sich Widerstand? Und was kann Kunst dazu beitragen? Zu sehen sind Werke von Berty Skuber, Chiara Fumai, Fluoro Fleece Kunstkollektiv, Franz Pichler, Ingrid Hora, Jakob De Chirico, Jasmine Deporta, Karl Plattner, Leander Schwazer, Maria C. Hilber, Othmar Winkler, Peter Kaser, Peter Lorenz & Yaron Guerrero Santos.
© Leander Schwazer
Die Europahütte im Spiegel der Geschichte
Neue Nationalgrenzen. Die Problemzonen Brenner und Landshuter Hütte – Teil 2
Alois Karl Eller
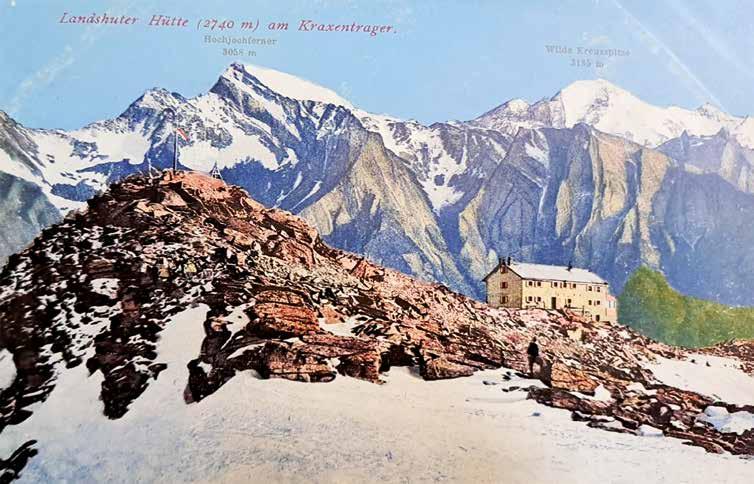
Die neue Grenze
Im Londoner Geheimabkommen zwischen Italien, Frankreich, England und Russland am 15. April 1915 wurde der Brennerpass von der italienischen Regierung erstmals eingefordert. Der Friedensvertrag von Saint Germain vom 26. September 1919 diente dann als Grundlage für die endgültige Festlegung der neuen Grenzen zwischen Italien und Österreich.
Um die österreichischen Interessen der neu zu bestimmenden Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien zu wahren, eröffnete die Zentralgrenzkommission mit Sitz in Wien 1920 in Innsbruck ein eigenes Länder-Zentralbüro, das u. a. für die Grenzfrage Brenner/Gries und die Landshuter Hütte zuständig war. Sämtliche Akten zur Grenzregelung liegen heute gesammelt im Österreichischen Staatsarchiv in Wien.
Die Verhandlungen der italienischen Grenzregelungskommission mit den österreichischen Delegierten sollten – so eine Weisung der Siegermächte – so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Ausgangspunkt für die touristische Erschließung des Tuxer Bergkammes mit der Landshuter Hütte am Wege war für die Sektion Landshut des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins immer der Bahnhof am Brenner.
Einer der Streitpunkte der beiden verhandelnden Delegationen war die Frage, wo genau die Wasserscheide der Flüsse Sill (Inn) und Eisack (Etsch) festzulegen sei, nach der laut Pariser Vertrag die endgültige Grenze gezogen werden sollte. Die Vertreter der italienischen Delegation legten diesen Punkt nahe dem Brennersee fest, die österreichischen Delegierten wollten hingegen die Wasserscheide etwas südlich der Dorfkirche am Brenner sehen.
Die Landshuter Hütte mit Blick gegen Südosten (Hochjochferner und Wilde Kreuzspitze). Postkartenmotiv 1939. K. Redlich Innsbruck. Bildarchiv Bibl. Mus. Ferd.

Sie bestanden auf ihrem vorgebrachten Hinweis, dass schon von früher her das Wasser von ihrem festgelegten Punkt nordwärts entwässert worden sei. Da die Unterhändler zu keiner Einigung kamen und beide Seiten vor allem auf die Zuteilung des Bahnhofes Brenner bestanden, schritt schlussendlich die Pariser Botschafterkonferenz ein und beschloss am 17. Februar 1921, dass der Bahnhof Brenner Italien zufallen solle.
Über die neue Grenze am Brenner wurden deren Bewohner über die Presse informiert: „Die kleine Ortschaft Brenner mit der Kirche, dem Postgasthof und dem Pfarrhof sowie dem Bahnhof Brenner liegen nach dem Verlauf dieser Grenze auf italienischem Gebiet. Die an der Reichsstraße nach Innsbruck knapp nördlich des Bahnhofes Brenner gelegene Höfegruppe, in deren Mitte sich das Kerschbaumer Haus befindet, ist jetzt die erste Ansiedlung auf österreichischem Boden. Auch das Brennertal, durch das der Aufstieg zur Landshuter Hütte und zu dem als Aussichtspunkt berühmten Kraxentrager führt, verbleibt bei Österreich. Westlich vom Einschnitt des Brennerpasses geht die festgesetzte Grenze bis zum Kreuzjoch (2.264 m), östlich bis zum Wolfendorn (2.775 m). Die Strecke vom Wolfendorn bis zum Kraxentrager ist noch nicht endgültig geregelt,

die Festlegung dieser Grenzstrecke vielmehr noch von der Entscheidung über die Zugehörigkeit der knapp an der Wasserscheide gelegenen Landshuter Hütte abhängig.“ Und weiter: „Auch das Venntal, durch das der Aufstieg zur Landshuter Hütte führt, bleibt bei Österreich.“ Dem Zeitgeist entsprechend wurden Grenzen damals weniger als Verbindung zwischen den Nationen, sondern gezielt als Barrieren – auch militärisch gesichert – aufgebaut. Die neu gezogene Grenze am Brenner war dem gerade aufstrebenden Alpintourismus in keiner Weise förderlich.
In der Folge wurden die Grenzübertritte zunehmend erschwert; die faschistische Regierung zielte darauf ab, alle Verbindungen der Deutschsprachigen nördlich des Brenners mit den Südtirolern zu behindern oder gar zu unterbinden.
Wem fällt die Landshuter Hütte zu?
Als besonders schwierig erwies sich die Grenzfestlegung rund um die Landshuter Hütte. Ohne Vorwissen wird die damals festgelegte Grenze von Fachleuten und Laien bis heute als unverständlich und provokativ wahrgenommen. Sowohl die österreichische als auch die italienisch geleitete Grenzregelungs-Kommission
1. An der Nordseite der Landshuter Hütte, am Eingang des „Club Alpino Italiano“, befindet sich der Grenzstein, der den Verlauf der Grenzlinie zwischen Österreich und Italien zeigt. Das „Ö“ steht für Österreich, die zwei Linien im rechten Winkel deuten den Verlauf durch die Schutzhütte an.
stellten Ansprüche auf die Zuteilung der Schutzhütte. Der österreichische Vertreter und Unterkommissar Laimbichler riet bei der strittigen Frage dazu, dass es „sehr wertvoll (wäre), dieses große prachtvoll gelegene Haus für (…) (die Republik Österreich) zu gewinnen“. Auch der Direktor des Länderzentralbüros Innsbruck war der Meinung, dass die österreichische Delegation sich vor allem um die Zuteilung der Landshuter Hütte bemühen sollte. Er schrieb: „Für die touristischen Interessen Tirols ist (…) die Landshuter Hütte ungleich wichtig.“ Sie sei zur Besteigung der Berggipfel Kraxentrager, Wildseespitze, Wolfendorn und Amthorspitze von großer Bedeutung, könne man diese doch ohne alpinistische Erfahrung von der Hütte aus leicht besteigen. Von der italienisch geführten Delegation sprach sich erstmals der Delegationsleiter Pariani, der ursprünglich den gesamten Bau einforderte, für die Teilung der Landshuter Hütte aus.
Die „Wasserscheiden“-Hütte
Die Unterkommissare beider Delegationen begaben sich daher gemeinsam auf die Landshuter Hütte und stellten fest, dass die Wasserscheide genau durch die Schutzhütte verlief: Auf der einen Seite der Hütte flossen kleine Rinnsale Richtung Eisack
und Etsch, auf der anderen Seite Richtung Vennbach, Sill und Inn Richtung Norden. Somit war die Wasserscheide in die Hütte zu verlegen.
Die endgültige Teilung der Hütte wurde vom Grenzregelungsausschuss am 11. September 1922 beschlossen: „Der ältere früher erbaute Teil, der mehr auf österreichischem Boden steht, verbleibt bei Österreich, der neuere, später erbaute, zum größeren Teil auf italienischem Boden stehende, gelangt zu Italien.“
Durch die Grenzfestlegung kann die Landshuter Hütte seither mit einer besonderen Eigenart aufwarten: Die österreichischitalienische Grenze verläuft quer durch die Schutzhütte. Gerade an dieser Grenzziehung wird ersichtlich, dass nationale Grenzen aus irgendeinem Interesse und über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg gezogen wurden. Mit einem seltsamen Doppelhaken werden Zweidrittel des Hauses dem Staat Italien zugeteilt, ein Drittel verbleibt bei Österreich. An der Nordseite des Hauses steht seit 1922 ein Grenzstein, der den Verlauf der Grenzlinie festlegt. Das „Ö“ steht für Österreich, die zwei Linien im rechten Winkel verweisen auf die Grenzlinie, die durch die Hütte verläuft. An der gegenüberliegenden Südseite des Hauses steht der nächste Grenzstein, der den weiteren Grenzverlauf anzeigt. Das „I“ steht für Italien, die Jahreszahl 1920 zeigt das Jahr an, in dem Südtirol zu Italien geschlagen wurde.
Offiziell wurde der österreichische Teil der Hütte am 24. August 1924 dem Vertreter des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Oberbaurat Ing. Othmar Sehrig, und dem Sektionsleiter des Alpenvereins Landshut Kaufmann Handl übertragen. Den größeren italienischen Teil (2/3) besaß ab diesem
2. Grenzstein am Pfitscherjoch
Tag der CAI (Club Alpino Italiano).
Die militärische Grenzsicherung
Die neu gezogene Grenze zwischen Italien und Österreich trennte mit einem Schlag die Bewohner Südtirols vom deutschsprachigen Norden. Offiziell war ein Grenzübertritt nur mehr am Brenner, am Reschen und am Draupass im Pustertal gestattet. Grenzüberschreitungen im Gebirge wurden von Italien strengstens untersagt, der Abstieg ins Pfitschertal oder der Weg über den Brennersattel waren daher verboten. An verschiedenen Stellen entlang der Grenze konnte der Wanderer 1928 auf Warntafeln die Aufschrift lesen: „Grenzübertritt strengstens verboten, gegen Zuwiderhandelnde wird von der Waffe Gebrauch gemacht.“ Ausdrücklich untersagte das italienische Militärkommando das Fotografieren oder die Anfertigung von Zeichnungen oder Skizzen im besprochenen Grenzbereich. Der Tourist tat gut daran, den Fotoapparat nicht offen zur Schau zu tragen, „da (er) sonst Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit werden könnte“.
Was bedeutete dies für den Fortbestand der Landshuter Hütte? Der Westteil der Hütte, im Eigentum des DAV Sektion Landshut und auf österreichischem Boden liegend, konnte ohne Grenzüberschreitung vom Venntal aus problemlos erreicht werden. Als problematisch erwies sich dann jedoch der weitere Aufstieg zum beliebten Kraxentrager, dessen Besteigung ohne Grenzübertritt nicht mehr möglich war. Der Landshuter Höhenweg entlang des Pfitscher Nordgrates lag nun zur Gänze auf italieni-
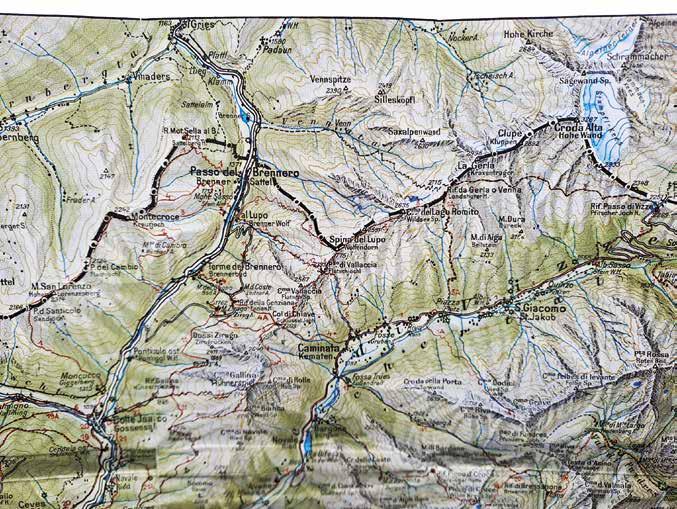
schem Boden und war zeitweise für Touristen gesperrt. Auch die Besteigung weiterer Berggipfel (Seefeldspitze, Wolfendorn, Amthorspitze) war ohne Grenzverletzung nicht mehr möglich. Die DAV Sektion Landshut hat sich als Eigentümerin sehr bemüht, die weitere Benützung in ihrem Anteil der Schutzhütte nach besten Kräften zu ermöglichen. In diesem Teil errichtete die Sektion 1924 einen neuen Gastraum, eine eigene Küche und neue Toilettenräume. So konnten nun im erweiterten Teil der Schutzhütte 26 Personen auf 14 Matratzen und zwölf Betten Nächtigung finden.
Im größeren und schöneren Teil der Hütte waren an die acht italienische Grenzwächter („finanzieri“) stationiert; im gesamten Grenzgebiet entlang der Brennerlinie hatte die italienische Militärverwaltung eine Truppe in der Stärke von einer Division (rund 5.000 Mann) postiert, um so die Grenze hermetisch abzuriegeln. Dieser Einheit standen auf österreichischer Seite nur vier Gendarmen und vier Finanzbeamte gegenüber. Der Bergfreund Leonhard Dolleneck aus Innsbruck berichtet im Jahr
1928 von einem eigenartigen Vorfall in der Schutzhütte: „Als der Hüttenwirt, Herr Gschwendtner aus Kufstein, heuer Ende Juni den Hüttenbetrieb eröffnete, zog er, wie dies bei allen Hütten des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins der Brauch ist, die Landesflagge auf. Darob großes Erstaunen bei der italienischen Besatzung. Zufällig weilte damals bei der Hütte auch noch ein stärkeres Truppendetachement. Als die Italiener erkannten, dass die Tiroler Fahne nicht zu ihren Ehren aufgezogen sei, holten sie schleunigst vom Brenner eine Trikolore herauf und jetzt weht von dem einen Ende der Hütte die Tiroler Fahne und vom anderen die Trikolore.“
Bedrohlicher Grenzbereich
Im Laufe der 1920er Jahre kam es laut Zeitungsberichten zu einigen Zwischenfällen an der Grenze:
1921: Mitglieder des Alpenvereins Innsbruck planten den Aufstieg über das Venntal zur Landshuter Hütte. In Venn versperrten Finanzer der Grenzwache diesen den Weg und führten sie anschließend in die Ortschaft
Brenner, wo sie von einem Brigadier verhört wurden. Der Vorweis der Reisepässe führte schließlich zu ihrer Entlassung; sie wurden in bewaffneter Begleitung bis zur Landesgrenze zurückgeführt.
1928: Der aus Innsbruck stammende Student Wilhelm Kanitscheider, der in der Landshuter Hütte übernachtete, verirrte sich im Zimmer und übertrat dabei die Staatsgrenze in der Schutzhütte. Er wurde daraufhin von den stationierten Finanzern festgenommen, zur Station Brenner begleitet und schließlich nach Brixen abgeführt. Dort ließ man ihn erst nach sieben Tagen Gefängnis wieder frei.
1928 Beim Aufstieg zum Kraxentrager werden vier Tiroler Touristen von fünf italienischen Finanzern mit geladenen Gewehren angehalten und darauf in den italienisch besetzten Teil der Hütte abgeführt. Erst nach einem halbstündigen Verhör werden sie wieder in ihre Freiheit entlassen.
Der Einbruch des Alpintourismus
Die bedrohlichen Verhältnisse im Grenzbereich und die negative Berichterstattung in der
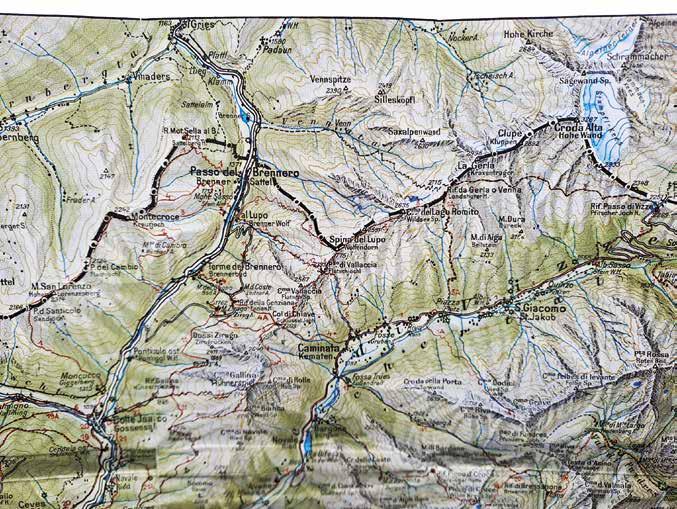
deutschsprachigen Presse führten zu einem raschen Einbruch der Besucherzahlen. Nur vereinzelt wagten noch Touristen den Aufstieg zur einst so beliebten Landshuter Hütte. Der Vorstand der Sektion Landshut entsandte 1927 den Rechtsanwalt Bücherl, der in einer Aussprache mit dem Kommandanten der Finanzbrigade in St. Jakob in Pfitsch erreichte, dass jener Teil des Landshuter Höhenweges vom Pfitscher Joch bis zur Landshuter Hütte für Alpintouristen aus Deutschland zumindest teilweise freigegeben wurde. Zudem wurde vereinbart, dass die italienische Besatzung –diese verfügte in unmittelbarer Nähe der Hütte über kein Wasser – dieses unter der Schutzhütte in rund 20 Minuten Gehzeit auf österreichischem Boden entnehmen konnte, wohingegen italienischerseits den Touristen keine Schwierigkeiten mehr im kleinen Grenzverkehr gemacht werden sollten. So war ab nun auch wieder der Aufstieg zum Kraxentrager für Touristen aus Deutschland möglich.
Um den Hüttenbesuch doch wieder etwas zu beleben, entstand unter Vorschlag des Schriftfüh-
rers der DAV Sektion Landshut, Georg Geistbeck, die Idee, auf ös terreichischem Boden einen zwei ten Zugang zur Landshuter Hütte zu schaffen. Dieser wurde ange legt und führte von Innervals zur Zeischalm, über die Säg- und Hohe Wand zum Kraxentrager und im Abstieg zur Landshuter Hütte. Damit war die Verbindung zur Geraer Hütte und weiter ins Zillertal wiederhergestellt. Zu Ehren des Gedankengebers wur de der etwas anspruchsvolle Bergsteig 1928 „Geistbeckweg“ getauft.
Noch 1928/29 konnte unter der Leitung von Hüttenwirt Gschwendtner ein weiterer Zu bau errichtet werden, welcher der Sektion Landshut auf 4.721 Reichsmark zu stehen kam.
Die Toponomastik

Die italienische Regierung und die ortsansässigen politischen Vertreter erkannten den Schaden, der durch das Fernbleiben vieler deutschsprachiger Alpintouristen entstanden war. Daher bemühten sich italienischsprachige Werbeträger, Urlauber im norditalienischen Raum für einen Südtirol-Besuch neu anzusprechen. Erstmals entstanden so Gebietsführer für ganz Südtirol in italienischer Sprache (20 Neuauflagen). In diesem Rahmen verfasste Carlo Viesi aus Auer den kleinen Führer Nr. 15, der den Wipptaler Raum beschreibt. Die Verfasser konnten bei dieser Arbeit auf höchste staatliche Unterstützung setzen. Damit einher ging auch die Umsetzung nationalistisch faschistischen Gedankengutes: Alle Südtiroler Orts- und Flurnamen erschienen erstmals offiziell ins Italienische übertragen.
Diesen Geist gibt in der Einlei-
EineigenerGartenlst ein StückParadiesaufErden.WerihmZeitund Zuwendungschenkt.w,rd reich belohnt:Schonauf engstemRaum gedeihenBlumen.Kräuter.Früchteund Gemüse- ein Genussfür AugenundGaumen Schickt uns innerhalb15. Septemberein Foto von eurem scheinen Garten(bille Vor-und Zunamesamt Telefonnummerund/oder E„Mail-Adresseund den Wohnortangeben;es wfrd eine Einsen• dung pro Personberücksichtigt)an barbarafontana@dererker,it. Oieersten30Fotos.dieunserreichen.werdenwir im Oktober-Erker veroffenllichen.Ander Verlosungnehmenalle Einsendungenteil
Unttr alten Teilnehmern verlosen wir tolle Preise. Sie werden kontaklierlundkönnenihrenPreis in der Erker-Redaktionzu Bürozeiten abholen.

Carlo Viesi, Sulla via del Brennero. Vipiteno e Colle Isarco, Rom 1925
tung zum Wipptaler Ortsführer im Jahr 1925 der Autor Carlo Viesi wieder, wenn er schreibt:
„Con la vittoria che ha riportato la gloriosa bandiera della Patria sui termini sacri, un nuovo soffio di vita è penetrato tra queste estreme valli montane. E dalla pianura padano, dalle cento cittá, dalle regioni lontane risalgono i cittadini d´Italia a vedere le belle terre, a godere le balsamiche arie di questa zona terminale alla grande Catena alpina, che Dio ed il valore dei nostri soldati hanno ridato alla Nazione per la sua sicurezza e per la sua unitá.“ („Mit dem Sieg konnte die glorreiche Fahne des Vaterlandes an die heilige Grenze getragen werden, ein neuer Lebenshauch ist in diese extremen Bergtäler eingedrungen. Und die Italiener der padanischen Ebene, der hunderten italienischer Städte und der weiter südlichen Regionen mögen dieses schöne Gebiet aufsuchen, die heilsame (‚balsamische’) Luft in diesem Grenzgebiet an der Alpenhauptkette in sich aufnehmen, diese hat Gott und haben unsere tapferen Soldaten der Nation zu ihrer Sicherheit und zu ihrer Einheit wiedergegeben.“). Ein Vergleich der geographischen Karten für das hier besprochene Gebiet zeigt vor dem Ende des Ersten Weltkrieges die deutschsprachige Toponomastik und die deutschsprachige und italienische Version von 1925. Der nationalistisch gesinnte Ettore Tolomei, der noch während des Ersten Weltkrieges (1916) alle Südtiroler Orts- und Flurnamen ins Italienische übertrug, diente dem Autor Carlo Viesi als Vorlage. Folgende Benennungen erscheinen im hier besprochenen Gebiet erstmals in deutscher und italienischer Sprache:
Hohe Wand =
Croda Alta (Ettore Tolomei)
Kluppen = Clupe (Ettore Tolomei)
Kraxentrager = La Gerla (Ettore Tolomei)
Landshuter Hütte = Rifugio da Gerla o Venna (Ettore Tolomei; im Grundbuch der Katastralgemeinde Pfitsch scheint nur die Bezeichnung Vennahütte auf)
Wildseespitze = Cima del Lago Romito (Ettore Tolomei)
Wolfendorn = Spina di Lupo (Ettore Tolomei)
Die turbulenten 1930er Jahre
Die gute Instandhaltung der Landshuter Hütte war für die DuÖAV Sektion Landshut auch weiterhin ein großes Anliegen. Ein freudiges Fest stand im Frühjahr 1931 an. 27 Mitglieder des Vereins fuhren am 27. Juni mit einem Bus bis zum Brenner, von wo aus sie am nächsten Tag den Aufstieg über das Venntal zur Landshuter Hütte unternahmen. Auf dem Weg dorthin wurden sie in Venn von den Hüttenwirten Gschwendtner und Hartmann mit Böllerschüssen und Musik empfangen. Noch am selben Tag erfolgte die Eröffnung des nach den Plänen von Architekt Schmittinger errichteten neuen Nebenbaues an der Schutzhütte mit Erdgeschoss, Mulistall, Waschküche, Vorratsraum und Schlafraum mit sieben Lagern. Die Arbeiten waren ein Gemeinschaftswerk der Hüttenwirte und des Schriftführers Georg Geistbeck von der Landshuter Sektion.
Für den Sommer 1931 meldet der Hüttenwirt Gschwendtner, dass der Besuch wegen schlechten Wetters und den weiteren
Behinderungen durch die italienischen Grenzbeamten auf dem Höhenweg sehr beeinträchtigt war. Gut verlief hingegen der Sommer 1932.
1933 brach die Besucherzahl aus dem Deutschen Reich abrupt ein. Die deutsche Reichsregierung verordnete im Mai 1933 die sogenannte „TausendMark-Sperre“, wonach jeder deutsche Staatsbürger, der nach Österreich einreisen wollte, eine Gebühr von 1.000 Reichsmark zu entrichten hatte. Dieser Erlass erfolgte wegen der Gegnerschaft Österreichs gegen das nationalsozialistisch ausgerichtete
Deutsche Reich. Die Folgen für den österreichischen Fremdenverkehr waren verheerend. Die Auswirkungen beklagte auch der Hüttenwirt auf der Landshuter Hütte.
Im nicht allzu weit entfernten Zillertal vermerkte Pfarrer Josef Krapf in Mayrhofen: „Infolge der Tausend-Mark-Sperre hat die Zahl der Fremden derart abgenommen, dass sie in den letzten Jahren auf 20 Prozent gesunken ist. Der größere Teil der ausschließlich für den Fremdenverkehr vorbereiteten Zimmer blieb unbenützt. Viele Häuser waren den ganzen Sommer über hindurch leer.“
Trotz Ausbleibens der Gäste aus dem Deutschen Reich vermeldet Hüttenwirt Gschwendtner 1935, dass er die Landshuter Hütte länger als sonst im Herbst wegen des guten Besuches bewirtschaften werde. Wie ist es dazu gekommen?
Der Tuxer Hauptkamm war für die italienische Regierung – wie das gesamte Brennergebiet –von Anfang an eine Militärzone („zona militare“). In den 1930er Jahren, besonders zwischen 1935 und 1936, setzte eine ver-
stärkte, geheim gehaltene und militärisch ausgerichtete Bautätigkeit entlang der Brennerlinie ein. Auf beiden Anhöhen des Passtales ließ Diktator Benito Mussolini höchstpersönlich neue, für die Zivilbevölkerung gesperrte Militärstraßen errichten. Ähnlich dem deutschen Westwall sollte am Brenner eine Sperrlinie für eventuelle Angriffe aus dem Norden aufgebaut werden („Valle Alpino del Littorio“ – „Linea Badoglio“).
In diesen Plan wurde auch das Pfitschertal mit seinen Übergängen mit einbezogen. So erbaute das italienische Militär 1934/35 die Militärstraße von Fussendrass auf das Schlüsseljoch; ebenso wurde der bestehende Saumpfad von St. Jakob bis zum Pfitscherjoch zur Militärstraße ausgebaut. 1935 waren an die 50 Soldaten vom Militärregiment beim Ausbau beschäftigt. Diese zumeist aus dem Süden Italiens rekrutierten Soldaten waren die besten Gäste im österreichischen Teil der Schutzhütte; besonders an den Wochenenden füllten feiernde Soldaten die Gaststube, und dies bis in den Spätherbst 1935 hinein.
Nach der Fertigstellung der Militärstraßen kehrte wieder Ruhe in der Landshuter Hütte ein. Weder Gäste aus dem Deutschen Reich noch italienischsprachige Gäste besuchten jetzt die Landshuter Hütte. 1938 blieb sie erstmals ganzjährig geschlossen –und so blieb es bis 1945.

„Blitzlicht”, 26. Juni 2025, 17.11 Uhr © Roland Wagner
Schönes Unsichtbares
Pfammes am Eingang des Pfitschtales

Pfammes – lieblich und seit langem unberührt, ein Platz im Dornröschenschlaf. Hinter jeder Ecke gibt es etwas Schönes zu entdecken und zu erwecken.
Diesem Platz zu begegnen, der für mich unbekannt ist, erweckt in mir eine kribbelige Vorfreude. Beim Gehen übe ich mich in der Kunst, „erwartungslos“ zu sein. Denn etwas Neues kann ich am besten sehen, wenn ich ohne Vorstellung bin.
Die Erweiterung meiner Komfortzone ist Voraussetzung, damit ich diesem „Neuen“ begegnen kann. Hier betrete ich einen Raum in der Natur, der zugleich auch ein Raum in mir ist. Selbst gedachte Grenzen zu überschreiten, ist Horizonterweiterung.

Das Erkunden des Platzes gibt mir Orientierung, es ist wie ein gemeinsames Herantasten und Kennenlernen. Durch diese Berührung beginnt die Lebendigkeit spürbar zu werden, die Energie kommt somit auch durch mich an die Oberfläche. Das ist gegenseitiges Erwecken.
Es sind immer auch unentdeckte Potentiale, die der Ort widerspiegelt. Ist das überall der Fall? Ja, die Neugierde und die Offenheit, sich berühren zu lassen, öffnen oft unsichtbare Türen.
Wo kannst du deine Komfortzone erweitern, um etwas „Neues“ für dich zu entdecken und zu erwecken?
40 Jahre Öffentliche Bibliothek Stilfes

Im August begeht die Öffentliche Bibliothek Stilfes ihr 40-jähriges Bestehen – ein Meilenstein für eine Einrichtung, die sich seit vier Jahr zehnten der Förderung von Bildung und Kultur widmet und die Lesekompetenz und die Freude am Lesen fördert.
Der Grundstein für den Bibliotheksbetrieb wurde 1985 mit der Bildung des „Bibliotheksrates der Volksbibliothek Erzpfarre Stilfes“ gelegt. Entscheidende Impulse lieferte das 1983 in Kraft getretene „Weiterbildungs- und Bibliotheksgesetz“, das die rechtliche und institutionelle Grundlage für den systematischen Aufbau öffentlicher Bibliotheken in Südtirol schuf.

Heute setzt sich der Bibliotheksrat aus Dekan Christoph Schweigl als gesetzlichem Vertreter, der Vorsitzenden Alexandra Gspan Thaler, Vertretern von Gemeinde und Schule sowie den Bibliotheksleiterinnen Christine Wieser (Stilfes), Claudia Ainhauser (Trens) und Viviana Penz (Mauls) zusammen. Der Rat ist im Auftrag des Trägers für die organisatorische und inhaltliche Ausrichtung der Bibliothek verantwortlich. Der Hauptsitz in Stilfes sowie die Zweigstellen in Trens und Mauls bilden gemeinsam ein ehrenamtliches Bibliothekssystem, das durch großes Engagement und breite lokale Verankerung geprägt ist. Die drei Bibliotheken verfügen über einen vielfältigen Bestand an Büchern, Zeitschriften, Spielen, CDs und DVDs.
anstaltungen realisiert werden. ten zählen u. a. Buchvorstellungen mit Historiker Oswald Überegger, die Präsentation der Jahreschroniken der Gemeinde Freienfeld in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt sowie Abschlussveranstaltungen zum Sommerlesepreis, wie das „Kino unter freiem Himmel“ gemeinsam mit dem Bildungsausschuss. Bereits 2010 wurde das Bibliothekssystem erstmals zertifiziert, im Frühjahr 2024 wurde das sechste Wiederholungsaudit erfolgreich abgeschlossen. Dies bestätigt den kontinuierlichen Einsatz für Qualität, Innovation und eine zukunftsgerichtete Bibliotheksentwicklung. Die Bibliothek Stilfes nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, zurückzublicken, aktuelle Herausforderungen zu reflektieren und zugleich neue Perspektiven zu eröffnen. Die Feierlichkeiten finden am 8. August um 20.00 Uhr im Innenhof des Widums in Stilfes statt. Das Programm umfasst einen Auftritt des bekannten Poetry Slammers Nathan Laimer, der mit sprachlicher Finesse und feinem Humor begeistert. Eine Fotoschau gewährt Einblicke in die bewegte Geschichte der Bibliothek, während ein Blechbläserquartett für den musikalischen Rahmen sorgt.
Im Anschluss an das offizielle Programm lädt die Bibliothek zu einem Jubiläumsumtrunk.
Rita Thaler Wieser
Im Zeichen von Alexander Langer
Im August finden in der Casarci in Sterzing zwei besondere literarische Veranstaltungen statt, die von zwei spannenden Stimmen der italienischen Kulturlandschaft getragen werden.
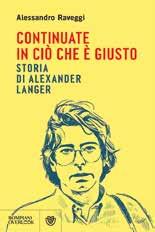
Am 21. August (18.00 Uhr) stellt Alessandro Raveggi im Gespräch mit Andrea Bovo seine neue Biografie „Continuate in ciò che era giusto. Storia di Alexander Langer“ vor. Dreißig Jahre nach dem Tod von Alexander Langer, der in Sterzing geboren wurde, zeichnet das Buch das Leben eines Hoffnungsträgers nach: Pazifist, Umweltschützer und Mitbegründer der italienischen Grünen. Raveggi, Schriftsteller und Essayist aus Florenz, lädt dazu ein, den Geist Langers und seine Botschaft von Hoffnung und gesellschaftlichem Engagement neu zu entdecken. Ebenfalls in der Casarci präsentiert Francesca Melandri am 28. August (18.00 Uhr) ihren neuen Roman „Piedi freddi“. Die Autorin, bekannt für erfolgreiche Romane wie „Eva schläft“, „Über Meereshöhe“ und „Alle außer mir“, nimmt das Publikum mit auf eine Reise zwischen familiärer Erinnerung und europäischer Geschichte. Sie verknüpft die Tragödie des Russlandfeldzuges ihres Vaters mit den heutigen Bildern des Krieges in der Ukraine. Der Abend wird von Karin Hochrainer moderiert und bietet zudem die Gelegenheit, weitere Werke von Melandri kennenzulernen, die in viele Sprachen übersetzt und international geschätzt werden.
Beide Veranstaltungen werden gemeinsam von der Stadtbibliothek Sterzing, Arci Vipiteno und dem Verein „il Telaio“ aus Bruneck organisiert. Der Eintritt ist frei.
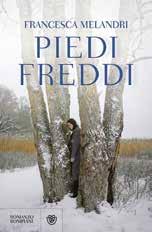
Neue Klimaüberwachung für das Bergbaumuseum
Am Museumsstandort Ridnaun des Landesmuseums Bergbau wurde vor kurzem eine neue automatische Anlage zur Überwachung der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit installiert. Dadurch wird die Sicherheit der Museumsobjekte erheblich erhöht.
Das Landesmuseum Bergbau bemüht sich seit mehreren Jahren, die k onservatorischen Bedingungen für die zahlreichen Mu seumsobjekte nach haltig zu verbessern. Nach der Errichtung eines neuen, klima tisierbaren Depot raums und der Aus stattung einiger größerer Vitrinen mit Klimageräten folgt nun ein weite rer wichtiger Schritt: Mit Mitteln aus dem Nachtragshaushalt 2024 wird derzeit ein modernes, auto matisiertes Über wachungssystem für Raum temperatur und Luftfeuchtigkeit installiert. Es ersetzt die teilweise veralteten analogen Geräte und sorgt für einen erheblichen Sicherheitsgewinn. Das neue System überwacht sowohl die Depoträume als auch die Ausstellungsbereiche, speichert die erfassten Daten zentral und meldet Abweichungen sofort, sodass bei Bedarf umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Nach einer detaillierten Auswertung der Daten kann die Museumsverwaltung in den kommenden Monaten über weitere Optimierungsmaßnahmen zur verbesserten Konservierung der Objekte entscheiden.
Bergbau umfassen mehrere zehntausend Objekte aus unterschiedlichsten Materialien, darunter Bergbauakten, Fotos, Pläne, Werkzeuge, Maschinen, Mineralien und Gesteine und Alltagsgegenstände aus dem Besitz von Bergarbeitern und Arbeiterinnen. Besonders fragile Materialien wie Spezialpapiere, Textilien, Holzobjekte oder beschichtete Oberflächen reagieren empfindlich auf Temperaturschwan-

kungen und Luftfeuchtigkeit. Deshalb ist eine präzise Klimaüberwachung essenziell.
Eine der Hauptaufgaben eines jeden Museums ist es, die Objekte in seinen Sammlungen zu inventarisieren, katalogisieren und fachgerecht zu lagern, um sie für die nächsten Generationen zu erhalten. Das Landesmuseum Bergbau bewahrt damit wertvolle Zeugnisse der jahrhundertealten Bergbautradition Südtirols. Diese Objekte stehen nicht nur für Forschungsarbeiten und Ausstellungen zur Verfügung, sondern können auch im Rahmen von Sonderführungen in den Depots von der Öffentlichkeit besichtigt werden.
Die Sammlungen des Landesmuseum

Das Rücksiedlerhaus in Sterzing
von Karl-Heinz Sparber
Am 8. Februar 1952 verkaufte Sebastian Hofer aus Sterzing sein Grundstück (eine 2.873 m² große Wiese, im Grundbuch als Grundparzelle 659/4 „Auf Villa“ in der Katastralgemeinde Thuins registriert) an die Provinz Bozen. Der damalige Landeshauptmann Dr. Karl Erckert hatte den am 20. September 1951 vereinbarten Kaufpreis von 1.723.800 Lire (zum Quadratmeterpreis von 600 Lire) bereits an den Verkäufer ausbezahlen lassen. Das Land plante hier (auf der neu errichteten Bauparzelle 130) den Bau von zwölf Wohnungen für die Rücksiedlerfamilien, die im Zuge der Option von 1939 ausgewandert waren. Angesichts der katastrophalen Wohnungsnot in den ersten Nachkriegsjahren und der großen Nachfrage der vielen obdachlosen Rücksiedler war der Landesausschuss Bozen gezwungen, möglichst viel Wohnraum zu errichten. Der Sterzinger Bau war
eines der ersten Bauvorhaben dieser Art und es sollten noch weitere in Meran, Brixen und Bozen folgen.
Am 2. Oktober 1953 genehmigte der Landesausschuss den Bau und die Finanzierung des Wohnhauses für Rücksiedler und schon am 28. August 1954 stand der Rohbau, den die Firma Borona in Rekordzeit errichtet hatte. Die Firstfeier fand im Gasthof „Lilie“ in der Neustadt in Anwesenheit von zahlreichen Persönlichkeiten und 35 Arbeitern statt. Gekommen waren Bürgermeister Hans Saxl, Obmann des Rücksiedlungsausschusses Altbürgermeister Josef Oberretl, Landesbauamtsleiter Ingenieur Leonardi, Bauleiter und Planer Ingenieur Minarik, Baufirmeninhaber Cavaliere Borona, der zur Firstfeier samt Essen eingeladen hatte, und der Leiter des Amtes für Rücksiedlungshilfe Dr. Wilfried Plangger, der von den zahlreichen Schwierigkeiten beim
Bau des gelungenen Wohnhauses berichtete. Im Anschluss an die Firstfeier fand eine Begehung der Baustelle und des Rohbaues statt.
Die Einweihung
Der Sterzinger Dekan Johann Corradini nahm am 1. Juli 1955 die feierliche Einweihung des neuen Rücksiedlerhauses vor. Landeshauptmann Karl Erckert war persönlich erschienen und gab einen kurzen Rückblick über die Tätigkeiten der Rücksiedlungshilfe. Er selbst hatte 1939 zwar für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert, musste der tatsächlichen Umsiedlung allerdings nicht Folge leisten. 1943 wurde er zum kommissarischen Bürgermeister von Meran ernannt. In seine Amtszeit als Landeshauptmann fiel der Wiederaufbau der Infrastruktur des Landes, wobei der Bau von Unterkünften für die
Rücksiedler, die aus dem zerstörten Deutschen Reich nach Südtirol zurückkehrten, eine besondere Herausforderung darstellte. Er versuchte auch stets zwischen den Optanten und den Dableibern zu vermitteln. In seiner Rede betonte er nicht ohne Stolz, dass der Sterzinger Bau der erste größere Rücksiedlerwohnbau im Land sei, der mit Landesmitteln finanziert wurde. Die Baukosten für die 17 Wohnungen beliefen sich auf rund 45 Millionen Lire. Bürgermeister Hans Saxl bedankte sich nach der Einweihung sehr herzlich beim Landeshauptmann für die großzügige Bereitstellung der finanziellen Mittel und beim Fraktionsvorsteher von Thuins Josef Inderst (das Haus stand auf Thuiner Grund).
Der Obmann des Gesamtverbandes der Südtiroler in Österreich (GVS) Dr. Rudi Schlesinger war mit einigen Mitarbeitern nach Sterzing gekommen und sprach
Das Rücksiedlerhaus steht seit 70 Jahren.


Das Sterzinger Wappen von Heiner Gschwendt an der Ostseite Die Sgraffitos (Sinnspruch und Sterzinger Wappen) stammen von Heiner Gschwendt.
in seiner Dankesrede über das ge lungene Werk und im Anschluss daran über die vielen Nöte und Sorgen der Südtiroler in Öster reich. In Tirol waren seit 1940 in 22 Gemeinden Siedlungen für Südtiroler Umsiedler errichtet worden. In jedem Bundesland gab es Südtiroler-Verbände, an die sich die Rückoptanten ab 1948 wenden konnten.
Die Behörden und Gäste nahmen anschließend eine eingehende Besichtigung des Hauses vor. Dazu mussten sie das Riesenbachl noch über eine kleine Brücke überqueren. Bewundert wurden sowohl die landschaftlich ansprechende Bauform als auch die gelungene Ausgestaltung der lebensgroßen Sgraffito-Figuren (in Zement gegrabene und dann bemalte Wandbilder) an der Nordseite des Gebäudes und des Sterzinger Wappens an der Ostseite durch den Klausner Künstler Heiner Gschwendt. Sinn und Zweck des Hauses ist in dem Spruch festgehalten: „Dieses Haus wurde vom Landesaus-
schuß Bozen im Jahre 1955 erbaut, um Südtiroler Rücksiedlern eine Heimatstatt zu geben.“
Zum Abschluss der Feier waren auch einige Rücksiedlerfamilien erschienen, die noch am gleichen

Einer der zwei Gemeinschaftsräume ist heute Waschraum für sieben Mieter.
Tag die ihnen zugewiesenen Wohnungen zu beziehen gedachten. Mit Ergriffenheit und Genugtu-
Riesenbachl: Das Riesenbachl (das Wort „Ries“ bedeutet „Geländerinne“, „Riss zum Holztreiben“) fließt von Thuins herunter vorbei am Rücksiedlerhaus und ist normalerweise ein unscheinbares Bächlein. Beim Bau der Brennerautobahn 1966 wurde das Wasser in einen Betonstollen gezwängt und unterquert seither die Autobahn. Bei starkem Regen und vor allem bei Hagel kann sich das Rinnsal gefährlich aufstauen und so wie am 4. November 1966 großen Schaden anrichten. Das Regenwasser staute sich vor dem Rücksiedlerhaus, wo es in eine Röhre mit 60 cm Durchmesser fließen sollte, doch das mitgeführte Baumaterial riss einen zwei Meter tiefen Graben auf und bedrohte sogar den Sterzinger Pfarrwidum. Die St. Margarethenstraße wurde arg beschädigt und im Zuge der geplanten Regulierung des Riesenbachls 1968 erweitert. Das Riesenbachl war gleichzeitig die Gemeindegrenze zwischen Sterzing und der Altgemeinde Thuins (dazu gehörten die Ortsteile Vill, Vals an der Lahn und Unterackern), die 1931 mit der Gemeinde Sterzing zusammengelegt wurde.
ung übernahmen sie die Schlüssel für ihr neues, aber noch nicht eingerichtetes Heim. Die damalige Hausordnung war sehr restriktiv. So mussten beispielsweise die Ruhezeiten (12.30 – 15.00 Uhr, 22.00 – 8.00 Uhr) eingehalten werden, Teppichklopfen vom Balkon aus war verboten, ebenso Wäsche und Kleider an den Fenstern sichtbar aufzuhängen, „um das architektonische Gefüge des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen“. Wäschewaschen war nur in der Waschküche im Kellergeschoss erlaubt. Die Reinigung der Gemeinschaftsflächen musste von den Mietern turnusweise gewissenhaft durchgeführt werden. Jede Partei musste das Treppenhaus bis zum darunterliegenden Stock reinigen. In zwölf Artikeln wurde praktisch alles geregelt, was entweder verboten oder gestattet war.
Der heutige Bestand
Das „Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol“ hat mit der Übergabeurkunde vom 17. Dezember 1999 das gesamte Gebäude von der Provinz Bozen übernommen und verwaltet seither das „Rücksiedlerhaus“. Bereits im Jahr 1983 war das Haus in 16 materielle Anteile aufgeteilt worden. Alle Wohnungen verfügen über zwei bis drei Zimmer samt Küche, Gang, Abstellraum, Bad-WC, WC-Vorraum und WC. Jede der jeweils vier Wohnungen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Stock hat auf der Südseite einen kleinen Balkon. Dazu kommen für
jede der 16 Wohnungen noch Gemeinschaftsanteile: Stiegenhaus, Gang, Waschraum, Hofraum, Fahr- und Motorradabstellplatz, Stiege, Eingang, Autostellplatz und Kamin.
Im Dachgeschoss sind schließlich noch zwei Wohnungen untergebracht; zudem stehen zwei Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Im Kellergeschoss sind 14 Keller und zwei Wohnungen.
Im vergangenen Jahr wurde das gesamte Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Das 70 Jahre alte Gebäude ist jedoch nicht barrierefrei und hat keine Aufzüge. Dieser Umstand macht vor allem den älteren Bewohnern des Hauses zu schaffen. Anfangs gab es noch einen Hausmeister, der sich um den Innen- und Außenbereich kümmerte, doch mit dem Tod von Albert Tavernini ging auch diese Ära zu Ende. Das gleich alte Rücksiedlerhaus in Brixen ist in diesem Jahr mustergültig saniert worden; vor allem wurden zwei große, außenseitige Aufzüge errichtet, was die Wohnqualität bedeutend steigert.
Rücksiedlungsausschüsse in Südtirol
Bis 1952 hatten sich in Südtirol 40 Hilfsorganisationen gebildet, die sogenannten Rücksiedlungsausschüsse. Mitglieder waren Vertreter der Geistlichkeit und der Gemeindeverwaltungen, aber auch hilfsbereite und opferwillige Privatpersonen, die den zahlreichen Rücksiedlern bei der
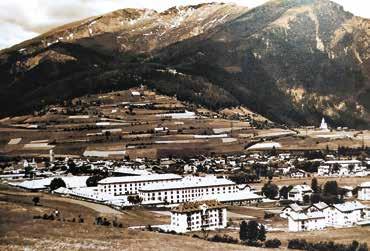
Eingliederung in die Arbeitswelt behilflich waren und vor allem bei der Unterbringung in Wohnungen beistanden. Die rascheste und billigste Möglichkeit der Wohnraumbeschaffung war der Ausbau von bestehenden Gebäuden. Eine durchschnittliche Ausbauwohnung mit zwei Zimmern und einer Küche kostete rund 530.000 Lire. Im Vergleich dazu kostete eine der 17 Neubauwohnungen im Sterzinger Rücksiedlerhaus 2.500.000 Lire, also ungefähr fünfmal so viel. In Sterzing versuchte der Rücksiedlungsausschuss unter Obmann Josef Oberretl (Mitglieder Kiebacher und Knollenberger) verzweifelt, günstige Ausbaugelegenheiten ausfindig zu machen; schließlich entschied man sich für den Neubau in der St. Margarethenstraße.
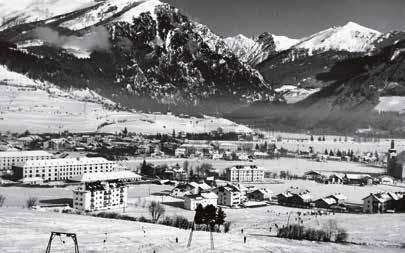
Amt für Rücksiedlungshilfe an Optanten
Die Südtiroler Optanten im Ausland hatten ab Inkrafttreten des Optantendekrets am 5. Februar 1948 ein Jahr lang Zeit (also bis zum 4. Februar 1949), um für die Wiederverleihung der italienischen Staatsbürgerschaft anzusuchen und damit legal zurückzukehren. Seit Kriegsende 1945 kehrten schätzungsweise 8.000 bis 12.000 Personen auf illegalem Weg über die sogenannte „grüne Grenze“ nach Südtirol zurück. Es wird vermutet, dass es einen organisierten Menschenschmuggel über den Brenner gegeben habe. Meist kamen diese illegal Eingereisten bei Verwandten oder Bekannten an ihrem ursprünglichen Heimatort unter

und erfuhren kaum Probleme im Umgang mit den italienischen Behörden. Das neu gegründete Amt für Rücksiedlungshilfe an Optanten unterstützte ab 1949 die etwa 10.000 bis 12.000 ausgewanderten Südtiroler Optanten erfolgreich bei ihrer legalen Rückkehr und Reintegration in die alte Heimat. Der erste Leiter des Amtes für Rücksiedlungshilfe war SVP-Landessekretär Wilfried Plangger. Er optierte 1939 für das Dritte Reich, wanderte jedoch nicht aus und fand 1940 eine Anstellung bei der „Arbeitsgemeinschaft der Optanten“ (ADO), die ins Leben gerufen wurde, um die Aussiedelung der Südtiroler Optanten zu organisieren. Diese Organisation hatte 577 Angestellte. Verglichen dazu war das Amt für Rücksiedlungshilfe in Bozen 1949 mit maximal 25 Mitarbeitern relativ bescheiden bestückt. 1957 wurde das Amt aufgelöst. Die Organisation war zuständig für zahlreiche direkte Hilfeleistungen:
• Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Rückoptanten,
• Beschaffung von Wohnraum,
• Bearbeitung von persönlichen Anfragen von Rückoptanten.
• Organisation des Empfangs der Rücksiedlertransporte aus Deutschland (insgesamt 13 bis 1951) an den Bahnhöfen Brenner und Bozen. Die Mitarbeiter der Außenstelle Brenner kümmerten sich um den Grenzübertritt der Rückoptanten. Bei der Ankunft in Bozen wurden sie
von Wilfried Plangger, SVP-Politikern sowie Angehörigen und einem Damenkomitee empfangen.
• Erfassen der Rückoptanten durch Karteikarten.
• Organisation von Weihnachtsfeiern in Rücksiedlerheimen sowie einer Ferienkolonie für Kinder.
• Finanzielle Beihilfen für Rückoptanten wurden sowohl vom österreichischen Staat als auch vom Amt für Rücksiedlungshilfe in Bozen (30 Millionen Lire im Jahr 1949) vergeben.
• Soforthilfe beim Wiedererwerb der italienischen Staatsbürgerschaft und bei Ansuchen um Familienzusammenführungen.
• Durchgangsheime in Brixen, Meran und Blumau: Obdachlose Rückoptanten konnten darin kostenlos wohnen; Berufstätige mussten einen kleinen finanziellen Betrag entrichten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer reichte von einigen Tagen bis hin zu Jahren. 1959 wurden alle Durchgangsheime geschlossen.
• Bis Juni 1950 bildeten sich in 37 Gemeinden Hilfsausschüsse. Unterstützung der Rückoptanten bei der Wohnungssuche.
• Besorgung von Einrichtungsgegenständen.
• Ausspeisung von bedürftigen Rückoptanten.
• Außerdem organisierten die Hilfsausschüsse Geld- und Sachspenden.
Das Rücksiedlerhaus („Casa degli optanti“) nach der Einweihung 1955
Das Rücksiedlerhaus um 1960 von der „Sternwiese“ aus gesehen (links unten)
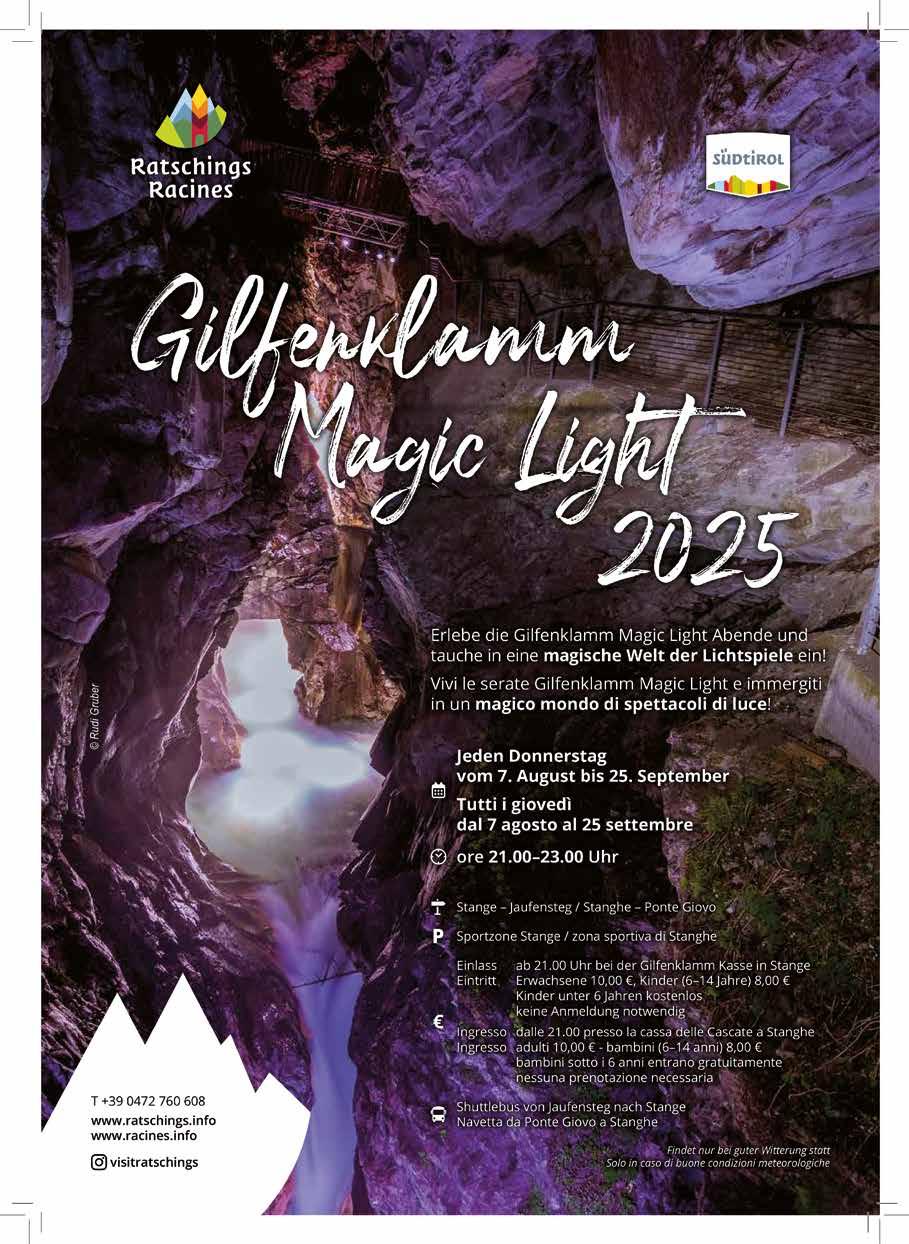
“Scelte decisive per il futuro”
Durante la seduta di giugno, il Consiglio comunale di Vipiteno ha approvato a maggioranza il documento programmatico del sindaco Peter Volgger. Come previsto, non sono mancate critiche da parte dell’opposizione, ma anche da alcuni membri della stessa maggioranza.
“Siamo stati eletti per amministrare la città di Vipiteno nei prossimi cinque anni. Di fronte alle sfide e alle opportunità che ci attendono, siamo determinati a tracciare un percorso sostenibile per il futuro della nostra città”, ha affermato il sindaco Peter Volgger durante la presentazione del documento programmatico. Il piano di sviluppo comunale riveste, secondo lui, un ruolo centrale, in quanto non rappresenta solo uno strumento strategico, ma anche una guida che fissa gli obiettivi per i prossimi 15-20 anni. “Sta a noi lavorare insieme per mantenere la qualità della vita e il tenore di vita raggiunti a Vipiteno, e possibilmente migliorarli”. Anche nei prossimi anni, però, i margini finanziari resteranno limitati. “Tuttavia, i successi degli ultimi quattro anni e mezzo ci infondono fiducia – ha proseguito Volgger –. Se siamo riusciti a ottenere buoni risultati in tempi difficili, siamo convinti che potremo farcela anche in futuro. Non contano solo i numeri, ma anche la passione e la coesione del nostro team. Sfruttiamo insieme le opportunità che questa collaborazione ci offre e presentiamo Vipiteno come una città vivibile, culturalmente ricca e forte dal punto di vista economico!” Con queste parole, il dibattito ha preso il via.
Werner Graus ha espresso una critica decisa al documento programmatico, giudicandolo carente di idee e di ambizione innovativa. Lo ha definito una “copia ampliata” del documento del 2020, contenente molte promesse non mantenute. Secondo Graus, il programma si limita a riportare “principi” e “valori” che dovrebbero essere ovvi e il cui ribadimento risulta superfluo. Questo, a suo dire, lascerebbe intendere che il benessere dei cittadini in passato non sia stato considerato una priorità. Graus ha poi evidenziato contraddizioni in punti concreti che, secondo lui, metterebbero a rischio lo sviluppo della città. Ha criticato l’intenzione di preservare il suolo edificabile pur

incentivando la costruzione di case unifamiliari. Inoltre, ha bocciato il piano di riduzione dei parcheggi in centro, definendolo dannoso per l’economia locale e poco realistico, dato che renderebbe più difficile il collegamento con i comuni limitrofi. Mancano, secondo lui, idee innovative nei settori del turismo, dell’economia e della digitalizzazione. Per quanto riguarda l’amministrazione comunale, Graus ha espresso dubbi sull’efficacia della gestione del personale e sulla disponibilità al confronto, evidenziando l’uscita di due figure dirigenziali. Ha definito poi “ripetitiva” la richiesta di stabilire priorità finanziarie, già contenuta nel documento del 2020, senza che negli ultimi cinque anni si siano visti risultati significativi. Ha inoltre chiesto la riduzione delle tariffe per l’acqua potabile, le acque reflue e i rifiuti, ritenute troppo alte. A tal proposito ha sollecitato l’attuazione del progetto – esistente dal 2012 – per la ristrutturazione della rete fognaria e la transizione a un sistema separato. In ambito ambientale e dei trasporti, Graus ha bocciato lo spostamento dei parcheggi fuori città, ritenendolo inefficace sia per rafforzare l’economia che per rivitalizzare il centro. Mancano, secondo lui, piani concreti per la realizzazione dei nuovi parcheggi e per un’area campeggio. Temi come mobilità, elettromobilità e illuminazione pubblica non sarebbero sufficientemente trattati, nonostante la necessità di interventi urgenti per la sicurezza di pedoni e ciclisti.
Anche per quanto riguarda le opere pubbliche, come la nuova caserma dei vigili del fuoco, la riqualificazione della pista per skater e la progettazione del palaghiaccio, Graus ha denunciato l’assenza di progressi rispetto a quanto previsto già nel documento precedente. Ha poi lamentato che la creazione di un consiglio giovanile, promessa dal 2020, non sia ancora avvenuta. Lo stesso vale per il piano di sviluppo della zona sportiva.
Anche Evi Frick (SVP) ha criticato il documento programmatico, definendolo poco innovativo e superficiale. Ha sottolineato una gestione troppo rigida del personale comunale, priva di strumenti moderni per rendere l’amministrazione un datore di lavoro attrattivo. In ambito finanziario, ha riscontrato la mancanza di stru-
menti adeguati di controllo e analisi dei costi. Per quanto riguarda la politica economica, Frick ha affermato che il documento ignora le sfide attuali, come il cambiamento demografico. Gli incontri con i rappresentanti del mondo economico ogni tre o sei mesi sarebbero insufficienti per “guardare oltre il proprio orticello”. Nei progetti edilizi pubblici mancherebbero riferimenti a iniziative importanti e alla gestione delle strutture comunali.
I capitoli dedicati a famiglia e scuola sarebbero, secondo Frick, troppo generici e poco approfonditi. Per quanto riguarda i giovani, manca il collegamento del consiglio giovanile con temi centrali come la digitalizzazione e la prevenzione sanitaria. Le politiche per le donne si limiterebbero a un progetto e alla semplice indicazione del numero di dipendenti di sesso femminile, invece di affrontare in modo sistematico la questione della parità di genere. Anche la politica migratoria sarebbe affrontata in modo limitato, senza tenere conto dei minori e dell’integrazione a lungo termine. Infine, mancherebbero piani strategici per le scuole e gli asili in lingua tedesca.
Nel complesso, Frick ha criticato la scarsa concretezza e profondità del documento, mettendo in dubbio anche la sua paternità e insinuando che si tratti più di un “male necessario” che di uno strumento effettivo di governance strategica.
Le critiche sono arrivate anche dall’interno della maggioranza. “Il documento contiene molte misure positive che condivido”, ha dichiarato Verena Debiasi (Für Sterzing Wipptal). “Tuttavia, non posso sostenere la fusione delle due aree sciistiche di Monte Cavallo e Ladurns, per questo motivo mi asterrò dalla votazione.”
Il documento programmatico è stato infine approvato a maggioranza con due voti contrari da parte di Evi Frick e Werner Graus (SVP), e tre astensioni: Verena Debiasi (“Für Sterzing Wipptal”), Paul Eisendle (SVP) e Massimo Bessone (SìAmo Vipiteno).
Il piano delle zone di pericolo nella zona lungo l’Isarco fino al ponte Hofer è stato modificato: l’area è stata riclassificata da “rossa” a “blu”.
Comune di Vipiteno
Presentato il documento programmatico
Secondo il sindaco Alber, anni intensi e decisivi attendono il Comune di Brennero. Sono in fase di avvio progetti che daranno a Colle Isarco una maggiore qualità della vita e quindi nuove opportunità di sviluppo.
A inizio luglio, Alber ha presentato al con-

processo, fornendo indicazioni su cosa fare con la strada statale una volta completata la circonvallazione, e su come riorganizzare parcheggi e aree verdi. Secondo Alber, esiste già uno studio di fattibilità per un parcheggio interrato sotto piazza Ibsen, che dovrebbe essere realizzato tramite una partnership pubblico-privata. Uno studio legale è incaricato della gestione dell’operazione. Il partner privato finanzierà il parcheggio, ricevendo in cambio l’ex casa degli ufficiali in via Tribulaun, che dovrebbe passare alla Provincia. Lì è prevista anche la realizzazione di una struttura per la prima infanzia.
Il sindaco ha informato che Colle Isarco è un paese di transito. Con l’attesa riduzione del traffico grazie alla circonvallazione e al tunnel di base del Brennero, il paese avrà una vera occasione di aumentare la qualità della vita e di attrarre un turismo più duraturo. Nel documento Alber ribadisce l’intenzione di collegare le aree sciistiche di Monte Cavallo e Ladurns attraverso la Valmigna. Un nuovo studio di fattibilità ha escluso l’ipotesi di un collegamento diretto con Colle Isarco. Sono in corso colloqui con gli uffici provinciali e i gestori degli impianti sciistici. Una decisione nei prossimi mesi sarebbe importante per permettere agli operatori di organizzarsi per
Per l’estate, Alber ha annunciato la presentazione di uno studio che dovrà consentire una decisione sull’impiego delle energie rinnovabili (vento, sole, acqua). Ampio spazio ha trovato il tema dell’integrazione dei nuovi cittadini e la gestione delle famiglie problematiche che non mostrano volontà di
Il sindaco desidera portare eventi culturali di rilievo a Colle Isarco, Fleres e Brennero questo grazie alla trasformazione della palestra di Colle Isarco in una sala polifunzionale. Alber ha inoltre informato che la riqualificazione energetica della casa delle associazioni di Fleres sarà anticipata grazie a un contributo statale già approvato. Anche l’ex casa canonica tornerà ad essere accessibile al pubblico.
Il consiglio comunale ha approvato il documento con nove voti favorevoli, tre contrari (Freie Liste) e un’astensione. Armin Keim ha motivato il voto contrario della sua lista sostenendo che non sono stati coinvolti nella redazione del documento e che molti contenuti risultano troppo vaghi. Mancano, secondo lui, progetti concreti per la mobilità, la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e le scuole, che dovrebbero essere pronte ad affrontare la prevista crescita demografica.
Wipptal: inaugurata la nuova Residenza per Anziani e Centro diurno, un modello innovativo di assistenza

È stata ufficialmente inaugurata sabato 7 giugno la nuova Residenza per anziani Wipptal con annesso Centro diurno, una struttura moderna e accogliente pensata per offrire un’assistenza professionale in un ambiente familiare agli anziani del territorio. L’edificio, unico nel suo genere in Alto Adige, è stato realizzato con un approccio modulare e in tempi record, segnando un passo importante nella risposta ai bisogni socioassistenziali della comunità.
All’evento inaugurale hanno partecipato autorità locali e provinciali, operatori, cittadini e naturalmente gli ospiti e i loro familiari, a testimonianza del valore di un progetto che punta a rafforzare il sostegno alle famiglie e a promuovere l’inclusione sociale. La Presidente della Comunità comprensoriale Wipptal, Monika Reinthaler, ha aperto la cerimonia con parole sentite:
“Quella che presentiamo oggi non è semplicemente una struttura, ma una vera casa. Una casa per i nostri anziani che hanno dato tanto alla società e che ora meritano cure attente, rispetto e umanità. I collaboratori della residenza, con grande dedizione e impegno, spesso svolgono turni straordinari per sopperire alla carenza di personale”.
Anche il Presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha evidenziato la complessità della situazione nella zona della Wipptal, soprattutto in relazione alla vicinanza con l’Austria, che rende più difficile la reperibilità di personale a causa della maggiore flessibilità offerta oltre confine. “Per questo – ha sottolineato – è fondamentale puntare su modelli innovativi e flessibili di gestione”.
Particolarmente toccante l’intervento della vicepresidente e assessora Rosmarie Pamer, che ha condiviso un’esperienza personale per sottolineare il valore delle residenze per anziani:
“Comprendo quanto sia difficile affidare un genitore alle cure di una struttura, ma posso dire che, per la mia famiglia, è stata la scelta giusta. Grazie alla professionalità e all’attenzione quotidiana degli operatori, mia madre vive oggi con dignità e serenità, qualità che da soli non saremmo riusciti a garantirle”.
A conclusione della cerimonia, i partecipanti hanno potuto godere di un momento conviviale con Weißwurst e dolci preparati con cura dalle Contadine della Wipptal, in un clima di festa e condivisione.
Comune di Brennero
Fortezza: quattro chiacchiere col sindaco
Il futuro del paese, la visione sociale del paese e un commento sulle elezioni in Wipptal
È passato poco più di un mese dalle Comunali di maggio e a Fortezza pare non fossero neppure necessarie, vista la conferma (quasi) totale dell’esecutivo di Giunta uscente e la riconferma – potremmo dire – a furor di popolo di Thomas Klapfer a primo cittadino. Lo abbiamo incontrato dopo il successo ottenuto dall’ Svp in paese, successo pieno che avrebbe consentito alla compagine della Stella Alpina di governare senza alleanze o “aiuti” esterni.
Eppure, Bettina Cipolletta, della lista civica “Luce per Fortezza”, è stata riconfermata assessore.
Così, con la scomparsa dell’altra civica, confluita poi in “Fratelli d’Italia” ad opera dell’unica rappresentante eletta, il Comune non ha, de facto, un’opposizione.
“Sono contento – ha affermato Klapfer – della mia riconferma. Mi piace il ruolo di primo cittadino e lo svolgo con passione anche se, lo annuncio sin da adesso, sarà la mia ultima volta. Credo – afferma nel concludere il pensiero – che ci sia un tempo per ogni cosa e quando saranno scaduti i prossimi cinque anni, ci sia qualcun altro in grado di portare avanti il Comune, qualcuno di più giovane”.
Il suo pensiero in tal senso è coerente con le decisioni prese. Piccoli passi, cambiamenti graduali. Fedele al motto universale
“squadra che vince non si cambia”, Klapfer ha di fatto sostituito un solo mem bro di giunta preferendo Tobias Stein mann alla pur validissi ma Giovanna Summerer.
A questi ha af fidato le com petenze relati ve alle attività europee e ge mellaggio tra comuni (chi si ricorda ancora che Fortezza è ge mellata con Zeitlarn in Baviera? N.d.R.), ambiente e tutela della natura, centro riciclaggio e centri raccolta differenziata smaltimento rifiuti associazioni manifestazioni pubbliche, comune-clima.

mano alla problematica che sta diventando veramente pesante per il paese. Nella richiesta c’era anche l’installazione di telecamere, a deterrenza del fenomeno dell’abbandono illegale di immondizia, nei pressi delle campane di raccolta e dei cestini.
E a proposito di rifiuti: già nella prossima riunione consiliare, sarà dibattito sull’argomento. Risale allo scorso anno infatti la presentazione al sindaco di una richiesta popolare, firmata da un centinaio di cittadini, per mettere

“Se ne parla ormai dagli anni ’90 – puntualizza Klapfer – ed è un fenomeno strettamente legato alla situazione geografica che a quella sociale del paese. Inutile nascondercelo – afferma – Fortezza è un paese di transito. Tanti sono i pendolari che usano il nostro territorio come stazione intermedia per i loro viaggi quotidiani e usano scaricare i loro rifiuti qui, prima di tornare a casa. Ci sono poi i nuovi arrivati, ancora non abituati a concetti come “raccolta differenziata” o “smaltimento corretto” o ancora “biologico” eccetera. Ne parliamo, ripeto, da anni ma trovare una soluzione è difficile. Allo stato attuale, posso dire che preferisco il male minore, ovvero che l’immondizia venga lasciata nei pressi di un cassonetto, piuttosto che gettata nei boschi. Almeno lì, posso mandare un operaio a ripulire”. Come dargli torto? Purtroppo, siamo in un’era nella quale bisogna scegliere il danno minore. Per l’educazione sociale, il rispetto dell’ambiente e la buona educazione, ci vogliono metodo e tempo.
Gli elettori, lo abbiamo già detto, hanno premiato Klapfer – crediamo – anche per il suo avere una
visione futura del paese. Una visione coerente con le più moderne teorie sociologiche: “Credo fermamente in quello che è il traguardo di rendere Fortezza un paese più bello. Se è bello l’ambiente si vive meglio, ci si rilassa di più, ci si sente più a casa. Ho un concetto. Come nel computer esiste un hardware e un software. Hardware è inteso come strutture, ed è il compito più facile da realizzare. Abbiamo, a tal proposito, terminato la costruzione del nuovo ponte - passeggiata sull’Isarco, che attende l’uniformazione del colore, la realizzazione di una staccionata di sicurezza sul versante est e il collaudo, per unire la passeggiata sul lungolago al parco archeologico della strada romana. Poi toccherà all’ultimo lotto, il lungolago fino al forte, concludere il progetto. Entro marzo del prossimo anno sarà inoltre terminata la ricostruzione dell’ex casa ANAS, che nelle nostre intenzioni dovrà diventare il punto d’incontro di culture diverse. Nei progetti infine, c’è l’intenzione di valorizzare le piazze, Piazza Marconi e Piazza Municipio. Ecco, - sottolinea – questo è hardware. Il software è mettere assieme le culture diverse, creare convivenza e soprattutto comunicazione, comunicazione tra genti diverse che convivono nello stesso luogo, anche se penso che il vero collante, la vera integrazione, la vera comunicazione si crei a scuola, per e con le generazioni prossime e alle scuole dedicheremo grande attenzione”. La speranza del sindaco è questa e non si può dargli torto quando afferma che questo è il compito più difficile. È la struttura sociale stessa del paese, ad essere, meglio a far di Fortezza un luogo “diverso”. A Fortezza infatti con-
vivono 27, forse 28 etnie diverse, la maggior parte delle quali provengono dall’Africa e dall’estremo Oriente.
A queste si aggiungono i “classici”, ovvero italiani, tedeschi, ladini. “Abbiamo anche centinaia di fortezzini che risultano residenti all’estero o in altre regioni che in rapporto ai residenti “veri” sono tantissimi. È un’altra realtà, poco conosciuta, poco considerata con la quale fare i conti e che, teoricamente, svilisce ogni risultato elettorale, ogni nostra decisione, ogni progetto. Non è più come un tempo, che i fortezzini rientravano per votare. Oggi non c’è più l’obbligo, né il senso del dovere morale e, spesso, neppure l’occasione coincidente per un rientro. E così i numeri sulla carta, non coincidono più con la realtà quotidiana”.
Chissà se basterà (certamente no, ma può essere un inizio) il “KM 488”, questo il nome dato all’ex casa ANAS, punto d’incontro ipoteticamente ideale, a far nascere quella comunicazione fra genti diverse, quelle della realtà vera.
“Abbiamo scelto di lasciare l’indicativo chilometrico che esisteva già sulla vecchia struttura, per non cancellare definitivamente un pezzo di storia del paese – ha sottolineato Klapfer - e dunque mantenere idealmente l’identità di una struttura che segnalava la distanza chilometrica della Statale dell’Abetone e del Brennero. Le strade furono costruite anche per incontrarsi e di qui passa una delle più antiche strade d’Europa. La vera sfida del nostro tempo è la comunicazione, vista anche la diffusione dei telefoni cellulari”.
Anche sulle frazioni, in particolar modo Mezzaselva (che è più “paese”, dove c’è più “comunità” rispetto a Fortezza), quello che il rieletto sindaco chiama “hardware” avrà un suo peso. Dato per scontato ormai il progetto già approvato e finanziato del nuovo ponte sull’Isarco, in ingresso al paese, per mettere al sicuro la frazione in caso di improvviso innalzamento del livello dell’Isarco (i lavori partiranno a fine settembre), la novità annunciata dal sindaco è il probabile spostamento della caserma dei Vigili del Fuoco
Volontari, che attualmente si affaccia su Piazza San Martino. “Penso riusciremo a ricollocarla in zona industriale – dichiara Klapfer – e ciò per rendere la struttura più consona alle esigenze di pronto intervento, anche in virtù dell’entrata in funzione del nuovo ponte e per rendere la piazza più fruibile alla gente”.
Tra le più importanti introduzioni di regole, regolamenti e facilitazioni, ci sarà quella della nuova legislazione provinciale che concede ai Comuni la possibilità di delimitare un’area nel nucleo comunale ben definita e dunque da definire, per costruire senza i passati benestari provinciali. “Dovremo delimitare l’area precisa –afferma Thomas Klapfer – che ci conceda con criterio un piano edilizio. Resta la regola che fuori da quest’area sarà comunque la Provincia a dare il benestare mentre al Comune rimarrà il dare un parere positivo e negativo. Decideremo prossimamente”.
Tante le novità dunque, tanti i progetti, tante le direttrici per il prossimo quinquennio. Ci congediamo con un commento “politico” del sindaco sui cambiamenti radicali nella composizione dei consigli comunali a Fortezza, in Wipptal e sul ruolo dell’Svp, il “suo” partito: “Per ciò che riguarda Fortezza, ricordo che nel 1990 avevamo 6 consiglieri e c’erano quattro partiti italiani. Oggi, gli equilibri si sono rovesciati. Se sia merito nostro o demerito degli altri, sarà il tempo a decretarlo. Noi abbiamo fatto bene, spero, e continueremo a farlo. In altri comuni la Stella Alpina perde a favore delle liste civiche? E’ l’onda lunga della politica degli errori: a Vipiteno la Bürgerliste è nata in opposizione alla politica Svp provinciale che voleva la chiusura dell’ospedale. A Campo di Trens invece si voleva costruire la grande centrale elettrica contro il volere della popolazione. Andare contro il volere popolare è un errore e oggi chi ha compiuto quegli errori paga”. E termina con un arzigogolo verbale che suona come un mònito: “E’ sbagliato affidare un’idea sbagliata alla persona sbagliata”!
Autostrada del Brennero: confermati
i vertici, avanti con il progetto del Green Corridor
Continuità alla guida di Autostrada del Brennero. L’Assemblea dei Soci ha con fermato per un terzo mandato Hartmann Reichhalter alla Presidenza e Diego Cattoni come Amministratore Delegato, con Alessia Rotta nuo vamente nel ruolo di Vicepresi dente. Un segnale chiaro di fi ducia e coesione, in un momento decisivo per il futuro della A22. Durante l’assemblea è stato ap provato anche il bilancio 2024, che evidenzia un utile di 97,92 milioni di euro (+22,35%) su 405,5 milioni di ricavi, con oltre 125 milioni destinati a investimenti e manutenzioni. Di questi, 50,6 milioni (+34,7%) sono stati impiegati in innovazione gestionale e infrastrutturale.

I Soci hanno ribadito l’importanza di affrontare con determinazione la gara per il rinnovo cinquantennale della concessione, puntando su un modello sostenibile e a misura di territorio. “Serve coerenza e stabilità per arrivare a un green corridor efficiente e rispettoso dell’ambiente”, ha dichiarato Arno Kompatscher, Presidente della Regione Trentino Alto Adige. Sulla stessa linea Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia di Trento, che ha parlato di una “partita strategica per lo sviluppo e la mobilità del Paese”.
Il nuovo CdA, che include anche Martin Ausserdorfer, Diego Binelli, Astrid Kofler e altri rappresentanti territoriali, guiderà ora la Società verso il deposito della candidatura alla gara, in scadenza il 30 giugno, sulla base della proposta di finanza di progetto presentata da A22.
La sfida ora è ottenere la nuova concessione, senza oneri per la finanza pubblica, per garantire un futuro efficiente, sicuro e sostenibile alla principale arteria tra nord e sud Europa.
cm
I cronisti ripercorrono con soddisfazione i progetti portati a termine
I cronisti nella Wipptal – attivi a titolo volontario in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali – svolgono un ruolo decisivo nella documentazione della realtà locale contemporanea. Il loro lavoro meticoloso, che spesso si concretizza in cronache annuali, rappresenta un patrimonio inestimabile di avvenimenti locali: un interesse che va ben oltre il valore informativo, contribuendo a preservare la memoria collettiva e a rendere visibile l’evoluzione del territorio. “È sempre sorprendente vedere quanto sia accaduto e cambiato nel corso degli anni”, afferma un rappresentante dei cronisti. Questi documenti acquistano un valore particolare con il passare del tempo, opponendosi all’oblio e custodendo preziosi ricordi per singoli cittadini, associazioni e gruppi. Attualmente, cronisti volontari sono attivi nei comuni di Campo di Trens, Racines e Vipiteno, dove redigono cronache annuali. A Colle Isarco è in fase di costituzione un nuovo gruppo. Le attività sono varie e possono risultare molto stimolanti a livello personale: includono la redazione di libri dei paesi, pubblicazioni a sfondo storico-contemporaneo e raccolte di immagini d’epoca. A Vipiteno è stata inoltre istituita una biblioteca di grande valore, che già conta 999 volumi a tema locale, con l’obiettivo di ampliarla ulteriormente. I cronisti accolgono volentieri donazioni di libri o fotografie pertinenti, destinandole a un utilizzo significativo. Nel corso dell’ultima assemblea annuale dei cronisti della Wipptal, svoltasi a fine maggio, Roland Thaler è stato confermato presidente. Come referenti locali sono stati inoltre nominati Helmuth Wieser (Campo di Trens), Josef Gasteiger (Vipiteno), Paul Felizetti (Racines) e Robert Holzer (Brennero). Gli interessati possono rivolgersi direttamente a loro o contattare il cronista distrettuale al numero 349 6172101.
Alla scoperta delle vie ferrate della Wipptal: emozioni in verticale tra natura e panorami mozzafiato
La Wipptal sta diventando una meta sempre più apprezzata dagli appassionati di arrampi cata e outdoor. Negli ultimi anni, il territorio si è arricchito di nuove vie ferrate, itinerari attrezzati che permettono anche ai non alpi nisti di vivere l’emozione della montagna in tutta sicurezza. Tra le proposte più interes santi della zona spiccano la nuovissima via ferrata Ibex a Racines, la via ferrata Ölberg in Val di Vizze, la via ferrata Lampskopf in Val di Fleres e la falesia Forte Alto a Fortezza.
Inaugurata di recente, la via ferrata Ibex parte nei pressi del Maso Pulvererhof a Raci nes di Dentro, è già diventata un punto di rife rimento per gli amanti dell’adrenalina. I 900 metri di cavo d’acciaio installati e le diverse varianti di difficoltà garantiscono divertimen to e sfida per ogni livello. L’itinerario include quattro percorsi con caratteristiche simili ma livelli di difficoltà crescenti con un minimo di livello di difficoltà obbligatorio moderata mente difficile fino all’estremamente difficile. Il tratto iniziale della ferrata è facile. Il percorso per bambini all’ingresso, lungo 100 metri, è stato pensato su misura per avvicinare i più piccoli al mondo della montagna in modo sicuro e divertente. Qui, la mascotte Raci – uno stambecco simpatico e istruttivo – accompagna i giovani arrampica tori con pannelli informativi su natura, sicu rezza, tecnica e rispetto dell’ambiente.

A Fleres di Dentro, con partenza dal parcheggio presso il ponte di Sasso, si può percorrere la bella via ferrata Lampskopf che si snoda
tra rocce, prati e boschi, lambendo le pendici del Lampskopf (Gogelberg) fino al Rifugio Tribulaun.
All’ingresso della Val di Vizze, subito dopo la galleria che porta ad Avenes, si trova l’in gresso della via ferrata Ölberg, un percorso di media difficoltà adatto a chi ha già espe rienza e vuole mettersi alla prova in un am biente naturale con splendidi panorami sulla vallata e sulle vette circostanti. Attraverso i 230 metri di dislivello si incrociano passaggi tecnicamente interessanti. Come in tutte le ascese è necessario avere un passo sicuro e non soffrire di vertigini.
La ferrata presenta un grado di difficoltà me dio, ha una lunghezza di 500 m ed è ideale per scalatori esperti. Per quanto riguarda i bambini è raccomandata un’altezza minima di 1,30 m e un’adeguata esperienza nell’ar rampicata.
Nel complesso il percorso ha una durata di ca. tre ore.

Il percorso alterna tratti verticali a sezioni più tranquille, con una vista spettacolare sul crinale di confine tra Italia e Austria. Gli alpinisti, amanti delle vie ferrate, che apprezzano le esperienze complete, il piacere della natura e l’arrampicata facile, qui, si trovano al posto giusto. La salita è impegnativa e con un dislivello di ca. 1.000 metri. A causa dell’esposizione a sud, l’escursione è tutta esposta al sole. Infine, per chi preferisce la falesia alla ferrata, la Falesia di Forte Alto a Fortezza offre un’interessante parete d’arrampicata attrezzata, adatta a tutti i livelli. Immersa in un prato attrezzato, la zona offre tavoli da picnic, aree verdi, spazio per slackline, e persino un secondo settore più in alto con vie facili. Il parco d’arrampicata di Fortezza, a circa 15 minuti a piedi dal Forte di Fortezza, è molto apprezzata dai principianti e dalle famiglie e rappresenta un perfetto punto d’incontro tra sport, natura e memoria storica. sp
La via ferrata Ibex a Racines
La via ferrata Ölberg
Vizze
Broncos: giovani promesse, spirito di rivincita e sguardo al futuro nella nuova stagione dell’Alps Hockey League
Con l’avvicinarsi della nuova sta gione dell’Alps Hockey League, i Wipptal Broncos sono pronti a ri partire con entusiasmo e determi nazione. La rosa 2025/26 guarda al futuro, puntando con decisione sui talenti locali e sulla continui tà tecnica che ha portato frutti importanti nella passata stagio ne. La squadra, ancora in fase di definizione, ha già mostrato un orientamento chiaro: investire sui giovani cresciuti nel vivaio. Saranno infatti quattro i giovani che entreranno stabilmente nel roster della prima squadra: Erik Hofer, 18 anni, ha già svolto la preparazione estiva con i Broncos lo scorso anno e ha preso parte ad alcune amichevoli. Reduce da due stagioni con i Falcons Brixen, ha chiuso il campionato 2023/24 con 9 gol e 6 assist. Marco Niccolai, classe 2005, ha seguito un percorso analogo, crescendo nel farm team di Bressanone. Nell’ultima stagione in IHL ha messo a referto 13 gol e 8 assist. Damian Leitner, portiere nato nel 2007, è un prodotto puro del vivaio Broncos. Nelle ultime due stagioni ha già collezionato 15 presenze tra i pali nella IHL e sarà ora parte integrante del gruppo senior. Gabriel Nitz, giovane difensore cresciuto nei Falcons Brixen, ha già maturato esperienza con i Wipptal Broncos e in Alps Hockey League. Vanta anche tre medaglie ai mondiali giovanili. Dalla prossima stagione sarà un membro fisso della prima squadra dei Broncos. Grazie alla sinergia ormai consolidata con i Falcons Brixen, questi giovani continueranno a maturare esperienza giocando in entrambi i campionati, una formula vincente per garantire crescita e ritmo partita. Alla guida della squadra ci sarà ancora Johan Sjöquist, l’allenatore svedese che nella scor-

sa stagione ha saputo guidare i Broncos in una rimonta emozionante, culminata con il raggiungimento delle semifinali playoff. La sua conferma rappresenta un punto fermo in un progetto tecnico basato sulla valorizzazione dei giovani e su una visione a lungo termine. Nel frattempo, arrivano anche le prime conferme ufficiali da parte dei giocatori: Dominik Groh continuerà a difendere la porta dei Broncos insieme a Fabian Klammer, mentre in difesa ci saranno ancora Alessio Niccolai, Johannes Gschnitzer, Daniel Soraruf, Alexander Brunner e Liam Nardon. Tra gli attaccanti, è stato confermato anche James Livingston, ala destra di origine canadese, che sarà uno dei punti di riferimento del reparto offensivo. Ha confermato la sua presenza anche Alex Planatscher, altro tassello importante nel mosaico dei cavalli selvaggi insieme ad Alex Zecchetto. A questi si aggiungono Connor Sanvido, Bryson Cianfrone ed il capitano Paul Esendle. A rafforzare il reparto difensivo arriva anche un nuovo innesto, il finlandese Jerkko Rämö, difensore mancino con una spiccata propensione offensiva, pronto
a dare solidità e dinamismo alla retroguardia. Si è pensato anche di fornire un valido rinforzo in attacco con l’acquisto del canadese, con radici italiane, Franco Sproviero che per la prima volta attraversa l’oceano per giocare in Italia con i Wipptal Broncos. Il campionato dell’Alps Hockey League, che inizierà sabato 20 settembre, vedrà la partecipazione di 13 squadre provenienti da quattro nazioni: sette per l’Italia (HC Asiago, SG Cortina, HC Merano, HC Unterland Cavaliers, SG Renon Rittner Buam, HC Valgardena ed SSI Vipiteno Broncos), quattro per l’Austria (ECB Bregenzerwald, EC Adler Kitzbühel, EC Red Bull Salisburgo Juniors ed EK Zeller Eisberen) ed una a testa per Slovenia (SIJ Acroni Jesenice) e Croazia (KHL Sisak). Tutte le formazioni disputeranno 36 partite nella stagione regolare, affrontandosi tre volte ciascuna. Seguirà poi la divisione in un Master Round e due gruppi di Qualification Round, prima dei playoff, che inizieranno il 3 marzo 2026. Il vincitore della decima edizione dell’Alps Hochey League sarà incoronato entro il 25 aprile. I Broncos arrivano da una stagione
2024 memorabile, che li ha visti protagonisti di una straordinaria rimonta. Dopo un avvio difficile, con la squadra relegata nei bassifondi della classifica, il gruppo ha trovato coesione, grinta e fiducia, risalendo fino a raggiungere le semifinali. Un risultato che ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente e che oggi rappresenta una solida base su cui costruire il futuro. Anche quest’anno, le partite casalinghe verranno disputate nel campo provvisorio di Vipiteno, in attesa della costruzione del nuovo palaghiaccio che andrà a sostituire la struttura crollata a causa delle forti nevicate. Una situazione logistica complicata resa più idonea dalla Società con il montaggio di nuove tribune e posti a sedere, che però non ha mai fermato la determinazione della squadra né l’affetto e la vicinanza del pubblico, sempre pronto a sostenere i propri colori. La nuova stagione sarà un banco di prova importante per confermare quanto di buono fatto e per lanciare una nuova generazione di giocatori, pronti a scrivere il prossimo capitolo della storia dei Broncos.
Il calore del pubblico in una partita della scorsa stagione.
Vipiteno accoglie la polifonia georgiana: un viaggio musicale tra tradizione e spiritualità
Lo scorso mese, nella suggestiva cornice della chiesa di Santo Spirito a Vipiteno, si è tenuta una straordinaria serata dedicata ai canti polifonici tradizionali della Chiesa georgiana, un evento inedito per la cittadina altoatesina. Protagonista della serata è stato il Coro Gamarjoba di Tbilisi, diretto da David Shugliashvili, rinomato etnomusicologo, docente universitario e autore di diverse raccolte di musica sacra georgiana. A dare il benvenuto agli ospiti sono stati il sindaco Peter Volgger ed il vicesindaco Fabio Cola, segnando così l’importanza istituzionale e culturale dell’iniziativa. Il programma, realizzato in collaborazione con il METS,
Museo Etnografico Trentino di San Michele e la Fondazione Caritro, ha rappresentato un ponte culturale tra l’Italia e la Georgia, attraverso uno dei patrimoni musicali più antichi e affascinanti d’Europa. A guidare e introdurre il pubblico in questo viaggio musicale è stato Renato Morelli, regista, studioso e instancabile promotore delle tradizioni musicali popolari, che ha aperto la serata con parole cariche di significato: “Quando l’Unesco ha stabilito che accanto ai patrimoni materiali dell’umanità ci sono anche quelli immateriali, il primo patrimonio immateriale nominato fu il canto georgiano. Questo perché è un canto di grande
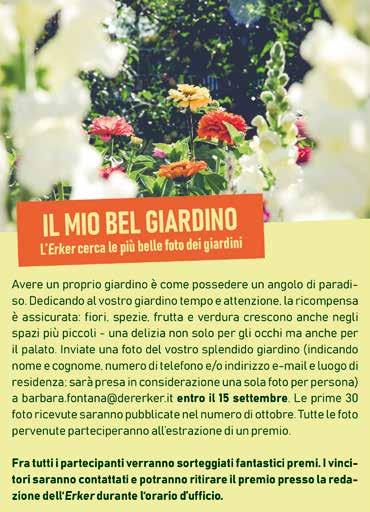
complessità, di grande ricchezza, di grande storia.” Morelli ha saputo trasmettere la profonda importanza di questa tradizione, minacciata nei secoli da dominazioni straniere. Dopo la conquista russa del Caucaso, il canto e la lingua georgiana furono vietati dal Patriarcato di Mosca, che impose la liturgia e il canto in lingua russa. La Georgia, cristianizzata nel IV secolo, ben prima della Russia, vantava una tradizione liturgica autonoma, con canti a tre voci di straordinaria antichità e arcaicità. Il merito della sua sopravvivenza si deve a Filimus Koridze, celebre cantante lirico e etnomusicologo, che decise di abbandonare la carriera operistica per salvare il canto liturgico georgiano. Koridze trascrisse oltre 6.000 canti, smentendo chi sosteneva che la loro complessità li rendesse impossibili da codificare. Consapevole della minaccia rappresentata dal regime bolscevico, tentò di trasferire le sue trascrizioni in Italia, con l’aiuto di ex colleghi del Teatro alla Scala. Un’impresa epica che lo ha portato, nel 2011, ad essere santificato dal Patriarcato della Chiesa autocefala georgiana. Nel corso della serata, il pubblico ha potuto ascoltare una selezione di canti liturgici, tra cui uno struggente brano dedicato alla Madonna, poeticamente paragonata a una vigna — simbolo ricorrente nella tradizione georgiana, patria del vino. I canti, legati ai momenti della vita quotidiana, dal lavoro ai brindisi, hanno regalato un viaggio attraverso le voci arcaiche e potenti della Georgia. Situata nel Caucaso meridionale, tra l’Europa orientale e l’Asia occidentale, la Georgia confina con Russia, Azerbaigian, Armenia e Turchia. Un crocevia di culture e religioni, è oggi uno Stato indi-

pendente con una forte identità europea. Negli ultimi anni ha espresso con decisione la propria volontà di entrare a far parte dell’Unione Europea, un processo che ha preso ufficialmente avvio con la presentazione della domanda di adesione nel 2022. Questa aspirazione è sostenuta anche dalla volontà di proteggere e promuovere un patrimonio culturale unico, come dimostra proprio la tutela e la diffusione del canto polifonico sacro. Il concerto si è tenuto pochi giorni dopo una rassegna di canti gregoriani, offrendo un’interessante occasione per confrontare due forme di canto sacro profondamente diverse ma accomunate da un’origine antichissima e da un’intensa spiritualità. Se il gregoriano è caratterizzato da una linea monodica sobria e meditativa, il canto georgiano colpisce per la sua ricchezza armonica, le tre voci indipendenti che si intrecciano creando un tessuto sonoro denso, talvolta dissonante per l’orecchio occidentale, ma di grande impatto emotivo. Un evento raro e prezioso, reso possibile dalla tenacia e passione di Renato Morelli, da anni impegnato nella valorizzazione delle tradizioni musicali popolari, non solo italiane. La serata a Vipiteno ha rappresentato non solo un concerto, ma un incontro tra culture, un viaggio spirituale e sonoro, che ha arricchito tutti i presenti. bm
Momenti del concerto.
Concerti
in chiesa a Mareta Brass’n Sax & narrazione
Il 7 agosto, quattro musicisti (Chris Haller, sassofono; Walter Plank, tromba; Peppi Haller, trombone; Toni Pichler, tuba) incontrano una narratrice (Heike Vigl) nella chiesa parrocchiale di Mareta. Il risultato è una combinazione divertente, pulsante e audace di storie e musica. Il programma comprende opere di vecchi maestri, jazz swing e blues e qualche sorpresa. L’ensemble Brass’n Sax è composto in parte da musicisti della Joe Smith Band e dal suo leader Peppi Haller alias Joe Smith.

Una serata ricca di suoni, profondità ed espressività musicale è quella offerta dal gruppo musicale Bozen Brass il 21 agosto. Caratterizzato da virtuosismo, profondità e una sottile arte del suono, lo stile unico dell’ensembleuna miscela di musica classica, jazz, musica da film e fascino altoatesino - farà risuonare le pareti della chiesa parrocchiale di Mareta.
Entrambi i concerti iniziano alle ore 21:00. L’ingresso è libero (donazione volontaria). sp
Giornate Equestri di Prati 2025: un successo che stabilisce nuovi standard
Con un livello tecnico elevatissimo, grande partecipazione e un pubblico entusiasta, le Giornate Equestri di Prati si sono concluse il 13 luglio 2025, inaugurando con successo il nuovo formato di 10 giorni sotto il motto “Jumping in the Alps”. L’evento ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per l’equitazione in Trentino-Alto Adige. Il momento clou è stato il Gran Premio dell’Alto Adige, vinto da Filippo Gasca Queirazza su Salto 77. Oltre 1.000 partenze, tre concorsi

in dieci giorni e categorie dai 40 ai 145 cm hanno dato vita a una manifestazione sportiva dinamica e intergenerazionale, con ampio spazio anche ai giovani talenti. Il moderno Centro Equestre Wiesenhof ha garantito condizioni ideali per cavalli, atleti e pubblico, contribuendo al record di partecipazione. La combinazione tra sport, natura e ospitalità ha reso questa edizione un modello per il futuro dell’equitazione in regione.
sp

Raduno alpini Sez. Alto Adige a Vipiteno
Venerdì 27 e sabato 28 giugno scorsi, la Sezione ANA Alto Adige ha organizzato il Raduno Sezionale 2025.
L’evento si è svolto a Vipiteno in collaborazione con il 5° Reggimento Alpini, che nelle stesse giornate ha
celebrato la propria Festa di Corpo. Alla manifestazione hanno partecipato la Fanfara della Brigata Alpina Julia, che ha accompagnato alcune fasi dell’evento, e la Fanfara Sezionale di Verona - Città di Caldiero, che ha guidato la sfilata del sabato.
sp
Calendarietto
C.A.I Brennero
02.08.25: Grigliata a Rofis Boden – Stilves (Gruppo giovanile)
03.08.25: Escursione rifugio Tribulaun
07.08.25: Gita al Lago Rondella
09.-10.08.25: Pernottamento in rifugio (Gruppo giovanile)
25.-30.08.25: Settimana estiva “Portami in montagna con il CAI di Brennero” (Gruppo giovanile)
C.A.I Vipiteno Escursionismo
10.08.25: Escursione alla „Ratschinger Weisse“Bella e poco frequentata escursione in fondo alla Valle di Racines - Dislivello: 1.200 m ca. fino alla cima 1.400 m ca. tempo di percorrenza andata e ritorno: 6/6,30 ore. Difficoltà: E (escursionisti). Informazioni e iscrizioni: Adriano 333 8914478. 17.08.25: Schafkopf Bramstall sulle vedrette di Ries – Bella traversata in vetta nel Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina, bella escursione prima attraverso una valle idilliaca con numerosi alpeggi, poi in vetta con una splendida vista. Dislivello: m 900 circa, tempo di percorrenza: 5 ore circa (salita 3h – discesa 2h), difficoltà: E (escursionisti). Iscrizioni e informazioni: Andrea, tel. 335 272822.
24.08.25: Escursione attraverso la forcella de Lech al Lech de Lagaciò e rifugio Scotoni - Bellissima escursione circolare nel Parco naturale Fanes – Sennes – Braies. Lunghezza percorso: 10 km, tempo di percorrenza: 4:00 ore, dislivello: m 760, difficoltà: E. Iscrizioni e informazioni: Mariassunta 333 5476147.
31.08.25: Piz Boè e Rifugio Kostner al Vallon partendo da Passo Pordoi - Escursione circolare nel cuore del Gruppo del Sella. Informazioni e iscrizioni: Fabrizio 334 7901129. G.A.M.
3.-4.08.25: Salita al rifugio Tribulaun con pernottamento e attraversata fino al rifugio Cremona. 24.-25.08.25: Attendamento al Lago di GardaEscursioni, ferrate e falesie per giovani alpinisti con accompagnatori qualificati.
A.N.A.
06.08.25: Stand alla festa delle lanterne con polenta e baccalà
Biblioteca civica e ARCI
21.08.25: Alessandro Raveggi presenta la sua nuova biografia “Continuate in ciò che era giusto”. Storia di Alexander Langer. (Bompiani, 2025)- ore 18:00 Casarci
28.08.25: Francesca Melandri presenta il suo nuovo romanzo “Piedi freddi”(Bompiani, 2024)- ore 18:00 Casarci
Per
Bozen Brass
Filippo Gasca Queirazza su Salto 77
„Der schönste Job der Welt“
Die Bergführer Stefan Fassnauer und Fabian Bacher im Porträt
Leise, konzentriert und mit beiden Beinen auf dem Boden – so begegnen einem Stefan Fassnauer aus Ridnaun und Fabian Bacher aus Pardaun. Aber sobald es in Richtung Gipfel geht, wachsen sie buchstäblich über sich hinaus. Die beiden Freunde leben und lieben die Berge –und sie haben sich entschieden, ihren Beruf dort auszuüben, wo andere Urlaub machen: als staatlich geprüfte Bergführer.
I Barbara Felizetti Sorg
Bei Fabian Bacher war es ein eher unspektakulärer Moment, der alles veränderte – zumindest auf den ersten Blick. Sein Bruder kam eines Tages mit einem Kletterseil nach Hause und fragte ihn: „Gehen wir in Stange klettern?“ Fabian, damals 18 Jahre alt und Profiskifahrer mit Ambitionen, zögerte nicht. Und dann war es um ihn geschehen. „Das hat sofort Klick gemacht – und daraus wurde schnell ein extremer Fanatismus. Anders geht’s auch nicht in diesem Beruf.“ So nüchtern erzählt Fabian von seinen Kletteranfängen – und doch steckt darin das Feuer, das seither in ihm brennt. Schon damals hatte er einen „Plan B“ im Kopf: Wenn es mit der Skikarriere nicht dauerhaft klappt, wird er Bergführer. 2020 beendete er seine Profikarriere und schlug, mitten in der Coronazeit, den neuen Weg ein. Er arbeitete Tourenberichte ab, bestand die Aufnahmeprüfung 2021 und startete 2022 mit der Ausbildung. In dieser Zeit lernte er Stefan Fassnauer kennen, mit dem ihn seither nicht nur viele
gemeinsame Touren, sondern eine tiefe Freundschaft verbindet. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, schmunzelt Fabian. Denn die Ausbildung hat es in sich. Stefan Fassnauer hat den Weg bereits früher eingeschlagen und ebenfalls konsequent verfolgt. Als Kind war er mit den Eltern oft auf Bergtouren unterwegs: Die erste Skitour mit fünf Jahren, die erste alpine Klettertour mit zwölf. Zwischendurch trainierte er intensiv als Biathlet, doch irgendwann war klar: Der Berg ruft lauter. Mit 22 begann er die Bergführerausbildung und zählt heute zu den jüngsten im Land, die diesen Beruf ausüben. Sein Ziel ist klar: Er möchte langfristig ganz vom Bergführen leben. Die Nachfrage ist da, vor allem im Sommer, wenn das Spektrum an Touren größer ist. „Es ist ein realistisches Ziel“, sagt er. „Aber man braucht Geduld und Ausdauer – wie bei einer langen Tour.“
Fabian arbeitet im Winter hauptberuflich als Skitrainer und Skilehrer, im Sommer als Bergführer – am liebsten im Wipptal, dort, wo er zu Hause ist. Die französischen Nordwände der Alpen reizen ihn aber auch, genauso wie die Klassiker Eiger und Matterhorn. „Aber es ist auch wichtig, sich selbst schöne Touren zu gönnen, bei denen man nicht verantwortlich ist. Sonst verliert man die Freude.“
Zwischen Verantwortung und Glücksmomenten

Bacher: „Man muss sich auch selbst schöne Touren gönnen.“
115 Tage umfasst die Ausbildung zum Bergführer: 100 Tage
auf Tour im gesamten Alpenraum, viel in den Westalpen, dazu 15 Tage Theorie. Es wird nicht nur geklettert, sondern
auch gerettet, analysiert, bewertet. Vom Felsklettern über Hochtouren („Die Königsdisziplin“) bis hin zu Skitouren – das gesam-
Fabian
Stefan Fassnauer:
„Ein Bergführer muss Ruhe ausstrahlen, auch wenn es kritisch wird.“

te alpine Repertoire muss beherrscht werden. Von 14 Teilnehmern des Kurses haben zehn die Ausbildung abgeschlossen, einer kam bei einer privaten Tour ums Leben. „Solche Momente holen dich auf den Boden der Realität zurück. Aber sie bestätigen auch, wie wichtig es ist, mit Respekt unterwegs zu sein“, so Stefan. Bergführer zu sein bedeutet mehr, als nur ein Seil zu legen oder den Weg zu kennen. Es ist ein Beruf mit großer Verantwortung. „Die Menschen vertrauen dir ihr Leben an“, sagt Fabian. Die erste Tour allein mit Kunden habe ihn viel Kraft gekostet –nicht körperlich, sondern mental. „Du musst Entscheidungen treffen, du musst einschätzen, wie deine Kunden ticken, und das oft in Situationen, die sie selbst überfordern.“
Stefan ergänzt: „Du bist als Berg-
führer nicht nur Sportler und Begleiter, du bist auch Pädagoge, manchmal Psychologe. Du musst Ruhe ausstrahlen, auch wenn es kritisch wird.“ Das Wetter, die Verhältnisse, die Kondition der Kunden – vieles kann sich schnell ändern. Und nicht selten muss eine Tour abgebrochen werden, auch wenn die Enttäuschung groß ist. „Sicherheit geht immer vor. Das Ziel ist nicht der Gipfel, sondern gesund nach Hause zu kommen.“
Zuckerhütl, Tribulaun –und geheime Pfade
In ihrer Heimat im Wipptal fühlen sich die beiden am wohlsten, für Skitouren im Winter ist das Gebiet geradezu ideal. Im Sommer geht’s hinaus in den gesamten Alpenraum, auch nach Frankreich oder in die Schweiz, oft

DENTOPLUS
zwei Wochen am Stück. „König Ortler“ ist natürlich ein beliebtes Ziel für Kunden. Im Wipptal besonders gefragt sind Touren auf das Zuckerhütl im hintersten Ridnauntal oder den Tribulaun im Pflerschtal. „Aber man muss nicht immer die Modetouren machen“, sagt Stefan mit einem Augenzwinkern. „Ein Bergführer hat auch so manchen Geheimtipp im Rucksack.“
Was sie sich von ihren Kunden wünschen? „Am schönsten ist es, wenn jemand einfach gut drauf ist und nur noch der passende Gefährte fehlt“, sagt Fabian. Dabei lassen sich Kunden meist in zwei Gruppen einteilen: Die einen haben große Zweifel, ob sie es schaffen, und sind dann die Fittesten. Die anderen meinen, es werde kein Problem, und kehren bald um. „Nicht mein Tag heute“, heißt es dann oft. „Das ist okay,
aber wir müssen frühzeitig erkennen, wie es wirklich um jemanden steht.“
Bei aller Anstrengung – es sind die emotionalen Momente, die hängen bleiben. Freudentränen am Gipfel, Gespräche am Seil, gemeinsames Überwinden von Grenzen. „Das ist jedes Mal wieder etwas Besonderes“, sagen beide. Auch nach unzähligen Touren, vielen Nächten im Biwak und langen Anfahrten bleibt die Begeisterung.
Ihr bisher höchster Gipfel war der Dom in der Schweiz, über 4.500 m hoch. Den haben sie gemeinsam bestiegen. Und noch viele weitere Touren sollen folgen. Und wenn man sie fragt, ob sie sich für den richtigen Beruf entschieden haben, kommt die Antwort wie aus einem Mund: „Ja. Es ist der schönste Job der Welt.“

1Timab en
Berglauf
10 Jahre
Mareiter Stein Attacke
Berglauf
Erfolg für Patrick Ramoser

Bereits zum zehnten Mal wird am 9. August die „Mareiter Stein Attacke“, organisiert vom ASV Mareit, ausgetragen. Die Bergläufer der Kategorie „Race“ starten um 8.30 Uhr im Dorfzentrum von Mareit und laufen über 4,8 km und 1.180 Höhenmeter bis zum Gipfel des Mareiter Steins. In der Jubiläumskategorie „Staffel“ hat der Startläufer eine Strecke von 2,6 km und 700 Höhenmeter zu bewältigen, der Zielläufer übernimmt die letzten 2,2 km und 480 Höhenmeter bis zum Gipfel des Mareiter Steins. Die Kategorie „Hobby“ macht sich mit Mittelzeitwertung auf den Weg zur Kerschbaumeralm (5,5 km/830 Hm). Um 14.00 Uhr werden am Festplatz von Mareit die Sieger gekürt.
Bereits am Vorabend findet um 18.30 Uhr rund um Schloss Wolfsthurn der Kinderlauf statt. Die Prämierung findet um 20.00 Uhr auf dem Festplatz statt.
�� www.mareitersteinattacke.com
Der Stubai Ultratrail 2025 hat Ende Juni mit einer Rekordbeteiligung von 1.500 Läufern aus aller Welt eindrucksvoll gezeigt, warum das Motto „Epic Trails. Epic Valley“ mehr als gerechtfertigt ist. Patrick Ramoser vom ASV Freienfeld lieferte sich in der Königsdisziplin auf dem 78 km langen Stubaier Höhenweg mit 6.000 Höhenmetern ein packendes Kopf-an-KopfRennen mit Lokalmatador Christian Stern, das bis auf die letzten Meter spannend blieb. Mit einer Endzeit von 12:35.06 Stunden erreichte Ramoser den 2. Platz, nur wenige Sekunden hinter dem Sieger. Damit verwies er u. a. den starken Tschechen Tomas Kubicik (12:42.46) auf Rang 3.
Strecke – vor allem, weil es mein erstes Rennen war, das durch die Nacht und über so viele Stunden ging. Gerade deshalb bin ich umso

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Rennen mit so einem Ergebnis beenden würde. Mein einziges Ziel an diesem Tag war es, einfach nur das Ziel zu erreichen“, so Patrick Ramoser nach dem Rennen. „Ich hatte großen Respekt vor dieser extrem herausfordernden
Berglauf
überraschter von meinem eigenen Kampfgeist und meiner Entschlossenheit, während des gesamten Rennens so gut durchzuhalten. Alles lief besser als erwartet.“
Im Bild (v. l.) Patrick Ramoser, Christian Stern und Tomas Kubicik.
Lukas Mangger Dritter bei „La Velenosa“
Bei der neunten Ausgabe des beliebten Berglaufs „La Velenosa“ über 14 anspruchsvolle Kilometer am Fuße des Monte Terne überzeugte Lukas Mangger aus Ridnaun (im Bild 1. v. r.) mit einer starken Leistung und sicherte sich den 3. Platz. Über 1.000 Teilnehmer gingen an den Start dieses mittlerweile traditionsreichen Laufs in Venetien. Das Rennen war von Beginn an von hohem Tempo geprägt. Während sich an der Spitze Lorenzo Cagnati und Michael Galassi – das spätere Siegerduo – ein spannendes Duell lieferten, sicherte sich Mangger mit einer Zeit von 1:12.03 Stunden verdient den 3. Rang – ein starkes Ergebnis auf der technisch fordernden Strecke, die vor allem in der zweiten Hälfte mit steilen Abstiegen und engen Pfaden alles abverlangte.

Erker 08/25
Zwei Siege für Severine Petersen
Beim renommierten Kaiserkrone Trail Ende Juni in Söll triumphierte Severine Petersen, die in Gossensaß lebt, eindrucksvoll auf dem Medium Trail über 21 km und 1.408 Höhenmeter. In einer starken Zeit von 2:29.09 Stunden ließ sie die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich souverän den Gesamtsieg bei den Damen. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs rund um das imposante Kaisergebirge verwies sie die Deutsche Marina Janussek (2:35.42) auf Rang 2. Den 3. Platz belegte die Österreicherin Christina Mandlbauer mit einer Zeit von 2:41.02. Beim 8. Rosengarten Schlern Skymarathon durfte sich Severine Petersen über ihren zweiten Sieg in Folge auf der 36-Kilome-
Leichtathletik

ter-Distanz freuen. Die gebürtige Deutsche bewies nicht nur Konstanz, sondern auch eindrucksvolle Form: Mit 4:22.40,2 Stunden war sie sogar knapp zehn Minuten schneller als bei ihrem Vorjahressieg.
„Das Rennen ist einfach schön, vom Anfang bis zum Ende“, sagte Petersen im Ziel. Besonders bemerkenswert: Die Athletin war erst kürzlich von einer Verletzungspause zurückgekehrt. Von dieser war auf der anspruchsvollen Strecke mit rund 2.000 Höhenmetern jedoch nichts zu spüren: Mit einem breiten Grinsen erreichte sie das Ziel im Dorfkern von Tiers. Ihre stärkste Verfolgerin Clara Carste aus Deutschland hatte über 15 Minuten Rückstand.
glänzen auf der Seiser Alm
Anfang Juli fand der 12. Seiser
Alm Halbmarathon statt. 900 Athleten – ein restlos ausver

21-km-Lauf teilgenommen. Bei den Männern siegte Daniele Felicetti aus Predazzo in einer Zeit von 1:18.21 Stunden, gefolgt von Samuel Demetz. Auf den
Rängen 3 und 4 folgten zwei Wipptaler, beide mit hervorragenden Zeiten: Markus Ploner (links im Bild) aus Mittewald passierte die Ziellinie in einer Zeit von 1:21.47 Stunden und sicherte sich damit erneut einen Stockerlplatz; Martin Griesser aus Mauls beendete das Rennen mit einer Zeit von 1:22.42 Stunden. Benjamin Eisendle aus Ratschings wurde Siebter (1:28.05).
Das Damenrennen entschied Alessia Scaini (1:34:12) für sich. Severine Petersen (1:38.25) aus Gossensaß landete auf Platz 5.
Leichtathletik
Talente glänzen bei „Trofeo Triveneto“
Beim renommierten „Trofeo Triveneto“, dem Saisonhöhepunkt der U14-Leichtathletik für die Regionen Friaul, Veneto, Trentino und Südtirol, zeigte sich die Südtirol-Auswahl unter Landestrainer Karl Schöpf in starker Form und erreichte den 6. Gesamtrang. Einen entscheidenden Beitrag zu diesem Erfolg leisteten vier Nachwuchstalente aus dem Wipptal, allen voran Clara Seehauser, die mit einer Weite von 12,16 m im

Kugelstoßen einen hervorragenden 2. Platz erzielte. Anna Kruselburger lief über 1.000 m in 3.15,10 Minuten auf Rang 3 und stellte dabei eine persönliche Bestzeit auf.
Auch Jonas Walter überzeugte im Kugelstoßen mit 10,66 m und belegte einen soliden 5. Platz. Armin Aukenthaler sprintete die 60 m in 8,47 Sekunden und war außerdem Teil der 4x100-mStaffel, die mit 53,89 Sekunden ebenfalls Platz 5 erreichte.
Radsport
Tour-Transalp-Sieg für Thomas Gschnitzer
Mit beeindruckender Ausdauer und Teamgeist triumphierte der Sterzinger Thomas Gschnitzer gemeinsam mit seinem Teamkollegen Michael Ober rauch bei der diesjährigen „Tour Trans alp“, dem wohl härtesten Ama teur-Etappen rennen in Euro pa. Die beiden Radsportler konnten sich nach sieben kräftezehrenden Etappen über die Alpen – mit insgesamt 750 km und 15.000 Höhenmetern – zum zweiten

Mal in Folge den Gesamtsieg in der Masters-Kategorie sichern. Rund 650 Teilnehmer aus über 30 Nationen starteten heuer in
Innsbruck und erreichten nach anspruchsvollen Etappen über Pässe wie den Reschenpass und das legendäre Stilfserjoch ihr Ziel in Riva del Garda. Gerade die Königsetappe von Pfunds nach Bormio stellte für viele eine besondere Herausforderung dar – für Gschnitzer und Oberrauch jedoch ein weite-
Mit einer Gesamtzeit von 19:15.39 Stunden gewannen die beiden Ausnahmesportler alle sieben Etappen in ihrer Kategorie und zeigten damit einmal mehr ihre Klasse und Konstanz.
Gemeinsam stark fürs Leben
Anfang Juli radelten wieder rund 100 Teilnehmer – darunter über 30 transplantierte Sportler aus ganz Europa – gemeinsam 300 km und 4.000 Höhenmeter von Innsbruck nach Arco. In Sterzing legten sie einen Zwischenstopp ein.
Mit diesem Kraftakt zeigen sie, dass ein Leben nach einer Transplantation nicht nur möglich, sondern auch aktiv, gesund und voller Lebensfreude ist. „Diese Tour ist mehr als ein Sportevent. Sie ist ein bewegendes Zeugnis menschlicher Widerstandskraft, medizinischen Fortschritts und tiefer Dankbarkeit gegenüber Organspendern“, so Marco Panizza, Präsident des veranstaltenden Transplant Sportclub APS. Beim ersten „Boxenstopp“ am Krankenhaus
Sterzing am 4. Juli wurden die Radfahrer von Gesundheitslandesrat Hubert Messner, Sanitätsbetrieb-Generaldirektor Christian Kofler, Gesundheitsbezirksdirektorin Elisabeth Montel und dem Verwaltungsleiter des Krankenhauses Sterzing Peter Volgger empfangen. Die Radveranstaltung symbolisiere die gute Zusammenarbeit von Tirol, Südtirol und dem Trentino: Eurotransplant und das italienische Nationale Zentrum für Transplantation arbeiten grenzüberschreitend zusammen, damit Menschen, die auf ein Organ warten, schneller und rechtzeitig die lebensrettende Transplantation erhalten, hieß es in den Wortmeldungen. Allen Organisatoren, medizinischen Fachkräften und Unterstützern aus Politik und Verwaltung, die diese Tour möglich gemacht haben und den
lebensverändernden Wert der Organspende sichtbar machen, wurde herzlich gedankt. Bei ihrer Ankunft in Arco am 6. Juli feierten

die Teilnehmer, Gäste und Unterstützer gemeinsam das Leben, als Hommage an die Spender und als Aufruf, Organe zu spenden. Denn Organspende bedeutet Leben – oft auch ein sehr sportliches.

Koorcllnatlon- alszlplln - Kraft• sclrnelllgkelt Ausdauer Beweglle11l<elt sell:lstverteli:llgung [nordlnazlane- alscipllna- Fnrza• Veloclca R-eslstenza - Flessilllllt:i - Aurndlresa
Fußball
Michael Bacher nimmt den Hut

Jahren mit seiner Familie in St. Ulrich lebt, hatte zuletzt mit einer Oberschenkelzerrung zu kämpfen; generell plagten ihn in letzter Zeit immer irgendwelche Schmerzen. Doch für seinen
RICHTIGSTELLUNG
etzten Einsatz als aktiver Fußballer biss er noch einmal die Zähne zusammen und wurde dafür mit einem emotionalen
Bacher blickt auf über 180 Einsätze in Italiens dritter und vierter Liga zurück und war u. a. für den FC Südtirol, Cremonese und Virtus erona aktiv. In den letzten Jahren spielte er im Amateurbereich, zuletzt mit Herz und ahrung beim FC Gröden. „Ich habe in meiner Karriere viel erlebt“, sagt Bacher. Aber das Wichtigste sind nicht etwa die Siege und Titel, sondern die Freundschaften, die geblieben sind.“ eit mit seiner Familie verbringen – im August erwartet er mit Ehefrau Tamara das zweite Kind. Beruflich ist er als selbstständiger Verkäufer in Norditalien unterwegs fen ihm seine Fußballjahre: „Man lernt viele Menschen kennen und viele
Sein letztes Spiel krönte Michael Bacher mit einem nahezu perfekten Abschluss: einem kraftvollen Auftritt, einem Aufstieg und einem auf jeden Fall würdigen Abschied vom Fußball. log
Christian Wieser ist seit 40 Jahren im Ausschuss des ASV Freienfeld tätig. Fälschlicherweise wurde in der Juli-Ausgabe des Erker angegeben, dass er vier Jahrzehnte als Präsident des Vereins tätig war. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. Die Redaktion
f,C Südtirol erneut zu Gast in Ratschings
Trnininqslag,erim Zeichender uerburtde1theit
Auch in diesem Jahr absoiuleru der FC :Sülitjrol se.intro.liitiOl'tellH sommeArai ningsl.G.gerin R~mings - bereiu Z,Um 3•.Mal l.lef,eiuu skh der \ll!fl'•l!inim Rldnaunto.l auf d1l! ~omml!fldl! s11l$011\)Or. \lom u. bis wm 2!6 .Jl1.11iwar die Mannicllaft im H:Dt>et„A! mare;tt" in Mareit unter,g;e,b:r,ctclltund t1rainier:i;etiiglicll i • ~e Sportzone in nan-g;e.
Fl!'al!',lim~• E"mpt,,~9 im Uo~I ,,$cl,n~bN'~'", omz,eire \J~mul?f u11~ a~rFC SiidtiroJ u~jle11 ~ut lfM Tnirni11~11age1sr.an dll.
Der A111ftalitt w111n'.lemit einem \UJl1lkommensa.pe,rit1f nm 'l-lotel .,sch1uel!!eri,1"gefeiert. In M~rlichem Rahme:n b~griißtfl'l \>ertreer der Gemeintle ~a:tsthings, tief Ratschings Tourismus Genosse11sct1aft, !le!J"Berq,llahltel1: Rats ciling s• IJaufen nd l!les ·i:;1.1.~llalQ1Jer-eins
P4fr11~r«J1<1f1~e,j,i119~n: Rilri(llin!Jf ro~rrimui unlf ller FCS ~llli~~Jn illn w~iti'r\1'Zlliamme1111rt>rit,

Atm.oahl Ridnaunto.l ·tlie Mannschaft 11111.tl •!las B@tweuerte.a.m. Auch FCS-Geschiiftsfiihr·er Oletmar Pfe1fe,r uni!!. 'vi2eprnsident Carlo con.11 betonten bei di-ese,rG,ei-egenheit !lie gn)~E! 'Wertscl1iitzu g fii:ir die langji'ihrigc Partnerschaft mit •!ll!m Gelliet. Im zug,f des Empfangs \1,n1rde-auch die besteilende Koop•erntion zwische;n dem FC si.idtirol und. de·r Ratschi11.g,sTouri,~mu1ge·nosse11sctu1ft für d r~i weitere J allre \lerHingert - ein nark·es Zeichenfür die 11achl1alttg,e Zusammenarlleit. zu>iscilen Sport Tou,rism .s unl!l. lolit-all!r Ulimchaft.
IEil'I h-er.zlictl.es Oanl(esclliin ol'I den FC SÜdtirol fü.r •!IE!l'IBesucil 1:1111!1. d e u H'tJrau~11suolle Paruurn:haft!
\1J\\lW.ratul'lit1gs.info I it1fo@rntschil'lgs.info 1 @) \lisitratschitlgs
Sportpsychologie
Jannik Sinner – ein Geschenk für den italienischen Tennissport und weit darüber hinaus
Jannik Sinner tut nicht nur dem italienischen Tennis gut, sondern dem Sport im Allgemeinen. Der junge Sextner, der vor zehn Jahren seine Heimat verließ, um Tennisprofi zu werden, ist mittlerweile zu einem nationalen Idol aufgestiegen – so sehr, dass er zeitweise sogar den in Italien heißgeliebten Fußball in den Schatten stellt.

Der Grund für seine enorme Popularität liegt sicherlich in seinem außergewöhnlichen Talent, das er immer wieder mit dem gelben Filzball eindrucksvoll unter Beweis stellt. Doch das allein erklärt seine Beliebtheit nicht.
Vielmehr ist es sein stets höfliches, respektvolles und bescheidenes Auftreten, das in Italien eine Welle der Anerkennung – ja, teilweise sogar der Verehrung – ausgelöst hat. Und das, wie ich meine, völlig zu Recht: Sinner ist ein Athlet, der seine Mannschaftskollegen stärkt, sie motiviert und sie durch sein Verhalten inspiriert, an sich zu glauben. Er tut dem (Tennis-)Sport ebenso gut wie der Menschlichkeit im Allgemeinen. Das hat auch die Wirtschaft erkannt – sowohl hier in Südtirol als auch auf der ganzen Welt.
Die sportpsychologische Perspektive
Die zentrale sportpsychologische Frage, die sich aus Sinners Wirkung ableitet, lautet: Warum gibt es Athleten, die ihre Mannschaftskollegen mitreißen – und andere, die eher hemmend oder unterdrückend auf ihr Umfeld wirken? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Vielmehr scheint es sich um ein komplexes Zusammenspiel mentaler, emotionaler und sozialer Faktoren zu handeln.
Persönlichkeit als Schlüssel Zunächst einmal muss ein „Superathlet“ überhaupt daran interessiert sein, seine Teamkollegen mit auf seine „Siegesreise“ zu nehmen. Dazu bedarf es sozialer Kompetenz: Kommunikationsfreude, Kontaktfähigkeit und Empathie. Der Athlet muss in der Lage sein, persönliche Eitelkeiten zurückzustellen und stattdessen das Wohl des Teams in den Vordergrund zu rücken – ohne dabei seine eigene Leistungsfähigkeit zu verlieren.
Solche Persönlichkeiten zeichnen sich durch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung aus und überzeugen durch mentale Stabilität. Sie sind keine lauten Anführer, sondern inspirierende Vorbilder, auf die man sich verlassen kann – auf dem Platz wie daneben.
Natürlich spielen auch die Umgebungsbedingungen eine wesentliche Rolle. Trainer, Betreuer und das gesamte Teamumfeld müssen die positive Ausstrahlung eines solchen Athleten erkennen und fördern. Wenn das gelingt, entsteht ein echtes Erfolgssystem.
Jannik – ein Vorbild für unsere Gesellschaft Man muss nicht viele Worte verlieren: Jannik Sinner ist ein mitreißender TopAthlet. Er begeistert nicht nur seine Teamkollegen, sondern Millionen von Menschen durch sein respektvolles, aufrichtiges Auftreten – als Mitspieler, Vorbild und Mensch.
Besonders wertvoll ist Jannik auch für unsere Jugend, nicht nur im Kinderund Jugendsport. Er arbeitet hart, ist stets lernbereit, lebt Fair Play auf und neben dem Platz und bleibt trotz aller Erfolge ein sympathischer, authentischer Mensch.
Ein Vorbild, wie es der moderne Sport –und unsere Gesellschaft – dringend brauchen.
Martin Volgger, Sportpsychologe

Spannende Matches bei Ratschings Open
Bereits zum siebten Mal veranstaltete der Tennisclub Ratschings das beliebte Tennisturnier „Ratschings Open“, das Anfang Juli in Ratschings aus getragen wurde. Das Turnier war of fen für Damen und Herren und fand in den Kategorien 2, 3, 4 sowie 4NC statt. Insgesamt 110 Spieler nah men daran teil und lieferten sich in den verschiedenen Ras tergruppen span nende Matches.
Finalspiele die Preisverleihung statt. Dabei bedankte sich Günther Eisendle, Präsident des TC Ratschings, bei allen Teilnehmern, freiwilligen Helfern und


Im Herrenfina le der Kategorie Open konnte sich Christian Fellin mit einem klaren 6:1, 6:3-Sieg gegen Pe ter Jakub Homola durchsetzen und den Titel holen. Bei den Damen trium phierte Aliz MrvaKovacs, die Lorena Lungkofler souverän mit 6:2, 6:4 bezwang.
In der Kategorie 4 trafen im entscheidenden Spiel Klaus Kruselburger und Peter Rainer aufeinander. Kruselburger dominierte die Partie und sicherte sich mit 6:0, 6:4 den Sieg in seiner Gruppe. Nach einer Woche voller spannender und fairer Begegnungen, die auch von zahlreichen Zuschauern mitverfolgt wurden, fand im Anschluss an die

Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Abschließend lud er alle Anwesenden zu einem geselligen Umtrunk ein.
Reitsporttage Wiesen setzen neue Maßstäbe
Mit einem großartigen Teilnehmerfeld, sportlichen Höhepunkten und begeisterten Besuchern gingen Mitte Juli die Reitsporttage Wiesen zu Ende. Unter dem Motto „Jumping in the Alps“ feierte das traditionsreiche Turnier eine eindrucksvolle Premiere im neuen 10-Tage-Format und bestätigte einmal mehr seinen Status als bedeutendstes Reitsportevent der Region Trentino-Südtirol.
„Diese zehn Tage waren organisatorisch eine Herausforderung, aber auch ein voller Erfolg. Die Stimmung war sportlich, fair und familiär; genau das, wofür Wiesen steht“, resümiert Jakob Hochrainer, Leiter der Reitsporttage Wiesen.
Der sportliche Höhepunkt fand am 13. Juli mit dem Großen Preis von Südtirol statt, der auf einer Höhe von 145 cm ausgetragen wurde. Den Sieg sicherte sich der aus Lana stammende Filippo Gasca Queirazza auf Salto 77, vor Riccardo Andreis mit Antares du Castel und Elena Chiarotti auf Myrco. Queirazza zeigte sich nach dem Turnier begeistert: „Dieses Turnier ist für mich jedes Jahr ein Fixpunkt im Kalender. Das Engagement der Familie Hochrainer hat diese Veranstaltung auf ein neues
Niveau gehoben. Inmitten der Berge, auf knapp 1.000 m, erwarten uns hier nicht nur perfekte Bedingungen für den Sport, sondern auch ein Umfeld, in dem man sich als Reiter einfach wohlfühlt.“
Mit dem neuen Konzept von drei Springturnieren innerhalb von zehn Tagen, Prüfungen von 40 cm bis 145 cm, über 1.000 Starts und zwei Großen Preisen an den Sonntagen, wurde die Erfolgsgeschichte der Reitsporttage spürbar fortgeschrieben. Neben sportlicher Spitzenklasse setzten die Veranstalter auch 2025 bewusst auf Nachwuchsförderung. Zahlreiche junge Talente nutzten die Gelegenheit, sich in gut besetzten Prüfungen vor großem Publikum zu beweisen. Der Mix aus Einsteigerklassen, Jugendprüfungen und Profisport sorgte für ein lebendiges und generationenübergreifendes Turniererlebnis. Auch der veranstaltende Reitclub Wiesen durfte sich über beachtliche Erfolge seiner Vereinsmitglieder freuen. Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs war erneut das moderne Reitsportzentrum Wiesenhof. Die mit hochwertigen Reitböden aus-
gestattete Anlage bot optimale Bedingungen für Pferd, Reiter und Publikum. Die Kombination aus professioneller Infrastruktur, frischer Bergluft und Südtiroler Gastfreundschaft

überzeugte Gäste und Aktive gleichermaßen. Mit rund 1.000 Starts und mehreren tausend Besuchern wurde nicht nur ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt, sondern auch die Bedeutung des Reitsports in Südtirol eindrucksvoll unterstrichen. Die Reitsporttage Wiesen haben gezeigt: Die Mischung aus Sport, Landschaft und Leidenschaft funktioniert – und setzt Maßstäbe für kommende Ausgaben.

Reitsport
Ski alpin
Nach der Saison ist vor der Saison
Auch wenn der Winter längst vorbei ist, bleibt die Rennge meinschaft Wipptal aktiv. Bei der 46. Vollversammlung, die vor kurzem stattfand, wurde nicht nur eine positive Bilanz der vergangenen Skisaison ge zogen, sondern auch der Blick auf die Zukunft gerichtet.
Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Peter Volgger (Sterzing) und Vize-Bürger meister Thomas Strickner (Rat schings), Vertreter der ange schlossenen VSS-Vereine sowie der Direktor des Oberschulzentrums Sterzing Christian Salchner und Benno Linser von der Raiffeisenkasse Wipptal, unterstrichen die Bedeutung des Vereins für den Bezirk.
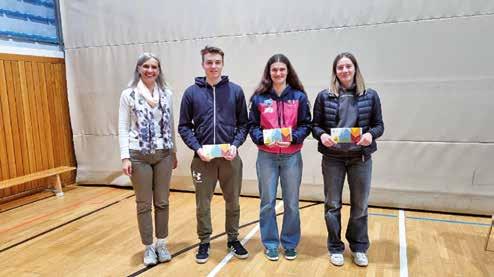
Die geehrten Athleten (v. r.) Victoria Klotz, Ivy Schölzhorn und Valentin Sparber mit Ilona Bonomo, Ausschussvertreterin im Förderverein
ßer sein könnte.
Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Neuwahl des Ausschusses nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit. Präsident Arnold Schölzhorn eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf eine sportlich intensive und organisatorisch fordernde Saison, die stark von gesetzlichen Neuerungen im Bereich Sport geprägt war. Die Renngemeinschaft musste sich neuen Vorgaben stellen, nahm aber auch regelmäßig an Fortbildungen teil, um sich professionell weiterzuentwickeln.
Besonders erfreulich war im Sommer 2024 die Auslieferung des neuen Vereinsbusses, der nach über einem Jahr Lieferzeit endlich übernommen werden konnte. Dank der großzügigen Unterstützung durch die Südtiroler Sparkasse steht der Bus nun im Dienst der jungen Athleten, auch wenn das Platzangebot für die sperrige Skiausrüstung grö-
Im sportlichen Bereich gab es Veränderungen im Trainerteam: Patrick Hofer betreute gemeinsam mit dem neuen Trainer Luca Varoli die U16-Gruppe, während Alex Polig weiterhin für die U18und U21-Athleten verantwortlich war. Anstelle von David Pixner, der nach Liechtenstein wechselte, stand ihm Stefanie Windisch zur Seite.
Trotz wetterbedingter Herausforderungen im Frühjahr konnten zahlreiche Rennen erfolgreich abgehalten werden. Der Raiffeisen Grand Prix der U14 in Ladurns fand planmäßig statt. Leider mussten die FIS-NJR-Doppelrennen in Ratschings wegen Nebel abgesagt werden, einer der Läufe wurde im April nachgeholt. Auch die Wipptalcup-Rennen – ein Slalom in Ridnaun und ein Riesentorlauf in Ladurns –wurden dank der Unterstützung der Basisvereine und Skigebietsbetreiber erfolgreich durchgeführt.
Die Trainerberichte von Stefanie
Windisch, Lukas Bacher, Patrick Hofer und Alex Polig zeigten: Fleiß, Disziplin und Teamarbeit zahlen sich aus. Die Athleten der Renngemeinschaft Wipptal konnten mit vielen starken Leistungen auf sich aufmerksam ma-
Besondere Leistungen
Victoria Klotz
Landesmeistertitel U18 Slalom
chen. Prämiert wurden Victoria Klotz (Jg. 2008), Ivy Schölzhorn (Jg. 2007) und Valentin Sparber (Jg. 2007). Eva Sophia Blasbichler, Leonie Girtler und Lukas Sieder wurden im Landeskader bestätigt. Auch das elfköpfige Seniorencup-Team hat wieder an der Raiffeisen-Südtirolcup-Master-Rennserie teilgenommen und konnte in der Vereinswertung den 3. Rang bestätigen. Mit großem Dank an alle Trainer, Ausschussmitglieder, ehrenamtlichen Helfer, Torrichter und Busfahrer Alfred Plank endete die Vollversammlung mit der einstimmigen Genehmigung der Jahresabschlussrechnung durch die Revisoren.
Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt. Ihm gehören Ilona Bonomo, Matthias Gschliesser, Josef Putzer, Arnold Schölzhorn, Karl Sparber und Manfred Thaler an.
2. Platz EYOF Bakuriani (Georgien) Team-Parallel-Riesentorlauf
3. Platz EYOF Bakuriani (Georgien) Slalom
2. Platz Gesamtwertung Marlenecup U18 Aufnahme in die C-Nationalmannschaft
Ivy Schölzhorn
Landesmeistertitel U18 Super-G,
• 2. Platz Italienmeisterschaft Anwärter U18 Abfahrt
3. Platz Italienmeisterschaft Anwärter U18 Riesentorlauf
3. Platz Gesamtwertung Marlenecup U18
• 3. Platz Gesamtwertung Gran Premio Italia U18+U21 Velocitá Aufnahme in die C-Nationalmannschaft
Valentin Sparber
3. Platz Italienmeisterschaft Anwärter U18 Slalom
3. Platz Gesamtwertung Marlenecup U18
Eiskunstlauf
Erfolgreiche Saison für Ice School Academy
Drei Wipptaler im Nationalteam

Dem italienischen Nationalteam im Biathlon gehören in der kommenden Saison drei Athleten aus dem Wipptal an. Patrick Braunhofer aus Ridnaun, der für die Sportgruppe der Carabinieri startet, ist Mitglied der Gruppe „Milano Cortina 2026“, genauso wie Birgit Schölzhorn aus Sterzing, die ebenfalls für die Carabinieri an den Start geht. Andreas Braunhofer aus Ridnaun (Ca

rabinieri) und Aaron Niederstätter (Carabinieri), der ebenfalls vom ASV Ridnaun kommt, sind hingegen Teil der Gruppe AIN.
Die Weltcupmannschaft der Damen wird von Alex Inderst aus Ridnaun trainiert, Devis Da Canal ist Materialtechniker im Weltcupteam. Karin Oberhofer ist für die nationalen Bewerbe zuständig.

Seit vergangenem Oktober ist die renommierte Trainerin Linda Senettin Teil der neu gegründeten Ice School Academy ASD in Sterzing. Mit über 20 Jahren Erfahrung und großem Engagement hat sie in Sterzing eine leistungsstarke Eiskunstlaufschule etabliert, die auch auf nationaler Ebene Anerkennung findet. Senettin schafft es immer wieder, junge Talente in kürzester Zeit von der Basis bis zur Wettkampfreife zu führen. In der vergangenen Saison konnten etwa Alina Graus, Giulia D’Angelo und Daniela Kruselburger mit großem Einsatz glänzen und hervorragende Platzierungen erzielen.

Mit einem Dank an alle Sponsoren, die diese erfolgreiche Saison möglich gemacht haben, blickt die Ice School Academy nun hochmotiviert in die Zukunft.

(v. l.) Patrick Braunhofer, Birgit Schölzhorn und Andreas Braunhofer
Biathlon
Handwerk
Lehrlinge fahren günstiger
Mit einem wichtigen Schritt hat die Südtiroler Landesregierung beschlossen, dass künftig auch Lehrlinge in den Genuss der vergünstigten Tarife für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommen. Bislang war dieses Angebot ausschließlich Oberschülern vorbehalten. Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh) hatte sich seit geraumer Zeit für diese tarifliche Gleichstellung starkgemacht – mit Erfolg.
„Auszubildende haben häufig ebenso Bedarf, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Ausbildungsstätte zu fahren wie Schüler. Es freut uns sehr, dass ein Beschluss in diese Richtung gefasst wurde“, so lvh-Präsident Martin Haller. Der Verband sieht in der Entscheidung ein klares Signal
© lvh.apa
der Wertschätzung gegenüber den Lehrlingen und ihrem Beitrag zur wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Entwicklung in Süd tirol.
„Diese Gleichstellung ist ein längst über-
fälliger Schritt. Junge Menschen sollen unabhängig von ihrer Ausbildungsform mobil sein können – und zwar zu fairen Bedingungen. Die Entscheidung der Landesregierung ist ein starker Impuls für die Attraktivität der Lehre“, betont lvh-Direktor Walter Pöhl.
Der lvh sieht die Maßnahme zudem als Beitrag zur Förderung nachhaltiger Mobilität und als Unterstützung für Familien, die durch die vergünstigten Tarife finanziell entlastet werden. Die Möglichkeit, kostengünstig zur Lehrstelle zu gelangen, stärkt den Stellenwert der beruflichen Ausbildung und unterstreicht deren Gleichwertigkeit mit schulischen Bildungswegen.

Tischler & Planer
Europas Nr. 1 für Aluminium-Balkone und mehr
Seit über einem Jahrhundert steht der Name LEEB für höchste Qualität, Innovationskraft und individuelle Gestaltung im Außenbereich. Gegründet 1906 und als traditionelles Familienunternehmen geführt, sind wir heute Europas Nr. 1 im Balkonbau – mit einem umfassenden Produktsortiment aus hochwertigem Aluminium.
Unsere Stärke: Ihr Mehrwert
Ob Balkon, Anbaubalkon, Zaun, Sichtschutz, Sommergarten oder Terrassenüberdachung – unsere Produkte zeichnen sich durch edles Design, Stabilität und Langlebigkeit aus. Sie sind nahezu wartungsfrei und witterungsbeständig – dank der einzigartigen Alu Comfort Plus®-Beschichtung, die kratzfest, schmutzabweisend und UV-resistent ist.
Balkone im Fokus
Unsere Balkone sind mehr als nur Anbauelemente – sie sind gestalterische Highlights, die Ihrem Zuhause Charakter und Wert verleihen. In Form, Farbe und Material individuell anpassbar, verbinden sie architektonische Vielfalt mit technischer Perfektion. Ob Neubau oder Sanierung: Ein LEEB-Balkon macht den Unterschied.
Unsere Balkonvielfalt reicht von klassisch bis modern – mit mehr als 250 Designvarianten, die sich harmonisch an jede Architektur anpassen lassen. Ob Sie sich für elegante Glasfüllungen, natürliche
Holzdekore oder blickdichte Lamellen entscheiden: Alle Ausführungen überzeugen durch Formstabilität, Farbbeständig-

tungen geeignet. Unsere drei verschiedenen Systeme sind individuell planbar, äußerst langlebig und fügen sich optisch harmonisch ins Gesamtbild Ihres Hauses ein – eine Wertsteigerung inklusive.
Ein stilvoller Balkon mit Glaselementen – gefertigt aus hochwertigem Aluminium in bewährter LEEB-Qualität.
keit und hochwertige Verarbeitung. Dank der intelligenten Fertigung mit verdeckter Verschraubung entsteht ein besonders harmonisches Gesamtbild – ganz ohne sichtbare Verbindungselemente. Darüber hinaus bieten wir maßgefertigte Sonderlösungen – zum Beispiel für Eckbalkone, Hanglagen oder Sanierungen mit statischen Anforderungen.
Sie haben noch keinen Balkon? Kein Problem – Leeb macht’s möglich! Für Häuser ohne bestehenden Balkon bieten unsere Anbaubalkone die perfekte Lösung – ganz ohne massive Eingriffe in die Bausubstanz wird der Wohnraum erweitert. Sie werden freistehend vor das Gebäude gestellt, sind statisch geprüft und ideal für Nachrüs-
Persönlich. Kompetent. Vor Ort. In Südtirol setzen wir auf einen starken Vertriebspartner, der unsere Werte teilt und Sie persönlich vor Ort betreut – von der Erstberatung über die Planung bis zur Montage. Ihre Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt. Unsere Beratung ist kostenlos, unverbindlich –und maßgeschneidert.
Vertrauen Sie dem Original
Mit über 150 Vertriebspartnern in Europa, modernster Fertigung und zertifizierten Qualitätssicherungen ist LEEB der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Jedes Projekt ist ein Unikat – mit dem Anspruch, Design, Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau zu vereinen.
Machen Sie den ersten Schritt – bestellen Sie sich einen Gratis-Katalog, vereinbaren Sie einen Beratungstermin und entdecken Sie, was mit LEEB alles möglich ist!
�� +39 371 1472844
+39 345 7540926 | BZ-Technik �� www.leeb-balkone.com

Zweifach prämiert
Bei der renommierten „Finest Beer Selection 2025“ von Meininger & Doemens in Bayern konnte sich die Volgger Genuss KG erneut als Spitzenbrauerei positionieren. Gleich zwei ihrer Biere wurden mit der Bewertung „sehr gut“ ausgezeichnet und gehören damit offiziell zu den besten Bieren im internationalen Vergleich.
Das fruchtig-hopfenbetonte „Hohe Ferse Neipa“ sowie das klassisch-weißbierige „Ridnauner Schneespitze Hefe-Weißbier“ überzeugten die Fachjury in der Blindverkostung mit herausragender Qualität und Charakterstärke. Verkostet wurden die Biere im Rahmen der streng nach Braumeisterangaben durchgeführten Beurteilungen, die sich nicht an starren Kategorien, sondern an der Individualität und handwerklichen Ausführung jedes einzelnen Biers orientieren.
Wohnen im Wandel
Die Welt des Interior Designs ist in ständigem Fluss, doch die aktuellen Möbeltrends für 2025 zeigen eine klare Tendenz hin zu bewusstem Konsum, anpassbaren Lösungen und einer starken Betonung des persönlichen Stils. Verbraucher suchen zunehmend nach Möbeln, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional, langlebig und umweltfreundlich sind.
Einer der dominantesten Trends ist die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit. Dies äußert sich in der Bevorzugung von Möbeln aus recycelten oder upgecycelten Materialien, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und umweltfreundlichen Produktionsprozessen. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt eine entscheidende Rolle – Investitionen in hochwertige, zeitlose Stücke, die Generationen überdauern können, werden als nachhaltiger empfunden als kurzlebige Trendmöbel. Reparaturfähigkeit und modulare Systeme, die sich bei Bedarf
erweitern oder umbauen lassen, gewinnen ebenfalls an Attraktivität.
Flexibilität und Multifunktionalität
Angesichts kleinerer Wohnflächen sind flexible und multifunktionale Möbel gefragter denn je. Sofas, die sich in Betten verwandeln lassen, ausziehbare Tische, die von Esstisch zu Arbeitsplatz mutieren, und Stauraumlösungen, die sich nahtlos in den Raum integrieren, sind nur einige Beispiele. Der Wunsch nach Anpassungsfähigkeit spiegelt sich auch in modularen Systemen wider, die sich individuell konfigurieren und bei Bedarf erweitern lassen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden.
Die Rückkehr zur Natur
Natürliche Materialien wie Massivholz, Rattan, Leinen und Baumwolle dominieren das Bild. Sie bringen Wärme und Authentizität

in die Wohnräume. Die Farbpa lette orientiert sich ebenfalls an der Natur, mit erdigen Tönen wie Terrakotta, Sand, verschiedenen Grüntönen und warmen Braun tönen. Akzente werden oft mit gedämpften Blau- oder Rosa tönen gesetzt. Auch organische Formen und abgerundete Kanten sind wieder verstärkt zu sehen, die eine weichere, einladendere Atmosphäre schaffen.
Individualität und „Well-being“

Abseits von reinen Funktionalitäten steht das Wohlbefinden im eigenen Zuhause im Mittelpunkt. Möbel sollen nicht nur praktisch sein, sondern auch eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit schaffen. Dies
führt zu einer Zunahme von komfortablen Polstermöbeln, Textilien mit angenehmer Haptik und der Integration von Biophilic Design-Elementen, wie der verstärkten Präsenz von Pflanzen und natürlichen Materialien. Der persönliche Ausdruck gewinnt
ebenfalls an Bedeutung: Anstatt homogen eingerichteter Räume wird die Mischung aus verschiedenen Stilen, Erbstücken und individuellen Fundstücken immer beliebter, um eine einzigartige und persönliche Geschichte zu erzählen.
Integrierte Technologie
Obwohl der Fokus auf Natürlichkeit liegt, integriert sich Technologie immer subtiler in Möbelstücke. Integrierte Ladestationen ür mobile Geräte, smarte Beleuchtungssysteme, die sich an timmung anpassen, oder Lautsprechersysteme, die unauffällig im Möbeldesign verschwinden, sind Beispiele für diese Entwicklung.
Die aktuellen Möbeltrends spiegeln den Zeitgeist wider: bewusster, flexibler und persönlicher zu leben. Hersteller und Händler, die diese Bedürfnisse erkennen und innovative Lösungen anbieten, werden den Markt von morgen prägen.


Tischlerei mit Zukunft – Arbeiten bei barth
Die Tischlerei barth in Brixen steht seit fast 150 Jahren für Qualität im Innenausbau – ein traditionsreiches Familienunternehmen, das weltweit renommierte Projekte für Luxusmarken und Museen realisiert. Doch anstatt sich auf dem Erfolg auszuruhen, investiert sie gezielt in ihre Zukunft – und in die Menschen, die sie mitgestalten.
„Als technischer Arm des Architekten entwickeln wir individuelle Innenausbaukonzepte und setzen sie millimetergenau um. Unsere Tischlerinnen und Tischler arbeiten mit hochwertigen Materialien und verbinden traditionelles Handwerk mit modernster Fertigungstechnologie“, erklärt Ivo Barth.
Engagiert, vielfältig, zukunftsorientiert
Die Berufsausbildung junger Fachkräfte hat bei barth Tradition und Zukunft zugleich. Seit 1957 wurden 86 Lehrlinge aufgenommen – viele von ihnen arbeiten noch heute im Unternehmen. Bei einigen ist mittlerweile sogar die nächste Generation in Ausbildung oder fest bei barth angestellt. Aktuell absolvieren zehn Lehrlinge ihre Ausbildung in verschiedenen Berufen, betreut von einem engagierten Team und erfahrenen Ausbildern. barth nimmt jährlich neue Lehrlinge auf – ein klares Zeichen für nachhaltiges Engagement und hohe Ausbildungsqualität. Die Rückmeldungen der Lehrlinge sprechen für sich: kollegiales Umfeld, abwechslungsreiche Tätigkeiten bei Arbeit und Materialien, wertschätzende Betreuung und zahlreiche Benefits schaffen ein Umfeld, in dem Lernen Freude macht. Ein ehemaliger Lehrling, der vor wenigen Monaten seine Ausbil


bringt es auf den Punkt: „Ivo und Max geben immer ihr Bestes für uns als Team und das spürt man auch im Alltag.“
Echtes Handwerk, das bleibt Wer mit Holz arbeitet, braucht ein gutes Auge für Form und Funktion, ein feines Händchen im Umgang mit dem Werkstoff –und den Anspruch, etwas zu schaffen, das nicht nur gut aussieht, sondern auch Bestand hat. Jedes Werkstück ist ein Unikat – getragen von der Idee, dass Qualität nicht vom Band kommt, sondern aus echtem Handwerk. Genau das lebt barth – Tag für Tag. Es entstehen individuelle Lösungen, maßgeschneidert bis ins letzte Detail. Was barth besonders macht, ist der gekonnte Mix aus Materialien: Neben Holz kommen auch Glas, Metall oder moderne Verbundstoffe zum Einsatz. Das Unternehmen setzt auf modernste Technik dort, wo sie das Handwerk unterstützt –und auf echtes Können dort, wo Maschinen an Grenzen stoßen. Bei barth wird das Tischlerhandwerk nicht nur ernst genommen, sondern aktiv gefördert – mit einem Umfeld, in dem Kreativität, Präzision und Stolz auf echte Handarbeit ganz selbstverständlich dazugehören.
Ein Arbeitsplatz mit Mehrwert
Bei barth gibt es ein breites Angebot an Benefits: Flexible Arbeitszeiten, Freistellungen für ehrenamtliches Engagement sowie Yoga-Kurse sind ebenso selbstverständlich wie regelmäßige Teamevents, organisiert vom firmeneigenen Freizeitverein. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das nicht nur produktiv, sondern auch wertschätzend und menschlich ist.
Ivo und Max Barth
Fotos: Alex Filz
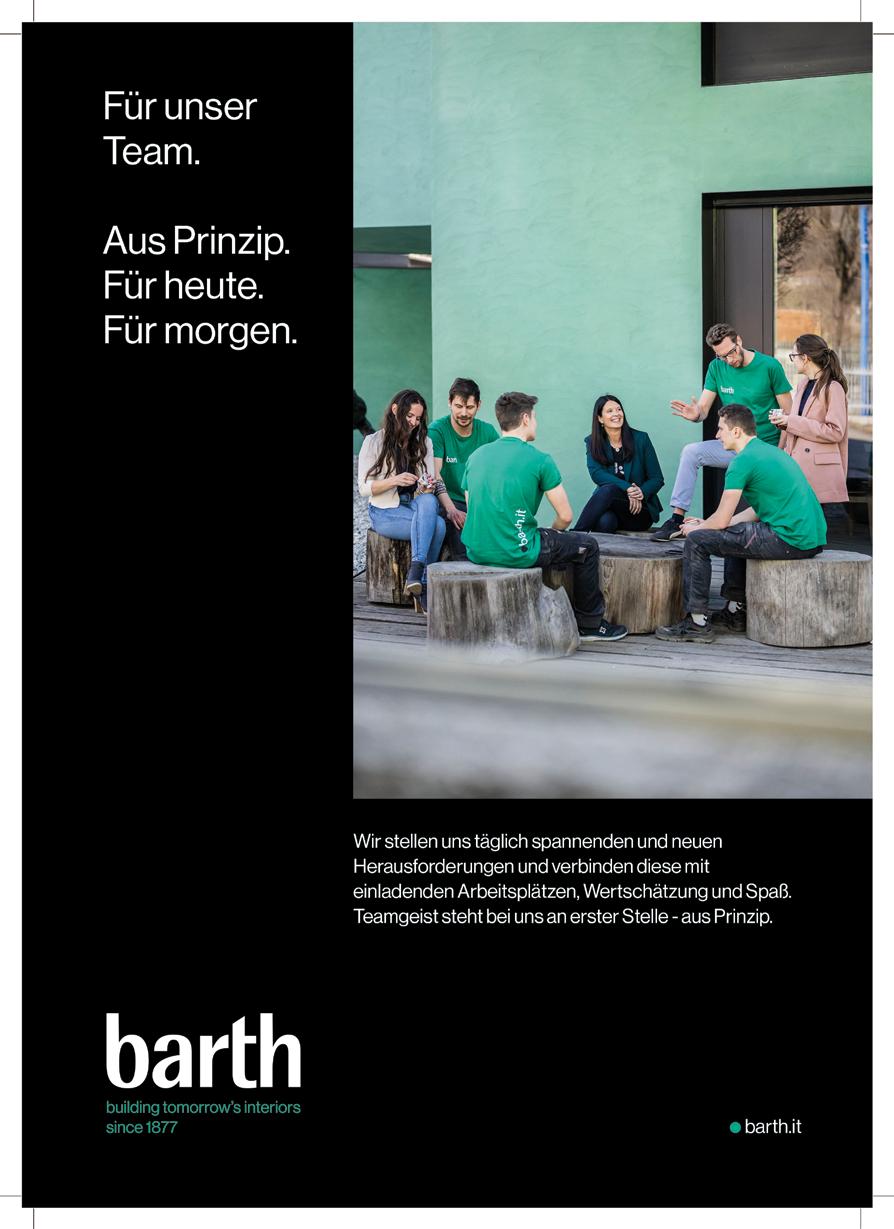
Die Macht der Farben
Farben sind weit mehr als bloße Dekorationselemente – sie sind psychologische Werkzeuge, die unsere Stimmung, Produktivität und unser allgemeines Wohlbefinden in Innenräumen tiefgreifend beeinflussen können.
BLAU wirkt beruhigend, entspannend und fördert die Konzentration – ideal für Schlafzimmer oder Arbeitszimmer, in denen Ruhe und Fokus gefragt sind. Es hilft, Stress abzubauen und einen erholsamen Schlaf zu fördern. Zu viel intensives Blau kann jedoch auch kühl oder distanziert wirken.
ROT ist eine Farbe der Energie, Leidenschaft und Aktivität. Es stimuliert und regt an. Im Esszimmer kann Rot den Appetit anregen und die Kommunikation fördern. Als Akzentfarbe in Wohnräumen kann es dynamische Impulse setzen und beleben, während ein Übermaß an Rot schnell als aufdringlich, überwältigend oder sogar aggressiv empfunden werden kann. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.
GELB steht für Optimismus, Freude, Licht und Kreativität. Es bringt Helligkeit in dunkle Räume, fördert positive Gedanken und
kann die geistige Aktivität steigern, weshalb es sich gut für Küchen, Flure oder kreative Arbeitsbereiche eignet. Ein zu grelles oder unpassendes Gelb kann jedoch auch Unruhe erzeugen.
GRÜN, die Farbe der Natur, symbolisiert Harmonie, Wachstum, Ausgeglichenheit und Erneuerung. Es wirkt beruhigend auf die Augen und fördert Entspannung sowie Regeneration. Grün ist eine exzellente Wahl für Wohnzimmer, Bäder und Büros, wo eine ausgeglichene, friedliche und naturverbundene Atmosphäre gewünscht ist.
WEISS steht für Reinheit, Klarheit, Weite und Neuanfang. Es lässt kleine Räume op tisch größer und heller erscheinen und dient oft als perfekte neutrale Basis, die andere Farben und Einrichtungselemente her vorragend zur Geltung bringt. Ein rein weißer Raum kann allerdings schnell steril oder kühl wirken, wenn er nicht durch wärmende Texturen, Holz oder ausgewählte Farbakzente belebt wird.
SCHWARZ vermittelt Eleganz, Stärke, Luxus und Raffinesse. In Maßen eingesetzt, beispielswei-
se für Möbel, Akzente oder eine einzelne Wand, kann es Tiefe und Dramatik erzeugen und eine sehr moderne Ästhetik schaffen. Ein Übermaß an Schwarz lässt Räume jedoch schnell klein, bedrückend und düster erscheinen.
GRAU ist die Farbe der Neutralität, des Ausgleichs und der Anpassungsfähigkeit. Es bietet eine vielseitige Leinwand für farbige Akzente und schafft eine ruhige, oft sehr moderne und stilvolle Atmosphäre. Die Wirkung variiert stark je nach Nuance – warme


Lukas‘ way to PROGRESS –
Vom Maurer zur Leitung der größten Baustellen Südtirols
Nach diesem Motto hat auch Lukas Bachmann nach rund zehn Jahren als Maurer seinen Weg zur PROGRESS GROUP gefunden. Baustellen waren ihm nie fremd. Sein Vater hat selbst 45 Jahre auf Baustellen, auch als Maurer, gearbeitet. Daher ist Lukas auf der Baustelle groß geworden und fühlt sich dort auch heute noch heimisch.
Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen.
Paulo Coelho
So stand Baggerfahrer, gleich hinter Astronaut, hoch auf seiner „Was werde ich, wenn ich groß bin“-Liste. Ganz weg von dem ist er nie gekommen, da er das technische Interesse, was ihn am Astronauten fasziniert hatte, und die Arbeit auf dem Bau als Bagger fahrer nun in seinem aktuellen Job perfekt verbinden kann. Bereits bei seinem ersten Projekt konnte er dies unter Beweis stellen.
Vom Maurer
zur Baustellenleitung
Lukas führt als Projekt leiter die größten und span nendsten Baustellen Südtirols, Österreichs und der Schweiz. Durch einen Bekannten wurde

er auf die Firma Progress AG aufmerksam und stieg wenig später als Verkäufer für das Pustertal ein. Dann kam Corona, alle waren zu Hause und ein Projektleiter für ein neues Projekt wurde benötigt. Lukas sprang ein und konnte sich von dem „Übergangsjob“ nicht mehr lösen. Zu spannend waren die Baustellen, die Aufgaben und das Arbeiten an verschiedensten innovativen Projekten. „Mir macht es einfach Spaß, überall Einblicke in die Technik zu bekommen, das Projekt von außen zu steuern und viel mit internen und externen Kollegen zusammenarbeiten zu können“, so Lukas zu seiner Entscheidung, Projektleiter zu bleiben und den Verkauf anderen Kollegen zu überlassen.
Großprojekt als Einstieg
Die Großbaustelle OBI, die bis heute eines seiner Lieblingsprojekte ist, war sein allererstes Projekt. Gemeinsam mit seinem Team musste er in kürzester Zeit enorme Mengen an Betonfertigteilen verbauen und alles daransetzen, dass dies laut Plan funktioniert. Auch wenn es bei seiner Tätigkeit – wie er betont – keine langweiligen Projekte gibt, ist
dieses erste besonders komplex gewesen. Genau das ist der Sinn in seinem Job, gibt er offen zu, denn für einfache Montagen braucht es keinen Projektleiter. Als Problem-Löser und bestenfalls Problem-Verhinderer trägt er viel Verantwortung, findet aber, dass es mit einem solchen Team nicht schwer ist, seine Arbeit gut und vor allem mit Freude zu machen.
We are PROGRESS
Unsere Mission ist es, nachhaltig bessere Lebensbedingungen für Menschen zu schaffen. Wir sind eine Unternehmensgruppe, die sich auf Maschinen und Software für die Automatisierung der Betonfertigteilproduktion spezialisiert hat und zudem ein eigenes Fertigteilwerk am Firmensitz in Brixen betreibt.

Für mehr Infos besucht unsere Website: www.progress.group/jobs
PROGR 1ESS GROLIP

RJr uriser TeamStichenwir
Softwareentwicl<Jer/Web iDev,eloper(m/w/d)
Sof'WareCcmsultant (m/wfd)
Sen.tioe Desk Mitarbeiter (m/w/d}
Konstrukteur für unseren 30-0.rucke,r lmlwld)
Proiektimanager (m.tw/d}
Elektriker !Elektrotechniker (rn/wtd)
Kranfüh er tür iHallen ki än e (m/w/d)
Technischer ze· C:hne für Bausysteme lmtw/d}
B ufn enieur (mtw/dj
9'Brixen
Bewirb dich hier?
www.progrEss grou pf,t0bs
Im „Hobbyraum“ von Herbert Nitz erzählt jedes einzelne Stück über den längst vergessenen Bauernalltag von früher. Ein Rundgang durch den ehemaligen Stall und die (jahrhunderte-)alten Schätze der Familie Nitz aus Egg.
Dinge, soweit das Auge reicht: Kornschaufeln, Mohnstampfer, Brotgrommeln, „Riffl“ zum Granten- und Schwarzbeerklauben, Weinfässer, Handhobeln, Holzski und aus Hanfseilen geflochtene Holz-Schneeschuhe, Fässer zum Buttern, Bügelscheren zum Schafe scheren … Das und weit mehr hat Herbert Nitz im ehemaligen Stall neben seinem Haus zusammengetragen. Alles ist schön geordnet, an die Decke gehängt, einsortiert, in Regalen und Kisten verstaut. Auf dem einstigen Bergbauernhof „Mesner“, dem heutigen Gasthaus „Egg“ unterhalb des Penserjoches auf 1.500 m, wird nichts weggeworfen. Auch sein Großvater war Tischler – er
„Glump“ Mehr als
hätte es nie übers Herz gebracht, das, was ihm lang einen treuen, wertvollen Dienst erwiesen hat, zu verbrennen, wegzuwerfen oder zu verkaufen.
Der „Heilige Geist“ blickt auf ein altes Feldtelefon, ein Röhrenradio und einen Telefunken-Fernseher herab. Die geschnitzte Gottestaube wurde früher auch „Suppenprunzer“ genannt, weil sie in der Stube über dem Esstisch hing, und während die Leute aus dem großen Topf Suppe löffelten, den hochgestiegenen Dampf in die Teller tropfen ließ. Gegossene Herrgötter von der Firma Leitner hat Herbert auch – und eine spezielle Glocke, die ein Ministrant mit sich trug, wenn der Pfarrer Sterbenden die letzte Ölung gab. Egal, was man Herbert fragt, er weiß von jedem Stück, wozu es diente. Der Anker an der Fuchsfalle sollte verhindern, dass sich der Fuchs die Tatze abreißt und verletzt davonhinkt. Der Jägerrucksack war mit Schießpulver, Schrotkugeln und

Papier gefüllt.
Viele Stücke sind über 100 Jahre alt und immer noch gut erhalten, weil sie im Trockenen gelagert sind. An der Decke hängen haufenweise Leisten und hölzerne Passformen. Sie gehörten dem Hausschuster, der auf den Höfen robuste Schuhe fertigte, sofern der Hausherr das nötige Leder dazu hatte. Die Sohle fertigte er aus Holz, verstärkt mit zahllosen kleinen Nägeln, um auf Hängen rutschfest gehen zu können. Zum Heuziehen wurden Fußeisen montiert, und um über eisige Wege nach Stilfes abzusteigen. Werkzeuge von mehreren Handwerksberufen sind hier zu finden. Die meisten gibt es heute nicht mehr, ebenso wenig wie die Geräte, mit denen sie einst gearbeitet haben.
Herberts „Sammlung“ reicht über die Holzstiege hinauf in den oberen Stock, zu den Wagen für die Heuarbeit, dem Gespann für Rind und Ross, den Ziehrechen und Minirechen, um das aufge-
bundene Heu am Schlitten an den Seiten herunterzurechen, Halbschlitten, Ganzschlitten mit „Penne“ und Weiberschlitten. Auf diesem durfte auch die Bäuerin aufsitzen, statt zu Fuß nach Stilfes gehen zu müssen. Viele fuhren mit dem Gonser nach Stilfes. Diese Rodel konnte man vorne hochheben, hinten waren Krallen, um auf dem Eis bremsen zu können. Die Seile brauchte es, um das Heu zusammenzubinden und es auf dem Kopf heimzutragen. Daneben stehen mehrere Spinnräder, eine Kinderkraxe, ein Kinderplumpsklo, eine Kälbertränke und ein Kaminbesen, die Herbert an die „Kamin-Tschuggen“ erinnert, kleine Bäumchen, welche die Buben aus dem Wald holten und im Kamin auf- und abschoben, um ihn zu reinigen. Mit dem Dreschflegel, der daneben hängt, wurden montags, nach dem sonntäglichen Tanz, möglichst im Takt die Getreidekörner aus den Fruchtständen geschlagen. Ein anderer spezieller

Schreitbaggera r beiten Tiefbauarbeiten Holzschi ägerung Spezialfällung Mulchen von Straßen und A mwiesen E-Mail mair-stefän,@outlook.com Tel +39 338 5310123
Schlägel diente dazu, Schweinen auf den Kopf zu schlagen, um sie zu betäuben.

Im Holzbottich rührten und kneteten Bauern im Frühjahr und im Herbst rund 150 kg Roggenmehl, Salz, Wasser und Kümmel zu einem Teig zusammen – eine anstrengende und klebrige Arbeit. Der Teig war auch ein guter Klebstoff, etwa um „Patschen“ zu machen. Noch heute backt Familie Nitz zwei- bis dreimal im Jahr Brotlaibe aus selbst gemahlenem Roggenmehl im steinernen Backofen. Die hauseigene Getreidemühle hat Herbert wieder in Gang gesetzt.
Zwischen alten Hüten und Schürzen, Krauthobeln, Buttermodeln, Mus- und Keschtnpfannen, Waagen, Geschirr, Waschtischen und Waschbecken, an die man auch „Weinhähne“ aufschrauben konn-
Wolfgang – Holz- und Steinbild hauer – einige seiner alten Modelle aufbewahrt: ein geschnitztes Murmeltier, eine Teufelsmaske, Krippen, Heiligenfiguren und vieles mehr.
Beim Hinausgehen zeigt Herbert noch einen alten, schwarzen Böller aus Eisen. Man füllte ihn mit Schwarzpulver und Papier. Wenn man ihn zündete, machte er einen lauten Krawall und die Papierfetzen flogen nur so herum – damit Brautleute ihre Hochzeit ja nicht verschliefen. Im Wald hat Herbert außerdem eine zerfetzte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Welche Art, lässt sich nicht mehr genau sagen. Er nahm sie mit, da Splitter dieser Größe nur noch selten zu finden sind. Zu seiner Sammlung gehören auch
kommen hat, Hellebarden und anderes Geschütz.
Auch wenn’s langsam eng wird, Platz gäbe es noch. Aber was Herbert nicht kennt, braucht er nicht. Und was er schon lange haben will – einen Rohrbohrer und eine „echte“ Bretterschneidesäge –hat niemand mehr. So baute sich Herbert, gelernter Elektriker, der gern tischlert, eine Säge nach.
Sein aktuelles Projekt ist ein detailgetreuer Nachbau der Bohrerkirche, der St. Bernhardkirche und der Hofkapelle, die in Egg stehen bzw. gestanden sind: Miniaturen aus Holz, mit abdeckbarem Dach, je nach Kirche versehen mit Bänken, Kanzel, Glocken, Sonnenuhr und Wetterhahn auf dem Kirchturm. Nach diesem richtete der Mensch viele Arbeiten auf Feld
digte sich Wind und wohl eine verregnete Heuarbeit an. Im Winter konnte bei Wind wegen drohender Lahnen kein Heu gezogen werden.
Herbert nennt den Sammlerraum „Hobbyraum“ – weder „Werkstatt“ noch „Museum“. Er kennt sowieso nur ein einziges Museum, das auch wirklich gut ist: das Freilichtmuseum Stübing bei Graz. Dort arbeiten ältere Leute heute noch mit dem Werkzeug von früher. Deswegen sind sie auch die einzigen, die ihm eine Antwort geben können, wenn er sie über die landwirtschaftlichen Praktiken und das Handwerk vergangener Zeiten fragt. Erst das, sagt Herbert, mache ein Museum zu einem echten Museum.

lvh-Senioren

Vier Tage voller Magie, Kultur und Pariser Flair: Vor kurzem verwandelte sich die „Stadt der Liebe“ für 30 reiselustige Südtiroler Althandwerker in eine traumhafte Kulisse für besondere Begegnungen, stimmungsvolle Entdeckungen und unvergessliche Eindrücke.
Die bunt gemischte Reisegruppe – bestehend aus junggebliebenen Senioren und Begleitern – hatte Glück auf ganzer Linie: perfektes Wetter, ein charmantes Design-Hotel mitten im malerischen Montmartre-Viertel, kulinarische Höhepunkte und
natürlich die Stadt selbst, die sich in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt zeigte.
Zwischen Seine-Schifffahrt bei Sonnenuntergang, dem majestätischen Eiffelturm, charmanten Spaziergängen durch den Jardin du Luxembourg und der legendären Mona Lisa im Louvre war für alle etwas dabei. Besonders die deutschsprachige Stadtrundfahrt sorgte für Begeisterung – ein echtes Highlight, das Geschichte, Architektur und Pariser Lebensgefühl wunderbar miteinander verband.
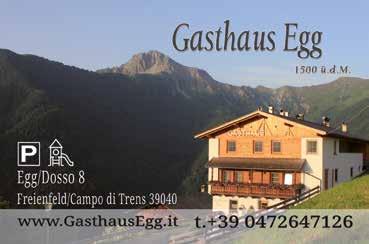
Der Wintergarten kehrt zurück
Nach fünfjähriger Pause können nun wieder Wintergärten an bestehenden Gebäuden errichtet werden. Die neuen Bestimmungen bringen einige Änderungen im Vergleich zu den früheren Regelungen mit
Gute Nachrichten für alle, die sich den Traum vom eigenen Wintergarten erfüllen möchten: Mit et des Landeshauptmannes ist der Bau von Wintergärten in Mischgebieten – auch im historischen Ortskern – wieder möglich. Davon betroffen sind jedoch nur bestehende Gebäude, die vor dem 4. September 2007 errichtet wurden.
Da der Wintergarten im Sinne des Gesetzes als Maßnahme zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen gilt, wird seine Fläche auch künftig nicht für die Baumassenberechnung herangezogen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden:
GasthauEgg
stattet sein.
✅ Die Bauteile müssen bestimmte Wärmedämmwerte (U-Werte) einhalten.
✅ Mindestens 70 Prozent der Fassadenfläche des Wintergartens müssen verglast sein.

✅ Das Gebäude muss vor dem 4. September 2007 bestanden haben oder über eine Baugenehmigung vor diesem Datum verfügen.
✅ Der Abstand zwischen Gebäudeaußenwand und Verglasung des Wintergartens darf maximal 3,5 m betragen.
✅ Die Wärmespeicherung sowie die Wärmeabfuhr ins Gebäude müssen sichergestellt sein.
✅ Der Wintergarten darf nicht mit einer Heizanlage ausge-
Werden all diese Voraussetzungen erfüllt, darf ein Wintergarten im Ausmaß von maximal acht Prozent der Bruttofläche der Wohneinheit errichtet werden, wobei der Wintergarten in jedem Fall eine Fläche von 9 m2 erreichen darf und die Fläche von 30 m2 nicht überschreiten darf.
In Gebieten mit Durchführungsoder Wiedergewinnungsplan muss die Möglichkeit zur Errichtung eines Wintergartens laut dieser Verordnung im jeweiligen Plan vorgesehen sein. Es empfiehlt sich daher, bereits im Vorfeld Rücksprache mit der Gemeinde zu halten.
www.verbraucherzentrale.it
Auf zur Futurum!
nung gesorgt! Der Eintritt ist frei.

18. bis zum 20. September in der Messe Bozen statt und bietet gemeinsam mit den Landesmeisterschaften der Berufe ein abwechslungsreiches Programm für Jugendliche und deren Eltern
Die Futurum 2025 informiert aktuell und umfassend zu den Bildungs- und Berufswegen und erleichtert Jugendlichen
Für jede:n was dabei

und deren Eltern die Entscheidung bei der Wahl der Ausbildung. Zeitgleich findet die Landesmeisterschaft der Berufe WorldSkills South Tyrol, Italy statt, bei der junge Talente aus unterschiedlichen Berufsgruppen in spannenden Wettbewerben gegeneinander antreten. Die Wettkämpfe gelten als offizielle Vorausscheidung für die Teilnahme an der nächsten Berufsweltmeisterschaft in Shanghai im September 2026. Damit ist für Span-
Die Bildungsmesse, die vom 18. bis zum 20. September von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Messe Bozen über die Bühne geht, richtet sich im Besonderen an junge Menschen und deren Eltern. Jugendliche der Mittelschule können sich direkt am Stand der Schulen darüber informieren, welche deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Schulen und Ausbildungswege es nach dem erfolgreichen Mittelschulabschluss gibt. Oberschülerinnen und Oberschüler werden an den Ständen der Unis und Fachhochschulen aus Südtirol, Tirol, dem Trentino und Norditalien beraten. Die Studieninformation Südtirol ist ebenfalls vor Ort und berät u. a. zur Anerkennung der Studientitel. Auch Erwachsene, die Interesse an einer Weiterbildung oder Neuorientierung haben, sind bei der Futurum 2025 genau richtig.
Besondere Initiativen Im Rahmen der Futurum informiert das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen beim Stand „Schule-Wirtschaft“. Ziel der Initiative ist es, Informationen zur Südtiroler Wirtschaft zu vermitteln, Interesse an wirtschaftlichen Themen zu wecken und unternehmerisches Denken zu fördern. Zudem bekommen Be-
triebe am 19. September beim „Meet the companies“ die Gelegenheit, sich Jugendlichen zu präsentieren und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Weiteres Highlight ist der MINT-Stand, bei dem es Wissenswertes rund um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gibt. Darüber hinaus bietet das Amt für Ausbildungs- und
Berufsberatung den Messebesucher:innen individuelle Beratung und Informationen.
WorldSkills South Tyrol, Italy Tel. 0471 945 777 worldskills@ handelskammer.bz.it www.worldskills.it

woddskil\s SouthTyrolltalyin Act1

62. Althandwerkertreffen
Rund 600 Senioren aus dem gesamten Land kamen Ende Juli zum traditionellen Althandwerkertreffen in die Festung Franzensfeste. Das diesjährige Treffen wurde vom lvh-Bezirk Wipptal unter der Leitung von Bezirksobfrau Petra Holzer und Ortsobmann Thomas Kerschbaumer in Zusammenarbeit mit zahlreichen Helfern veranstaltet.
lvh-Präsident Martin Haller würdigte die Verdienste der ehemaligen Handwerker und hob ihre Erfahrung als wertvolle Grundlage für kommende Generationen hervor. Lobende und anerkennende Worte sprachen auch zahlreiche Ehrengäste. „Es ist immer wieder eine große Ehre für mich, auf viele Kollegen zu treffen, gemeinsam zu lachen und sich auszutauschen“, so lvh-Obmann Johann Zöggeler, der mit 2.100 Mitgliedern der größten Gruppe innerhalb des Verbandes vorsteht.
Mit großem Applaus wurden die beiden ältesten Teilnehmer ausgezeichnet, darunter Anna Mantinger Mitterrutzner (98 Jahre) aus Brixen sowie Schuhmacher Sebastian Brugger (96 Jahre) aus Bruneck.
Das Althandwerkertreffen bot den idealen Rahmen, um Erinnerungen aufleben zu lassen, alte Bekannte wiederzusehen und neue Freundschaften zu schließen – ein unvergesslicher Tag voller Freude, Gemeinschaft und Anerkennung.
Langlebig und nachhaltig
In einer Zeit, in der schnelle Bauweisen oft im Vordergrund stehen, erlebt der traditionelle Ziegelbau eine wohlverdiente Renaissance. Er steht für Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und ein unvergleichliches Wohnklima, die ihn zu einer attraktiven Wahl für Bauherren machen, die in die Zukunft investieren möchten. Die Vorteile des Ziegelbaus reichen weit über seine Ästhetik hinaus und bieten praktischen und ökologischen Nutzen.
Ziegel sind bekannt für ihre extreme Widerstandsfähigkeit. Sie trotzen Wind und Wetter über Jahrhunderte hinweg, was sie zu einem der langlebigsten Baumaterialien überhaupt macht. Ein in Ziegelbauweise errichtetes Gebäude behält nicht nur seinen Wert über Generationen, sondern kann diesen sogar steigern. Die geringe Anfälligkeit für Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge oder Feuer minimiert den Wartungsaufwand und sichert die Investition langfristig ab. Diese Robustheit redu-
ziert zudem den Bedarf an aufwendigen Sanierungen, was sowohl Kosten als auch Ressourcen spart.
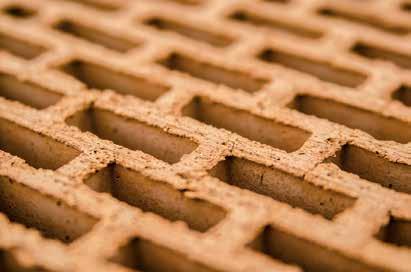
Nachhaltigkeit und Wohngesundheit
In Zeiten des Klimawandels gewinnt die ökologische Bilanz von Baumaterialien immer mehr an Bedeutung. Ziegel bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Lehm, Sand und Wasser – Materialien, die lokal abgebaut werden können und reichlich vorhanden sind. Ihr Herstellungsprozess

ist vergleichsweise energieeffizient, am Ende ihrer langen Lebensdauer sind Ziegel vollständig recycelbar.
Darüber hinaus tragen Ziegel erheblich zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was Schimmelbildung vorbeugt und für eine konstante, angenehme Luftfeuchtigkeit sorgt. Die Fähigkeit von Ziegeln, Wärme zu speichern und langsam abzugeben, trägt zudem zu einer natürlichen Temperaturregulierung bei, die sowohl im Sommer als auch im Winter für ein behagliches Wohngefühl sorgt. Frei von chemischen Zusätzen sind Ziegel zudem besonders allergikerfreundlich.
Energieeffizienz und Schallschutz
Die massive Bauweise mit Ziegeln bietet von Natur aus eine hervorragende Wärmedämmung. Die hohe Speichermasse der Ziegelwände sorgt für ein träges Temperaturverhalten im Gebäude. Das bedeutet, dass die Wärme im Winter lange im Haus bleibt und im Sommer die Hitze draußen gehalten wird. Dies führt zu niedrigeren Heiz- und Kühlkosten und trägt somit aktiv zum Klimaschutz bei.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der hervorragende Schallschutz. Die dichte Struktur von
Ziegelwänden absorbiert Schallwellen effektiv und reduziert die Übertragung von Außenlärm sowie Geräuschen zwischen einzelnen Räumen. Dies schafft eine ruhige und entspannte Wohnatmosphäre, die besonders in dicht besiedelten Gebieten oder Mehrfamilienhäusern von unschätzbarem Wert ist.
Zeitlose Ästhetik und Vielseitigkeit
Ziegelhäuser haben einen unverwechselbaren Charme und eine zeitlose Ästhetik, die sich in unterschiedlichste architektonische Stile integrieren lässt – von rustikal bis modern. Die Vielfalt an Farben, Formen und Oberflächen von Ziegeln bietet Architekten und Bauherren große Gestaltungsfreiheit. Ob klassischer Rotziegel, elegante Klinkerfassade oder weiß geschlämmter Ziegel – der traditionelle Ziegelbau ermöglicht individuelle Lösungen, die über Generationen hinweg begeistern.
Angesichts dieser vielfältigen Vorteile ist es nicht verwunderlich, dass der traditionelle Ziegelbau weiterhin als kluge und zukunftssichere Entscheidung für private Bauherren, Investoren und Gemeinden gilt, die Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und dauerhaften Komfort legen.
Im Zeichen eines Jahrhundertprojektes
Die diesjährige Jahresversammlung der Elektrotechniker und Elektromechaniker im lvh fand in der beeindruckenden Kulisse der Festung Franzensfeste und im BBT-Infopoint statt.

Einen eindrucksvolleren Rahmen für die Jahresversammlung hätte man sich kaum wünschen können: Der exklusive Blick in den Brenner Basistunnel (BBT) bildete den praxisnahen Auftakt: Bei einer geführten Baustellenbesichtigung erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Anschließend eröffnete Herbert Kasal, der Obmann der Elektrotechniker im lvh, die Versammlung, gefolgt von einem Grußwort von lvh-Präsident Martin Haller. Im Rückblick auf das vergangene Jahr standen Weiterbildung, rechtliche Neuerungen und die Digitalisierung im Fokus. Für das kommende Jahr kündigte die Berufsgemeinschaft weitere Impulse im Bereich Normenarbeit an.
Ein Höhepunkt war der Fachvortrag von Florian Alber, Kommandant der Berufsfeuerwehr Bozen, zum Thema Brandschutztechnik. Er unterstrich die wachsende Bedeutung elektrotechnischer Fachkräfte bei sicherheitsrelevanten Anlagen. Beim abschließenden Austausch wurde deutlich: Die Kombination aus Praxis, fachlichem Input und kollegialem Miteinander macht die Jahresversammlung zu einem wichtigen Impulsgeber für die Zukunft der Branche.
Im Bild die Teilnehmer bei der Begehung des BBT.

Brauchtum
Lebendiges auf der Alm
Am 24. August ist auf den Almen im Wandergebiet Ratschings-Jaufen die faszinierende Welt des traditionellen Handwerks zu sehen. Von 11.30 bis 16.30 Uhr führen Handwerker altes Handwerk vor – von der Spinnerei über Textilkunst bis hin zum Schuhmacher und Drechsler.
Alles handgewebt
Edith Gschnitzer aus Thuins webt gerade Küchentücher und Deckchen für Holzschüsseln. Vorwiegend aus Leinen und Baumwolle, ihren Lieblingsfasern. In Naturfarben, ihren Lieblingsfarben. An einem Küchenhandtuch arbeitet sie zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie lang und breit das Gewebe ist und wie viele Fäden es pro Zentimeter braucht. Die Fäden schären, sie auf den Webstuhl aufziehen, durch die Litzen und das Webblatt ziehen, mit dem Schiffchen Schuss für Schuss die Fadenkette setzen, zum Schluss das fertige Gewebe vom Stuhl nehmen, den Stoff nähen, waschen und bügeln ... Das alles braucht Zeit. Von Beruf ist Edith pädagogische Mitarbei-


Instrumentenwerkstatt • Offlcina degli strumenti
STEVE
Reparatur und Neubau von Blechblasinstrumenten
Obk11d1er Stei.i11
Pflersch 67, 39041 ßren11e1, BZ IT + 39 348 362 46(),; stcfanobkirchc,9.s@gmail.com
terin in einem Kindergarten, sie steht kurz vor der Pension. Vor acht Jahren hat sie die Webschule in Imst besucht. Vorher schaute sie dem Weber Michael Scharrer aus Hinterpflersch über die Schulter, die Weberei hat sie sofort gepackt. „Die Ordnung fasziniert mich am meisten“, sagt Edith. „Weil man genau sein, zählen und mitdenken muss.“ Am Anfang fand sie alles kompliziert. „Weben hat viel mit Mathematik zu tun.“ Mit der Zeit vertraute sie darauf, nach Gefühl zu weben – und staunt jedes Mal, wie sich Edith Gschnitzer: „Die Ordnung fasziniert mich beim Weben am meisten.“
Die beste Lösung für Blechblasinstrumente
Ich bin Stefan Obkircher, Blechblasinstrumentenbauer aus Pflersch. Mit viel Liebe zum Detail und einem feinen Gespür für Klangqualität und Spielbarkeit fertige ich individuelle Instrumente. Reparaturen, Restaurierungen und persönliche Anpassungen machen meinen Beruf spannend und herausfordernd. Seit über einem Jahr bin ich nun selbstständig und möchte mich bei all meinen Kunden für ihr Vertrauen bedanken. Kontaktieren Sie mich und wir finden gemeinsam die beste Lösung für Ihr Blechblasinstrument.
die einzelnen Fäden langsam zu einem Muster zusammenfügen.
Die Weberei ist für Edith auch eine Schule fürs Leben. „Oft wehrt es sich und ich muss eine Entscheidung treffen: Lasse ich es jetzt bleiben oder fange ich neu an?“ Weben bringt sie zur Ruhe, wenn sie wieder einmal zu viel auf einmal machen will, und merkt, dass dann erst recht nichts mehr geht. „Weben gibt mir die Struktur und Ordnung, die mir im Alltag manchmal fehlen.“
Gerne setzt sich Edith auch vor das Spinnrad, befestigt den Anfangsfaden an der Spule, tritt mit dem Fuß aufs Pedal, hält mit einer Hand den gesponnenen Faden und zieht mit der anderen Hand langsam Fasern aus dem Wollvorrat heraus und verbindet am drehenden Rad Fasern zu Garn. Ein langsamer, meditativer Prozess.
Seit Edith selbst spinnt und webt, geht sie viel bewusster mit Stoffen um. „Ein handgewebtes Stück anzufassen, macht mich ehrfürchtig, weil ich weiß, wie viele Stunden es gebraucht hat, bis es entstanden ist.“ Bei Veranstaltungen zeigt sie anderen gerne ihr Spinnrad, ihren Tischwebstuhl und ihre

Arbeit, weil sie ihr sehr am Herzen liegen. Einmal kam ein zwölfjähriger Junge an ihrem Stand vorbei. Er war so fasziniert vom Webstuhl, dass sie ihn einlud, selbst ein kleines Stück zu weben. Er blieb ganze zwei Stunden. „Weben zieht einen in den Bann. Das Geschick, mit einem Webstuhl zu arbeiten, kommt dann fast von allein.“
Rundum gedreht
In der Drechselbude von Roland Rizzi dreht sich alles ums Holz. Sorgfältig spannt er ein Stück in seine Drehbank ein, schaltet sie ein und beginnt den schnell rotierenden Rohling mit Dreheisen und ruhiger Hand zu schneiden, zu schleifen und zu polieren, um daraus eine Schüssel, eine Christbaumkugel,
Roland Rizzi aus Gossensaß: „Beim Drechseln vergesse ich den Alltag.“

einen Salz- und Pfefferstreuer oder ein anderes rundes Objekt zu formen. Jedes Stück ist ein Unikat.
Gut Gedrechseltes braucht gutes Geschick und ein scharfes Auge. Der Holzrohling ungenau eingespannt, das Dreheisen zu stumpf, das Messer falsch angesetzt, das Holz zu trocken oder zu feucht, und das ganze Kunstwerk ist verloren. Roland arbeitet ohne festen Plan, lässt sich vom Holz inspirieren und führen. Die Zirbe mag er am liebsten, wegen ihrer feinen Struktur und ihrem harzigen Duft. Aber auch aus Birke, Esche, Ahorn, Nuss und Erle, von Pilzen oder schwarzen Linien durchzogenem alten Bauholz entstehen wunderbare Gegenstände zum Anschauen und Gebrauchen. Für filigrane Schreibgeräte, Schlüsselanhänger und Schmuck verwendet Roland exotische Hölzer, u. a. aus Indonesien, Hawaii, Süditalien oder Amerika.
Die Drehbank hat der gelernte Maschinenschlosser vor vielen Jahren selbst gebaut – als Geschenk für seinen Schwiegervater. Nach dessen Tod holte er sie zurück und begann, mit ihr zu
Handwerk & Musik auf der Alm
• Rinneralm: Spinnen / Ridnauner Böhmische
• Summit Mountain Club: Textile Handwerkskunst / Brixner Böhmische
• Wasserfalleralm: Schuhe machen / Böhmische Klausen
• Kalcheralm: Drechseln / Auftritt der Volkstänzer Wiesen
arbeiten und von ihr zu lernen. Mittlerweile ist die Drehbank weit mehr als sein Lieblingshobby. Sie ist sein Refugium, wo er stundenlang Holz in Form bringt, während die Zeit stillsteht.
Handwerkerin mit Faden und Wolle
Ingrid Bodner hatte Glück. Schon im Grundschulunterricht lern-

Ingrid Bodner häkelt, webt, macht Makramee und Punch Needle – künstlerische, nachhaltige Einzelstücke aus ethisch und regional hergestellten Materialien © silbersalz
te sie Häkeln, Stricken, Filzen, Weben, Nähen, wie sie ihre Hände als Werkzeug und das Geschick mit Faden und Wolle als ganz besondere Sprache nutzen kann. Ingrid aus Osttirol, seit jeher mit Südtirol verbunden, lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Antholz. Ihr Lebenslauf gleicht einem Patchwork: Über ihre Arbeit im Kindergarten und Tourismus fand sie – dank ihrer drei Kinder – wieder zurück zur geliebten Handarbeit, die seit drei Jahren auch ihr Beruf ist.
Anfangs häkelte sie für Freunde und Verwandte Stirnbänder aus nachhaltigen Materialien, weil dies auch den konsumbewussten und gesunden Lebensstil ihrer Familie widerspiegelt. Ihre bisher aufwendigsten Projekte: Stirnbänder aus Merinowolle für die Biathlon-WM 2020 mit AntholzSchriftzug und gehäkelte, konische, alpingemusterte und maßgeschneiderte Lampenschirme für das Boutique Biohotel Gitschberg in Meransen. Ingrid liebt Interior-Kunst und Ästhetik, das meditative Fließen in der Langsamkeit, das Handgriff für Handgriff Designs und Muster entstehen lässt, die es vorher nicht gab. „Ich bin Handwerkerin mit Passion für Kunst”, sagt die Textilkünstlerin, weil sie auch Dinge fertigt, die das Wohnen schöner machen, darunter Wandteppiche, Wandbilder und InteriorDekor. Ihre Technik: Häkeln in allen Varianten und Makramee, eine jahrtausendealte meditative Knüpfkunst, die sie sich über Youtube und Bücher selbst angeeignet hat. Mittlerweile gibt sie selbst Kurse und Workshops über Techniken, für Bildungshäuser, Verbände, Schulklassen, Lehrpersonen und Interessierte, um ihnen zu zeigen, wie man auch aus alten Häkeldecken noch neue Kunstwerke wie Mandalas
oder Traumfänger machen kann. Und dass Handarbeit Kopf und Herz freimacht. Gerade beim Makramee finden viele Kinder und Jugendliche Ruhe und Fokus. Auch wenn Ingrid immer alle Hände voll zu tun hat, der Spagat zwischen Familie und Selbstständigkeit groß ist, nimmt sie sich Zeit für sich, joggt und experimentiert liebend gern mit neuen Techniken – derzeit Tufting, bei der mit einer Nadelpistole Garn in Stoff geschossen wird, um Masche für Masche einen Teppich zu nähen. Eine Bildserie ist in Planung. Als Amateurfotografin weiß Ingrid, wie inspirierende Räume die Kreativität beflügeln. Kein Wunder also, dass der Künstlerin in ihrer Textilmanufaktur „Kunst.in.Textil” Ideen regelrecht entgegentanzen.
Wie man Schuhe macht „Wie macht man eigentlich Schuhe?“ Ausgerechnet während seiner Doktorarbeit in Biologie wollte ihm diese Frage nicht mehr aus seinem Kopf gehen. Martin-Carl Kinzner aus Gossensaß konnte nicht anders: Er musste sich von Walter Brunner, dem letzten Schuhmacher im Wipptal, zeigen lassen, wie dieses Handwerk geht. Und so kam es, wie es kommen musste: Martin-Carl schmiss seinen Beruf als Biologe, absolvierte in Dornbirn (Vorarlberg) die Maßschuhmacher-Lehre, eröffnete seine eigene Werkstatt in Sterzing – und ist immer noch glücklich damit. Seit Herbst 2019 fertigt er Schuhe vom Schaft bis zur Sohle, jede einzelne Naht von Hand gearbeitet. 20 bis 40 Stunden Arbeit stecken in einem Maßschuh, je nach Modell und Machart, ganz nach Wunsch des Kunden. „Ich lerne enorm viel während meiner Arbeit als Schuhmacher, über

Füße und Geh-Gewohnheiten der Kunden und über mich selbst, wenn ich an handwerkliche oder anatomische Grenzen stoße. Es ist wie je den Tag Selbst-Therapie, um meinen Mentor zu zitieren“, so Martin-Carl lachend. Sein bevorzugtes Material ist Leder, ein vielseitiger Rohstoff: elastisch und fest zugleich, anpassungsfähig, atmungsaktiv, langlebig und es kann problemlos repariert werden – egal, ob Martin-Carl es zu einem Schuh, einer Handtasche oder einem anderen Accessoire verarbeitet hat. Seit einiger Zeit konzentriert sich „dor Schuachmocher“ darauf, seine Produkte vorwiegend aus Südtiroler Häuten zu fertigen. In Zusammenarbeit mit einigen ausgewählten Bauern entsteht hochqualitatives Leder aus Südtirol für traumhafte Schuhe und Lederwaren – aus Südtirol.
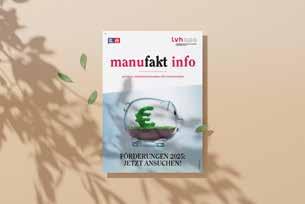
Alle aktuellen Förderungen, vor allem auf Landesebene, sind in der Digital-Ausgabe der „manufakt info“ zu finden. Diese erscheint digital und wird ständig bezüglich der neuesten Fördermaßnahmen aktualisiert. Für jede Förderkategorie werden detaillierte Informationen zu den Zielgruppen, den Fördersätzen, den Antragsverfahren und den Kontaktinformationen bereitgestellt.
rb/bar
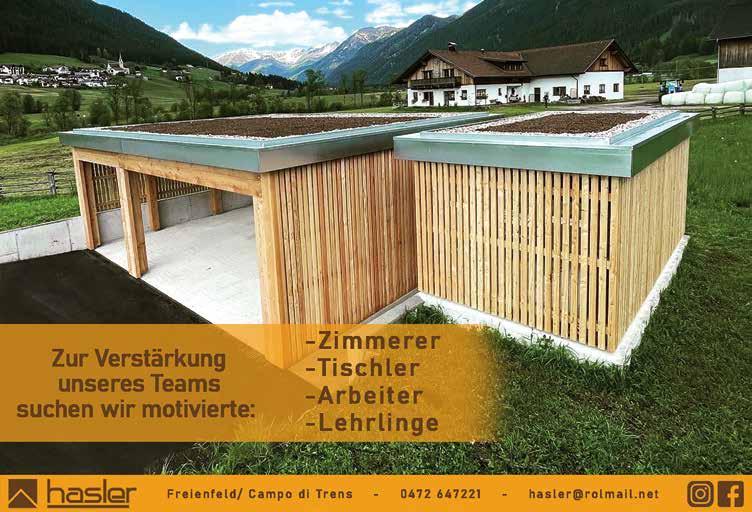
Mortec Tooor, wir suchen Menschen wie dich, die mehr wollen!!!

Mortec Tooor ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Kaltern, spezialisiert auf die Herstellung von Torsystemen für den Pri vatsektor und Industriebedarf, fertigt aber auch Umzäunungen und Balkongeländer an. Was das Unternehmen mit mittlerweile 40 Mitarbeitern so attraktiv macht, sind das gute Betriebsklima, familienfreundliche Rahmenbedingungen und fließenden Eintrittszeiten. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens ist breit gefächert, was die Arbeit abwechslungsreich macht. Wenn du kommunikativ und kontaktfreudig bist, es dir Freude bereitet, andere Menschen zu begeistern, und du dich in ein junges dynamisches Team einbringen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Konkret gesucht werden ein Montage-Techniker und ein externer Verkaufsberater. Technisch Interessierte können sich gerne melden: jobs@mortec.it oder Tel. 0471 962 510

Raum für Türen
Ob elegant, geradlinig oder als optisches Highlight – Innentüren bieten weit mehr als reinen Sicht- und Schallschutz. Sie beeinflussen maßgeblich, wie wir Innenräume wahrnehmen.

Je nach Design können Türen verschiedene Atmosphären schaffen oder den Fokus auf andere Raumdetails lenken. Schlichte, flächenbündige Türen, oft weiß und unauffällig, fügen sich harmonisch in die Wand ein und rücken andere Gestaltungselemente in den Mittelpunkt. Diese Zurückhaltung eignet sich u. a. für öffentliche oder repräsentative Räume
Durch bewusste Material- oder Farbwahl können Türen auch zu einem erfrischenden Blickfang werden. So vermitteln dunkle Holztüren Wärme und Gemütlichkeit. Glastüren lassen Räume optisch weiter und offener
wirken, indem sie Licht fließen lassen und dennoch Grenzen schaffen. Auch satiniert, verspiegelt oder ornamentiert beeinflussen sie die Atmosphäre in einem Raum.
Kombinierte Glas-Holz-Innentüren erzeugen eine lebendige, elegante und lichtdurchflutete Wohnatmosphäre und verbinden Stabilität mit filigraner Leichtigkeit.
Ein kraftvolles gestalterisches Element sind auch raumhohe Innentüren. Sie erstrecken sich vom Boden bis nahezu zur Decke oder bis zur Deckenhöhe, vergrößern Räume optisch und verbinden sie gleichzeitig miteinander.
„Mission Handwerk“
Im Zweiwochenrhythmus informieren Südtirols Junghandwerker in ihrem Podcast „Mission Handwerk“ über die neuesten Trends und Entwicklungen im Handwerk. Mal gibt es „Couchratscher“ mit Experten, mal Diskussionen im „Pro & Contra“, mal inspirierende Geschichten und praxisnahes Wissen für alle Handwerksbegeisterten, um voneinander zu lernen und das Handwerk in all seinen Facetten zu beleuchten. Der Podcast ist u. a. auf der Webseite www.junghandwerker. it/#podcast zu hören.
Berufsfindungstag bei der Baufirma Graus
Im Rahmen des Berufsfindungstages der GRW Wipptal/ Eisacktal hat die Baufirma Graus auch heuer wieder interessierte Mittelschüler auf ihrem Firmengelände empfangen.
Die Jugendlichen erhielten einen praxisnahen Einblick in verschiedene Berufe des Bauhandwerks. Mit Helm und Handschuhen ausgestattet durften sie selbst Hand anlegen und typische Tätigkeiten auf dem Bau kennenlernen.
„Wir möchten junge Menschen für das Handwerk begeistern und zeigen, welche Chancen die Baubranche bietet“, so Martin Brunner von der Firma Graus.
Giornata dell'orientamento professionale presso l'impresa edile Graus
Nell'ambito della giornata dell'orientamento professionale organizzata dalla GRW Wipptal/Eisacktal, anche quest'anno l'impresa edile Graus ha accolto presso la propria sede studenti delle scuole medie interessati al settore.

Das Interesse war groß – viele Schüler zeigten sich beeindruckt und informierten sich rege über Ausbildungswege im Baugewerbe.
I ragazzi hanno potuto ottenere una visione pratica e diretta delle diverse professioni artigianali nel settore edile. Dotati di casco e guanti, hanno avuto la possibilità di cimentarsi in attività tipiche del cantiere e conoscere da vicino il lavoro sul campo. "Vogliamo entusiasmare i giovani per i mestieri artigianali e mostrare le opportunità che il settore edile può offrire", ha dichiarato Martin Brunner dell'impresa Graus. L'interesse è stato elevato: molti studenti si sono mostrati impressionati e si sono informati attivamente sui percorsi formativi nel settore delle costruzioni.

Sportmedizin Gesundheit
„Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.
Sebastian Kneipp
„
Freiwillige im Sozialdienst
Das ganzheitliche Verständnis der Gesundheit ist in der traditionell asiatischen Philosophie und Medizin tief verwurzelt, aber auch in Europa gab und gibt es neben der (Weiter-)Entwicklung der wissenschaftlichen Medizin eine holistische Tradition.
Das Modell von Sebastian Kneipp ist dabei verblüffend modern. Es betont die tragende Wichtigkeit von fünf Säulen für die Entwicklung und den Erhalt der Gesundheit und bringt sie mit einfachen Sprüchen auf den Punkt:
„Wenn der Vater einer Erkrankung oft unbekannt ist, die Mutter ist immer die Ernährung.“
ERNÄHRUNG
KRÄUTER
BALANCE
„Derjenige wird am besten tun, der eine gemischte Kost hat.“
„Jeder Karren braucht Schmiere – und der Körper Fett“.
„Die Natur ist die beste Apotheke.“
„Jedes einzelne Kräutlein hat seine eigene individuelle Wirkung.“
„Im Maße liegt die Ordnung. Jedes Zuviel und Zuwenig setzt anstelle von Gesundheit die Krankheit.“
„Untätig schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet.“
„Der Mensch ist die unteilbare Einheit von Leib und Seele.“
„VOR jeder Anwendung sich die nötige Wärme verschaffen.
NACH der Anwendung muss abermals durch Arbeit oder Bewegung die nötige Wärme gesucht werden.“
WASSER
BEWEGUNG
„Die meisten Krankheiten können auf vier verschiedene Arten mit dem Wasser geheilt werden: mit Waschungen, Bädern, Wickeln und Gießungen.“
„Als Regel für alle kann gelten, dass die Minimalzeit nach einer Wasseranwendung stets ¼ Stunde betragen soll. Wie dieselbe ausgefüllt werde (durch Gehen, Arbeit usw.) bleibt sich gleich.“
„Das natürlichste und einfachste Abhärtungsmittel besteht im Barfußgehen.“
„Auch die Atemgymnastik kann mit dem Spaziergange leicht verbunden werden.“
Das Kneipp’sche Wassertreten ist wohl die bekannteste, aber nur eine vieler Methoden der Kneipp-Gesundheitslehre, deren besonderes Potential sich aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Säulen ergibt. Im Wipptal und im restlichen Land gibt es verschiedene Kneippanlagen, die neben Wasserbecken und Brunnen, Barfußwegen, Kräuterspiralen und Ruhezonen auch viele Informationen und geführte Anwendungen bieten.
Der Sozialdienst Wipptal hat das Jahr 2025 zum „Jahr der Freiwilligen im Sozialdienst“ erklärt, um den wertvollen Einsatz der Freiwilligen wertzuschätzen, ihre Tätigkeit noch sichtbarer zu machen und weitere Menschen für das freiwillige Engagement zu gewinnen.
Gemeinsam mit den Freiwilligen hat der Sozialdienst ein beson deres Jahresprogramm erarbei tet. Vor kurzem stellten Leitungskräfte und Frei willige die Dienste und ergänzenden Tätigkeiten der Freiwilligen bei einer Informationsveranstal tung vor. Christine Haller Zwischenbrugger erzähl te über ihre Aufgaben im „Sprachen-Cafè“, Martha Steinkasserer von ihren langjährigen Erfahrungen in der Begleitung von Senioren. „Ich möchte keine einzige davon missen“, so Steinkasserer. Die größte Dankbarkeit komme von den Personen selbst. „Die freiwillige Tätigkeit erfüllt mich. Ich empfehle sie jedem weiter, um diese Freude selbst zu erfahren.“
Monika Reinthaler und den Leitungskräften des Sozialdienstes eine Wanderung in Pflersch. Direktorin Brigitte Mayr stellte die neuen Outdoor-Westen vor, die künftig bei Einsätzen getragen werden. Im Namen des Sozialdienstes dankte sie den Freiwilligen für ihre ehrenamtlich geleisteten Dienste in diesem Jahr. „Eure Mitarbeit unterstützt und ergänzt unsere professionelle Ar

Kai Schenk, Facharzt für Sportmedizin

Ende Mai unternahmen die Freiwilligen mit Bezirkspräsidentin
Pilzkontrolle
Wer Pilze nicht eindeutig bestimmen kann, lässt besser die Finger davon oder fragt bei den Experten der Mykologischen Kontrollstelle des betrieblichen Dienstes für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (SIAN) nach. Sie prüfen Pilze auf ihre Genießbarkeit und stellen Bescheinigungen zum Pilzverkauf aus. Geöffnet ist die Kontrollstelle montags von
der unsere Anerkennung und unseren Dank verdient. Besonders wertvoll sind euer offenes Ohr und jedes gute Wort, das ihr zu den Menschen bringt.“ Wer sich ebenfalls freiwillig einbringen möchte, kann sich an Claudia Zampol wenden: Sozialdienst Wipptal, Tel. 0472 726406.
16.00 bis 17.00 Uhr sowie vom 16. August bis zum 21. November auch an geraden Werktagen von 16.00 bis 17.00 Uhr sowie freitags von 11.00 bis 12.00 Uhr. Vormerkungen für die kostenlose Beratung per E-Mail (sian@sabes.it) und unter der Rufnummer 0472 812460 (Brixen, Dantestr. 51, Krankenhaus, Gebäude C).
Anmeldung: ab 01.09.2025 online über www.rheumaliga.it
DasaktuellsteProgrammfinden sie immer auf unsererWebsitewww.rheumaliga.tt
Kurse Oktober 2025, - Mai 2026,
p TERTAL
Yoga
(angepasst an die Bedürfn'sse de Teilnehmerinnen)
Ort: Vroni Fi,sc er Yoga, Tobla:ch 26 Einheiten, 130 Euro
Do 17.30-18.30 Uhr Star • 09.10.25 Fischer Vroni
Wassergymnastik (Wass rtiefe 1.s rn)
Ort; Hotel Kirchenwirt. Tobh1c.:h 16 Einheiten, 130 Euro
Fr 09.00•10.00 Uhr Start: 09.0U.6 Ma1r Michael
Fr 10.00-11.00 Uhr Sta t: 09.01.26 Mair Michael
Gesundheitsgymnastik
Ort: Krankenhaus Bruneck 26 Einheiten, 1310Euro
Mo 17.30-18.30Uhr Start: 06.10.25 lrmerhoferAndrea
Ort Grundsi;;hule Tob1atll 26 Einhelrten, HO Euro
Mi 17.30-18.30 Uhr Start: CIB.10.25 Schäf'er Renate
Wassergymnastik
Ort: Cron 4 Reischach 26 Einheiten, 180 Euro
Do 09.00-10.00 Uhr Stan: 09.10.2'5 Alexandra Rametta
Do 10.00-11.00 Uhr Start: 09.10.25 Alexandr.i R..tmetta
M• 13.00-14.00 Uhr Start: 08.10.2.S Thaler Dagmar
Mi 14.00-15.00 Uhr Start: 08.10.25 Thaler Dagmar
STERZL G
Wassergymnastik
Ort: l(rank,en .ausSterz·nc 26 Eilfliheirten,12.0Euro
Mi 16.30-17.00Uhr Start; 08.10.25 Braiootti Alexandra
Mi 17.10-17.40 Uhr Stan: CIB.10.25 Braidotti Alexandra
Sanfte Gymnastik mit Musik gan2 eitliche Bewegungfür mehr LebensqualJtät
Ort;Altenheim Schloss Moos, Sten:i111 26 E:inheiten, 130 1 Euro
Mo 09.00-10.00 Uhr Start: 06.10.25 SteinerSeppiAnnemarie
BRIXE /VAi RN
Gesundheitsgymnastik
Ort: Turnhalle Vahrn
Mi 18.00-19.00 Uhr Start: 08,10.2.5
10' Einheiten, SOEuro Braito Vanessa
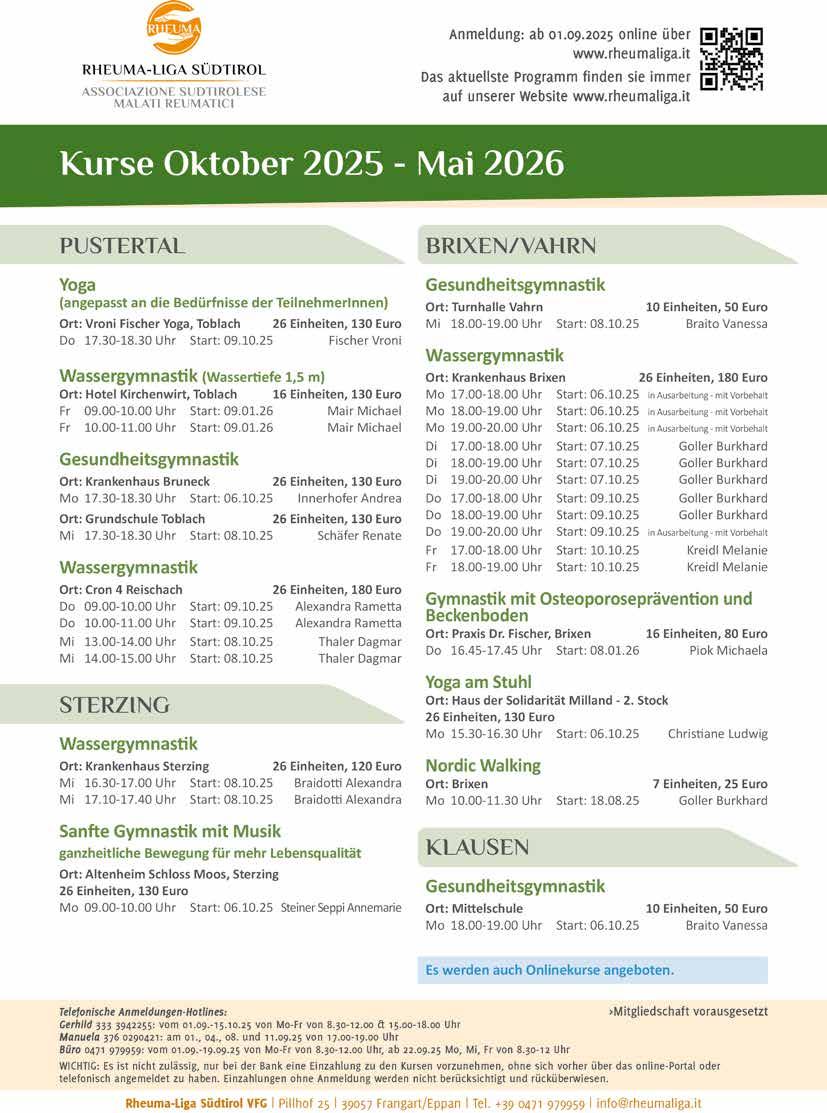
Wassergymnastik
Ort: Krankenhaus Brixen 26 Einine·iten,180 Euio
Mo 17.00-18.00Uhr Start 06.10.25 1111\JJSDcllelt~- \'Otbtl'l:llt
Mo 18.00-19.00 Uhr Start: 06.10.25 nAJ.Jmbetl-\JClj!· m ~IJ
Mo 19.00-20.00 Uhr Start: 06.10.25 innusatbe!~•m vorbeh.Jlt
Di 7.00· 8.00 Uhr Start: 07. 0.25 GoHerBurkhard
m 18,00-19.00 Uhr Start; 07,l0.25 Goller Burkhard
Di 19.00---20.00Uhr S art: 07.10.2.S Goller Burkhard
Oo 7.00-18.00Uhr Start: 09.10.25 Goller Burkhard
Do 18.00-19.00 Uhr Start: 09.!0a25 Goller Bw1chard
Do 19.00-20.00 Uhr Start: 09.10.25 innusatbe!~•m vorbeh.Jlt
Fr 7.00·18.00Uhr Start 10. 0.2S KrerdlMe1ani
r 18.00-19.00 Uhr Start; 10.l0.2S Krekil Melanfe
Gymnastik mit Osteoporoseprävention und Beckenboden
Ort~ Prax,tsDr. Fischer, Brixen 16 Einheiten, 80 Euro Do 16,45-17.45 Uhr Start: 03.01.26 Piok Michaela
Yogaam Stuhl
Ort: Haus der Solidarität Mill!and 2. Stock 26 E:inheiten, 130 Euro Mo 15.30-16.30 Uhr Start: 06.10.25 Christiane Ludwig
Nordic Walking
0 rt: BriJll.~n 7 Ei,nheiten, 25 Euro Mo 10.00-11.30 Uhr Start; 18.08.25 GoUer Bur1d,ard
KlA SEN
Gesundheitsgymnastik
On: M,ittelschuie 10 Einheiten, 50 'Eun:,, Mo 18.00-19.00Uhr Start: 06.10.25 Braito Vanessa
s werde auc Onlinekurs,eangeboten.
TeretonlS(;h~Anm~ld'1i1Stn•Hotfines: >Mitg:tiedschaUvo rausgeseu.t C!rhlld333 394l:255: vom DL09.-T.§:.H1. ·~ 1Jllln Mo-Fr yan 11.3~1:i.oa 1§.Q0-1S.oo Uhf Manllr:la :n6 0290421; am 01 o ., Q8. und 1.oll,:lS ~1:in 1 ?,QO·l!Ji.-00 Uhf 80ro,0471 979959=vom ot.09.-19-.09.:25von Mo-Fr voM 11,;ci-1,.00 Uhr, ab 2vi.9.2~ o, MI, fr von 11.30--12IJl1r WICHTIG:E$ i:;t nicht ;wl"ssig. nur bei der bnk eine Elnuhlung zu den t:uir~e.n'fOrzunehmen,ahne skh ~Qritt~rv!>erda5 online-Porta.!oder tl!l@fo.ni,sdia ngem ldt!t zu t,aib~n. E1nuhlung1m o,h11 :,\nmtJldu nij we.tde~ fl fc.)'ltb rileks' chlJgt und riklil bf !'l'lllest:11. - irol VFGI P1llhof 25 1 39057Fr ng t/Ep an I Tel -'-3904, t 9}~59 1 mfo rl1 -umaliga il
APOTHEKEN
26.07.-01.08.: Stadtapotheke
Tel. 765397
02.08.-08.08.: Apotheke Wiesen Tel. 760353
09.08.-15.08.: Apotheke Gilfenklamm Tel. 755024
16.08.-22.08.: Apotheke Paracelsus
Tel. 377 3130989
23.08.-29.08.: Stadtapotheke
30.08.-05.09.: Apotheke Wiesen
Die Turnusapotheke ist sonntags und feiertags von 9.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. ÄRZTE
02.08.: Dr. Valbona Kurtallari Tel. 324 0953522
03.08.: Dr. Markus Mair
Tel. 329 2395205
09.08.: Dr. Robert Hartung
Tel. 333 5216003, 764517
10.08.: Dr. Pietro Stefani
Tel. 349 1624493, 760628
14.08.: Dr. Massimiliano Baccanelli
Tel. 334 9156458
15.08.: Dr. Giuliana Bettini
Tel. 320 6068817
16.08.: Dr. Sonila Veliu
Tel. 349 6732243
17.08.: Dr. Markus Mair
Tel. 329 2395205
23.08.: Dr. Barbara Faltner
Tel. 335 1050982
24.08.: Dr. Alberto Bandierini
Tel. 388 7619666, 764144
30.08.: Dr. Esther Niederwieser
Tel. 335 6072480, 75506
31.08.: Dr. Pietro Stefani
Tel. 349 1624493, 760628
Der jeweils diensthabende Arzt kann von 8.00 Uhr (an Vorfeiertagen ab 10.00 Uhr) bis 8.00 Uhr des darauffolgenden Tages unter der angegebenen Telefonnummer erreicht werden und ist von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie von 16.30 bis 17.00 Uhr in seinem Ambulatorium anwesend.
ZAHNÄRZTE:
Notdienst Samstag und Feiertage dental clinic Dalla Torre, 9.00 – 12.30 Uhr, Tel. 335 7820187
TIERÄRZTE (NUR GROSSTIERE)
02./03.08.: Dr. Stefan Niederfriniger 09./10.08.: Dr. Michaela Röck
15.08.: Dr. Stefan Niederfriniger
16./17.08.: Dr. Carmen Huber
23./24.08.: Dr. Johanna Frank
30./31.08.: Dr. Michaela Röck
Dr. Stefan Niederfriniger Tel. 388 8766666
Dr. Michaela Röck, Tel. 347 1375673
Dr. Johanna Frank, Tel. 347 8000222
Dr. Carmen Huber, Tel. 348 9232496
KLEINTIER-NOTFALLDIENST
Tierklinik Thumburg, Tel. 335 7054058, 335 1206704, 335 259994
Tierarztpraxis Sterzing, Geizkoflerstr. 20A, Tel. 388 8766666, 328 0514167
1.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr.
Konzert der Musikkapelle Wiesen, Wiesen, Gemeindepark, 20.30 Uhr
2.8.
„’s Kropfnradl“: Originale Pfitscherkrapfen, Tirschtla mit Spinat oder Kraut, Kirchenchor St. Jakob, St. Jakob, Dorfplatz, 10.30 – 16.00 Uhr. Bei schlechter Witterung im Schulgebäude von St. Jakob. Vorbestellungen bis zum Vortag möglich: Tel. 335 6973027.
Basil Hofer Lauf, Pfitsch.
Konzert der Musikkapelle Mareit, Mareit, Festplatz, 20.30 Uhr
Konzert der Musikkapelle Mauls, Sterzing, Stadtplatz, 20.30 Uhr.
3.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr. Penser Joch Bike Day, Penser Joch.
4.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr.
6.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr. Laternenparty, Sterzing.
7.8.
2. Bürgerversammlung zur „IstZustandsanalyse“ des Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und Landschaft der Gemeinde Sterzing, Vigil-RaberSaal, 19.00 Uhr.
Konzert „Brass’n Sax“, Mareit, Pfarrkirche, 21.00 Uhr. Gilfenklamm Magic Light, Stange, Gilfenklamm, 21.00 Uhr.
8.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr. Konzert des Bayerischen Landesjugendorchesters, Sterzing, Pfarrkirche, 20.00 Uhr.
Jubiläum „40 Jahre Bibliothek Stilfes“, Stilfes, Innenhof Widum, 20.00 Uhr.
8./9.8.
Feuerwehrfest, Mareit, Festplatz.
9.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr.
Filmpremiere „High Above –Highlining on Tribulaun“, Sterzing, Stadttheater, 20.00 Uhr, Eintritt frei.
Mareiter Stein Attacke, Mareit. Konzert der Musikkapelle Mareit, Kematen, 20.30 Uhr.
10.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr.
Konzert der Streicherakademie Bozen, Sterzing, Stadttheater, 20.30 Uhr.
Konzert der Musikkapelle Trens, Sterzing, Stadtplatz, 10.30 Uhr.
12.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr.
13.8.
Laternenparty, Sterzing.
14.8.
Theater „Robin Hood“, Theatergemeinschaft Wipptal, Ried, Burgruine Straßberg, 20.30 Uhr. Repair Cafe, Sterzing, Garten Margarethenhaus, 17.00 –20.00 Uhr.
Gilfenklamm Magic Light, Stange, Gilfenklamm, 21.00 Uhr.
Orgelabend zum Hochfest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ mit Sabine Walter, Sterzing, Pfarrkirche, 20.00 Uhr.
15.8.
Konzert der Musikkapelle Wiesen, Freienfeld, Schloss Sprechenstein, 20.00 Uhr.
16.8.
Konzert der Musikkapelle Innerpfitsch, St. Jakob, 20.30 Uhr.
20.8.
Laternenparty, Sterzing.
21.8.
Konzert „Bozen Brass“, Mareit, Pfarrkirche, 21.00 Uhr. Buchvorstellung „Continuate in ciò che era giusto. Storia di Alexander Langer“, Alessandro Raveggi, Sterzing, Casarci, 18.00 Uhr.
Gilfenklamm Magic Light, Stange, Gilfenklamm, 21.00 Uhr.
22.8.
Offener Kleiderschrank, Mauls, Grundschule, 17.00 – 20.00 Uhr.
23.8.
Konzert „Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar“, Sterzing, Stadttheater, 20.30 Uhr.
Konzert der Musikkapelle Stilfes, Sterzing, Stadtplatz, 20.30 Uhr
23./24.8.
Kirchtagsfest der Musikkapelle Mareit, Mareit, Festplatz. Jubiläum „65 Jahre Segelfluggruppe Sterzing“, Sterzing, Fliegerplatz.
24.8. „’s Kropfnradl“: Originale Pfitscherkrapfen, Schwarzbeerkrapfen, Tirschtla mit Spinat, Kirchenchor St. Jakob, St. Jakob, Dorfplatz, 10.30 – 16.00 Uhr. Bei schlechter Witterung im Schulgebäude von St. Jakob.
Vorbestellungen bis zum Vortag möglich: Tel. 335 6973027.
Konzert der Musikkapelle Wiesen, Wiesen, Gemeindepark, 20.30 Uhr.
28.8.
Buchvorstellung „Piedi freddi“, Francesca Melandri, Sterzing, Casarci, 18.00 Uhr. Gilfenklamm Magic Light, Stange, Gilfenklamm, 21.00 Uhr.
30.8.
Konzert der Musikkapelle Wiesen, Sterzing, Stadtplatz, 20.30 Uhr.
Kurse
Giulia Formisani, laureata in Belle Arti presso l’università di Siviglia, terrà un corso di pittura ad olio con modello dal 18 al 22 agosto. Orario: dalle ore 18.00 alle ore 22.00 presso LURX. Costo: 50 Euro. FormisantisApp Tel. +33614977570.
18. – 20.9.
World Skills South Tyrol Italy in Action. Landesmeisterschaft der Berufe, Bozen, FieraMesse.
Märkte
5., 12., 19., 26.8.: Sterzlmarkt, Sterzing.
5., 20.8.: Brennermarkt.
1., 8., 15., 22., 29.8.: Bauern markt, Sterzing, 9.00 – 13.00 Uhr.
3.8.: Flohmarkt, Sterzing.
15.8.: Kräuter- und Bastelmarkt, Maria Trens, 10.30 – 13.00 Uhr. 25.8.: Vieh- und Krämermarkt, Sterzing.
Ausstellungen
Bis 31.10.
„Den Aufstand proben“, Ster zing, Stadt- und Multscher-Mu seum.
Bis 9.11.
„Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“, Franzensfeste, Festung.
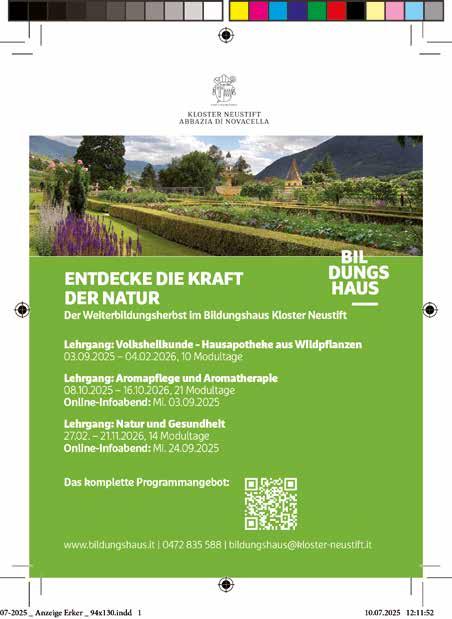
„Jagd, Hund, Mensch“, Mareit, Schloss Wolfsthurn.
„Brücken durch die Zeit“, Franzensfeste, Festung.
Dauerausstellungen
„Eingebunkert“, Franzensfeste, Festung.
„Die Kathedrale in der Wüste“, Franzensfeste, Festung.



Redaktionsschluss: 15.08.25

Eine Abordnung der FF Wiesen gratuliert dem Mitglied außer Dienst Norbert Plattner zum 75. Geburtstag.
Lieber Christian und Martin,
seit vielen Jahren leistet ihr einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der Firma. Einen herzlichen Dank für eure Betriebstreue und euren unermüdlichen Einsatz! Jürgen mit EMP-Team


Deine Spuren bleiben.

25. Jahrestag
Maria Martin geb. Obex
In Liebe denken wir an dich ganz besonders bei der hl. Messe am Sonntag, den 31. August um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Mareit.
Allen, die daran teilnehmen, ein herzliches Vergelt’s Gott.
In Liebe Paolo, Patrizia, Alexandra und Elisa und alle Verwandten

Ein Jahr ohne dich
Alles ist anders … Es gibt so viele Momente, in denen wir an dich denken. So viele Stunden, in denen wir dich gern in unserer Mitte hätten. So viele Augenblicke, in denen wir dich vermissen. So viele Dinge, die wir gerne noch mit dir erlebt hätten.


1. Jahrestag
Martha Schwazer geb. Goller
Wir halten dich in unserem Herzen fest, besonders am 17. August bei der hl. Messe um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche von Wiesen.
Danke allen, die daran teilnehmen und dich in Erinnerung behalten.
Deine Familie

Irgendwann ...
Irgendwo…
Irgendwie …
Sehen wir uns wieder ...
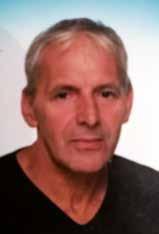

15. Jahrestag
Max Überegger
Streal Max
Verbunden in ewiger Erinnerung und Liebe feiern wir am Sonntag, den 24. August um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Sterzing den Gedächtnisgottesdienst.
Allen, die daran teilnehmen, ein herzliches Vergelt’s Gott.
Deine Lieben
Norberto Molini
* 29.08.1945 † 09.08.2019
Una persona amata non muore mai veramente, ma resta viva nei cuori dei suoi cari.
Con immutato amore e nostalgia la tua famiglia
Ein herzliches Vergelt’s Gott für die tröstenden Worte und Umarmungen, für die vielen Kerzen, Blumen und Gedächtnisspenden sowie für die Anteilnahme an den Rosenkränzen und an der Trauerfeier.
Ein herzliches Danke allen, die an der würdevollen Gestaltung mitgewirkt oder sonst einen Dienst verrichtet haben.
Danke an alle, die einfach da waren.
Danke an alle, die unsere Mame in liebevoller Erinnerung behalten.
Für immer in unseren Herzen!
Die Trauerfamilie

Unsere Lieben wachsen, wenn sie gegangen sind, in uns hinein, werden Teil von uns, geben uns ihre Liebe und Kraft. Und am Ende bewahren wir sie unsichtbar in uns.
Jörg Zink

Unvergessen
20. Jahrestag Karl Gasteiger
* 07.06.1948 † 07.08.2005
In liebevoller Erinnerung und dankbar für die schöne Zeit mit dir, lieber Karl, verbunden in Liebe, gedenken wir deiner am Samstag, den 2. August um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche von Ridnaun.
Allen, die daran teilnehmen, ein herzliches Vergelt’s Gott. In Liebe deine Familie
5. Jahrestag Hilde Plattner geb. Trenkwalder
Liebe Hilde, du warst für uns wie eine Mutter. Vergelt’s Gott!
Ganz besonders denken wir an dich und auch an Hermann beim Gottesdienst am Sonntag, den 24. August um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Wiesen.
Die Hofer-Geschwister mit Familien

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, kann sie nur fühlen. Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse. Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, aber die Hand fasst ins Leere.
1. Jahrestag
Luisa Pattis
Villa Pattis, Thuins
* 12.12.1938 † 24.08.2024
Ganz besonders denken wir an dich bei den hl. Messen am Sonntag, den 24. August um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Sterzing und am Sonntag, den 24. August um 17.00 Uhr in der Kirche des Kapuzinerklosters in Barbarano am Gardasee.
Deine Lieben

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles, niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.
Andreas Badstuber
* 02.06.1991 † 08.06.2025
Ein herzliches Vergelt’s Gott für die tröstenden Worte und Umarmungen, für die vielen Kerzen, Blumen und Spenden sowie für die Teilnahme an den Rosenkränzen und der Trauerfeier.
Danke für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier sowie allen, die dabei einen Dienst verrichtet haben und die unseren Andreas in liebevoller Erinnerung behalten.
Eure Verbundenheit war uns ein großer Trost.
Die Trauerfamilie
10. Jahrestag
Karl
Oberhauser
* 9. Dezember 1932
† 9. August 2015
Lieber Vati!
Zehn lange Jahre sind mittlerweile schon vergangen, seit du nicht mehr sichtbar unter uns bist, und doch ist es so, als ob es gerade erst gestern war. Die Lücke, die du in unserer Familie hinterlassen hast, war, ist und bleibt groß. Doch wir wissen, eines Tages werden wir uns bei Gott, dem himmlischen Vater, wiedersehen.
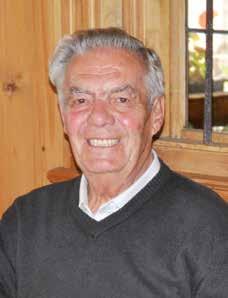
Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an dich denken.
Ganz besonders aber denken wir an dich bei der Hl. Messe am Sonntag, den 10. August um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Sterzing.
Vergelt’s Gott allen, die sich im Gebet an unseren Vati erinnern!
In Liebe
Thea
Astrid und Elmar
David, Alina mit Michi, Juna und Alexander, Lukas und Simon



AlsGottsah, dassderWegzulang, derHügelzusteil unddasAtmen zu schwer wurde, legteerdenArmumihn undsprach:„Kommheim!“
Albert Ainhauser
„Sarner Albert“
* 16. Juli 1943 † 2. Juli 2025
Vergelt’s Gott
- allen Beteiligten für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier, - für die zahlreiche Teilnahme an den Rosenkränzen, - für die vielen Blumen-, Kerzen- und Gedächtnisspenden,
- für die entgegengebrachte Anteilnahme und jedes tröstende Wort.
Danke jedem, der unseren Tate im Gebet miteinschließt und in liebevoller Erinnerung behält.
Die Trauerfamilie

2. Jahrestag
Es ist für uns immer noch unbegreiflich, dass unser über alles geliebter
Walter Keim
† 06.08.2023
nicht mehr unter uns ist.
17. Jahrestag 17° anniversario Monika Fontana 20.10.1954 05.08.2008
In Liebe und Dankbarkeit denken wir ganz besonders an dich beim Gottesdienst am Sonntag, den 10. August um 10.00 Uhr in der Kirche von Franzensfeste.
In Liebe und Dankbarkeit denken wir Gottesdienst am Sonntag, Kirche von Franzensfeste.
Ti ricordiamo in particolar modo
Ti ricordiamo in particolar modo domenica, 10 agosto alle ore 10.00

Gemeinsam gedenken wir deiner ganz besonders am Wir denken an dich und spüren, „Was machst du heute?“,

Michael
Ein Jahr ohne dich Nichts ist mehr, wie es war!
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie zwingt uns dazu, mit dem Unbegreiflichen zu leben.
Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind, in unseren Gedanken und unseren Herzen.
Außerhofer
Michi
* 22.09.2000 † 16.08.2024
Ganz besonders denken wir an dich am Sonntag, den 24. August um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Innerpflersch.
In Liebe Mami, Papi und deine Familie




Acht Jahresind ~al:l!Je!IIII, selt du, liebe M l, von uns 9c9angcn b~t.
iH'eleneGschnitzer
9~.b.Hofer
30.()9.1959· t 05.08.2017
Wir ,dan~en i!Jr.en,die an unsere H~lene denk.~ und $ie in lieber Erinnerung bcha.ltm.
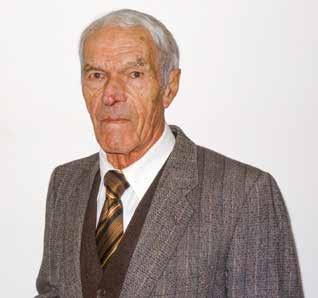
Herzlichen Dank
Hermann
Mariä Aufnahme in den Himmel
Ein Fest der Hoffnung und der Freude am Glauben
Am 15. August feiern wir das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel – ein Hochfest, das in besonderer Weise Hoffnung und Freude schenkt. In der Mitte des Sommers, wenn die Natur in voller Reife steht, blicken wir zum Himmel, dorthin, wo Maria, die Mutter Jesu, mit Leib und Seele aufgenommen wurde.
Dieses Fest sagt uns, dass das Leben nicht mit dem Tod endet, sondern dass Gott den Menschen vollenden will. Maria, die „voll der Gnade“ war, wird zur Wegweiserin für alle, die auf sie vertrauen. Sie geht uns voraus auf dem Weg der Hingabe und der Liebe – und zeigt uns, dass nichts von dem, was wir glauben und tun, verloren geht. In vielen Gegenden ist es Brauch, an diesem Tag Kräuter zu weihen – ein Zeichen für die heilende Kraft Gottes in den Kräutern, die uns gesund erhalten oder von Krankheiten heilen. Der Duft der Kräuter, die festlichen Gottesdienste – all das erinnert daran, dass der Himmel mitten unter uns ist.
In einigen Dörfern wird an diesem Tag auch ein Kräutermarkt angeboten, an dem fleißige Frauen und Männer für einen guten Zweck verschiedenste Kräuter und Salben verkaufen. Damit schauen sie über den Tellerrand hinaus und schenken armen und leidenden Menschen in den verschiedensten Teilen der Welt Hoffnung auf ein besseres Leben. So kann die Freude, die von diesem schönen Fest mitten im Sommer ausgeht, auf andere Menschen weitergegeben werden.
für die Anteilnahme, für die Gebete und für jeden Gedanken an unseren lieben Vater, für die vielen Kerzen, Blumen und Spenden, … für die tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben, für die ergreifende musikalische Gestaltung des Abschiedsgottesdienstes und allen, die dabei einen Dienst verrichtet haben, allen, die unseren Vater als liebenswerten Menschen schätzen und ihn in guter Erinnerung behalten.
Die Trauerfamilie
Der jüngst verstorbene Altpfarrer von Maria Trens hat immer wieder den Satz gesagt: „Wo die Mutter ist, da ist auch der Sohn.“ Wenn man zu Maria betet, zu ihr pilgert, wird man auch ihren Sohn Jesus finden. Das ist wohl der tiefste Sinn jeder Marienverehrung: durch Maria zu Jesus finden. Sie zeigt den Weg, wie man ein gelingendes Leben führen kann: hören – empfangen – gebären; auf das Wort Gottes hören, es empfangen, in sich „Fleisch“ werden lassen und es auf (in) die Welt bringen.
MARTIN ELLEMUNT


Pfiffikus
Pfiffikus sucht einen interessanten Hinweisstein. Wer den genauen Standort kennt, schreibt unter dem Kennwort „Wipptaler Pfiffikus“ an den Erker, Neustadt 20 A, 39049 Sterzing (E-Mail info@dererker.it). Adresse nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 20. August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; an der Verlosung können nur schriftliche Einsendungen teilnehmen.
Auflösung des Vormonats: Die gemütliche Parkbank befindet sich vor dem Sterzinger Stadttheater in der Bahnhofstraße. Seit der Eröffnung des Stadttheaters zur Jahrtausendwende standen hier zwei großzügig errichtete Schaufenster auf langen Betonsockeln (11 m und 17 m lang). Ursprünglich dienten die Glasvitrinen als Hinweistafeln für Veranstaltungen im Stadttheater, auch der Sterzinger Seniorengemeinderat hatte darin einen fixen Platz für Informationen. Zusätzlich stand in der Glasgalerie ein großer Flachbildschirm zur Verfügung, der aber selten funktionierte.
Die Glaskonstruktionen wurden Ende April 2025 abgetragen und die Fundamente teilweise abgeschliffen. Dann wurden 343 Holzlatten (6 x 80 cm) gleichmäßig aufgeschraubt und somit erhielten die Betonklötze die neue Funktion einer gemütlichen schattigen Sitzgelegenheit in der Nähe des Stadttheaters und der Bushaltestellen.
Das Los bestimmte CHRISTINA RIEDERER aus Ster zing zum Pfiffikus des Monats Juli. Die Gewinnerin erhält einen Warengutschein im Wert von 25 Euro , einzulösen bei und zur Verfügung gestellt von der

Kannst Du die 5 Fehler finden?

ERKOKU

AUFLÖSUNGEN DES VORMONATS
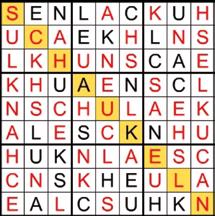
LÖSUNG: SCHAUKELN
Der Gutschein kann in der Redaktion zu Bürozeiten abgeholt werden.
Wir gratulieren!
Nach bekannten Sudoku-Regeln muss ein Quadrat aus 9 x 9 Kästchen ausgefüllt werden – hier allerdings mit den vorgegebenen Buchstaben. Das ERKOKU muss so vervollständigt werden, dass in allen Zeilen, Spalten und Blöcken jeder Buchstabe genau einmal auftritt. In der Diagonale von oben links nach unten rechts erscheint dann das Lösungswort (= Genehmigung, Einwilligung).
FOLGENDE BUCHSTABEN WERDEN VORGEGEBEN:
•A•E•S•K•C•M•G•A ORTSBESICHTIGUNG •BIRGERMOASCHTER MENA•MEM•OCHN•BA •IT•SO••ITH••OEM ATLATONIN•AUCHN• •STRASSENZUSTAND GLAIM••••••A•XII •ON•P•••••••INES ESTEE••••••ER•RL •ELDR•••••••ADE• ANWIL••••••ANE•T •SETE••••••••RUE RTL••••••••HAREM •ALOE•A•F•RADI•P •TAMISCHERKLACHL NIHILISTIN•SCHAH •SA•IR•MN•UV•TAU DTN•GELL•UNE•ERP •ITR•NA•ENTN•TEF SKLAVEN•UANER•NN LÖSUNG: GONDELDINNER
5,ohn~II
lahf e~ f'O/lppj (lii, El@~C n 1 (w1r,pl
DAS WIPPTAL-RÄTSEL
verwendet umgangssprachliche, dialektale Begriffe, die im Wipptal weit verbreitet sind. Sie werden mit (wipp) für wipptalerisch oder umgekehrt mit (dt) für deutsche Hochsprache gekennzeichnet, z. B.: Ei (wipp) = Goggele, ingaling (dt) = bald
Ob~nl<:, He~re&!eltUnij;.llbt fo:ün„t]iChi,t" 8Mi:h v
l!lrollsChß fru~I hl. lgl:, Elec1ron jC;.gnMro <:,
G11 1111 (w1pll) Bru,i.onn• !kl~!ilpromukt 1111 ,;,
G0,!!l~eln$IIIVI, l81iel~ Ahl:. und
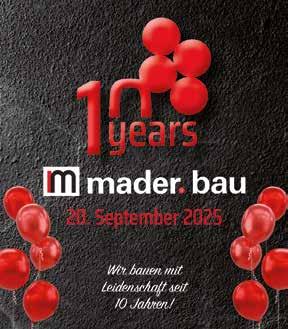
t,.,.trl!f' ·(111 ll,;Miffen jWl~PI
~,c,ln, V11t, n1t1n~ng '"• 11PPI
,n, ' n10lh1eN! ,t, Pl!IJ$0ft~M 1 l~p) le du eh 1
Hote ~ea- ,.,~h111t: un<I G.it~C- V10r w,rto Z.l!I cflnun_Q Y<trb nd, .,n;tA~ T"
U5$~1',IJl(llh"1 IWfPPl
Se11ol chl.il, ~Chi Pf, Abt
rurch~~-1 f'ecli,, H~rz tw1ppl
Tra;~, ilet E.ribnl~g,i, -;, 11qm l. r o..cyllnn, \l'es.uvl:.a4t, ~up! ~ta;at K8,,,· 11sn1mi;
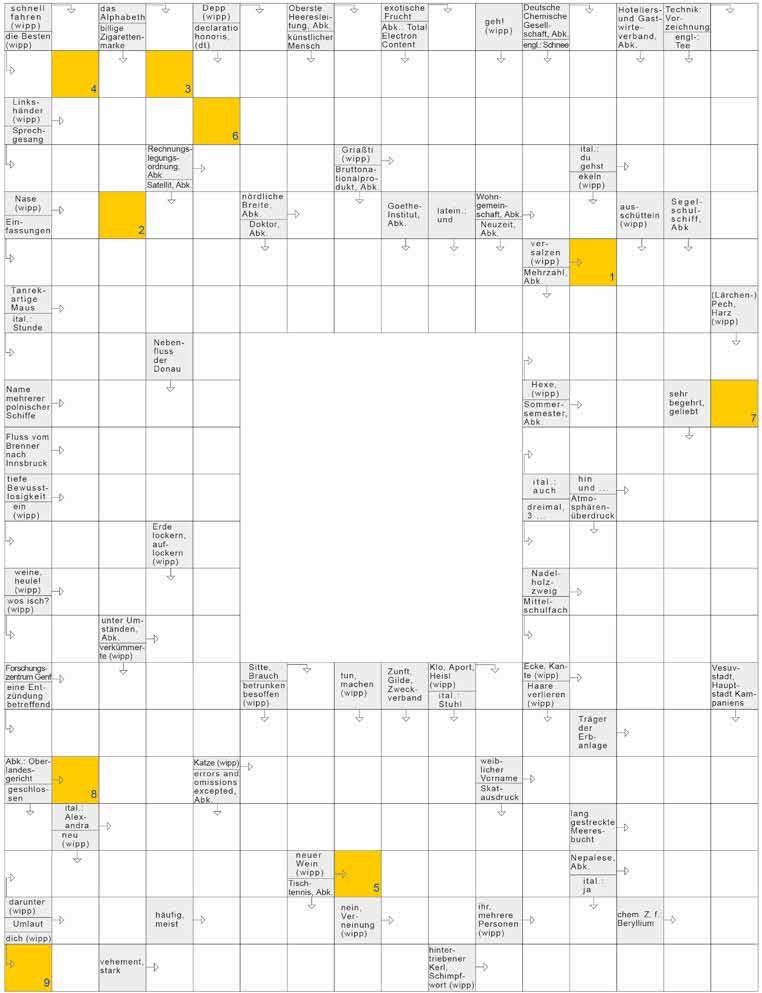
Auflösung in
nächsten Nummer
Wipptaler Sumserin
Gonz weiß isch‘s unter der Stodt. Nit epper, dasses in Summer gschniebm hatt, weil sell tuet‘s, wenn schun, decht lei in die Heachn, sollat zin Okiehln wiedr amol a kolte Strömung von Nordpol oerkemmin. Und a der Weißspitz leichtit a nit a sou hell afs Tol oer.
Sein tien des de gonzn Camperkistn, de sich gleim nebn der untern Stodteinfahrt broat gimocht hobm. Kuen Mensch woaß, woher de kemmin, wie long de bleibm, ober uens honn i derfrogg: De bleibm, solong‘s ihmen gfollt, und wohrscheinlich gfollt in de sell in beschtn, dass se do nicht zohln und a nicht zohln mießn.
Wos ober de Campierer sicher nit tien, isch, dass de ihmigen Dreck mit huem nemmin. Weil der kannt in de Grattn, ba der Hitze, jo unhebm zi schtinkn. Und sell konnsche woll a nit verlongen. Ober noar stellt sich holt die Froge, wou tien de ihrn Obfoll hin?
Weard schun sein, dass ba ins do in der Umgebung kuen richtiger Campingplotz meahr isch, ober wenn noar decht a wilder Campingplotz schun entstondn isch, mießat holt, wie sischt in viel ondre Orte af der Welt, do an Ordnung gimocht sein: Zearscht mueß amol der Mill ourntlich entsorgg wearn kennen, noar soll afs Obwosser gidenkt wearn. Und des kannt noar mit die Gebührn, de zi Recht unfolln, finanziert wearn. Weil dass ba ins do a Plotz isch, wou du a sou praktisch und gratis a länger stiehn bleibm kommsch, hot sich sicher long schun ummergschprochn. Und sie warn jo bled, wennse des nit nutzatn. Und lei asou, und genau deswegn, wearn do sicher nit wieniger!

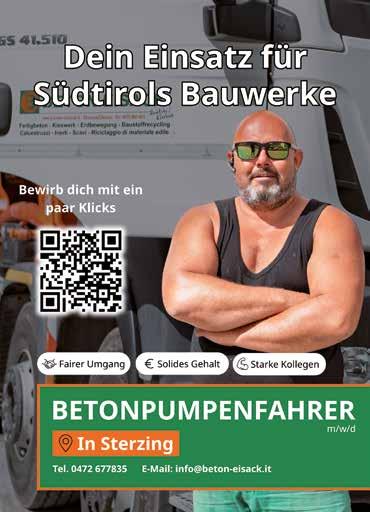
VERSCHIEDENES
Übernehme das Tapezieren von Bänken und Stühlen (auch alte Bänke und Stühle). Erreichbar unter Tel. 335 5917358.
Verkaufe Range Rover
Evoque , 71.000 km, Baujahr 2017, Diesel, 150 PS, Automatik, 4x4, sehr guter Zustand, garagengepflegt. Weitere Infos: Tel. 340 9297489.
Antikmöbel (1 Schlafzimmer), Zirbenholz, preisgünstig zu verkaufen. Tel. 338 1805056.

• Barkeepe_ :in/Barchef:in (S-foge-Woche)
• Chef d:e ltan9 (m/w, Voll- oder Teilzeit)
Wir freuen uns auf dich! 04 72 659800 oder 340 5459161 ;obst berghotel-rotschings..com

amen Flyer E-Bike zu verkaufen. 4 Jahre alt, kaum gebraucht, 450 km, Größe M, Schloss mit Alarm, Akku 750 Watt, Sattelstützenfederung, Preis 1.800 Euro. Bei Interesse: Tel. 333 9111553.
erkaufe Brennholz . Weitere Infos: Tel. 347 0833862.

! www.zahnarzt-angam,11 viuto
• seI1ilb 15Jalw11er olQreiCh mSüdcirol
• g:mzj~Ii!HJeOflMli!- Parlnerpi:msfür Vor•1mdNat~btaharidllJl!Qell m INITL
• ein rlei 9tllß1enKh l!i1Unn;im~mtl 45-f hngerEtfo!ir
• besten$ausQC$1.atteterutumhtfia,11tco u11d2llloc~q.ialifiliorw l ,n uo
• fop-llvHhtiil1111dbitst~llllhantll:!Jngs mol)lich~ • 1 filr AP!gsrpa II t n auch1m Ollrnrnsctil f
• 1 och n ric~nrTMnsfMim0e1uar-r~
• Protescsiornfrt.it 111dHerzlrd !!it ~precl\1111 lilr 1rn3 r,;'"'\ ~knit s~fU"-'1 3391070114
Wiese in St. Jakob, Pfitsch, 15.000 m², zu verkaufen. Tel. 348 5706651.
Altholz von Stadel zu verkaufen. Tel. 348 5706651.
PARTNERSUCHE
Suche ehrliche, treue Partnerin , die es ernst meint, im Alter von 30 bis 38 Jahren.
Wenn du Interesse hast, melde dich gern: Vwdasauto4@ outlook.com.
WOHNUNGSMARKT
Zu vermieten
3-Zimmerwohnung in Sterzing mit Balkon, Keller und Autoparkplatz ab Oktober zu vermieten. Tel. 333 3022137.
Zu mieten gesucht
Cercasi appartamento in affitto per 4 persone nella zona di Vipiteno, Prati. Tel. 327 3880045.
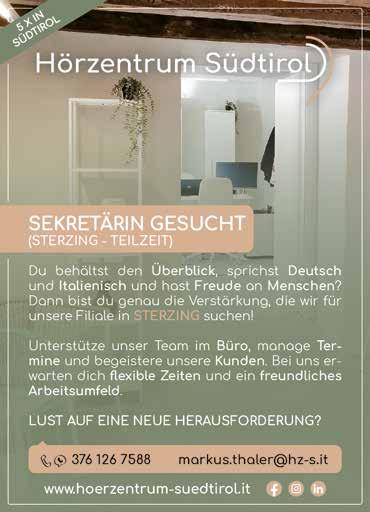

adlatus
Fahrer/in
mit B-Cap FGhnuschl!ln In Sterzlng und Umgebung für B@hlndertenfahrdH!nst@ gesucht [T~ilzeit).
Gerne ;iuch Rentnsr/1nnen.
Adlatu5EO,Tel.0473 211423 E-Mail: fahrdlenst@adlatus.lC
Zahqtechnische Labor
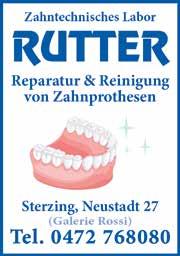
Reparatur & Reinigung von Zalmprothe en 'tcrzing, enstadt 27 1L l rl • R •~ i) Tel. 0472 7·68080 (iAfJEJJHOP
Futunser otiv,erte~ am, HotelGas nhof~uc n w r Koch oder Köchin una Kel ner /in
1t 1~1tcr c cfih w c l. B 50 % RJb.ltt bei P~rt, crhotcls. Gr3 S ~-8ike-V('fil'lh, f1tnt>SSS id O J. "· m lnteres~ gl!Weckt? Da1nnfre-uen wfr uns auf defne Bewerbung!
• gerda@gas:.enhof.com \.+39 33S 7833999

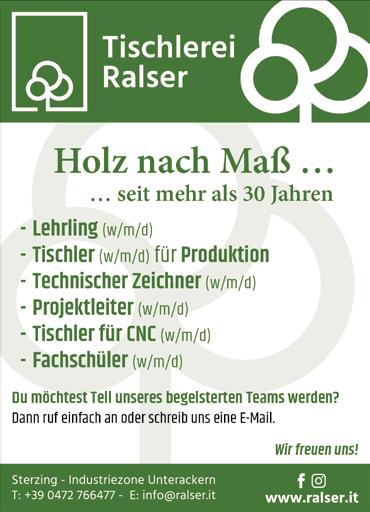
Holz nach Maß ... . . . seit mehr als 30 Jahren
IJehrHng(w/m/d)
- Tischlerrw/m/d)fürProduktion -TechnischerZeichner(w/m/d)
- Proiektleiter(w/m/d)
- Tischlerfür CNC(w/m/11) -Fachschüler(w/m/11)
aumöch~e-stTellunsieresbege1s1e1tenTeamswerden? nannrufeinfachanoclerseihreWunse,ineIE-MaU.
Wiffreuea11ns~
Sterzing - Industriezone Unteraic!c:ern f 1@) T: +39 0472 766477 - E: info@ralser_it www.ralser.it
GEBURTEN
Brenner: Meeram Waqas (06.06.2025, Brixen). Jakob Prast (13.06.2025, Brixen).
Freienfeld: Ordi Kazani (16.06.2025, Bozen). Valentina Zössmayr (20.06.2025, Brixen).
Pfitsch: Tommi Eisendle (13.06.2025, Brixen). Jakob Graus (19.06.2025, Pfitsch). Paul Zihl (24.06.2025, Brixen). Lorik Musliu (28.06.2025, Brixen).
Ratschings: Abida Sekh (26.06.2025, Brixen). Elias Mair (29.06.2025, Brixen). Johanna Klotz (29.06.2025, Brixen).
Sterzing: Muhammad Ali Malik (03.06.2025, Brixen). Loris Jakimi (05.06.2025, Brixen). Jacopo Mattioli (17.06.2025, Brixen). Marisa Pernezha (18.06.2025, Brixen). Alex Bonfanti (28.06.2025, Brixen).
TODESFÄLLE
Freienfeld: Hilde Hochrainer, 90 (02.06.2025, Freienfeld). Andreas Badstuber, 34 (08.06.2025, Freienfeld). Marianna Plaickner, 87 (16.06.2025, Sterzing).
Pf itsch: Sandro Pontalti, 71 (13.06.2025, Sterzing). Anna Baumgartner, 93 (18.06.2025, Sterzing). Iqbal Mohammad, 68 (26.06.2025, Pfitsch).
Ratschings: Eduard Rainer, 75 (11.06.2025, Ratschings). Matilde Hofmann, 82 (13.06.2025, Sterzing). Alois Obex, 87 (27.06.2025, Sterzing). Hermann Siller, 88 (28.06.2025, Ratschings).
Sterzing: Maria Niederkofler, 92 (02.06.2025, Sterzing). Emma Dalla Torre, 93 (05.06.2025, Sterzing). Sonia Plancher, 69 (05.06.2025, Meran).
Martin Staudacher, 54 (11.06.2025, Franzensfeste). Giampaolo Crepaz, 63
(11.06.2025, Franzensfeste). Luise Pöhl, 92 (27.06.2025, Sterzing).
EHESCHLIESSUNGEN
Brenner: Stefanie Heidegger und Manuel Braunhofer (07.06.2025, Sterzing). Deborah Mayr und Nicolai Wild (21.06.2025, Gossensaß). Barbara Hilber und Peter Girtler (25.06.2025, Gossensaß).
Freienfeld: Barbara Salcher und Fabian Taschler (14.06.2025, Freienfeld). Helene Hofer und Bastian Brunner (20.06.2025, Freienfeld).
Pfitsch: Katharina Engl und Hannes Stofner (02.06.2025, Torri del Benaco).
Alexa Volgger und Matthias Psaier (07.06.2025, Sterzing). Sabine Aichholzer und Marco-Flavio Bernardini (13.06.2025, Sterzing). Daniela Holzer und Patrick Kral (28.06.2025, Pfitsch).
Julia Gander und Hannes Karlegger (28.06.2025, Pfitsch).
Ratschings: Melanie Conte und Hans Gschliesser (21.06.2025, Mareit).
Sterzing: Franziska Riederer und Michael Messner (14.06.2025, Sterzing). Nadine Egger und Johannes Mair (21.06.2025, Sterzing). Stefanie Windisch und Christopher Cipriani (21.06.2025, Sterzing).
Astrid Linser und Armin Gschnitzer (27.06.2025, Sterzing).
BAUGENEHMIGUNGEN
Brenner: Andreas und Martin Fleckinger, Verena Schwärzer, Pflersch 101/A: Abbruch der Gebäude und Verlegung der Kubatur in Form einer Wiedererrichtung eines Wohnhauses, versch. Bp., versch. Gp., K.G. Pflersch.
Freienfeld: Ägidius und Lukas Wieser,
Stilfes 20/C: Verlegung des Feldweges im Bereich des Wastnerhofes, versch. Gp., K.G. Stilfes.
Pfitsch: Greti Hofer, Kematen, Fussendrass 30: Meliorierung und punktuelle Entsteinung auf der Gp.550/2, K.G. Pfitsch. Adele Aigner, Josef, Magdalena und Max Radl, Wiesen, Thurnerweg 17: Bauliche Umgestaltung, Beseitigung architektonischer Barrieren, Sanierung, energetische Sanierung und Erweiterung, Errichtung eines überdachten Autostellplatzes, Bp. 469, K.G. Wiesen. Ratschings: Mader Immobilien KG d. Mader Peter Paul & Co., Außerratschings, Stange: Errichtung eines Wohngebäudes mit Tiefgarage, Bp.103/28, K.G. Ratschings. Edyna GmbH, Kaltenbrunn, Telfes: Neubau der Kabine „Kaltenbrunn“, versch.Gp., K.G. Telfes. Christian und Ivan Wurzer, Mareit, Mühle 9: Bauliche Umgestaltung, Sanierung und energetische Erweiterung des bestehenden Reihenhauses, Bp.417, m.A. 2, K.G. Mareit. Florian Lanthaler, Telfes, Untertelfes: Errichtung eines Wohngebäudes für die Hofstelle mit Errichtung von Garagen, Gp.483/1, K.G. Telfes. Walter Schölzhorn, Innerratschings, Lehen: Errichtung von Lawinenablenkdämmen im Bereich der Hofstelle und des Hotels Larchhof, versch.Gp., K.G. Ratschings. Sterzing: Helmut Steiner, Gänsbacherstraße 44/A: Bauliche Umgestaltung, Sanierung und Erweiterung, Bp. 428, K.G. Sterzing. Heinrich und Thomas Zelger, Hochstraße 2/A: Änderung der Zweckbestimmung von Wohnung in Büro, m.A.9, Bp.202/1, K.G. Sterzing.
FUNDE UND VERLUSTE www.fundinfo.it
Vor hundert Jahren ...
1925
Zusammengestellt von Karl-Heinz Sparber
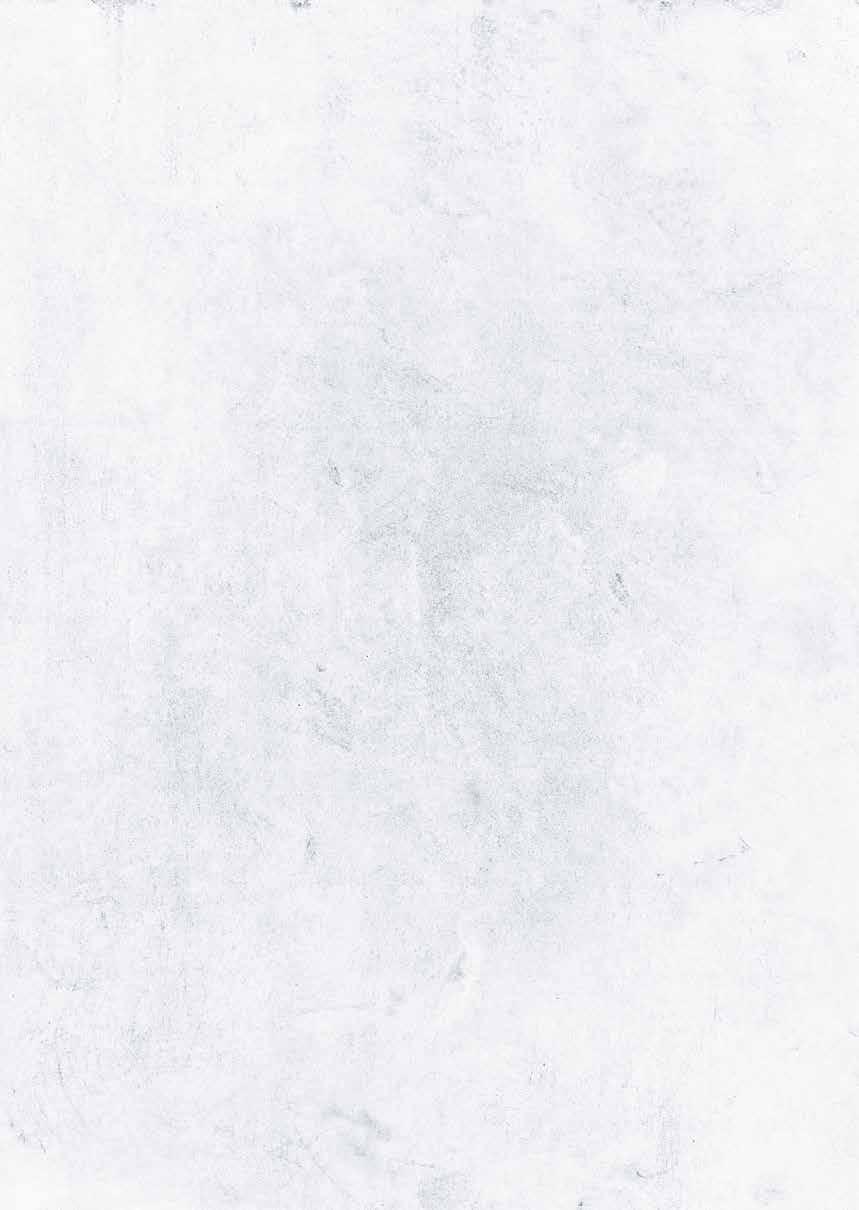
05.08.1925
Das internationale Sommerskirennen in Gossensaß
Voller Erfolg der Innsbrucker. Auch die übrigen Deutschen erfolgreich. Die Ausschreibung dieses Wettlaufes wurde nach ihrer Bekanntgabe wohl allseits mit Lächeln aufgenommen, und dies mit Berechtigung. (…). Die vom Sportverein Gossensaß beziehungsweise von der Kurvorstehung am 2. August zur Durchführung gebrachten internationalen Skiwettläufe standen unter

den denkbar ungünstigsten Witterunqs- und teilweise auch Schneeverhältnissen. Der Sprunglauf mußte schon Wochen vorher abgesagt werden und nur dem Umstande, daß in den letzten Tagen die Sonne sehr spärlich zum Vorscheine kam, war es zu danken, daß der Langlauf abgehalten werden konnte (…). Der Großteil der Läufer stieg während des Tages zur Magdeburger Hütte an. In den ersten Morgenstunden setzte heftiger Regen ein, der fast den ganzen Tag über anhielt. Bis tief ins Tal nisteten sich Nebel und Wolken ein. Die Abhaltung des Laufes schien sehr in Frage gestellt (…). Die 5 Kilometer lange Strecke führte vom Start weg (2.700 Meter) unmittelbar auf den Stubenferner und über diesen steil zur Bremerscharte, zirka 3.000 Meter, wo Kehrt gemacht wurde. Die gleiche Strecke war zur Abfahrt zu benützen. Knapp vor dem Ziele (Start und Ziel war gleich) führte sie neuerlich ansteigend bis unterhalb der Schneespitze 3.100 Meter. Von hier weg Abfahrt ins Ziel. Insgesamt wies die Strecke 600 Meter (!) Steigung auf (…). Während des Laufes war die Strecke im tiefsten Nebel gehüllt und es war immer nur die nächste Markierungsfahne sichtbar. Einsetzendes Schneetreiben behinderte den Lauf sehr. Auch waren die Schneeverhältnisse - nasser
Firn, teilweise Wassereis und Wasserrinnen - besonders in der Abfahrt hinderlich. Die erzielten Zeiten waren aber trotzdem gute zu nennen. Leider fehlten am Start, der ja auch gleichzeitig Ziel war, jedwede Unterkunft und sonstige Schutzmittel gegen das böse Wetter (…). Den Hauptteil der Teilnehmer stellte Italien, darunter auch eine Militärpatrouille. Aus Deutschland waren drei Läufer erschienen. Oesterreich war durch die Innsbrucker Hugo Hörtnagl, Moser und Hans Baldauf vertreten. Für die Innsbrucker war der Lauf ein voller Erfolg. Alle drei Läufer konnten sich siegreich placieren. Hörtnagl erreichte die Bestzeit mit 41 Minuten und 26 Sekunden. Auch die deutschen Konkurrenten konnten Erfolge erzielen. Einen Großteil der Preise gewann der W.-Sp.-V. Sterzing, der durch zahlreiche Läufer vertreten war. Einen sportlichen Mißerfolg hatten dafür die Reichsitaliener zu verzeichnen, die - obwohl gut vertreten - fast alle Plätze den Deutschen überlassen mußten. Eine Ausnahme bildeten die zwei Finanzieri, die sehr gute Zeiten liefen (…). Im festlich geschmückten Saale des „Palast-Hotels“ in Gossensaß fand abends die Preisverteilung statt, die der Präsident des Italienischen Skiverbandes vornahm. Leider konnten die mehrfachen Ansprachen und die Worte der Preisverteilung selbst von den meis-
Stübl beim guten Rötel beisammen, wo keine Tanzmusik hinkam, dafür deutsches Wort und deutsches Lied uns bis zur Abschiedsstunde vereint hielten. H. B.
Innsbrucker Nachrichten
18.08.1925
Ein Hirtenknabe vom Blitze getötet
Am 15. des Monats wurde der 14jährige Hirtenknabe Stefan Kofler, als er auf der Fluige-Alm bei Sterzing Ziegen hütete, von einem Blitzstrahl getötet.
Innsbrucker Nachrichten
23.08.1925
Die Elektrifizierung der Brennerbahn
Die Bahnstrecke Kufstein-Franzensfeste wird nun auch auf italienischer Seite elektrifiziert werden. Die „Gazzette Ufficiale“ veröffentlichen ein Dekret, wonach die Staatseisenbahnverwaltung 60 Millionen Lire zur Elektrifizierung der Strecke Bozen-Brenner, bis wohin bekanntlich Österreich die Elektrifizierung durchführt, auswirft. Diese Summe wird auf die zwei Finanzjahre 1925/26 und 1926/27 verteilt werden.
Der Tag

ten Deutschen nicht verstanden werden, da sie in italienischer Sprache gefaßt waren (…). Trikolore, italienische Hymne und dergleichen waren weggeblieben. Die Veranstaltung beschloß ein Sportball, wobei das mondäne Kurpublikum auf seine Rechnung kam. Zur selben Zeit saßen wir Deutsche mit unseren Landsleuten im „hinteren“
26.08.1925
Aus Gossensaß, 24. August, wird geschrieben
Derzeit befinden sich hier Infanterietruppen auf Manöver. In Pontigl stehen zwei große Zeltlager für 1.800 Mann. Letzte Woche fuhr Seine Eminenz Kardinal Rafael Merry del Bal mit dem Auto durch Gossensaß über den Brenner. In Pontigl bereitete ihm das Offizierskorps des Regimentes 231 mit General Spiller eine spontane Huldigung. Gestern war Truppenbeeidigung mit Feldmesse und nachmittags Sportspiele der Truppen.
Allgemeiner Tiroler Anzeiger
26.08.1925
Gossensaß, Waldfriedhof
Am vorigen Sonntag war, wie alljährlich, hl. Amt im Waldfriedhof für die verstorbenen und gefallenen Soldaten, zu welchem sich auch Feldmarschall Cadorna einfand.
Allgemeiner Tiroler Anzeiger
Telemarkübung vor dem Palasthotel in Gossensaß 1933
27.08.1925 (Die drei ersten Preise beim Skiwettrennen in Gold und Silber, in Kunstbronze gefasst und mit Marmorfuß)
Das Interessante Blatt