


Südösterreich






















Südösterreich





























Wertschöpfungskette Holz





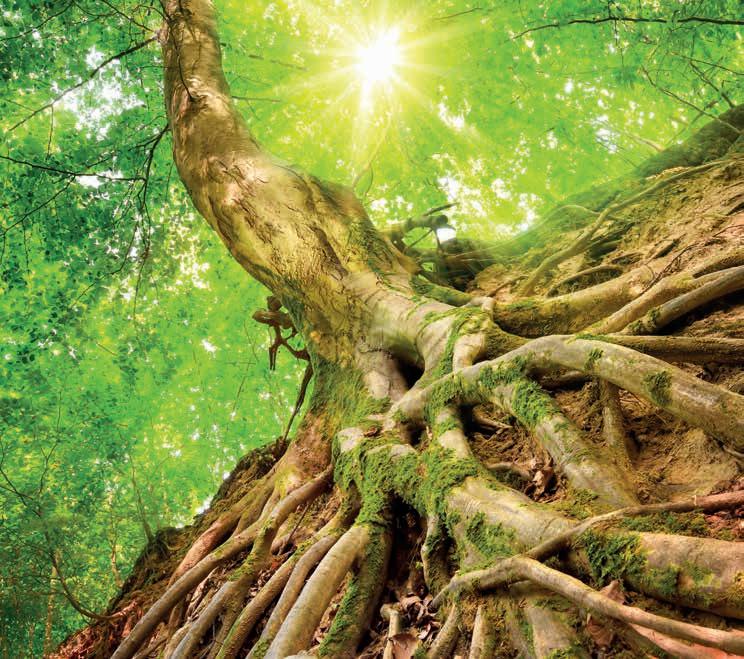
Lehrling des Jahres
Kärnten und die Steiermark forcieren ihre bundesländerübergreifende Zusammenarbeit.
Jungtischler Florian Dörfler lebt seine Kreativität mit dem Naturwunder Holz.
Waldmomente für Jung und Alt
Eva-Maria Puschan hat ihr ehemaliges Elternhaus in einen Waldkindergarten verwandelt.












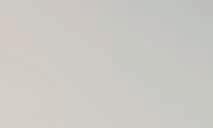
























Willkommen in der Zukunft des städtischen Lebens. HeimatGlück ist Teil einer intelligenten Stadtinfrastruktur. Hier verschmelzen Innovationen mit urbanem Lebensstil. Von intelligenten Energielösungen bis hin zu vernetzten Verkehrslösungen bietet Ihnen HeimatGlück ein Wohnen, das sich den Bedürfnissen der modernen Welt anpasst. ab € 3.560,-/m2



EIN PROJEKT DER
VERKAUF UND INFORMATION
Innovation Wohnen Nageler GmbH
Hans-Sachs-Straße 16/5, 9020 Klagenfurt
T +43 463 515 304 | Mail: office@innovationwohnen.at
„HeimatGlück“ in Klagenfurt zeichnet sich durch modernen Wohnkomfort, viel Grün und durchdachte Planung zu erschwinglichen Preisen aus.
Im Klagenfurter Stadtteil Harbach wächst eine Smart City, die die Vorteile urbanen Wohnens mit Leben im Grünen verbindet. In der Endausbaustufe sollen in dem östlichen Stadtteil Miet- und Eigentumswohnungen für rund 1.700 Menschen stehen. Die Landeswohnbau
Kärnten – Neue Heimat ist einer der Bauträger der Smart City und setzt mit „HeimatGlück“ auf Eigentumswohnungen zu fairen Preisen.
„Der Bedarf nach leistbaren Eigentumswohnungen ist groß“, sagt der Geschäftsführer der Neuen Heimat, Harald Repar. „Daher errichten wir im Rahmen des Projekts Harbach zwei Baukörper mit insgesamt 70 Wohneinheiten und einem Gemeinschaftsraum. Ich freue mich, dass es uns auch bei diesem Eigentumsprojekt gelingt, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und alle Menschen haben das Recht darauf.“
„Jedes Bauvorhaben entspricht einem hohen Qualitätsstandard“, erklärt Repar. Auch beim Objekt „HeimatGlück“ sorgen hochwertige und ökologisch nachhaltige Materialien wie Holzböden und Natursteinfliesen für eine gemütliche Atmosphäre. Alle Einheiten sind mit großzügigen Loggien und Balkonen inklusive flexibler Sonnenschutzsysteme oder mit Dachgärten ausgestattet. Einige Parterrewohnungen verfügen über einen kleinen, privaten Grünanteil.
Die Grundrisse der Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen sind so gestaltet, dass der Raum maximal genutzt wird. Während der Planungsphase besteht die Option für die künftigen Eigentümer, die Wohnungen nach ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Der Gemeinschaftsraum kann für Veranstaltungen aller Art genutzt werden.
Die Klagenfurter Firma „Innovation Wohnen Nageler GmbH“ ist Ansprechpartner für Interessenten. Raphael Nageler steht ihnen für ausführliche Informationsgespräche zur Verfügung. |


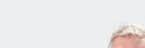






Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften unterliegen strengen Kriterien. Sie dürfen nicht gewinnorientiert kalkulieren und daher werden die Baukosten ohne Aufschlag weiterverrechnet. „Dadurch liegen unsere Objekte auch weit unter den Marktpreisen“, sagt der Heimat-Geschäftsführer. „Weiters versuchen wir, kostengünstige Grundstücke zu erwerben beziehungsweise Baurechte von Gemeinden zu erhalten. Auch Betriebskosten werden kostendeckend weiterverrechnet, die Höhe der Verwaltungskosten liegt unter dem maximalen Wert und der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag wird ebenfalls nur in der notwendigen Höhe eingehoben“, führt Repar aus. Im „HeimatGlück“ sorgen darüber hinaus auch innovative Energiesysteme für niedrige Betriebskosten.











Geschäftsführung Landeswohnbau Kärnten: Harald Repar, CSE und Wolfgang Ruschitzka. © Fotografie Gleiss










Holz als Lebensgefühl
Wussten Sie, dass der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft stammt und im frühen 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer zunehmenden überregionalen Holznot definiert wurde?
Ziel der Nachhaltigkeit ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung und Regeneration der Ressourcen zu schaffen.
Ich bin froh, dass sich der Wandel in unseren Köpfen bereits vollzieht und das Naturbewusstsein vieler Menschen wieder wächst. Dazu gehört auch gelebte Kultur, die mit Veranstaltungen wie dem Holzstraßenkirchtag (14. Juli in Fresach) für die ganze Familie vermittelt wird. Auch ist der 30. August (Internationaler Holztag – im Rahmen der Holzmesse Klagenfurt) ein wichtiger Meilenstein für dieses Bewusstsein.
Fazit: Bauen auch Sie in Zukunft ein bisschen mehr Holz in ihren beruflichen wie privaten Alltag ein. Denn wir alle sind Wald- und Holzbotschafter:innen!
Ihr Walter Rumpler

Dem Ursprung auf der Spur „Gerade in unserer heutigen digitalen Welt sind starke Wurzeln wichtiger denn je.“ Mit diesen Worten wurde ich im Waldkindergarten von EvaMaria Puschan empfangen, die uns im Zukunftsgespräch auf Seite 46 Einblicke in ein naturnahes Bildungskonzept gewährt. Der Wald ist aber auch tief in der DNA des advantage Magazins verankert. Eine tragende Säule, die das Thema Holz entscheidend mitgeprägt hat und 2021 unerwartet aus dem Leben geschieden ist, war Frau Burgi Hämmerle. Auch wenn wir uns nie persönlich kennengelernt haben, so ist ihre Präsenz spürbar. Danke, liebe Burgi, für dein Wirken!
Und so machen wir uns in dieser Ausgabe auf die Suche nach interessanten Spuren und laden Sie, werte Leser:innen ein, sich mit uns auf eine Reise entlang der Wertschöpfungskette Holz zu begeben – zurück zu den Wurzeln!
Herzlichst, Petra Plimon
Advantage Wirtschaftsmagazin advantage Wirtschaftsmagazin advantage.magazin
www.advantage.at
COVER: Foto: AdobeStock | Grafik: Werk1
PEFC/06-39-364/11
PEFC-zertifiziert

4 Der Wald als Klimaschützer
Wie nachhaltige Waldbewirtschaftung und Bauen mit Holz dem Klima hilft.
10 Kreativ mit Holz Jungtischler Florian Dörfler wurde zu Kärntens Lehrling des Jahres gekürt.
19 Kooperation statt Konkurrenz
Das Kärntner Netzwerk TINAA und der Holzcluster Steiermark vertiefen ihre Zusammenarbeit.
26 Prominente Exkursion
Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic besichtigte den Koralmtunnel.
28 Zugfahrt mit Mehrwert Kärnten und die Steiermark wollen auch in punkto Kultur gemeinsame Akzente setzen.
46 Zurück zu den Wurzeln

OFFENLEGUNG nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24 , 25 Mediengesetz. IMPRESSUM: Gründung 1997. Herausgeber: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Verlag & Medieninhaber: advantage Media GmbH. Geschäftsführung: Walter Rumpler und Petra Plimon. Chefredaktion: Petra Plimon, petra@plimon.at. Redaktion: Beatrice Torker, Monika Unegg. Anzeigenleitung: Walter Rumpler. Fotos: advantage, pixelio.de, pixabay.com, unsplash.com bzw. beigestellt lt. FN. Adresse: advantage Media GmbH, Villacher Ring 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, T: +43 (0)650 7303400. Die Meinungen von Gastkommentatoren müssen sich nicht mit der Meinung der advantage-Redaktion decken. Alle Rechte, auch Übernahme von Beiträgen gem. §44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. AGB/Haftungsausschluss/rechtlicher Hinweis: www.advantage.at
Eva-Maria Puschan hat ein Betreuungskonzept für Kinder im digitalen Zeitalter entwickelt.
56 Energiegemeinschaften
Ein Modell der Gegenwart und Zukunft für Menschen, die gemeinsame Sache machen.
60 Mehr als Waldbaden
Wald „auf Rezept“ könnte auch in Österreich bald zur Realität werden.




Wie nachhaltige Waldbewirtschaftung und Bauen mit Holz zu einem klimafreundlichen Leben für die nächste Generation beitragen können. Von Petra Plimon


Schon der Freiberger Oberberghauptmann Carl von Carlowitz formulierte vor mehr als 300 Jahren, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Das Prinzip der Nachhaltigkeit hat aktuell mehr Relevanz denn je. Wir haben Persönlichkeiten aus Kärnten und der Steiermark daher folgende Frage gestellt: Wie hilft die Wald- und Holzwirtschaft dem Klima und welche Bedeutung hat der Wald für Sie persönlich?




















Zwischen Klimakrise und Kreislaufwirtschaft: Der Wald ist die Grundlage für eine der wichtigsten Wertschöpfungsketten in Österreich.
© Adobe Stock





Anna-Sophie Pirtscher, Leiterin der Forstlichen Ausbildungsstätte
Ossiach am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)
Der Wald kann CO2 aus der Luft aufnehmen und den Kohlenstoff in Biomasse und dem Waldboden speichern.
Durch die langfristige Nutzung von Holz wird dieser Effekt sogar noch verstärkt, indem Kohlenstoff über die Lebensdauer der Bäume hinaus gebunden wird. Besonders in städtischen Gebieten ist der Wald ein wertvoller Luftfilter und sorgt für angenehme Kühle an heißen Sommertagen. Damit er auch zukünftig all seine Funktionen erfüllen kann, ist eine klimafitte und nachhaltige Waldbewirtschaftung unerlässlich. Während der Wald zweifellos ein Teil der Lösung zum Klimawandel ist, darf er nicht als alleiniges Heilmittel betrachtet werden. Persönlich bewundere ich den Wald zutiefst. Er ist mein Arbeitsplatz und schafft es, dass ich bei Spaziergängen abschalten kann. Er bietet endlose Entdeckungsmöglichkeiten: ein kleines Buschwindröschen am Wegrand, ein Fraßmuster auf einer Rinde oder einen geschäftigen Ameisenhaufen.
© FAST Ossiach/Schmette-Krch

Paul Lang, Obmann Waldverband Steiermark und proHolz Steiermark Unser Land wäre ohne Wald gar nicht vorstellbar. Ohne Wald würden wir uns nicht wohlfühlen. Speziell unser Kleinklima wäre ohne den kühlenden Effekt der Wälder sicher nicht so angenehm, wie es derzeit noch ist. Klimatechnisch gesehen haben unsere Wälder aber eine noch viel erstaunlichere Funktion. Sie können das CO2 in unseren lebensnotwendigen Sauerstoff umwandeln – und das nur mithilfe von Wasser und der Sonne. Das Geniale dabei ist: Wenn wir Holz als Baustoff – für Möbel oder auch Fenster, Böden und vieles mehr – verwenden, dann wird der im Holz gebundene Kohlenstoff noch viele weitere Jahre gespeichert. Inzwischen können an jenem Platz, an dem reife Bäume geerntet wurden, schon wieder neue Bäume wachsen und wieder CO2 binden! Holzverwendung ist also Klimaschutz! Durch möglichst hohen Einsatz von Holz und Holzfasern in immer mehr Bereichen können wir zudem enorm viel Erdöl ersetzen. Das ist ein zusätzlicher wichtiger Klimaschutz.
Für mich ist der Wald die sauberste Fabrik der Welt. Wir Waldbäuerinnen und Waldbauern bewirtschaften unsere Wälder seit vielen Jahren, indem wir Holz nutzen und trotzdem wird der Wald nicht weniger! Kein anderer Wirtschaftssektor arbeitet so nachhaltig.
© Thomas Luef

Elisabeth Schaschl, Leiterin des Referates Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer Kärnten
Der Wald spielt in Kärnten eine überaus wichtige Rolle und ist Teil unserer Kulturlandschaft. Rund 61,3 % der Kärntner Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Neben der Bereitstellung erneuerbarer Rohstoffe und der Einkommensquelle für die Eigentümer:innen – 96 % des Kärntner Waldes befindet sich in Privatbesitz – sorgt der Wald für sauberes Trinkwasser, wirkt als Klimaregulator und schützt vor Naturkatastrophen. Damit er diesen vielen Anforderungen gerecht werden kann, ist eine nachhaltige, verantwortungsvolle Bewirtschaftung durch die Waldbesitzer:innen Voraussetzung. Mittels Jungwuchspflege, Mischbaumförderung und Durchforstungen werden stabile Wälder geschaffen, die dem Klimawandel gewachsen sein werden, denn die Verwendung von Holz ist nach wie vor der Schlüssel zur Einsparung von CO2-Emissionen.
Der Wald ist für mich Einkommensquelle, Klimaregulator und Schutzfaktor Nr. 1. Wichtig ist der achtsame Umgang mit dieser wertvollen Ressource.
© Martin Mayer

Herfried Lammer, Bereichsleitung Projects & Services Smarte Composite & Oberflächen bei „wood kplus“
Viele zögerliche Haltungen gegenüber Maßnahmen zum Klimaschutz kommen daher, weil wir sie – oft unberechtigt –mit Rückschritt verbinden. Konsequente Aufforstung kann global einen signifikanten Beitrag zur Reduktion von CO2 leisten, ohne diese Bedenken zu tangieren. Die stoffliche Nutzung von Holz in verschiedensten Anwendungen in vermehrtem Ausmaß, aufbauend auf einer nachhaltigen Waldwirtschaft, und damit das CO2 aus dem Kreislauf zu entnehmen, ist langfristig aber notwendig und bietet gleichzeitig eine große Chance. Diese Form des Carbon Capturing, die meist auf bereits existierenden Technologien aufbaut, gilt es in Zukunft vermehrt zu nutzen. Berechtigte Bedenken, im Sinne von Nichterfüllen von wichtigen Anforderungen an das jeweilige Produkt, müssen dabei beispielsweise durch Forschung und Entwicklung ausgeräumt werden, ebenso wie unberechtigte Vorurteile.
© Andreas Balon

Doris Stiksl, Geschäftsführerin
ProPellets Austria
Der Wald und das Holz sind für den Klimaschutz unverzichtbar. Der Baum ist eine geniale Erfindung der Natur: Produziert beim Wachsen den wunderbaren Rohstoff Holz, bindet dabei CO2 und setzt nur ein Gas frei – und das ist Sauerstoff. Holzprodukte – vom Dachstuhl bis zum Kochlöffel – binden den Kohlenstoff wie ein zweiter Wald. Sägespäne, die bei der Verarbeitung entstehen, dienen der klimaneutralen Wärmegewinnung und ersetzen klimaschädliche fossile Energieträger. Somit ist der Wald und das Holz für uns Österreicher:innen wohl einer der größten Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.
Für mich ist es ein unglaubliches Privileg hier in diesem Waldland Österreich leben zu können. In einem Land, das knapp zur Hälfte mit Wald bedeckt ist. Die langjährige Tätigkeit im Forst- und Holzbereich hat meine Wertschätzung für diesen wertvollen Lebensraum und Rohstoff noch weiter gestärkt. Ich lebe in einem Holzhaus, nutze Wärme aus nachhaltigen Holzpellets und unser Familienwald wird mittlerweile von meinem Sohn mit Herzblut gepflegt und bewirtschaftet. Der Wald ist nicht nur mein liebster Erholungsort, sondern auch eine der größten Möglichkeiten, regionale Wertschöpfung zu generieren und aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken.
ProPellets



Richard Stralz, CEO & Aufsichtsratsvorsitzender Mayr-Melnhof Holz
Die steigende Nachfrage nach Holz im Zuge der Klima- und Ressourcenwende markiert die Renaissance dieses Werkstoffs. Seine einfache Bearbeitung, regionale Verfügbarkeit und unschlagbare CO2-Bilanz machen ihn essenziell für unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder.
Holz leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise, denn ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2 –als Baum wie als Möbel, Holzgebäude oder Spielzeug. Holznutzung schafft also einen zweiten Wald, da der Kohlenstoff im verarbeiteten Material gebunden bleibt, während durch die Aufforstung ein neuer Wald nachwächst, der wiederum Kohlenstoff speichert und Sauerstoff an die Umgebung abgibt. Der größte Hebel ist der Substitutionseffekt: Wenn Holz andere, CO2-intensive, nicht-nachwachsende Materialien ersetzt und dadurch deren CO2-Emissionen bei der Herstellung vermieden werden. Die in Österreich aus heimischem Holz hergestellten Produkte ersparen pro Jahr rund acht Mio. Tonnen CO2, das entspricht etwa einem Zehntel der nationalen Treibhausgasemissionen. Holz haben wir genug, das ist die schöne Nachricht. Es wächst hierzulande mehr nach, als geerntet wird. Für mich persönlich ist der Wald ein wichtiger Erholungsraum und er schafft viele Arbeitsplätze. Er gehört unbedingt nachhaltig bewirtschaftet, damit er uns auch zukünftig in all seinen Funktionen dienen kann.
© Maili








Andrea Pirker, Waldbesitzerin aus Kulm am Zirbitz und Mitglied des Vereins „Forstfrauen“

Johann A. Weinberger, Obmann proHolz Kärnten und Geschäftsführer Weinberger Holz
Die Holzwirtschaft ist Abnehmer für nahezu alle Produkte, die der Wald produziert. Das entnommene Holz beinhaltet sehr viel gebundenes CO2. Eine verstärkte Holznutzung erhöht unsere Menge an CO2, die wir aktiv einlagern. Mit Häusern aus Holz können wir einen zweiten Wald wachsen lassen, der eine echte CO2 Senke ist.
Bei der Herstellung vieler anderer Baumaterialen werden große Mengen an CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, diese weisen daher einen deutlich schlechteren CO2 Fußabdruck auf. Je mehr in Holz gebaut wird, desto besser ist das für unser Klima. Wir können diesen Effekt noch weiter verstärken, indem wir die Produkte länger nützen und am Verwendungsende einer weiteren stofflichen Nutzung zuführen (z. B. Altholz upcyclen mittels Spanplattenerzeugung – so wird aus der alten Gartenbank eine Küche).
Für mich persönlich ist die Wald- und Holzwirtschaft einer der größten, effektivsten und einfachsten Hebel, um unsere Welt „enkelfähig“ zu machen. Es liegt in unserer Verantwortung, heute bestmögliche Entscheidungen für morgen zu treffen. Ein bewusster Spaziergang in einem gepflegten, hellen und lichtdurchfluteten Wald, wo die Vögel zwitschern, ist ein „Akkuladen“ für Seele, Geist und Körper. © Weinberger Holz GmbH
Der Wald reinigt die Luft, sorgt für sauberes Wasser und gleicht Klimaextreme aus. Er befeuchtet die Luft wo nötig und entzieht ihr durch die Atmung der Bäume Schadstoffe. Schlussendlich wird durch das Wachsen der Bäume CO2 gespeichert, das durch die Verwendung von Holz weiterhin gebunden bleibt. Denkt man an einen Holzbau, so kommt Holz nicht nur in tragender Funktion zur Anwendung, sondern isoliert durch die eingeschlossene Luft zugleich. Damit wird der bei Betonbauten notwendige Vollwärmeschutz obsolet.
Der Wald ist für mich Natur pur, Heimat, Kraftort, Entspannungsraum, Lebensraum, aber auch Arbeitsplatz, Beobachtungsraum, Fitnesscenter und Finanzreserve! Ohne meinen Wald wäre ich nicht, was ich heute bin und er darf auch von mir erwarten, dass ich ihn sorgsam hege und pflege. Ich sehe es als primäre Aufgabe den Wald für uns alle und die nächsten Generationen zu erhalten!
© Martin Betz
Rund 48 % der Staatsfläche Österreichs ist Wald – das sind mehr als vier Mio. Hektar. Das waldreichste Bundesland ist die Steiermark mit einer Bewaldung von 62 %, gefolgt von Kärnten (61 %).
Quelle: Österreichischer Waldbericht 2023


Martin Gruber, LandeshauptmannStellvertreter und Forstreferent von Kärnten
Mehr als 60 Prozent der Kärntner Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Das ist ein hoher Wert für eine sehr wertvolle Ressource. Denn der Wald ist ein CO2-Speicher. Aber er erfüllt noch viel mehr Funktionen.
Nachhaltig bewirtschaftete Wälder bedeuten Wertschöpfung, Biodiversität sowie Schutz unserer Siedlungen und Straßen vor Lawinen oder Muren. Nur ein gesunder Wald kann auch in Zukunft all diese Rollen erfüllen. Deshalb ist es wichtig, einerseits die Forstbesitzer:innen zu unterstützen, um zerstörte Wälder wiederherzustellen, und andererseits Projekte zu fördern, die sich mit dem Aufbau klimafitter Wälder beschäftigen. Für mich persönlich ist der Wald ein wichtiger Erholungsort und Holz gleichzeitig ein nachhaltiger Rohstoff, der in Kärnten beim Fenster hereinwächst. Wer aktiven Klimaschutz betreiben will, muss sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder einsetzen.
© Büro LHStv. Gruber/Taltavull
INTERVIEW
mit Ing. Fritz Klaura, Landes-Innungsmeister Holzbau Kärnten


„Gebot der Stunde ist es dem riesigen Leerstand von Gebäuden entgegenzuwirken, indem man diese revitalisiert und die Gebäude auf die Anforderungen der Zukunft ertüchtigt.“
Fritz Klaura


„Holz schafft die Wende“
Gebäudeertüchtigung und kreislaufgerechtes Bauen sind das Gebot der Stunde.
Im Interview mit advantage unterstreicht Fritz Klaura, Landes-Innungsmeister Holzbau Kärnten, wie kreislaufgerechtes Bauen mit Holz dem Klima helfen kann.
advantage: Welche Vorteile bietet der Baustoff Holz?
Fritz Klaura: Die Bauwirtschaft ist global betrachtet für 60 Prozent der Schadstoffemissionen verantwortlich. Obwohl wir hierzulande den natürlichen Baustoff Holz in Hülle und Fülle vorrätig haben, wurde dieser bisher nur spärlich genutzt. Holz zeichnet sich dadurch aus, dass es einerseits im Wachstum Schadstoffe aus der Luft entnimmt, über die Photosynthese in Holzmasse und Blattwerk wie auch lebensnotwendigen Sauerstoff umwandelt und andererseits als Baustoff vor allem das gebundene CO2 so lange konserviert bis es der Natur in Form von Verbrennung oder Vermoderung zurückgeführt wird. Somit ist Holzbau ein aktiver Klimaschützer!

„Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von vorhandenen Bauteilen aus Holz in anderen Gebäuden, sprich Re-Use von Gebäudeteilen oder Konstruktionselementen.“
Fritz Klaura
Haben wir überhaupt genügend Holz zur Verfügung, um die Bauaufgaben zu erfüllen? Sind unsere Wälder nicht schon an ihr Limit gelangt, wenn man hie und da kahle Waldflächen durch Borkenkäferbefall sieht?
Regional sind da schon bedenkliche Entwicklungen zu sehen, wie im Lesachtal oder im Mölltal, wo Schutzwälder betroffen sind und ihre Funktion nun von technischen Verbauungen erfüllt werden muss. Da sehen wir die Auswirkungen des Klimawandels ganz drastisch. Dennoch haben wir genügend Wald, um den Bedarf an Holz als Baumaterial zu decken. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass wir endlich von flächen- und ressourcenverbrauchenden Vorgangsweisen Abstand nehmen müssen und uns nachhaltiger Methoden bedienen. Nur bewirtschaftete Wälder sind ein Garant für die Nachhaltigkeit. Gebot der Stunde ist es dem riesigen Leerstand von



Gebäuden entgegenzuwirken, indem man diese revitalisiert und die Gebäude auf die Anforderungen der Zukunft ertüchtigt. Mit vorgefertigten und hochdämmenden Holzelementen kann man diesen Gebäuden eine neue thermische Hülle geben. Ausbau, Umbau und Sanierung sind die Stärken des Holzbaus.
Wie kann so eine Gebäudeertüchtigung mit Holz realisiert werden?
Die Gebäudestruktur bleibt in weiten Zügen erhalten. Die neue Infrastruktur wird an den Fassaden hochgezogen. Mit einer vorgefertigten, neuen, hochdämmenden Gebäudehülle, in der die Fenster, Lüftungsgeräte, thermische Kollektoren und Photovoltaikelemente eingebaut sind, wird das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. Die Sanierung der innenliegenden Nasszellen (Bäder, WC’s), der Böden und der Raumausstattung erfolgt wie bisher. Zukunftsweisend, schnell und ökonomisch: So lässt sich diese Art der Gebäudeertüchtigung zusammenfassen.
Diese Form der Sanierung bedarf einer disziplinierten Zusammenarbeit zwischen Architekten, Haustechnikplaner, Werkplaner und letztlich auch dem Auftraggeber. Das Ergebnis ist in allen Fällen
wirtschaftlicher und nachhaltiger als herkömmliche „Sanierung“ mit aufgeklebten Polystyrolplatten (Porozell) als Wärmedämmverbundsystem.
Diese Art der Sanierung und Verbesserung wäre zudem angetan, dem gigantischen Leerstand von Gebäuden entgegenzuwirken. Eine Offensive in diese Richtung würde einerseits dem Schadstoffausstoß entgegenwirken und andererseits die heimischen Wirtschaftskreisläufe stärken, die Abhängigkeit von ausländischen Materialien mindern und den Erhalt der ländlichen Kulturlandschaft fördern.
Welchen Beitrag kann der Holzbau in punkto Kreislaufwirtschaft leisten?
Kaskadennutzung skizziert die Möglichkeit, den Rohstoff Holz mehrfach und effizienter zu verwenden: zum Beispiel zunächst als Material für Gebäude, Innenausbauten oder Möbel, dann für Holzwerkstoffe und zuletzt zur Gewinnung von Strom und Wärme. Dadurch kann eine möglichst hohe Ressourceneffizienz und ein Maximum an Wertschöpfung erreicht werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von vorhandenen Bauteilen aus Holz in anderen Gebäuden, sprich Re-Use
von Gebäudeteilen oder Konstruktionselementen. Da ist der Holzbau perfekt. Nur muss man halt wissen, wo es so etwas gibt.
Welche Rahmenbedingungen braucht es da seitens der öffentlichen Hand?
Ich bin der Meinung, wenn die öffentliche Hand das fördern will, dann müsste so etwas wie eine Material-Datenbank zur Verfügung gestellt werden, wo gebrauchte Bauteile und Gebäudekomponenten gelistet sind, die zur Wiederverwendung geeignet wären. So etwas bräuchten wir für die gesamte Baubranche; nicht nur für Betonteile, sondern auch für Holzteile usw. |
Landesinnung Holzbau / Sparte Gewerbe & Handwerk
Ing. Friedrich KLAURA
Koschutastraße 4
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: 05 90 90 4 – 120
F: +43 5 90 904 114
E: innungsgruppe2@wkk.or.at

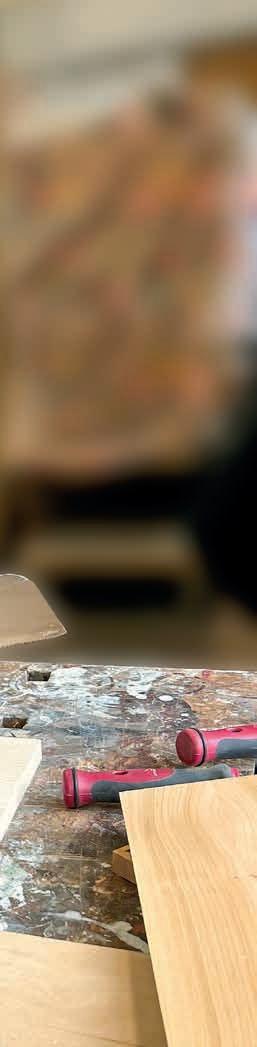

Florian Dörfler wurde als Kärntner Lehrling des Jahres 2023 ausgezeichnet und macht sich nun bereit für die WorldSkills, die Weltmeisterschaften der Berufe, in Lyon. Von Petra Plimon
,,Für mich war eigentlich schon lange klar, dass ich Tischler werden will“, betont Florian Dörfler (18), der seine Lehre bei der Tischlerei Konec in Feldkirchen mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Sein Können stellte das Nachwuchstalent bereits bei zahlreichen Wettbewerben erfolgreich unter Beweis.
Talente fördern
Nach dem Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb ging es für den gebürtigen Gurktaler im Vorjahr gleich weiter zum Bundesbewerb, wo er unter den Top fünf landete. Bei den Berufsstaatsmeisterschaften in Salzburg, den „AustrianSkills“, konnte Florian Dörfler schließlich mit seiner Leistung Ende November Bronze gewinnen und sich für die WorldSkills in Lyon qualifizieren. Im Feber diesen Jahres heimste der ambitionierte Jungtischler eine besonders begehrte Trophäe ein. Von einer Fach-
„Ich kann junge Menschen nur motivieren, auch solche Wege einzuschlagen. Denn mit einer Lehre kann man heutzutage alles erreichen.“
Florian Dörfler, Lehrling des Jahres
jury wurde Florian Dörfler in einem spannenden Finale nicht nur zum Spartensieger Gewerbe und Handwerk, sondern auch zum Kärntner Lehrling des Jahres 2023 gewählt.
Lehrling des Jahres
44 angehende Fachkräfte aus sechs Sparten gingen um die Auszeichnung ins Rennen. Dabei wurden im Vorfeld über 50.000 Stimmen in einem Onlinevoting für sie abgegeben. „Ich kann meine


Kreativität am Holz ausleben und erlebe jeden Tag aufs Neue, wie durch meine Arbeit tolle Dinge entstehen. Am liebsten arbeite ich mit Massivholz“, bekräftigt
Dörfler, für den die Lehre einen idealen Einstieg in die Arbeitswelt darstellt: „Ich kann junge Menschen nur motivieren, auch solche Wege einzuschlagen. Denn mit einer Lehre kann man heutzutage alles erreichen.“
Mit Freude am Tun
Aktuell bereitet sich Florian Dörfler intensiv auf die Teilnahme an den WordSkills vor, die von 10. bis 15. September in Lyon, Frankreich, über die Bühne gehen werden. Eine Delegation aus Kärnten wird den Lehrling des Jahres zu den Berufsweltmeisterschaften begleiten. „Abgesehen vom fachlichen Üben werden wir über Skills Austria auch mit zusätzlichen Angeboten wie Workshops, Englischkurse und Mentaltraining im Vorfeld unterstützt. Man bekommt viele Einblicke“, freut sich
Dörfler, dessen erklärtes Ziel die Meisterprüfung ist.
Beruf mit Zukunft
Hinter jedem jungen Leistungsträger steht aber auch ein engagierter Lehrbetrieb, der den Fachkräftenachwuchs entsprechend fördert. „Florian ist ein Ausnahmetalent.

„Für die Zukunft ist es wichtig, junge, ambitionierte Menschen wie Florian im Betrieb zu haben. Es kann nur gemeinsam gehen.“ Konstantin Konec, Tischlermeister
Für die Zukunft ist es wichtig, junge, ambitionierte Menschen wie ihn im Betrieb zu haben. Es kann nur gemeinsam gehen“, betont Juniorchef und Tischlermeister Konstantin Konec, der 2016 selbst als Teilnehmer bei den Berufsmeisterschaften erfolgreich war. Die Lehrlingsausbildung nimmt bei der Tischlerei Konec in Feldkirchen einen sehr hohen Stellenwert ein. Nahezu alle der aktuell 15 Mitarbeiter haben im Betrieb auch ihre Lehre absolviert.
Tradition trifft Moderne
„Geprägt vom traditionellen Handwerk versuchen wir hochwertige Möbel und Wohnwelten aus Holz mit verschiedensten Materialien wie Glas, Textilien, Corian, Stein oder Stahl zu kombinieren“, erklärt Konstantin Konec, der die Tischlerei gemeinsam mit seinen Geschwistern Olivia und Tobias führt. Von der Planung bis zum fertigen Projekt: Der Familienbetrieb in dritter Generation legt größten Wert auf Qualität und regionale Wertschöpfung. Inzwischen spielt auch die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. |

Die Berufsweltmeisterschaften werden alle zwei Jahre ausgetragen. Mission der „WorldSkills“ ist die Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe und der Berufsbildung weltweit. Junge Fachkräfte aus aller Welt im Alter bis 22 Jahre haben hier die Gelegenheit ihr fachliches Können international unter Beweis zu stellen.
Die Kärntner Sparkasse blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück und positioniert sich als solider Partner der heimischen Wirtschaft.
„Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung.“
Vorstandssprecher
Mag. Siegfried Huber
Das seit über 15 Jahren kontinuierliche Kundenwachstum setzt sich fort und weitere Investitionen in das Filialnetz sowie für die finanzielle Bildung und Gesundheit der Menschen liegen im Fokus. Der Erfolg der Kärntner Sparkasse kommt über unzählige Förderungen wiederum den Menschen und der Gesellschaft in Kärnten zugute.
Solide Bilanz
Getrieben von einer guten operativen Performance mit neuerlichem starken Kundenwachstum (+5.813 Kund:innen) und einem günstigen Zinsumfeld stieg das Betriebsergebnis im Jahr auf 83,04 Mio. Euro. Der Jahresgewinn verzeichnet einen Anstieg auf 59,8 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte das Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) trotz steigendem Betriebsaufwand (+10,2 %) mit einer Reduktion um 12,3 % auf einen Wert von 52,5 % verbessert werden. Das Kreditvolumen stieg im Jahresvergleich um 1,9 % auf 3,33 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen wuchsen auf einen Stand von 4,13 Mrd. Euro. Ein Plus von 0,4 % weist die Kärntner Sparkasse zum Jahresende 2023 bei der Bilanzsumme in Höhe von 5,06 Mrd. Euro aus.

Eine starke Eigenkapitalausstattung von 20 % (Steigerung von 1,6 %) ist die Basis für weiteres Wachstum in allen Kundenund Geschäftsbereichen. „Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung“, betont Vorstandssprecher Siegfried Huber. Bereits zum elften Mal wurde die Kärntner Sparkasse mit dem „Recommender-Award“ ausgezeichnet und erreichte somit das Spitzenfeld aller Regionalbanken in Österreich. „Das Recommender-Gütesiegel ist eine Auszeichnung und Bestätigung der hervorragenden Kundenorientierung unserer Betreuer:innen, wir sind sehr stolz darauf“, so Vorstandsdirektor Michael Koren.
Auch die digitalen Services in der Sparkassengruppe werden ständig erweitert. George
stellt die Erfolgsgeschichte der Kärntner Sparkasse dar. Mit George-Business sind seit kurzem auch die Firmenkunden Teil der George-Familie. Ein wesentlicher Ankerpunkt ist aber dennoch die persönliche, direkte Betreuung in den Filialen. „Financial Health“ – also die finanzielle Gesundheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld – stehen dabei im Fokus. „Der Zugewinn von neuen Kund:innen zur Kärntner Sparkasse seit über 15 Jahren ist die Bestätigung unserer umfangreichen Initiativen für ‚Financial Health‘ in Verbindung mit kompetenter, persönlicher Betreuung in unseren 49 Filialen in ganz Kärnten“, erklärt Vorstandsdirektorin Ulrike Resei. Das Zukunftsprojekt schlechthin ist der Generalumbau am Neuen Platz in Klagenfurt. Die von der Kärntner Sparkasse entwickelte WohlfühlStrategie wird demnach auch in den Umbau des Sparkassen-Hauptgebäudes einfließen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant. |
Alvise Foscari-WidmannRezzonico, Christoph Steiner,
Martin
Straubinger (v. l.) © Plimon

Was die heimische Forstwirtschaft derzeit wohl am meisten beschäftigt, ist die europäische Einflussnahme auf die zukünftige Waldbewirtschaftung.

ÖWISSENSWERT
Das SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme (SURE) stellt ein Zertifizierungssystem zur Verfügung, um die Einhaltung der geforderten Nachhaltigkeitskriterien der EU für die Erzeugung von Strom und Wärme aus Biomasse nachweisen zu können. Ab einer Größe von 20 MW Brennstoffwärmeleistung müssen Anlagenbetreiber, die Biomasse einsetzen, nachweisen, dass das eingeetzte Holz aus nachhaltiger Produktion stammt. Mit der Einführung der RED III (ab 1.1. 2025) wird die Größenschwelle für die Nachweispflicht von 20 auf 7,5 MW gesenkt und zahlreiche neue Kriterien implementiert.
sterreich hat bereits eines der weltweit strengsten Forstgesetze, das im Wesentlichen ein Waldschutzgesetz ist. „Die österreichische Forstgesetzgebung war auch beispielgebend für viele andere Länder. Über den Green Deal greift die Europäische Union (EU) nun massiv in die zukünftigen Bewirtschaftungsvorschriften der heimischen Wälder ein“, betont Martin Straubinger, FoscariWidmann-Rezzonico’sche Forstdirektion.
Wald als CO2-Speicher
Ziel ist es, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird. Der Wald spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ein Festmeter Holz speichert – je nach Baumart – mehr als eine Tonne CO2. „Wenn man eine durchschnittliche Waldlage hernimmt, hat man einen Zuwachs von zehn Festmetern Holz im Durchschnitt pro Hektar pro Jahr. Das ist eine beachtliche Menge. Auf einem Hektar Wald können über zehn Tonnen CO2 jährlich in den Bäumen gespeichert und damit aus der Atmosphäre entzogen werden“, erklärt Straubinger.
Strenge Kriterien für Energieholz
Die von der EU erlassene, neue Richtline für Erneuerbare Energien (RED) betrifft insbesondere die Biomasse und bringt eine Bürokratiewelle mit sich. „Wenn wir forstliche Biomasse z. B. an die Kelag verkaufen, müssen wir das Holz nach den *SURE-Kriterien zertifizieren“, so Straubinger. Es muss eine lückenlose Dokumentation nachgewiesen werden, die über Audits überprüft wird – vom Ursprungsort des Holzes über die Transportwege bis hin zum Kunden (analog zum EU-Lieferkettengesetz in der Industrie). „Die Kriterien lassen jedoch sehr viel Spielraum in der Beurteilung. Allerdings, wenn gelieferte Biomassemengen bei einem Audit nicht anerkannt werden nach den SURE-Kriterien, dann hat diese Menge kein Zertifikat und es ist dafür pro Festmeter Holz eine Strafe von rund € 100,- zu zahlen. Das kann rasch teuer werden“, weiß Straubinger.
EU-Entwaldungsverordnung
Ein weiteres Thema, mit dem die heimische Waldwirtschaft derzeit befasst ist, ist die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Diese soll ab 1.Jänner 2025 in Kraft treten. 420 Mio. Hektar Wald weltweit – eine Fläche größer als die EU – sind zwischen 1990 und 2020 verloren gegangen. Entwaldung und Waldschädigung sind wichtige Treiber von Klimawandel und Biodiversitätsverlust. „Die Geschäftspraktiken einiger Großkonzerne zwingen die gesamte Forstbranche in ein unglaubliches bürokratisches Regelwerk. Schuld ist das ausgesprochene Fehlverhalten von einigen


wenigen globalen Playern, die im Holzgeschäft tätig sind“, so Straubinger. Für die Lieferkette Holz bedeutet dies, dass jeder Marktteilnehmer beginnend beim Waldbesitzer ab 30. Dezember 2024 für jedes Holz und Holzprodukt, das in Verkehr gebracht wird, eine Sorgfaltserklärung abgeben muss. Erst mit einer entsprechenden Referenznummer darf Holz geschlägert und verkauft werden. „Jeder Festmeter Holz, der ab 2025 keine Referenznummer hat, gilt in Europa dann als illegal geschlägertes Holz. Man schafft einen unglaublichen, zusätzlichen Bürokratismus, wo für uns als Betrieb und für die Waldbesitzer keine Sinnhaftigkeit erkennbar ist“, so Straubinger. Dabei ist der Zustand des Waldes mit aktuellen Satellitenfotos in höchster Auflösung jederzeit ersichtlich. Es gibt nahezu keine Branche, die derartig offen einsichtig ist wie ein Forstbetrieb. Jahrzehntelang hat die EU bei illegalen Schlägerungen, wie z. B. in Rumänien, sprichwörtlich zugeschaut und diese gefördert. „Mit fatalen Folgen auch für die heimische Forstwirtschaft: Billiges, weil gestohlenes Holz überschwemmte die
„Früher waren der alte Baum und der alte Waldbestand für viele Waldbesitzer die sprichwörtliche grüne Sparkasse. Heute sind alte Bäume und alte Waldbestände zum Risiko geworden.“
Martin Straubinger
Märkte. Heimische Waldbewirtschaftung wurde zunehmend unrentabel. Jetzt werden mit der EUDR alle über einen Kamm geschoren! Gleichen Unsinn erkennen wir bei der Renaturierungsverordnung“, betont Straubinger. Ziel ist die Wiederherstellung der Natur wie sie vor 70 Jahren vorhanden war: Kraftwerke sollen abgebaut, Auwaldflächen und Überflutungsgebiete zusätzlich geschaffen werden. „Gleichzeitig wird jedes neue Kraftwerksprojekt in noch unberührten Seitenbächen gefördert. Da weiß die rechte Hand der EU oft nicht was die Linke tut,“ so Straubinger.
Grüne Sparkasse wird zum Risiko Der Klimawandel ist auch in der Forstwirtschaft allgegenwärtig und wird immer sichtbarer, wie etwa durch den Baumartenwandel in den Wäldern. „Die Tanne, aber auch gewisse Laubhölzer – wie Buche, Ahorn und in tieferen Lagen die Eiche –sind besonders zukunftsfähig. Das entscheidende ist die Mischung“, erklärt Straubinger, für den ein weiteres Faktum sehr bezeichnend ist: „Früher waren der alte Baum und der alte Waldbestand für viele Waldbesitzer die sprichwörtliche grüne Sparkasse, auf die man im Fall des Falles zurückgegriffen hat. Heute sind alte Bäume und alte Waldbestände zum Risiko geworden. Und dieses Risiko sind eben extreme Wetterereignisse und die Zunahme der Borkenkäfer.“
Führungswechsel in Paternion
Kürzlich übergab Martin Straubinger die Leitung der Foscari-WidmannRezzonico’schen Forstdirektion in jüngere
„Mit den neuen EU-Vorgaben gibt es gravierende Regeländerungen für den laufenden Betrieb, es sind noch intensivere Dokumentationen notwendig.“
Christoph Steiner
Hände. Christoph Steiner, der seit mehr als 20 Jahren im Forstbetrieb tätig ist und bereits für die Koordination der gesamten Holzernte zuständig war, übernahm die Funktion des Forstdirektors. „Mit den neuen EU-Vorgaben gibt es gravierende Regeländerungen für den laufenden Betrieb, es sind noch intensivere Dokumentationen notwendig. Prinzipiell ist das Potenzial des Betriebes groß. Wir haben einen mischbaumartenreichen Gebirgswald und sind daher nicht nur von einer Baumart abhängig. Das produzierte Rundholz ist am Markt u. a. wegen seiner Qualität und unserer Liefer- und Termintreue sehr gefragt“, bekräftigt Steiner. Foscari ist einer der bedeutendsten forstwirtschaftlichen Besitze Österreichs. Die Aktivitäten der Forstdirektion umfassen ein weit reichendes Gebiet, das sich vom östlichen Randbezirk von Villach bis knapp zu den Ufern des Weißensees erstreckt. |
Foscari-Widmann-Rezzonico’sche Forstdirektion
Schloßstraße 1 9711 Paternion

Eine Branche im Fokus eines harten Versicherungsmarktes.
Die Holzindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der österreichischen Wirtschaft. Laut Daten des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, trägt sie mit etwa 3,6 % maßgeblich zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Dennoch steht die Versicherbarkeit der Holzindustrie vor zahlreichen Herausforderungen, die sowohl durch interne Dynamiken als auch durch externe Faktoren beeinflusst wird.
Aktuelle Situation
Aktuell ist die Versicherbarkeit der Holzindustrie durch eine Reihe von Entwicklun-
„Insgesamt ist ein ganzheitlicher Ansatz zum Risikomanagement entscheidend, um die vielfältigen Gefahren in Sägewerken zu bewältigen.“
Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO der Koban Südvers
gen gekennzeichnet, die Versicherer bei der Bewertung und Preisgestaltung von Polizzen berücksichtigen müssen. Dazu gehören die Zunahme von klimabedingten Naturkatastrophen, die Gefahr von Betriebsunterbrechungen durch technische oder logistische Probleme, Preissteigerungen bei Schadenzahlungen aufgrund Inflation und neue technologische Bedrohungen wie Cyberangriffe.
Versicherer bieten in Österreich verschiedene Produkte an, um die Risiken der Holzindustrie abzudecken, darunter u. a. Sach-, Betriebsunterbrechungsversicherungen, (Produkte-)Haftpflichtversicherungen, Cyberversicherungen, Maschinen-
bruch- sowie Maschinenbruchbetriebsunterbrechungsversicherung usw. Diese Produkte müssen jedoch ständig angepasst werden, um den sich ändernden Marktverhältnissen gerecht zu werden.
Brandrisiko bei Sägewerken
Sägewerke sind Betriebe, in denen Holz geschnitten, verarbeitet und gelagert wird. Aufgrund der Natur des Materials und der industriellen Prozesse besteht in Sägewerken ein erhöhtes Risiko für Brände. Ein Brand kann nicht nur erhebliche Sachschäden verursachen, sondern auch die Sicherheit der Mitarbeiter:innen gefährden und die Umwelt belasten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sägewerke geeignete Vorkehrungen treffen, um den Brandschutz zu optimieren. Als Hauptursachen von Bränden kommen folgende Faktoren in Frage:
1. Holzstaub: Ein Hauptfaktor, der zu Bränden in Sägewerken führen kann.
2. Funkenflug: Die Verwendung von Sägeblättern, Schleifmaschinen und anderen Werkzeugen kann Funken verursachen, die brennbare Materialien entzünden können, wenn sie nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden.
3. Elektrische Probleme: Defekte elektrische Verkabelungen, Überlastungen oder Kurzschlüsse können ebenfalls Brände auslösen, insbesondere in Umgebungen, in denen Holzstaub vorhanden ist.
4. Hitzeeinwirkung: Hohe Temperaturen durch fehlerhafte Maschinen oder unzureichende Kühlung können leicht brennbare Materialien entzünden.
5. Zusätzlich eingebrachte Brandlasten: Diese erhöhen das Risiko im Produktionsprozess und können meist mit einfachen Mitteln verhindert werden.
6. Cyberangriffe: Das mittlerweile für viele Betriebe nicht mehr unbekannte Cyberrisiko hat in vielen Branchen Einzug gehalten.
Dies erfordert von den Versicherern, ihre Risikomodelle kontinuierlich anzupassen und möglicherweise höhere Prämien zu verlangen, um die Wirtschaftlichkeit der Verträge zu erhalten. Zudem spielt die technologische Entwicklung eine wesentliche Rolle. Fortschritte in der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung können einerseits effizientere und sicherere Methoden für das Arbeitsumfeld bieten, andererseits aber auch neue Risiken einführen, zum Beispiel durch die Abhängigkeit von komplexen Maschinen und Systemen.
Ausblick
Der Ausblick für die Versicherbarkeit der Holzindustrie in Österreich ist von einer Mischung aus Unsicherheit und Optimismus geprägt. Aus gesellschaftlicher Sicht müssen Versicherer und Unternehmen der Holzindustrie eng zusammenarbeiten, um innovative Versicherungslösungen zu entwickeln, die den spezifischen Risiken dieser Branche gerecht werden und diesen für unser Land wichtigen Branchenzweig bestmöglich schützen.
Heutzutage haben sich je nach Unternehmensgröße diverse Mindeststandards etabliert, wobei hier als Beispiel eine Brandmeldeanlage im Produktionsbereich zu erwähnen ist. Technische Mindeststandards sollten jedoch stets im Ein- und Gleichklang mit organisatorischen Maßnahmen stehen. Zu dem im Risikomanagement bezeichneten „low-hanging-fruits“ zählen Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeiter:innen, laufende thermografische Untersuchungen von elektronischen Bauteilen und Schaltschränken, regelmäßige Feuerwehrübungen, ordnungsgemäße Einweisung von Fremdfirmen inkl. der sogenannten Heißarbeitsscheine, regelmäßige Wartung und Revision von Maschinen.
Insgesamt ist ein ganzheitlicher Ansatz zum Risikomanagement entscheidend, um die vielfältigen Gefahren in Sägewerken zu bewältigen. Durch die Implementierung

„Die individuelle Risikoberatung stellt die Basis für ein nachhaltiges Versicherungskonzept dar“.
Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO der Koban Südvers
von präventiven Maßnahmen, Notfallplanung und kontinuierliche Verbesserung können Sägewerke sicherere Arbeitsumgebungen schaffen und das Risiko von Unfällen und Schäden minimieren. Die Sicherstellung der Versicherbarkeit der Holzindustrie in Österreich erfordert eine dynamische und flexible Herangehensweise, die sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die zukünftigen Möglichkeiten berücksichtigt. Durch die Anpassung an sich ändernde Bedingungen und die Investition in nachhaltige und risikomindernde Technologien kann die Holzindustrie weiterhin ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Wirtschaft bleiben. |
KOBAN SÜDVERS Group GmbH Ing. Florian Traußnig MBA Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO www.kobansuedvers.at florian.traussnig@kobangroup.at Tel: +43 664 966 85 72
„Klimajäger“ Andreas Jäger, WKK-Präsident Jürgen Mandl, Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende BKS Bank und WKK-Direktor Meinrad Höfferer (v. l.). © WKK / Daniel Waschnig

Über 200 Besucher:innen informierten und vernetzten sich im März beim ersten Nachhaltigkeitstag der Kärntner Wirtschaft.
Mit den ESG-Kriterien und der EU-Taxonomie-Verordnung kommen komplexe Vorgaben auf die Unternehmen zu. Damit die Kärntner Betriebe zu diesem breiten Themenkomplex bestens informiert sind, veranstaltete die Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam mit der BKS Bank den ersten Nachhaltigkeitstag. „Eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes ist nicht nur für das Klima wichtig, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, betonte WKK-Präsident Jürgen Mandl.
Keine Kür, sondern Pflicht
Die mehr als 200 Besucher:innen waren sich bewusst, dass dies ein schwieriges und auch sehr herausforderndes Unterfangen sein wird, das nur im Schulterschluss von Wirtschaft, Politik und jedem Einzelnen gelingen kann. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, ist noch viel Vorarbeit zu leisten. „Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Ich empfehle
jedem Unternehmen, dieses kostenlose Service in Anspruch zu nehmen, um gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiges Wirtschaften zu setzen“, so Mandl.
Ab 2025 ist der Nachhaltigkeitsbericht keine Kür, sondern Pflicht. Zusätzlich zum Finanzbericht müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeiter:innen, 50 Mio. Euro Nettoumsatz oder 25 Mio. Euro Bilanzsumme ab dem Jahr 2025 nichtfinanzielle Informationen im Lagebericht des Geschäftsberichtes veröffentlichen. Diese müssen vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Ein Jahr später gilt dies auch für börsennotierte KMUs. Wer sein Unternehmen nachhaltig ausrichtet, wird demnach auch in Zukunft erfolgreich sein.
Gesellschaftliche Verantwortung Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit ist die BKS Bank, die bereits zum dritten Mal in Folge von einer Fachjury mit dem ASRA für ihren Nachhaltigkeitsbericht ausgezeichnet wurde. „Jedes Unternehmen muss sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein und einen Beitrag
zu den großen globalen Herausforderungen wie dem Klimaschutz leisten. Eine transparente Berichterstattung ist eine wichtige Informationsquelle für IInvestor:innen und Kund:innen. Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht zeigt das Unternehmen, welchen Einfluss es auf Gesellschaft und Umwelt hat. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine Chance für Unternehmen“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank.
„Die Wirtschaftskammer
Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien.“
WKK-Präsident Jürgen Mandl
Vielfältiges Programm
Das Programm des ersten Nachhaltigkeitstages bot Unternehmern aus allen Branchen wertvolle Informationen und Impulse. Im Rahmen einer hochkarätigen Fachausstellung beantworteten Expert:innen Fragen zu den Themen Berichtswesen, Ökobilanzen oder Energieverbrauch. Im Fokus standen Förderungen, Softwarelösungen für das Reporting oder welche Daten für die Erstellung einer Klimabilanz benötigt werden. Großer Andrang herrschte auch bei den fünf Workshops. |
INTERVIEW
mit Sebastian Adami, Geschäftsführer Timber Innovation Network Alpe-Adria (TINAA) und Alexander Pinter, Geschäftsführer Holzcluster Steiermark GmbH
Kärnten und die Steiermark verstärken ihre Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette Holz.
Von Petra Plimon

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Kooperation des Timber Innovation Network Alpe-Adria (TINAA) mit dem Holzcluster Steiermark. Im Interview mit advantage geben die beiden Geschäftsführer Sebastian Adami und Alexander Pinter Einblicke in die Zusammenarbeit.
advantage: Wofür steht das Netzwerk TINAA in Kärnten?
Sebastian Adami: TINAA setzt sich zum Ziel, die Holzwirtschaft in Kärnten zu stärken und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir verfolgen dabei eine ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette Holz, inklusive der Zulieferbetriebe. Zentral ist auch der Wissenstransfer in den Bereichen Bildung, Forschung, Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ein weiteres Ziel von TINAA ist die Förderung von Kooperationen und Innovationen sowie die attraktive Positionierung der Kärntner Holzwirtschaft im Alpe Adria Raum.
Welche Schwerpunkte setzt der Holzcluster Steiermark?
Alexander Pinter: Der Holzcluster Steiermark agiert nach dem Motto „Fördern, Vernetzen und Entwickeln“. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen unsere Clusterpartner-Betriebe. Wir bieten ihnen eine optimale Plattform zur Vernetzung, Weiterbildung und Präsentation ihrer Leistungen. Gleichzeitig sind wir mit unseren Expert:innen auch Teil verschiedenster Projekte und Initiativen und können dadurch branchenspezifisches Wissen sowie Knowhow rund um Hightech-Innovationen in unser Netzwerk einfließen lassen. Wir machen Wissenstransfer sowohl zu KMUs, EPUs als auch Großbetrieben möglich.
Wieso ist die bundesländerübergreifende Kooperation so wichtig?
Adami: Die Zusammenarbeit zwischen TINAA und dem Holzcluster Steiermark erweist sich als entscheidender Faktor für
unseren Erfolg. Unternehmen aus beiden Bundesländern nehmen eine herausragende Position als weltweite Innovationsführer ein. Unser Bestreben liegt darin, dieses Wissen durch kontinuierlichen Austausch und gemeinsame Visionen weiter zu stärken. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht uns, gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten und innovative Wege zu beschreiten.
Pinter: Kärnten und die Steiermark stehen im Bereich der Holzbranche großteils vor ähnlichen Herausforderungen. Das vergangene Jahr war kein einfaches: Gestiegene Zinsen, KIM-Verordnung, Inflation und Fachkräftemangel. Diesen Themen mit bundesländerübergreifenden Initiativen zu begegnen, halten wir für sinnvoll. Wissenstransfer und -austausch, wie etwa im Bereich der Weiterbildung, des Lehrlingscoachings, aber auch bei Themen wie Holzbau oder innovativen Anwendungen des Werkstoffs Holz, stehen dabei ganz oben auf unserer Agenda. Wir
freuen uns, so gemeinsam zur Weiterentwicklung der Holzbranche beitragen zu können.
Welche gemeinsamen Aktivitäten sind in Zukunft geplant?
Adami: Wir haben ehrgeizige Pläne für zukünftige gemeinsame Aktivitäten, wobei ein zentrales Element unseres Engagements das Netzwerktreffen im Rahmen der Alpen Adria Holzmesse Ende August in Klagenfurt ist. Diese Veranstaltung dient nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern auch der Stärkung von Beziehungen und der Förderung von gemeinsamen Projekten. Wir möchten die Zusammenarbeit in der Holzbranche über die Landesgrenzen hinweg stärken und innovative Impulse für die Zukunft setzen.
„In unserer Betrachtung der Wertschöpfungskette Holz legen wir großen Wert darauf, das Gesamtbild zu erfassen und über die Grenzen der Region hinauszublicken.“
Sebastian Adami
Pinter: Die bereits angesprochene Holzmesse steht natürlich auch in unserem Fokus. Allerdings sehen wir auch Möglichkeiten, gemeinsames Knowhow über unsere Forschungspartner:innen zu generieren. Im Forschungsprojekt ForForestInnovation beschäftigen wir uns derzeit mit Datenerhebung rund um den Wald, um bessere Prognosen über dessen Bewirtschaftung und Nutzung treffen zu können. JOANNEUM RESEARCH, einer unserer Knowhow-Partner, hat vor Kurzem ein eigenes Labor, das Digital Twin Lab im Klagenfurter Lakeside Park, eröffnet. Ein Anknüpfungspunkt für Wissenstransfer sowohl für die steirische Holz-
branche, als auch für jene in Kärnten. Mit digitalen Zwillingen können Prognosen für Zukunfts-Szenarien wesentlich genauer getroffen und mögliche Schritte in Richtung klimafitter Wald leichter erzielt werden.
Welche Trends zeichnen sich aktuell in der Holzbranche ab?
Adami: Der Holzbau hat eine tiefgreifende Transformation erfahren und technologisch sind mittlerweile nahezu unbegrenzte Möglichkeiten realisierbar. Die Herausforderung liegt jedoch oft in den gesetzlichen Vorschriften, die in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß sind und innovative Ansätze behindern. Ein weiterer vielversprechender Trend ist die verstärkte Verwendung nachhaltiger Rohstoffe als Ersatz für konventionelle Materialien. Innovative Produkte aus Kärnten, wie beispielsweise Klettergriffe, Straßenschilder aus Holz und ein neuartiger Verbissschutz für Bäume, demonstrieren eindrucksvoll die Vielseitigkeit und Innovationskraft dieser Region.
Pinter: Der innovative Einsatz von Holz im Mobilitätssektor kann einen positiven Effekt auf die CO2-Reduktion im Lebenszyklus eines Kraftfahrzeuges bewirken. Im Forschungsprojekt CARpenTieR engagieren wir uns, die Bedeutung von
„Bundesländerübergreifendes Knowhow aufzubauen und zu nutzen, wird für beide Regionen von entscheidender Bedeutung sein und einen gewinnbringenden Effekt erzeugen.“
Alexander Pinter
Holz als alternativen Werkstoff hervorzuheben. Im Holzbau steht der Bereich der Wohnraum-Sanierung, aber auch jener der Systemoptimierung momentan besonders im Fokus. Digitalisierung und Automatisierung führen auch im Holzbau zu effizienteren Prozessabläufen, die uns einen Schritt weiter in Richtung klimaneutrales Bauen bringen. Auch künstliche Intelligenz findet in der Holzbranche ihre Anwendung.
Was ist Ihre persönliche Motivation sich für das Zukunftsthema Holz einzusetzen?
Adami: Holz begleitet mich seit meiner Kindheit, geprägt durch familiäre Wurzeln. Die tiefergehende Auseinandersetzung mit diesem einzigartigen Werkstoff zeigt mir seine faszinierenden Facetten. Besonders überzeugt bin ich von Holz als Beitrag zur CO2-Thematik – eine Überzeugung, die weiterwachsen wird.

WIRTSCHAFTSFAKTOR HOLZ IN SÜDÖSTERREICH:
In KÄRNTEN erwirtschaften rund 3.600 Betriebe mit 22.550 Mitarbeiter:innen eine Bruttowertproduktion von 2,8 Mrd. Euro. In der STEIERMARK sind es rund 5.800 Betriebe mit etwa 55.000 Mitarbeiter:innen und einer Bruttowertproduktion von 5,8 Mrd. Euro.
Pinter: Als Betriebsleiter eines Forstbetriebs kenne ich die Thematiken der Branche, aber auch die Faszination dieses vielseitigen Werkstoffs aus erster Hand. Holz ist der Bau- und Werkstoff des 21. Jahrhunderts – und es wächst wieder nach und speichert dabei CO2, wie schon mein geschätzter Kollege erwähnt hat. Das ist genau, was ein innovativer Werkstoff aufweisen muss. Daher bin überzeugt davon, dass auf viele Fragen der Zukunft die Antwort Holz lautet. |
Das Institut ROBOTICS der JOANNEUM RESEARCH begleitet Klein- und Mittelbetriebe in der Digitalisierung von Fertigungsprozessen. Die Holzbranche bietet großes Potenzial.
Durch die Digitalisierung verändert sich auch die Holzindustrie, die einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in Kärnten und der Steiermark darstellt. Vom automatisierten Einbringen des Holzes im Wald, über den Transport, die Lagerung, das Zersägen der Baumstämme, die automatisierte Verarbeitung bis hin zum Produkt: Bei den Unternehmen, insbesondere bei Klein- und Mittelbetrieben (KMU), ist sehr viel Potenzial für Digitalisierung und Modernisierung vorhanden. Während der Innovationsgrad für Produkte durchaus hoch ist, ist das für die Fertigung oft nicht gleichermaßen zutreffend. Hier setzt das Institut ROBOTICS der JOANNEUM RESEARCH an und unterstützt Unternehmen in der digitalen Transformation.
Digitalisierung und Holz Grundsätzlich gilt zu unterscheiden, ob es sich um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder von organisatorischen Abläufen handelt. Dann sind es nämlich meist eher Softwarelösungen, die mit der Fertigung an sich nur am Rande zu tun haben. „Wir von ROBOTICS hingegen befassen uns mit der Digitalisierung von Fertigungsprozessen, etwa, wie sehr manche mehr oder weniger ausgeprägten, sich wiederholenden Tätigkeiten mit Hilfe von Automatisierungslösungen oder Robotern verbessert werden können“, erklärt Christian Oswald. Roboter haben oft den Ruf, dass es sich dabei um sehr teure Lösungen handelt. Das muss jedoch nicht immer der Fall sein. Oft lassen sich Dinge sehr einfach lösen. „Es bietet sich daher –insbesondere für kleinere Unternehmen –an, sich Schritt für Schritt diesem Thema zu nähern,“ so Oswald weiter.
Praktikable Lösungen
Das Institut ROBOTICS arbeitet praxis-
näher, als so mancher vielleicht vermuten würde. „Wir können dabei helfen, von den zahlreich vorhandenen Förderinstrumenten Gebrauch zu machen und etwaige Lösungen zu diskutieren“, betont Michael Rathmair. Das könnte z. B. eine Platzoptimierung von Gewerbeflächen oder der Holzlagern sein. Dazu gibt es moderne (Simulations-)werkzeuge, wie man so etwas beispielsweise virtuell durchführen könnte, ohne vorab größere Investitionen tätigen zu müssen. Auch digitale Zwillinge spielen vermehrt eine Rolle.
Über den Tellerrand blicken Gerade kleine Unternehmen verbinden mit dem Begriff Forschung oft ein strategisches und teures Unterfangen. Ein Grund mehr für das dynamische Team rund um Christian Oswald und Michael Rathmair KMUs zu motivieren, das Angebot des Institutes ROBOTICS zu nutzen und auf branchenübergreifende Erfahrungswerte zurückzugreifen. Die Prozessoptimierung mit Automatisierung und Robotik steht dabei im Fokus. „Als Forschungsunternehmen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es oft recht schwierig ist, Unternehmen davon zu überzeugen, dass Forschung einen kompetitiven Vorteil bieten könnte und regen dazu an, dass die Unternehmen Kontakt mit uns aufnehmen. Dabei sollen sie keine Scheu davor haben, uns auch scheinbar triviale Herausforderungen zu erzählen“, so Oswald und Rathmair unisono. |
KONTAKT
JOANNEUM RESEARCH
ROBOTICS – Institut für Robotik und Flexible Produktion 9020 Klagenfurt am Wörthersee T +43 316 876-2035
christian.oswald@joanneum.at michael.rathmair@joanneum.at

„Es bietet sich insbesondere für kleinere Unternehmen an, sich Schritt für Schritt diesem Thema zu nähern.“
Christian Oswald

„Wir können dabei helfen, von den zahlreich vorhandenen Förderinstrumenten Gebrauch zu machen und etwaige Lösungen zu diskutieren.“
Michael Rathmair
INTERVIEW
mit Simone Schmiedtbauer, Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft Steiermark
Die Steiermark setzt auf ein breites Maßnahmenbündel, um die Wälder zukunfts- und klimafit zu halten.
40.000 Forstwirtinnen und Forstwirte sind in den steirischen Wäldern aktiv und liefern die Basis für eine Wirtschaftsleistung entlang der Wertschöpfungskette Holz von rund 12 Mrd. Euro allein in der Steiermark. Diese wird in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen, denn man will den nachwachsenden Rohstoff Holz ganz gezielt im Kampf gegen den Klimawandel einsetzen – sei es als Kohlenstoffspeicher in Holzhäusern oder Möbeln, als nachhaltiger Energielieferant in Form von Biomasse oder zur Entwicklung neuer holzbasierter Werkstoffe, wie Landesrätin Simone Schmiedtbauer im Interview mit advantage betont.
advantage: Was bedeutet für Sie nachhaltige Waldwirtschaft?
Simone Schmiedtbauer: Nachhaltige Waldbewirtschaftung zeichnet sich dadurch aus, dass weniger Holz entnommen wird, als nachwächst und dass die Forstwirt:innen in Generationen denken. Echte Nachhaltigkeit entsteht dann, wenn wir heute schon an die nächsten Generationen denken und sicherstellen, dass sie den Wald ebenso nutzen können, wie wir es tun. Da geht es auch um Fragen der Verjüngung der Bestände und die Klimawandelanpassung.
Wie geht’s dem Ökosystem Wald im Klimawandel?
Der Klimawandel bereitet dem Wald zunehmende Probleme und ist die größte Herausforderung für die heimischen Wälder. In der Steiermark setzen wir auf ein breites Maßnahmenbündel, um die Wälder zukunfts- und klimafit zu halten. Ein Projekt, auf
das ich besonders stolz bin, ist die dynamische Waldtypisierung. Damit haben wir ein praktisches Online-Tool geschaffen, wo sich Forstwirt:innen maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen für ihren Wald holen können. Basierend auf Lage, Klima, Niederschlag und anderen relevanten Faktoren bekommt man etwa Empfehlungen für die richtige Baumart für den eigenen Wald.
„Echte Nachhaltigkeit entsteht dann, wenn wir heute schon an die nächsten Generationen denken und sicherstellen, dass sie den Wald ebenso nutzen können, wie wir es tun.“
Simone Schmiedtbauer
Welchen Beitrag kann der Holzbau für den Klimaschutz leisten?
Der Holzbau leistet einen unschätzbaren Beitrag zu unseren Bestrebungen nach mehr Nachhaltigkeit. Ich bin stolz, dass wir in der Steiermark mit einer Quote von rund einem Drittel Holzbau im gemeinnützigen Bereich, für den ich zuständig sein darf, zu den absoluten Spitzenreitern gehören. Denn Holz ersetzt nicht nur fossile Baustoffe, sondern speichert in jedem Kubikmeter Holz auch eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre!
Was sind derzeit die größten Herausforderungen für Waldbauern und Forstbetriebe? Die größte Herausforderung ist ganz sicher der Klimawandel mit all seinen Begleiterscheinungen – Stich-


„Eine weitere Herausforderung für die heimische Forstwirtschaft ist auch der zunehmende Regelungsdruck aus Brüssel.“
Simone Schmiedtbauer
wort Borkenkäfer. Eine weitere Herausforderung für die heimische Forstwirtschaft ist auch der zunehmende Regelungsdruck aus Brüssel. Bei uns ist die nachhaltige Waldbewirtschaftung gelebte Praxis. Viel Bürokratie braucht es bei uns also nicht. Ich habe mich als Europaabgeordnete immer gegen zu viele europaweite Vorgaben in der Forstwirtschaft ausgesprochen, denn man kann spanische oder portugiesische Wälder ganz einfach nicht mit österreichischen oder finnischen Wäldern vergleichen. Hier haben wir eine unglaubliche Vielfalt und das ist gut so. Hier braucht es eine Rückkehr zur Subsidiarität.
Sie sind selbst Landwirtin. Welche Bedeutung hat der Wald für Sie persönlich?
Eine Große! Ich bin leidenschaftliche Forstwirtin und Jägerin. Unser Wald ist für mich aber auch ein Kraftort. Wenn ich mit meiner Familie und meinen Hunden im Wald spazieren bin, dann tanke ich dabei Energie wie sonst kaum wo. |

WISSENSWERT
Die Steiermark ist mit über einer Mio. Hektar Wald – das sind knapp 62 % der Landesfläche – das waldreichste Bundesland Österreichs.
Der vielseitige Werkstoff Holz regt zu allerlei nachhaltigen Ideen und Kooperationen an. advantage hat einen Blick quer durch Südösterreich gewagt.
An der FH-Salzburg – Campus Kuchl entdeckte der Kärntner Felix Reiner (26) seine Leidenschaft für innovative Lösungen aus Holz. Die Kombination mit der Liebe zum Sport mündete schließlich in der Idee, eine nachhaltige Alternative für Klettergriffe auf den Markt zu bringen. „Speziell die Kletterszene genießt den Ruf, auf die Umwelt zu achten. Wenn man sich jedoch die modernen Kletter- und Boulderanlagen genauer ansieht, kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass dies nicht auf die Indoor-Kletterbranche übertragbar ist: Tonnenweise Kunststoff-Griffe, welche zwar einwandfrei funktionieren, doch zumeist aus Materialien gefertigt werden, die nicht recycelt werden können und aus fossilen Rohstoffen bestehen“, so Reiner. Daraus entstand die Mission, nicht nur Produkte auf den Markt zu bringen, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, sondern auch ein Kreislaufsystem beinhalten, durch welches die Produkte wieder recycelt bzw. upcycelt werden können. Mittlerweile werden die Griffe auf der ganzen Welt verkauft und über 25 Kletter- und Boulderhallen sind von den Produkten überzeugt.


Holz kann mit modernster Technik auch in bisher unentdeckte Anwendungsbereiche gebracht werden. Forschungsprojekte wie WoodC.A.R. und CARpenTier, aber auch das steirische Unternehmen Weitzer Woodsolutions sind federführend bei der Frage, wie Holz in der Mobilität eingesetzt werden kann. Ob Öffis, Privatautos oder Nutzfahrzeuge – Hightech-Leichtbau-Holzteile können uns in Zukunft viel nachhaltiger und unabhängiger bewegen. Denn im Gegensatz zu Metall sind sie leichter, ökologisch herstellbar und konkurrenzfähig – bei höchster heimischer Wertschöpfung. Mit Leichtbau-Holzteilen kann es in Europa angesichts der unsicheren Materialversorgungslage außerdem gelingen, unabhängiger von fernen Märkten zu werden.
Felix Reiner stellt innovative Klettergriffe aus Holz her, die weltweit Anklang finden.

Bei der Entwicklung der ökologischen Baumschutzhülle stand die Gewährleistung eines optimalen Wuchsraums für die Pflanze an erster Stelle. © Fundermax
Kunststoffhüllen und Schutznetze schützen Bäume, bleiben oft im Wald und belasten das Ökosystem als Mikroplastik. Biologisch abbaubare Baumschutzhüllen lösen dieses Problem nachhaltig und tragen zur Bildung von wertvoller Biomasse bei. Aus dieser Idee entwickelte das Kärntner Traditionsunternehmen Fundermax in Zusammenarbeit mit Witasek aus Feldkirchen eine innovative Baumschutzhülle. „Sie schützt vor Wildverbiss und entlastet das Ökosystem durch biologischen Abbau. Die Baumschutzhüllen bestehen zu 99 % aus Holz und werden in einem speziellen Nassverfahren hergestellt, ohne zusätzliche Bindemittel“, erklärt Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax. Die Markteinführung ist für Herbst 2024 geplant und markiert einen Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung der Forstwirtschaft. Diese innovative Lösung zeigt, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg und Umweltschutz miteinander zu verbinden und gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen zu minimieren.

Woazboard ist ein handgemachtes
Balance Board mit Rocker aus heimischen Hölzern.
© Christian Schmidt

Der FH Kärnten Architekturstudiengang hat den International DesignbuildXchange Award 2024 für ein innovatives Holzbauprojekt für obdachlose Menschen gewonnen. ©
Alles begann in einer kleinen Werkstatt in der Südsteiermark: Vier Jungs hegten den Traum, ihre Leidenschaft zum Surfen mit einem Handwerk zu vereinen. Da die Materialien, aus denen Surfbretter gebaut werden, alles andere als umweltfreundlich sind und auch die Nähe zum Meer fehlte, wurde „Woazboard“ geboren. „Ein Woazboard ist ein aus heimischen Hölzern, in liebevoller Handarbeit gebautes Balance Board mit Rocker (eine durchgehende Biegung des Brettes). Wir wollten ein Produkt entwerfen, das lokal und nachhaltig produziert werden kann, für jeden zugänglich ist und auch ohne großen Aufwand verwendet werden kann“, erklärt Otto Kaltner. Dem Startup ist es zudem ein Anliegen mit Rohstoffen zu arbeiten, die langlebig und strapazierfähig sind. „Was uns am meisten am Werkstoff Holz fasziniert, ist, wie einzigartig er ist. Ohne zusätzlichen Aufwand macht er jedes einzelne von uns hergestellte Board zu einem Unikat.“

Die Lavanttaler Tischlergemeinschaft ist eine Kooperation von aktuell fünf eigenständigen Tischlereien aus dem Lavanttal.
Die soziale Dimension des nachhaltigen Bauens
Die Nachfrage nach nachhaltigem und sozialem Wohnraum nimmt weltweit zu und Architekten stehen vor der Herausforderung, innovative Lösungen zu entwickeln. In diesem Kontext zeichnet sich der Studiengang Architektur an der FH Kärnten als Vorreiter aus. Der International DesignbuildXchange Award 2024 für das wegweisende Holzbauprojekt „Impulshaus“, das sich mit der dringenden Problematik der Obdachlosigkeit auseinandersetzt und von Studierenden entwickelt und umgesetzt wurde, ist Lohn für jahrelange Forschung und Kompetenzentwicklung. „Wohnraum für Menschen ohne Zuhause zu entwickeln ist wichtiger denn je. Wir arbeiten sehr intensiv daran, das Projekt auch in der Zukunft weiterzuführen“, betont Julien Presland, ehemalig mitwirkender Student und nun Mitarbeiter der FH Kärnten.
Die Lavanttaler Tischlergemeinschaft, Österreichs längst währende und noch immer bestehende Handwerkerkooperation, feiert ihr 30-jähriges Jubiläum: 1994 entschlossen sich 13 Tischlerbetriebe aus dem Lavanttal, eine bislang einzigartige Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu starten. „Wir haben damals erkannt, dass das wirtschaftliche Überleben nur gesichert ist, wenn wir gemeinsam arbeiten“, blickt Obmann Klaus Penz zurück. Durch die enge Kooperation ergeben sich wertvolle Synergien beim Einkauf, bei den Produktionsmöglichkeiten, der Werbung sowie der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft und haben uns in den 30 Jahren unseres Bestehens sehr gut und zum Vorteil für jeden einzelnen Betrieb und unserer Kunden entwickelt. Wir haben bewiesen, dass man mit Zusammenarbeit sowohl Großprojekte abwickeln kann, als auch sämtliche Arbeiten für den Privatkunden zu einem attraktiven Verhältnis von Preis und Leistung bekommt“, so Penz.

Die hochrangigen Exkursionsteilnehmer:innen vor dem Gedenkstück, dem Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine.
© Alois Rumpf
WISSENSWERT
- Mehr als 10.000 direkt
Beschäftigte in der gesamten Bauzeit
- Koralmbahn 130 Kilometer, Koralmtunnel 33 Kilometer lang- sechstlängster Tunnel der Welt
- Vollinbetriebnahme
Dezember 2025
- 160 bis 170 Güter- und Personenzüge täglich, bis zu 250 km/h Geschwindigkeit , „gezogen“ von Taurus bzw. Siemens Triebfahrzeugen , Fahrtzeit Graz-Klagenfurt rund 45 Minuten
- Kostenstabiles Gesamtvolumen von € 5,4 Mrd.
- Mehrwert durch 95 % österreichische Unternehmer bleibt im Land
- 160 Unternehmer dzt. noch im Tunnel beschäftigt

Die Koralmbahn hat viele „Väter“, aber nur eine „Mutter“. Von Alois Rumpf
er letzte Schienenfluss ist geschlossen“ konnte eine prominente Besuchsdelegation von Klaus Schneider und Helmut Steiner – Projektleiter seit Baubeginn des Koralmtunnels vor 20 Jahren – voller Stolz vernehmen. Manfred Kainz, WKO-Regionalstellenobmann Deutschlandsberg, hatte seine ehemaligen politischen Weggefährten, denen Landeshauptfrau a. D. Waltraud Klasnic, Bürgermeister a. D. Siegfried Nagl, die ehemaligen Landtagsabgeordneten Josef Straßberger, Heinz Gach, Wolfgang Kasic und Peter Rieser angehörten, zu einer Exkursion des Koralmtunnels geladen. Bürgermeister Peter Neger konnte die
Runde im Baubüro BTA KAT Ost Schönaich Anfang April herzlich in seiner Gemeinde willkommen heißen.
Prominente Exkursion
In einer Begehung konnte die ranghohe Delegation schließlich nicht nur den Infopark Weststeiermark mit dem zehn Meter hohen Bohrkopf der Tunnelbaumaschine des Bauloses KAT2 mit einer Weltrekordvortriebslänge von 17,1 km, sondern auch den IC-Halt Bahnhof Weststeiermark besichtigen. Der Bahnhof, der langsam Gestalt annimmt, ist eines der Herzstücke der Koralmbahn im Westen der Steiermark und passt sich bestens der Land-



„Der Koralmtunnel ist ein kleiner Teil für die große Welt.“
Waltraud Klasnic, Landeshauptfrau a. D.
schaft – mit Blick zur Koralm, der Burg Deutschlandsberg und dem Lassntitztal –an. Das „Portal Ost“ war für die Besucher:innen der Einstieg in den fast fertigen Tunnel. Hier konnte man das „Feeling“ der Bahn hautnah erleben und sich die gigantische Arbeit der Beschäftigten bis zu diesem Zeitpunkt vorstellen.
Im Gespräch mit der „Mutter der Koralmbahn“ – Landeshauptfrau a. D. Waltraud Klasnic – kam von ihr vor allem die Freude und Dankbarkeit über das Entstehen und die baldige Inbetriebnahme der Koralmbahn zu Tage. Begonnen vom damaligen Bundeskanzler Schüssel über
Verkehrsminister Gorbach in enger Zusammenarbeit mit LH Haider konnte der Kampf für die Koralmbahn – und zusammenhängend in der Folge den Semmeringtunnel als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors, wichtig und zukunftsweisend für die aufstrebenden Wirtschaftsräume –gewonnen werden. „Der Koralmtunnel ist ein kleiner Teil für die große Welt“, so Klasnic. Sie vergaß aber nicht, auch den weststeirischen unentwegten „Vorkämpfern“ für die neue Südstrecke – allen voran Reinhold Purr, Christoph Klauser, Wolfgang Chibidziura sowie Manfred Kainz und Walter Kröpfl- zu danken, die mit ihrem vollen Engagement für die Sache bis zur Unterschrift am 7. Dezember 2004 „ruhelos“ wirkten.
Eine Analyse der Exkursion in Form eines gemeinsamen Mittagessens im Gasthof Schaller – TEZ Georgsberg – durfte nicht fehlen. |

mit Wolfgang Muchitsch, Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Landesmuseums für Kärnten (kärnten.museum)

Das neue kärnten.museum hat eine große Anziehungskraft entwickelt und bereitet sich gemeinsam mit der Steiermark auf die Eröffnung der Koralmbahn vor. Von Petra Plimon
Seit einem Jahr leitet Wolfgang Muchitsch die Geschicke des kärnten.museum. Im Interview mit advantage spricht der gebürtige Steirer über aktuelle Projekte und wie man der Zugfahrt durch den Koralmtunnel künftig einen Mehrwert bieten will.
advantage: Was sind die programmatischen Schwerpunkte des kärnten.museum im heurigen Jahr?
Wolfgang Muchitsch: Unser großes Projekt im kärnten.museum ist in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum des Mediums Radio in Österreich, das wir anhand des Bundeslandes Kärnten bearbeiten. Die Sonderausstellung „Immer auf Sendung“ läuft vom 19. April bis 6. Oktober. Wir schaffen zudem eine neue, noch bessere Ausstellungsebene im Public Space im Erdgeschoss des kärnten.museum, die frei zugänglich ist. Dort werden wir uns Themen widmen wie „Hitler entsorgen“,





wo es darum geht, wie man mit Überresten der NS-Vergangenheit umgeht, die man vielleicht in einem Privathaushalt findet. Weitere Schwerpunkte sind der Briefbombenterror der 1990-er Jahre und wir begeben uns wieder auf die Suche nach dem Ort Noreia. Wir beenden das Jahr mit einer großen Kunstausstellung, über die wir heute aber noch nichts verraten dürfen.
„Das
kaernten.museum sollte ein lebendiger Ort sein, der alle begeistert, die ihn besuchen.“
Wolfgang Muchitsch
Mit welchen Angeboten können die Besucher:innen darüber hinaus rechnen?
2024 ist auch geprägt durch die Übernahme von zusätzlichen Standorten und Museen. Die „wissens.wert.welt“, das spartenübergreifende Mitmach-Museum für Kinder ab fünf Jahren, ist seit 1. Jänner Teil des kärnten.museum. Wir errichten gerade eine Erlebnisausstellung zum Thema „Zauberei. Von Merlin bis Hogwarts“, die im Juni eröffnet wird und schaffen dadurch ein zusätzliches Angebot für junge Besucher:innen.
Auch verhandeln wir derzeit mit dem Pilgermuseum Globasnitz, das wir ja schon sehr schon lange wissenschaftlich mitbetreuen. Es gibt Gespräche den gesamten Betrieb zu übernehmen.
Zudem soll das „Bachmann Haus“ in der Henselstraße in Klagenfurt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es wird im Juni 2025 anlässlich des Geburtstags von Ingeborg Bachmann und den Tagen der deutschsprachigen Literatur eröffnet werden.
Welche Pläne gibt es für das Kärntner Botanikzentrum sowie den Wappensaal?
Wir haben als kärnten.museum inzwischen elf Standorte. Innerhalb dieses Verbandes ist das Kärntner Botanikzentrum natürlich


© kärnten.museum/ Arnold Poeschl
DER Hotspot der Biodiversität. Es gibt selten eine vergleichbare Situation im Zentrum einer Landeshauptstadt, wo man einen solchen Ort der Naturvielfalt zur Verfügung hat. Wir sind gerade in Verhandlung mit der Stadt Klagenfurt um die Erweiterung der Stollenanlage am Kreuzbergl, die wir als großes Schaufenster nutzen wollen. Es soll ein Ort der Bewusstseinsbildung entstehen.
Im Wappensaal im Landhaushof planen wir gemeinsam mit dem Land Kärnten „ein Tor zur Demokratie“ – vor allem für junge Menschen – zu schaffen. Dafür haben wir einen Gestaltungswettbewerb durchgeführt und sind dabei eine Umsetzung bis zu Beginn des kommenden Jahres zu realisieren. Das wird der Auftakt für das Erinnerungsjahr 2025 sein.
2025 wird auch die Koralmbahn in Vollbetrieb gehen. Wie bereitet sich das kärnten,museum darauf vor? Wir werden uns gemeinsam mit den Kolleg:innen des steirischen Landesmuseums mit der besonderen Beziehung der beiden Bundesländer auseinandersetzen – speziell mit den Motiven, weshalb Menschen die Landesgrenze überquert haben bzw. über-
queren. Zeitgleich mit dem Start der Koralmbahn im Dezember 2025 planen wir ein großes Ausstellungsprojekt. Wir bemühen uns auch um eine Kooperation mit den ÖBB, weil es uns auch darum geht, die Inhalte, die wir generieren, zu den Menschen in die Züge zu bringen und dieser Zugfahrt einen Mehrwert zu geben. Das Großprojekt Koralmbahn benötigt nicht nur eine entsprechende Infrastruktur und wirtschaftliche Vernetzung, sondern auch einen kulturellen Überbau, um den Menschen zu signalisieren, dass wir eine gemeinsame, wichtige Region darstellen und dass es eine ganz besondere Beziehung zwischen unseren beiden Bundesländern gibt, die für mich ja ähnlich ist wie jene zwischen Tirol und Vorarlberg oder zwischen Salzburg und Oberösterreich. Es war schon immer ein gemeinsamer Kulturraum, der durch Gebirgslandschaften getrennt ist, die es immer irgendwie zu überwinden galt und gilt.
„Als kärnten.museum ist es uns wichtig, ein Ort des zivilgesellschaftlichen Diskurses zu sein, d. h. die brennenden Fragen der Gegenwart bei uns zu behandeln und auszuverhandeln.“
Wolfgang Muchitsch
Mobilität ist aus meiner Sicht kein menschliches Grundbedürfnis, sondern eine Notwendigkeit, um Grundbedürfnisse zu stillen. Wenn diese nicht mehr an einem Ort erfüllt werden können, wie es in der Historie oft der Fall gewesen ist, dann brauche ich auf einmal die Mobilität. Diese Tunnelstrecke ist natürlich für das Land Kärnten auch ein Jahrhundertereignis. Da braucht es auch ein gewisses kulturelles Umfeld, abgesehen von einem Festakt. Viele Kärntner:innen sind in der Steiermark und umgekehrt: Nun ist es wichtig, die Chancen zu erkennen und Synergien zu suchen. |



38.000 Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen 190.000 Arbeitsplätze! ›tagderarbeitgeber.at



Mit der Gründung der PMS Alternative Energie Systeme GmbH werden ab sofort auch kundenorientierte Lösungen im Bereich der alternativen Energiesysteme geboten.
Die Experten der PMS Alternative Energie Systeme GmbH (PMS AES) unterstützen und beraten Kunden bei der Planung und Entwicklung neuer Heizungsanlagen, informieren über neueste Technologien, optimieren bestehende Anlagen und entwickeln bei Bedarf auch Digitalisierungsstrategien. Bestens qualifizierte Mitarbeiter:innen, Flexibilität und ein rund um die Uhr erreichbarer Kundenservice sowie rasches
„Durch die geballte Kompetenz der gesamten PMS Gruppe mit mehr als 600 Mitarbeiter:innen österreichweit sind wir der kompetente Partner für Komplettlösungen im Bereich Industrieelektrik, Automatisierung, Ventiltechnik, Digitalisierung und nun auch alternativer Energiesysteme.“
Franz Grünwald, Geschäftsführer PMS-Gruppe


Die Lavanttaler Unternehmensgruppe
PMS besteht aus:
- PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH
- PMS Competence Center Schaltanlagen GmbH
- PMS valveTec GmbH
- PMS Digital Solutions GmbH
- PMS Technikum Lavanttal GmbH
- PSI Powerful Solutions International GmbH
- PMS Alternative Energiesysteme GmbH
und effizientes Ersatzteilmanagement zeichnen das Unternehmen aus.
Profundes Knowhow
Als Geschäftsführer der PMS AES fungiert Kurt Schmerlaib, der auf jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken kann. Unterstützt wird er in der Geschäftsführung von Sohn Marco Schmerlaib und Prokurist Stefan Zoder. „Unser Ansatz umfasst eine gründliche Analyse der Prozessabläufe vor Ort, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Dabei legen wir großen Wert auf die Erhaltung der Substanz der Anlage. Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, die Effizienz der Anlagen zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren, um unseren Kunden einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, individuelle Lösungen für jeden Kunden zu entwickeln“, gibt Kurt Schmerlaib Einblick in die Firmenphilosophie.
Von der Heizung zum alternativen Energiezentrum
Der neue Geschäftsbereich erweitert das umfangreiche Portfolio der PMS Gruppe und bietet bestehenden und neuen Kunden den großen Vorteil, durch „crossselling“ maßgeschneiderte und erfolgreiche Lösungen „aus einer Hand“ zu bekommen. „Die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig. Durch unsere Niederlassungen in Wien/Schwadorf, Linz, Kapfenberg, Kundl, Villach und unser Headquarter in St. Stefan im Lavanttal und der geballten Kompetenz der gesamten PMS Gruppe mit mehr als 600 Mitarbeiter:innen österreichweit sind wir der kompetente Partner für Komplettlösungen im Bereich Industrieelektrik, Automatisierung, Ventiltechnik Digitalisierung und nun auch alternativer Energiesysteme“, freut sich Franz Grünwald als Eigentümer und Geschäftsführer über den Ausbau und die Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe. |
„Unser Ziel ist es, individuelle Lösungen für jeden Kunden zu entwickeln.“
Kurt Schmerlaib, Geschäftsführer PMS AES
KONTAKT
PMS Gruppe
PMS-Straße 1
9431 St. Stefan im Lavanttal T: +43 50 7670 office @ pms.at www.pms.at
Payer, Johann Pluy, Andreas Matthä, LH Peter Kaiser, LR Sebastian Schuschnig, Andreas Pichler (v. l.). © LPD Kärnten / Gleiss
Land Kärnten und ÖBB wollen den Standort gemeinsam weiterentwickeln und Betriebsansiedelungen forcieren.
Nicht zuletzt aufgrund der Koralmbahn rückt der Logistikstandort Kärnten noch stärker in den Fokus. Zentrale Anlaufstelle ist das Logistik Center Austria Süd (LCAS) mit dem neuen Geschäftsführer Andreas Pichler. Die LCAS-Eigentümer Land Kärnten, ÖBB-Infrastruktur AG, Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft (BABEG) unterzeichneten Ende Feber ein Memorandum of Understanding, um die Zusammenarbeit zu verstärken. Der ÖBB-Rahmenplan 2024-2029 sieht für den Standort Villach-Fürnitz insgesamt 72,8 Mio. Euro vom Bund vor.
„Kärnten ist spätestens mit der Koralmbahn im wirtschaftlichen Herzen Europas und immer mehr Warenströme werden sich auf die Schiene verlagern.“ Sebastian Schuschnig, Mobilitätslandesrat Kärnten
Von der Straße auf die Schiene „Kärnten rückt immer mehr in die Mitte Europas. Das wollen wir international noch sichtbarer machen,“ betont Landeshauptmann Peter Kaiser. Wesentlich dabei

ist es, die entsprechende Infrastruktur weiter auszubauen und noch mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Vorantreiben will man aber auch die Vermarktung des Standortes und die Bearbeitung der Grundstücke in VillachFürnitz, um für bahnaffine Investoren noch attraktiver zu werden.
Klares Bekenntnis für Standort
„Kärnten ist spätestens mit der Koralmbahn im wirtschaftlichen Herzen Europas und immer mehr Warenströme werden sich auf die Schiene verlagern. Kärnten kann sich hier als wichtigste Drehscheibe positionieren“, betont auch Kärntens Mobilitätslanderat Sebastian Schuschnig. Erstmals kam es zu einer Einigung auf Investitionen und den Ausbau, noch heuer wird der Planungsstart erfolgen – ein klares Bekenntnis zum Standort und ein wichtiges Signal an Investoren und für Betriebsansiedelungen. Dabei soll das LCAS als „one-stop-shop“ für Unternehmen fungieren, die sich hier ansiedeln wollen. Konkret soll es künftig alle Grundstücke vor Ort zentral anbieten können. „Damit kann die LCAS endlich professionell gegenüber Investoren auftreten“, so Schuschnig. Zudem soll ein Standortkonzept entwickelt werden und bei Investitionen will man so viele EU-Förderungen wie möglich ansprechen.
Für ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas
Matthä liegt der 300.000 Quadratmeter große Standort Villach-Fürnitz exzellent und wird insbesondere durch die Koralmbahn und in weiterer Folge durch die Anbindung an den Semmeringbasistunnel gestärkt. Dem Land Kärnten dankt Matthä auch für die Einzelwagenförderung: „Sie ist ein wertvoller Trigger für die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene.“
AREA Süd im Fokus
Auch Kärntens Wirtschaftskammerpräsident bezeichnet den Abschluss der Absichtserklärung zwischen dem Land Kärnten und den ÖBB als gute Nachricht für Fürnitz, für den Logistikstandort Kärnten und die AREA Süd. Der seit Jahren besprochene, aber immer wieder verzögerte Ausbau der bestehenden Anlagen könnte damit nun Wirklichkeit werden, hofft Jürgen Mandl. Damit sind endlich die Voraussetzungen gegeben, mittelfristig eine Drehscheibenfunktion für den Schienengüterverkehr im Alpen-AdriaRaum mit besonderem Augenmerk auf den bislang mit Anlaufschwierigkeiten kämpfenden Zollkorridor zum Hafen Triest einzunehmen. Entscheidend sind auch die nunmehr eröffneten Fördermöglichkeiten durch die EU, die sich unter anderem aus der Aufnahme von VillachFürnitz in das Kernnetz des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) ergeben. |
von Hans Lach
Bücher aus dem 19. Jahrhundert stehen unter Arsenverdacht. Plötzlich ist man um die Gesundheit der Menschen besorgt. Sollte mit diesem Angstporno möglicherweise altes Wissen nicht mehr zugänglich gemacht werden?
Wer nichts weiß, muss alles glauben. Bücher sind und waren stets verlässliche Wissensvermittler. Allerdings verliert zunehmend das Bücher-Wissen die Materialität in Form der Digitalisierung. Damit haben die Bibliotheken nicht mehr die Funktion als kompetenter Wissensort.
Wissen, einmal in Buchform gespeichert, bleibt in seiner Ursprünglichkeit. Digitale Texte können jederzeit „adaptiert“ und dem Zeitgeist angepasst werden. Dadurch ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Ein gutes Beispiel dafür ist „Lügipedia“. Diese fiktionale „Bibliothek“ ist kostenfrei. Warum eigentlich? Wer hat ein Interesse an kostenloser „Wissensvermittlung“?
Wenn in den Massenmedien plötzlich Berichte über Bücher auftauchen, die mit „Gift“ kontaminiert sein sollten, dann ist das ein Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Der Staat bzw. staatliche Institutionen machen sich Sorgen um unsere Gesundheit beim Umgang mit Büchern? Eigenartig.
Der ORF berichtete z. B. am 1. März 2024 unter der Überschrift Arsen in Büchern – Bibliotheken alarmiert: „Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) erlässt einen vorübergehenden Ausgabestopp für einige Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge soll in einigen grünen Farbpigmenten Arsen enthalten sein. Auch weitere Wiener Bibliotheken sind alarmiert.“
Ebenso Bibliotheken in der BRD. Betroffen seien Bücher mit grünen Einbänden oder Vorsatzblättern. Gefährlich könne das Einatmen von Staub aus den betroffenen Büchern sein. Auch über die Finger, mit der Zunge zum Umblättern der Seiten angefeuchtet, könne Arsenstaub aufgenommen werden. Schuld sei das Pigment namens „Schweinfurtergrün“.
Wenn man weiß, dass die Vernichtung von Wissen im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Menschheit
ein „normales“ Phänomen darstellt und sich durch die uns bekannte Geschichte zieht, dann könnte man zum Schluss kommen, dass es sich bei den „durch Arsen verseuchten Büchern“ um eine moderne Form der „Bücherverbrennung“ handeln könnte. Bestimmte Bücher können nicht mehr eingesehen werden. Sie werden wohl einige Zeit in Kisten gelagert und schließlich entsorgt. Der Menschheit geht unwiederbringlich Wissen verloren.
Während in unserer heutigen Zeit Arsen die Schuld zugewiesen wird, um Bücher aus dem Verkehr ziehen zu können, waren es einst moralische, politische oder religiöse Gründe. Bücherverbrennungsaktionen waren „staatlich“ inszeniert und von der Obrigkeit geduldet.
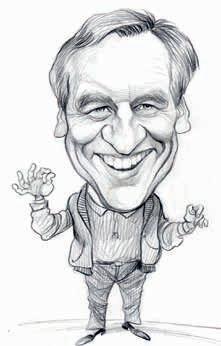
Vernichtung von Wissen ist ein Phänomen, das die Menschheitsgeschichte – so weit ein Überblick möglich ist – begleitet. Bereits in der Antike gab es Verbrennungen. Die Bibliothek von Alexandria, um die sich zahlreiche Mythen ranken, soll die bedeutendste Bibliothek in der Antike (Anfang 3. Jhdt. v. Chr.) gewesen sein. Ein spektakulärer Großbrand soll (um 30 v. Chr.) diesen Wissensspeicher vernichtet haben. Die Epochen des 17. und 18. Jahrhunderts, in welchen Bücher bewusst zerstört wurden, stechen hier besonders hervor. Die römisch-katholische Kirche führte seit dem vierten Jahrhundert Bücherverbrennungen durch. Die Inquisition bildete dabei den Höhepunkt. Gut dokumentiert sind die Bücherverbrennungen 1933 im nationalsozialistischen Deutschland.
Wissen ist Macht und wird bei jenen Menschen angewendet, die nichts wissen (wollen). |
ZUR
HANS
Autor und Verleger office@alpenadria-verlag.at
von Heinz E. Pfeifer, Obmann Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten


(oben) Heinz E. Pfeifer, Obmann Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten. (links) PC-Bildschirm, wie er bei einem sehbehinderten Nutzer aussieht. © BSVK
Mit 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) in Kraft. Doch was bedeutet das für Sie als Unternehmen oder Auftraggeber?
Produkte und Dienstleistungen, die unter das Gesetz fallen, sind zukünftig „barrierefrei“ anzubieten. Diese müssen auch für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sein. Hauptsächlich betrifft es Produkte und Dienstleistungen, die allen Menschen eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Im Wesentlichen betrifft das den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Regelungen betreffen Hard- wie auch Software. In Kärnten sind die Unternehmen im Hardwarebereich überschaubar. Ganz anders sieht es bei Information und Kommunikation aus. Zukünftig müssen Informationen, Buchungsplattformen oder Online-Shops uneingeschränkt nutzbar sein. Zwar gibt es eine Übergangsfrist bis 28. Juni 2030, diese gilt aber nur für Angebote, die vor dem Start des BaFG erstellt wurden.
Die Einhaltung des Gesetzes wird vom Sozialministerium überprüft und es drohen Strafen bis zu 80.000 Euro.
Was sollten Sie tun?
Stellen Sie sicher, dass Ihre Websites, Online-Formulare, Webshops, etc. WCAGkonform sind. WCAG ist der Standard, an dem die Voraussetzungen für Barrierefreiheit gemessen werden. Schnelle Softwarelösungen, wie sie aktuell angeboten werden, erfüllen diesen Standard nicht. Wir empfehlen eine unabhängige Projektbegleitung und -überprüfung. Dies erfolgt durch eine WACA-Zertifizierung (www.waca.at) oder einen zertifizierten Experten, einen sogenannten Web-Accessibility-Expert. Als Interessensvertretung der Menschen mit Seheinschränkungen in Kärnten stehen wir gerne unterstützend zur Seite.
Für viele Kärntner:innen mit Behinderung ist die digitale Welt Chance und
Fluch zugleich. Eine Chance, um selbstständig am sozialen Leben teilnehmen zu können und Fluch, wenn durch Barrieren dieser Weg verstellt ist und man damit ausgegrenzt wird.
Zu einer nachhaltigen Gesellschaft gehört ein Miteinander und Chancengleichheit für alle. Zehn Prozent von uns sind auf Barrierefreiheit angewiesen. 60 Prozent profitieren davon und 100 Prozent gewinnen mit einer Gesellschaft, die niemanden zurücklässt! |
WEITERE INFORMATIONEN www.bsvk.at
Keine Kritik ist auch ein Lob! Diese Art der Führung, wie sie seit den Anfängen der 2000-ern gelebt wurde, ist lange überholt. Neue Zeiten bedürfen neuer Wege in der Führung.
Der Arbeitsklima Index in Österreich attestiert schwarz auf weiß die seit Jahren sinkende Zufriedenheit am Arbeitsplatz von Mitarbeiter:innen. Wenn es zu einer Kündigung kommt, verlassen viele nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. In einer Zeit, wo soziale Interaktion – ein menschliches Grundbedürfnis – aufgrund der immer digitaleren Lebensweise kürzer denn je kommt, ist es umso wichtiger als Arbeitgeber eine wertschätzende zwischenmenschliche Basis im Geschäftsumfeld zu schaffen.
Wert schaffen als Führungskraft
Warum ist Wertschätzung in einem Umfeld, das Leistung gegen Leistung tauscht so wichtig? Weil wir Menschen nach wie vor keine Maschinen sind. Hinter den Handlungen der Menschen versteckt sich der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung. Und hier ist der Punkt, an dem du als Führungskraft Wert für dein Umfeld schaffen kannst. Um es mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe zu sagen: „Willst du dich deines Wertes freuen, so musst der Welt du Wert verleihen“. Interpretiert man das Zitat aus der Perspektive des Leaderships, könnte man sagen: Bringe deinen Mitarbeiter:innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen Wertschätzung entgegen und du erhältst dafür die Früchte deines Werts, die du dir wünscht: Motivation, Engagement, erhöhte Mitarbeiterbindung, verbessertes Arbeitsklima, höhere Produktivität, mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Mitarbeiterfindung und -bindung in einer Welt des Fachkräftemangels sind heute
die Schlüsselfragen aller Unternehmen. Ein Türöffner dafür ist wertschätzende Führung.
Führung mit Herz und Verstand Und genau hier sehe ich den Wert und das Potenzial unseres FE&MALE LEADERSHIP SUMMIT. Meine Vision ist es nämlich Menschen zum Wachsen zu bringen. Wachstum in einem Unternehmen beginnt mit dem Wachstum der Führungskraft, die ihre Wertschätzung und ihr Werteempfinden an alle Teammitglieder weitergeben kann. Das diesjährige Thema unseres bereits zum zweiten Mal stattfindenden Summits am 9. Oktober 2024 lautet „Führung mit Herz und Verstand“. Ein Thema, mit dem wir gemeinsam mit allen Teilnehmer:innen Leadership revolutionieren wollen, eine Community des Führungskräftewachstums aufbauen und Menschen das Bewusstsein des Führens näherbringen möchten.
Leadership der Zukunft
Ein Statement als Führungskraft setzt du heute nicht mehr nur mit deinem Knowhow, sondern du beeindruckst z. B. die Generation Z – die Mindful Generation, junge Menschen die mit Meditation, Nachhaltigkeit, grenzenlosen Informationsquellen und dem Wunsch nach universeller Freiheit aufgewachsen sind – mit Wertschätzung.
Beim FE&MALE LEADERSHIP SUMMIT setzen wir daher bei euch –den Führungskräften – an und geben Werkzeuge für das nächste LeadershipLevel mit. Wie Herz und Verstand zusammenarbeiten können, wie du aufmerksam

„Wachstum in einem Unternehmen beginnt mit dem Wachstum der Führungskraft, die ihre Wertschätzung und ihr Werteempfinden an alle Teammitglieder weitergeben kann.“
Gabriele Stenitzer
mit offenen Augen deine Führung und damit dein Unternehmen revolutionierst und neue Wege des Erfolgs öffnest. Wie Frauen in die selbstbewusste und Männer in die bewusste Führung kommen. Denn wenn Führungskräfte wachsen, wachsen auch die Menschen in ihrem Umfeld. Und ich möchte mit meiner Arbeit Menschen zum Wachsen bringen. Das ist Leadership der Zukunft. |
Die ersten 3 Tipps für wertschätzende Führung, die ich schon heute teilen möchte, sind:
❶ Baue positive Arbeitsbeziehungen auf, indem du offenen Meinungsaustausch förderst.
❷ Begeistere als Führungskraft. Das baut Motivation und persönliche Bindung auf.
❸ Starte bei dir: Sei du die Veränderung, die du mit deiner Führung erreichen möchtest. Das Leben ist wie ein Spiegel.
WEITERE INFORMATIONEN
www.femlead-summit.at


Als Premium-Integrator für digitale Außenwerbeflächen bringt sich Wallerie nun in Stellung. © Wallerie
Unter der Leitung von CEO Sebastian Lanner fokussiert sich Wallerie ab sofort auf die Planung, Installation und den Support hochwertiger LED Walls und Screens für den Outdoor Bereich.
Wallerie ist Premium-Integrator für Outdoor LED Wände und Stelen sowie Screens im Schaufenster- und IndoorBereich. Das Familienunternehmen ist jüngster „Spross“ der LANNER Media GmbH, die mit monitorwerbung und Wallerie zwei innovative Marken in der Welt der Digital Signage Systeme unter einem Dach vereint.

n stark frequentierten Standorten, an Fassaden, auf Dächern, im Schaufenster oder in Fußgängerzonen: großflächige Videowände und Stelen schaffen Aufmerksamkeit. Als Premium-Integrator für digitale Außenwerbeflächen bringt sich Wallerie in diesem Nischenmarkt nun in Stellung. Ihr Background: Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Aufbau und Betrieb von hunderten Digital Signage Systemen in Österreich, Deutschland und Italien.
Hochwertige Lösungen
„Wer eine LED Wall oder ein anderes Outdoor Digital Signage System kaufen will, tut sich aktuell schwer, sich einen Überblick über die Preise und Möglichkeiten zu verschaffen. Wir ändern das nun, indem wir einen Online-Zugang zu hochwertigen, standardisierten Lösungen bieten“, sagt
CEO Sebastian Lanner. Gleichzeitig steht das Team Interessenten mit umfassender Beratung zur Seite.
100%ig wetterfest
„Die hochauflösenden Infoscreens sind das Ergebnis jahrelanger Innovation und technischer Expertise. In unserem Team finden sich vom Schlosser, Mechatroniker, Software-Entwickler, Projektmanager bis zum Client Support Spezialist sämtliche Fachleute, die wissen, worauf es bei langlebigen Videowalls ankommt. Speziell im Outdoor Bereich werden diese von oft rauen Umweltbedingungen auf die Probe gestellt. Trotzdem müssen sie gestochen scharfe Bilder liefern“, betont Lanner. Um das zu garantieren, setzt das familiengeführte Unternehmen Wallerie neben der Bandbreite an eigenem Know-how auf regionale Entwickler und Zulieferbetriebe.

Gebündeltes Know-how
„Außerdem sehen wir uns bei jedem Projekt langfristig in der Verantwortung. Das beginnt bei der Standortanalyse, geht über die Unterstützung beim Genehmigungsverfahren und reicht bis zum Support inkl. laufendem Monitoring, Fernwartung oder raschem On-Site-Support“, so Lanner. Auch die intuitive Software zur Bespielung der digitalen Werbetafeln wurde in Österreich entwickelt. Das Design stammt von Red Dot Award Gewinnerin Michaela Unterweger und der Designagentur AberJung.
Erfolgreiche Projekte
Für monitorwerbung beispielsweise hat Wallerie zuletzt eines der modernsten DOOH Werbenetze in Österreich aufgebaut und 20 großformatige LED Walls in ganz Kärnten installiert. „Für das Unter-
nehmen Wilhelmer Sport & Mode in Vandans in Vorarlberg haben wir eine 3D-Eck-LED Wall im Schaufenster umgesetzt. Mit einer Screenfläche von 12 m2 erzeugt sie räumliche Tiefe und spezielle visuelle Effekte, die echte Eyecatcher sind“, erzählt Lanner, der Projekte in ganz Österreich, Südtirol und Deutschland realisiert. Weitere Vorteile einer eigenen digitalen Werbetafel: Sie schafft 365 Tage im Jahr ungeteilte Aufmerksamkeit, kann einfach und individuell bespielt werden, ist ein sichtbares Zeichen für die Modernität eines Unternehmens und gilt als eines der umweltfreundlichsten Werbemedien.
Programmatische Anbindung
Übrigens: Wer seine Werbebildschirme auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen will, profitiert vom VermarktungsKnow-how des Familienunternehmens
Wallerie. „Auf Wunsch übernehmen wir die programmatische Anbindung oder sind für innovative Beteiligungen an attraktiven Standorten offen, sodass DOOHWerbeflächen entweder günstiger erworben werden können, für Refinanzierung sorgen oder im besten Fall ein Geschäftsmodell für unsere Kunden sind“, so Lanner. |
KONTAKT
Wallerie
Hauptstraße 42 9620 Hermagor T: +43 4282 29777 info@wallerie.at www.wallerie.at
EXPERTENTIPP
Änderungen im GmbH-Recht: Senkung des Mindeststammkapitals bei der GmbH und FlexKap als neue Gesellschaftsform seit 1. Jänner 2024.

Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) haften die Gesellschafter für Gesellschaftsschulden nur mit ihrer Einlage und nicht persönlich mit ihrem Privatvermögen. Dies steht im Gegensatz zum Einzelunternehmer und den Gesellschaftern der Personengesellschaften, die grundsätzlich persönlich mit ihrem Privatvermögen für die Schulden haften. Quasi als Rechtfertigung für diese beschränkte Haftung ist bei der Gründung einer GmbH von den Gesellschaftern eine Einlage zu leisten, deren Summe das Stammkapital bildet. Das Mindeststammkapital wurde mit 1. Jänner 2024 auf € 10.000,– gesenkt. Von diesen € 10.000,– sind zumindest € 5.000,–bei der Gründung auf das Treuhandkonto des die Gründung beurkundenden Notars oder auf ein zu eröffnendes Konto der Gesellschaft zu zahlen. Alternativ oder zusätzlich können auch ein bestehendes Unternehmen oder sonstige Sacheinlagen
(z. B. Maschinen, Büroeinrichtung, Fahrzeuge) eingebracht werden. Für den noch offenen Einzahlungsbetrag haften alle Gesellschafter solidarisch.
Die geleistete Einlage darf den Gesellschaftern nicht wieder zurückbezahlt werden. Diese haben grundsätzlich nur Anspruch auf den im Jahresabschluss festgestellten Bilanzgewinn.
Das eingezahlte Stammkapital dient als Startkapital über das die Geschäftsführung verfügen kann und die Ausgaben zahlen kann. Die Gründer sollten sich daher überlegen, ob die Gründung mit dem Mindeststammkapital im Hinblick auf den weiteren Geschäftsgang ausreichend ist, oder nicht ein höheres Stammkapital erforderlich ist, denn die Höhe des Stammkapitals, die im Firmenbuch öffentlich einsehbar ist, hat naturgemäß Einfluss auf die Bonität und die Außenwirkung gegenüber Geschäftspartnern und Kunden. Auch sollte bedacht werden, dass die Geschäftsführer im Fall der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit verpflichtet sind, den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen und bei verschuldeter zu später Antragstellung für die Schäden persönlich haften, die den Gläubigern dadurch entstehen. Auch haftet die Geschäftsführung persönlich für die schuldhafte Nichtzahlung von Abgaben an das Finanzamt und die schuldhafte Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.
Seit Jahresbeginn erfolgt seitens des Firmenbuchgerichtes eine Überprüfung, ob die bestellten Geschäftsführer wegen ge-
wisser Wirtschaftsdelikte (z. B. Betrug, betrügerische Krida, organisierte Schwarzarbeit, Abgabenbetrug, Geldwäsche) nach dem Beginn des heurigen Jahres verurteilt wurden. Trifft dies zu, gilt der betreffende Geschäftsführer als disqualifiziert und wird die Gesellschaft vom Firmenbuchgericht aufgefordert einen anderen Geschäftsführer zu bestellen und den disqualifizierten Geschäftsführer abzuberufen.
Dies galt bisher in ganz ähnlicher Form nur für gewerberechtliche Geschäftsführer, die ebenfalls von der Gewerbebehörde auf eine Verurteilung überprüft werden und von der Ausübung des Gewerbes ausgeschlossen werden können.
Neu: Die Flexible Kapitalgesellschaft Neben der GmbH gibt es seit Jahresbeginn die Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKap oder FlexCo), die es unter anderem ermöglicht sogenannte UnternehmenswertAnteile ohne Stimmrecht an Investoren oder Mitarbeiter auszugeben. Dies macht diese Gesellschaftsform vor allem für die Gewinnung von Investoren interessant, da mit diesen Anteilen keine Haftung für offene Einlageverpflichtungen verbunden ist. |
KONTAKT
Die Kärntner Notar:innen stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: www.ihr-notariat.at
Notariatskammer für Kärnten: 0463/51 27 97
Die BKS Bank gründet die „Du & Wir“-Stiftung unter dem Dach der Caritas Stiftung Österreich. Zustiftungen sind schon ab 5.000,- EUR möglich.
„Die Stiftung unterstützt nachhaltig und langfristig sozial wertvolle Projekte in Österreich mit besonderer Berücksichtigung von Menschen in Not und Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf“, so Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Mit einem Stiftungskapital der BKS Bank von 500.000,- Euro hat die BKS Bank den Grundstein gelegt, um langfristig Renditen für soziale Zwecke zu erwirtschaften. Wobei die Bank mit ihrem Engagement auch auf ihre Kunden setzt. Stockbauer:
Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer lädt
Privatpersonen und Unternehmen herzlich dazu ein, als Zustifter zu agieren. © Gernot Gleiss
„Wir laden diese herzlich dazu ein, als Zustifter zu agieren, was bereits ab 5.000 Euro möglich ist.“
Vorteile einer Zustiftung Zustiftungen erzielen im Vergleich zu Spenden eine langfristige Wirkung, haben einen viel größeren individuellen Gestaltungsspielraum und sind über die Spendenabsetzbarkeit hinaus steuerlich absetzbar. Die Steuerabsetzbarkeit kann gemäß EStG § 4a und § 4b unabhängig voneinander ausgenutzt werden (in Kombination bis zu maximal 20 % des Jahresgewinns). Zustifter können nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen sein, die

durch diese Form der Investition nicht nur sozial wirken, sondern auch ihre ESGWerte nach außen tragen. „Mit der „Du & Wir-Stiftung“ eröffnen sich für Privatpersonen und für Unternehmen neue Möglichkeiten, einen wertvollen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Fragen zu leisten und gleichzeitig ihre Steuerlast zu reduzieren“, so Stockbauer.
Du & Wir-Konto
Zusätzlich wurde von der BKS Bank mit dem „Du & Wir“-Konto ein nachhaltiges Konto auf den Markt gebracht, das laufend einen Beitrag zur Stiftung leistet. Pro Kontoeröffnung fließen automatisch 12,Euro an die Stiftung. Die Kontoführung bleibt trotzdem günstig, da die BKS Bank auf einen Teil des Kontoführungsentgelts verzichtet. „Wir freuen uns sehr, mit dem ,Du & Wir-Konto‘ unser nachhaltiges Produktangebot gezielt erweitert zu haben. Neben dem erfolgreichen ,Natur & Zukunft-Konto‘, das die Aufforstung heimischer Schutzwälder unterstützt, decken wir mit dem ,Du & Wir-Konto‘ zahlreiche soziale Aspekte ab“, so Stockbauer. |
BKS Bank
St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt am Wörthersee 0463/5858-0 bks@bks.at www.bks.at
gesammelt von Isabella Schöndorfer

Klagenfurts kreative Blüten
Tamara Eichner erweckt Klagenfurts Innenstadt zum Leben: Im neuen Flower Studio verzaubert sie mit einzigartigen, handgefertigten Trockenblumen-Kreationen. Ihre Leidenschaft für Design und Natur blüht auf 70 Quadratmetern in der Paradeisergasse 3 auf, wo sie neben ihren floralen Kunstwerken auch handgemachte Unikate anderer Kärntner Künstler:innen präsentiert. Mit Mut und Engagement setzt sie ein Zeichen gegen Leerstand und für eine lebendige Stadt voller Möglichkeiten und Inspiration. © www.flowerstudio.at

Ein Fest der Inklusion und Musik
Die MONEL GmbH feierte ihr fünfjähriges Bestehen mit einer mitreißenden Benefizveranstaltung im Kulturhaus Seeboden. Über 600 Gäste, darunter prominente Persönlichkeiten, genossen ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Highlights und einer beeindruckenden Modeschau. Die Veranstaltung unterstrich das Engagement von MONEL für Inklusion und soziale Integration, ehrend auch die scheidende Behindertenanwältin Isabella Scheiflinger.
Highlight des Abends: Der erste Auftritt der talentierten Sängerin Elena mit Helmut Brunner von Meilenstein. © MONEL GmbH



2024 definiert Fotografie in Kärnten neu In diesem Jahr widmet sich Kärnten ganz der Fotografie. Unter dem Motto „Über das Land / o deželi“ startet am 14. Mai, um 17 Uhr im Raum für Fotografie sowie dem kärnten.museum ein Programm, das bis zum 31. Oktober die vielschichtigen Perspektiven der Fotokunst erkundet. Das Kurator:innen-Kollektiv section.a präsentiert Werke von 16 international tätigen Künstler:innen, die sich kritisch und kreativ mit dem Thema Land auseinandersetzen und zum Nachdenken über Landschaft, Lebensräume und gesellschaftliche Phänomene auffordern. Mit der Nutzung des Plakats als zentralem Medium macht das Jahr der Fotografie Kunst im öffentlichen Raum sichtbar und zugänglich, bricht mit konventionellen Narrativen und eröffnet neue Dialoge über unsere Umgebung und Identität. Ein vielfältiges Programm aus Workshops, Diskussionen und Ausstellungen in Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen lädt dazu ein, die künstlerische Fotografie als Medium des Ausdrucks und der Reflexion neu zu entdecken.
Eine eigene Website wird zur digitalen Homebase des Schwerpunktjahres und informiert über die einzelnen künstlerischen Beiträge, erlaubt eine Vertiefung der Thematik: www.ueberdasland.at
Mehr Infos unter www.radlobby.at/ kaernten/criticalmass. © radlobby.at

Ein Stück Italien für Zuhause
Sarah Wüster und Raphael Kohlweiss bringen italienischen Genuss nach Hause. Mit cavolobianco.com (zu Deutsch: Weißkohl) bieten sie exklusive italienische Spezialitäten, direkt von kleinen Familienbetrieben und Bauern aus Italien. Ihr Onlineshop steht für höchste Qualität und naturbelassene Delikatessen. Inspiriert vom Grazer Start-up Leben und regelmäßig auf heimischen Märkten präsent, garantieren sie echten italienischen Geschmack und verlässlichen Service bis zur Haustüre. So sind sie vom 27. bis 28. April 2024 auch wieder beim Kunst- und Designmarkt in der Seifenfabrik anzutreffen. © www.cavolobianco.com

Maximilian Missoni,
Head of Design Polestar und Thomas Hörmann, Managing Director Polestar Österreich.
© Polestar

Radparade für nachhaltigen Tourismus
Am 11. Mai 2024 verwandelt sich Reifnitz erneut in ein Paradies für Radbegeisterte. Die Critical Mass, ausgerichtet von der Radlobby Kärnten, präsentiert die erste Fahrradmesse des Bundeslandes, umrahmt von einer Sternfahrt aus Klagenfurt, Velden und Keutschach. Besucher:innen erwartet eine Mischung aus lokalen Fahrradhändlern, Fahrradstunts, LiveMusik und kinderfreundlichen Fahrradparcours. Das Event zielt darauf ab, nachhaltigen Tourismus zu fördern und Fahrradfahren als gesunde, umweltfreundliche Fortbewegungsart zu zelebrieren.

Historische Verbrechen im neuen Licht
In der Waagner-Biro-Straße 106a erstrahlt der neue Polestar Space Graz. Als Anlaufpunkt für Elektromobilität bietet dieser allen Interessierten Einblicke in die Welt der schwedischen Elektroautomarke. Besucher:innen genossen die Möglichkeit, die neuesten Modelle zu erleben. Im Rahmen der „My Smart City Graz“ setzt Polestar ein starkes Zeichen für nachhaltige Fortbewegung.
Die steirische Autorin Mirella Kuchling, bekannt für ihre Frauenzimmer-Trilogie, präsentiert mit „Mörderische Frauenzimmer –13 historische Kriminalgeschichten“ eine fesselnde Sammlung, die in die dunklen Abgründe weiblicher Kriminalität eintaucht. Die Geschichten entführen die Leser:innen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Kuchlings packende Erzählweise bringt die düsteren Seiten der Vergangenheit ans Licht und zeigt, wie diese Frauen gegen ihre widrigen Umstände rebellierten – oft mit tödlichem Ausgang. Erschienen in der edition keiper. www.mirella-kuchling.at
© Covergestaltung: Karin Kröpfl


INTERVIEW
mit Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten
Auch heuer ruft die Wirtschaftskammer
Kärnten den 30. April zum „Tag der Arbeitgeber“ aus.
WK-Präsident Mandl über die Institutionalisierung einer guten Idee, die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung der Unternehmer und die Hausaufgaben, die die Politik für ein unternehmensfreundlicheres Kärnten zu erledigen hat.
advantage: Die Wirtschaftskammer Kärnten ruft erneut den 30. April zum „Tag der Arbeitgeber“ aus. Welche Botschaft möchten Sie betonen?
Jürgen Mandl: In Kärnten gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihren Ideen und ihrer Tatkraft die Wirtschaft am Laufen halten. Sie schaffen Arbeitsplätze, Wohlstand und sichern unsere Sozialsysteme. Der Tag der Arbeitgeber soll die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass es ohne Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber keine Arbeit und keinen arbeitsfreien Tag gäbe. Die EinPersonen-Unternehmen spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle, denn sie haben ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen.
Welche Maßnahmen sind dieses Jahr geplant?
Auch die zwölfte Auflage vom „Tag der Arbeitgeber“ geht mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen einher. Eine möchte ich hervorstreichen: Am 25. April findet

der bereits vierte X-Trail Businessrun statt. Es gilt – ähnlich wie im Arbeitsalltag –Hürden im Team oder als Einzelkämpfer zu bewältigen.
Die Stimmung vieler Unternehmerinnen und Unternehmer ist schlecht, die Wirtschaftsdaten sind im Keller. Ist es wirklich so schlimm? Bei weitem nicht. Nüchtern betrachtet leben wir in der besten aller bisherigen Welten. Noch nie sind so wenige Kinder an Hunger gestorben, noch nie gab es so wenige Arme oder Opfer von Naturkatastrophen. Noch nie waren Bildung, Lebenserwartung und Wohlstand weltweit so hoch wie heute.
Arbeit wird neu definiert, Arbeit wird neu gelebt. Wie sehen Sie das? Für mich ist Arbeit als wichtiger Teil des
Lebens zu sehen, der nicht nur die Grundlage für eine eigenständige Existenz ist, sondern sehr oft auch Sinn und Selbstbestätigung gibt. Aber in Österreich diskutieren gewisse politische Kreise seit Monaten lieber über die 32-Stunden-Woche, natürlich bei vollem Lohnausgleich. Wir brauchen gezielte soziale Unterstützung und Anreize für diejenigen, die mehr leisten wollen.
Wer mehr arbeitet, hat aber nicht mehr im Börserl.
Das ist richtig. Wer von 20 auf 40 Wochenstunden aufstockt, arbeitet um 100 Prozent mehr – und bekommt dafür in Österreich nur 72 Prozent mehr Netto. Statt Leistungsanreize zu setzen, hält unser Steuersystem die Menschen vom Arbeiten ab. Das muss sich ändern, Leistung muss sich wieder lohnen. |
Ab dem Kalenderjahr 2024 treten in Österreich neue Regelungen zur Steuerbegünstigung von Arbeitnehmer:innen in Kraft.

Darunter enthalten sind unter anderem Erhöhungen der Überstundenzuschläge. Ziel dieser Maßnahme ist es, die belasteten Arbeitnehmer:innen, die aufgrund der angespannten Personalsituation vermehrt in Anspruch genommen werden, zu entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es gibt daher auch in Verbindung mit All-in Vereinbarungen die Möglichkeit, höhere steuerfreie Beträge zu berücksichtigen, jedoch gibt es dadurch auch neue Anforderungen in Bezug auf die Arbeitsaufzeichnungen.
Neue Regelung im Überblick
Eine bedeutende Änderung betrifft den monatlichen Freibetrag für Überstundenzuschläge. Bislang waren höchstens zehn Überstunden mit einem 50-prozentigen Zuschlag steuerfrei, wobei der Höchstbetrag hierfür bei 86 Euro lag. Ab 2024 wird dieser Freibetrag dauerhaft auf 120 Euro angehoben. Darüber hinaus wurde eine zeitlich begrenzte Regelung für die Jahre 2024 und 2025 eingeführt, welche eine weitere steuerliche Begünstigung vorsieht.
Für diese beiden Jahre können Arbeitgeber:innen zusätzlich zu den zehn steuerfreien Überstunden weitere acht Überstunden mit einem Höchstbetrag von insgesamt 200 Euro begünstigt entlohnen. Für diese Änderung ist vorerst keine Verlängerung geplant, stattdessen soll ab 2026 die Entlastung durch eine Änderung der Progressionsstaffel abgegolten werden.
Was bedeutet diese Änderung konkret für All-in Vereinbarungen?
All-in Vereinbarungen sind ein bedeutendes Element der Lohnabrechnung. Sie regeln die Vergütung von zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden über die reguläre Arbeitszeit hinaus und dienen vor allem dazu, die Flexibilität am Arbeitsplatz zu erhöhen. Mit ihrem Abschluss werden sämtliche Überstunden durch eine überkollektivvertragliche monatliche Entlohnung abgedeckt, wobei die Überstundenpauschale als separater Bestandteil der Vergütung erscheint.
Für die Berücksichtigung steuerfreier Zuschläge sind in der Regel keine separaten Aufzeichnungen erforderlich, sofern bereits in früheren Lohnabrechnungsperioden Überstunden in ähnlichem oder höherem Umfang geleistet und vergütet wurden. Die erhöhte Freibetragsgrenze kann demnach ohne zusätzliche Aufzeichnungen ausgeschöpft werden, wenn die zuvor geleisteten Überstunden den Freibetrag übersteigen. Um die Steuerfreiheit der Überstundenzuschläge bei Überstundenpauschalen zu gewährleisten, muss im Jahresdurchschnitt die entsprechende Anzahl der Überstunden im erforder-
lichen Ausmaß (120 Überstunden; für 2024 und 2025: 216 Überstunden) geleistet und nachgewiesen werden. Bei Dienstbeginn oder erstmaliger Ableistung von Überstunden sind jedoch über einen Zeitraum von sechs Monaten Aufzeichnungen zu führen.
Obwohl Führungskräfte und andere Arbeitnehmer:innen, die über erhebliche Entscheidungsbefugnis verfügen, von der Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit gemäß dem Arbeitszeitgesetz befreit sind, müssen sie dennoch mindestens sechs Monate lang die geleisteten Überstunden für die Anerkennung der Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen dokumentieren. Angesichts der erhöhten Anzahl steuerfrei auszahlbarer Überstundenzuschläge im Jahr 2024 ist es erneut erforderlich, für mindestens sechs Monate Aufzeichnungen zu führen. Wenn kein Nachweis erbracht werden kann, besteht das Risiko einer Nachverrechnung im Rahmen einer GPLB (Gemeinsamen Prüfung Lohnabgaben und Beiträge). Falls es beabsichtigt ist, die steuerfreien Zuschläge bei der Auszahlung von All-in Gehältern zu berücksichtigen, wird daher empfohlen, für einen Zeitraum von sechs Monaten eine genaue Aufzeichnung über die tatsächlich geleisteten Überstunden zu führen. |
KONTAKT
Mag. Michael Singer
Aicher & Partner Steuerberater OG Tel. 04212/2211 office@aicher.biz


„Wir
Im Rahmen der Gesellschaftspolitischen Gespräche widmeten sich die Entscheidungsträger von morgen dem Thema „WORK-LIFE-BALANCE vs. LIFE-WORK-BALANCE“.
Mit der Generation Z treten junge Menschen in die Arbeitswelt ein, die vielfach andere Werte und Erwartungen mitbringen als ihre Vorgänger. Weniger arbeiten avanciert für viele immer mehr zum Trend. Welche Auswirkungen das auf unseren Sozialstaat und den Wirtschaftsstandort hat und wie der Ausgleich zwischen Arbeit und Leben gelingen kann, darüber diskutierten die „jungen“ Kärntner Sozialpartner im dritten Teil der Gesellschaftspolitischen Gespräche in der Wirtschaftskammer Kärnten. Durch einen spannenden Schlagabtausch rund um das Thema „Work-Life-Balance vs. Life-Work-Balance“ führte Petra Plimon, Chefredakteurin des advantage-Magazins.
Rahmenbedingungen schaffen
Für Christoph Frierss, Vize-Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Kärnten,ist klar: „Es gibt keinen Wohlstand, wenn wir nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und der Sozialstaat Österreich kann auch in Zukunft nur durch Arbeit und Einkommen aufrechterhalten werden. Die immer
wieder geforderte Arbeitszeitverkürzung würde Kärnten gegenüber ausländischen Mitbewerbern weiter ins Hintertreffen bringen.“ Mathias Paul Podhajsky, Vorstandsmitglied der Jungen Industrie Kärnten, verwies auf die notwendigen Hausaufgaben, um die regionale Stärke des Bundeslandes Kärnten zu erhalten: „Politik und Unternehmen müssen für jene Rahmenbedingungen sorgen, innerhalb welcher Menschen sinnstiftend, flexibel und mit Commitment sich lohnende Leistungen erbringen können. Dadurch gelingt ein individuelles, von Lebensphasen abhängiges Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit sowie eine Stärkung des Industriestandortes.“
Arbeit und Leistung attraktivieren
Mario Pichler, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend in Kärnten und Vertreter der AK Young Kärnten, ging insbesondere auf die Perspektive der jungen Arbeitnehmer:innen ein und wies darauf hin, dass die zwischen 1997 und 2012 Geborenen grundsätzlich sehr moti-
viert seien und ihre Work-Life-Balance auch oft mit Bildung und dem Aufbau einer Existenz verbringen würden. Laut Pichler müsse Arbeit zudem Spaß machen. Denn: „Geht man gerne zur Arbeit, stellt das Thema Zeit kein Problem bzw. keine Diskussion mehr dar.“ Felix Götzhaber, Landesobmann der Kärntner Landjugend, unterstrich vor allem das ehrenamtliche Engagement der jüngeren Generation, denn auch das sei harte Arbeit. „Österreich lebt nicht nur von der Wirtschaft, sondern ist auch zum großen Teil von ehrenamtlichen Tätigkeiten abhängig – seien es die Blaulichtorganisationen oder der Pflegebereich. Das Ehrenamt boomt mehr denn je zu vor.“
Letztlich waren sich die „jungen“ Kärntner Sozialpartner einig: Die vielfach geforderte 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist keine Lösung im Sinne des Sozialstaates. Ganz im Gegenteil: Der Leistungsbegriff müsse neu definiert werden. Denn wer mit Freude bei der Sache ist, für den ist Leistung kein Unwort (mehr). |
„Gerade in unserer heutigen digitalen Welt sind starke Wurzeln wichtiger denn je.“
Eva-Maria Puschan

Eva-Maria Puschan
ist es ein Anliegen
Kindern starke Wurzeln für das Leben mitzugeben.
© Verein WurzelWerk
ZUKUNFTSGESPRÄCH
mit Eva-Maria Puschan
Eva-Maria Puschan hat ein zukunftsträchtiges
Betreuungskonzept für Kinder im digitalen
Zeitalter entwickelt. Von Petra Plimon
Unweit der Burgruine Finkenstein ist ein einzigartiger Ort der Bildung entstanden, der „Waldmomente“ für Jung und Alt in den unterschiedlichsten Facetten erlebbar macht. Im Zukunftsgespräch mit advantage spricht Waldpädagogin
Eva-Maria Puschan (36) – selbst Mutter –über ihr Herzensprojekt, den Waldkindergarten „Wurzelkinder“.
Wodurch zeichnet sich Ihr persönlicher Zugang zum Wald aus?
Eva-Maria Puschan: In meinem ursprüng-

lichen Beruf bin ich Kleinkinderzieherin. Gleichzeitig liegt der Werkstoff Holz quasi in meiner DNA, mein Vater ist Tischlermeister. 2011 habe ich den Betrieb übernommen und ein Geschäft in Villach mit dem Fokus auf gesunden Schlaf und kreative Holzarbeiten geführt. Durch meinen Lebensgefährten, der eine Landwirtschaft mit Wald besitzt, wurde der Wunsch das ursprüngliche Wissen zu erweitern immer größer. Nach einer forstlichen Aus- und Weiterbildung habe ich die Waldpädagogik für mich entdeckt und es entstand die Idee meinen Mitmenschen den Wald wie-

„Meine Vision ist es, Kindern von heute eine Kindheit zu schenken ,wie es früher einmal war‘ unter Miteinbeziehen der digitalen Möglichkeiten.“
Eva-Maria Puschan
der näher zu bringen. Somit konnte ich das Thema „Wald und Holz“ ideal mit meinen Grundkompetenzen als Kleinkinderzieherin verbinden.
Dadurch, dass mein Elternhaus in Latschach nahe der Burgruine Finkenstein mitten im Wald steht und im Erdgeschoss Räumlichkeiten verfügbar waren, hat sich die Möglichkeit aufgetan, den






umliegenden Wald als offenes und freies Bildungshaus zu nutzen. Die „Waldmomente Station“ wurden ins Leben gerufen. Ich begann Führungen im Wald sowohl für Groß und Klein anzubieten sowie speziell Walderlebnisse für die Jüngsten in Form von Kindergeburtstagen und Ferienbetreuungsangeboten bereitzustellen.
Wie entstand die Idee einen eigenen Waldkindergarten zu eröffnen?
Das Konzept der „Wurzelkinder“ ist noch relativ jung. Wir sind ein privater Kindergarten, der seit 2020 auf Vereinsbasis geführt wird und auf individuelle, ganzjährige Betreuung in einem familiären Umfeld setzt. Die Idee entwickelte sich aus meinen Erfahrungen im klassischen Gemeindekindergartenbereich und meiner selbstständigen Tätigkeit als Waldpädagogin in verschiedenen Bildungseinrichtungen sowie den Erkenntnissen aus meinen Ferienbetreuungsangeboten.
Unser Team betreut aktuell 29 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Die Nachfrage ist immens, unsere Warteliste lang. Zu Beginn habe ich nicht damit gerechnet, dass der Zuspruch so groß sein
wird, denn wir liegen ja für die meisten Eltern nicht direkt am Weg.
Was macht das Angebot so einzigartig?
Es ist ein bodenständiges Betreuungskonzept für Kinder im schnelllebigen, digitalen Zeitalter, die kein „entweder oder“, sondern ein „sowohl als auch“ lernen sollen! Das Angebot richtet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte, denen Naturbezug und traditionelles Wissen am Herzen liegen. Derzeit sind wir im Verfahren mit dem Land Kärnten, um eine Landesanerkennung zu erhalten.
Welche Vision verfolgen Sie mit dem Projekt?


„Wir sind ein privater Kindergarten, der seit 2020 auf Vereinsbasis geführt wird und auf individuelle, ganzjährige Betreuung in einem familiären Umfeld setzt.“
Eva-Maria Puschan
Meine Vision ist es, Kindern von heute eine Kindheit zu schenken „wie es früher einmal war“ unter Miteinbeziehen der digitalen Möglichkeiten - im Einklang mit der Natur, begleitet von christlichen Jahresfesten und mit bäuerlichen Prozessen. Neben ausreichend Bewegung in der Natur – frische Luft zu jeder Jahreszeit schafft ein starkes Immunsystem – spielt auch der richtige Umgang mit unseren wertvollen Lebensmitteln eine wesentliche Rolle. Mitgründerin des Vereins ist meine Kusine, die selbst einen Bauernhof bewirtschaftet. Von dort beziehen wir das Fleisch. Ein eigener großer Gemüsegarten ist, neben unseren Bauern, Hauptlieferant für das tägliche Essen.
Ich möchte den Kindern von klein auf ein Grundwerkzeug in die Hand geben, das durch Achtsamkeit Wurzeln schafft und damit eine starke Resilienz für das weitere Leben gewährleistet. Gerade in unserer heutigen digitalen Welt sind starke Wurzeln wichtiger denn je. Wer den Naturkreislauf versteht, versteht auch das Leben selbst und bekommt damit Halt und Sinn. |


Im Rahmen eines Berufsorientierungsprojektes erkundeten
Schüler:innen des Stiftsgymnasiums St. Paul im Lavanttal die Säulen der Demokratie und den Medienbereich.
Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) setzt auf spannende und praxisorientierte Projekte, um jungen Menschen die Arbeitswelt näher zu bringen. Ziel ist es gemeinsam mit Schulen und Vertreter:innen aus den unterschiedlichsten Branchen, dass Berufswege besser erfahrbar und leichter vorstellbar gemacht werden. Die BBOK wird beauftragt und finanziert durch das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, das Land Kärnten und die Industriellenvereinigung (IV).
Säulen der Demokratie
„Aufgrund der Vielfalt an beruflichen Perspektiven ist es wichtig, junge Menschen frühzeitig bei ihrer Berufs- und Bildungswahl zu unterstützen“, erklären Tamara Skubel und Marion Hasse von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) – Standort Wolfsberg. Mit der Organisation des interaktiven Formates
„Säulen der Demokratie“ und dem Medienprojekt „top stories“ wurde Schüler:innen der vierten Klassen am Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal kürzlich die Möglichkeit geboten, wertvolle Einblicke in Berufsbilder der Legislative, Exekutive, Judikative sowie der Medienwelt zu erhalten. Im Rahmen von Kurzworkshops konnten die Jugendlichen direkten Kontakt zu Berufsvertreter:innen aus der Region knüpfen und praxisorientierte Eindrücke gewinnen.
Top stories
Als Referent:innen mit dabei waren Bürgermeisterin Maria Knauder von der Stadtgemeinde St. Andrä, Amtsleiterin Silke Thamerl von der Marktgemeinde St. Paul, Richterin Renate Brenner vom Bezirksgericht Wolfsberg, Gruppeninspektor Andreas Tatschl von der Polizeiinspektion Wolfsberg und Petra Plimon vom Wirtschaftsmagazin advantage. In den einzel-
Marion Hasse (BBOK), Andrea Pötsch (Stiftsgymnasium St. Paul), Direktorin Ines Leschirnig-Reichel (Stiftsgymnasium St. Paul), Renate Brenner (Bezirksgericht Wolfsberg), Andreas Tatschl (Polizeiinspektion Wolfsberg), Amtsleiterin Silke Thamerl (Marktgemeinde St. Paul i. Lav.), Bürgermeisterin Maria Knauder (Stadtgemeinde St. Andrä), Petra Plimon (Wirtschaftsmagazin advantage), Tamara Skubel (BBOK), Günter Peter (Stiftsgymnasium St. Paul), v. l. n. r. © Knauder
„Aufgrund der Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten ist es wichtig, junge Menschen frühzeitig bei ihrer Berufs- und Bildungswahl zu unterstützen.“
Tamara Skubel und Marion Hasse, BBOK Wolfsberg
nen Kurzworkshops boten die Referent:innen den Schüler:innen Informationen zum Werdegang und interessante Einblicke in den Berufsalltag und deren Tätigkeiten. Zudem gab es genügend Raum für persönlichen Austausch und kritische Fragen. Beim zweiten Teil des Projektes erwartete die Schüler:innen ein Exkursionstag zu den Schauplätzen der „Säulen der Demokratie“ (Kärntner Landtag, Landesgericht Klagenfurt, Polizeiinspektion Annabichl) sowie im Rahmen des Medienprojektes ein Besuch bei der Antenne Kärnten. |

Die Technische Akademie St. Andrä im Lavanttal bietet ein spannendes Sommercamp für Kinder und Jugendliche, um in die Welt der technischen Berufe einzutauchen.
Im Vorjahr wurde mit dem Sommercamp „Girls Go Technik“ ein einzigartiges Ferienerlebnis in der Technischen Akademie (TAK) in St. Andrä im Lavanttal ins Leben gerufen. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Angebot heuer entsprechend erweitert. „Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 erhalten nicht nur die Möglichkeit, gemeinsam eine abenteuerliche Zeit zu verbringen, sondern frühzeitig technische Berufsfelder kennenzulernen und ihr handwerkliches Geschick zu erproben“, freut sich Geschäftsführer Manfred Vallant.
„Unser Ferienprogramm soll junge Menschen ermutigen den technischen Bereich zu erkunden und erste technische Fähigkeiten zu erlangen.“
Manfred Vallant, Geschäftsführer TAK
Sommercamp
Das Sommercamp bietet eine interessante und lehrreiche Umgebung mit vielen spannenden Workshops sowie jede Menge Spaß, Abwechslung und Action. Damit setzt die Technische Akademie ein wichtiges Zeichen für die Familien in der Region. Zugleich trainieren die Kinder und Jugendlichen frühzeitig ihre handwerklichen Fertigkeiten. „Unser Ferienprogramm soll junge Menschen ermutigen den technischen Bereich zu erkunden und erste technische Fähigkeiten zu erlangen. Die Jugendlichen lernen neue berufliche



In der Technischen Akademie (TAK) in St. Andrä im Lavanttal werden heuer spannende Sommercamps für Kinder und Jugendliche angeboten. © TAK
Handlungsfelder kennen und sie werden motiviert, sich weiter damit zu beschäftigen“, so Vallant. Das ist der Grundstein für einen natürlichen Umgang zu technischen Themen in späteren Lebensjahren.
Professionelle Betreuung
Das Team besteht aus erfahrenem Fachpersonal und Betreuer:innen, die sich liebevoll um die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen kümmern. „Wir integrieren Lernmomente in unser abwechslungsreiches Programm, um einerseits die technischen Fähigkeiten und Kenntnisse und andererseits die sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu erweitern“, erklärt Vallant. Geboten wird ein breites Spektrum an Aktivitäten, wie das Erlernen von einfachen handwerklichen Fähigkeiten. Neben dem Technikschwerpunkt wird auch Wert auf wichtige Soft Skills wie






Die Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00-16:30 in folgenden Wochen statt:
KW 28: 8.7.-12.7.2024
KW 29: 15.7.-19.7.2024
KW 34: 19.8.-23.8.2024
KW 35: 26.8.-30.8.2024
(speziell für Mädchen)
Kosten inkl. Verpflegung
€ 200,-/Woche
Pro Woche max. 15 Plätze
Teamarbeit, Problemlösung und Kommunikation gelegt. Natürlich darf auch der Spaß in Form von Spielen und sportlichen Betätigungen im Freien und Ausflügen nicht zu kurz kommen.
Freude an der Technik
Die Ferienbetreuung findet in den Räumlichkeiten der TAK St. Andrä statt. Die Workshops und Hands on Stationen werden in den vollausgestatteten Werkstätten unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften durchgeführt. „Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen ist uns sehr wichtig. Unsere Einrichtung entspricht allen Sicherheitsstandards und alle Aktivitäten werden unter Aufsicht durchgeführt“, so Vallant. Für Outdoor-Aktivitäten stehen ausreichend Grünflächen zur Verfügung.
Zudem erhalten die Jugendlichen hochwertige Verpflegung während des Sommercamps – ein Frühstück sowie ein Mittagessen pro Tag sind inkludiert. „Wir achten dabei auf eine kinder- und jugendgerechte, frische und ausgewogene Ernährung. Das Mittagessen wird frisch gekocht und warm von einem Anbieter vor Ort angeliefert. Für das Einnehmen der Mahlzeiten steht ein sehr gut ausgestatteter Speiseraum zur Verfügung. Obst, Säfte und Wasser stehen den ganzen Tag über zur Verfügung“, so Vallant.
Regionale Wirtschaft als Partner Als Ausbildungsbetrieb legt die TAK in ihrer Arbeit großen Wert auf Kooperationen mit der heimischen Wirtschaft. Das Sommercamp wird auch von Seiten der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Wolfs-
berg und von regionalen Betrieben unterstützt. „Denn wenn schon frühzeitig die Interessen und Talente von Kindern und Jugendlichen für Technik geweckt werden, hilft das nicht nur bei der zukünftigen Berufswahl, sondern auch in weiterer Zukunft den Betrieben mit den Fachkräften“, so Vallant.
Spezielles Angebot für Mädchen Insbesondere die Mädchenförderung ist der TAK ein großes Anliegen. „Das Sommercamp ,Girls go Technik‘ 2023, das wir in Kooperation mit dem Frauenreferat des Landes Kärnten und EqualiZ umgesetzt haben, hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst praktisch auszuprobieren und so Hemmschwellen für diese Berufsfelder abzubauen. Dieses Wissen und diese Kooperation wollen wir auch in unserem Ferienprogramm wieder nutzen und gezielt Mädchen ansprechen und motivieren, mit dabei zu sein“, so Vallant. Die letzte Sommercamp-Woche (26. bis 30. August 2024) wird daher speziell für Mädchen angeboten. Auch Frau in der Wirtschaft unterstützt diese einzigartige Ferienbetreuung heuer erstmalig. |
WEITERE INFORMATIONEN
Technische Ausbildungs GmbH Siebending 22A 9433 St. Andrä i. Lav. T +43(0)4358/24 147 office@technische-akademie.at www.technische-akademie.at


In der ehemaligen Klagenfurter Postgarage wurde mit dem TCC ein europaweit einzigartiges Testzentrum für Erwachsene, Jugendliche, Unternehmen und Schulen geschaffen.
© Thomas Waschnig
Preis/Testung
TCC-Test für Schüler:innen/ Jugendliche pro Testkandidat:in 154 Euro (inkl. 10 % MwSt.)
TCC-Test für Erwachsene pro Testkandidat:in 198 Euro (inkl. 10 % MwSt.)
Die Wirtschaftskammer
Kärnten fördert: Schulklassen:
Preis pro Schüler:in 22 Euro (inkl. 10 % MwSt.) Zusätzlich übernimmt die Wirtschaftskammer Kärnten für Schulklassen die Kosten für den Bustransfer von der Schule zum TCC und retour.
Wirtschaftskammermitglieder:
Pro Testkandidat:in 33 Euro (inkl. 10 % MwSt.)
Einzeltestungen:
Pro Testkandidat:in 33 Euro (inkl. 10 % MwSt.)

Mit dem neuen, europaweit einzigartigen Testzentrum setzt die Wirtschaftskammer einen zukunftsorientierten Impuls für den Standort, den Arbeitsmarkt sowie das Bildungsland Kärnten.
In der ehemaligen Postgarage – nur wenige Gehminuten vom Klagenfurter Hauptbahnhof entfernt – wurde mit dem Testcenter Carinthia (TCC) eine innovative Testumgebung für Jugendliche, Erwachsene, Unternehmen und Schulen geschaffen. „Unser fundiertes und innovatives Testsystem macht Stärken und berufliche Kompetenzen in allen Altersstufen sichtbar und hilft immens bei der Berufsorientierung, ob für Ein-, Um- oder Wiedereinsteiger“, betont WKK-Präsident Jürgen Mandl. Das TCC wurde am 1. März nach einer Bauzeit von weniger als einem Jahr eröffnet. Die Kosten belaufen sich auf 4,5 Mio. Euro –eine Direktinvestition der Wirtschaftskammer
in den Wirtschafts- und Lebensstandort, die in Europa bislang einzigartig ist. Der laufende Betrieb wird vom WIFI getragen.
Jetzt auch für Erwachsene
Das TCC ist eine wichtige Schnittstelle, um dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Vorbild war das höchst erfolgreiche Testund Ausbildungszentrum (TAZ): Hier wurden mittels standardisierten Testverfahren (29 Teststationen) zwölf Jahre lang die Stärken und Fähigkeiten von Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren – mittlerweile 40.000 – festgestellt. Im TCC wird das bewährte Konzept fortgeführt und das Angebot um branchenspezifische Kom-
„Die Kenntnis der eigenen Stärken wird für die Zukunft eine noch größere Rolle spielen, um der Komplexität und der ständigen Veränderung der Arbeitswelt zu begegnen.“
Andreas Görgei, Geschäftsführer WIFI Kärnten
petenztests für Erwachsene erweitert. Ein Simulatorzentrum und weitreichende Beratungsangebote ergänzen das Angebot.
Am Puls der Zeit
Traditionelle Karrierewege und Arbeitsstrukturen verändern sich rasant. Genügte bisher eine Ausbildung und ein Arbeitsplatz für ein ganzes Berufsleben, wechseln Arbeitnehmer:innen heute mehrmals im Laufe ihrer Karriere den Job oder sogar die Branche. „Dies erfordert eine kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der beruflichen Fähigkeiten. Die Kenntnis der eigenen Stärken wird für die Zukunft eine noch größere Rolle spielen, um der Komplexität und der ständigen Veränderung der Arbeitswelt zu begegnen“, erklärt WIFI-Geschäftsführer Andreas Görgei, auch Leiter der Bildungspolitischen Abteilung der WKK.
Berufliche Orientierung
Das TCC stellt ein innovatives und fundiertes Testsystem für alle Erwachsenen bereit, die ihre Stärken und Kompetenzen erforschen möchten. Der TCC-Test schafft berufliche Orientierung, indem jene Berufsfelder identifiziert werden können, die zu den eigenen Stärken passen. Die kompetenzorientierten Testergebnisse geben auch Aufschluss darüber, ob bereits

WK-Direktor Meinrad Höfferer, WKO-Präsident Harald Mahrer, WKK-Präsident Jürgen Mandl und WIFI Kärnten Geschäftsführer Andreas Görgei bei der feierlichen Eröffnung des TCC. © PSB Media
erworbenes Know-how den aktuellen Anforderungen von Unternehmen entspricht. Neben den fixen Basistests (grundlegende und kognitive Fähigkeiten) können Teilnehmer:innen aus einer Reihe von branchenspezifischen Kompetenztests aus den Fachbereichen Technik, Tourismus und Verwaltung wählen. Die Ergebnisse der Kandidat:innen werden genauso wie die Profile relativ und nicht absolut dargestellt: Jedes Testergebnis bezieht sich auf den Vergleich mit allen Kandidat:innen, die in den vergangenen zwölf Monaten diesen Test absolviert haben. Die Ergebnisse stehen nach der Testung unmittelbar zur Verfügung und werden im Rahmen eines abschließenden Orientierungsgesprächs gemeinsam mit individuellen Entwicklungspfaden erörtert. Das Testangebot wird ständig erweitert.
Service für Unternehmen
Gleichzeitig unterstützt das TCC Unternehmen direkt, die qualifiziertesten Bewerber:innen auszuwählen und passende Fachkräfte zu finden. Betriebe können Bewerber:innen für eine offene Stelle im TCC objektiv testen lassen. Zusätzlich können Unternehmen kostenlos ein Anforderungsprofil hinterlegen und so auf geeignete Fachkräfte aufmerksam gemacht werden, die die unternehmensspezifischen
Anforderungen erfüllen. Ein einzelnes Testverfahren dauert inklusive Orientierungsgespräch zwischen zweieinhalb und vier Stunden und kostet 198 Euro (inkl. 10 % MwSt.). Auch hilft das TCC den Kärntner Betrieben dabei, geeignete Lehrlinge zu finden. Dafür hinterlegen Betriebe ein eigenes Anforderungsprofil und können zusätzlich einen Firmen-TCCTest Junior für die konkrete Lehrlingsauswahl durchführen lassen.
Schulbesuche erwünscht
Das TCC ist auch der versierteste Anbieter von Berufsorientierung für Kärntner Schulen. Hier können Schüler:innen nicht nur ihre Talente entdecken, sondern lernen auch die Lehrberufe kennen, die zu ihren Stärken passen. Wenn sie nicht mit ihrer Schulklasse das TCC besuchen, können sich Jugendliche auch zu einem JuniorEinzeltest im TCC anmelden. |
Testcenter Carinthia
Lastenstraße 26 9020 Klagenfurt am Wörthersee T 059434-9092
E tcc@wifikaernten.at www.tcc.or.at
Die Fachhochschule Kärnten setzt verstärkt auf individuelle Lernwege und die Vermittlung von Future Skills.
„An der FH Kärnten legen wir großen Wert auf die Vermittlung von Future Skills, denn diese sind durch KI nur bedingt oder gar nicht zu ersetzen und werden für Führungskräfte und Mitarbeiter:innen in Zukunft notwendiger denn je.“
Rektor Peter Granig
Der Bedarf an flexiblen und durchlässigen Bildungssystemen mit individuellen und zeitgemäßen Weiterbildungsformaten wächst.
Aufgrund eines dynamischen Wissensanstieges und der fortschreitenden Digitalisierung ist es wichtig, zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln und auszubauen. „Lehren und Lernen verändert sich an Hochschulen rapide. Insbesondere die Anforderungen an Studierende bzw. Absolvent:innen von zukünftigen Arbeitgeber:innen erfordern Flexibilität, Dynamik und das schnelle Anpassen an sich ändernde Rahmenbedingungen“, betont
Rektor Peter Granig. Die FH Kärnten ist daher stetig bestrebt, agil zu bleiben und neue Wege zu finden, um Wissen zu vermitteln und zeitgemäße Bildungsformate im Einklang mit den Erfordernissen des Arbeitsmarktes bereitzustellen. Praxisorientierung spielt von jeher eine entscheidende Rolle.
Um auch den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden, wird verstärkt auf die Gestaltung von attraktiven Lern- und Arbeitsumgebungen gesetzt. „Die FH Kärnten nutzt vielfältige Möglichkeiten, um individuelle Lernwege zu ermöglichen und die Qualität der Lehre zu verbessern“, erklärt Vizerektorin Angelika Mitterbacher. Bildungsangebote, die bis zu einem gewissen Grad zeit- und ortsunabhängig in Anspruch genommen werden können, entsprechen dem Zeitgeist. Flexibilität wie auch Planbarkeit nehmen einen immer größeren Stellenwert ein: Online-Module, Teilzeitstudium und berufsfreundliche Formate sind wichtige Ansätze. Hybride Lehr-Lernsettings ermöglichen es, sowohl in Präsenz als auch online teilzunehmen. „Wir haben – wenn man so will – eine hybride Arbeits- und Lernwelt geschaffen, die Raum für Kollaboration, Begegnung und zukunftsorientiertes Lernen bietet. Dabei geht es uns um die Balance zwischen analog und digital, in der Menschen weiterhin im Mittelpunkt stehen“, so Mitterbacher.
Kompetenzen der Zukunft
Des Weiteren zeichnen sich in der Hochschul- und Mediendidaktik Trends ab, die die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen in Zukunft zunehmend beeinflussen. Große Veränderungen bringen Einsatz und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lehre mit sich. „Das Reproduzieren von Wissen und Verdichten von Inhalten verliert an Bedeutung. Entscheidend für uns ist die Frage, was kann auch in naher und ferner Zukunft nicht mit KI gelöst werden“, sagt Granig. Um Studierende auf zukünftige gesellschaftliche und berufliche Herausforderungen vorzubereiten, wird der Fokus daher neben Fachwissen vermehrt auf Schlüsselkompetenzen gelegt. „An der FH Kärnten legen wir großen Wert auf die Vermittlung von Future Skills, denn diese sind durch KI nur bedingt oder gar nicht zu ersetzen und werden für Führungskräfte und Mitarbeiter:innen in Zukunft notwendiger denn je“, so Granig. Dazu zählen traditionelle Fähigkeiten wie Teamarbeit, Problemlösung und Kreativität sowie moderne Kompetenzen wie Softwareentwicklung, Datenkompetenz und agiles Arbeiten.
Lebenslanges Lernen
Die Bildungsangebote der FH Kärnten sind dabei nicht nur auf das Studium beschränkt: Um lebenslanges Lernen zu fördern, werden auch vielfältige Weiterbildungsangebote für Absolvent:innen und
Rektor Peter Granig und Vizerektorin
Angelika Mitterbacher. © Johanna Dulnigg

„Die FH Kärnten nutzt vielfältige Möglichkeiten, um individuelle Lernwege zu ermöglichen und die Qualität der Lehre zu verbessern.“
Vizerektorin Angelika Mitterbacher
















Berufstätige bereitgestellt. Die FH Kärnten entwickelt daher innovative Ausbildungsformate, sogenannte Micro Credentials, um praxisrelevantes Wissen flexibel und modular zu vermitteln. „Insgesamt ist es uns wichtig, dass unsere Hochschule agil ist und sich kontinuierlich an die sich wandelnden Anforderungen der Gesellschaft anpasst. Nur so können wir zukunftsorientierte Bildungsangebote bereitstellen und Studierende optimal auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten“, so Mitterbacher. |

KONTAKT
FH Kärnten
Peter Granig, Rektor T: +43 (0)5 90500-7100 p.granig@fh-kaernten.at www.fh-kaernten.at














Ein Modell der Gegenwart und Zukunft: Regionale Einheiten, in denen Menschen gemeinsame Sache machen, Energie erzeugen und nutzen.
Von Monika Unegg
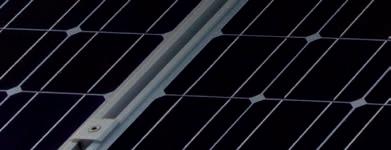
Energiegemeinschaften liegen im Trend und ermöglichen es die Energieversorgung mitzugestalten. © pixaby.com/PublicDomainPictures
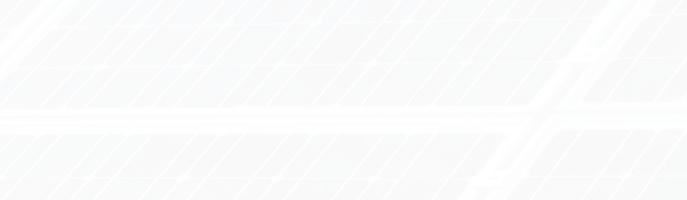

Energiegemeinschaften sind in vielen Bereichen noch wenig bekannt, und doch entwickeln sie sich rasant und bieten den Nutzer:innen eine gewisse Form von Unabhängigkeit. Derzeit sind drei Formen möglich.



Bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen – kurz GEA genannt – können sich etwa Mieter:innen oder Eigentümer:innen in Mehrparteienhäusern, aber auch in Bürogebäuden oder Einkaufszentren zusammenschließen, um gemeinsam eine Erzeugungsanlage zu nutzen. Dafür kommen grundsätzlich alle Technologien in Frage. Laut der Website der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ gibt es in Österreich rund 1.000 aktive GEA, die seit 2017 möglich sind und als Vorläufer der Energiegemeinschaften gelten.
Die BEG – Bürgerenergiegemeinschaft –darf sich hingegen über die Konzessionsgebiete mehrerer Netzbetreiber in ganz Österreich erstrecken, ist aber auf Strom beschränkt. Gewinnerzielung darf nicht im Vordergrund stehen. Elektrizitätsunternehmen, Mittel- und Großunternehmen dürfen im Gegensatz zu EEGs an BEGs teilnehmen, sie dürfen dort aber nicht die Kontrolle ausüben.
Steirischer Pionier

Eine EEG – Erneuerbare Energie Gemeinschaft – ist ein Zusammenschluss zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Energie – Strom, Wärme oder Biogas – aus erneuerbaren Quellen. Die Energieformen können erzeugt, gespeichert, verbraucht und verkauft werden. EEGs nützen die Anlagen des Netzbetreibers und müssen immer innerhalb des Konzessionsgebiets eines einzelnen Netzbetreibers angesiedelt sein. Großunternehmen und Elektrizitätsunternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ein Pionier in Sachen EEG ist Stefan Mussger. Er hat mit Gleichgesinnten die EEG Premstätten initiiert und aufgebaut. 2022 wurde sie gegründet, seit 2023 ist sie aktiv. Mittlerweile erstrecken sich zahlreiche EEGs über weite Bereiche der Steiermark und die Initiatoren haben bereits erfolgreich ihre Fühler nach Kärnten ausgestreckt.
Teilnehmen kann jeder, unabhängig davon, ob er selbst Strom erzeugt oder diesen nur bezieht. Private Haushalte, Organisationen, Kommunen und Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter:innen beschäftigen und deren Bilanzsumme unter 43 Mio. Euro jährlich liegt, können dabei sein. Genutzt werden die bestehenden Netze.
Die EEG Premstätten ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, das wurde in den Statuten festgeschrieben. Überschüsse werden für die Finanzierung sozialer und
„Wir haben die nachhaltige Verbesserung in den Bereichen Energie, Dekarbonisierung, Sensibilisierung, gesellschaftliches Miteinander sowie Klimaund Umweltschutz im Fokus.“
Stefan Mussger, Obmann der EEG Premstätten
umweltrelevanter Projekte oder zur Unterstützung Notleidender genutzt. „Unser Verein ist ganzheitlich orientiert. Wir haben die nachhaltige Verbesserung in den Bereichen Energie, Dekarbonisierung, Sensibilisierung, gesellschaftliches Miteinander sowie Klima- und Umweltschutz im Fokus“, erklärt Mussger, Obmann der EEG Premstätten und Obmänner-Vorsitzender der EEG Steiermark.


Daher soll auch die Teilnahme leistbar sein. Einen Euro pro Zählpunkt und Monat beträgt der „Mitgliedsbeitrag“, das sind pro Teilnehmer:in, unabhängig von der Größe, also zwölf Euro im Jahr. Bindefrist gibt es keine, man kann jederzeit wieder austreten. Jedes Mit-
glied kann zu festgelegten Tarifen Strom in die EEG einspeisen und beziehen, wobei Abnehmerpreis und Einspeisevergütung gleich hoch sind. Derzeit sind es 11,626 Cent pro Kilowattstunde. Die Mitglieder behalten ihre Verträge mit ihrem Energieversorgungsunternehmen und beziehen von ihm ihren Reststrom, wenn im EEG-Verbund zu wenig verfügbar ist.
Mit der Zero-Tarifoption können Mitglieder Teile ihres produzierten Stroms auch direkt an andere Zählpunkte innerhalb der EEG verschenken. So kann zum Beispiel ein Unternehmen Angestellten Strom um null Cent pro Kilowattstunde zur Verfügung stellen, was in diesem Fall den Vorteil hat, dass die Steuer ebenfalls null ist. Oder Gemeinden können ihren Bürger:innen Strom abkaufen und der Freiwilligen Feuerwehr oder gemeinnützigen Organisationen kostenlos zur Verfügung stellen.
Die Zero-Tarifoption bietet weitere finanzielle Vorteile auf Netzebene, wie reduzierten Netzarbeitspreis, den Entfall der Elektrizitätsabgabe sowie den Erneuerbaren-Förderbeitrag für den Strom, der aus der EEG bezogen wird.
Das Modell ist ein großer Erfolg. „Wir haben seit der Ausrollung im Jänner 2024 bereits über 20 aktive EEGs in der Steiermark und mehr als 100 weitere solidarische regionale EEGs in Gründung“, erzählt Mussger. Da das Interesse auch jenseits der „Grenze“ sehr groß ist, erschließen die Steirer nun die „Kärnten Netz“. 46 EEGs sind im südlichsten Bundesland geplant. Sie sollen nach und nach aktiv werden, sobald die Netzzugangsverträge abgeschlossen sind.
Raiffeisen: EEG-Genossenschaften
Auch die Kärntner Raiffeisenbanken haben ihre ersten EEGs gegründet. Mit Ende März waren es 21 Gemeinschaften, die in Form von Genossenschaften etabliert wurden und nach und nach aktiv werden sollen. Mit der geplanten Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes werde sich am Energiemarkt einiges tun, es werden mehr Player hinzukommen und die Haushalte und kleinere Strukturen bekommen ein stärkeres Gewicht, erklärt Vorstandsdirektor Gert Spanz, der bei Raiffeisen für diesen Bereich zuständig ist. In ganz Kärnten fanden und finden Informationsveranstaltungen statt und die Bürger:innen können sich jederzeit zu einer der EEGs anmelden. „Wir sind eine Regionalbank, daher sind wir für das Thema regionale Energieversorgung geradezu prädestiniert, darüber hinaus unterstützen wir nachhaltige Projekte“, so Spanz. Auch soll das Bewusstsein in der Bevölkerung für Nachhaltigkeit und Klimaveränderung gestärkt werden. Weiters werden dadurch Investitionen und die Wertschöpfung in der Region gefördert.
Bürgerenergiegemeinschaft
Die erste Bürgerenergiegemeinschaft in Kärnten ist die „Energie in Kärnten Kraftwerke GesmbH“. Sie ging im Dezember 2022 in Betrieb und erhielt 2023 den „Energy Globe Award“ in der Kategorie Feuer. Laut Einreichunterlagen konnte bereits in den ersten beiden Abrechnungsmonaten rund 70 Prozent des Energiebedarfs der Verbraucher gedeckt werden. Träger ist die Firma Kostmann in St. Andrä. |

„Mit der geplanten Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes wird sich am Energiemarkt einiges tun, es werden mehr Player hinzukommen. Haushalte und kleinere Strukturen bekommen ein stärkeres Gewicht.“
Gert Spanz, Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten
Die Kärntner Raiffeisenbanken widmen sich intensiv dem Aufbau regionaler EnergieInfrastrukturen. © Raiffeisen Landesbank Kärnten




Thomas Robas, Unternehmer aus Klagenfurt, setzt auf ein flexibles Energiekonzept. Was wann und wie genutzt wird, hängt von den Preisen am Energiemarkt ab.
Der erste Meilenstein in Richtung Energieunabhängigkeit wurde im Jahr 2003 mit einer Biomasseheizung, betrieben teils mit Hackschnitzeln, teils mit Pferdemist aus den eigenen Stallungen, gelegt. Während andere Reitanlagen den Pferdemist entsorgen lassen müssen, konstruierte der innovative Klagenfurter seine eigene Biomasse-Heizanlage. In Summe gilt es auf Gut Drasing eine Fläche von 7.200 m² (inklusive Hotel, Restaurant, Nebengebäude, Reithalle und 25 Meter Pool) zu beheizen. Das auf dem eigenen Gelände errichtete Biomassekraftwerk stellte dies von 2003 bis 2016 sicher. Ein Mischverhältnis Mist:Hackschnitzel im Verhältnis 1:1 lieferte ausreichend Energie, um den beträchtlichen Eigenbedarf zu decken und würde vermutlich noch heute in der damaligen Form genutzt werden, wenn es zu keinen größeren Preissteigerungen am Holzmarkt gekommen wäre.
Von der Biomasse zur Sonnenkraft
„Mit der gesteigerten Nachfrage nach Pellets, flossen die Sägespäne in die Pelletsproduktion ab und wurden als Einstreu für die Pferdeboxen unattraktiv teuer.
Durch den florierenden Gastronomie- und Hotelbetrieb explodierten somit trotz Biomasseheizung die Heiz- aber auch Stromkosten. Ich musste mir Alternativen einfal-
len lassen. Letztendlich wurde die Idee geboren, die Betriebszeiten des Biomasseheizwerkes zu reduzieren, über die Sommermonate Solarthermie zu nutzen und Strom über PV-Anlagen zu erzeugen“, erklärt Robas.
Noch im gleichen Jahr – 2016 – wurde aus der Idee Realität und der nächste Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit gemacht. Ein Entschluss, der bei einem jährlichen Stromverbrauch von an die 150.000 Watt nicht nur eine gute Entscheidung in Sachen Nachhaltigkeit, sondern auch Kostenersparnis bedeutete. In Zusammenarbeit mit der Klagenfurter Firma Santech entstand ein Mix aus dem bereits bestehenden Biomasseheizkraftwerk, einer Photovoltaikanlage (3.000 m² Fläche angebracht auf dem Dach der Reithalle und der Stallung), einer Solarthermieanlage und einer Wärmepumpe. Die überschüssige Energie wird in einen 60.000 Liter Warmwasserpufferspeicher sowie in 360 Batterieblöcke eingespeist und kommt bei Bedarf zum Einsatz.
Mehr als „nur“ Energieautark Neben der ökologischen Sinnhaftigkeit profitieren auch Gäste des Hotels von der Möglichkeit ihre E-Autos und E-Bikes bequem während des Aufenthalts an der gutseigenen Ladestation auftanken zu können. Autark ist die Gutsanlage aber auch
„Nutzen, was uns die Natur bietet, da gibt es so viele interessante Möglichkeiten. Egal ob als Einzelaktion oder als durchdachter, der Zeit und den Bedürfnissen angepasster Mix.“
Thomas Robas
in Sachen Wasserversorgung – es besteht kein Anschluss an das öffentliche Netz. Ebenso bei der eigenen Klärgrube. In Summe zeigt sich der Klagenfurter überzeugt von seinem nachhaltigen Konzept: „Als Inselanlage konzipiert, blackoutsicher und schwarzstartfähig, ist mit diesem speziellen Mix aus erneuerbaren Energien ein unabhängiger Betrieb sichergestellt, auch wenn es zu mehreren Wochen Stromausfällen bei den gängigen EVU kommen sollte.“
Wenngleich bereits jetzt eine breite Palette an erneuerbaren Energien genutzt wird, ist Thomas Robas noch unschlüssig, wie es weitergeht. Auch Windenergie könnte künftig ein Thema werden. Alles abhängig davon, wie sich die Preise am Energiemarkt und bei der Erschließung von zukünftigen erneuerbaren Energien entwickeln. „Nutzen, was uns die Natur bietet“ – so lautet die Devise, die Thomas Robas auch weiterhin in die Realität umsetzen möchte. |
Bereits 20 Minuten Aufenthalt im Naturraum sorgen für eine signifikante Erholung des vegetativen Nervensystems. Von Petra Plimon
Neben seiner Nutz- und Schutzfunktion hat der Wald nicht nur ausgleichende Effekte auf das Klima, sondern wirkt auch gesundheitsfördernd für den Menschen. Was in vielen Ländern bereits Gang und gäbe ist, könnte auch in Österreich bald zur Realität werden: Wald „auf Rezept“.
Seit den 2000-er Jahren boomt die Forschung rund um naturbasierte Gesundheitsmaßnahmen und Interventionen, die vergleichbare Effekte erzielen können wie Medikation, Therapie oder Reha-Angebote in Innenräumen. „Zugrunde liegend kann man sagen, – und da ist sich die Wissenschaft einig und die Faktenlage gegeben – dass Waldaufenthalte sich allgemein positiv auf unsere physische, psychische und soziale Gesundheit auswirken“, weiß Dominik Mühlberger, der sich im Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) im Fachbereich Wald, Gesellschaft und Internationales u. a. dem Bereich „Green Care WALD“ verschrieben hat.
Fakten aus der Forschung
Ein Blick quer durch zahlreiche, internationale Studien verdeutlicht, welche positiven Effekte der Naturraum auf die menschliche Gesundheit hat. Bereits ein 20-minütiger Aufenthalt im Wald – wohl-
Der Wald erfährt als Ort der Gesundheitsförderung eine immer größere Bedeutung.
© BFW/Irene Gianordoli

gemerkt ohne Einfluss von Handy und Co. – reduziert das Stresslevel und steigert den Serotoninspiegel. Regelmäßige Bewegung im Grünen leistet demnach einen wertvollen Beitrag zu mehr Wohlbefinden.
Auch die „3-30-300-Grünflächenregel“ basiert auf Forschungsergebnissen und besagt: Ideal sind mindestens drei Bäume in Sichtweite von jedem Wohnraum, 30 Prozent der Außenfläche rund um jeden Wohnraum sind mit Bäumen und Grünflächen bedeckt, niemand sollte mehr als 300 Meter vom nächsten Grünraum entfernt leben, den er persönlich besuchen kann. Die „3-30-300-Regel“ untermauert demnach eine Steigerung der Lebensqualität durch Bäume und Grünflächen und könnte als Leitbild für zukunftsfähige oder gesündere Wohnraumgestaltung insbe-

„Waldaufenthalte wirken sich positiv auf unsere physische, psychische und soziale Gesundheit aus.“
Dominik Mühlberger, BFW

sondere im städtischen Raum fungieren.
Forscher:innen aus Großbritannien haben zudem herausgefunden, wie sich Biodiversität auf die Gesundheit auswirkt: „Wenn ich mehr als fünf verschiedene Vogelstimmen in meiner Wohngegend höre, wirkt sich das stärker auf mein Gesundheitsempfinden aus, als ein finanzieller Einkommenssprung“, betont Mühlberger.
Mehr als Waldbaden
Das Thema Wald und Gesundheit bewegt die Menschen von jeher. Beflügelt wurde die Diskussion in Europa zweifelsohne durch ein Konzept aus Japan, das mittlerweile in aller Munde ist: Shinrin Yoku oder Waldbaden. Der Begriff Waldbaden, der zum Modewort avancierte, beschreibt das Eintauchen in die Natur, die Stille und
Idylle des Waldes sowie das bewusste Wahrnehmen seiner belebenden Wirkung mit dem Ziel der (Selbst-)heilung. Es sind Fähigkeiten, die viele Menschen im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung und Konsumorientierung scheinbar verlernt haben und Stück für Stück beginnen wieder zu entdecken.
Wald auf Krankenschein
Alleine, wenn wir und also im Wald bewegen, tun wir unserer Gesundheit etwas Gutes. „Verstärkt werden können die gesundheitsförderlichen Eigenschaften des Waldes, wenn die Gegebenheiten des Naturraums in Präventions- oder Therapieangebote miteinfließen. Dahingehend vermittelt der BFW-Lehrgang ,Green Care: Wald fördert Gesundheit‘ umfassendes Wissen bis hin zur konkreten Gestaltung
„Verstärkt werden können die gesundheitsförderlichen Eigenschaften des Waldes, wenn die Gegebenheiten des Naturraums in Präventions- oder Therapieangebote miteinfließen.“
Dominik Mühlberger, BFW
von gesundheitsförderlichen Angeboten“, erklärt Mühlberger.
Europaweit gibt es bereits immer mehr Paradebeispiele, wo naturbasierte Reha-, Therapie- oder gesundheitsfördernde Maßnahmen von der Krankenkasse zugelassen und gefördert werden. Auch in Kanada wird der Aufenthalt im National Park, der Eintritt kostet, bereits vom Hausarzt verschrieben („green prescription“ oder „social prescription“). „Das ist der nächste Schritt, den wir auch in Österreich erreichen wollen, weil das eine Diversifizierung der gesundheitsförderlichen Angebote bedeutet. Es funktioniert in vielen Ländern“, so Mühlberger abschließend. |
Quellen: BFW, WHO

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) widmet sich allen Aspekten des Lebensraums Wald – in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht. Wer zukünftig gesundheitsförderliche Angebote bereitstellen möchte, kann im Lehrgang „Green Care: Wald fördert Gesundheit“ vielschichtiges Know-how inkl. rechtlicher Grundlagen bis hin zur Gestaltung konkreter gesundheitsförderlicher Methoden und Angebote im Wald erwerben.
Mehr Informationen: www.greencarewald.at
Kärntens größter Fahrradfachhandel More setzt bereits auf Dienstradleasing. © PSB Media
Mittels Gehaltsumwandlung kann das Wunschfahrrad in kleinen Raten bezahlt und zu 100 % privat genutzt werden.
Durch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, die das Modell in Österreich erst möglich gemacht hat, liegt Dienstradleasing immer mehr im Trend. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter:innen dabei zu unterstützen, berufliche und private Wege klimaschonend zurückzulegen sowie ihre Gesundheit zu fördern und profitieren zugleich von steuerlichen Vorteilen und finanziellen Förderungen.
Win-Win-Situation für alle
„Es ist kein herkömmliches Leasing, sondern wird über Gehaltsumwandlung finanziert. Sprich: Der Mitarbeiter kann das Fahrrad nur über den Arbeitgeber leasen. Gleichzeitig kann das Wunschfahrrad aber auch 100 Prozent privat genutzt werden,“ erklärt Christoph More, der Kärntens größten Fahrradfachhandel in Spittal an der Drau betreibt und von dem Modell begeistert ist.
Mitarbeiter:innen können sich dadurch zwischen 30 bis 40 Prozent gegenüber einem Privatkauf sparen. Auch entsprechende Versicherungspakete sind bereits inkludiert. „In der Praxis hat auch der Arbeitgeber durch die Gehaltsumwandlung weniger Lohngesamtkosten und spart dadurch nochmal extra“, so More.
Und so funktioniert‘s
Der Arbeitgeber least ein Fahrrad oder

E-Bike, das sich der Arbeitnehmer vorher bei einem Händler-Partner ausgesucht hat. Das Dienstrad wird dem Arbeitnehmer zur Privatnutzung überlassen und kann somit zur Gänze auch außerhalb der Arbeit genutzt werden.
Die Leasingrate kann teilweise oder vollständig durch die sogenannte „Gehaltsumwandlung“ vom Brutto-Lohn des Mitarbeiters einbehalten werden. Dadurch sinkt die Lohnsteuer- und die Sozialversicherungsbemessungsgrundlage, der Mitarbeiter zahlt weniger Steuern und spart zwischen 30 bis 40 Prozent. Zu beachten gilt, dass eine Gehaltsumwandlung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist: Die resultierenden Geldbezüge müssen über dem gesetzlichen Kollektivvertrag liegen bzw. dürfen nach Abzug der Nutzungsgebühr für das Dienstrad nicht darunter liegen.
Einfach, digital und zeitsparend
Die Abwicklung des Leasingprozesses ist komplett digital, simple und benutzerfreundlich gestaltet. „Wir als Händler arbeiten mit einer Vielzahl an Leasing-Anbietern wie etwa ,LeaseMyBike‘ zusammen. Das Startup aus Österreich hat die heimische Rechtslage bestens im Blickfeld und bietet darauf basierend einen sehr transparenten Rechner, der das Wunschrad sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer im Vorfeld genau kalkuliert“, betont More.
„Die Partnerschaft mit dem Fachhandel ist wichtig, auch in der Nachbetreuung. Wir stehen für Qualität.“ Christoph More
Fahrräder können ab einem Wert von 800 bis 15.000 Euro über einen Zeitraum zwischen zwei und vier Jahren geleast werden. Betriebe können das Dienstradleasing ihren Vorstellungen bzw. den Bedürfnissen der Mitarbeiter:innen entsprechend anpassen. Im Rahmen des klimaaktiv mobil Förderprogramms können Jobräder (mit/ohne E-Antrieb) ab einer Stückzahl von fünf Rädern und Transporträder (mit/ohne E-Antrieb) gefördert werden. „Auch die Rückabwicklung – etwa im Falle einer Kündigung –ist kein Problem. Der Mitarbeiter stellt das Fahrrad zum Händler, das Fahrrad wird überprüft und an die Leasingfirma retourniert“, erklärt More. |
Hier geht es zum Dienstrad-LeasingRechner: leasemybike.at/ dienstrad-leasingrechner-oesterreich
Das Rote Kreuz bietet in Kärnten eine breite Palette an Dienstleistungen, die darauf abzielen, Menschen in allen Lebensphasen zu unterstützen und zu begleiten.
© Rene Knabl
Das Rote Kreuz in Kärnten ist ein unentbehrlicher Partner, der Menschen in sämtlichen Lebenslagen umfassend unterstützt.
Ein breites Spektrum an Dienstleistungen wird angeboten, die darauf abzielen, individuelle Bedürfnisse zu erfüllen und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Angebote im Bereich der Pflege und Betreuung sowie

„Wir sind da. Egal in welcher Phase des Lebens. Auf die Menschen beim Roten Kreuz kann man sich verlassen.“
Brigitte Pekastnig, Dritte Vizepräsidentin des Roten Kreuz Kärnten

der sozialen Dienste. Brigitte Pekastnig, Dritte Vizepräsidentin des Roten Kreuzes und Referentin für Pflege und Betreuung, betont die Wichtigkeit, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zu begleiten. Ihr persönliches Engagement erstreckt sich insbesondere auf den Bereich der sozialen Dienste, den sie maßgeblich mitgestaltet hat.
Betreuung daheim
Die mobile Hauskrankenpflege des Roten Kreuzes ermöglicht es Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Geschultes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal sowie Pflegeassistent:innen bieten professionelle Unterstützung direkt im Zuhause der Betroffenen. Von Wundversorgung über Medikamentenverabreichung bis hin zur Körperpflege und Mobilisation decken sie ein breites Spektrum an Pflegeleistungen ab. Zudem kooperieren sie eng mit anderen Fachkräften wie Hausärzten und stehen pflegenden Angehörigen beratend zur Seite. Um pflegende Angehörige weiter zu entlasten, bietet das Rote Kreuz einen Besuchsdienst an. Freiwillige Mitarbeiter:innen besuchen regelmäßig Menschen zu Hause und gestalten gemeinsam Zeit.
Unterstützung in vielen Bereichen
In schwierigen Lebenslagen, wie dem Verlust eines Partners oder finanziellen Engpässen, stehen freiwillige RotkreuzSozialbegleiter:innen zur Seite. Sie unterstützen bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben und der Organisation von Amtswegen. Ein weiteres Angebot des Roten Kreuzes ist die Team Österreich Tafel, die Menschen mit knappen finanziellen Ressourcen unterstützt, indem sie kostenlose Lebensmittel anbietet.
Aber auch schwer kranke Menschen erhalten Unterstützung von professionellen Palliativteams und ausgebildeten Freiwilligen, um ihre Lebensqualität bis zum Schluss zu verbessern.
Das Rote Kreuz Kärnten engagiert sich mit seinen vielfältigen Dienstleistungen dafür, Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu unterstützen und zu begleiten. Durch das breite Spektrum an Angeboten wird ein individuelles und bedarfsgerechtes Eingehen auf die Bedürfnisse der Menschen ermöglicht.
Die kontinuierliche Präsenz und Unterstützung des Roten Kreuzes gewährleistet ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit für die Menschen in Kärnten. |




Exklusives Ambiente, Blick auf das türkisblaue Wasser, ein eigener BADESTRAND mit großem Steg – das ist
Cloud P, der neue Wohntraum am Faaker See.
großzügig angelegte Drei- bis Vierzimmerwohnungen in drei Villen sind das neueste Angebot von ATVImmobilien, dem Spezialisten für Seeimmobilien. Das Luxusresort „Cloud P“ direkt am Faaker See, gestaltet von Architekt Peter Pichler, vereint anspruchsvolles Wohnen und erlesene Entspannung. Es wird in Kürze fertig und ist noch vor diesem Sommer bezugsbereit.
Urlaubsfeeling das ganze Jahr Seeimmobilien sind nach wie vor gefragt, wobei die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. „Daher freut es mich besonders, dass ich mit ,Cloud P‘ etwas anbieten kann, was sich alle Kund:innen, die ein Refugium am See suchen, wünschen“, erklärt Seeimmobilien-Experte Alexander Tischler, der seit mehr als fünf Jahrzehnten Liegenschaften und Wohnungen an den Kärntner Seen vermittelt.
Hohe Lebensqualität
Das neueste Objekt am Faaker See ist ein besonderes Kleinod. Privatsphäre und Exklusivität in allen Bereichen, NurglasPortale und Glas-Fassaden, große Terrassen, ein voller Seeblick, ein Swimmingpool
mit großem Wohlfühlbereich, eine helle Tiefgarage sowie das modernste Heiz- und Kühlsystem erwarten die neuen Eigentümer. Das Highlight ist der eigene Badestrand mit dem großen Badesteg und einem Badehaus mit Sonnendeck.
Die warmen Fluten des Faaker Sees und die Lage im Süden Kärntens mit Wandern, Radfahren, Golfen und der Nähe zu Italien bedeuten eine hohe Freizeitqualität für die ganze Familie.
Leben am Wasser kann auch die körperliche und mentale Gesundheit unterstützen. „Und mit einer Seeimmobilie genießt man das ganze Jahr über Urlaubsfeeling“, sagt Tischler. Darüber hinaus ist sie auch eine Investition für Generationen. Denn der Wert von Seeimmobilien ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen und wird sich auch weiter erhöhen.
Große Expertise
ATV hat im Laufe der Jahrzehnte eine in Kärnten unvergleichliche Expertise für außergewöhnliche Immobilien erworben. Ob ein Penthouse in herrlicher Aussichtslage, ein ruhiges Ferienhaus, eine Villa am See, ein Haus in Seenähe, ein Chalet an der Skipiste, eine Ferienwohnung oder


Das Wohnprojekt „Cloud P“ schmiegt sich mit seiner einzigartigen Archtitektur in die Kärntner Seenlandschaft. ©ATV Immobilien
„Mit einer Seeimmobilie genießt man das ganze Jahr über Urlaubsfeeling. Darüber hinaus ist sie auch eine Investition für Generationen.“
Alexander Tischler
eine Luxusvilla, Tischler berät seine Kund:innen bei Kauf und Verkauf und bringt die richtigen Partner zusammen. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für jeden das Richtige zu finden“, betont er. Seit mehr als 50 Jahren gelingt das. ATV kann aber auch Immobilien anbieten, die nur diskret verkauft werden und über die man keine Informationen im Internet oder in den Medien findet.
Sie möchten mehr über diese Seeimmobilie erfahren oder sich über weitere Immobilien am & um Wörthersee, Ossiacher See, Faaker See, Millstätter See und Weißensee informieren? |
KONTAKT
ATV-Immobilien GmbH, seit 1971
Mag. Alexander Tischler T +43 4248 3002 office@atv-immobilien.at atv-immobilien.at @seelage




office@atv-immobilien.at | @seelage.at
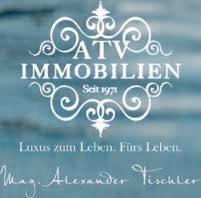
von Iris Straßer
Warum wir auf dem Weg zur Dekarbonisierung viel genauer hinsehen sollten und Klimaschutz ein zutiefst soziales Thema ist.

In meiner Arbeit als Nachhaltigkeitsexpertin stehe ich nicht nur mit Unternehmen im laufenden
Kontakt, sondern bin auch Gesprächspartnerin für Banken. Die Rolle des Finanzsektors in der Transformation ist zentral und den Banken wurde viel –vielleicht auch zu viel – an Mitwirkung am Weg zur Klimaneutralität Europas übertragen.
So darf ich derzeit in Workshops mit Firmenkundenbetreuer:innen einen Beitrag dazu leisten, sie auf ihre künftige Aufgabe vorbereiten, mit ihren Kund:innen über ESG*-Themen zu sprechen und auch Informationen einzuholen, die dann – nicht heute, aber morgen – auch deren Bonität beeinflussen wird und schon jetzt in die Risikobewertung bei der Kreditvergabe einfließt.
In diesem Projekt konnten wir auch Gespräche führen, um zu hören, wie Kund:innen die Anforderungen an die grüne Transformation und auch die zunehmende CO2 Bepreisung einschätzen und welche Auswirkung sie für ihr Geschäftsmodell sehen.
Lange Einleitung Ende.
Eines dieser Gespräche fand mit einem Kohlehändler statt. Etwa 80% des Umsatzes stammen aus dem Verkauf von Kohle, weitere 15% aus Öl und 5% Pellets. (Wie) wird dieses Unternehmen den nächsten Betriebsmittelkredit bekommen?
können. Wer heizt heute noch mit Kohle? Es sind arme Menschen, alte Leute, denen wir die Kohle liefern und denen wir auch helfen, sie in die Häuser zu bringen, Bergbauern. Manche bestellen seit letztem Jahr nur mehr die Hälfte, weil sie sich den Preisanstieg nicht leisten können, heizen dann nur mehr die Küche.
Was sollen wir tun? Diese Menschen im Stich lassen? Zusperren? Dazu sind wir zu nahe an den Menschen dran, die arm, die enttäuscht sind, die keine Perspektive und auch keine realistische Alternative haben.“
Auf die Frage, was das Unternehmen braucht, lautet die Antwort: „Hoffnung. Eine Perspektive, wie es für uns weitergehen kann. Begleitung auf dem Weg der Entwicklung für uns und unsere Kund:innen. Es ist von weit weg so leicht zu sagen, keine fossile Energie mehr. Theoretisch bin ich da dabei. Aber was heißt das praktisch für die Menschen, die sich keinen Umstieg leisten können?“
Reiche Menschen, die sich chic ein Elektroauto kaufen und für lange Strecken das große Zweitauto in der Garage haben, die täten sich leicht mit der Dekarbonisierung. Andere werden einfach übersehen. „Wir wollen diese Menschen nicht im Stich lassen, verstehen sie das?“
ZUR PERSON
IRIS STRASSER
leitet Verantwortung zeigen!, ein Unternehmensnetzwerk für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft und lehrt Nachhaltigkeit an mehreren Hochschulen. Sie erreichen die Autorin unter iris.strasser@ verantwortungzeigen.at
Also hinein ins Gespräch.
Das Unternehmen besteht seit knapp 80 Jahren, erzählt der Unternehmer. „Wir waren erfolgreich und haben den Aufschwung der Wirtschaft jahrzehntelang mitbegleiten können. Wir waren eine wichtige Branche. Heute sind wir ein schmutziges Unternehmen, werden für unsere Geschäfte verachtet. Wir wissen nicht, ob es uns in fünf oder zehn Jahren noch gibt. Der CO2 Preis pro Tonne steigt so dramatisch an, die Kosten können wir nicht auf unsere Kunden überwälzen. Das sind nämlich jene Menschen, die sich einen Umstieg der Heizung nicht so einfach leisten
Und dann erzählt er noch, dass eine Regionalpolitikerin manchmal bei ihm Kohle kauft und an arme Menschen liefern lässt. Darüber redet sie nicht, aber es hilft.
Zum Schluss bedankt sich der Unternehmer. Fürs ehrliche Zuhören.
Wir müssen genauer hinsehen, wo es welchen Weg der Umstellung in der Transformation braucht. Klimaschutz ist ein zutiefst soziales Thema. Davon bin ich schon lange überzeugt. Nach diesem sehr emotionalen Gespräch noch mehr. |
* *ESG = Environmenal Social Governance; Nachhaltigkeitskriterien, über die künftig (meist verpflichtend) Auskunft gegeben werden muss
Von FiT bis zur Zukunftskonferenz: Mit maßgeschneiderten Programmen schafft das Arbeitsmarktservice Kärnten neue Perspektiven für Frauen am Arbeitsmarkt und unterstützt zugleich die Wirtschaft mit Fachkräften.
Näheres auf ams.at/kaernten








