
7 minute read
Österreichs 6G-Forschung ist in allen Belangen state-of-the-art
by medianet
Wiewohl in Europa derzeit noch der 5GAusbau zentrales Thema ist, werkt dennoch ein europäisches Konsortium, bestehend aus führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich des Mobilfunks und der Nachrichtentechnik, an der technischen Machbarkeit von 6G. Maßgeblich daran beteiligt sind die österreichischen Unternehmen Technikon Forschungs und Planungsgesellschaft mbH (als Koordinator) und NXP Semiconductors Austria sowie das Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation der TU Graz. „Die Welt wird immer vernetzter. Mehr und mehr Daten müssen von immer mehr drahtlosen Geräten ausgesendet, empfangen und verarbeitet werden – der Datendurchsatz wächst. Im Horizon2020Projekt REINDEER widmen wir uns diesen Entwicklungen und erarbeiten ein Konzept, mit dem die Datenübertragung in Echtzeit praktisch ins Unendliche skalierbar ist“, so TU GrazForscher Klaus Witrisal, Experte für drahtlose Kommunikationstechnik.
Antennen als Wandfliese oder Tapete
Advertisement
Denn die Art der Antennen für die Datenübertragung werde sich ändern müssen; denkbar wären etwa Antennen als Wandfliese oder Tapete. Wie das gelingen soll? Witrisal erklärt den Ansatz: „Wir wollen eine sogenannte RadioWeavesTechnologie entwickeln – eine Art Antennengewebe, das an jedem Ort in beliebiger Größe installiert werden kann, etwa in Form von Wandfliesen oder als Tapete. So können ganze Wandflächen als Antennenstrahler fungieren.“
Bei bisherigen Funkstandards wie UMTS, LTE oder auch aktuell 5G erfolgt die Signalübertragung über Basisstationen – also eine
Horizon2020-Projekt REINDEER
Noch mehr Datenmengen noch schneller übertragen: Das ist das erklärte Ziel einer neuen Antennentechnologie, die im Horizon2020Projekt REINDEER (REsilient INteractive applications through hyper Diversity in Energy Efficient RadioWeaves technology) erarbeitet wird. Das Projekt REINDEER wird im Rahmen des EUProgramms Horizon2020 mit insgesamt 4,6 Mio. € gefördert. 600.000 € davon entfallen auf die TU Graz, wo das Projekt im „Field of Expertise Information, Communication & Computing“ verortet ist, einem von fünf Forschungsschwerpunkten der Universität.
© SAL
Thomas Lüftner (l.) und Pedro Julián (r.) freuen sich über die Zusammenarbeit.
Antenneninfrastruktur, die fest an einer Position verortet ist. Je dichter das Netz an ortsfester Infrastruktur ist, umso höher ist der Durchsatz (also jene Datenmenge, die in einem bestimmten Zeitfenster übertragen und verarbeitet werden kann). Diese Basisstationen stellen allerdings einen Flaschenhals dar: Je mehr drahtlose Geräte mit einer Basisstation verbunden sind, desto instabiler und langsamer ist die Datenübertragung. Mit der RadioWeavesTechnologie würde dieser Flaschenhals verschwinden, „weil wir anstelle eines einzigen Knotenpunktes beliebig viele Knotenpunkte einhängen können“, so Witrisal.
Echtzeit-Inventarisierung und grandioses Stadionerlebnis
Für das private Heim brauche es die Technologie freilich nicht, so Witrisal. Doch für industrielle und öffentliche Anlagen birgt sie
Projektpartner
c Technikon (Leadpartner, Österreich) c NXP Semiconductors Austria (Österreich) c TU Graz (Österreich) c BlooLoc NV (Belgien) c Ericsson (Schweden) c KU Leuven (Belgien) c Linkopings Universitet (Schweden) c Lunds Universitet (Schweden) c Telefónica Investigacion Y Desarrollo SA (Spanien) https://reindeerproject.eu/

Möglichkeiten, die weit über 5GNetzwerke hinausgehen. „Wenn in einem Sportstadion 80.000 Menschen, alle ausgerüstet mit einer Virtual RealityBrille, das entscheidende Tor zeitgleich aus der Perspektive des Torschützen anschauen möchten, ist das mit dem RadioWeavesAntennenfeld zukünftig möglich.“ Die Funkwellen würden zudem die drahtlose Energieversorgung der VRBrillen sicherstellen.
Auch in Industriehallen könnte die Technologie für eine noch nie dagewesene Abdeckung sorgen. Es wäre machbar, Tausende von Objekten in Echtzeit zu lokalisieren. Überhaupt sieht Witrisal große Chancen für die funkbasierte Ortungstechnologie – ein Forschungsschwerpunkt seiner Arbeitsgruppe an der TU Graz. Die Forschenden gehen davon aus, dass mit der RadioWeavesTechnologie Güter auf zehn Zentimeter genau geortet werden können. „Damit lassen sich dreidimensionale Modelle von Güterströmen realisieren – für die Produktion und Logistik bis hin zur erweiterten Realität auf der Verkaufsfläche.“
Das Forschungsprojekt ist Anfang 2021 gestartet. Bis 2024 möchte das Konsortium einen ersten HardwareDemonstrator entwickeln, um die RadioWeavesTechnologie experimentell validieren zu können. „6G wird erst Ende dieses Jahrzehnts spruchreif werden – doch dann wollen wir sicherstellen, dass der schnelle drahtlose Zugang dort ist, wo wir ihn brauchen, wenn wir ihn brauchen“, betont Witrisal. ◆
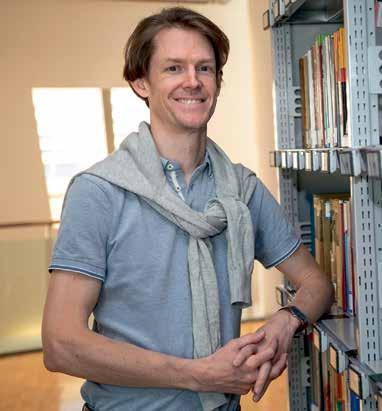
© TU Graz/Robert Frankl
„Unser Heer“ – innovativ – forschend – Zukunft sichernd
Wie das Bundesheer mit unterschiedlichsten Maßnahmen und einer Vielzahl an Projekten den Innovationsstandort Österreich stärkt.
Forschung und Entwicklung haben beim Österreichischen Bundesheer (ÖBH) eine lange Tradition. Das Nationale Verteidigungsforschungsprogramm FORTE und der European Defence Fund (EDF) bringen in diesem Forschungsfeld einen neuen und zusätzlichen Schub – und können langfristig auch zu einer Stärkung des Wissens- und Technologiestandorts Österreich im europäischen Innovationswettbewerb beitragen.
Im Jahr 2008 wurde die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des ÖBH evaluiert und auf neue Beine gestellt. Seitdem hat die zuständige Abteilung „Forschung und Rüstungspolitik“ für das Bundesministerium für Landesverteidigung die entsprechenden forschungsbezogenen Agenden des Bundesheeres auf nationaler und internationaler Ebene über und trägt unter anderem maßgeblich zur Fähigkeitsentwicklung der österreichischen Streitkräfte bei. Durch engen Kontakt zu den wichtigsten universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, zu Gremien wie dem Wissenschaftsrat oder der eigenen Wissenschaftskommission im Ministerium, aber auch zu Industrie und Wirtschaft, beobachtet und bewertet die Abteilung stets die neuesten Entwicklungen. Mit anderen Dienststellen im Verteidigungsbereich, wie beispielsweise dem Amt für Rüstung und Wehrtechnik, dem Cybersicherheitszentrum, der Landesverteidigungsakademie oder der Theresianischen Militärakademie setzt das Bundesheer auch intern zukunftsorientierte Forschung & Entwicklung in einer Vielzahl an Projekten um.
Forschung als strategischer Faktor
Forschung stellt für das Bundesheer einen zentralen Faktor dar. Sie ist nicht nur Treiber für die Innovationsfähigkeit der Organisation, sondern ist auch die notwendige und wichtige Grundlage für die Streitkräfte- und Fähigkeitsentwicklung. Die dabei unerlässliche Forschung folgt einem gesamtheitlichen Ansatz und findet nicht nur im technischen, sondern auch im sozial-, geistes,- und kulturwissenschaftlichen Wissensfeld statt. Dabei muss sich Forschung den Herausforderungen der Zukunft zielgerichtet stellen, um ihren Beitrag zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Organisation bzw. der Streitkräfte als „strategische Reserve“ der Republik im gesamten Aufgabenspektrum
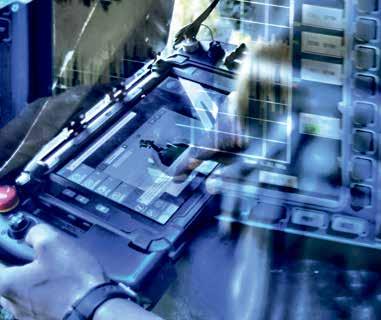
Facts & Figures*
Berufssoldaten: davon Soldatinnen: 15.456 642
Zivilbedienstete: 7.623
Soldaten und Soldatinnen in Auslandseinsätzen: ~1.000 Grundwehrdiener: 6.264 BMLV-Budget BVA 2021 in Mio. Euro: 2.522,393
* Stand 01.05.2021
BM für Landesverteidigung (BMLV)
Roßauer Lände 1, 1090 Wien Tel: +43(0)50201-0 buergerservice@bmlv.gv.at www.bundesheer.at
Schlüsseltechnologien Wehrtechnik 2030
c Künstliche Intelligenz
c Autonome Systeme
c Quantentechnologie
c Space Technology
c Biotechnologie
c Human Enhancement / Augmentation /
Modulation
c Materialwissenschaft & Nanotechnologie
c Neurowissenschaft
BMLV/Guenter Wilfinger ©

© Beganovic Amir © BMLV

Spitzentechnologie bei Österreichs Bundesheer: Der ferngesteuerte Bombenentschärfungsroboter „Theodor“ im Einsatz und der selbstfahrende Transportroboter in Erprobung.
des Bundesheeres zu gewährleisten. Dies inkludiert nicht nur, emergente Technologieentwicklungen und Trends rechtzeitig zu erkennen, sondern auch zukünftige Schlüsseltechnologien für das Bundesheer nutzbar zu machen.
Standort fördern – strategische Entwicklungen anstoßen
Im nationalen Umfeld stehen dem Österreichischen Bundesheer unter anderem das Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS und das Verteidigungsforschungsprogramm FORTE, die gemeinsam die sogenannte Sicherheitsklammer bilden, zur Verfügung. Während FORTE den Bereich der Wehrtechnik zur Unterstützung der militärischen Auftragserfüllung im Fokus hat, folgt KIRAS dem Dual-Use-Ansatz und stellt die zivile Komponente im nationalen Forschungsumfeld dar. Die nationalen Forschungsförderprogramme haben aber nicht nur zum Ziel, den Bedarfsträgern im öffentlichen Bereich – wie Ministerien, Behörden, Ländern, etc. – den Zugang zu zielgerichteten Forschungsergebnissen zu ermöglichen. Sie sollen auch die österreichische Industriebasis für die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene vorbereiten und somit den Standort Österreich sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Konkurrenzfähigkeit österreichischer Unternehmen im internationalen Umfeld stärken.
Auf europäischer Ebene wurde der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) etabliert, der die innovative, industrielle und wissenschaftliche Basis der europäischen Verteidigungsindustrie stärken und einen entscheidenden Beitrag zur strategischen Autonomie der EU leisten soll. Im Zeitraum 2021-2027 unterstützt der EDF mit insges. 7,9 Mrd. Euro Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die sich mit aktuellen Verteidigungsfragen und neuen Sicherheitsbedrohungen beschäftigen. Dadurch sollen strategische Entwicklungen in ausgewählten Industriesektoren angestoßen und eine bessere strategische Positionierung österreichischer Unternehmen im europäischen Umfeld erreicht werden.
ÖBH – ein starker und verlässlicher Partner für die Zukunft
Im Zuge zahlreicher Projekte und Vorhaben im nationalen und internationalen Umfeld konnte sich das ÖBH als starker und verlässlicher Partner für die österreichische Wirtschaft und Industrie etablieren. Allein in den letzten fünf Jahren wurden rund 300 Projekte umgesetzt und ca. 200 Partnern aus Forschung, Wirtschaft und Industrie in diesem Bereich rund 90 Mio. Euro an Fördermitteln zugänglich gemacht. Darüber hinaus wurden wesentliche technologische Fortschritte und innovative Lösungen für das ÖBH umgesetzt. Die enge Kooperation zwischen ÖBH und seinen Partnern bedeutet aber auch in Zukunft Chance und Herausforderung zugleich, denn die hochdynamischen Entwicklungen, beispielsweise in den Bereichen der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit oder der hybriden Bedrohungen, erfordern rasche, flexible und innovative Lösungen für ein zukunftsfittes Bundesheer und damit für ein zukunftsfittes Österreich.










