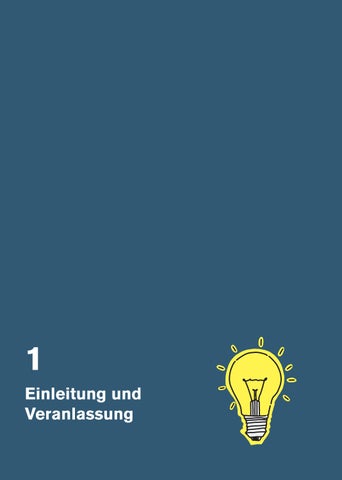Einleitung und Veranlassung
1. Einleitung und Veranlassung
Der Landkreis Regen liegt im Bezirk Niederbayern und ist eine der Kernregionen des Höhenzugs des Bayerischen Waldes entlang der Grenze zur Republik Tschechien. Der Landkreis deckt dabei recht unterschiedliche Landschafts- und Besiedlungsformen ab. Während im Westen eine offene, stark von der Landwirtschaft geprägte Kulturlandschaft anzutreffen ist, so ist der Osten durch dicht bewaldete Höhenzüge mit dem Nationalpark Bayerischer Wald geprägt. Insgesamt handelt es sich um einen sehr ländlichen Landkreis mit den Mittelzentren Regen, Viechtach und Zwiesel.
Wie jede andere Region in Mitteleuropa ist auch der Landkreis Regen maßgeblich von seiner Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte geprägt. Zahlreiche Kulturtechniken, die sich über die Jahrhunderte herausgebildet hatten, sind - so bedeutend sie auch für die Entstehung des heutigen Landschaftsbildes gewesen sein mögen - ökonomisch heute kaum oder sogar gar nicht mehr relevant. Der Verlust grundlegender Kulturtechniken bleibt nicht ohne Wirkung auf das Erscheinungsbild des Landkreises. Die ökonomischen Auswirkungen jedoch konnten zu einem nicht unerheblichen Teil durch andere Wirtschaftszweige - hier vor allem den Tourismus, aber auch die Ansiedlung von Industrie - abgefedert werden; in der Folge steht der Landkreis im Kern wirtschaftlich solide da. Der Wandel wirkt sich auch auf das Kulturerbe, und darunter sind sowohl die einzelnen historischen Bauwerke, aber auch Siedlungen und ganze Landschaftsbilder zu verstehen, entsprechend aus. Festzustellen ist dies vornehmlich am Nutzungsverlust von historischen Gebäuden, dem zumeist folgenden Leerstand sowie drohender Vernachlässigung. Doch auch Landschaftsbilder können sich verändern, wenn ein Wirtschaftszweig entfällt; Auswirkungen dieser Art sind zum Beispiel in der Landwirtschaft unschwer zu erkennen. Hinzu kommen ganz grundlegende Veränderungen in der Wertschöpfung, aber auch im täglichen Leben der Bewohner. Zu nennen sind hier Stichworte wie Landflucht, Überalterung, stark veränderte Versorgungswege oder technischer Fortschritt. Insgesamt ergibt sich aus diesen Gegebenheiten eine Situation, die das Potenzial hat, ganz gravierende Veränderungen für das gewachsene Erbe des Landkreises herbeizuführen.
Der Landkreis Regen hat den grundlegenden Vorteil, dass er ein sehr reizvolles und ansprechendes Landschaftsbild bereithält. Dies kann leicht dazu verführen, die durch die tiefgreifenden Veränderungen entstehenden Bedrohungen zu marginalisieren. Tatsächlich aber sind, trotz der grundlegend positiv zu bewertenden Grundstruktur, Missstände und Bedrohungen vielerorts festzustellen. Beispielhaft kann der Leerstand mit folgender Vernachlässigung in den Mittelzentren genannt werden oder aber der Verlust eines ganzen Wirtschaftszweiges von ganz zentraler kultureller und identifikatorischer Bedeutung, der Glasproduktion.
Der festgestellte Zustand war für die Verantwortlichen des Landkreises im Verbund mit dem Bayerischen Landesdenkmalamt Grund genug, Ideen zu entwickeln, wie dem drohenden Verlust von grundlegend prägenden gewachsenen Landschafts- und Siedlungsbildern entgegen gewirkt werden kann. Handlungsbedarf war schon früher festgestellt worden. Davon zeugen bereits aufgestellte lokale Entwicklungskonzepte.
Dazu zählt vor allem eine Reihe an „Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK)“. Zu nennen sind hier
2010 ILEK Zellertal (Drachselried und Arnbruck)
2014 ILEK Grüner Dreiberg (Bischofsmais, Rinchnach, Kirchberg im Wald und Kirchdorf im Wald) mit einer Fortschreibung im Jahr 2022
2018 ILEK Nationalparkgemeinden
2020 ILEK Donauwald
2023 ILEK Teisnachtal
2023 eine Neufassung des ILEK Zellertal von 2010 seit 2021 entwickeln die Nationalparkgemeinden ein Radwegekonzept.
2024 entsteht ein Burgenkonzept im Rahmen ILE Bayerwald
Denkmalpflegerische Erhebungsbögen zur Dorferneuerungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege liegen für folgende Gemeinden vor:
DEB Flanitz (Frauenau) 2012/13
DEB Oberried (Drachselsried) 2016/17
DEB Unterried (Drachselsried) 2016/17
DEB Gotteszell (Gotteszell) 1997
DEB Lindberg (Lindberg) 1999/2000
DEB Ludwigsthal (Lindberg) 2015/16
DEB Gehmannsberg (Rinchnach) 2012/13
Ferner gibt es für Viechtach Entwicklungskonzepte mit dem Schwerpunkt historische Bausubstanz:
2016 Kommunales Denkmalkonzept Stadt Viechtach gemeinsam mit der Städtebauförderung Niederbayern (KDK)
2019 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für Viechtach (ISEK)
Die Zahl der Konzepte lässt ausdrücklich auf den Handlungswillen der Beteiligten schließen; sie macht aber auch deutlich, dass Handlungsbedarf vorliegt. Nicht alle Konzepte waren in der Konsequenz auch erfolgreich; die Gründe hierfür waren vielfältiger Natur. Ein Beispiel ist das Auseinanderfallen der Gemeinschaft ILE Donauwald, aus dessen Sezession das ILEK Teisnachtal hervorging.
Das „Interkommunale Denkmalkonzept“ hatte schon einen Vorlauf, der im Jahr 2021 begann. Als Ergebnis wurde 2023 ein grobes Vorkonzept vorgestellt, bei dem der Fokus auf den „baulichen Hinterlassenschaften der Glasproduktion und -verarbeitung“ lag (Quelle: Landratsamt Regen: Leistungsbeschreibung zur Erstellung eines Interkommunalen Denkmalschutzkonzeptes 2024, S. 2).
Im Jahr 2024 schließlich wurde die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus dem Büro nonconform (Wien) und dem Büro winterfuchs für Bauforschung und Baukultur (Berlin) mit der Ausarbeitung des Interkommunalen Denkmalkonzeptes beauftragt. Bei der Bearbeitung handelt es sich um die Phase I eines als dreiphasig angelegten Gesamtprojektes. Die Phase I beschränkte sich auf die Beschaffung der Wissensgrundlagen und im Ergebnis auf die Herausarbeitung von rund acht konkreten Handlungsfeldern. Erarbeitet wurden im Rahmen der Phase I konkret
- Kurzer Abriss der Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte der Region
- Darstellung von Haus- und Konstruktionstypen
- Erfassung und Darstellung von baulichen Anlagen, die im Zusammenhang mit den historischen Kulturtechniken stehen
- Beschreibung der Kulturlandschaft mit den wesentlichen Elementen
- Image Map „Kultur-Erbe-Technik“
- Feststellung von Gefährdungslagen
- Sammlung zu vorbildhaften Projekten
- Festlegung von rund acht Handlungsfeldern
Zur Erarbeitung der Wissensgrundlagen erfolgte eine ausführliche Befahrung des Landkreises, die Sammlung und Sichtung von Literatur zum Landkreis und seinem kulturellen Erbe sowie die Installation und Anhörung eines „Wissenschaftlichen Beirates“ und eines „Arbeitsgremiums“.
Die Ergebnisse dieser ersten Phase werden in dem hier vorliegenden Dokument vorgelegt, bzw. wurden - wie die ImageMap - den Auftraggebern in digitaler Form (Q-Gis) zur Verfügung gestellt.
Die Phasen II und III waren nicht Bestandteil der Beauftragung. Sie werden sukzessive ausgeschrieben und beauftragt. In der Phase II werden Modellkommunen für die Handlungsfelder vorgeschlagen und konkretisiert, in Phase III sollen die erarbeiteten Handlungsvorschläge umgesetzt werden.
Die im Text angeführten Fallbeispiele sind - soweit möglich - mit Objektnummern versehen. Diese Objektnummerierung wurde im Verlauf der Befahrung des Landkreises über die mobile Q-Field-App vergeben; sie findet auch in der Image-Map in Q-Gis Verwendung und erlaubt eine schnelle Verortung. Überdies sind in der Image-Map weitere Informationen zu den Objekten hinterlegt.
2. Kurzer Abriss der Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte der Region
Literatur:
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns als Beitrag zur Biodiversität, 30 Innerer Bayerischer Wald, 2011
Zur Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte des ‚Inneren Bayerischen Waldes‘, zu dem der Landkreis Regen zählt, existiert eine große Zahl an Veröffentlichungen. Knappe Zusammenfassungen mit Auswertung dieser Quellen finden sich in den aufgeführten DEB‘s (Denkmalpflegerischen Erhebungsbögen zur Dorferneuerung). Auf diese wurde bei der Ausarbeitung maßgeblich zurückgegriffen.
Zur geografischen Abgrenzung des inneren Bayerischen Waldes ist den Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamttes für Umwelt zu entnehmen: „Der ‚Innere Bayerische Wald‘ umfasst die spät besiedelten bzw. in Nutzung genommenen Hochlagen des Bayerischen Waldes von der Regensenke bzw. dem ‚Vorderen Bayerischen Wald‘ bis zur Bayerischen Landesgrenze nach Tschechien. Im Norden schließt der ‚Oberpfälzer Wald‘ an, nach Osten setzt sich das Gebiet im Böhmerwald fort“.
Das Gebiet des Altlandkreises Regen (bis zur Gebietsreform 1972 mit Zusammenlegung mit dem Landkreis Viechtach umfasste dieser 26 Gemeinden) war Teil des „unwirtlichen, siedlungsfeindlichen Nordwaldes“ („silva nortica“, 853 n. Chr., DEB Flanitz 2012, 3), der erst vergleichsweise spät – nicht vor 1000 n. Chr. – besiedelt wurde. Als unbesiedeltes Wildland galt der Waldgürtel zwischen dem deutschen und dem böhmischen Siedlungsraum als Gesamtregion nach damaligem fränkischgermanischem Recht zunächst als Eigentum des Königs. Das Klima war rau, die Böden ertragsarm, die Lage abgelegen; die frühen Siedlungen der Zeit vor 1000 entstanden zunächst außerhalb dieser Region.