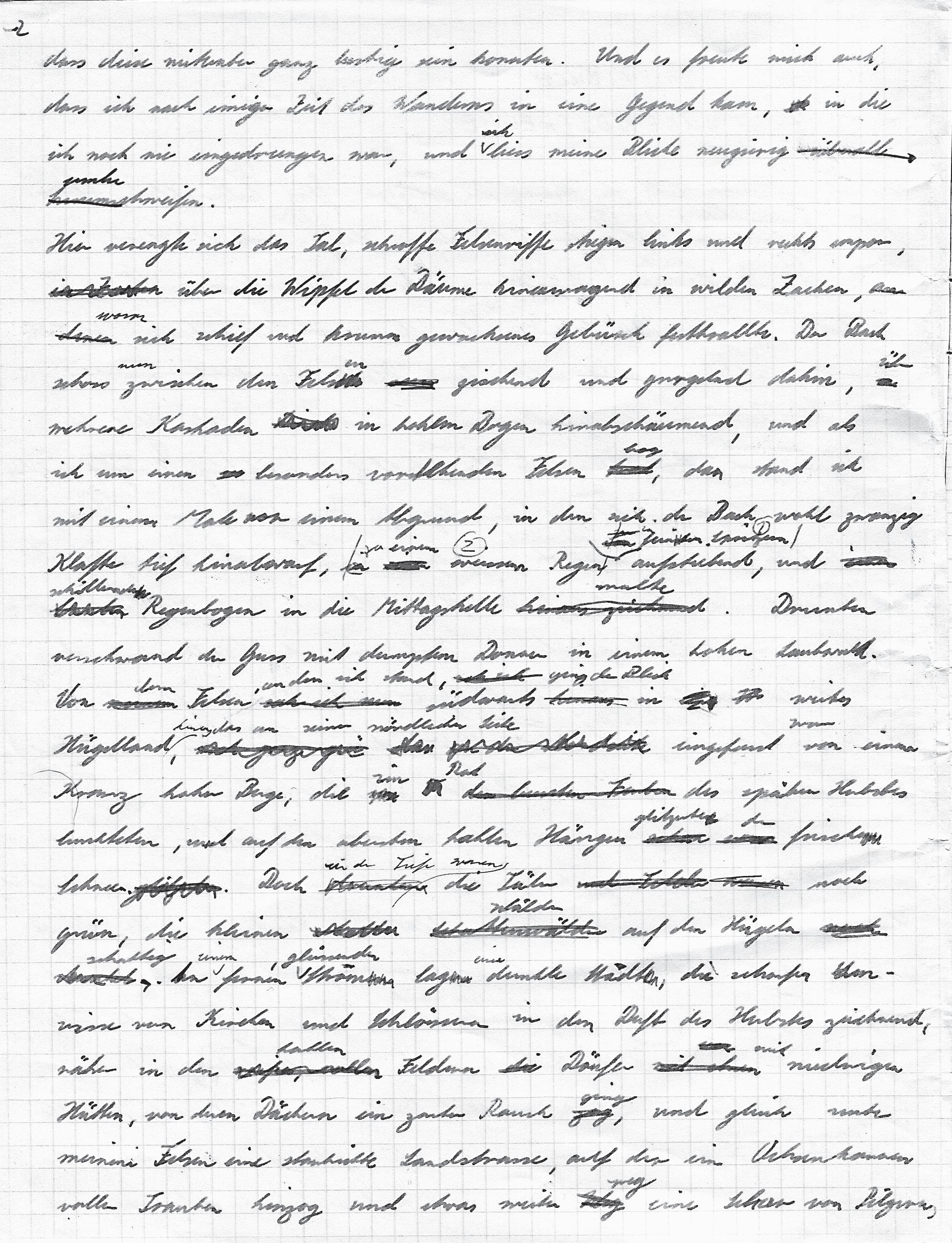Erstes Buch
8
Kinderzeit
Was meine Geburt betrifft, verhielt es sich nach den Erzählungen meiner Mutter so: An dem Tage von Nancy, als durch helvetischer Arme Kraft und den Witz Ludwigs des Unheiligen dem Burgunder aufs Haupt geschlagen ward, dass ihm der Lebensatem aus der Nase fuhr und der Teufel seine raffgierige Sache in die verdiente Hölle schleppen konnte – die Sippe meiner Mutter war damals gerade auf der Flucht vor dem Burgunder, da mein Oheim Scipione ihm das goldene Vlies gestohlen; und auf der Flucht hatten sie die Alpen überschritten und waren das Livinental bis Lavorgo hinabgezogen; da erfüllte sich die Zeit, dass meine Mutter gebären sollte, und weil mein anderer Oheim Silla und meine Urgrossmutter Lucrezia – sie lenkte damals, obwohl sie, wie sie selbst sagte, 243 Jahre alt war, die Geschicke der Sippe –, weil diese es aber für zu gefährlich hielten, dass der ganze Tross der Kindbette zuliebe längere Zeit raste, so wurden bloss meine Mutter und die alte Base Barbara in einer Höhle zwischen Lavorgo und Giornico zurückgelassen, in der, trotz des Feuers, das die Base mit eilig gesammeltem dürrem Holz entfachte, und trotz des schönen Wetters – denn über die kahlen Höhen ringsum spannte sich der Himmel in strahlender Klarheit –, doch in der Höhle, in der ich geboren wurde, dort wehte ein eiskalter Wind.
Über die Person meines Vaters konnte mir meine Mutter nie genaue Angaben machen. Bald nannte sie die klingenden Namen spanischer Zigeuner, bald einen fettleibigen elsässischen Strauchritter von grosser Trinklust und bescheidenen Geistesgaben, bald den Kardinal Wolsung; bei unserem letzten Zusam-
9
mentreffen sprach sie schliesslich von einem Basler Apotheker, dessen Namen sie nicht mehr anzugeben wusste, und fast bin ich geneigt aus Gründen, von denen noch zu berichten sein wird, dem am ehesten Glauben zu schenken.
Als nun die Base Barbara nach meiner Geburt nicht ohne Zufriedenheit festgestellt hatte, dass ich an Leib und Gliedern wohl geraten war, nachdem sie mich gewaschen und zum ersten Mal meiner Mutter an die Brust gelegt hatte, da eilte sie also dann ins Dorf Giornico hinab zum Pfarrer, damit ich getauft werde und wie anständige Leute einen Namen erhalte. Der Pfarrer willigte nach einigem Hin und Her ein, das Kind der Fremden zu taufen, sofern die Base bis zum nächsten Morgen eine Gotte und einen Götti auftriebe – doch die Base, einsichtig wie sie war, fand das sei so gut wie die Taufe verweigern und verliess das Pfarrhaus und das Dorf unglücklich und zornig. Ach, ach, rief sie aus, und das waren nicht ihre einzigen Klagerufe, soll er denn kein ehrlicher Mensch werden dürfen, der Kleine, nur weil der Pfarrer auf Gotte und Götti beharrt? O Himmel hilf! Und sie setzte sich an den Strassenrand, legte ihr Gesicht in ihre Hände und weinte bitterlich. Als sie nun aber aufstehen und sich die Nase schnäuzen wollte, da erblickte sie mit Staunen eine Frau, die unbemerkt vor sie hingetreten war und die zwar in sehr einfacher Kleidung ging, in Miene und Haltung aber etwas höchst Edles hatte. Mit mitleidigem Blick schaute sie auf die alte Barbara hinab und fragte sie mit einer wohlklingenden Stimme nach der Ursache ihres Kummers, und als sie Auskunft erhalten hatte, sprach sie: Nichts ist leichter, als dir zu helfen, Weib, ich bin die heilige Cäcilia, und wenn du dich aufmachst und selbst einen Götti findest, so will ich morgen euer Kindlein aus der Taufe heben. Und während die alte Barbara noch auf die Knie fiel und Dankgebete stammelte, entschritt sie dorfeinwärts, und ihre Gestalt umgab dabei ein milder Lichtschimmer, und ein unbeschreiblich süsser Duft erfüllte den Ort, wo sie eben noch gestanden hatte.
10
Mit neuer Zuversicht machte sich die Base nun auf den Weg, um meiner Mutter den halben Erfolg ihrer Bemühungen zu melden. Sie wollte eben den Kastanienhain betreten, in dem die Höhle lag, als es im Gebüsch am Wegrand raschelte und ein Mann daraus hervortrat. Er schien fremd in der Gegend, denn er schaute sich etwas unsicher um und machte Miene, die Base anzusprechen. Er war von mittlerer Grösse; ein weiter, grüner Mantel wallte ihm von den Schultern, und auf dem Haupte trug er ein grünsamtenes Barett. Seine Gesichtszüge waren markant, unter den buschigen Augenbrauen funkelte ein Paar schwarze Augen – und überhaupt hätte er für einen sehr schönen Mann gelten müssen, wenn er nicht auf dem linken Fuss merklich gehinkt hätte, ein Übel, dessen Eindruck durch den Gebrauch eines Stockes mit silbernem Knauf eher verschärft als gemildert wurde.
Wie, dachte die Base, wenn dieser fürnehme Herr sich dazu verstehen könnte, unserem Kleinen Gevatter zu stehen? Und ehe der Fremde noch etwas sagen konnte, fiel sie vor ihm auf die Knie und sprach flehentlich: Signore, habt Mitleid mit einer alten Frau! Worauf der Signore die Base aufforderte, ihm ihren Kummer zu berichten, und als er nach Ursachen und Nebenumständen hinlänglich Auskunft erhalten hatte, sagte er: Es ist zwar nicht meine Gewohnheit, bei dergleichen Anlässen zu assistieren, Alte – und dabei zuckte ein etwas sonderbares Lächeln um seine Mundwinkel –, aber da du es so dringend bedarfst, kann ich es wohl einmal versuchen. Und während die Base noch ihre dankbaren Segenswünsche stammelte, schritt auch er gegen das Dorf hin, und die Base erzählte später immer nicht ohne Befremden, dass ihr dabei ein Geruch in die Nase gestiegen sei, als ob der Signore einen sehr kräftigen Wind hätte entweichen lassen.
So kam die Stunde heran, die die alte Barbara mit dem Pfarrer abgemacht hatte. Meine Mutter hatte entschieden, dass ich
11
Lotario getauft werden sollte nach ihrem Vater, der in Flandern aufs Schafott gebracht worden war, weil er den Kirchenmäusen von Gent das Sprechen beigebracht hatte. Dieser Name ist mir durch mein ganzes Leben hindurch treu geblieben, und nicht wie die andern, die mir zu tragen zufielen, nach kurzer Zeit wieder entlaufen wie eine halbwilde Katze; wenn ich zu mir selber sprach, habe ich mich nie anders angeredet und auch meine Gotte und mein Götti haben nur diesen meinen Taufnamen gebraucht, wenn sie sich mir zeigten.
Meine Mutter und die Base Barbara, die mich in den Armen trug, stiegen also in das Dorf hinunter. Vor der Kirche warteten bereits der Pfarrer und meine beiden Paten. Als man nun aber miteinander in die Kirche hinein gehen wollte, da geschah etwas Sonderbares. Mein Götti, der eben noch mit festem Schritt vorangegangen war, geriet auf der Kirchentreppe ins Stolpern und stürzte so unglücklich, dass er das rechte Hosenbein aufschlitzte und sein Knie elendiglich zerschürfte. Darüber lamentierte er heftig und setzte sich auf die Treppenstufen, beteuernd, in diesem Zustande könne er unmöglich bis zum Taufstein gehen und dort eine respektable Figur machen. Ach, Signore, rief da die alte Barbara entsetzt, Sie wollen doch nicht etwa unsere ganze Taufe zuschanden machen, wo wir uns doch alle schon so gefreut hatten? – Und sie begann sogleich wieder zu schluchzen.
Wie meine Mutter mir erzählt hat, brach ich in diesem Augenblick ebenfalls in Tränen aus und schrie dabei so jämmerlich, dass es den Pfarrer erbarmte und er vorschlug, die Taufe zur Not unter freiem Himmel vorzunehmen, wogegen denn niemand etwas einzuwenden wusste. Meine Mutter behauptete später oft, dass meine Gotte meinen Götti damals ganz eigentümlich angeblickt habe und dass es auch verwunderlich gewesen sei, wie mein Götti, sobald der Pfarrer in die Kirche gegangen, um das Taufgeschirr zu holen, sich erhoben und fortan keine Zeichen von Schmerz mehr gezeigt habe.
12
So wurde ich denn eben getauft, etwas unordentlich zwar; draussen vor der Kirche, auf den treuen Namen Lotario, und die heilige Cäcilie und der wunderliche Edelmann assistierten dabei überaus manierlich. Der anschliessende Taufschmaus war bescheiden: Die alte Barbara hatte einen Laib Brot besorgt, von dem sie austeilte, und mein Götti zog eine Flasche Wein aus der Tasche; besonders der Pfarrer sprach dem Rebensaft wacker zu, sodass er ganz rote Backen bekam. Die heilige Cäcilie schenkte meiner Mutter ein silbernes Halskettchen, worauf mein Name eingraviert stand, und nahm ihr das Versprechen ab, es mir nicht vor meinem siebenten Geburtstag umzulegen, und mein Götti schärfte ihr ein, besonders in den Neumondnächten auf mich aufzupassen und versprach, wenn es mir im Leben einmal übel ergehen sollte, hülfreich zur Stelle zu sein. Und nach vielen Glückwünschen und Dankesreden trennte sich die Gesellschaft.
Meine Mutter und die alte Barbara begaben sich zu ihrer Höhle zurück, um auszuruhen, denn schon am nächsten Tag wollten sie der Sippe nachreisen, die nach dem Langensee hinübergezogen war. Über den Verlauf der folgenden Wanderung war allerdings später von meinen Onkeln und Tanten nichts Genaueres mehr in Erfahrung zu bringen; die Sippe meiner Mutter lief offenbar ständig vor der Nachricht vom Ausgang des Treffens von Nancy her, in steter Angst vor den Häschern des Herzogs Karl, der da doch schon lange tot und begraben war. Erst in einem weit abgelegenen Waldtal fanden sie zur Ruhe, einem verwunschenen Orte, dessen Zugänge alle von Brombeerhecken dicht überwachsen war, seit Jahrzehnten hatte ihn wohl niemand mehr betreten. Das ganze Jahr floss hier ein klarer, kühler Bach, an dem vormals eine einsame Mühle gestanden hatte, die nun längst verfallen war. In ihren Trümmern schlug unsere Sippe das Lager auf – denn so beschloss es meine Urgrossmutter Lucrezia. Es war dies gewisslich das elendeste Lager, das ich von den vielen Lagern in unserem Leben zu Gesicht
13
bekommen, den Winter durch nährten wir uns kümmerlich von Flechten und kleinen Waldtieren, die wir roh verzehren mussten – denn Feuer durften wir keines anzünden, um uns nicht durch den Rauch den Häschern Karl des Herzogs zu verraten. Sommers dann ging es schon üppiger zu, schlemmten wir mit den Beeren des Waldtals – das Tal verlassen durfte beim Sammeln natürlich keiner, damit nicht etwa die Häscher des Herzogs Karl ihn aufgriffen. Zum Glück gesellte sich im ersten Jahr nämlich eine junge Ziege zu uns, die sich offenbar verlaufen hatte, nur mit Mühe gelang es meinen Oheimen Silla und Scipione, die Urgrossmutter Lucrezia davon abzuhalten, das Tier unverzüglich zu schlachten, da sie fürchtete, sein Gemecker könnte die Häscher des Herzogs auf unsere Spur lenken. Meine Urgrossmutter war ja damals – ich sagte es schon – 243 Jahre alt, und der Gedanke, von den Burgundern verfolgt zu werden, grub sich in ihrer Seele immer tiefer und fester ein, sodass er bald einziger Antrieb ihrer Handlungen und alleinige Richtschnur ihrer Entschlüsse war. Zumindest erschien uns das so, doch wagte kaum je einer ihr zu widersprechen, denn ihre Weisheit war noch in ihrer zunehmenden Verfinsterung unermesslich. Die Ziege indes wurde immerhin gerettet, und mit ihrer Milch bin ich zu einem grossen Teil aufgezogen worden. Jahre später, als ich bei Temistocle Maroni in die Lehre ging, las ich in den Historien des Herodot von Halikarnassos, wie die Tyrrhener in einer grossen Hungersnot Erfinder der Spiele wurden: Abwechselnd assen und arbeiteten sie den einen Tag und fasteten und ruhten den andern, und um sich währenddessen vom Knurren ihrer Bäuche abzulenken, erfanden sie das Würfelspiel. Nicht viel anders war unser Leben in jener zerfallenen Mühle, tagsüber Suche nach Kräutern und Beeren und abermals Zusammensitzen in der kalten Finsternis. Wie die Tyrrhener ihren knurrenden Bauch hatten wir unsere Angst: vor der Finsternis, vor dem nächsten Tag und vor den Häschern des
14
Herzogs Karl, und damit wir unsere Angst weniger fühlten, erzählten uns die Onkel und Tanten, seltener auch die Urgrossmutter Lucrezia selbst, Geschichten aus der ruhmreichen Vergangenheit unserer Familie, teils was sie selbst erlebt hatten, teils was ihnen erzählt worden war. Jede einzelne dieser Geschichten habe ich mehr als einmal gehört, und obwohl ich noch sehr klein war, als unsere Sippe zerstreut wurde, erinnere ich mich an manche noch so genau, als ob ich sie selber erlebt hätte.
Da war zunächst die Geschichte von meinem Grossvater mütterlicherseits, dessen Erbe mein Name war. Ihn hatte, nachdem er lange Jahre mit der Sippe durch die Welt gezogen war, das Verlangen nach Wohlstand und Sesshaftigkeit ergriffen, und er war deshalb in ein Kloster in Genf eingetreten. Als er nun in jenem Kloster seit einiger Zeit Beichten hörte und Absolutionen erteilte, fiel ihm auf, dass zu den Beichtstunden eines jüngeren Ordensbruders mit Namen Candidus die Gattin eines der vornehmsten Ratsherren der Stadt immer öfter kam. In den Beichtstühlen der hohen, dunklen Kirche, die nach nordischer Art in barbarischem und gotischem Stil gebaut war, waren nun in der Regel Beichtiger und Beichtender weniger durch hölzerne Wände als durch den Anstand getrennt; und als mein Grossvater sich zufällig einmal hinter einer Säule in der Nähe von Bruder Candidus’ Beichtstuhl aufhielt, bemerkte er, dass diese Beichte, was Länge und Vertraulichkeit anbetraf, jegliches Mass überschritt, ja am Ende Sünde, Beichte, Busse und Vergebung in ganz unerlaubter Weise ineinander übergingen. Es geschah einige Zeit danach, dass Bruder Candidus sich beim Frühgebet erkältete und mein Grossvater vom Abt den Auftrag erhielt, seine Beichtstunden zu übernehmen.
Mein Grossvater wusste, wann er die Ratsherrin zu erwarten hatte; er ging zuvor noch in den Ossan, sich eine knöcherne Totenhand zu besorgen, die er sorgsam im hintern Ärmel seiner
15
Kutte verbarg. Alsbald erschien die Ratsherrin. Da es in der Kirche sehr düster war und mein Grossvater die Kapuze über den Kopf gezogen hatte und er seine Stimme verstellte, hielt sie ihn für ihren Candidus und begann in der gewohnten Weise zu berichten. Jetzt streckte mein Grossvater aber die Totenhand aus seinem weiten Ärmel hervor und begann mit dieser der Ratsherrin jene Zärtlichkeiten zu erweisen, die sie sich von Candidus so gern hatte gefallen lassen. Welches war aber nicht ihr Schrecken, als sie auf ihrem nur von einem dünnen Schleier bedeckten Busen die Knochenhand fühlte: Hellauf schrie sie und fiel in Ohnmacht, meinend, dass der bleiche Tod selber gekommen sei, sie zu holen. Mein Grossvater aber nutzte den Augenblick und entschwand. Ob der Schrecken bei der Ratsherrin eine dauerhafte Besserung zeitigte, wussten meine Onkel am Ende der Erzählung jeweils nicht anzugeben.
Eine andere Geschichte, die wir, trotz ihrer für uns alle fatalen Folgen besonders lieb hatten, handelt davon, wie mein Oheim
Scipione dem Burgunder das goldene Vlies stahl. Wohl zwei Dutzend Mal hat der Oheim sie selbst erzählt, und wunderbar war es dabei, wie er sich jedesmal, wenn er sie vorbrachte, an mehr und erstaunlichere Einzelheiten zu erinnern vermochte. Von der homerischen Breite seiner Erzählung kann meine in schwindendem Lichte des Lebens rasch dahineilende Feder nur einen schwachen Abglanz geben; auch kürze ich wohlweislich meine Erzählung, denn da heute durch das Verdienst mutiger Männer die Welt so noch grösser wird, wird dem Leser die Zeit immer kürzer – o jener göttliche Florentiner besang noch in hundert Liedern das ganze Weltgebäude mit all seinen Fackeln und Finsternissen: Ein Fünklein Helles und ein Flecklein Schwarz mischen die Heiligen noch in ihren Sonetten zusammen. Aber ich schweife ab. Mein Onkel berichtete Folgendes:
In jenen Tagen nächtigte der Herzog in einem flandrischen Schloss, dessen Namen auszusprechen Scipiones welscher Zun-
16
ge von Jahr zu Jahr schwerer fiel. Dieses lag an einem Fluss, und an demselben Fluss stand auch die Herberge, welche mein Oheim an einem Herbstabend kurz nach dem Einnachten zu erreichen suchte. Es hatte in den Tagen zuvor reichlich geregnet, und die Wege waren an manchen Stellen von tiefen breiten Gumpen unterbrochen, und an einem von diesen – es war ein besonders grosser, nahezu ein Teich, der mit seinem trüben Wasser quer über die Strasse ging –, dort traf Scipione auf ein altes Weiblein, das ihn anflehte, er möge sie doch hinübertragen. Da mein Onkel ein gefälliger Mann war und das Weiblein klein und dürr schien, lud er es linksseitig auf seine Schultern und begann in den Teich hineinzuschreiten. Das Weiblein wurde aber bei jedem Schritt schwerer, und immer tiefer sank Scipione in den Schlamm des Grundes ein, und kurz bevor er die andere Seite erreichte, blieb sein rechter Schuh im Schlamm stecken. Scipione liess sich davon nicht beirren, watete aus dem Teich hinaus und lud das Weib ab, welches sich mit einem Strom heiteren Ruhms bedankte und danach lachend im dunklen Walde verschwand. Dann legte er rasch das noch verbliebene Stück Wegs zu der Herberge zurück.
Dort herrschte, als er ankam, gerade lebhafter Betrieb, denn der Wirt empfing eine Reisegesellschaft von Amsterdamer Bürgern. Scipione trat dennoch zu ihm und bat ihn um ein Nachtlager.
Nun, könnt Ihr zahlen?, fragte der Wirt und musterte meinen Oheim misstrauisch, da ihm der Mann mit nur einem Schuh nicht gerade vertrauenerweckend vorkam.
Nein, antwortete Scipione, der wie immer kein Geld hatte, aber Ihr könnt meinen Schuh haben, denn einer allein nützt mir nichts.
Einer der Amsterdamer Herren lachte, als er das hörte und sagte: Das ist die Ungerechtigkeit der Welt; dieser Mann muss seinen Schuh hergeben, um ein Nachtlager zu bekommen; aber
17
der Herzog trägt eine Kette um den Hals, von der ein einziger Ring wohl so viel wert ist wie dieser ganze Gasthof.
Verwundert fragten ihn alle, was er meine, und er gab die Auskunft: Die Ordenskette der Ritter vom goldenen Vlies, welche der Herzog trage, sei von massivem Gold und könne doch mit ihrem ganzen Gewicht den Hochmut in der Brust des jungen Mannes nicht bezwingen und dass der Herzog in einem Schloss eine halbe Wegstunde fussabwärts von der Herberge übernachte.
Der Wirt wandte sich aber wieder zu meinem Oheim und sagte: Was soll ich mit einem Schuh? Ein Stück altes Leder für mein gutes Nachtlager? Geht, hinter der Scheune habe ich eine Scheiterbeige, dort könnt Ihr schlafen.
Scipione erzürnte diese Rede, und er sprach mit Festigkeit: Wirt, damit du siehst, mit wem du es zu tun hast, ich kaufe dir den Gasthof ab.
Ei, lachte der Wirt, und mit was will der Haberecht mir bezahlen? Mit der Kette von Herzog Karl etwa?
Du sagst es, Wirt, antwortete mein Onkel, bevor es tagt, sollst du sie in den Händen halten.
Hoho, rief da der Amsterdamer, dieser Mann ist verwegen, aber ein Spass wäre es doch, wenn er den fürstlichen Prasser unbemerkt um etwas erleichtern könnte: einen guten Zobel schenk ich ihm obendrein, wenn er’s schafft.
Alle lachten, und der Wirt wies meinen Oheim zu einem kleinen Nachen, der am Ufer hinter der Herberge angebunden war und mit dem er zum Schloss des Herzogs hinabfahren konnte. Der Wirt war wohl, als er das tat, wie die Wirte oft zu abendlicher Stunde, nicht mehr ganz nüchtern, und der Amsterdamer Herr ohnehin lachlustig und zum Übermut geneigt; aber ich will der Erzählung meines Oheims nicht vorgreifen. Nur ein Windlicht mit einer Kerze bat sich Scipione noch aus, dann setzte er sich in den Nachen und liess sich den
18
Fluss hinabtreiben. Bald schon tauchte vor ihm das graue Gemäuer des Schlosses aus der Nacht; der Mond malte durch die ziehenden Wolken wunderliche blaue Bilder auf die Wälle und Türme, die aus dem schwarzen Fluss hoch in den unruhigen Himmel ragten.
Der Wald rauschte im Wind, aber die Burg lag so still wie menschenöde, niemand bemerkte Scipione, als er herankam, bis er so dicht an den Wällen war, dass ihn von den Türmen aus niemand mehr sehen konnte. An einer Stelle öffnete sich hier die Mauer zum Fluss: Ein Tor tat sich auf, an der wohl Wasser geholt und Geschirr gespült wurde. Hierhin steuerte Scipione seinen Nachen, vertäute ihn an einem Mauervorsprung und verliess ihn, nur sein Windlicht mit sich nehmend. Hinter dem Wassertor führte eine Treppe ins Burginnere hinauf. Scipione folgte ihr lautlos bis zu einem ersten Absatz. Da tat sich plötzlich hinter ihm eine Tür auf; erschrocken fuhr er herum. Er sah in einen hohen, nur von Kohlenglut in einem Kamin erleuchteten Raum, vielleicht die Küche. In der Tür stand eine junge, nur leicht bekleidete überaus hübsche Küchenmagd. Sie schien nicht weniger erschrocken, auf Scipione zu stossen als dieser, ertappt zu sein.
Guten Abend, Küchenmagd, sagte mein Oheim schliesslich; möge das Feuer in deinem Ofen niemals ausgehen.
Guten Abend, Nachtdieb, erwiderte sie, beruhigt über die freundliche Anrede, möge deine Kerze niemals erlöschen.
Der Fortgang des Gesprächs – sie traten dazu auf Drängen meines Oheims in die Küche – nahm bald einmal Formen an, die zu berichten keinem gebildeten Autor und anzuhören keinem gebildeten Publikum ziemt. Darüber hinaus erfuhr Scipione, dass Herzog Karl ebenso gut wie andere edle Herren wusste, wozu Hausmägde auch noch taugen und dass sie sich deshalb auf allerhöchstem Befehl noch hier befinde; ferner dass der Herzog seinen Orden auf einem Schemel neben seinem Bett
19
aufbewahre, da er des Goldes angenehmen Glanz in seinen schlaflosen Stunden nicht missen wolle. Es gelang Scipione, die Magd, die übrigens Mathildis hiess, mit mancherlei Versprechen dazu zu überreden, diese Nacht dem Herzog, wenn er fest eingeschlafen wäre, das goldene Vlies von dem Schemel zu stehlen und zusammen mit ihm, Scipione, aus der Burg zu flüchten. So geschah es.
Im Morgengrauen langte mein Oheim mit Mathildis wieder bei dem Gasthof an, wo er aber bloss den Wirt aus den Federn rüttelte, ihm die Kette des goldenen Vlieses in die Hand drückte und sich dann mit Mathildis nach dem Lager unserer Sippe aufmachte. Als meine Urgrossmutter Lucrezia dort von der Tat ihres Enkels erfuhr, verfügte sie die sofortige Flucht nach Süden; dabei musste allerdings nach einiger Zeit Mathildis, die das Reisen weniger gut vertrug als die Frauen der Sippe, krank in einem elsässischen Kloster zurückbleiben, sie war nämlich schwanger. Zum Abschied schenkte Scipione ihr den kleinen goldenen Widder, der an des Herzogs Kette gehangen hatte. Wie recht Lucrezia übrigens hatte, die Häscher Karls des Kühnen zu fürchten, erfuhr ich erst viel später: Der Wirt, in dessen Haus man schon am nächsten Tage das Gold gefunden hatte, wurde nach einem raschen Hofgericht aufs Rad geflochten, sein Gasthof niedergebrannt. Der Amsterdamer, der noch jung und kräftig war, kam auf die Galeeren.
Freilich bestanden unsere gesellschaftlichen Unterhaltungen in der zerfallenen Mühle nicht bloss in Geschichten von der Tat, die sich vielleicht wenig für die Ohren von uns Kindern eigneten. Vielmehr waren die Frauen der Sippe, allen voran die Base Barbara und die uralte Lucrezia, reich an Kinderreimen und Geschichten, denen meine Vettern und ich, der ich der Jüngste war, immer wieder wie verzaubert zuhörten. Was meine Vettern angeht, so muss ich hier bemerken, dass sowohl Silla als auch Barbaras Bruder, der mürrische Balbo, mehrere Kinder hatten,
20
von denen ich aber, vielleicht gerade der stattlichen Zahl halber, nur in wenigen Fällen Namen und Gesichter im Sinne behalten habe. Am ehesten erinnere ich mich noch an Sillas Ältesten, den alle Gigi nannten und den ich sehr viel später in der Person des Marchese Strofinacci wiedererkennen sollte; ferner an Sillas Jüngsten, der am meisten mit mir zusammen spielte, und einer der Söhne Balbos, Marfiro mit Namen, welcher ebenso schweigsam war wie sein Vater, wenn auch in einer heiteren Art, die ihn viele Jahre später nach einem wildbewegten Künstlerleben in die Fussstapfen meines leiblichen und namenmässigen Grossvaters treten und Geistlicher werden liess. Aber auch an diese beiden erinnerte ich mich wohl kaum so deutlich, wären sie mir nicht in entscheidenden Augenblicken meines Lebens wiederbegegnet.
Oft am späteren Nachmittag versammelten wir uns mit unseren Brüdern und Schwestern um die alte Base, während sie Beeren ablas oder alte Lumpen sehr geschickt mit Gräsern zu immer neuen Gewändern zusammenflickte; dann bettelten wir sie an, sie möge uns wieder eine von jenen Geschichten erzählen, die wir alle schon längst auswendig kannten und nichtsdestoweniger immer wieder hören wollten; und die alte Base begann dann meist wirklich zu erzählen, zum Beispiel in der folgenden Weise:
Es war einmal ein Zauberer, der lebte in einer schwarzen Burg dicht über den steilen Klippen am Meer. Es war aber ein böser Zauberer, und deshalb sann er auf Unheil für die Seeleute, die an seiner Burg vorbeisegelten, um für ihren König Aloe und Myrrhe, Ebenholz und Elfenbein, Rubinen und Smaragde aus dem glücklichen Arabien zu holen. Mit erbittertem Herzen hörte er ihre Rufe, wenn sie einander anwiesen, der tobenden
Gischt von den Klippen auszuweichen.
Deshalb lauerte er einmal der schönen und sangeskundigen Tochter der Fee Pantialeia auf, als sie an einem Maimorgen über den Distelberg ging, um vierblättrige Kleeblätter auszu-
21
streuen. Er näherte sich ihr in Gestalt einer Schnake, betäubte sie mit giftigem Stich und entführte sie auf seine Burg. Dort nahm er ihr die Seele weg und tat diese in einen Tonkrug, den er im untersten Kellergewölbe seines Schlosses verbarg. Dann machte er eine grosse Seifenblase und hängte sie an einer Eisenrute vom Burgfried über das Meer hinaus. Dort hinein sperrte er das Feenmädchen und gab ihr einen Spinnrocken in die Hand, damit sie aus Schicksal Unheil spönne, und nun musste sie singen, wann immer ein Schiff im Meer unten vorbeifuhr. Das klang so wunderbar, und ihre Goldhaare leuchteten so herrlich dazu, dass die Seeleute das Steuer vergassen, um nur zu schauen und zu hören, und so wurden die Schiffe von den Wirbeln des Meeres erfasst und gegen die Klippen geschleudert, dass die Matrosen alle jämmerlich zugrunde gingen. Ihre Knochen sah man bald ausgebleicht auf den untersten Felsen liegen, denn eine Schar von nackthalsigen Geiern siedelte sich auf der Burg an und nährte sich von den zerschellten Leichen. Es war aber auf einem jener Schiffe auch ein Schiffsjunge, der hiess Niccolo. Erst ganz neulich fuhr er zur See und hatte noch nie geflucht. Während nun die anderen Matrosen, als der Segler scheiterte, von den schäumenden Strudeln in die grünen Tiefen gerissen wurden, wurde Niccolo alleine von einer seltenen Welle sanft gehoben, fortgetragen und auf dem Felsen abgesetzt.
Auf einmal fand er sich da umringt von Geiern, die ihn, den Anblick Lebender nicht gewohnt, neugierig anstierten. Da bekam er Angst, denn er war allein, und um der unheimlichen Gesellschaft zu entfliehen, begann er, an den Felsen hochzuklettern.
Da erhob sich aber die Geierschar, mit den Flügeln zischend, in die Lüfte, und sie kreischten alle durcheinander: Packt ihn! Packt ihn! Immer enger umkreisten sie ihn und streiften ihn mit dem beissenden Wind ihrer Schwingen.
22
Da hörte Niccolo es auf einmal hinter sich flüstern: Keine Angst! Keine Angst! Kriech mir ins Nasenloch, da bist du sicher! Erstaunt sah er sich um, konnte aber niemand sehen. Deshalb fragte er zaghaft: Wer spricht mit mir? Dumpf und leise kam die Antwort: Ich der Berg, der Berg! Und tatsächlich bemerkte Niccolo nun neben sich eine ansehnliche Lücke im Gestein, wo er schnell hineinschlüpfte. Da aber die Geier draussen weiter lärmten und er sich immer noch fürchtete, kroch er immer tiefer in die Höhle hinein, die sich vor ihm auftat, und als er so weit gekommen war, dass er die Vögel nicht mehr lärmen hörte, da sah er schon ein Stück heiteren Tag über sich. So kletterte er eilig weiter, um wieder ins Freie zu gelangen.
Wie staunte er aber, als er sich oben plötzlich in einem wüsten Wald befand, in dem er bloss sehr fein das düstere Gemäuer der Burg zwischen den Stämmen sehen konnte. Dann machte er sich auf den Weg zur Burg, denn dort zumindest vermutete er Menschen, die ihm helfen konnten. Immer dichter wurde aber der Wald, und endlich blieb Niccolo an einem dornigen Ast hängen, dann merkte er es zu spät, und als er sich umwandte, war der Ast bereits abgerissen, und schwarzes Blut quoll aus der Bruchstelle.
Du armer Baum!, rief Niccolo da.
Und: Oh weh!, rief da auch der Baum. Was quälst du mich? Lass mich doch wenigstens ruhn und mach nicht mein Unglück noch grösser.
Es tut mir ja auch sehr leid, antwortete Niccolo ihm. Doch sag, lieber Baum, weshalb bist du so unglücklich?
Da seufzte der Baum und sprach: Nicht immer war ich ein Baum: Geboren wurde ich als Erbprinz von Cipanga, doch ich verliebte mich vom Hörensagen in die schöne und sangeskundige Tochter der Fee Pantialeia. So machte ich mich auf und fuhr durch viele Völker und Meere, bis ich hierherkam; denn ich wollte sie von dem bösen Zauberer befreien, der sie gefangen
23
hält. Aber er war stärker als ich und hat mich in diesen Baum verhext: Alle Bäume, die du hier siehst, waren einst tapfere Prinzen, denen es ergangen ist wie mir.
Und da schien es Niccolo, als nickten die Bäume ringsum traurig. Ach, fragte er deshalb, gibt es denn kein Mittel, sich gegen den bösen Zauberer zu schützen?
Aber da hörte er es mit einem Mal in einem Gebüsch zu seinen Füssen aufgeregt zwitschern, und als er sich niederbeugte, sah er einen kleinen Vogel, der sich im dornigen Gestrüpp verfangen hatte und unaufhörlich rief: Mach mich frei, mach mich frei! Sorgfältig löste Niccolo das Tierlein aus dem Gezweig, und kaum hatte er es befreit, da schlug es schon mit den Flügeln und schoss zwitschernd hoch empor über alle Wipfel des Waldes.
Nun fasste sich Niccolo ein Herz, ging mutig weiter und kam endlich zu der Burg. Um die lief aber ein tiefer Graben, und nur eine Ziehbrücke führte darüber, welche an festen Seilen hochgezogen war. Doch da wurde in der Luft ein Schwirren und Zwitschern laut: Ein Schwarm von tausend kleinen Vögeln kam durch die Luft gezogen; sie stürzten sich alle sogleich auf die Seile, pickten so lange daran, bis sie zerrissen und die Brücke krachend niederging. Staunend ging Niccolo da hinüber und durch das Tor in den düsteren Hof der Burg. Diese fand er leer und rings von hohen Mauern umschlossen, nur an der Seite zum Meer hin ragte der Burgfried auf, dessen schweres Eisentor jedoch verschlossen war.
Zieh mich heraus, zieh mich heraus, hörte er da plötzlich am Boden wispern. Er sah hinab und erblickte unter dem Unkraut, das den Boden des Hofes bedeckte, ein Büschel Gras, das sich vorstehend bewegte, obwohl kein Wind war. Da packte Niccolo es mit der Hand, zog es heraus, und siehe, da war es ein Alräunchen ganz wie ein Rüebli gestaltet, hatte aber Arme und Beine und ein runzeliges Gesicht, über dem sich der üppige grüne Haarschopf gar lustig ausnahm.
24
So ging Niccolo zu dem Tor des Bergfrieds, und kaum hatte er mit dem Alräunchen das Schloss berührt, da sprang das schwere Tor von selber auf und liess Niccolo hinein. Der Turm war innen ganz finster, nur die Treppe herab, die in die oberen Stockwerke hinaufführte, kam etwas Licht. Deshalb stieg Niccolo da hinauf und kam zuletzt auf der obersten Plattform des Turmes zu der Eisenrute mit der Seifenblase, in der die Feentochter noch immer sponn und sang.
Sieh, sagte da das Alräunchen, hole die Eisenrute herein, dann zerspringt die Seifenblase und das schöne Feenkind wird dein. Aber vergiss das Beste nicht. Doch als Niccolo dem Alräunchen gehorchen wollte, da hörte er es hinter sich brüllen. Er drehte sich um, und da stand ein gewaltiger Bär, der schon die Tatze erhoben hatte, um ihn zu schlagen. Dieser Bär war der böse Zauberer, der zuerst immer in dieser Weise erschien, um seine Feinde zu erschrecken; wenn sie dann ihr Schwert zückten, um ihn niederzustossen, verwandelte er sich in eine Fliege und schwirrte so lange um den Feind herum, ohne sich fangen zu lassen, bis der Kämpfer müde wurde, und dann nahm er die Gestalt einer Schlange an und biss den Gegner in den Fuss, so dass er bewusstlos hinfiel; dann kehrte er in seine wirkliche Gestalt zurück und verzauberte den Geschlagenen in einen Baum.
Da Niccolo nun aber kein Schwert oder sonst etwas hatte, um sich zu wehren, bekam er die schauderlichste Angst, und in seinem Schrecken warf er das Alräunchen dem Bären in seinen grossen roten Schlund. Der Bär war darüber so verblüfft, dass er das Alräunchen einfach verschluckte, aber das tat ihm nicht gut, denn er geriet ins Wanken, ging auf allen Vieren, wich und brach schliesslich tot zusammen.
Nun holte Niccolo die Eisenrute herein und sowie die Seifenblase den Boden des Turmausgucks berührte, zerplatzte sie, und das Feenkind trat heraus; so schön war sie, dass Niccolo vor ihr niederkniete und sie unterwürfig bat, ihm die Treppe hinab
25
zu folgen, da schien sie ihn gar nicht zu hören. Er fasste sie deshalb an der Hand, und sie folgte ihm ohne Widerstehen, doch mit einem Ausdruck vollkommener Blödigkeit, so dass Niccolo gar nicht wusste, was er von alldem halten sollte. Erst als sie schon unten waren und eben das Tor des Turmes durchschreiten wollten, erinnerte sich Niccolo an das Wort des Alräunchens: Vergiss das Beste nicht. Und er schaute zurück, was er wohl vergessen haben mochte. Da erblickte er eine zweite Treppe, die in einen Keller hinabführte. Er entschuldigte sich höflich einen Augenblick von seiner fühllosen Begleiterin und stieg eilig hinab. Dort kam er in ein grosses dumpfes Kellergebäude, wo den Wänden entlang allerlei Gestelle liefen, doch nur auf einem einzigen stand ein einziger grosser Tonkrug. Von diesem hob Niccolo den Deckel, um zu sehen, ob darin die verheissene Kostbarkeit steckte. Er war aber leer, bloss ein gelber Schmetterling flog taumelnd daraus hervor, so dass Niccolo den Deckel rasch wieder aufsetzte und die Kellertreppe emporstieg, der Falter gaukelte dabei vor ihm her. Als er zum Tor kam, stand das Feenmädchen noch immer dort, wie er sie verlassen hatte. Der Schmetterling aber baumelte ihr um den Kopf, bis sie schliesslich lachen musste und rief: Schau, schau! Und als sie den Mund auftat, da schlüpfte der Schmetterling hinein und kam nicht mehr heraus.
Und jetzt wurde die Feentochter plötzlich anders, sie sah sich um, begriff, was geschehen war, fiel Niccolo um den Hals, nannte ihn ihren grossherzigen Retter und den Ritter ihres Herzens; und das war ihm nun fast auch wieder nicht ganz recht. Und so verliessen sie über die Zugbrücke die Burg: Alle die Bäume draussen waren wieder Prinzen geworden und jubelten ihnen zu, und auch die Fee Pantialeia war schon da, welcher das Orakel des Psammukkis in Asbalon den Tag geweissagt hatte, an welchem ihre Tochter befreit werden würde, und noch in derselben Woche feierte man im Palast der Fee die Hochzeit,
26
und heute ist Niccolo ein grosser König in Dschinaistan, dem Lande der Feen.
Es wäre natürlich falsch, anzunehmen, wenn die Base in der Weise ihre Erzählung beendigt hatte, seien wir zufrieden gewesen; vielmehr riefen wir entweder stracks nach einem neuen Märchen, oder wir quälten die Base mit Fragen über unerzählte Einzelheiten der Geschichte. Wie viele Stufen es gewesen seien auf den Turm hinauf, und wie viele Geier auf den Felsen gewohnt hätten, und was aus den Geiern geworden sei, und ob es wahr sei, was Scipione uns von den Geiern erzählt hatte, dass sie nämlich einen so guten Geruchssinn besässen, dass sie sich drei Tage im Voraus an den Plätzen versammeln, wo es Aas geben würde. Was man auch über diese Fragen denken mag, in der Weise übten und bildeten wir unseren Scharfsinn, und die alte Barbara hatte auf alles eine Antwort. Oft widersprachen wir ihr auch, weil wir meinten, wir wüssten die bessere Antwort ohnehin schon selber, denn da wir allein die Frage gefunden hatten, warum sollten wir nicht auch allein die Antwort finden?
Wenn wir uns dann aber bei solchen Gesprächen auch einmal allzu heftig stritten, so beruhigte uns die alte Base mit einer neuen Geschichte. Was mich betrifft, so hörte ich am liebsten von den Abenteuern meines Grossvaters, da ich mich von namens wegen gewissermassen selbst als ihr Held fühlen konnte. Ich will von dem vielen, was ich über ihn erfuhr, nun noch die ebenso belustigende wie traurige Geschichte seines Todes hierhersetzen, die mir mehr als alle teuer war: Der Erzbischof von Gent, der auch hin und wieder in dem Kloster, in dem mein Grossvater lebte, die Messe las, war ein Mann von weiten Interessen und ebenso weitherzigen Ansichten; vorzüglich interessierte er sich für die Astrologie und die Alchimisterei, insbesondere das Goldmachen. Er hatte in den unterirdischen Gewölben seines Palastes grosse Laboratorien eingerichtet, in denen er zusammen mit einem ägyptischen Verschnittenen und einem
27
französischen Gelehrten, welche die Gewölbe niemals verliessen, seinen Untersuchungen nachging. Das wusste jedermann in der Stadt, auch wenn man nicht öffentlich davon sprach und niemand zugegeben hätte, dass er es wusste.
Der ältere Lotario nun besass etliche Kenntnisse in der Alchemie, teils weil solche seit alters in unserer Familie überliefert wurden, teils weil er eine Zeit lang in Kiew bei einem Griechen aus Adrianopel in der Lehre gewesen war. Wen wundert’s, dass ihn bald fachmännische Neugier für die Versuche des Erzbischofs packte? Einen ordentlichen Weg, in die verschlossenen Kasernen des Bischofs zu gucken, fand er aber nicht, und so verfiel er auf folgendes Mittel: Er mischte aus verschiedenen Kräutern und Pulvern – die Barbara behauptete, die Mischung zu kennen, hat sie uns aber nie verraten – ein Elixier, das er tröpfchenweise auf Scheiben eines leckeren französischen Käse brachte und diese solcherart präparierten Lockstücke in allen Winkeln der Klosterkirche hinterlegte. Von dort verschwanden sie jeweils bald, denn die Kirchenmäuse von Gent, denen der ältere Lotario so Verstand und Sprache beizubringen hoffte, fanden Gefallen an der ungewohnt üppigen Speise. Der Erfolg blieb nicht aus: Schon bald ging mein Grossvater regelmässig nachts in die Kirche, um mit den Mäusen zu sprechen. Er überredete sie, einen Gang zum Palast des Bischofs zu graben unter Ausnützung mehrerer Keller und einiger Maulwurfsgänge in den Gärten und ihm so regelmässig von den Versuchen des Erzbischofs Bericht zu erstatten. Im Übrigen hielt er sie an, das Schweigen zu wahren, solange es Tag war und die Kirche mit Leuten angefüllt.
Das wäre nun wohl alles gut gegangen, hätte nicht eines Tages der Sakristan den Krug mit dem Messwein etwas gar zu unsanft in den Schrank gestellt, wodurch ein kaum merklicher Sprung entstand. Die Mäuse, denen der Schrank übrigens längst ein bekanntes Revier war, entdeckten dies und suchten von nun
28
an den Ort immer häufiger auf, um sich an der angenehmen Süsse zu laben. Natürlich waren sie bald berauscht, vergassen das Schweigegebot, plauderten Beichtgeheimnisse aus, parodierten während der Messe den Vorleser und sangen auch mitunter zu ihrem Vergnügen gregorianische Choräle, welche die einzige Musik war, die sie kannten.
Als die Kunde von dem possierlichen Treiben zum Abt des Klosters gelangte, bestellte er heimlich zwei alte, im Exorzismus erfahrene Mönche zu Wächtern, damit sie des Nachts in der Kirche aufpassten, ob etwa jemand käme, die Mäuse zu sprechen. Tatsächlich: Mein Grossvater kam, die Mäuse versammelten sich zu seinen Füssen, und er schalt sie heftig wegen ihrer Trunkenheit und forderte sie auf, ihre Zungen künftig zu zügeln. Nein, rief da ein junger Mäuserich – die alte Base behauptete, er habe Rinks geheissen –, nein, warum gibst du uns die Rede, wenn wir sie doch nicht gebrauchen dürfen nach unserem Willen. Nein, rief da aber auch der eine der beiden alten Mönche, die dem allem zugesehen hatten; nein, das ist zu toll! Und sie traten hinter der Säule hervor, hinter der sie sich versteckt hatten, und packten den Lotario, während die Mäuse erschreckt in ihre Löcher davonsprangen. So wurde mein Grossvater unter der Anklage der Hexerei vor Gericht und dann zu Tode gebracht. Es wird erzählt, der Erzbischof habe ihm Leben und Freiheit versprochen, wenn er ihm die Mischung der Sprech-Tinktur verriete; doch mein Grossvater, der wohl einsah, dass damit sein geheimes Wissen ungut bekannt würde, sei festgeblieben. Eine andere Variante der Geschichte, die ich aber erst von Russo erfuhr, ging dahin, dass Lotario mit dem Erzbischof gemeinsame Sache gemacht habe, ihm alle Geheimnisse brachte und dann, als er ihm auch die Zubereitung des Steins der Weisen verraten hatte, auf Geheiss des Erzbischofs heimlich erwürgt worden sei; der Erz-Prälat selbst aber sei vor den Augen des Volkes vom Teufel geholt worden, da er durch den Stein
29
Zum Autor
Virgilio Masciadri, geboren am 23. November 1963, hat nach der Matura Typus A an der Alten Kantonsschule Aarau von 1983 bis 1988 an der Universität Zürich Griechisch, Latein und Mittellatein studiert. Im Dezember 1993 promovierte er mit einer bei Professor Walter Burkert verfassten Arbeit, die bereits seine Ambitionen auf eine neue methodische Grundlegung der Altertumswissenschaften erkennen liess und die 1996 unter dem Titel Die antike Verwechslungskomödie: Menaechmi, Amphitruo und ihre Verwandtschaft erschienen ist. Von 1989 bis 1990 arbeitete er als Assistent am Klassisch-Philologischen Seminar und von 1992 bis 1993 am Mittellateinischen Seminar der Universität Zürich. Von 1998 bis 2000 war er mit einem Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds an der École Pratique des Hautes Études in Paris, wo er an der Habilitation arbeitete und in diesem Rahmen auch ein Zusatzstudium (Diplôme post-doctoral) absolvierte. Virgilio Masciadri hat ab 1988 an verschiedenen Zürcher und Aargauer Kantonsschulen als Lehrer für Latein und Griechisch gewirkt. Von 2000 bis 2002 war er als Berater für Latein und Paläographie der Historikergruppe des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich tätig. Neben seiner wissenschaftlichen und schulischen Tätigkeit hat er sich auch einen Namen als Schriftsteller und Dichter gemacht und sich in der Redaktion der Schweizer Literaturzeitschrift orte sowie in der Geschäftsleitung des orte-Verlags für die zeitgenössische Literatur eingesetzt.

190
Die Herausgeberinnen
Claudia Masciadri, geboren 1931 in Winterthur, ist Virgilio Masciadris Mutter. Das Familienleben stand bei ihr an oberster Stelle. In jungen Jahren schon zeigte sich ihr Interesse an Literatur, das sie ihren Kindern weitergab. Mit grosser Liebe pflegte sie Haus und Garten ihres Mannes Celeste Masciadri oberhalb des Comersees, wo Sohn Virgilio zahlreiche seiner Schriften verfasste.
Cornelia Masciadri, geboren 1954, hat Übersetzung studiert und sich zur Schauspielerin und Sängerin ausgebildet. Neben ihrer Übersetzungstätigkeit hat sie eigene Lied- und Opernprojekte konzipiert, zu denen ihr Bruder Virgilio Masciadri Texte und Libretti geschrieben hat; die Zusammenarbeit der Geschwister war eng. Ihrem Mann Martin Strebel half Cornelia Masciadri beim Aufbau eines Ateliers für Buch- und Papierrestaurierung in Hunzenschwil, wo die Mutter von zwei Kindern lebt.
191
© 2023 by orte Verlag, CH-9103 Schwellbrunn
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Brigitte Knöpfel
Umschlagbild: AdobeStock
Gesetzt in Arno Pro Regular
Herstellung: Verlagshaus Schwellbrunn
ISBN 978-3-85830-317-2
www.orteverlag.ch