Fachmagazin des Bachelor Studiengangs Medienmanagement der FH St. Pölten Ausgabe 38 - März 2022 -


Fachmagazin des Bachelor Studiengangs Medienmanagement der FH St. Pölten Ausgabe 38 - März 2022 -


Medienmanagement
• Bachelorstudium: 6 Semester
• Vollzeit
Schwerpunkte
• Medienwirtschaft & Strategie
• Publizistische und journalistische Grundlagen
• Medienproduktion und -technologie
Jetzt informieren: fhstp.ac.at/bmm

3 Inhalt
4 Editorial
5 Geschichten die uns Bilder erzählen Visualisierungen in den Medien von Laura Sophie Maihoffer
9 Der Motor der Internet-Entwicklung ist X-rated von Cornelia Plott
12 Ein Leben im #technologischen Wandel von Michael Haas
15 Filmfestivals: „Das zu erleben, was wir Kino nennen“ von Paul Jelenik
18 Kinderfernsehen – Noch am Puls der Zeit? von Sophie Böhm
21 „Ach, du bist Schriftsteller*in?“ Einblicke in einen Beruf im Wandel von Valeria Brunner
24 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Erfolgsgarant Klicks von Wanja Lang
26 Was das Virus mit dem freien Theater macht von Sarah Schöllhammer
28 (Cyber-)Mobbing – Schreie, die niemand hört von Jennifer Binder
30 Gratiszeitungen – grenzen- und kostenlos in einer Wegwerfgesellschaft von Viktoria Ecker
32 Behindertensport im medialen Rampenlicht von Kathrin Plchot
34 Das Lizenz-Roulette: Sportübertragungsrechte im Geldrausch von Wanja Lang
38 20 Jahre Medienmanagement Alumni Success Stories
46 Medienskandale im Wandel der Zeit –Geht Qualitätsjournalismus verloren? von Hannah Schinagl
50 Zwischen Handysucht und moderner Bildung (digitale) Medien im Unterricht von Theresa Zahradnik
52 Filmlizenzen: Ein Handel zwischen traditioneller Bedeutung und neuer Marktkomplexität von Paul Frühwirt
56 Terrorismus – Gefahren für Medienschaffende und Berichterstattung von Elizaveta Egorova 57
58 TV-Nachrichten – das härteste Geschäft? von Isabella Steiner
60 Vom Info-Flyer zum „Instagram“ Werbespot –Der Wandel des Medienmarketings von Theresa Zahradnik
63 Trafikant*innen: Die analogen Influencer*innen unserer Zeit von Paul Frühwirt 66
66 „Die Zukunft der Lokalmedien ist anspruchsvoller als ihre Vergangenheit.“ von Valeria Brunner 70
70 Community Management: How to? von Katharina Pöschl
73 Mediale Gerüchteküchen: Nutzen und Gefahren von Viktoria Ecker
76 Journalismus: Ein Beruf, viele Legenden Von Anna Hohenbichler 78
78 Impressum


Empfinden Sie gelegentlich mediale Reminiszenzen, gar Nostalgie? Die Gestalter*innen dieser SUMOSonderausgabe sind im Durchschnitt etwa 20 Jahre jung, und ich erfuhr, dass auch sie sich teils wehmütig, teils verschämt „Pixi“-Büchern, „Bravo“ (online), erster unerlaubter „Facebook“-Posts entsinnen. Von diesen generationenverbindenden Erinnerung und gut gemachten Remakes profitiert die Medienbranche. An der FH St. Pölten erfinden sich Medienmacherinnen und Medienmacher seit 25 Jahren immer wieder neu. Denn Innovation bedeuten für uns nicht, Seiendes der allwissenden Müllhalde („Die Fraggles“) zu überlassen, sondern Funktionierendes für die Befriedung steter Bedürfnisse und sich wandelnder Probleme zu adaptieren oder zu erneuern. Nehmen Sie unser spielerisches Cover – das die Künstlerin Becky Moshammer exklusiv für SUMO gezeichnet hat (GRAZIE!): Die Welt der analogen Medien – bunt, vielfältig, gewichtig – und damit auch viel besser für Illustrationen geeignet, als das All-InOne Gadget von heute: das Smartphone, das all diese Funktionen unscheinbar auf kleinstem Raum verinnerlicht. Pünktlich zu unserem Jubiliäum übrigens wurde auch das unverwüstliche Nokia 6310 nach 20 Jahren neu aufgelegt. Es kommt unglaubliche 22 Tage mit einer Akkuladung aus – dafür auch ohne Surfen im Internet.
Das SUMO-Team hat in dieser Ausgabe Entwicklungen und Veränderungen diverser Mediengattungen und ungewöhnliche Medienthemen nachgezeichnet, wie stets basierend auf Interviews mit hochkarätigen Expert*innen aus Medienpraxis und -wissenschaft. So etwa Beiträge zu Visualisierung in Printmedien mit Mads Nissen, Florian Klenk zur Berichterstat-

tung über Terror, den Medienskandalforschern Andre Haller, Christian von Sikorski und Reinhard Spitzer, Thomas Brezina zum Schriftstellerberuf, mit dem Moderator Ralph Caspers von „Die Sendung mit der Maus“ zu Kinderfernsehformaten. Sie erlesen weiter Vielfältiges zu Filmfestivals, warum Pornografie der Internettreiber wurde, über Sportübertragungsrechte, Gratiszeitungen, Mobbing-Täter, Trafiken als Distributionskanal, On- und Offline-Kunst, Paralympics, Theater, u.v.m.
Zusätzlich erwartet Sie eine Besonderheit in dieser Spezialausgabe: Wir stellen Ihnen eine feine Auswahl unserer Alumni vor, die wir in den letzten 20 Jahren ein Stück ihres Weges begleiten durften. Unter Anleitung von Gaby Falböck haben aktuelle Studierende die Absolvent*innen des Studiengangs Medienmanagement interviewt. Handverlesene Highlights der beeindruckenden Stories können Sie in der Heftmitte finden, die vollständige Version können Sie auf medienmachen.at nachlesen.
Wir jubilieren: 25 Jahre FH St. Pölten als Medienausbildungsstätte, 20 Jahre MedienmanagementStudium. Eine Kostprobe des funktionierenden Ausbildungserfolgs halten Sie in Händen: Das Medienfachmagazin Sumo, gestaltet von werdenden Medienprofis, die in jedweder Ausgabe auch in den Bereichen Distribution, Bildredaktion, Onlineproduktion, Unternehmenskommunikation, Sales und Printproduktion die vorliegende, gewichtige SUMOAusgabe gestemmt haben: GRAZIE MILLE!
Spannende Lektüre in Rück- und Vorschauen wünschend & auf die nächsten 25 Jahre, Roland Steiner, Gaby Falböck & Johanna Grüblbauer

Oft ist uns gar nicht bewusst, welcher Aufwand und welche Gedanken hinter dem Design und den Visualisierungen in den Medien stecken, während wir diese rezipieren. SUMO durfte hinter die Kulissen blicken und sprach dazu mit Norbert Küpper, welcher neben seinem Beruf als Zeitungsdesigner auch der Veranstalter des European Newspaper Award ist. Ebenso wurde Mads Nissen interviewt: Er hat 2015 und 2021 den Hauptpreis beim World Press Photo Award für das beste Pressefoto des jeweiligen Jahres gewonnen. Außerdem unterhielt sich SUMO mit Gerald Piffl, Produktmanager bei APA-Picturedesk und Archivleiter bei IMAGNO, dem größten privaten Bildarchiv Österreichs.
Wenn man eine Zeitung oder ein Magazin aufschlägt, ist es heute selbstverständlich, dass die Seiten mit Bildern, Illustrationen, Infografiken, Karikaturen und anderen Grafiken geziert sind. Diese dienen dem Verständnis, wecken Interesse, lassen die Rezipient*innen emotionaler auf die inhaltlichen Themen reagieren und schildern den Sachverhalt bisweilen, ohne dass Rezipient*innen den Text überhaupt lesen müssen. Ein lebendiges Pressefoto ist oft wirksamer als eine reißerische Schlagzeile. Dies wurde auch durch eine Studie des Poynter Institutes for Media Studies in Florida belegt. Hier fand man bereits 1990 heraus, dass Zeitungsleser*innen nicht durch eine Schlagzeile in den Artikel einsteigen, sondern durch eine Visualisierung. 85 % der Proband*innen fingen zuerst mit dem Bild an, gefolgt von der Bildunterschrift, bevor die Schlagzeile überhaupt gelesen wurde. Die Ergebnisse zeigten zusätzlich, dass kein Element in Zeitungen so sehr Aufmerksamkeit erregen, wie Bilder und Grafiken. Auch Norbert Küpper konnte ähnliche Ergebnisse mit seiner Eye-Tracking-Studie generieren. „Ein Bild ist immer der Einstieg in eine Seite und auch in eine Geschichte. Selbst wenn ein unscharfes Bild hergenommen wird, hat es für den/die Leser*in unterbewusst noch immer eine sehr hohe Bedeutung. Man orientiert sich meistens an visuellen Komponenten, egal ob Bilder oder Infografiken“.

Es ist jedoch noch nicht allzu lange her, dass Zeitungen ohne Bilder gedruckt wurden. Pressefotos etablierten sich generell erst ab dem 20. Jahrhundert, davor wurden Kupferstiche und Zeichnungen verwendet. „Bevor Fotos gedruckt werden konnten, gab es Holzschnitte. Es wurde hierzu ein Foto als Vorlage gemacht und dann wurde anhand dessen von Xylografen ein Holz-
schnitt angefertigt, mit dem man dann druckte. Hier liegt auch der Ursprung der Bildagenturen. In den 1850er/60erJahren haben Verlage ihre eigenen Druckstöcke erzeugt, diese lizenzierten sie sozusagen und verkauften oder borgten diese Druckstöcke her“, schildert Archivleiter Gerald Piffl. Den vermehrten Einsatz von Bildern in der Presse hatte man aber erst mit einem technischen Umschwung geschafft, in dem man es möglich machte, die Fotoapparate zu verkleinern und somit transportabler zu machen. „Die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ hatte bis vor knapp zehn Jahren nicht einmal ein Bild auf der Titelseite. Es war eine merkwürdige Situation, dass das Visuelle bei vielen deutschen Zeitungen gar keine Rolle spielte. Im Vergleich dazu spielte in den Niederlanden, Skandinavien, aber auch in den USA das Bild schon vor mehr als 20 Jahren eine riesige Rolle“, erläutert Norbert Küpper. In Österreich wurde der Aufschwung der Pressefotografie jedoch durch Papier- und Tintenknappheit im Zweiten Weltkrieg wieder gedämpft. Erst als man in den Nachkriegsjahren wieder mehr Ressourcen hatte, rückten Visualisierungen, insbesondere Bilder, immer mehr ins Zentrum.
Trotzdem hatte der Zweite Weltkrieg eine besondere Bedeutung für die weitere Entwicklung des Bildjournalismus in Europa. In der Kriegsberichterstattung waren die Grenzen zwischen Information und Propaganda fließend. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland war es damals wichtig, den Krieg als notwendig und sauber darzustellen, sowie die Soldaten als Helden. Pressefotograf*innen, die den Krieg anders darstellten um die Schattenseiten der damaligen Politik aufzuzeigen, drohte politische Verfolgung. Bilder und deren Inszenierung waren in dieser Zeit ein mächtiges Werkzeug, da die Menschen, die den Krieg von zu Hause mitverfolgten, dem was sie sahen, mehr glaubten, als dem
was sie gehört oder gelesen hatten. Mit ausgewählten Bildern konnte man also den zu Hause verbliebenen Leser*innen eine Sekundärerfahrung ermöglichen, mit der sie sich in die aktuellen Geschehnisse besser hineinversetzen konnten. Somit war die Wahl des Bildmaterials, welches durch die Knappheit an Papier und Tinte ohnehin schon sehr begrenzt war umso wichtiger. Im Nachhinein wurde klar, dass die Darstellung des Krieges durch Bilder nahezu „romantisch“ war, aber mit den eigentlichen Geschehnissen nichts zu tun hatte. Die Darstellungen in den Zeitungen erreichten jedoch nicht nur die eigene Gesellschaft, sondern ebenso die Gegner und somit wurde, laut dem deutschen Politikwissenschaftler Herfried Münkler, aus der Kriegsberichterstattung ein Berichterstattungskrieg.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit wurde der Bildjournalismus stark von den Alliierten geprägt. Dies kann man vor allem in den veröffentlichten Materialien des Projekts “War of Pictures“, welches von Medienhistoriker Fritz Hausjell geleitet wird, erkennen. Da die Alliierten ihre eigenen Medien in Österreich aufbauten, beeinflussten sie die österreichische Medienlandschaften mit diversen Printtiteln. Vor allem auch wöchentliche Bildbeilagen von der US-amerikanischen Besatzungsmacht, wie zum Beispiel für den „Wiener Kurier“, prägten die österreichische Bildkultur. Hier dominierten Themen, die der Unterhaltung dienten und Reportagen über den Wiederaufbau. Es bürgerte sich der „American Way of Life“ in die österreichische Bildwelt ein. Das geschah nicht nur thematisch, sondern auch durch die Bildgestaltung. Man schweifte ab von der normalen Frontalperspektive und nutzte verschiedene Blickwinkel und Brennweiten, um die Geschehnisse spannender abzulichten. Die Entwicklungen flossen in absehbarer Zeit auch in den österreichischen Bildjournalismus mit ein und blieb bestehen.
Etwas später fokussierte man sich dann immer mehr auf die Momentfotografie. Hier war es dann schon möglich Sportevents abzulichten. Man versuchte nun die Spontanität und die Bewegung abzubilden, trotzdem blieben die Bilder weiterhin sehr statisch. Bildreportagen gab es zwar vor dem Krieg bereits, musst aber wieder neu etabliert werden. Den nächsten großen Umbruch gab es in den 90er-Jahren, als die Zeitungen ihre Bilder in Farbe druckten, berichtet Piffl. Hier nahm plötzlich die Qualität der Bilder ab, da man vermutlich noch zu sehr an die hohen Kontrastmöglichkeiten von einer Darstellung in Schwarz-Weiß gewohnt war. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es laut Piffl ein unglaublich hohes Bildniveau in der Medienlandschaft, da Pressefotograf*innen durch den enormen Konkurrenzdruck gefordert werden. Deshalb spezialisieren sich viele Bildjournalist*innen gegenwärtig auf eine Nische, um nicht in der Masse unterzugehen.

Die Anforderungen an die Fotograf*innen werden immer höher. Das Medium Bild ist aktuell sehr populär, sowie in großen Massen vorhanden und das nicht nur im Bereich der Pressefotografie, sondern allgemein. Die Schweizer Forscherin Ulla Autenrieth (FH Graubünden) hat in ihrem Projekt zur Erforschung der Bilderwelt in den Sozialen Medien festgestellt, dass der Druck steigt, weil man auf „Facebook“, „Instagram“ und Co. als User*in mit außergewöhnlichen Bildern besonders hervorstechen will. Der Anspruch von vielen User*innen ist es nicht mehr, die Realität abzubilden, sondern entwickelte sich zu einer übertriebenen Darstellung von Ideal-Vorstellungen. Deswegen sollte das Pressefoto etwas an sich haben, damit es sich von dem alltäglichen Social Media Bild-Post abhebt und Rezipient*innen auf eine einzigartige Weise in die Geschichte beziehungsweise in die Berichterstattung hineinzieht. „I think that there should be something that speaks to you, something that will make your eyes stop and be attracted. It needs to be aesthetic, but different, so it speaks to the eyes, but it needs to speak to the brain as well. Maybe even a bit contradictionary, something you can´t really understand to make you curious and then it needs to speak to your heart”, erläutert Mads Nissen auf die SUMO-Frage hin, welche Eigenschaften für ein gutes Pressefoto essenziell sind.
Er schildert, dass es darum gehe, eine Sekundärerfahrung für die Rezipient*innen zu gestalten und somit den Moment einzufangen und die Betrachter*innen des Bildes annähernd das fühlen zu lassen, was man selbst als Fotograf*in fühlt und somit den Moment wieder gibt, der bereits vergangen ist. Um den Moment auch akkurat wiederzugeben, sei es vorrangig, das Bild nicht zu manipulieren. Gerade durch den Einfluss von Social Media und die Realitätsferne der Darstellung des Alltäglichen dürfen sich Pressefotograf*innen nicht verleiten lassen, ihre eigenen Werke zu manipulieren. Nicht ohne Grund wird im Ehrenkodex des österreichischen Presserates festgehalten: „Fotomontagen und Bildbearbeitungen, die von flüchtigen Lesern/ innen als dokumentarische Abbildungen aufgefasst werden, müssen deutlich als Montagen oder Bearbeitungen kenntlich gemacht werden.“ Auch wenn es inzwischen technisch leicht möglich ist, ein Bild durch Manipulation interessanter zu machen als es ist, sollten sich Fotograf*innen im Klaren sein, dass man durch diese Schritte die Wirklichkeit verfälscht und die Betrachter*innen in die Irre führt. Auch Nissen äußert sich zu diesem Thema: „I strongly believe in the ethics of classical journalism and I put a lot of effort that my work is truthful to make somebody see something that I saw, not just something I imagined. A lot of young people out there are a bit surprised how little I do to make my pictures look the way they do. People are so used to being able to manipulate themselves in their own photos, so when they learn how little me and some of my colleagues are actually doing, they are even a bit surprised.” Er selbst sagt, dass er nur den Kontrast und die Lichter ändere beziehungsweise anpasse, aber nie in das eigentliche Bild selbst eingreife.
Um das Bild von Anfang an spannend zu gestalten, gehört viel Recherchearbeit dazu. Man möchte zum perfekten Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um den perfekten Moment zu erfassen. Dazu gibt es verschiedene Herangehensweisen. „Some people say that you can either take pictures like a hunter walking around or like a fisher, where you stand in the same position and just have patience. I think for me it’s a bit of both. In the end it’s not about pictures it’s about the people in the image. So most of the time I will stay in the same scene the same situation. I will take a lot of images from many different angles, to capture different moments and then I will carefully look at all the small
differences afterward “, schildert der World Press Photo-Preisträger. Allgemein sollten Pressefotograf*innen laut Nissen nach dem Motto „dress boring and stay humble“ arbeiten, denn um die besten Bilder hervorzubringen, müsse man die Umgebung beobachten und sie nicht dominieren.
Bildjournalist*innen unterscheiden sich jedoch nicht nur in ihrer Vorgehensweise, sondern auch durch die Themen, auf die sie sich spezialisieren. Mads Nissen ist ein Fotograf, der sozial-politische Themen aufgreift und dazu möglichst aktuelle und neue Perspektiven zu der ausgewählten Thematik aufzeigt. Er möchte etwas mit seinen Bildern aussagen und somit die Welt ein Stückchen mehr verändern. Beispielsweise zeigt er auf dem World Press Photo of the Year 2021 zwei Personen in einem Altenheim in Brasilien, die sich in der COVIDPandemie das erste Mal wiedersehen und sich durch einen Plastikvorhang umarmen. Um so die Pandemie nicht nur in Zahlen und Fakten wiederzugeben, sondern eine Emotionalität zu vermitteln und die Schwächen der örtlichen COVID-Politik aufzuzeigen. Auf










der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Pressefotograf*innen, die noch aktuellere Geschehnisse aufgreifen, wie einen Unfall, einen Anschlag, eine Demonstration oder möglicherweise auch eine Pressekonferenz. Auch hier geht es darum Emotionen hervorzurufen und die BetrachterInnen zu stimulieren. Das darf man nicht vergessen, auch wenn weniger Zeit für die Vorbereitung bleibt.



Um die Vielfalt und Qualität der Gestaltung in den Medien zu gewährleisten und zu fördern, gibt es Preisausschreiben wie den World Press Photo Award, aber auch der European Newspaper Award trägt zu einer visuell stimmigen Medienlandschaft bei. „Beim European Newspaper Award geht es darum, dass man sieht, wie andere es machen und sich inspirieren lässt. Eine Zeitung, die völlig normal aussieht und bei der kein großer Wert auf Bilder gelegt wird, sowie keine Infografiken vorkommen, hat keine Chance zu gewinnen. Es geht

stark um die Bildfreundlichkeit und es muss funktional gestaltet sein. Es darf aber auch nicht übertrieben sein“, veranschaulicht der Herausgeber des Preises Norbert Küpper. Der European Newspaper Award fokussiert aber nicht nur allein auf Printmedien, sondern beschäftigt sich auch mit Websites von Medienunternehmen und Trends wie Podcasts. Beim letzten Durchgang des European Newspaper Awards wurden neben Layout und Design auch Fotografien ausgezeichnet. Es gibt unter anderem Kategorien für fotografische Serien, Portaitfotografie, Bildschnitt, Perspektive sowie Foto-Reportagen. Dabei werden immer die Fotografien im dazugehörigen textlichen Kontext bewertet, sei es Print oder Online.
Der World Press Photo Award ehrt hingegen außergewöhnliche Leistungen in der Pressefotografie. „I think it’s a very efficient way to get your work out, because there’s no newspaper cover, there’s no magazine cover, there’s no TV station that has such an outreach as the word press photo of the year. I think most of the world’s population saw this image by now and hopefully reflected


Kulthits & das Beste von heute „Thank
upon it”, erläutert Mads Nissen. Jedoch spricht er auch Bedenken aus, da viele Menschen sich an den Themen des Vorjahres orientieren würden und das vermutlich nicht nur, weil sie die behandelten Themen als wichtig empfinden, sondern weil es den Pressefotograf*innen um das Gewinnen selbst gehe. Bei diesen Preisen sollte laut ihm die verbildlichte Thematik im Vordergrund stehen und nicht der oder die Fotograf*in selbst.



Pressefotos dienen jedoch nicht nur dem heutigen Verständnis. Als historischer Archivleiter von IMAGNO, dem größten privaten Bildarchiv Österreichs, ist es die Aufgabe von Gerald Piffl, den Bestand von über vier Millionen Bilder zu digitalisieren und seinen Kund*innen dabei zu helfen, mittels Bilder historische Ereignisse zu rekonstruieren. „Ich habe gerade ein Projekt zum Thema Sportfotografie, bei dem ich alte Bilder zu Fußballspielen heraussuche. Zum Beispiel war 1974 das erste Bundesligaspiel. Der Kunde hat gefragt, ob es vom allerersten Tor ein Foto gibt. Wir haben dann Negative vom ersten Torschuss gefunden und auf dem nächsten Negativ war die Uhr abfotografiert, sodass man sagen konnte, dass das Tor in der 14. Minute gefallen ist. Der Kunde war äußerst begeistert, denn das war vollkommen unveröffentlicht.“, schildert Piffl. Altes Bildmaterial kann uns daher helfen, Momente, die vielleicht damals noch vollkommen unbedeutend gewirkt haben, aber einen historischen Kern haben, nachzukonstruieren. Auch hier geht es wieder um die Sekundärerfahrung, da es Bilder ermöglichen, sich Sachverhalte besser vorstellen zu können und die Geschichte dahinter lebendig machen.
Angesicht der meist rückläufigen Zahlen im Print-Bereich wird es spannend bleiben, wie die Arbeiten der Pressefotograf*innen und Grafiker*innen in Zukunft publiziert werden. Derzeit gibt es den Trend, dass man Nachrichten
anhand von Podcasts rezipiert oder sich die Zeitung mithilfe einer digitalen Stimme vorlesen lässt. Norbert Küpper und seine Kollegen hatten es nie für möglich gehalten, dass sich diese Art der Berichterstattung durchsetzen würde und das Bildliche, in einer ohnehin schon sehr bildlastigen Welt, untergeht. Aber das gedruckte Medium Zeitung selbst entwickelt sich auch weiter. „In den Niederlanden zum Beispiel legt man weniger Wert auf die aktuellen Nachrichten in den Zeitungen, die zwar vorhanden sind, aber man sagt sich, dass das was gedruckt wird, man bereits im Internet gelesen hat und es keinen Sinn gibt, das zu wiederholen. Daher geht man hier oft zu anderen Themen über. Sie machen inhaltlich andere Zeitungen und haben oft sehr stark ausgebaut textliche Beilagen, zum Beispiel zu kulturellen Themen“, führt Norbert Küpper aus. Bei dieser neuen Form der Tageszeitung spielen Bilder wiederum eine wichtige Rolle, da sie laut dem Zeitungsdesigner ein wichtiger Verkaufsfaktor sind. Ob Komplementarität oder Konvergenz – das Visuelle wird bleiben.
von Laura Sophie MaihofferCopyright: Morten Rode
Copyright: APA
Copyright: Privat
Während Schnitzel für manche zu Österreich gehören wie Aprés-Ski, so betrachten andere Menschen „schweinische“ Inhalte als festen Bestandteil des Internet. Gemeint ist Pornografie, die allzeit, meist barrierefrei und schambefreit abgerufen werden kann. Wer dabei noch in den Inkognito-Modus schlüpft, um sich durch ein verändertes Erscheinungsbild wie in einer anonymen Höhle zu fühlen, wird spätestens dann enttäuscht, wenn herausgefunden wird, dass Website-Betreiber und Internetanbieter trotzdem sehen können, was eigentlich lieber verborgen bleiben möchte. Was Rezipient*innen sexuell expliziter Inhalte im Netz jedoch auch selten wissen: Sie sind einer der Gründe, warum das Internet heutzutage so aussieht, wie wir es kennen. SUMO ging dieser Sache auf die Spur und befragte Kommunikationswissenschaftler und Medienökonom Jan Krone, Professor an der Fachhochschule St. Pölten, via Mail, und Sexualpädagogin Sabine Ziegelwanger.
Bei der Pornografie geht es nur um das eine, und das ist jedoch nicht das, was den meisten Menschen sofort in den Kopf schießt. „Geld regiert die Welt!“, lautet das weltbekannte Zitat, das auch auf die Erotikbranche umgelegt werden kann. Konkret bedeutet das, dass sich alles um günstige Produktion, günstigen Vertrieb und günstige Endgeräte dreht. Dies hat nicht nur das Drehen von Videos in den eigenen vier Wänden revolutioniert, sondern auch die Internetentwicklung signifikant beschleunigt. So basiert das Internet mit all seinen aktuellen Charakteristiken auf technischen Errungenschaften, die zumindest teilweise auf die Pornoindustrie zurückzuführen sind.
Im Jahr 1990 wurde das World Wide Web von Tim Berners-Lee über die Entwicklung der Hypertext Transfer Protocol http und der Hypertext Mark Up Language HTML gewissenmaßen begründet und das Internet ebenfalls für kommerzielle Inhalte freigegeben. Zwei Jahre später wurde der erste InternetBrowser Mosaic zum Leben erweckt, mit welchem bereits pornografische Inhalte abgerufen werden konnten. Tatsächlich sei dies gar nicht so weit hergeholt, denn auch Medienökonom Jan Krone nimmt an, „dass die Branche zu den Early Birds der Contentdistributoren via Internet Protocol gehörte. Die Domain ‚sex.com‘ zählte früh zu den wertvollsten Adressen und wurde offenbar vor elf Jahren für einen geringen achtstelligen Dollarbetrag weiterverkauft.“ Auch dieser Tage spielen Websites wie „YouPorn“, „Pornhub“ oder „xHamster“ in einer profitablen und populären Liga: „Pornhub“ verzeichnete im Jahr 2019 laut einer eigenen Studie insgesamt 42 Milliarden Aufrufe, was einer durchschnittlichen Zahl von 115 Millionen Aufrufen pro Tag entspricht.
Insgesamt wurden 6.597 Petabyte an Daten übertragen, wobei ein Petabyte 1.000.000 Gigabyte entspricht. Täglich sollen weltweit laut „Pornhub Insights“ etwa 18.073 Terrabyte geflossen sein. Eine extreme Summe an Daten, die dank moderner Technologien problemlos erfasst wird und die Ladezeit der Inhalte je nach Internetanbieter dennoch nur wenige Sekunden betragen lässt. Die Pornoindustrie sorgt demnach für bis zu einem Drittel des weltweiten Datenverkehrs, soziale Netzwerke befinden sich hier aber noch immer in der Vormachtstellung. Über einen langen Zeitraum hinweg wurden Angaben hinsichtlich Aufrufe und Datenmengen von Pornowebsites jedoch nicht von den Betreibern in die Welt geschrien, sondern lediglich von Beobachter*innen geschätzt. Gemäß Jan Krone würde „die Entwicklung von Kompressionsverfahren zur besseren, schnelleren, umfangreicheren Datenübermittlung durch dezentrale Netze in der Unterorganisation der UNO, der ITU (International Telecommunication Union) zusammenlaufen. Standardisierungsverfahren und Protokolle beispielsweise werden dort in der Breite der Einsatzmöglichkeiten und -wünschen zwischen Stakeholdern diskutiert.“ Ob dabei auch der Wunsch nach einer schnelleren Datenübermittlung aufgrund des regen Pornokonsums geäußert wird, lässt sich nur mutmaßen. Offensichtlich agiert die Pornografie-Branche gerne hinter verschlossenen Türen, so wurde beispielsweise auch erst im Jahr 2020 publik, dass das Unternehmen MindGeek, ehemals Manwin, an der Spitze des „Pornhub“-Imperiums steht. Der Unternehmenssitz befindet sich in Luxemburg, einer Steueroase.
Die maßgebende Bedeutung der Pornoindustrie für die Entwicklung und
Popularisierung des Internet lässt sich auch am Erfolg des Formates HTML5 betrachten. Der Standard zur Darstellung von Websites verbreitete sich nicht nur wie ein Lauffeuer, weil Apple sich weigerte, das Konkurrenzprodukt Flash auf iPads anzubieten, sondern auch, da die Betreiber von Pornoseiten rasch erkannten, dass Tablets und Smartphones lukrative Endgeräte darstellen und im Zuge dessen auf HTML5 umstellten. Ebenfalls galten Pornowebsites schon früh zu jenen, die versuchten, gegen das illegale Kopieren und Weiterverkaufen von Online-Inhalten vorzugehen. Ebenso gilt die Pornoindustrie als eine der ersten, die alternative Geschäftsmodelle anstrebten und dabei kostenfreie und werbefinanzierte Angebote ausbauten. Jedoch profitiert nicht nur das Netz von der Pornografie, sondern auch der/die Rezipierende selbst. Mussten früher noch öffentliche Kinos aufgesucht werden, um erotische Inhalte zu empfangen, langt dieser Tage das Öffnen des Browsers – und bei manchen das Aktivieren des InkognitoModus für ein besseres Gewissen. Auf die Frage, ob Kinos und Videotheken unter der Digitalisierung und der damit aufkommenden Online-Pornografie gelitten hätten, antwortet Medienökonom Krone: „In dieser Entwicklung unterscheidet sich die Branche nicht von anderen Verlagsorganisationen. Druck-, Aufnahmedienstleistungs- sowie analoge Versandbetriebe mussten sich genauso der Digitalisierung stellen wie auch der Verkauf auf der letzten Meile, also Abonnementanbieter und Einzelverkaufsstellen.“
Der Porno-Markt jedoch wird durch Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch bestimmt. Zudem stellen die frei zugänglichen pornografischen Inhalte im Netz vor allem für junge Rezipient*in-

nen oftmals eine große Gefahr dar. Sabine Ziegelwanger, ausgebildete Sexualpädagogin, Soziologin und Familienplanungsberaterin, wird in ihrer Arbeit immer wieder mit dem Thema der Pornografie konfrontiert. Insbesondere durch ihre Abhaltung von sexualpädagogischen Workshops in Schulen und Jugendeinrichtungen werden ihr immer wieder bei der Frage nach „Was ist für dich Sexualität?“ Begriffe aus dem Porno-Milieu aufgesagt. „Da geht es nicht nur um Begriffe wie Liebe und Wörter, die Sexuelles im Alltag beschreiben, sondern auch um jene, die ein ganz spezielles Wording benutzen und aus verschiedenen Genres der Mainstreampornografie kommen.“ Auch begegnet der Sexualpädagogin die Pornografie „als ein hochgradig gegendertes Thema“, denn die Nennung beliebter „Pornhub“-Suchbegriffe würde sich hauptsächlich bei Burschen beobachten lassen. Das habe insbesondere bei 13- bis 15-Jährigen „mit den spezifischen gesellschaftlich-kulturellen Rollenerwartungen, der psycho-sexuellen Entwicklung und der Suche nach Anerkennung innerhalb der Peergroup zu tun.“ So wollen Burschen besonders mutig, erwachsen und erfahren rüberkommen, wenn sie besonders viele Begriffe aus der Pornoszene nennen. Ob der gesellschaftliche Umgang mit Pornografie im Laufe der Zeit ebenfalls eine Veränderung durchgemacht hat und ob die Gesellschaft nun offener mit Sexualität und Pornografie umgeht, beantwortet Jan Krone mit: „Die einen reden offen darüber, die anderen nicht. Anderen ist es egal. Möglicherweise fällt diese Unterscheidung via Social Media heute nicht mehr auf, weil der Zugang zu Themen barrierefrei geworden ist.“
Sabine Ziegelwanger zögert erst, stellt jedoch fest, dass „noch immer nicht angstfrei und unaufgeregt über sexuelle Wünsche etc. kommuniziert wird und auch nach wie vor viele Wissenslücken herrschen.“ Andererseits sieht sie einen Fortschritt in der Offenheit und differenzierten Auseinandersetzung mit Pornografie. Denn, so Ziegelwanger, zeige auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Pornografie, dass Pornografie nicht gleich Pornografie ist. Es gäbe mittlerweile auch (queer-)feministischen, sogenannten „fair porn“, sowie entsprechende Porn Film Festivals und begleitende wissenschaftliche Diskurse. Allerdings stellen diese Zugänge derzeit noch eine kleine Blase innerhalb des Mainstreamimperiums dar.


Der Erstkontakt mit Pornografie erfolgt laut Ziegelwanger im Schnitt mit 13 oder 14 Jahren, was sich mittlerweile jedoch immer weiter nach vorne verlagere. Sie erwähnt ebenfalls, dass es bereits immer wieder Volksschulkinder gibt, die unfreiwillig mit pornografischen Inhalten in Kontakt kommen. Auch eine Studie im Jahr 2017 der Universität Hohenheim und Münster erlangte ähnliche Ergebnisse bei der repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Kindern. Konkret wurden die Gefühle und Begleitumstände beim Erstkontakt erhoben. Demnach machen Kinder und Jugendliche bereits früh mit sexuell explizitem Inhalt Erfahrung, meist in den eigenen vier Wänden, jedoch nur selten allein. In 40% der Fälle sind die Rezipient*innen unter Freund*innen, wenn sie zum ersten Mal pornografische Bilder oder Videos sehen. Sabine Ziegelwanger erwähnt, dass der Erstkontakt meist unfreiwillig und nicht geplant vonstattengeht, was auch die Studie der Universität Hohenheim und Münster belegt. Allerdings lassen sich auch hier geschlechterspezifische Unterschiede feststellen. So gaben 60 Prozent der Mädchen an, ungewollt auf explizite Inhalte gestoßen zu sein, lediglich 37 Prozent der Burschen erlebten Ähnliches. Im Zuge dessen wäre doch eine strengere Kontrolle der Pornografie im Internet eine Lösung, um Kinder und Jugendliche zu schützen? Dies sei nicht so einfach, worüber sich sowohl Jan Krone als auch Sabine Ziegelwanger einig sind. „Die Versuche des Gesetzgebers den Zugang zu Pornografie Kindern und Jugendlichen – ähnlich erfolgreich wie im Analogen – zu erschweren, sind bis heute überwiegend fehlgeschlagen und bleiben eine permanente Herausforderung an die gesamte Breite der Media Governance“, konstatiert Jan Krone. Auch Sabine Ziegelwanger spricht zwar von internationalen Standards, die „alles Illegale sanktionieren sollten“, ist jedoch der Meinung, der beste Jugendschutz sei Medienkompetenz und Aufklärung. „Bis dahin obliegt es vor allem Erziehungsberechtigten, die Entwicklung von Schutzbefohlenen adäquat zu gewährleisten“, schlägt auch Jan Krone vor. Und hiermit kann auch der Inkognito-Modus wieder deaktiviert werden, denn auch dieser schützt keinesfalls vor ungewollten Kontakten mit sexuell expliziten Inhalten oder Datentracking.
von Cornelia PlottCopyright:
Abschlussarbeiten:
Die online-Plattform für wissenschaftliche Arbeiten

Studierende und NÖ Akteur*innen sowie Hochschulen finden auf Knopfdruck auf der neuen Website alles was sie suchen:
Studierende – ein Thema für ihre akademische Abschlussarbeit
NÖ Akteur*innen – eine benutzerfreundliche Möglichkeit, ihr aktuelles, wissenschaftliches Thema an der Themenbörse anzubieten Hochschulen – neue Themen, die sie ihren Studierenden für ihre Abschlussarbeiten anbieten können

„Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung selbst.“ Heraklits rund 2.500 Jahre altes Zitat gilt auch für den heutigen Drang nach Innovation. SUMO hat sich im Zuge des 25-jährigen Jubiläums des Medienausbildungsstandorts Fachhochschule St. Pölten auf die Suche nach Antworten begeben, wie Verantwortliche mit Change-Prozessen umgehen und dabei versucht, Veränderung zu konkretisieren. Dazu sprach SUMO mit Geschäftsführer Gernot Kohl und Wolfgang Römer, Professor am Department Medien und digitale Technologien.
Der Begriff „Veränderung“ umfasst in der Theorie eine Vielzahl an Definitionen. Grundlegend kann man aber davon ausgehen, dass Veränderung eine Abweichung von einem bestimmten Zustand ist. Um der Sache näher auf den Grund zu gehen, hat sich SUMO gemeinsam mit Wolfgang Römer an einem Beispiel versucht, das eine Situation in Folge einer Veränderung darstellen soll, die uns allen bekannt ist.
Fragen Sie sich einmal selbst, wann Sie sich zuletzt in den Spiegel gesehen haben. Vermutlich erst heute, bevor Sie das Haus verlassen und sich auf den Weg in die Arbeit begeben haben. Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen? Vermutlich nicht! Vielleicht noch ein letztes Mal die Haare zurechtgerückt und auf in die Arbeit. Dabei stellt das „Vermutlich NICHT“ in der unternehmerischen Praxis ein Phänomen dar, das sich schnell zu einem Problem entwickeln kann. Man spricht dann auch oft von einer sogenannten Betriebsblindheit, also wenn man sich routinemäßig an einen Zustand gewöhnt, der auf Dauer nicht mehr hinterfragt wird, sodass Möglichkeiten hinsichtlich einer Veränderung gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Um sich einer Veränderung erst bewusst zu werden, bedarf es zum einen an Zeit, die einem erst klar macht, in welch einer komplexen Welt, getrieben von Vorsprung und Innovation, wir eigentlich leben. Selbst der Mensch ist angesichts des Alterns tagtäglich Teil einer humanen Veränderung, und das ist auch der Grund, weshalb Ihnen gestern vor dem Spiegel vermutlich nichts aufgefallen ist, denn die grauen Haare kommen nicht einfach über Nacht. Gehen wir einen Schritt weiter und nehmen an, dass Ihnen graue Haare gewachsen sind, dann gäbe es zwei Va-
rianten, wie sie reagiert hätten. Variante A, Sie können es kaum fassen, geraten in Panik und aufgrund dessen verpassen Sie die Bahn, die Sie pünktlich zur Arbeit bringen würde. Oder Variante B, Sie nehmen es offen hin, verlassen das Haus pünktlich und im besten Fall ist es Ihren Arbeitskolleg*innen nicht einmal aufgefallen. Dass Menschen eher dazu neigen, auf Veränderung zu reagieren – wo es sichtlich schon zu spät ist – anstelle zu agieren – dem vorzeitigen Befassen obliegt zwar der subjektiven Perspektive des einzelnen Individuums, ist aber tendenziell von großer Bedeutung hinsichtlich der normativen Ebene: also der Fähigkeit zu erkennen, inwiefern die Veränderung einen Einfluss auf etwas hat. Offenheit ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, Veränderung nicht nur wahrzunehmen, sondern auch damit richtig umzugehen. Dass die Schwierigkeit im Erkennen von Veränderung selbst und darüber hinaus im Erkennen von möglichen Zusammenhängen liegt, die sich positiv oder auch negativ auf angrenzende Prozesse und der Umwelt auswirken können, begründet Wolfgang Römer damit, dass Veränderung mit Unsicherheit und oft mit Angst einhergeht. Diese Faktoren grenzen uns Menschen in unseren Entscheidungen und schlussendlich auch in unserem Tun ein. Denn egal, ob Sie sich für Variante A oder B entscheiden, ändern können Sie die Situation in keinem der beiden Fälle. Fakt ist aber, dass bei Variante A die Veränderung eine negative Auswirkung auf Sie und Ihr Umfeld hat, die es vor allem in der Wirtschaft, aber auch im persönlichen Leben zu vermeiden gilt, so Römer, der Herbert Grönemeyer zitiert: „Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders.“

Wirft man einen Blick auf die Medien, dann wird einem schnell klar, dass mit der Implementierung des Internet nichts mehr so ist, wie es früher einmal war. Eine Welt ohne „Smart“ ist kaum mehr vorstellbar, vor allem nicht für die jüngeren Generationen. Geschäftsführer Gernot Kohl nahm SUMO mit auf eine kleine Zeitreise. Vor 25 Jahren wurde über eine Initiative der Landeshauptstadt St. Pölten der Grundstein für eine Bildungsstätte gelegt, die Teil der wohl größten Veränderung des letzten Jahrhunderts – der Digitalisierung – ist und sich im Zuge dessen auch selbst immer wieder verändern und anpassen musste. Die Fachhochschule (FH) St. Pölten zählt zu den bedeutsamsten Bildungsund Forschungseinrichtungen in Österreich. Ziel ihrer Gründung 1996 war es, eine zukunftsorientierte Bildungsstätte zu errichten. Für dieses Projekt lagen einige Themenschwerpunkte vor. Schlussendlich wurde durch Mitglieder des Fördervereins der Fachhochschule der Bereich der Telekommunikation als Schwerpunkt näher in Betracht gezogen und als tragende Säule in der Organisation verankert. Mit dem damaligen einzigen Studiengang „Telekommunikation und Medien“ stellte man aufgrund der Veränderung um die Jahrhundertwende im Bereich der Medien und Telekommunikation schnell fest, dass dieser Bereich weitere Potenziale verbirgt. So kristallisierten sich die Vertiefungen „Medienwirtschaft“ sowie „Medientechnik“ heraus, die bald sehr nachgefragt wurden. 2004 hatte die Institution erstmals 1.000 Studierende und erhielt den Titel Fachhochschule, so Gernot Kohl im Interview mit SUMO. Innovation und Qualität waren von Beginn an wichtige Bestandteile des Projekts FH und Treiber in Phasen der Entscheidungsfindung. Im Laufe der Jahre und aufgrund der stetig steigenden Studierendenanzahl wurden die Qualitätskriterien immer höher und man erkannte, dass die Kapazitäten und die Technik, die einen praxisnahen Unterricht möglich machen sollen, den Anforderungen nicht mehr entsprachen. Weiteres führte Gernot Kohl im Interview aus: „Daraufhin hat die Landeshauptstadt St. Pölten 2007 in die Erweiterung der Fachhochschule investiert und einen Campus errichtet, der als Medienausbildungsstätte den nötigen Platz sowie modernste Technik im Bereich der Radio- sowie TV-Technik bietet.“
Auch inhaltlich habe sich im Laufe der Jahre einiges getan, konstatiert Wolfgang Römer. Er kann sich noch gut an eine Zeit als Dozent dazumal erinnern, in der aufgrund des technologischen Wandels gerade in der Medienbranche es zu zahlreichen Umbrüchen im operativen Tagesgeschäft vieler Unternehmen kam. Neue Produkte kamen auf den Markt, mit ihnen eine Veränderung im Konsum und einer Veränderung, die neue Maßstäbe für Unternehmen und ihre Märkte setzte. So wurden bestehende Unternehmen technologischer und zugleich vernetzter. Dies ermöglichte ihnen einen neuen Zugang zu dem, was sie alle am Leben erhält: die Wertschöpfung. Ressourcen mussten effizienter eingesetzt werden, was dazu führte, dass starre Organisationen nicht mehr auf ihren Prozessen beruhen durften, da sie sonst die Anforderungen sowie die Interessen und Bedürfnisse hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Akteur*innen (Kund*innen, Lieferant*innen...) nicht mehr befriedigen konnten. Flexibilität war somit gefragt. Diese neuen Anforderungen schufen Potential für neue innovative Ideen, wodurch neue Märkte entstehen, die auch infolgedessen neuen Unternehmen die Möglichkeit bot, sich auf diesen Märkten zu etablieren und neue Maßstäbe zu setzen. Dass diese Veränderung so weit ging, dass sich nicht nur die operative Ebene an die neuen Gegebenheiten anpasste, sondern man sich auch aufgrund der Intensität strategisch neu ausrichten musste, dass sogar bis hin zu einer Adaption der Firmenphilosophie und somit der Seele eines Unternehmens führen kann, zeigt, wie wichtig es dann doch ist, Veränderung selbst aktiv mitzugestalten oder im Optimum selbst als Unternehmen, Veränderung einzuleiten und nicht erst im Nachhinein auf Veränderung zu reagieren. Denn nur so würden Wettbewerbsvorteile generiert und Ressourcen am effizientesten eingesetzt, wenn in diesem Zusammenhang das Potential der Veränderung erkannt und verstanden wurde. Aufgrund dessen haben sich auch kontinuierlich die Curricula der Studiengänge des vormaligen Departments „Medien und Wirtschaft“ immer wieder geändert. Dies führte dazu, dass sich nicht nur die Wissensvermittlung seitens der Lehrenden veränderte, sondern auch das Verständnis der Studierenden hinsichtlich medialer Kommunikation.
Dass Veränderung somit nicht immer leicht von der Hand geht und oftmals auch auf Widerstand stößt, ist darauf zurückzuführen, dass der Mensch bestehende Gewohnheiten nur ungern aufgibt beziehungsweise umformt. SUMO hat an dieser Stelle gefragt, wie man gerade in der Funktion des Entscheidungsträgers am besten agieren soll, sodass man im Sinn der Verantwortung anderen gegenüber nicht selbst in Gefahr läuft, ungeplant von der Veränderung überholt zu werden. Unabhängig von persönlichen Nuancen sind sich die Experten vor allem in dem Punkt sicher, dass Veränderung ALLE in einer Organisation betrifft. Dass der eine oder die andere im Unternehmen sich auch die Frage stellt: Weshalb müssen wir uns verändern, ist ein Zeichen, dass man gerade im Change-Prozess auf die Meinungen anderer hören sollte und demnach auch alle in den Prozess zu integrieren. Auch das frühzeitige Kommunizieren dürfe dabei nicht vergessen werden, da das Erkennen von etwas Neuem immer die schlechteren Argumente hätte, so Wolfgang Römer. Jetzt könnte man behaupten, dass gerade in Zeiten von COVID-19 der Ausbau der FH mit einem weiteren Gebäude sich nicht gelohnt hätte und man viel eher in Equipment zur Sicherstellung der Fern-
lehre investieren hätte sollen. Nichtsdestotrotz weist der Geschäftsführer der Fachhochschule St. Pölten daraufhin, dass man davon ausgehen kann, dass auch die Pandemie irgendwann ein Ende haben wird und die Studierenden an die FH zurückkehren werden, da die Lernkurve aufgrund der Interaktion im Hörsaal eine Bessere ist als zuhause vor den Bildschirmen.
Fakt ist, die Berufs- wie auch Studienwelt wird sich weiter verändern, Innovationen und neue Medien entstehen und sie werden Märkte wie Gesellschaften beeinflussen.
 von Michael Haas
von Michael Haas



Jedes Jahr staunen wir über die glamourösen Bilder, entstanden im Blitzlichtgewitter von Cannes und Venedig. Sind es die Stars, die Outfits, der berühmte rote Teppich? SUMO versuchte dieses Phänomen real zu fassen und unterhielt sich dafür mit dem Co-Geschäftsführer der „Diagonale“, Peter Schernhuber, sowie den beiden „Viennale“-Preisträgerinnen Milena Czernovsky und Lilith Kraxner
Swing in Unaufgeregtes, aber emsiges Treiben übertönt das Telefonklingeln an Presse- und Ticketschaltern. Menschen, bestückt mit blauen Armbändern, bahnen sich über zwölf Stufen abwärts ihren Weg zu einer Bar. Und schließlich Schlangen wartender Besucher*innen, die durch herausströmende Gäste der letzten Vorstellung unterbrochen werden. All das sind Szenen, die sich im hell erleuchteten Gartenbaukino in Wien um kurz vor 23:00 Uhr anlässlich der „Viennale V´21“ abspielen. Wer nicht für Getränke oder Toiletten ansteht oder in Gespräche vertieft ist, versucht einen der Sitzplätze zu ergattern, die es kurz vor Beginn der Vorstellung im Eingangsbereich noch gibt. So auch Xavier Chotard, der extra aus München angereist ist, um den Film „Spencer“ zu sehen. Er habe schon auf dem Filmfestival von Venedig davon gehört und nutze nun hier zu später Stunde seine Chance. „Eine tolle Vielfalt an tollen Filmen“ mache für ihn die „Viennale“ aus und ist wohl der Grund, sich regelmäßig auf einem der roten Kinosesseln wiederzufinden. Rote Kinosessel, die kurz vor Vorstellungsbeginn mehr und mehr von Gästen eingenommen werden und damit unter abgelegten Mänteln und Schals verschwinden. Man greift noch in die kürzlich an der Bar erworbenen Snacks und nippt am bis oben hin gefüllten Plastikweinbecher (Gläser mussten vor dem Saal auf einem Flaschenfriedhof zurückgelassen werden), dann tritt schon ein Sprecher ins Rampen-
licht. Kurz, aber enthusiastisch wird die Afterparty angekündigt, dann geht das Licht aus und der Filmprojektor fängt an zu surren.
Bis ein Filmprojektor auf einem Filmfestival zu laufen beginnen kann, muss viel an Organisationsarbeit geleistet werden. Laut Peter Schernhuber, CoGeschäftsführer und -Leiter des in Graz stattfindenden Festivals des österreichischen Films, müsse man hierbei jedoch unterscheiden zwischen den kaufmännischen und den inhaltlichen Aspekten eines Filmfestivals. So plane man budgetär bereits über einzelne Festivaleditionen hinaus, inhaltlich sei der Zyklus allerdings „ein sehr knapper“. Die COVID-Pandemie erschwerte jedoch die Organisation. So konnte das Festival 2020 nicht regulär stattfinden, 2021 sei die organisatorische Seite des Festivals geprägt gewesen von Änderungen und großen Budgetsorgen. Als das Event dann zwischen 8. und 13. Juni abgehalten werden konnte, sei es ein sehr schöner und bewegender Moment gewesen, „das zu erleben, was wir Kino nennen“. Damit Kino bei der „Diagonale“ passieren könne, vergebe man keine Aufträge an Künstler*innen und sei deshalb nicht als Produzent tätig, hält Schernhuber fest. Die Einreichungen fertig produzierter Filme würden von Einzelpersonen, Produktionsfirmen und
Verleihern zwischen September und November vorgenommen werden. Bei der Filmauswahl komme es auf drei wesentliche Punkte an, die in einem Sichtungsteam zusammen mit externen Expert*innen unter der Leitung von CoGeschäftsführer Sebastian Höglinger diskutiert werden. Zunächst versuche man zu beurteilen, welchen Anspruch der Film an sich selbst habe und wie es ihm gelinge, diesem Anspruch gerecht zu werden. Danach müsse festgestellt werden, ob der Film zur Idee des Festivals passe. Dieses versuche einen „repräsentativen Querschnitt des österreichischen Filmschaffens“ abzubilden, so Schernhuber. Schlussendlich habe man noch einen kuratorischen Anspruch der nationalen Kinematografie gegenüber, für die man auch die internationale Presse sowie internationale Kurator*innen begeistern wolle.
Noch ein weiterer Aspekt sei bei der Programmgestaltung sehr wichtig: Eingebettet in den globalen Film- und Festivalkreislauf spielt das Bemühen, Filme als Premiere zu zeigen eine Rolle. Ein kompliziertes und mitunter sehr ambivalentes Thema, so Schernhuber. Genau dieses Tauziehen um Erstaufführungen findet Lilith Kraxner allerdings „absurd“. Habe man bei einem Filmfestival Premiere gefeiert, so fielen viele andere Veranstaltungen weg. „Es ist ein Risikospiel“, postuliert Kraxner. Der Fokus auf Premieren hänge nicht zuletzt mit der medialen Aufmerksamkeit zusammen, die auf diese gerichtet werden, meint
Filmfestivals: „Das zu erleben, was wir Kino nennen“
„Das
wiederum Schernhuber. Gut sei das allerdings nicht. Zumal für die Filme. Hier herrschten dann Konkurrenzverhältnisse in der österreichischen Festivallandschaft. Grundsätzlich befinde man sich aber in einer Generation, wo man sich untereinander als Partner verstehe, was letztlich auch mit dem schwachen Stellenwert des Filmbereichs in Österreich zusammenhänge. Einerseits sei es klar, „dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten muss“, andererseits, dass die unterschiedlichen Festivals ihr Profil behalten. Auch und gerade im Fall ihres Films, einem fokussiert intimen, leisen Portrait einer erschöpften Frau.
Bevor ein Festival eine Auswahl treffen kann, müssen Filme von Filmschaffenden oder deren Vertreter*innen erst eingereicht werden. Zu diesen Vertreter*innen zählen die erwähnten Verleiher, der im Falle von Milena Czernovsky und Lilith Kraxner, den Gewinnerinnen des Spezialpreises der Jury bei der „Viennale 2021“, „sixpackfilm“ heißt. Czernovsky erläutert die Wichtigkeit der Absprache, welche Festivals bevorzugt würden. Den Film einfach so abzugeben, sei laut Kraxner am Anfang schwer gewesen, da man neben der Regie auch für Produktion, Schnitt und Drehbuch verantwortlich war. Nach einer erfolgreichen Einreichung sei Kraxner jedes Festival dann aber gleich wichtig, „das Unmittelbare“ sei allgemein das Spannende. Das Unmittelbare meint hier „Gespräche mit den Leuten, die den Film gerade gesehen haben“. Dabei sei es egal, ob es sich um ein riesiges und renommiertes Festival handele, oder um ein ganz kleines: „Hauptsache, der Film kann auf der Leinwand im Kino gezeigt und im Anschluss diskutiert werden“, so Kraxner.
Lilith Kraxner sieht andere Filmemacher*innen, die an denselben Festivals wie sie teilnehmen, nicht unbedingt als KonkurrentInnen. Man freue sich immer, neue Leute kennenzulernen. Czernovsky fügt an, dass das Schöne daran sei, überhaupt andere Filme bei diesen Festivals rezipieren zu können. Damit eine Festivalteilnahme als Filmemacherin grundsätzlich gut über die Bühne geht, sei für die beiden Regisseurinnen wichtig, gleich zu Beginn den Kontakt zu jemanden vom Festival zu knüpfen, um wichtige Tipps über die jeweilige Stadt zu erhalten. Das Angebot eines Guest Office nähmen sie ebenfalls dankend
Filmfestivals: „Das zu erleben, was wir Kino nennen“
an. Weiters seien gut essen und trinken, die Teilnahme am Rahmenprogramm, gemütliche Reiseoutfits und ein Hotel in der Nähe des Festivalstandorts Teil ihres Festival Survival Guides. „Nicht schüchtern sein, Leute ansprechen“, ergänzt Lilith Kraxner.
Das besagte Sichtungsteam, das Peter Schernhuber bei der „Diagonale“ bei der Filmauswahl hilft, ist nicht zugleich jene Jury, die den stolzen Gewinner*innen schlussendlich die Preise überreicht. Man bestelle nochmal neue Jurys, bei denen es sich um Expert*innen handele, die mit dem österreichischen Film vertraut seien. Gleichzeitig benötige es die notwendige Distanz der Jury-Mitglieder, so sollen auch internationale Expert*innen dafür angeworben werden.
Als Lilith Kraxner und Milena Czernovsky davon erfuhren, dass sie den diesjährigen Spezialpreis der Jury gewinnen würden, sei dies nochmals viel emotionaler gewesen als bei anderen Festivals, erinnert sich Kraxner. In Wien sehe man viele bekannte Gesichter, es sei eine ganz andere Art der Herausforderung und Nervosität gewesen, ein „schon irgendwie nacktes Gefühl“. Czernovsky verortet den Grund ebenfalls in der Tatsache, dass es sich bei der „Viennale“ um ein Festival in der Stadt handle, in der man wohne und seinem Alltag nachgehe. Der Preis war mit 4.000 € sowie einem Color-Grading- und Tonmischungsgutschein dotiert. Außerdem erhielten sie für ihren Film „Beatrix“ unabhängig davon einen „kleinen Ministart“ in Österreich, wenn das wieder möglich würde. Dies sei für die beiden überraschend gewesen, da „Beatrix“ ihr erster Film bei einem Festival war. Eben diese Events seien laut Peter Schernhuber Orte der sozialen Zusammenkunft, die dann gut seien, wenn BesucherInnen überrascht würden. Und das auf, aber auch vor der Leinwand.
So schnell wie der Film „Spencer“ begonnen hat, endet er auch. Das Publikum verfällt in kurzen Applaus, dann durchbricht schon der Lichtstrahl aufgrund einer sich öffnenden Tür die Finsternis. Erste Menschen stehen auf, bald sind es viele. Es ist spät, doch man redet darüber, wo man noch (überhaupt) gemeinsam Zeit verbringen könnte. Für Mathilde, eine Filmstudentin auf einjäh-

rigem Austausch in Wien, geht es nach ihrem ersten Film bei der „Viennale“ nach Hause. Angelehnt an einen Stehtisch reflektiert sie über das Festival und merkt den einfachen und günstigen Zugang an, den es in Cannes und bei anderen großen Filmfestivals nicht gebe. Ihr gefällt zudem, dass Besucher*innen
Filme von 6:00 Uhr morgens bis 23:00 Uhr abends besuchen können. Lange Kinotage also, die mit dem Aufstoßen der Schwingtür nach außen nun zu Ende gehen. Bis dann alles wieder von vorne losgeht – hier, oder auf einem der vielen anderen, je einzigartigen Filmfestivals.




 von Paul Jelenik
von Paul Jelenik

Filmfestivals: „Das zu erleben, was wir Kino nennen“

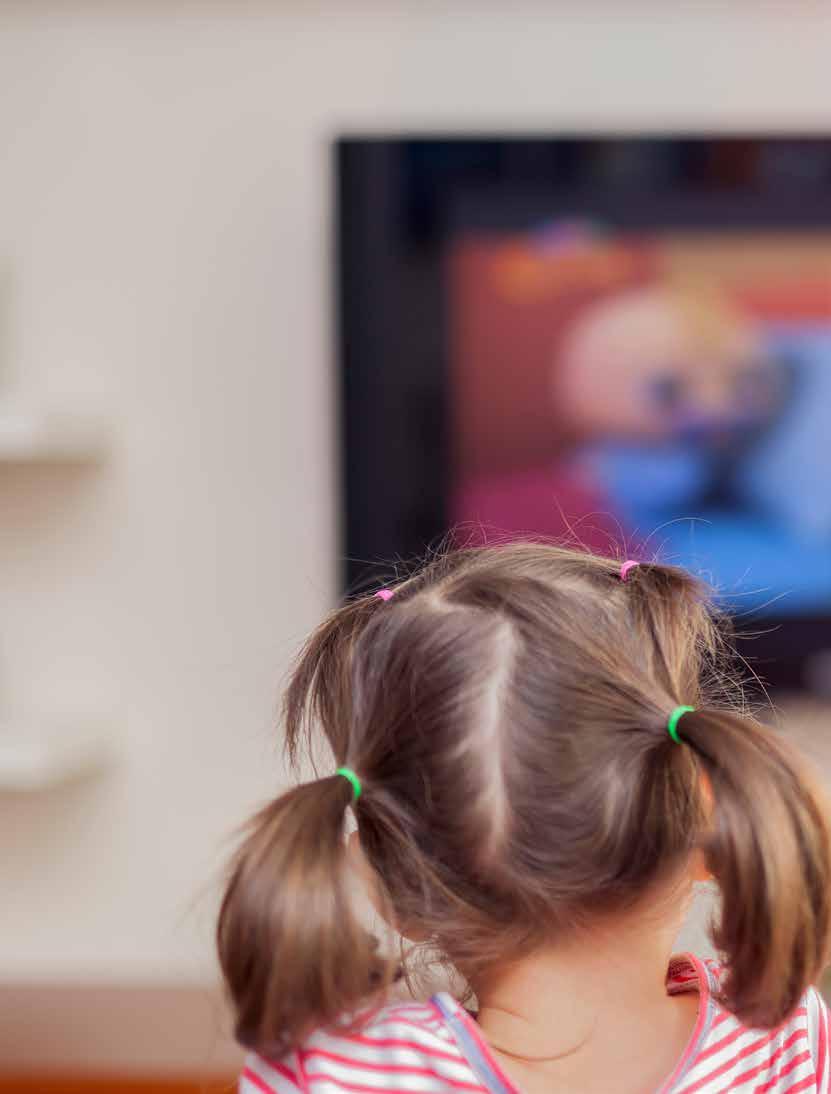
Es ist ein Zitat von einem, der es wissen muss: Hans Rosenthal war einer der ganz großen deutschen Showmaster. Er reiht sich in eine Liste mit Peter Alexander, Rudi Carrell, Hans Joachim Kulenkampff & Co. Allesamt waren sie Personen, die das deutschsprachige Fernsehen in den 1960er und 1970er Jahren maßgeblich geprägt haben. Der heutige Blick auf die historischen Samstagabendshows verrät manch überraschende Erkenntnis über die heile TV-Welt der Nachkriegsgesellschaft und wenig überraschende Entwicklungen der Fernsehrezeption. Bei allen medialen Veränderungen: Schöne Erinnerungen an eine „gute alte Zeit“ vor den Bildschirmen bleiben aber.
„Biene Maja“, „Kasperl & Petzi“ und andere Formate fesselten damals schon viele Kinder vor den Fernsehgeräten. Auch heute noch verbringen die jungen Rezipient*innen gerne Zeit vor den Bildschirmen. Schätzungen der Haupterzieher*innen nach nutzen Kinder durchschnittlich über eine Stunde lineares Fernsehen pro Tag. Dies geht aus der KIM-Studie 2020 (Kindheit, Internet, Medien) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest in Deutschland hervor. Doch während zu Beginn Kinderfernsehen vielfach als Spartenprogramm auf Sendern ausgestrahlt wurde, so wie es heute noch mit „OKIDOKI“ im ORF der Fall ist, ging der Wandel immer stärker hin zu eigenen Kindersendern, die auf hohen Zuspruch treffen.
Laut der KIM-Studie 2020 haben sechs von zehn der befragten Kinder einen Lieblingssender im TV. Dabei sind die ersten beiden Plätze von den Sendern
„KiKA“ (29%) und „SUPER RTL“ (22%) belegt. Der „Disney Channel“ (4%) und „Nickelodeon“ (4%) sind hingegen weit abgeschlagen zu den Nennungen der Erstplatzierten und reihen sich hinter
„RTL“ (10%) und „ProSieben“ (7%) ein. Anderslautend waren die Angaben bei selbiger Studie im Jahre 1999. Damals führte noch der private Sender „RTL“ (23%). „SUPER RTL“ und der „Kinderkanal“ („KiKA“) teilten sich den zweiten Rang mit je 20%.

Damit führt heute in Deutschland ein öffentlich-rechtlicher Kindersender bei den Präferenzen der Zuseher*innen vor einem Feld an privaten Kanälen. In Österreich liegen die Zahlen jedoch anders: Laut der aktuellen oberösterreichischen Kindermedienstudie haben die Hälfte der 6-10-jährige Kinder einen Lieblingskanal: 39% „YouTube“, da-
nach folgen die TV-Sender „KiKA“ (32%) und „Disney Channel (31%), gefolgt von „Netflix“ (30%) und „SUPER RTL“ (26%). Diese Studie zeigt auf, dass der ORF in besagter Altersgruppe ein Problem hat, da bloß 9% der Kinder ihn als Lieblingssender anführten. Doch worin unterscheiden sich öffentlich-rechtliche von den privaten Mitbewerbern?
Ralph Caspers meint dazu, dass das grundsätzliche Ziel, ein gutes Programm zu machen, welches gerne gesehen werde, sowohl bei den privaten, als auch bei den öffentlich-rechtlichen vorrangig sei.
Einen der wenigen Unterschiede bemerke er allerdings bezüglich der Wirkung nach außen. So seien die Recherchen für „SUPER RTL“, bei welchem er in den 90ern gearbeitet hat, deutlich
schwieriger gewesen, da die Menschen zumeist in dem Glauben gewesen seien, mit einer Krawallsendung zusammen zu arbeiten. Dass allerdings ein Kinderprogramm im Vordergrund stand und nicht Boulevardjournalismus, hätten die Meisten gar nicht richtig wahrgenommen. Dies läge nun allerdings auch schon einige Jahre zurück und könne sich im Laufe der Zeit natürlich verändert haben.
Der größte Unterschied ist wohl die Aussparung, beziehungsweise Begrenzung von Werbung bei den öffentlichrechtlichen Sendern.
Ermöglicht wird der Verzicht im Falle von „KiKA“, da der seit 1997 ausgestrahlte Sender als Gemeinschaftsprogramm der „ARD-Landesrundfunkanstalten“ und des ZDF durch einen Anteil des monatlichen Rundfunkbeitrages öffentlich finanziert wird. 1995 startete „SUPER RTL“, welcher als privater Sender natürlich auf Einnahmen aus der Werbung angewiesen ist. Beide jedoch eint, dass sie nicht rund um die Uhr Kinderformate senden. „KiKA“ zeigt eine Nachtschleife, in der je nach Empfangsart auf einen anderen Sender geschaltet oder „Bernd das Brot“ ausgestrahlt wird. „SUPER RTL“ hingegen wechselt in der sogenannten „Primetime“ zum Programm für Erwachsene.
Die Kindheit ist eine Zeit enormer und vor allem schneller persönlicher Entwicklung. Dabei werden die Heranwachsenden von vielen Sozialisationsfaktoren beeinflusst, liegen diese nun in der Nutzung von Medien, im familiären und schulischen Umfeld, im Freundeskreis oder gar in der gesamtgesellschaftlichen Ebene. All dies trägt zur Findung der Persönlichkeit und Prägung verschiedener Verhaltensweisen bei, die sich dann auch in anderen Bereichen des Lebens widerspiegeln. So beeinflusst zum einen natürlich das Fernsehen die Kinder, zum anderen wird aber auch der Fernsehkonsum von der Umwelt beeinflusst.
Große Faktoren, wie die Pandemie, hätten allgemein zu mehr psychischen Problemen bei Kindern geführt, merkt Julia Dier an. Dadurch würden sich die Heranwachsenden vermehrt in Medien zurückziehen, die älteren vielfach auf Social Media und die jüngeren dürften mehr fernsehen. Die Nutzung von Medien sei durch die Pandemie gestiegen. Doch Abseits des Gesundheitsthemas sind auch andere Themen in den Vordergrund gerückt. Viele Menschen sind sensibilisierter, sei dies nun gegenüber
Bereichen, die die Gesellschaft schon länger beschäftigen, wie Geschlechtergleichstellung und Gendering, oder Bewegungen welche in jüngerer Vergangenheit vermehrt in das Bewusstsein rücken, etwa „#BlackLivesMatter“ oder „FRIDAYS FOR FUTURE“.
Da „Die Sendung mit der Maus“ immer wieder Kinderfragen beantwortet, sind solche gesellschaftlichen Einflüsse auch hier spürbar. Zur Thematik von „FRIDAYS FOR FUTURE“ und Umweltschutz konstatiert Ralph Caspers: „Solche Fragen kommen viel mehr als vorher. Wobei es auch damals schon Fragen gab, wie zum Beispiel, als die Atomenergie ein bisschen in Verruf zu kommen, wegen Tschernobyl beispielsweise.“
Dies zeigt sehr gut, wie stark der Einfluss des Umfeldes und aktueller Vorgänge auf Kinder wirkt und dass dieser Einfluss damals wie heute das Verhalten und Wissensbedürfnis verändert. Wissensformate können diesen Informationsdurst der Kleinen stillen. Doch was sollte dabei im Vordergrund stehen: Wissensvermittlung, Wertevermittlung oder Unterhaltung?
Unser interviewter Elternteil, ein Vater zweier Kinder, erwartet sich in erster Linie einen bildenden Charakter betreffend den sozialen Umgang in Form von gewissen Wertevorstellungen, die transportiert werden sollten. Erst in zweiter Linie wünsche er sich, bei den darauf ausgerichteten Formaten, eine Vermittlung von Fakten und Wissensinhalten.
Auch Ralph Caspers sieht die Primärfunktion von Fernsehen nicht nur in Wissensvermittlung, sondern vor allem in der Unterhaltung. Er zieht einen anschaulichen Vergleich heran: „So ein bisschen, wie wenn man einem Hund eine Tablette geben möchte. Der wird die ja sofort wieder ausspucken. Deshalb muss man Tabletten immer schön dick in zum Beispiel Leberwurst einwickeln und dann schluckt der Hund das einfach runter und merkt gar nicht, was für eine Pille er geschluckt hat.“
Auch Kinder werden sich nicht mit der Intention, besonders viel lernen zu wollen vor den Fernseher setzen. Daher werden auch nicht die Formate nur rein auf Wissensvermittlung ausgerichtet. Unterhaltung ist immer der Grundstein, der den Transport von Lerninhalten erst ermöglicht. Trotz alledem lässt sich im Vergleich zu früher eine Vermehrung dieser Wissensformate feststellen. Dies resultiere laut Ralph Caspers schlicht und einfach aus der generellen Erweiterung des Angebotes und sei eine einfache Frage der Quantität.
Allerdings sind die Veränderungen im Angebot noch längst nicht die einzigen, die sich über die Jahre ergeben haben. Auch die Erzählweise und die Schnitte seien schneller und lauter geworden. Während unser interviewter Vater noch Zeichentrickfilme mit „gleichbleibenden Hintergründen“ und „nur einzelnen bewegten Figuren“ mit einer „ruhigeren Handlung“ in Erinnerung hat, seien nun Bilder stärker animiert und Aktionen schneller aufeinanderfolgend. Die Reaktion seiner Kinder auf die älteren Serien sei, dass sie diese als langweilig wahrnehmen. Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Veränderung auf die jungen Rezipient*innen hat.
Julia Dier sieht das schnellere und lautere Fernsehen als nur eine geringe Problematik, da hierbei Eltern noch guten Einblick im Gegensatz zu anderen Medien, wie das Handy, hätten. Lediglich für ganz kleine Kinder seien die schnellen Formate schlecht, da sie diese stark überforderten.

Im Laufe der Zeit sind viele ganz neue Kinderserien und -filme entstanden, doch oftmals wird auch einfach auf bestehende und bewährte Ideen zurückgegriffen. Serien wie „Biene Maja“ wurden beispielsweise lediglich adaptiert und in diesem Falle 3D-animiert. Bei solchen Neuauflagen scheiden sich natürlich die Geister und eine objektive Bewertung fällt durchaus schwer. Unser Elternteil äußert dazu: „Das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen. Aber einfach nur deshalb, weil ich es anders kenne. Wenn sich meine Kinder das anschauen, finden sie es gut.“

Dies zeigt abermals, wie stark Kinderfernsehen Menschen bis in das Erwachsenenalter prägt und wie fest verankert die Erinnerung an Originalfiguren und den Klang der Originalstimmen aus der eigenen Kindheit ist. Aus Ralph Caspers Sicht ist das Wichtigste, dass man wisse, was der Kern sei, der ein Format ausmacht. Dann könne man sehr viel rundherum verändern.
In der jüngeren Zeit hat sich die Nachfrage nach Videoplattformen und Streaming immer mehr erhöht. Mit so manchen Vorteilen, wie orts- und zeitunabhängigem Zugriff, der größeren Auswahlmöglichkeit und dem teils geringerem Werbeeinfluss lassen diese internetgestützten Anbieter das lineare Fernsehen schon teilweise sehr veraltet aussehen. So ist es durchaus bemerkenswert, dass bei der Frage nach den drei wichtigsten Lieblingssendern, -plattformen oder -streaminganbietern
„YouTube“ noch vor linearen Kindersendern genannt wird. Auch „Netflix“, „Amazon Prime“ und „YouTube Kids“ wird durchaus oft erwähnt. Das zeigt die 2020 erstellte Studie „Medienverhalten bei Kindern“, welche im Auftrag der „EDUCATION GROUP GmbH“ in Oberösterreich durchgeführt wurde, deren Ergebnisse sich von deutschen Studien durchaus unterschieden (Werte siehe oben). Zudem ist auch die geschätzte Sehdauer (KIM 2020) mit durchschnittlichen 24 Minuten für Streaming zusätzlich zu 68 Minuten linearen Fernsehen im Verhältnis gar nicht so gering.

Gründe für einen Umstieg zu Streaming seien für unseren interviewten Vater vor allem erhöhte Entscheidungsfreiheit gewesen. Er fände das normale Fernsehprogramm Filme betreffend relativ mau.
So manch ein/e Nutzer*in wird allerdings auch von der eingeschränkten Werbung auf bezahlten Plattformen angezogen. Denn Werbung beeinflusst Kinder sehr stark.
Unser interviewter Vater merke die Beeinflussung im Sprachgebrauch sehr deutlich. Dies äußere sich beispielsweise über Werbelieder, welche gekannt, gekonnt und nachgesungen werden, oder das Ersetzen von Bezeichnungen durch Markennamen.
Dabei ergeben sich diese Einflüsse natürlich nicht ausschließlich durch das
Fernsehen, sondern auch durch das Radio, Werbungen vor „YouTube“-Videos oder sonstigen Medieneinflüssen. Auch Streamingdienste schalten teilweise zumindest Trailer voraus.
Julia Dier erkennt die Beeinflussung durch Werbung, fügt allerdings hinzu, dass ein gewisses Maß an Werbung hinsichtlich der Frusttoleranz von Kindern wichtig sei. Da viele der jungen Zuseher*innen Formate ansonsten nur noch auf Abruf kennen, ohne sich dazwischen gedulden zu müssen. Der Konsumation von „YouTube“ präferiere sie das normale Fernsehen für Kinder, da Werbeinhalte dort auf die Kleinen abgestimmt seien, was bei der Videoplattform nicht durchgängig der Fall sei.
Des Weiteren geht mit dem Umstieg auf internetgestützte Kinderformate auch die Zeitgeberfunktion des Fernsehens für die Zuseher*innen verloren. Im Internet ist der Zugriff völlig frei und nicht an Ausstrahlungszeiten gebunden. Dadurch verschwinden zum Teil Strukturen, die das Fernsehen für manche Familien über Jahre geboten hat, wie die Schlafens-geh-Zeit mit dem „Sandmännchen“ oder die Hauptabendzeit um 20:15.
Allerdings setzen auch die Kindersender nicht mehr rein auf lineares Fernsehen, sondern zeigen auch im Internet Präsenz. Websites von Sendern oder erfolgreichen Formaten, passende Apps zu Kindersendungen, Mediatheken, interaktive Spiele, Diskussionsforen zu Programminhalten, abgestimmte digital verfügbare Bastelanleitungen und vieles mehr verhelfen den klassischen Kinderfernsehformaten, ihre Rezipient*innen auch online anzusprechen. Ralph Caspers erläutert: „Wenn klar ist, dass Leute nicht nur den Fernseher einschalten, sondern auch andere Geräte, dann versuchen wir auch auf den Geräten zu sein. Damit wir eben auch da eine kleine Heimat finden.“
Somit befindet sich das Fernsehen in der heutigen Zeit zwar durchaus in einem weitaus größeren Wettbewerb um Aufmerksamkeit, doch ist es immer noch für viele Menschen ein wichtiges Medium der audiovisuellen Unterhaltung. Schon allein die im Vergleich zu Streaming fast dreimal so hoch geschätzte Nutzungsdauer bei Kindern zeigt dies deutlich. Genauso trägt auch der Auftritt der Sender und Formate in der Onlinewelt dazu bei, dass das Kinderfernsehen immer noch am Puls der Zeit ist, welcher heutzutage nun einmal einfach ein wenig schneller schlägt.
von Sophie Böhm
Bücher schreiben als Brotberuf ist ein Traum Vieler. Star-Autor Thomas Brezina, Debüt-Autorin und Journalistin Eva Reisinger und Influencer, Kabarettist und Autor Michael Buchinger sprechen mit SUMO darüber, wie ihr Leben als Schriftsteller*innen aussieht und wie sie den Wandel in der Branche sehen.
Geschichten schreiben und damit das Leben finanzieren; davon träumen viele Menschen, nicht nur Kinder. Allerdings ist der Wunsch, Autor*in zu werden, neben den anderen oft genannten Tätigkeiten wie Astronaut*in oder Tierärzt*in einer der Dauerbrenner unter den Traumberufen der Kleinen. Doch im Gegensatz zur Astronautischen Raumfahrt oder Veterinärmedizin gibt es für den Beruf des/der Schriftsteller*in keine klassische wie unbedingte Ausbildung. Vor allem nicht an europäischen Universitäten. In den USA existieren an fast jedem College und auch schon an der High-School Kursangebote für kreatives Schreiben, die überlaufen sind. Ein solches Netz an Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Österreich nicht, vor allem nicht im sekundären Bildungsbereich. Auf Hochschulen werden mittlerweile vereinzelt Studiengänge im Literaturbereich angeboten, primär im östlichen Teil Österreichs. Seit dem Wintersemester 2009/10 besteht an der Universität für angewandte Kunst in Wien ein Institut für Sprachkunst. Anfänglich konnte dort lediglich ein künstlerisches Bakkalaureat-Studium in der Sparte Literatur absolviert werden. Im Wintersemester 2020 kam auch ein Masterstudiengang dazu. Außerdem bildet auch die Wiener Schule für Dichtung Autor*innen aus; wie der Name aber bereits vermuten lässt, liegt der Fokus hier sehr stark auf der Poesie. So versteht sich diese Institution auch selbst weniger als klassische Bildungseinrichtung, sondern mehr als Raum für „lehrhafte Begegnungen mit renommierten Autor*innen.“ Abgesehen von diesen Angeboten kommen diverse Kurse an den österreichischen Volkshochschulen dem „creative writing“Charakter der US-Kursangebote wohl noch am nächsten. Es gibt zwar noch Angebote, wie jene der Leondinger Akademie für Literatur, allerdings dürfte allein der Preis dieser für die meisten Literaturinteressierten Ausschlusskriterium genug sein. Ein Semester kostet dort 4.000 €.
Auch in Deutschland sind solche Angebote eher dünn gesät, eine Vorzeigerolle nimmt hier das deutsche Literaturinstitut in Leipzig ein. Dort werden
jeweils ein Bachelor- und ein Masterstudiengang in der Disziplin „Literarisches Schreiben“ angeboten. Ähnliche Ausbildungsmöglichkeiten bieten außerdem noch das Literaturinstitut der Universität Hildesheim und das Institut für szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin an.
Doch braucht es für diesen Beruf unbedingt eine spezifische akademische Ausbildung? Thomas Brezina sieht das nicht so. Er persönlich ist davon überzeugt, dass die Freude am Lesen und Schreiben und die ständige Neugier, wie man seinen eigenen Stil verfeinern kann, das Wichtigste seien. Sein Wissen verdankt er interessanten Funden in der Literatur zum Thema „Schreiben“ und er hat sich den Großteil seines Könnens über Dramaturgie, Dialog und Charaktere im Theater in London, sowie beim Lesen von – vor allem englischer – Literatur angeeignet.
Brezina befindet sich in einer privilegierten Situation, seine Bücher rangieren zumeist in den Bestsellerlisten. Auch international ist er gut im Geschäft. Zudem arbeitet er auch als Produzent im TV-Bereich.Doch wie ergeht es Newcomer*innen und weniger Bekannten?
Money, Money, Money - wie man als Schriftsteller*in über die Runden kommt Durch das Schreiben Geld zu verdienen ist hart. Eva Reisinger, die 2021 mit ihrem essayistischen Buch „Was geht, Österreich?“ debütierte, stellt klar, dass der Zugang zu Fördermitteln für Autor*innen in Österreich offener gestaltet werden müsse. „Entweder man ist sehr gut, was die Antragstellung von Förderungen angeht oder man ist auf einen Nebenverdienst angewiesen. Von den Vorschüssen, die man von einem Verlag bekommt, lebt man meist nicht allzu lang. Ausnahme sind einige wenige Starautor*innen.“ Hier sieht sie auch den Grund dafür, dass das Dasein als Schriftsteller*in und Influencer*in zunehmend verschmilzt und eine Reichweite in den sozialen Netzwerken immer mehr an Bedeutung gewinnt.
„Das kann man jetzt diskutieren, aber ich verstehe es einfach aus finanzieller Sicht komplett“. Gerhard Ruiss von der Interessensgemeinschaft Autorinnen Autoren (IG) schätzte im einem „KURIER“-Artikel 2016 die Anzahl der Personen, die in Österreich vom Schreiben leben können auf etwa 200 bis 500. Allerdings inklusive derer, die Tätigkeiten wie Werbetexten oder Ähnlichem nachgehen. Die Zahl der hauptberuflichen österreichischen Autor*innen von literarischen Werken dürfte demnach eher zweistellig sein. Gernot Wolfgruber, der im Kanon früherer Schülergenerationen Österreichs stand, proklamierte 2014 gar, dass niemand in Österreich vom Schreiben leben könne. Von den Tantiemen möglicherweise selten – sieht man von Brezina, Michael Köhlmeier, Arno Geiger und anderen Bestsellern ab –, bei anderen sind es Kräfte verzehrende Lesereisen, insbesondere für Kinderbuchautor*innen. Ein Autor zu SUMO: „Die IG hatte ausverhandelt, dass man für eine Lesung 300 Euro bekommt. Das Resultat heute ist dasselbe wie bei Musiker*innen: Sie spannen dich zusammen mit anderen, und du bekommst ein Drittel. Oder unter Vorwänden Spenden – grindig!“
Michael BuchingerCopyright: Dominik Pichler
Michael Buchinger ist ebenfalls der Meinung, dass das alleinige Dasein als

Autor*in ohne Nebenverdienste mehr Ausnahme als Regel ist. „Von allem was ich mache, sind meine Bücher eigentlich das am schlechtesten Bezahlte.“ Auch den schieren Aufwand, der hinter einem Buch steckt, hebt er hier ganz klar hervor. Für die monatelange Arbeit bleibe hier nämlich am Ende oft nicht mehr viel übrig. Das sei auch der Tatsache geschuldet, dass Bücher sich heutzutage einfach nicht mehr so oft verkaufen wie früher. Dem stimmt auch Thomas Brezina zu, er unterstreicht hier „die enorm hohe Anzahl der Neuerscheinungen.“ Die Konkurrenz schläft nämlich nicht, und in diesem Fall muss die Konkurrenz nicht unbedingt von einem anderen Verlag stammen.
Denn wer den klassischen Weg über einen Verlag nicht gehen möchte, dem bieten sich heute Möglichkeiten, mit wenigen Klicks selbst in die Verleger*innen-, Vermarkter*innen- und auch Autor*innenrolle zu schlüpfen. Das Stichwort lautet Self-Publishing. Dank der Unabhängigkeit war dieses Vorhaben schon immer einfacher umsetzbar als der klassische Weg über einen Verlag. Den Druckkosten geschuldet war es aber stets ein sehr teures Unterfangen. Mittlerweile ist es dank E-Readern aber möglich, auf Bestellung zu produzieren, was die Kosten deutlich drückt. Neben „Amazon“ bieten im deutschsprachigen Raum etliche Verlage und Buchhandelsketten verschiedenste Self-Publishing-Tools an. Während sich die Konditionen meist unterscheiden, sind die Leistungen bei fast allen Anbietern gleich, so Katrin Nussmayr in „Die Presse“ (2016). Nach einer Prüfung auf pornografische oder radikale Inhalte werden die Bücher in den jeweiligen Verkaufsverzeichnissen der Anbieter gelistet und können erworben werden. Die Kosten für das Listen des Buches übernimmt der/die Autor*in und erhält im Gegenzug für jedes verkaufte Exemplar eine Provision. Doch so einfach die Umsetzung auch klingen mag, umso schwieriger ist es, auf diesem Weg messbare Erfolge zu feiern. „Ich glaube, Self-Publishing ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt und geht leider oft schief.“, sagt Eva Reisinger. Laut ihr seien es nicht unbedingt immer junge Schriftsteller*innen auf der Suche nach ihrer Chance zum Durchbruch. Letztere würden ihre Texte tendenziell über Blogs oder diverse Social Media-Plattformen veröffentlichen. Self-Publishing nütze im deutschsprachigen Raum eher die ältere Generation für Nischenpublikationen, die nicht für das große Publikum gedacht sind.
Vom Ende der Einsamkeit
Was aber unabdingbar bleibt, ist der Schreibprozess an sich. Dieser sei – hier sind sich alle drei interviewten Schriftsteller*innen einig – ein sehr einsamer. Auch das damit einhergehende lange Sitzen und Zweifeln sind für Thomas Brezina Schattenseiten an seinem Beruf. „Vielleicht handeln auch gerade deshalb so viele Bücher vom Thema der Einsamkeit“, so Eva Reisingers Blick auf diese Thematik. Wolle man aber über etwas anderes schreiben, müsse man auch Erfahrungen sammeln, lautet deshalb auch ihr Ansatz. Sie selbst schreibe lieber im Café, im Büro oder in Schreibgruppen, so gut wie nie aber zu Hause. Michael Buchinger hingegen zieht es hinaus in die Natur, wo er sich dann in einem abgelegenen Haus voll und ganz auf den Schreibprozess konzentrieren kann: „Ich setze mir gerne Ziele und enttäusche mich ungern selbst.“ Darum reduziere sich sein Tagesablauf in den intensiven Phasen mehr oder weniger auf das Schreiben und Kochen. Sobald er sein Tagesziel erreicht habe, seien ihm aber auch Belohnungen wichtig.

Ein Blick in die Zukunft
Belohnungen und finanzielle Absicherung würde sich Eva Reisinger ebenso mehr für Autor*innen wünschen. Denn ihrer Meinung nach sei die Förderlandschaft im österreichischen Literaturbereich definitiv ausbaufähig. Als ebenfalls ausbaufähig sieht sie den Raum für Diversität in den Verkaufsregalen der Buchhandlungen. Den Aspekt der Diversität hebt auch Michael Buchinger als wichtig hervor und findet es gut, dass Stimmen von Minoritäten mittlerweile immer mehr Gehör finden. Was Buchinger und Reisinger beide als Wunsch für die Zukunft äußern, ist ein aktiver Diskurs über die gekauften Bücher. Sei es nun in Form von Book Clubs, über Social Media oder einfach in Gesprächen im Freundeskreis. Bevor ein offenes Gespräch über das Gelesene aber überhaupt stattfinden kann, müssen die Bücher auch gekauft werden. So wünscht sich Reisinger, „dass man sich darüber bewusst ist, dass man Bücher auch kaufen muss, damit Autor*innen davon leben können.“ Und genauso wie die Schriftsteller*innen von den Verkäufen leben, lebt die Gesellschaft dann vom Diskurs über das Rezipierte. Denn: Lesen erweitert Horizonte und verbindet Menschen.
 von Valeria Brunner
von Valeria Brunner
Einblicke in einen Beruf im Wandel

*Is it an ice cream cone and a chicken or a pelican?
Nope, it‘s our logo but upside down. Still, for us, it‘s important to see things from different perspectives to keep things moving.
LUX FUX is an up-and-coming digital marketing agency with offices in Salzburg and Vienna.

Feel free to check out our website: luxfux.at
Instagram: @luxfux.agency
Wie die Einschaltquote für das Fernsehen, sind Klicks und Traffic das Um und Auf für Erfolg im Online-Bereich. Generell ist Aufmerksamkeit die zentrale Währung der Medienbranche, die Digitalisierung verschärft den Wettkampf um ihren Erwerb maßgeblich. SUMO sprach mit Axel Maireder, Kommunikationswissenschaftler und Geschäftsleiter im Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) Österreich, und Lisa Sophie Thoma, Influencerin und Managing Director Influencer & Branded Entertainment bei diego5, über die Bedeutung von sozialen Medien und wie traditionelle Medien auf die wandelnden Bedingungen reagieren

Die Aufmerksamkeit, die wir Dingen zuwenden ist dramatisch kürzer geworden. Es geht alles viel schneller.“ Diese Beobachtung stellt Maireder in Bezug auf digitale Medien fest und weist somit auf eine Flüchtigkeit hin, die das aktuelle Rezeptionsverhalten prägt. In endlosen Scrolling-Schleifen schweift der Blick von einem Kurzbericht zur nächsten Schlagzeile, ohne dass der Inhalt richtig verarbeitet werden konnte. Die visuellen Eindrücke überlagern sich und Medien müssen die Aufmerksamkeit der Rezipient*Innen innerhalb von Sekunden einfangen. Im Internet spiele laut Maireder zudem die freie Zugänglichkeit von reichweitenstarken Plattformen wie „YouTube“, „Twitter“ oder „Instagram“ eine tragende Rolle, welche die Markteintrittsbarrieren im Mediensektor erheblich senkten und eine enorme Steigerung der werberelevanten Player bewirkten. Demnach buhlen nicht nur etablierte Medieninstitutionen um Klickzahlen oder Videoaufrufe der Nutzer*Innen, sondern gerade auch Privatpersonen, die Content über solche Plattformen distribuieren, im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und der Akquise von Werbepartnern mitmischen. In diesem Sinne kam es zu einer Demokratisierung des Öffentlichkeitszugangs, der früher nur journalistischen oder auch politischen Einrichtungen vorbehalten war.
Solch öffentlich wirksame Personen werden in der heutigen Gesellschaft als Influencer*Innen betitelt. Lisa Sophie Thoma war langjährig selbst in diesem Bereich tätig und konstatiert, dass der Beruf stark von einer Überlagerung des privaten und öffentlichen Lebens bestimmt sei. Dadurch dass das berufliche Schaffen stark personenbe-
zogen sei, herrsche eine stärkere emotionale Bindung zur Zuschauerschaft. Neben der Etablierung einer treuen Community sind diese Umstände auch besonders relevant für die Werbewirtschaft. Influencer*Innen versammeln Follower*innen um ihre Persönlichkeit, die Interesse daran hegen welche Auffassungen sie vertreten. Diesen Vorteil machen sich Unternehmen zu Nutze, indem sie Influencer*Innen als Botschafter*innen für Produkte anwerben, in der Hoffnung, dass Follower*Innen durch die Reichweite sowie Einfluss des*der Influencers*Influencerin zu Kaufentscheidungen verleitet werden. Thoma betont, dass potenzielle Konsument*Innen so das Gefühl einer authentischen Kaufempfehlung vermittelt bekämen und diese Form des Marketings in Zukunft noch häufiger vorzufinden seien werde.
Sponsorenkooperationen sind sehr attraktiv für Influencer*Innen und decken gemeinsam mit plattformintegrierten Werbeplatzierungen wie per Google „AdSense“ ein breites Spektrum ihrer Erlöse ab. Gerade deshalb sieht Thoma es als absolute Notwendigkeit an, Content über alle reichweitenstarken Plattformen zu distribuieren, sodass eine Diversifizierung und Absicherung der Einnahmequellen erzielt wird. Das Credo lautet hier also: So viel Klicks wie möglich! Thoma weist jedoch auch darauf hin, dass Influencer*Innen kreative und wirtschaftlich durchaus nachhaltige Wege gefunden hätten, um ihre Tätigkeit zu finanzieren. Ab einer gewissen Größe könnten sie beispielsweise eigene Produkte oder Merchandising rentabel an ihre Community verkaufen. Außerdem spielen Social-PaymentService-Anbieter wie „Patreon“ eine zunehmend wichtigere Rolle, die den Nutzer*Innen die Möglichkeit bieten, ihre Lieblings-Influencer*Innen mittels direkter Spende zu unterstützen.
Können klassische Medien auch digital?

Die Frage, die sich nun stellt: Was bedeutet all dies für klassische Medienanbieter? Auch sie adaptierten sich in puncto wandelnder Bedingungen der Digitalisierung und bedienen sich dabei unterschiedlicher Techniken, um im Rennen der Aufmerksamkeit nicht ins Hinterfeld zu geraten. Schlagworte wie „Click-Bait“ oder „Fake News“ ringen dabei am „Lautesten“ und Maireder meint einen Wandel im redaktionellen Prozess zu erkennen. Dabei spricht er von einer „Zuspitzung des Contents“. Gerade journalistische Medien im Online-Sektor würden sich eines griffigeren Sprachstils bedienen, der stark mit Extremen und Cliffhangern arbeitet und die flüchtige Neugier der Leser*Innen erwecken soll. Diese Darstellungsform hat eine lange Tradition in BoulevardBereich, fand jedoch durch die Digitalisierung und Verknappung der Aufmerksamkeitsspanne zunehmend Einkehr in die Qualitätsmedien. Reißerische Überschriften oder skandalisierende Wortwahlen avancierten so zum Status Quo und prägen den Online-Journalismus.
Klassische Medien entdecken des Weiteren auch immer mehr Plattformen für sich, die ihre herkömmlichen Distributionskanäle komplementieren sollen. Erst vor kurzen schlug die „Tik Tok“-Site des ORF hohe Wellen und zeigt die Bemühung des öffentlich-rechtlichen Senders digitale Trends in ihre Strategie zu implementieren. Thoma unterstreicht diesbezüglich, dass gerade jüngere Zielgruppen nur über solche Wege erreicht werden könnten. 25% der „Tik Tok“- Nutzer*Innen seien weder auf ‚Instagram“ noch „Facebook“ aktiv und verbringen ihre Freizeit schon gar nicht mit dem Rezipieren von linearen Fernsehprogrammen. Damit wird deutlich, dass auch klassische Medien eine Diversifizierung ihrer Kanäle erzielen müssen, wenn sie die Aufmerksamkeit aller Demographien für sich gewinnen wollen.
„Je mehr Likes und extreme Reaktionen ein Inhalt auslöst, desto eher wird er nach vorne gespült.“ Dieses Resümee zieht Maireder und macht darauf aufmerksam, wie die großen Internetkonzerne über den Onlinemarkt thronen.

Die algorithmische Grundlage dieser Seiten bestimmt, was in die Feeds der Nutzer*Innen geschleust wird und wo sich der Großteil ihrer Klicks versammelt. Qualitätskriterien nehmen hier oftmals nur eine mindere Rolle ein und
in Anbetracht der Vorwürfe der Whistleblowerin Frances Haugen gegenüber „Facebook“ scheint die Situation noch kritischer zu sein, als vorerst gedacht. Profitinteresse übertrumpft in der Unternehmensphilosophie das allgemeine gesellschaftliche Wohl und sorgt dafür, dass Verschwörungstheorien und unseriöser Content in sozialen Medien zirkulieren. Im Gegenzug konstatiert Maireder jedoch, dass es sich bei jeglichen Regulierungsinitiativen des Internet um eine schmale Gratwanderung handelt. Die großen Player erfüllen nämlich auch eine relevante Funktion und seien gerade durch ihre enorme Reichweite besonders zugänglich für Informationssowie Meinungsaustausch. Nichtsdestotrotz steigen die Anforderungen an die Konzerne und die Politik, verfolgt mit zunehmendem Interesse der Abläufe ihrer Unternehmungen. Im europäischen Raum wird der Digital Service Act weisen, welche Regelungen die Internetökonomie zukünftig formieren. Eines ist jedoch gewiss: Die Jagd nach der Aufmerksamkeit wird auch das digitalisierte Mediensystem und seine diversen Akteure weiter begleiten. Koste es, was es wolle.

Das Budget ist klein, die Kultur groß – und der Vorhang bleibt immer öfters zu. Die freie Theaterszene bildet neben den großen Institutionen wie dem Burgtheater eine zweite Säule in der österreichischen Theaterlandschaft. Doch nicht nur die Covid-19-Pandemie, sondern auch mediale Angebote konkurrieren zunehmend um die Aufmerksamkeit von Kulturbegeisterten. Wie halten kleine und mittlere Theaterbühnen dem zweiseitigen Konkurrenzdruck stand und wie gehen sie mit den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie um? SUMO sprach darüber mit zwei Theaterleiter*innen und Schauspieler*innen: Ernst Kurt Weigel vom Off Theater Wien und Michaela Ehrenstein von der Freien Bühne Wieden.
November 2021. Während das Theater im Vormonat gerade erst wieder etwas Fahrt aufnehmen konnte, kam es im November vor dem nächsten bundesweiten Lockdown zu einem schlitternden Halt – wobei manche mehr rutschten und manche weniger. Je nach Beschaffenheit und Geschäftsmodell variierte die Zufriedenheit von Theaterhäusern proportional zur Saalauslastung. Beides befand sich unterm Strich jedoch auf dem Abwärtstrend. Flächendeckend wurden Ticketeinbrüche verzeichnet, selbst Premieren im Burgtheater waren nicht voll besetzt. Weist das Burgtheater, das größte deutschsprachige Sprechtheater, eine durchschnittliche Gesamtauslastung von rund 66% auf, so stellt man sich die Frage: Wie geht es dann den freien Theatern? Und wie gehen diese damit um, wenn coronabedingt wieder einmal der Vorhang zubleibt?
Alternativ, trashig* und voller „Nebenjobber*innen“ mit unerfüllten Träumen von der großen Bühne: Eigenschaften, die nicht selten mit der freien, auch Offoder Independent-Theaterszene in Verbindung gebracht werden. Theaterhäuser oder -ensembles, die Programm abseits des Mainstreams produzieren, häufig kein festes Ensemble haben und zum großen Teil staatlich subventioniert sind. Ja und Nein. Was ist ein Vorurteil, was entspricht der Wahrheit?
Jenseits der großen Institutionen bilden freie Theater die zweite Säule in der professionellen Theaterlandschaft Österreichs. Die Szene vereint viele unterschiedliche Ästhetiken und Theatersparten. Gleichzeitig gibt es einige wesentliche Merkmale, die Akteur*innen der freien Szene gemeinsam haben. Off-Theater bieten einen Ort, an dem darstellende Kunst abseits von ästhetischen und inhaltlichen Anforderungen und dem kommerziellen Druck des Mainstream-Theaters eine Bühne finden kann. Unmittelbar im Zentrum steht zumeist die Auseinandersetzung mit der Kunst auf sämtlichen Ebenen, angetrieben von gesellschaftlichen Themen. Nicht selten werden Themen kollektiv im Ensemble erarbeitet, die Hierarchien sind flach und die Ausrichtung ist nicht kommerziell. Damit einhergehend wird auch ein Teil der freien Szene durch staatliche Mittel gefördert.

Viele Kunst- und Theaterschaffende setzen den Schritt ins freie Theater bewusst. Die selbstständigere Arbeitsweise bietet entsprechende Möglichkeiten, selbstbestimmter und autark zu arbeiten. Zumeist arbeiten sie als Teil eines Ensembles, das über eigene Räumlichkeiten verfügt oder ziehen als künstlerische Nomaden von Bühne zu Bühne. Österreich weist eine große Vielfalt an Off-Theatern auf. Unterschiede in Stil, Programm und Inszenierung prägen diese Vielfalt – und doch müssen sich alle, zusammen mit der restlichen Kultur des Landes seit März
2020 ein und derselben Herausforderung stellen. Wie gelingt den kleinen Bühnen die Pandemiebekämpfung?
Reaktion statt Aktion, lautet hierbei die Devise für viele, vor allem für große Häuser. Mangelnde Planbarkeit macht deutlich zu schaffen. „Was ist ein Plan?“, fragte sich die Intendantin des Landestheaters Vorarlberg Stephanie Gräve in einem ORF-Interview sarkastisch. „Klar, wir haben Pläne und dann machen wir wieder Pläne und wieder Pläne. Aber was es natürlich braucht, ist größtmögliche Flexibilität.“
Genau in dieser Flexibilität liegt der große Vorteil der kleinen und mittleren** Bühnen gegenüber den großen. „Man traut sich halt mehr“, so Schauspieler und Leiter des Off Theater Wien, Ernst Kurt Weigel. „Auf ihrer großen Kohle sind sie gesessen, Schockstarre. Was sollen wir jetzt machen?“, kommentiert er weiter das Handeln großer Bühnen während des Lockdowns, oder das Fehlen dieses. Die Flexibilität ermöglichte es auch vor allem dem Wiener Off Theater, schnell auf die Situation zu reagieren und Online-Lösungen zu entwickeln. Angesichts fehlender technischer Kapazitäten und mangelnden KnowHows konnte zwar zunächst noch kein absolut reibungsloser Ablauf eines Livestreamings via Smartphone garantiert werden.
Doch selbst über aufpoppende „Clubhouse“-Nachrichten, die den Livestream zusammenbrechen ließen konnte gelacht werden, bevor der Ablauf durch eine zunehmende Gewöhnung und verfeinerte technischen Lösungen professionalisiert wurde.
Sowohl Weigel als auch Michaela Ehrenstein, Leiterin der Freien Bühne Wieden, zufolge sei diese Flexibilität in sämtlichen Strukturen des freien Theaters verankert. Auch in der Programmierung werde stark davon profitiert. Programmpläne werden je nach Theater nur ein bis zwei Jahre im Voraus gemacht, können leicht umgestoßen und binnen kürzester Zeit komplett neu ausgelegt werden – somit kann nicht nur sehr beweglich auf coronabedingte Änderungen eingegangen werden, sondern vor allem auch auf gesellschaftliche. Stücke können besser auf das Zeitgeschehen angepasst werden und neue Ideen viel schneller eingearbeitet und wieder adaptiert werden. Auch die Aufgliederung in Departments ist bei Weitem nicht so groß, wie es in den großen Häusern der Fall ist. So werden Stücke im Falle des Off Theaters Wien gemeinsam entwickelt und Entscheidungen demokratisch im Team getroffen. Dabei wird stets darauf geachtet, Originalität zu wahren. Für die Klassikerpflege sind die großen Häuser zuständig sind, das freie Theater muss neue Zugänge finden. Das ist der allgemeine Konsens in der Branche. „Du kannst keinen ‚Hamlet‘ machen, dafür gibt es das Burgtheater. In der freien Szene muss man etwas anderes machen, so Weigel. Gleichzeitig machen sich auch große Bühnen immer mehr Impulse aus der Off-Szene zu eigen, was es schwierig macht, eigene neue Formen – eine „Off-Identität“ zu entwickeln – eine ganz eigene Problematik.
Aus diesen beiden Faktoren ergibt sich ein großer Handlungsspielraum für kleine und mittlere Bühnen. Nicht nur sind diese flexibler und trauen sich mehr, sondern haben auch die Möglichkeit sich Mitteln zu bedienen, die in den starren Konstrukten großer Häuser keinen Zugang finden. „Es können Impulse gesetzt werden, die in behäbigeren Betrieben nicht möglich sind“, beschreibt Ehrenstein die Dynamik kleiner Thea-
terbetriebe.
So baue die Freie Bühne Wieden auf eine Kombination aus neuen Texten, die im Rahmen von Uraufführungen mit traditionellen Theaterpraktiken umgesetzt werden und das Off Theater Wien auf eine Vermischung von lokalen und internationalen Stoffen, die sich vor allem anhand der Sprache auszeichnen und sich aneinander annähern. Grenzen verwischen und es kommt zunehmend zu Vermischungen von alt und neu, traditionell und innovativ, lokal und international.
Natürlich ist ein wesentlicher Befähiger dieses Handlungsspielraumes auch das staatliche Fördergerüst, auf das sich viele freie Bühnen stützen. Es macht ein Stück weit unabhängig von Eintrittserlösen – und zugleich stark abhängig von der Gunst der Fördergeber. Und diese möchten natürlich unter dem Strich ein Ergebnis sehen. Dass die Förderung bei Nichterbringung dessen dann auch schnell wieder weg ist, zeigt die Praxis. Erst im Jänner 2021 wurde dem Off-Theater der Stadt Salzburg die gesamte Jahresförderung gestrichen –wegen unzureichender innovativer Aspekte, heißt es in der Begründung. Wie lassen sich also Förderverpflichtungen mit dem Anspruch an Flexibilität und Originalität der freien Theater vereinen? Für Weigel stelle dies ein Kontrast in sich dar. Dass „unterm Strich“ für Kurator*innen aus eingereichten Stückkonzepten ein Ergebnis herausspringen soll, stehe mit seinem grundlegenden Verständnis von der Aufgabe seines Theaterschaffens im Konflikt: nämlich Fragen aufzuwerfen und nicht, sie zu beantworten. Das Ergebnis eines jeden Theaterstücks sei somit für jede/n Zusehende/n individuell interpretierbar. Aus dieser hohen Subjektivität und Unberechenbarkeit ergibt sich auch die Schwierigkeit einer Förderung im freien Theater.
Theater zwischen Nullen und Einsen
Doch wie geht es in Zukunft weiter? Werden Medien immer mehr Einzug ins Theater finden – und umgekehrt? Jüngste Entwicklungen sprechen dafür. Nur eine Woche vor dem erneuten landesweiten Lockdown im November 2021 ließ man im Rahmen der Nestroy-Gala die ungewöhnlichste Spielzeit der jüngeren Theatergeschichte Revue
passieren – und zeichnete digitale Formate mit einem Corona-Spezialpreis aus.
Auch im Programm des Off-Theaters
Wien werden Nullen und Einsen in Zukunft weiterhin wesentliche Rollen spielen. Das Feedback auf bisherige digitale Lösungen fiel sehr positiv aus: Man erreichte Publikum auf der ganzen Welt und entdeckte neue Möglichkeiten, mit Zusehenden durch die Kamera zu interagieren. Darin, dass dabei digitale Formate das Live-Erlebnis zunehmend überflüssiger machen werden, sieht Weigel keine Gefahr. „Solange es Menschen gibt, gibt es Theater“. Genauso wenig, wie es sich Cineast*innen in Zukunft nicht nehmen lassen werden, ins Kino zu gehen, werden Theaterliebhaber*innen auch wieder ins Theater zurückkehren. Zwar ist die Ablenkung durch alternative Entertainmentformen groß, doch so ist es auch der Drang, über sich selbst zu lernen und sich Gedanken darüber zu machen, welche Aufgabe ein/e jede/r in der Welt hat. Und das sieht Weigel als zentralen Aspekt im Theater. „Im Mittelpunkt steht der Mensch im Theater für mich. Der Mensch, der leidet, der denkt, der liebt, der stirbt und lebt und Leben schenkt, der verzweifelt – das ist für mich interessant. Und der wird immer interessant sein und da brauche ich eigentlich gar nichts dazu, außer einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin, der oder die mir etwas über mich beibringen kann.
von Sarah Schöllhammer Infobox Klein, Mittel, Groß- und Vollbühnen. Das sind die Unterschiede:
Während nach alter Definition die Grundfläche der Bühne für die Klassifizierung ausschlaggebend war, wird heutzutage vor allem nach Zuschauerkapazität untergliedert. Fasst der Raum bis zu 99 Personen, spricht man von einer Kleinbühne, bei 100-400 Personen von einer Mittelbühne und alles was darüber liegt gilt als Voll- oder Großbühne.
Hass, Bloßstellung, keine Gnade und Grenzen. Weder online noch offline. Ein neuer Treffpunkt des Mobbinggeschehens ist unter anderem „TikTok“ geworden. Um das Thema besser zu verstehen, sprach SUMO mit einem betroffenen Opfer und einem Täter, die in diesem Artikel den Namen Nicole und Leon tragen.
Eine Stück Salami wird ihr ins Gesicht geschossen: „Hier friss deine Artgenossen! Du fette Sau!“ schreien einige ihrer Mitschüler*innen. Andere filmen während des gesamten Geschehens, um es nachher auf „TikTok“ hochladen zu können. Nicole bricht in Tränen aus. Es sind Erzählungen aus einer Zeit, die sie beinahe ins Grab gebracht hätten. Einer Zeit, in der sie exzessivem (Cyber-)Mobbing ausgesetzt war.
In ihrem Aufsatz „Cyberbullying als neues Gewaltphänomen“ (2009) erläutern Thomas Jäger und Julia Riebel, dass es beim Cybermobbing darum gehe, stetig neue Technologien einzusetzen, um wiederholt und mit voller Absicht andere Menschen zu beleidigen, zu bedrohen, zu verletzen oder auch „nur“ um Gerüchte über sie zu verbreiten. Im Fall von Nicole treffen alle erwähnten Gründe zu.
Das Cybermobbing hat schon bald in der Schule begonnen. Neben Beleidigungen im Klassenzimmer, Bloßstellungen in der Pause und herablassenden Kommentaren während der Busfahrt musste sich Nicole auch in ihrer Freizeit dem Mobbing hingeben. Nachrichten über sie in Chats, bearbeitete Bilder von ihr die die Runde machten oder Ausgrenzungen von schulinternen Gruppen waren ihr Alltag. Mit der Zeit entwickelten sich nicht nur neue Kommunikationsplattformen, sondern es wurden neue Orte „erschaffen“, an denen exzessives Mobbing betrieben werden konnte. „Sie machten Bilder und Videos von mir, die sie sich dann gegenseitig schickten.“ Die Bilder, die daraus entstanden sind, wurden auch meist Nicole selbst geschickt. Gemeldet hat sie die Vorfälle nie. Sie hatte Angst vor den Konsequenzen, vor dem, dass ihr nicht geholfen und alles noch schlimmer wird. „Im Nachhinein weiß ich, dass ich mir damals schon Hilfe suchen hätte sollen, aber ich habe
mir immer wieder eingeredet, dass ich ja selbst daran schuld bin.“ Sie versuchte, die Mobbingangriffe zu ignorieren; so zu tun, als wüsste sie nichts von den Bildern und Videos. Nicole hatte die Hoffnung, dass sie irgendwann aufhören werden. Doch das Gegenteil war der Fall: Das Mobbing wurde in die Öffentlichkeit verlegt, Videos über Nicole wurden nun auf „TikTok“ gepostet. Ihr Outfit und ihr Aussehen wurde in den Videos bewertet. Außerdem wurde manchmal das Mobbing in der Schule gefilmt und über den chinesischen Kanal veröffentlicht. Nicole betont, dass die Videos gar nicht das Schlimmste waren, vielmehr haben sie die Kommentare der anderen User*innen verletzt. „Einige schreiben, dass ich mich aufgrund meiner hässlichen Visage doch am besten gleich umbringen sollte. Andere machten Vorschläge, wie man mich noch mehr bloßstellen könnte. Ich war am Ende meiner Kräfte.“ Die Folgen: Zwei Suizidversuche, Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik und die tägliche Einnahme von Medikamenten.
Der Videochatscreen bleibt schwarz. Leon will unerkannt bleiben und vor allem nicht gefilmt werden. Er selbst bezeichnet sich bewusst als Täter und weiß auch, was er damit anrichten kann und anrichtet. Seine Welt ist „TikTok“. Hier betreibt er eine Art von Hetzjagd gegen bestimmte User*innen und andere Personen, denen er zufällig begegnet. Um die Handlungen und vor allem die Gedanken hinter Cybermobbing besser verstehen zu können, gibt Leon einen Einblick in die Welt der Täter. „Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es hauptsächlich aus Langeweile mache, weil es so einfach und fast schon grausam klingt, aber was soll ich machen, Langeweile ist eigentlich der Hauptgrund.“ Es sei eine Ablenkung vom Alltag, geprägt von Neid, Langeweile und Gruppenzugehörigkeit. Durch die gemeinsame Abneigung gegen einen Menschen auf
„TikTok“ entstünden Gruppen, er fühle sich dann in seiner Meinung bestätigt und erwünscht. Er selbst verfüge bereits über 20 Accounts, via dieser er Hass-Kommentare schreibe. Content habe er auf keinen der Kanäle bereitgestellt. Was ihn am meisten triggere, seien Frauen, die mit ihren Videos bewusst nach Bestätigung suchten. „Wenn die keinen Hate haben wollen, dann sollen die den Kommentarmodus ausschalten, die wollen ja beleidigt werden, um Reichweite zu bekommen.“ Der Schäden, die er mit seinen Bemerkungen anrichtet, sei er sich zwar bewusst, aber es ist ihm ziemlich gleichgültig. Seiner Meinung nach sollte man keine Videos auf „TikTok“ posten, wenn man das Echo nicht aushalte. Videos, die jemanden bloßstellen sollen, wie am Beispiel von Nicole, findet er unterhaltsam. „Es ist ein einfacher Weg, sich einer Gruppe anzuschließen und die paar Kommentare tun doch niemanden weh.“ Ein weiterer Punkt den Leon an Cybermobbing schätzt ist die Anonymität. Seine Identität sei geheim und das gebe ihm die nötige Sicherheit. Er benütze stets, wenn er online unterwegs ist ein Pseudonym. Außerdem finde er die Intensität des Kanals wichtig: Manchmal werde ein von ihm geposteter Kommentar zum Top-Kommentar, das bedeutet, dass er somit schnell zu sehen ist. Es erreicht somit ein großes Publikum.
Im Jahr 2017 führte das Statistik Research Department in Deutschland eine Umfrage zu den möglichen Motiven von Cybermobbing durch. Befragt wurden 212 Schüler*innen, die schon einmal Cybermobbing betrieben haben. Rund 45% der 212 Befragten gaben an, Cybermobbing zu betreiben, weil es die betroffene Person verdient hätte. 43% erwähnten, dass sie Streit mit der gemobbten Person haben und es deswegen tun. Aus Spaß machen es etwa 23%.
Mobbing kann Menschen kaputt machen. Sie bis zum Äußersten bringen. Doch das Grausamste am Mobbing ist die Tatsache, dass die Täter*innen ihren sogenannten Spaß schon nach kurzer Zeit vergessen und Opfer noch Jahre später über die Taten und Worte der Mobber*innen nachdenken und sich den Kopf darüber zerbrechen, WARUM gerade sie zum Opfer wurden. Hier sollten auch die Kanalbetreiber ansetzen
von Jennifer BinderJohannes, 24 Jahre Teile deinen persönlichen #glaubandich Moment auf:
Was zählt, sind die Menschen.

Ausgehend von Schweden belebt die Gratiszeitung weltweit den kriselnden Zeitungsmarkt. Doch nicht auf allen Zeitungsmärkten schaffte es die Gratispresse erfolgreich Fuß zu fassen. Mit Fokus auf den DACHRaum diskutiert SUMO über die Implementierung und Etablierung der Gratiszeitung mit dem Medienwissenschaftler und Direktor des Instituts für Praktische Journalismus- und Kommunikationsforschung Michael Haller und Fritz Hausjell , stv. Vorstand am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien.
Vor einiger Zeit haben Tageszeitungen, die allein durch den Werbemarkt finanziert werden, weltweit die bislang statischen Marktverhältnisse aufgebrochen. Etablierte Zeitungsverlage sehen ihre Marktposition und ihren Stellenwert in der Gesellschaft bedroht. In manchen Ländern resultiert daraus ein hart umkämpfter Wettbewerb, konstatierte Horst Röper bereits 2006 („Media Perspektiven“). Zudem birgt die Abhängigkeit vom Werbemarkt zwei wesentliche Probleme: Zum einen herrscht eine große Substitutionskonkurrenz auf dem Markt, zum anderen können Werbetreibende fast identische Zielgruppen erreichen, in verschiedenen Medienprodukten werben oder auf das Internet ausweichen, so Mündges und Lobigs („Handbuch Medienökonomie“, 2020).
Die Geburtsstunde der Gratistageszeitung reicht bis ins Jahr 1882 zurück. Der Unternehmer Charles Coleman schaffte es seinen „Generalanzeiger für Lübeck und Umgebung“ in hoher Auflage zu produzieren und zu verteilen. Später wurde die Zeitung schrittweise zu einer Kaufzeitung umgestellt. Ähnliche Vorreiter sind unter anderem die „Manly Daily“ aus Australien, „Aspen Daily“ in den USA und die „Daily News“ aus Großbritannien, stellte Michael Haller in seinem großen Forschungsprojekt „Gratis-Tageszeitungen in den Lesermärkten Westeuropas“ fest (erschienen als Buch 2009). Mit der Gründung des Titels „Metro“ 1995 in Stockholm hat sich das Konzept als wirtschaftlich tragfähig erwiesen. Das Boulevardblatt etablierte sich schnell als nachgefragter Zeitungstyp, dennoch wurde die neue Marktnische auf Seiten der Qualitätszeitungen behindert. Diese Strategie funktionierte in manchen Ländern weniger erfolgreich als in anderen, so Röper. Somit etablierten sich innerhalb
von Europa markante unterschiedliche Trends. Bevor es Gratiszeitungen im tagesaktuellen Bereich gegeben habe, wurden bereits Gratisblätter, wie das „Bezirksblatt“, seit den frühen 1990er Jahren in Österreich verbreitet. Von den Menschen werde aber auch in dieser Hinsicht wahrgenommen, dass die redaktionelle Kraft eher bescheiden sei. Diese Form der Gratispublizistik sei bereits am Land bekannt gewesen und habe nicht die Qualitätszeitungen betroffen, erklärt Hausjell.
Um Reichweite zu generieren, müssen Zeitungen, die ausschließlich über Werbeerlöse finanziert werden, ihren Fokus auf die Distributionspolitik legen. Um optimale Reichweite erzielen zu können und um die entsprechende Zielgruppe, meist im Alterssegment von 25-50-jährigen, zu erreichen, bedarf es einer Distributionslogik, die das Publikum zeitlich sowie räumlich anspricht, sodass es optimal nutzungswillig ist. Wichtig dabei ist, dass potentielle Rezipient*innen auf die Zeitung aufmerksam gemacht und in weiterer Folge angelockt werden. Die Medienhäuser setzen dabei auf die Verteilung meist im öffentlichen Nahverkehr, per Zeitungsspender oder Handverteiler. Demnach werden Gratiszeitungen auch oftmals als Pendlerzeitungen betitelt, da diese überwiegend in Bahnhöfen verteilt werden. Dieses effiziente Verfahren bringt unter anderem den Vorteil, dass innerhalb kürzester Zeit viele Exemplare verteilt werden können. Berufstätige junge Pendler*innen sind für die Werbewirtschaft besonders attraktiv. Auf diese Weise können aber auch Angehörige von Minderheiten eher erreicht werden, konstatierte Haller 2009. Viele Menschen würden die Gratisblätter als eine Art Ergänzung zu ihren üblichen Medien lesen,
meint Hausjell. Besonders das sozial schlecht gestellte Publikum greife am stärksten zur Gratispresse, das sei aber auch durchaus auf Seiten der Medienmacher*innen intendiert.
HMS
Die Zeitungsmärkte der DACH-Länder weisen Gemeinsamkeiten in Punkto Struktur und Entwicklung auf, aufgrund von historischen Ereignissen und unterschiedlichen Marktgrößen gibt es laut Mündges und Lobigs aber auch fundamentale Unterschiede. Während die Tamedia AG (heute TX Group AG) mit dem Boulevardblatt „20 Minuten“ (deutschsprachig) und „20 Minutes“ (französischsprachig) sowie die Ringier AG – bis 2018 – mit „Blick am Abend“ es geschafft haben, drei gut aufgestellte Gratiszeitungen mit hohen Reichweiten in der Schweiz zu etablieren, hat sich laut Haller in Deutschland bisher auch aus rechtlichen Gründen keine Gratistageszeitung richtig entfalten können. Auch die Schweizer Gratiszeitungen nahmen ihren Ausgangspunkt in Skandinavien. Die schwedische Boulevardzeitung „Aftonbladet“ des nor-


wegischen Medienkonzerns Schibsted stand in direkter Konkurrenz mit dem schwedischen Kinnevik-Konzern, da dieser 1995 in Stockholm mit seiner Tochtergesellschaft Modern Times Group das Gratisblatt „Metro“ lancierte und den Abo-Zeitungen einen Teil ihres Anzeigenaufkommens wegnahm. Schibsted übernahm die Strategie der Konkurrenz und gründete mit Partnern in der Schweiz die 20 Minuten Holding GmbH. Auch in Österreich haben sich drei Gratistageszeitungen durchgesetzt: „Heute“, „Österreich“ und die „Tiroler Tageszeitung Kompakt“ haben sich konsolidiert und es geschafft, den Zeitungstyp zu etablieren. Nach der Einführung des Blattes „Heute“ 2004 versuchte „Österreich“ 2006 erst als reine Kaufzeitung Fuß zu fassen. Jedoch habe der Markt dies nicht ge-

dass die Ängste eher unbegründet sind. Nachdem in Deutschland das Projekt „15 Uhr aktuell“ beendet wurde und der sogenannte Kölner Zeitungskrieg in den Jahren 1999-2001 ausgefochten war, traute sich kein Verleger mehr, in den größten und umsatzstärksten Markt einzutreten, so Medienforscher Haller. Die schwedischen Medienkonzerne Metro International und Schibsted planten den Eintritt, nahmen allerdings wieder Abstand von diesem Vorhaben. Ein Grund für den Rückzug sei vor allem die Angst vor einem langen Kampf mit der führenden Axel Springer-Verlagsgruppe gewesen. Seither gab es keine erneuten Anläufe, Gratistageszeitungen zu etablieren. Deutschland illustriert laut Haller, dass der Rückgang von Marktanteilen deutscher Zeitungen und auch die Gesamtauflagen der Tagespresse unbeeinflusst von der Gratispresse verlief.
tragen, sodass der allergrößte Auflagenteil gratis vertrieben wird. Vor der Gründung von „Heute“ publizierte der Verlag Mediaprint („Krone“ und „Kurier“) 2001 als Verteidigungsstrategie gegen Schibsted sein eigenes Wiener Gratisblatt „U-Express“. Auf Grund der steigenden Kosten, die für die notwendigen Qualitätsstandards essenziell waren, und wegen Konflikten mit den Miteigentümern der „Kronen Zeitung“ habe man sich nach drei Jahren dazu entschieden, ihn wieder einzustellen. In Deutschland wurden Gratiszeitungen nach mehreren gescheiterten Versuchen um die Jahrtausendwende vollständig vom Markt verdrängt, schrieb Haller 2009. Großverlage wie Springer wollten keine kostenlose Zeitung in Deutschland, weil sie um das eigene Geschäft fürchten. Europaweite Untersuchungen ergaben laut Marcus Haas („Media Perspektiven“, 2006) aber,

Hypothetisch gesehen, können zwei verschiedene Trends aus der Diskrepanz zwischen Boulevard- und Qualitätszeitungen entstehen. Entweder schaffen es kostenlose Zeitungen als Ersatz für Kaufzeitungen zu fungieren und werden diese zu gegebener Zeit vom Markt verdrängen. Oder sie werden als erkennbares andersartiges Substitutionsprodukt anerkannt, das laut Haller (2009) eine andere Leserschaft beziehungsweise Nutzungswünsche bedient. Zudem hat sich die wirtschaftliche Basis der Presse verschlechtert. Werberückgang und Auflagenschwund bestimmen die Lage, somit gefährden knappe Ressourcen die Qualität des Journalismus, konstatierten Hagenah, Stark und Weibel („Medien und Kommunikationswissenschaft“, 2015). Laut Haller würden immer weniger junge Menschen Qualitätsjournalismus unterstützen, da die Inhalte jener Zeitungen auch in Zukunft online verbreitet werden. Das Ganze erfolge auf einer stark diversifizierten Weise, vom E-Paper über Podcasts, lokale TV-Videos sowie Newsletter bis hin zu digitalen Special Interest-Angeboten und Services. Hinter der Vielfalt stecke dennoch auch eine gewisse Einfalt, da die Inhalte einer Mehrfachverwertung unterliegen. Aus einer Recherche entstehen viele verschiedene Ausspielformate, dies könne für die Endnutzer*innen mühsam werden, da herausgefiltert werden muss, ob es sich nun um einen identen Inhalt handle, unterstreicht Hausjell. Aktuell beob-
achte man die Weiterentwicklung vom Gratisangebot zum hybriden Angebot, das bedeute, dass das informatorische Grundrauschen gratis bleibe, eigene Stories aber via Paywall nur mehr kostenpflichtig einsehbar sind. Das führe insbesondere zum oft debattierten Thema Clickbaiting. Die Gratiszeitung sei im Unterschied zu den Wochenblättern für Haller lediglich ein Übergangsmodell. An dieser Stelle könne man sich das bekannte Riepl’sche Gesetz in Erinnerung rufen, wonach neue Medien alte Medien nicht verdrängen. Gratiszeitungen werden in dieser Hinsicht als eine Ergänzung des Marktes und nicht als Ersatz angesehen. Haller zufolge funktionieren digitale Gratisangebote als Erweiterung der gedruckten Gratiszeitung, die hätte gegen die Ubiquität des Internet keine Chance. Wenn man sich ansieht, wie oft klassische Printmedien schon zu Grabe getragen worden sind, haben sie dennoch sehr viele andere Medien, unter anderem das Radio und Fernsehen, miterlebt sowie überlebt. Sieht man sich die mutmaßliche Inseratenaffäre rund um eine österreichische Gratiszeitung ansieht, dürfe nicht außen vorgelassen werden, dass diese Skandale auch einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft jener Blätter haben werden, resümiert Fritz Hausjell.
Während den Paralympics 2021 kämpften die Medien förmlich um ihre Sendezeit. Allein der britische Fernsehsender „Channel 4“ übertrug mehr als 1.300 Stunden aus Tokio. Nach Großevents allerdings wird dem Behindertensport nur noch wenig mediale Aufmerksamkeit geschenkt. Über mögliche Gründe beziehungsweise zukünftige Hoffungen sprach SUMO mit dem Präsidenten der Special Olympics Österreich Peter Ritter sowie Nico Feißt, Pressesprecher des Parasportvereins TSV Bayer 04.

Einmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze – diese zufriedenstellende Bilanz zog die österreichische Nation nach den Paralympics 2021 in Tokio. Obwohl es „nur“ ein Medaillenspiegel ist, zeigt dieser laut einer Presseaussendung des Österreichischen Paralympischen Committee deutlich die Professionalisierung des Behindertensports auf. „In den vergangenen Jahren hat sich der Behindertensport stark weiterentwickelt und ist heutzutage auf einem noch nie dagewesenen Niveau“, erklärt Nico Feißt. Sein Verein TSV Bayer 04 Leverkusen umfasst diverse Sportarten, von Schwimmen über Sitzvolleyball bis zu Leichtathletik, er selbst wurde im letzteren Bereich für den Paralympic Media Award nominiert. Auch der Präsident der Special Olympics Österreich Peter Ritter schließt sich dieser Meinung an: „Das Interesse, der Bekanntheitsgrad und die Möglichkeiten des Behindertensports sind im Vergleich zu den letzten Jahrzenten deutlich gestiegen.“ Eine wesentliche Unterscheidung, die hierbei vorgenommen werden muss, ist die Abgrenzung zwischen Paralympics und Special Olympics. Beide Sportbewegungen verfolgen die gleichen Ziele und Vorstellungen, doch während bei den Paralympics nur Personen mit körperlicher Behinderung teilnehmen dürfen, werden bei den Special Olympics auch Personen mit intellektueller oder Mehrfachbehinderung inkludiert. Die Sportnation Österreich ist insgesamt nicht nur bei den Paralympics, sondern auch bei den Special Olympics äußert erfolgreich. So konnten die Sportler*innen bei den Sommerspielen 2019 in Abu Dhabi 52 Medaillen mit nach Hause bringen.
Medien – aber wohin schauen sie?
Vom 24. August bis 5. September 2021 war kaum ein anderes Sportthema präsenter in den Medien als die Paralympics. Warum so plötzlich? „ORF Sport+“
übertrug tägliche Tageszusammenfassungen, ARD sowie ZDF haben mit mehr als 62 Stunden so viel wie selten zuvor live die Paralympics übertragen. Der britische Fernsehsender „Channel 4“ widmete sich in den 13 Tagen voll und ganz dem Behindertensport und übertrug sogar mehr als 1.300 Stunden aus Tokio. Doch nach dem Großevent wurden – und werden – die Berichterstattungen deutlich weniger. Eine Studie aus dem Jahre 2016, die im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums durchgeführt wurde, bestätigt diese Schieflage und zeigt, dass sich die Berichterstattung über Menschen mit Beeinträchtigung lediglich auf einige wenige Themenschwerpunkte konzentriert. Knapp 60% des Berichtsvolumen der untersuchten Medien entfällt auf die Themen Paralympics, Sportunfälle und Charity. Über sonstige sportliche Ereignisse und Erfolgsgeschichten wird merklich weniger berichtet. Nico Feißt sieht die mediale Situation nicht ganz so eng und hebt vor allem die positiven Veränderungen hervor. „Das mediale Interesse ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich gewachsen. Heutzutage wird der Behindertensport auch in Nachrichtenblöcken erwähnt, was früher undenkbar gewesen wäre. Obwohl die Berichterstattung zwischen den Paralympics abnimmt, kann man erkennen, dass deutlich mehr über den Behindertensport als in der Vergangenheit gesprochen wird.“ Gründe für das steigende Interesse der Medien sieht er vor allem in der hohen Professionalisierung und generellen Attraktivität des Behindertensports. Auch Peter Ritter betont die positiven Seiten der Berichterstattung: „Egal, wie klein ein Beitrag ist, er bringt ein enormes Ergebnis und steigert den Bekanntheitsgrad des Behindertensports. Speziell in den so genannten Erste Welt-Ländern kann man gute mediale Entwicklungen sehen, da das gesellschaftliche Interesse und die Möglichkeiten wachsen.“
Liegt es in der Natur der „Sache“?
Laut Nico Feißt gebe es verschiedene Gründe, warum dem Behindertensport nach Großevents weniger mediale Aufmerksamkeit geschenkt werde. „Dass die Berichterstattung abnimmt, ist logisch und liegt in der Natur der Sache. Wenn man sich mal anschaut über wie viele Sportarten nach den Olympischen Sommerspielen berichtet wird, bleibt eigentlich auch nur der Fußball übrig.“ Darüber hinaus möchten viele Vereine und Verbände das Risiko hinsichtlich ihrer Ressourcen nicht eingehen, um Kamera- oder Fotografenteams zu engagieren. Dadurch werde automatisch weniger über behinderte Sportler*innen berichtet. Peter Ritter erklärt sich das abnehmende Interesse der Medien nach Großevents ähnlich und behauptet: „Olympiaden, Weltmeisterschaften und nationale Spiele haben einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft als kleinere Events. Dadurch ist es klar, dass die Berichterstattung nach Special Olympics oder Paralympics abnimmt.“ Ebenso ergänzt Ritter, dass zum Beispiel Bezirksmeisterschaften des Behindertensports eher in Bezirkszeitungen aufgegriffen werde und es oftmals durch die geringere Lesereichweite so wirke, als würde gar nicht darüber berichtet werden.


Nico Feißt und Peter Ritter sind sich darin einig, dass die mediale Zukunft des Behindertensports vielversprechend aussehe. „Die Berichterstattung über die Paralympics 2024 in Paris wird mit Sicherheit nochmal ein neues Level erreichen. Bereits 2012 bei den Paralympics in London habe ich gedacht, dass es größer nicht mehr werden kann –und siehe da, die Entwicklungen sind gigantisch‘“, konstatiert Feißt euphorisch. Medien haben mittlerweile verstanden, dass der Behindertensport ein gesellschaftlich etabliertes Thema sei und sich an großer Beliebtheit erfreue. „In London 2012 haben wir es versucht, alle Interviewanfragen möglich zu machen, in Tokio 2021 war das aufgrund der Vielzahl einfach nicht mehr machbar“, fügt der Pressesprecher hinzu. Außerdem ist Feißt davon überzeugt, dass die Berichterstattung auch zwischen den Großevents zunehmen wer-
de. Peter Ritter sieht der Zukunft ebenso freudig entgegen und betont, dass die inklusiv-gesellschaftliche Bedeutsamkeit des Behindertensports in den letzten Jahren erst so richtig bewusst gemacht worden ist. „Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr versteckt, man wird sie zweifellos auch in Zukunft weiterhin stark medial aufzeigen. Wenn genauso viel Aufmerksamkeit den Menschen mit Behinderung wie den Menschen ohne Behinderung geschenkt wird, dann haben wir schlussendlich unser Ziel erreicht“, resümiert Ritter.

Copyright:
Copyright: Oliver Kremer_DBS
Sport spaltet, bewegt und verbindet. Sei es Fußball, Formel 1 oder Skifahren – Rezipient*innen versammeln sich in Scharen vor den Bildschirmen, um diese Events live mitzuverfolgen. Hinter den Kulissen tragen ORF, „DAZN“, „Sky“ & Co. jedoch ihren eigenen Wettbewerb aus und müssen für die begehrtesten Übertragungsrechte die Grenzen ihres Budgets ausreizen. Wie sich der Sportlizenzmarkt über die letzten Jahre weiterentwickelte und welche Hürden in Zukunft zu überwinden sind, erfuhr SUMO im Gespräch mit Hans Peter Trost, Leiter der Hauptabteilung Sport beim ORF, und Mario Lenz, Operating Officer & Director Group Sports Rights bei „PULS 4“.
„Live ist DAS wesentlichste Ereignis im Sport“, erklärt Trost und weist damit auf die Bedeutsamkeit von Sportübertragungsrechten für TV-Unternehmen, deren Rezipient*innen als auch die Werbewirtschaft hin. Die Faszination rund um Sport sei so tief in der Gesellschaft verankert, dass nahezu alle Sinus-Milieus (Zielgruppen-Typologien) angezogen werden. Gerade Großereignisse machen dies besonders deutlich. Das letztjährige Hahnenkamm-Rennen 2021 verfolgten im ORF 1,4 Millionen Österreicher*innen und das Finale der Europameisterschaft 2021 fesselte sogar rund 2 Millionen an die heimischen Bildschirme. Daran anknüpfend betont Lenz auch, dass Leute aktiv nach Sportinhalten suchen. Anders als bei Programmpunkten im Unterhaltungsbereich fallen hier die Werbemaßnahmen geringer aus, da die relevanten Ziel-

gruppen die Sportinhalte meist schon antizipieren oder sich selbstständig über ihre Ausstrahlung informieren. All diese Umstände machen exklusive Sportlizenzen so attraktiv, sind aber auch der Grund, weswegen sie sich zu so kostspieligen Gütern entwickelt haben. Doch wie werden diese Lizenzen eigentlich erworben?
Pauschal lässt sich darauf keine eindeutige Antwort formulieren, denn je nach zuständigem Sportverband gibt es abweichende Abläufe und andere Entscheidungskriterien. Grundsätzlich lassen sich jedoch Unterschiede im Erwerb von Premium-Lizenzen, wie die UEFA Champions League oder die Formel 1, und „kleineren“ Lizenzen aus weniger
populären Sportarten erkennen. Die bedeutsamen Übertragungsrechte von wirtschaftlich lukrativen Lizenzgebern werden im Normalfall plattformneutral ausgeschrieben und Interessenten können sich innerhalb eines festgesetzten Zeitraums für die befristeten Lizenzen bewerben. Die Vergabe läuft allerdings nicht über die zuständigen Sportverbände, sondern wird von externen Agenturen abgewickelt. Früher kümmerten sich die Sportverbände selbstständig um die Vergabe ihrer Lizenzen, jedoch weist Trost darauf hin, dass die zunehmende Komplexität im Lizenzhandel ein eigenständiges Vorgehen ohne juristische Beratung unmöglich machte. Anders als vor 20 Jahren seien Übertragungsrechte heutzutage in zahlreiche Lizenzpakete segmentiert. So können Unternehmen das Recht erwerben, Highlights von Sportereig-
nissen auszustrahlen, Wettbewerbe zeitversetzt zu übertragen oder lediglich News-Elemente in ihr Programm zu integrieren.
Trotz der gestiegenen Vielfalt an Produkten herrscht am meisten Interesse noch immer rund um die Live-Übertragungsrechte, da sie, gerade wenn sie exklusiv für ein Sendegebiet erworben werden, klare Wettbewerbsvorteile schaffen können. Die Segmentierung der Lizenzen ist aber auch mit wirtschaftlichen Vorzügen für die Sportverbände und damit einhergehend den einzelnen Vereinen verbunden. In der letzten Ausschreibung der 1. und 2. Bundesliga konnte die Deutsche Fußball Liga nach eigenen Angaben durch die verschiedenen Pakete Lizenzerlöse in Höhe von über 4 Milliarden € generieren.
Bei kleineren Lizenzgebern ist wesentlich weniger Geld im Umlauf, aber Lenz erkennt dafür eine engere Partnerschaft zwischen Verband und Lizenznehmer. Hier verzichten die Verbände meist auf externe Agenturen, da sowohl die gebotenen Lizenzen als auch die Menge an Interessenten überschaubar seien. Die Lizenzvergabe wird somit eigenständig vom Verband übernommen. Aus eigenen Erfahrungen bei den Verhandlungen mit derartigen Lizenzgebern berichtet Lenz weiters von direkter Absprache und größerer Flexibilität in der genauen Struktur der Rechtepakete. Die Lizenzen der bedeutsamen Sportverbände seien im Vergleich meist mit strengen Auflagen verbunden und generell herrsche wenig Verhandlungsspielraum in Bezug auf die Rahmenbedingungen der Übertragung. Dies hänge auch damit zusammen, dass aufgrund der Lukrativität dieser Rechtepakete ein schwächeres Abhängigkeitsverhältnis auf Seite des Lizenzgebers vorzufinden ist. Kleinere Verbände suchten dahingegen händeringend nach langfristigen Partnerschaften und seien daher offener für Kompromisse.
„Die Zeiten, wo jemand forderte, ich zahle eine Gebühr und möchte alles haben, sind vorbei.“ Diese These stellt Trost auf und gesteht ein, dass es sich für den ORF in Zukunft immer schwieriger gestalten werde, anderen Marktteilnehmern in Österreich lukrative Lizenzen strittig zu machen. Dafür fehle schlichtweg die Zahlungskraft. Der Wettbewerb hat in der jüngsten Vergangenheit wesentlich an Fahrt aufgenommen und Unternehmen wie „Sky“, „DAZN“ oder auch „Servus TV“ zemen-

tierten ihr gewinnorientiertes Interesse an der Übertragung von Sportereignissen. Das Geld bündelt sich in Österreich hauptsächlich um wenige Sportarten, die garantiert Zuschauer*innen versprechen und sichere Investitionen abbilden – allen voran Fußball, gefolgt von Formel 1 und Skifahren. Der ORF kann im Vergleich dazu eine viel größere Varietät aufweisen und zeigt über all seine Kanäle insgesamt 75 verschiedene Sportarten. Dieser Umstand ist auf den gesetzlich definierten Programmauftrag zurückzuführen, bietet dem ORF aber auch die Möglichkeit, Sportarten mit einer vermeintlich niedrigeren Zuschauerschaft massentauglich mitaufzubauen. Trost sieht hier vor allem Entwicklungspotential im Frauenfußball und unterstreicht die Investitionen, welche der ORF erfolgreich über die letzten Jahre in diesem Bereich tätigte. Die EM-Halbfinalpartie zwischen Österreich und Dänemark verfolgten zum Beispiel 1,3 Millionen Menschen live mit, wodurch deutlich wird, dass der ORF nicht unbedingt auf Premium-Lizenzen angewiesen ist.
Die Übertragung von Frauenfußball ist ein exzellentes Beispiel für ein Lizenzprodukt mit unausgeschöpften Potential. Grundsätzlich konstatiert Lenz
meinsam wachsen und groß werden können. Sportarten wie American Football oder Darts waren früher sehr wenig nachgefragte Rechte, doch haben sich mittlerweile zu attraktiven Lizenzen entwickelt, da das gesellschaftliche Interesse gewachsen ist. Lenz weist jedoch darauf hin, dass Unternehmen einen langen Atem benötigen, um solche Marken gewinnbringend am Markt etablieren zu können.
In der Theorie klingt es nach einem leichten Unterfangen, doch die Realität zeichnet ein anderes Bild. Der aktuell schon intensive Konkurrenzkampf droht sich in den nächsten Jahren weiter zu verschärfen. Lenz schätzt hier vor allem den endgültigen Markteintritt von globalen Playern wie „Amazon Prime“, die aktuell schon Lizenzen der UEFA Champions League erworben haben, als nächste Entwicklungsstufe ein. Diese hegen wirtschaftliche Anliegen in noch größeren Dimensionen und seien deshalb weniger an Übertragungsrechten für vereinzelte Sendegebiete interessiert. Ihr Fokus liege eher darauf, einzelne Territorien zusammenzufassen, damit sie die Lizenzen multinational verwerten können. Erdenklich wären Übertragungsrechte für größere Gebiete in ganz Europa, doch solche Prognosen sind immer mit einer Ungewissheit behaftet.
jedoch: „Die attraktivsten Sportrechte kosten auch am meisten Geld. Es gibt nicht irgendwo diesen einen verborgenen Schatz, den bis jetzt niemand gehoben hat.“ Des Weiteren führt er an, dass es sich gerade für kleinere Anbieter im Privatsektor progressiv herausfordernder gestalten wird, dem steigenden Wettbewerb am Lizenzmarkt entgegenzuwirken.
Deswegen seien sie zwangsweise darauf angewiesen, nach Partnerschaften auf nationaler Ebene zu suchen oder im Idealfall Sparten zu finden, die ge-
Des Weiteren könnten die Sportverbände bald selbst in die Rolle schlüpfen, ihren Content an die Öffentlichkeit auszuspielen. Lenz meint, dass Sportverbände in Zukunft möglichst viel Reichweite über ihre eigenen Kanäle generieren wollen. Neben den bereits existierenden sozialen Kanälen wäre es für manche Verbände auch leistbar, ihre Inhalte über eigene kostenpflichtige Plattformen digital zu distribuieren. Die National Football League bietet mit dem NFL Game Pass bereits solch einen Service an und Lenz kann sich vorstellen, dass weitere Sportverbände nachziehen. Allerdings betont er auch, dass die Verbände nicht auf die Lizenzeinnahmen von TV-Unternehmen verzichten können und sie einen wichtigen Faktor in der Generierung von Reichweite darstellen. Eine Koexistenz beider Distributionswege empfindet Lenz daher als wahrscheinlichsten Ausgang

Bei all diesen Diskussionen rund um die Wirtschaftlichkeit von Sportübertragungsrechten werde laut Trost schnell vergessen, dass Sport im weitesten Sinne auch Kulturgut ist und für die Gesellschaft eine sinnstiftende Funktion innehat. Dadurch, dass viele sportliche Wettbewerbe nur mehr mit einer monatlichen Abonnementgebühr oder mittels anderen Zahlungsschranken gesehen werden können, entwickele sich die Rezeption von Sport zu einer finanziell aufwändigen Beschäftigung, die sich nicht jede/r leisten kann. Die Vielfalt an Anbietern birgt des Weiteren eine starke Segmentierung der Sportinhalte in sich. Rezipient*innen müssen also Abonnements mit mehreren Anbietern abschließen, um Sport-Content in seinen vollen Zügen genießen zu können. Die Zahlungsbereitschaft
für Abo-Dienste sei in den Augen von Lenz zwar gestiegen, sollte aber nicht Anlass geben, den Zugang zu Sport weiterführend zu beschränken. Gerade Wettbewerbe von nationalem Interesse dürften sich nicht hinter Zahlungsschranken befinden, da sie kulturelle Werte transportieren. Gemeint sind Auftritte der österreichischen Nationalmannschaften oder Ereignisse wie die Olympischen Spiele. Wettbewerbe dieser Art solle jede/r sehen können, die bzw. der es will. In welche Richtung sich der Sportlizenzmarkt weiterentwickelt, hängt von den Markteilnehmern und ihren monetären Schmerzensgrenzen ab. Fakt ist allerdings, die gesellschaftliche Anziehungskraft von Sport wird definitiv bestehen bleiben.



Der Studiengang „Medienmanagement“ feiert seinen 20. Geburtstag. Solch runde Zahlen bieten stets Anlass dafür innezuhalten und zurück und nach vorne zu blicken. Rund 1.650 Absolvent*innen gingen mit erfolgreichem Abschluss aus dem Diplom-, Bachelor- und Masterstudium hervor. Der wandelbaren Medienbranche geschuldet, wurden acht (!) Änderungen des Curriculums vorgenommen, in denen rund 30 Dozent*innen und rund 100 Lektor*innen aus Wissenschaft und Praxis ihr Wissen weitergaben. Abseits der - wenngleich bemerkenswerten, so doch auch nüchternen - Zahlen, ist ein Studium mehr als Titel und Fakten. Wer könnte besser über diese „Lehrjahre“, die Learnings, die Highlights wie die zähen und schwierigen Momente im späteren Beruf sprechen als jene, die Medienmanagement studiert und mittlerweile in der Medienbranche Fuß fassen konnten. Lesen Sie im Folgenden Streiflichter jener Interviews, die im Rahmen der Lehrveranstaltung „Markt- und Mediaforschung I“ entstanden sind und bei denen mutige Studierende im 2. Semester bei erfolgreichen Alumni und heutigen Branchengrößen nachgefragt und auch nachgehakt haben. Wer es genau wissen möchte: Die Langversion finden Sie auf medienmachen.at oder via QR Code Scan.

Theo Kämmerer und Florian Geberth sprachen mit Roland Hochegger, Leiter Finanzen & Personal im ORF-Konzern, über den Wert journalistischer Arbeit bei fortschreitender Digitalisierung, über die Bedeutung von O-Tönen im Rundfunk sowie über kreative Bewerbungsstrategien.
...Sie haben mir da gerade einen Elfer aufgelegt, den ich jetzt verwandeln muss. Sie sind ja nicht nur Prokurist bei der ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG (OMC), sondern auch in der Personaladministration von „Ö1“, „Ö3“, „FM4“ und beim ORF Radio-Symphonieorchester. Von vielen Parteien ist die Zahl an Mitarbeiter*innen und Dienstnehmer*innen, die der ORF hat in den letzten Jahren arg unter Beschuss geraten. Ist das eine Challenge für Sie? Ja, es gab vom Stiftungsrat in den letzten Jahren klare Vorgaben. Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsgremium des ORF, das bei börsennotierten Unternehmen der Aufsichtsrat ist. Der Auftrag war, die Valorisierung, die der ORF für die Gebührenentgelte beantragen kann und die in der Regel vom Stiftungsrat genehmigt wird, deutlich geringer ausfallen zu lassen. Intention war, dass die Gebühren für die österreichischen Konsument*innen niedriger werden oder zumindest nicht entsprechend erhöht werden müssen. Da muss man auch dazusagen, dass etwa in Wien und Niederösterreich nur ein Drittel dieser Gebühren dem ORF zugutekommt und


immerhin ein Drittel als Einnahmen für die Bundesländer oder für die Stadt Wien einbehalten werden. Das heißt zwar ORF-Gebühr, ist es aber eben nur zum Teil.
Der Stiftungsrat hat also im Sinne des österreichischen Publikums verfügt, der ORF solle mit weniger Geld auskommen. Das ist legitim, genauso wie man das bei anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen auch gemacht hat. Es ist eine riesengroße Herausforderung, denn die ORF-Geschäftsführung hat sich entschieden, das Leistungs-Portfolio nicht einzuschränken. Es geht also darum, mit 15 bis 20 Prozent weniger Personal dieselbe Leistung zu erbringen. Zusätzlich hat man mit „ORF III“ noch einen weiteren Fernsehsender aus der Taufe gehoben, der in seiner Nische unglaublich erfolgreich ist und ein Vielfaches etwa der Einschaltquoten von „3sat“ hat. Parallel dazu sind wir jetzt in der Entwicklung des ORF-Players, neben der TVthek. Die TVthek ist ja auch etwas, das selbstständig sehr, sehr gut angenommen wird. Die vielen Apps, die die On Demand-Dienste anbieten, sind dabei noch gar nicht angesprochen. Das bedeutet also mehr Leistung und weniger Personal. Das heißt natürlich, in vielen Strukturen wesentlich effizienter zu werden, weniger Zeit zu haben für Produktionen und auch natürlich die modernen Mittel der Digitalisierung zu nutzen.
Melissa Brunbauer und Magdalena Kanev sprachen mit Melanie Spanl, Producerin bei Disney, über den Alltag in einer Firma, die nicht nur in Kinderaugen Strahlen zaubert, über das Erzählen von Geschichten im Bewegtbild- und im Audiosektor und nicht zuletzt über richtige Vorstellungsstrategien vor allem für Frauen.

...Was ist es bei „Disney“, das dich jetzt doch schon relativ lange dort hält? Vor allem die Kolleg*innen und das Umfeld. Es ist natürlich eine attraktive Marke, das kann man nicht verschweigen. Jeder, der „Disney“ sagt, hat Strahlen in den Augen und das ist einfach toll. Da arbeiten die besten Storyteller unserer Zeit und es ist generell eine tolle Firma - von den Kolleg*innen bis zu den Chef*innen. Ich glaube, das Spannendste an meinem Job ist, dass sich alle paar Jahre etwas grundlegend ändert. Ein Jahr machen wir Programm für Sechsbis Neunjährige, im nächsten Jahr für Teenager. Als der „Disney Channel“ vom Pay-TV ins Free-TV kam, haben wir plötzlich für die Primetime produziert. Das war auch ganz neu. Und jetzt ist „Disney+“ dazugekommen und wir machen plötzlich Formate fürs Streaming.
So ändert sich alle paar Jahre etwas und es bleibt immer spannend. Das mag ich so an meinem Job.
Wenn du jetzt deiner Arbeit nachgehst, gibt es da Punkte, wo du denkst: „Ach, das kenne ich von der Fachhochschule!“ Ich glaube, was ich bis heute noch brauche, sind Präsentationen ohne Ende. Das werdet ihr nie loswerden, könnt euch darauf freuen. Ich glaube, ich habe viel Erfahrung mitgenommen über die Zusammenarbeit in Gruppen, wie man sich auch mit Leuten, die man gar nicht so gut kennt, zusammenrauft und trotzdem was Cooles dabei rausbringt.
Würdest du sagen, dass dich auch die Fachhochschule irgendwie für diesen Bereich vorbereitet hat oder war das einfach deine Richtung und du bist sie trotzdem gegangen? Ich glaube, die Fachhochschule gibt einem das Werkzeug in die Hand. Damit kommt man an Stellen, wo man beweisen kann, dass man etwas kann oder ist. Man bekommt durch die FH die Qualifikation, damit man sich an solchen Stellen bewerben kann und man lernt so, wie man sich präsentiert.

Peter Hofbauer, verantwortlich für die Gesamtleitung Online der „Niederösterreichischen Nachrichten“ und der „Burgenländischen Volkszeitung“, sprach mit Jannik Fürst und Julian Landl über seine Studienzeit als unbequemer Student mit Hauptfach „SUMO“ und Nebenfach Medienmanagement, über richtiges Zeitmanagement und richtige Prioritätensetzung.

...Man sagt ja oft: Wer das Hobby zum Beruf macht, der muss nie wieder arbeiten gehen. Trifft das auf Sie zu? Wollten Sie schon immer in die Medienbranche? Das trifft auf mich so nicht zu. Da gibt es sicher andere Optionen. Momentan ist leider kein Formel1-Cockpit mehr frei und abgesehen davon wäre ich jetzt schon zu alt dafür. Spaß bei Seite. Natürlich war die Medienbranche von Beginn an sehr interessant für mich. Als ich 2006 zu studieren begonnen habe, war für mich damals nicht einschätzbar, welche Bedeutung und welche Durchdringung des Alltags durch die Medien in den Jahren danach noch folgen werden. Um das zeitlich einzuordnen: Ich habe zu studieren begonnen als es noch kein I-Phone gegeben hat (lacht). Als ich im Masterstudium war, sind IPads auf den Markt gekommen. „Facebook“ war bei uns noch nicht etabliert, von „Twitter“, „WhatsApp“, „Instagram“ & Co. gar nicht zu sprechen. Ausgehend davon könnte ich mir vorstellen, dass die Generation, die jetzt im Studieneinstieg ist und sicher viel mit Social Media zu tun hat, ihren künftigen Job mitunter als Hobby bezeichnet.

Gibt es jetzt irgendetwas, das Sie jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht anders machen würden? Beziehungsweise, welchen Tipp würden Sie sich von Ihrem früheren Ich zur Studienzeit geben?
(…) Es macht durchaus Sinn diese Rolle, die man als Medienmanager hat, auch für sich zu reflektieren. Du bist nicht Journalist, bist in der Regel aber auch kein Controller – dieses Rollenverständnis als Schnittstellenmanager und als Projektmanager vor allem, das war mir nicht bewusst. Mit dieser Frage konfrontiere ich auch immer die Studierenden im Praxislabor: Was könnt ihr eigentlich nach dem Medienmanagement-Studium? Und dann kommt ganz oft: „Wir wissen über alle unterschiedlichen Medienarten Bescheid.“ „Ja, aber was könnt ihr? Um ein Beispiel zu nennen: Ein Arzt weiß hoffentlich auch um die Anatomie des Menschen und er kann halt dann zum Beispiel operieren. Und was können wir denn als Medienmanager*in?“ Diese Frage zu reflektieren und dann draufzukommen: Hey, wir sind eigentlich Kunsthandwerker für die Medienbranche. Wir schauen, dass die Medien Produkte weitergestalten, neue Produkte auf den Markt bringen. Wir sind nicht die Schreiberlinge, weil wir nicht perfekt schreiben können, wir sind nicht die Programmierer*innen, weil wir nicht die Techniker*innen sind. Aber wir sind die, die in Form eines Konzepts den Grundstein für jedes Projekt künftig legen.

Copyright: P7S1P4_M.Koenig

zu heute? In welchen Tätigkeitsfeldern erkennst du die stärksten Veränderungen? Es ist allein schon eine Riesenveränderung, seitdem ich bei „ProSiebenSat.1PULS4“ angefangen habe. Allein schon, wenn man die Konkurrenz betrachtet. Das waren damals ganz klar andere Fernsehunternehmen und da im Wesentlichen der ORF und ATV; plus natürlich – und das war schon immer die Konkurrenz auch vom Fernsehen –andere Freizeitangebote. Denn die Leute müssen ja nicht vor dem Fernseher sitzen, sie könnten ja auch zur selben Zeit im Gastgarten sitzen. Man rittert ja um die Zeit der Menschen.
ses ganze Rad am Laufen halten und auch am Laufen halten müssen. Wenn sie irgendwann einmal sagen, sie gehen vom Investment-Gaspedal runter, dann implodiert das ganze Kartenhaus.
Mario Lenz, Geschäftsleiter Aktuelle Produktionen und verantwortlich für die Sportrechte der Sendergruppe ProSiebenSAT1PULS4, diskutierte mit Linus Duschl und Paul Frühwirt über die Bedeutung von Fußball in seinem beruflichen wie privaten Leben, die Vorteile eines Studiums im Pionierjahrgang und die Dynamik des Bewegtbildmarktes.
...Kommen wir jetzt mit einem kurzen Gedankenexperiment, nämlich zur Veränderung der Medienbranche: Wenn wir die Welt um 20 Jahre zurückdrehen, wie erinnerst du dich an die damalige Medienlandschaft im Vergleich
Damals waren es wie gesagt der ORF, ATV und wir. ATV gehört mittlerweile zu uns, „Servus TV“ ist aufgekommen und viel Geld haben sie schon immer hineingeworfen, aber jetzt haben sie auch die Strategie dahingehend geändert, dass sie das Geld in Sportrechte investieren. Das hat auch nochmals alles verändert. Aber der Grund für die beiden größten Unterschiede ist die technische Entwicklung, dass es auch leichter geworden ist Bewegtbild in die Masse zu tragen. Das hat zur Folge, dass jetzt sehr viele Medienunternehmen, die eigentlich gar nicht aus dem Bewegtbild kommen, insbesondere Zeitungen bzw. Printverlage, Bewegtbild machen.
Auf der einen Seite gibt es natürlich „YouTube“, die zwar noch immer behaupten, sie sind kein Medienunternehmen, aber natürlich sind sie ein Medienunternehmen und sie leben auch gut davon; das ist mit dem UserGenerated-Content noch einmal eine ganz andere Sache. Und dann gibt es diese Over-the-top-Plattformen wie „Amazon Prime“, „Netflix“ und Co, die mit sehr viel Investment weltweit die-

Lisa Hotwagner, Morgenmoderatorin beim „Ö3 Wecker“, sprach mit Christoph Toifl und Bernhard Gribitz über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben und über die vielfachen Herausforderungen an den Job einer Radiomoderatorin.
...Du hast gesagt, du hast in der Nacht angefangen. Kann man sagen, wenn man in der Nacht moderiert, sind jetzt nicht so viele Zuhörer*innen, und man ist ein bisschen „freier“, unter Anführungszeichen? Sicher, auch. Du wirst sowohl von dem Publikum als auch von den Chefs und Chefinnen nicht so beobachtet. Du stehst auch nicht so im Fokus wie z.B. im „Wecker“. Da haben wir tatsächlich tägliches Feedback. In der Nacht hast du das nicht. Deswegen ist es ja so ein bisschen, unter Anführungszeichen, eine „Übungsplattform“. Es ist zwar sehr hart, dort zu beginnen, aber es ist nicht so schlimm, wenn du dich einmal vertust oder wenn mal was schief geht – gerade, wenn du anfängst und eh überfordert bist. Du stehst da vor diesem riesengroßen Mischpult und da gibt es so viele Elemente, die du
Lisa Hotwagner, Moderatorin bei Ö3
Copyright: Philipp Lipiarski

drücken kannst, unterschiedliche Begriffe, die du verwendest – alles sehr neu. Du bist dann von dieser ganzen Technik und den Möglichkeiten überrollt und das, was du sagst, ist oft das letzte, worüber du nachdenkst. Wie beim Autofahren. Du lernst erst einmal Gas zu geben und die Kupplung zu bedienen. Deswegen war es gut in der Nacht zu beginnen, du probierst dich einfach aus. Und du hast Airchecks. Das sind sozusagen Feedbacktermine, wo du dir entweder mit dem Chef oder expliziten Airchecker*innen die ganze Sendung durchhörst, sowie alle Einstiege, die du machst. Das wird dann ganz genau analysiert – was du gesagt hast, wie du es gesagt hast, wann du es gesagt hast – oder das Timing verbessert, Feedback und Input gegeben.
Das Feedback kann man dann sehr leicht einarbeiten oder ist es sehr schwer, wenn man sich selbst umstellt? Teils, teils. Du darfst nicht vergessen, gerade beim Moderieren gibst du sehr viel von dir her. Es ist alles was du sagst sehr persönlich, wie du es formulierst, welche Wörter du verwendest, was du erzählst, und jede Kritik ist ein bisschen Kritik an dir selbst. Und das hast du in manchen anderen Bereichen, etwa wenn es ums Technische geht, nicht. Deswegen ist es am Anfang auch ein bisschen ein Aussiebverfahren.


Katharina Tauber und Viktoria Ecker im Interview mit Elisabeth Sonnleitner, Teamleiterin für Content Marketing und Publishing beim ÖGB Verlag über die Faszination für Journalismus und die Verpflichtung die Rahmenbedingungen dafür zu sichern, über die Freude der Wissensaneignung sowie Mut zu Pausen und Innehalten.

...Wie kamst du dann darauf Medienmanagement zu studieren? Ich hatte mit 16 so einen Drang alles zu wissen, was es auf der Welt nur geben kann. Ich habe gemerkt, dass es so viele spannende Themen gibt wie z. B. Feminismus und politische Bildung. Dann habe ich mir gedacht: „Wie cool es wäre bei einem Medienunternehmen zu arbeiten, wo ich dafür bezahlt werde, dass du ich mich mit Dingen gut auskenne?“ Ich war von der journalistischen Seite getriggert, weil ich während der Schule schon bei der „NÖN“ im Lektorat in meiner Heimatstadt nebenbei gearbeitet hatte. Ich fand diese NewsroomDynamik immer cool. Im Rahmen des Bachelorstudiums bin ich darauf gekommen, dass der journalistische Alltag mit meinen privaten Bedürfnissen und Zielen nicht so gut zusammenpasst. Aber ich habe immer gewusst, dass ich im Medienumfeld tätig sein will, weil es für mich einfach unglaublich wichtig ist, dass wir unabhängige Medien haben und das bedeutet auch sehr stark finanzielle Unabhängigkeit. In meinem letzten Job etwa hat alles, was wir gemacht haben, dazu beigetragen, unabhängigen Journalismus zu finanzieren z. B. durch die Konzeption neuer Werbeprodukte. Heute verbessere ich durch unsere Medienprodukte die Arbeitsbedingungen von Menschen in Österreich und stärke ihre Rechte.

Copyright: Niederkofler
Die richtige Kombination für mich ist in der Branche zu arbeiten, in der ich arbeiten will, und dass die Arbeit auch mit meinen Erwartungen an ein gutes Leben zusammenpasst.
Bernhard Sonntag, Vorstandsreferent der „Austria Presse Agentur“ (APA), diskutierte mit Antonella Bacher und Lisa Schinagl über falsche Erwartungen ans Studium, die Tücken des Perfektionismus und seinen zentralen inneren Motor, immer etwas dazulernen zu wollen.


...Sie haben es schon angedeutet, aber welche verschiedenen Tätigkeitsfelder hatten Sie schon inne im Job? Am Beginn war das Praktikum im Marketing der APA, da habe ich ein Marketingkonzept ausgearbeitet. Das war eher theoriegeleitet, da war die FH ein guter Hintergrund, weil man da noch die ganze Literatur präsent hatte. Dann habe ich in der internationalen Firma „MINDS International“ zuerst als Researcher gearbeitet und auch von der FH profitiert. Ich habe mir Trends im Mediensektor auf internationaler Ebene angesehen, habe Reports dazu geschrieben und versucht, diese Trends wie Citizen Journalism oder – wie es damals auf Englisch hieß – Hyperlocal Content in Hinblick auf die Nachrichtenagenturen zu analysieren. Das Netzwerk für das ich tätig war, war ein globales Netzwerk für Nachrichten. Man kann sich das vorstellen wie den „Verband Österreichischer Zeitungen“ (VÖZ), nur eben auf globaler Ebene für Nachrichtenagenturen. Nach dem Studium bin ich Vollzeit eingestiegen in die Firma und habe den Research-Bereich übernommen und eben das mit ein paar Mitarbeiter*innen weitergeführt. Wir haben monatlich Newsletter zusammengestellt mit den relevantesten Themen für die Entscheidungsträger*innen in den Nachrichtenagenturen. Dazu kamen einzelne Projekte, größtenteils Vernetzungsarbeit zwischen Abteilungen innerhalb der Nachrichtenagenturen. Innerhalb der Nachrichtenagenturen gibt es ja nicht nur Redakteur*innen, sondern auch zum Beispiel eine Platt-
Copyright:
form, von der Presseaussendungen verschickt werden, es gibt Pressespiegel, Grafikabteilungen usw., und wir haben die jeweiligen Fachabteilungen vernetzt. Zum Beispiel die Infografiker*innen aus Japan, Australien und Österreich, um zu schauen, was jetzt gerade technisch aktuell ist und was man voneinander lernen kann. Das waren Projekte, die sehr spannend waren für mich. (…)
im Radio oder wo sind Sie in die Branche eingestiegen? Ich habe immer das Gegenteil von dem gemacht, was irgendjemand von mir geglaubt hat. Ich komme aus einer Pädagog*innenfamilie und der Wunsch meiner Eltern war, dass ich Lehrerin werde. Natürlich wollte ich das nicht machen, weil es ja von mir erwartet worden ist. Genauso war es beim Praktikum. Jede/r hat gefragt: „Na Laura, zu welchem Radiosender gehst du denn jetzt?“ Ich habe mir gedacht: Nein, Radio habe ich vier Jahre lang gemacht. Was kann mir ein Radiosender noch beibringen? Wahrscheinlich gibt es professionelleres Equipment und besseren Schnitt. Aber
Laura Hermann, Coach bei „sinnvollFühren“ sprach mit Anna Horn und Julia Spiegl über ihre Begeisterungsfähigkeit, die sie immer wieder in neue Berufe führte, und warum das Medienmanagement-Studium an der FH dafür eine gute Basis schuf.

...War Ihr Pflichtpraktikum dann auch
Copyright: photo simonis
ich mache jetzt mal etwas anderes. Nach einem Radiointerview mit einem deutschen Schauspieler über dessen neuen Film bin ich zur Kinopremiere eingeladen worden. Dort hatte eine Agentur einen Stand, bei der ich dann das Praktikum gemacht habe. Es war eine Agentur, die sich mit Productplacement beschäftigt und das fand ich total spannend. Nachdem ich mit Film vorher gar keine Berührungspunkte gehabt

habe, dachte ich mir: Warum eigentlich nicht? Ich habe mich beworben und die Praktikumstelle bekommen.
Lukas Snizek, Gründer und CEO von „QuickSpeech“, sprach mit Nadine Kern und Tina Hanreich über mutige Entscheidungen, seine Erfahrungen als sehr junger Start-up-Gründer und die Freude am Tischtennis.

...Jetzt ist die Gründung von „QuickSpeech“ schon ja ein paar Jahre her und es hat sich schon Einiges entwickelt. Wie war für dich damals der Einstieg und wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus? Der Einstieg in den Beruf mit „QuickSpeech“ war ein sehr fließender, weil es ein wenig wie ein Hobby war. Vergleichbar damit, wenn ihr ein Projekt habt, das ihr gerne gemeinsam machen würdet, wo ihr sagt: „Wir arbeiten jetzt dran.“ Es ist nicht so, wie in einem klassischen Jobeinstieg, wo du von heute auf morgen hingehst und deine fixen Arbeitszeiten hast. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese ersten Monate. Da habe ich mich für Gespräche zu Starbucks in Wien gesetzt am Samstag. Wo man einfach mal darüber geredet hat, wie könnten wir das angehen, damit wir irgendwie rausgehen. Es ist immer mehr geworden und irgendwann hatten die Kund*innen immer mehr Wünsche. Zuerst hatten wird das erste Minimum-Produkt, das mussten



wir dann weiterentwickeln und dann wurde es mehr in diese Richtung. Heute ist mein Geschäftsalltag so, dass ich geregelte Arbeitszeiten habe oder zumindest versuche, dass ich die einhalte. Das mache ich für mich persönlich, damit ich psychisch nicht durchdrehe. Das war am Anfang etwas anderes, weil es eben noch eher ein Hobby war. Da gehst du rein und sagst: „Ja, am Wochenende kein Problem.“ Das merke ich jetzt schon, dass ich wirklich sage: „Ich arbeite eigentlich Montag bis Freitag.“ Wenn heute etwas passiert, etwa Pläne, die abgegeben werden müssen, dann muss man einschieben. Aber sonst fangen wir um 09:00 Uhr an und arbeiten bis 18:00, 19:00 Uhr, Montag bis Freitag.
mich eine Möglichkeit irgendetwas zu machen?“ Er hat gesagt: „Naja, schick‘ mir die Bewerbung und ich gebe das meinem Marketingchef weiter.“ So bin ich mit Anfang 20 bei der großen Plattenfirma im Konferenzraum gesessen und wurde auf Herz und Nieren geprüft. Umringt von goldenen und platinenen Schallplatten von „Green Day“ und den „Chilli Peppers“, genauso, wie man sich als Laie das Show Business vorstellt, und habe mir dann gedacht: „Cool, das möchte ich jetzt unbedingt machen.“ Also es war ein bisschen das Netzwerk, das man sich aufbaut. Eines der wichtigsten Elemente für jede Karriere ist auch das richtige Unternehmen zur richtigen Zeit. Es war damals ein cooles Team, circa 16 Leute für ganz Österreich bei „Warner“. Das war natürlich auch sehr familiär und hat irrsinnig Spaß gemacht. Ich hatte den großen Vorteil, dass man mich hat
Ulrich Raab, Head of Marketing International und Brand Activation bei RAUCH Fruchtsäfte, diskutierte mit Larissa Eichler und Fabian Lahninger über die herausfordernde wie bereichernde Arbeit mit Künstler*innen in der Musikbranche, seine Erfahrungen beim Branchenwechsel und seine Erinnerungen an spontane Weihnachtslieder beim Campus-Radio.

...Wie bist du zu deinem Pflichtpraktikum bei „Warner Music“ gekommen und wie hast du die ersten Einblicke in die Branche gefunden? Man weiß, jetzt muss man sich etwas überlegen, da das Studienende näher rückt: Wo liegen jetzt wirklich meine Interessen? Bei mir war das Spektrum wieder relativ breit: vom Eventmanagement bei „ProSieben“ über ein ORF-Journalisten-Praktikum bis zum Flüchtlingshochkommissariat der UNO. Auf meiner Shortlist an Interessen war auch die Musikbranche. „Warner“ hat mir damals sehr gefallen, weil viele Künstler – etwa „Red Hot Chili Peppers“ oder „Green Day“ – mich persönlich sehr angesprochen haben. Durch meine jahrelange Tätigkeit beim Campus-Radio, und dabei auch die Redaktionsleitung für ein Jahr, habe ich diese Plattenfirmenleute gekannt. Mit denen hat man immer die Interviews ausgemacht. Deshalb hatte ich einen Kontakt bei „Warner“ angerufen und gefragt: „Wie schaut es aus bei euch, gibt es für
selbstständig arbeiten zu lassen. Also ich durfte schon selbst Pressetermine abwickeln, nachdem die ersten zwei gepasst haben. Man hört stets die Horrorgeschichten, dass der oder die Praktikant*in immer Kaffee kochen muss, was zum Glück schon lange nicht mehr der Fall ist. Das habe ich so in meiner ganzen Laufbahn nicht erlebt.
Niklas Gusenbauer, Manager Digital Business bei „Sony Music Entertainment Austria GmbH“, sprach mit Valeria Brunner und Mavie Berghofer über die Bedeutung von Eigeninitiative und Selbststudium in der nie stillstehenden Musikwirtschaft.


...Gab es in deinem Bachelorstudium die Lehrveranstaltung „Musik“ schon? War dir schon bewusst, dass du gerne in diese Richtung gehen möchtest oder hat sich das Interesse an der Musikwirtschaft bei dir erst später herauskristallisiert? Dieses Fach gab es damals leider wirklich nicht. Ich bin aus dem Bachelor in den Master gekommen und ab dem Zeitpunkt kam es ins Curriculum und das hat mich dann natürlich ein bisschen geärgert. Aber auch hier ja war es so, dass ich mich selbst mit der Musikwirtschaft auseinandergesetzt, meine Bachelorarbeit dazu verfasst habe und mich in das Thema einarbeiten konnte. Das Interesse bestand nicht nur, weil ich mich sehr gerne mit Musik auseinandersetze, sondern weil mich der Background interessiert hat. Wie verdient ein/e Künstler*in Geld? Wie laufen die Erlösströme ab? Wie kann ein/e Künstler*in über das Radio Geld verdienen? Ich habe mich auch bei der Masterarbeit genau mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ein Punkt, der mir an der FH St. Pölten sehr gefallen hat und bis heute gefällt: Dass man die Freiheit hat, sich mit den Themen zu beschäftigen, die einen am meisten interessieren.
Wenn du jetzt 3 Key Learnings aus dem Bachelorstudium nennen müsstest, welche wären das? Strategisches Management steht da auf jeden Fall ganz oben bei mir. Auch die Priorisierung
verschiedener To-Do‘s ist ein wirklich wichtiger Punkt. Das heißt, man hat im Studium ja mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen und man lernt hier Deadlines einzuhalten. Das unterschätzt man oft in der Arbeitswelt, aber dieses klassische Soft Skill hat mir sehr geholfen. Als dritten Punkt auch das Interesse, mich mit gewissen Themen näher auseinanderzusetzen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mich Content Management so sehr interessiert. Dank des Fachs und des Dozenten, den wir hatten, habe ich mich dann näher damit auseinandergesetzt und Zusatzliteratur gelesen und bin dann mit meinem ersten Job ins Content Management eingestiegen. Da hat mir der Background, den ich mir da an der FH aneignen konnte sehr geholfen.
Florian Dobin, Key Account Manager bei „k-digital Medien GmbH & Co KG“ (Kurier Redaktionsgesellschaft), sprach mit Afifa Akhtar und Angelika Bruckner über Mut, Offenheit auch für Themen, die auf den ersten Blick gar nicht so interessant sind, als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere.
...Was würdest Du deinem damaligen Ich mit dem Wissen von heute zum Studium Medienmanagement sagen? Unterschiedliche Sachverhalte in einen Kontext zu setzen, ist sicher eines der größten Learnings. Weil mir das auch in meiner weiteren Karriere geholfen hat und ich das bis heute brauche – für Produkte, Strategien, Herangehensweisen. Dass man Dinge nicht nur aus einem Blickwinkel betrachtet, sondern: Wenn wir ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt bringen, geht es nicht nur um die Vermarkter-Perspektive, sondern auch um die Nutzen-Perspektive der Konsument*innen. Ich habe eine technologische Komponente, eine kommunikative Komponente und eine soziale Komponente – wie bringe ich die zusammen? Was ist eigentlich der Benefit für die Kund*innen? Ich darf nicht nur umsatz- oder gewinnorientiert denken, ich muss den Nutzen in den Vordergrund stellen. Zusätzlich sollten Regionalität und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. (…)
Kannst du dich noch an deinen ersten Tag im Studium erinnern? Ja, selbstverständlich! Ich glaube, dass sich jede/r Student*in an den ersten FH Tag erinnern kann, weil er einfach wahnsinnig aufregend war und weil es der nächste Schritt zum Erwachsenwerden und „Ich bin jetzt cool“ ist. Es war ein tolles Gefühl, diesen Studierendenausweis in die Hand zu bekommen und dann auf die erste FH Party zu gehen und zu sagen: „Ich studiere jetzt Medienmanagement.“ Es war spannend, all die Leute kennenzulernen und ein Teil dieser Gang zu sein. (…)An manche Ereignisse kann ich mich bis heute bestens erinnern: Wolfgang Römer ist mit der Gitarre auf den Tisch gestiegen und hat gesagt: „So, ihr seid jetzt alle da und ich heiße euch willkommen.“ Das sind diese kleinen Momente, an die ich wirklich gerne zurückdenke und manchmal wäre ich gern noch mal 20 und würde das gerne nochmal machen, aber nur manchmal (lacht).


Niki Fuchs, Head of Marketing & Digital bei radio 88.6 und Geschäftsführerin von „Addicted to Rock“, sprach mit Valerie Klein und Lily Strasser über ihre Liebe zum Radio, den keineswegs unbeschwerlichen Weg zur Geschäftsführerin der Addicted to Rock Gmbh und die Abenteuer im Auslandssemester in Paris.

hatten nur ORF1 und ORF2. Man hat keine Ahnung, wie man sich orientieren soll. Das heißt, du brauchst Selektionssysteme und du musst wirklich qualitativ hochwertigen Content bieten, weil sonst gehst du unter. Also da hat sich sehr viel geändert in der Vielfalt und natürlich in der Rezeption, vor allem durch Smartphones, aber auch Smart Home via „Alexa“ und Co. Wer sich in Marketing und Content hierbei nicht mit dreht, ist fehl am Platz.
Copyright: Matthias Auer
...Machen wir kurz ein spontanes Experiment und drehen die Welt um 20 Jahre zurück. Sie haben damals ihr Studium angefangen und sich dann auch intensiver mit Medien auseinandergesetzt. Wie war denn die Medienbranche damals im Vergleich zu heute? Im Radio kann ich sagen war Formatradio halt ganz groß, wie es „Energy“ oder 88.6 und Ö4 gemacht haben. Das verändert sich im Moment sehr stark. Meiner Meinung nach geht es vor allem um den Community First Gedanken. Alleine wie man Radio heute gestaltet hat sich sehr verändert, gerade auch technisch oder durch soziale Medien. Als ich begonnen hatte, konnte Hörer*innen uns im Studio anrufen – nun schicken sie uns „WhatsApp“-Sprachnachrichten. Oder TV-Serien: Ich glaube, wir haben sogar als FH-Projekt eine Talkshow gemacht. Man hat auch noch komplett linear geschaut, also nichts On-Demand – du bist halt um 19 Uhr 30 Uhr vor der „Zeit im Bild“ gesessen und um 20:15 Uhr hat dann der Hauptabendfilm begonnen.
Was hat sich denn deswegen bezüglich der Wünsche und Bedürfnisse der Rezipient*innen in den letzten 20 Jahren geändert? Es existiert unendlich viel guter und schlechter Content im Gegensatz zu früher. Meine Großeltern
Martin Seeger, zuständig für Geschäftsleitung und Sales bei der „ProSiebenSat.1PULS 4 GmbH“, erzählt Kristina Petryshche und Sebastian Püttner, wie er mit sozialer Intelligenz trotz schlechter Begabung als Handwerker einen Studioumbau leiten konnte, welche Eigenschaften man als Medienmanager*in mitbringen sollte und warum man auch in einem großen Konzern offen über anstehende Projekte und Probleme diskutieren sollte.

phone in die Kamera). Du hast dauernd dein Smartphone mit, wo sich alles mit Medien und Werbung befasst. Das muss man auch mögen. Es schwappt natürlich immer auch ein bisschen ins Privatleben rein. Es ist eine Kommunikationsbranche und wenn jemand sehr introvertiert ist, dann – gibt es natürlich auch Jobs. Aber dann rate ich nicht, im Vertrieb zu arbeiten oder in den Redaktionen, wo man auf die Straße gehen, Beiträge drehen, Sendungen machen muss. Das geht dann nicht. Teamplayer zu sein, ist auch extrem wichtig, weil eine Fernsehshow funktioniert nur, wenn das Team dahinter funktioniert. Ein Kundenauftrag kommt auch nur zu Stande, wenn jedes Zahnrad ineinandergreift und die Abteilungen zusammenarbeiten. Das sind Aspekte, auf die ich bei Bewerbungsgesprächen achte. Das Können ist wichtig, aber wenn ich da jemanden gegenübersitzen habe, wo der Funke nicht überspringt, weil das keine Persönlichkeit ist oder sich selbst nicht gut darstellen kann, dann ist man wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben in der Branche.
Copyright:ProSiebenSat.1PULS4
...Was sollte man als angehender Medienmanager mitbringen? Also Interesse, das ist einmal das aller wichtigste. Du musst dich mit Medien einfach gerne befassen und permanent befassen. Das ist das Um und Auf. Es ist auch ein Job, der dich 24 Stunden am Tag verfolgt (Martin hält Smart-



Korruption, Verleumdung, Bestechlichkeit. Für eine/n ordentliche/n Bürger*in ist klar: Bei diesen strafbaren Verfehlungen besteht zweifellos Skandalpotenzial. Doch die Etablierung von Online-Medien hat der Entstehung und der Definition von Skandalen opake Eigenschaften verliehen, wodurch das Feld der Medienskandale unübersichtlicher geworden ist. SUMO sprach mit Junior-Prof. Christian von Sikorski (Univ. Koblenz-Landau) sowie Prof. (FH) André Haller (FH Kufstein) über die Rolle der Medien bei der Aufdeckung von Skandalen, der Bedeutung von unabhängigem Journalismus und über die zukünftige Entwicklung von Medienskandalen. Außerdem diskutierte SUMO mit dem ehemaligen Sportjournalisten Reinhard Spitzer (u.a. „Tips“, ORF Oberösterreich, Ö3, „Life Radio“) über die aufdeckende Funktion des Journalismus bei Dopingskandalen.
Wirft man einen Blick auf die österreichische Vergangenheit, könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass scheinbar alle Bereiche der Gesellschaft von einem speziellen Phänomen geprägt sind: den Skandalen. Basierend auf den jüngeren Ereignissen lässt sich aber die These ableiten, dass Medienskandale hauptsächlich einem politischen Fehlverhalten entspringen und dass somit vorrangig Politiker*innen die Urheber*innen Aufsehen erregender Vorfälle sind. An dieser Stelle sind beispielsweise die BUWOG-Affäre, welche im Jahr 2009 aufgedeckt worden ist, die Causa Casinos, in der seit dem Jahr 2019 ermittelt wird, oder die Ibiza-Affäre erwähnenswert. Dennoch lässt sich die Sache der Skandale nicht allein auf das Feld der Politik beschränken.
Um das Verständnis der historischen Entwicklung von Medienskandalen und der aktuellen Rolle von Medien im Zusammenhang mit der Berichterstattung von Skandalen zu erleichtern, ist die Definition der Begrifflichkeiten hilfreich. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass für das Zustandekommen eines Skandals drei Faktoren notwendig sind.
Christian von Sikorski, Junior-Professor an der Universität Koblenz-Landau, nennt hier an erster Stelle die Tatsache, dass es entweder gesetzeswidrige Verstöße oder viele Normüberschreitungen geben müsse, die auch nicht von
juristischer Relevanz sein müssten. André Haller, Professor für Marketing & Kommunikationsmanagement sowie Digital Marketing an der Fachhochschule Kufstein, spricht in diesem Zusammenhang von „den Grenzen des guten Geschmacks“, die durch eine Verletzung der Normen gesprengt würden. Als zweite Komponente, damit ein Skandal als ein solcher definiert werden könne, müssten diese Überschreitungen entweder öffentlich ablaufen oder durch Investigativ-Journalismus aufgedeckt werden, so Haller. Außerdem sei es notwendig, dass mehrere Medien über eine gewisse Zeit darüber berichteten. Die öffentliche Berichterstattung sei dann wiederum Voraussetzung für den dritten Faktor, der zur Entstehung eines Skandals notwendig sei. Das Fehlverhalten müsse in der Gesellschaft Verärgerung und Empörung auslösen und der überwiegende Teil der Bevölkerung müsse sagen: „Dieses Verhalten ist zu verurteilen“, so von Sikorski. Wesentlich sei aber auch die öffentliche Äußerung des Unmuts über bestimmte Vorgänge. In dieser Hinsicht erwähnt Haller auch die Verschiebung dieses Prozesses durch Social Media, durch die auch Kleinstgruppen schon minimale Verstöße skandalisieren könnten. Das wirft in Zusammenhang mit einem Fehlverhalten, das überwiegend online skandalisiert wird, die Frage auf, wann man im Jahr 2022 überhaupt noch von einem Skandal spricht.
Laut Haller gebe es durch Online-Medien mehr Aufregung und Empörung, was auf die neuen Möglichkeiten der Aufdeckung zurückzuführen sei. Denn
normale User*innen könnten nun durch verschiedenste Plattformen selbst investigative Recherche betreiben und so Fehlverhalten aufdecken. Als Beispiel nennt Haller sogenannte „Wikis“, durch die sich Nutzer*innen austauschten und beispielsweise nach Plagiaten suchten. Weiters eröffneten digitale Medien neue Kanäle, auf denen skandalöses Verhalten vorkommen könne. Denn während man sich früher nur mündlich austauschte und Gesagtes viel schwerer nachzuweisen war, gebe es jetzt mehr Wege, Beweise zu erbringen. Auch von Sikorski verweist auf das erhöhte Skandalpotenzial, dessen Ursprung in den neuen Medientechnologien liege. Allerdings betont er dennoch die Wichtigkeit herkömmlicher Medien. Denn auch wenn die Skandalisierung durch Social Media oft der Auslöser für eine vertiefte Recherche sei, spreche man heutzutage ohne Berichterstattung der klassischen Medien in der Regel nicht von einem größeren politischen Skandal.
Aufgrund aktueller Untersuchungen in europäischen Ländern konstatiert von Sikorski, dass sich eine Zunahme an Skandalen abzeichne. Allerdings steige die Anzahl komplexer Fälle nicht äquivalent mit der Anzahl an geringfügigen Normüberschreitungen. Tendenziell würden nämlich unbedeutende Verfehlungen in größerem Maß skandalisiert als tatsächlich relevante Fälle, die
ein gewisses Maß an sozialen Schaden nach sich ziehen, so wie beispielsweise die Veruntreuung von Steuergeldern. Die Neigung zur Skandalisierung von geringfügigen Verstößen durch Medien lasse sich durch die damit verbundene Aufmerksamkeit erklären. Denn diese Fälle könnten prinzipiell einfacher dargestellt werden als komplexe Fälle und seien somit für Rezipient*innen leichter verständlich. Von Sikorski stellt in diesem Zusammenhang fest: „Eigentlich sind Rezipient*innen erstmal gut darin zu sagen, was übertrieben ist und was nicht.“ Doch die Komplexität der Fälle und das Kursieren von Fehlinformationen erfordere eine gewisse Quellenkompetenz, die aber tendenziell eher abnehme. Seriöse Quellen könnten durch den Rückgang dieser Kompetenz immer schwieriger identifiziert werden. Darüber hinaus gehe auch die Fähigkeit verloren, sich auf längere Beiträge konzentrieren zu können, was ein gewisses Durchhaltevermögen und Training erfordert. Dieses Verhalten widerlegten auch aktuelle Studien aus dem Feld der politischen Kommunikation. Sogenannte „Hyper-Consumer“, die durchgehend Nachrichten rezipierten, hätten weniger politisches Wissen als Personen, die klassische Medien und weniger Quellen nutzten. Von Sikorski hebt deswegen besonders die Wichtigkeit der Quellenkompetenz hervor, welche schon durch die Bildung in den Schulen ausgebaut werden könne.

Zum einen gibt es also auf Seiten der Rezipient*innen Wege, um der Desinformation im Internet und somit inszenierten Skandalen und Fake News entgegenzusteuern. Aber auch aus Sicht der Medien existiert ein Instrument zur Verdrängung von Falschinformationen im Web. „Man muss eine Lanze brechen für den Qualitätsjournalismus“, so Haller. Denn Qualitätsjournalist*innen folgten gewissen Prinzipien, einem Mehr-Quellen-System und einem Kodex innerhalb ihres Berufsstandes, was wiederum bedeute, dass diese sehr transparent in ihrer Arbeit vorgingen. Ein aktuelles Beispiel sei die Ibiza-Affäre, bei der darüber aufgeklärt worden sei, wie die „Süddeutsche Zeitung“ die Informationen erhalten und analysiert habe.
Medien stehen aufgrund unterschiedlicher Abhängigkeiten und Machtverhältnisse in einem bestimmten Spannungsfeld mit der Politik. Diese Entwicklung habe einen historischen Hintergrund, resümiert Haller. Die Parteipresse sei eben sehr parteinah gewesen, weshalb es da nur eine geringe Objektivität gegeben habe. Durch den InvestigativJournalismus, der in Volontariats-Schulen gelehrt worden sei, etablierte sich die Unabhängigkeit vom Staat. Da aber Journalist*innen dennoch auf exklusive Quellen und somit enge Verbindungen in die Politik angewiesen seien, sei die Wahrung der Neutralität für den Qualitätsjournalismus von oberster Priorität.
„Da steht natürlich jede*r Journalist*in in der Pflicht, dass er bzw. sie sich nicht zum Spielball politischer Akteur*innen macht“, postuliert Haller.
Über Skandale von Werbekunden berichten Medien kaum
Doch dieser Interessenkonflikt zeichnet sich nicht nur mit Akteur*innen der Politik, sondern auch bei Werbekund*innen der Medienunternehmen ab. Eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2020, die von Samuel Stäbler (Tilburg University) und dem Kulturwissenschaftler Marc Fisher durchgeführt wurde, zeigt, dass über Skandale von Werbetreibenden bei Magazinen sehr wenig berichtet wird. „Es sollte niemals der Fall sein, dass über Fehlverhalten nicht berichtet wird, weil Unternehmen regelmäßig Anzeigen oder andere Arten bezahlter Werbung schalten“, fordert Haller. Denn unabhängiger Journalismus führe zu höherer Glaubwürdigkeit und halte die Auflagen zumindest einigermaßen stabil. Außerdem haben Medien eine gewisse Verantwortung im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Skandalen. Denn Medien spielten beim Anstoß, der dann zu ersten Ermittlungen führe, eine sehr zentrale Rolle, meint Haller. Die Idee der Medien als vierte Gewalt sei aber dennoch sehr hoch gegriffen. Denn diese könnten zwar einen Verstoß aufdecken, ob dieser schlussendlich strafrechtlich zu ahnden sei, entschieden dann aber Gerichte.
Medien hätten nicht mehr dieselbe Macht wie früher, zu definieren, was ein Skandal sei, weil ein großer Teil der Bevölkerung Nachrichten auf sozialen Medien rezipiere. Das liege zum einen an der selektiven Auswahl der Nachrichten und zum anderen am Algorithmus, der über die Inhalte bestimme, die den Leser*innen zukommen. Das führe dazu, dass klassische Medien an Macht verlieren, weshalb es umso essentieller sei, dass sich Medienunternehmen nicht ausruhen und unabhängig arbeiteten. „Man braucht unabhängige Qualitätsmedien, die weiterhin stark sind“, betont von Sikorski und beantwortet so die Frage, wie sich die Stellung der Medien bei der Aufdeckung von Skandalen in Zukunft entwickeln wird. Auch Haller hebt den Qualitätsjournalismus als fundamentalen Bestandteil objektiver Berichterstattung hervor.
Journalisten*innen als Ersatz der Behörden bei Dopingskandalen?
Auch die Branche des Spitzensports ist für etliche Skandale empfänglich, vor allem für Skandale im Zusammenhang mit Doping. Zahlen aus aktuellen Berichten der World Anti-Doping Agency zeigen, dass die Anzahl an Dopingfällen gemessen an den durchgeführten Blutund Urin-Proben zwischen den Jahren 2014 und 2019 weltweit nur von 21% auf rund 15% zurückgegangen ist. Das bedeutet also, dass es zwar grundsätzlich einige Dopingfälle gibt, ob diese aber schlussendlich aufgedeckt werden, ist von einigen Faktoren abhängig.
Reinhard Spitzer, Sportjournalist bis 2021, nennt hier zu Beginn die internationalen Nachrichtenagenturen, die den Journalist*innen prinzipiell die ersten Informationen zu Dopingfällen liefern.



„Wenn man so etwas als Journalist*in selber mitbekommt, wäre es eher ein Zufallstreffer“, behauptet Spitzer nach jahrzehntelanger Berufserfahrung im Sportsektor. Allerdings betont er auch, dass es ohne den unnachgiebigen Journalismus einige der großen Dopingskandale vermutlich gar nicht gegeben hätte. Grundsätzlich werde über internationale Dopingfälle zwar in regionalen Medien berichtet, selbst nachrecherchieren tue man aber meist nur, wenn es Sportler*innen aus der geografischen Nähe zu den Medienunternehmen betreffe. Auch Spitzer betont in Bezug auf die Recherche den hohen Stellenwert der Objektivität und nennt
außerdem die Ethik als grundlegenden Pfeiler bei der Berichterstattung. Denn wenn Sportler*innen Fragen ehrlich beantworteten, liege es an der Einschätzung und Ehrlichkeit des Journalisten, wie viele Informationen letztendlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden würden. „Schlussendlich bleibt aber der Journalist immer der Objektive“, so Spitzer. Allerdings würden die wenigsten Sportler*innen die ganze Wahrheit ans Licht rücken, was unter anderem auf den Druck durch das Sponsoring zurückzuführen sei. Denn für viele Sportler*innen sei die Geldleistung der Sponsoren existenziell und das Risiko, dass diese Leistungen ausblieben zu hoch.
Genaue, feinfühlige Recherchen seien daher von großer Relevanz. Diese nehmen jedoch viel Zeit in Anspruch, welche durch Effizienzsteigerungen in den Redaktionen vor allem bei privaten, gewinnorientierten Medienunternehmen oft nicht mehr verfügbar sei. „Das Tempo geht auf Kosten der Qualität“, konstatiert Spitzer. Auch die fehlenden finanziellen Ressourcen spielten dabei eine wichtige Rolle, weshalb vor allem öffentliche Förderungen zur Wahrung der Unabhängigkeit von äußerster Wichtigkeit seien.
In Zukunft weniger Dopingskandale?
Der zukünftigen Entwicklung von Dopingskandalen sieht Spitzer eher betrübt entgegen. Denn: „Die Dopingsünder sind immer einen Schritt voraus. Der Sünder agiert und die anderen reagieren.“ Weiters beschränke sich die Sache der Dopingvorfälle nicht allein auf das Feld des Spitzensports, sondern auch auf den Amateursport, in dem es aber keine medizinische Kontrolle gebe. Das gehe dann auf Kosten des Gesundheitssystems und schade auf lange Sicht einer Volkswirtschaft. Darum sei eine öffentliche Presseförderung für Medienunternehmen, welche eine uneingeschränkte und unabhängige Recherche garantiere, umso wichtiger und essentiell zur Wahrung der Demokratie. „Öffentliche Presseförderung bedeutet mehr Unabhängigkeit von den Mächtigen“, ergänzt Spitzer.
von Hannah SchinaglCopyright:
Copyright:
Unser Job: Werbung treffsicher platzieren. Egal ob im TV oder digital.

Die IP Österreich ist einer der führenden crossmedialen Reichweitenvermarkter in Österreich. Die Tätigkeiten reichen vom Werbezeitenverkauf über die Spoteinplanung auf den TV Sendern, bis hin zur Durchführung spannender Forschungsstudien und Marketingmaßnahmen sowie der Abwicklung von digitalen Werbekampagnen auf großen Portalen wie RTL+, Gala, GEO u.v.m.
Reinschauen und mehr erfahren: ip.at/karriere
Obwohl die Digitalisierung keine neuartige Thematik ist, scheint die Kontroverse über digitale Medien im Klassenzimmer nicht enden zu wollen. Um Licht ins Dunkle des Diskurses über Offline-Bildung zu bekommen, sprach SUMO mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Karin Zajec, und mit Susanna Öllinger, österreichische Bundesschulsprecherin 2021/22.
Auch wenn die Nutzung digitaler Medien in Klassenräumen ein modernes Phänomen zu sein scheint, wird doch bereits seit den 1960er Jahren an Risiken und Potentiale dieser im schulischen Kontext geforscht. Wirft man einen Blick auf die zahlreichen Studien zur Nutzung digitaler Medien bei Kindern und Jugendlichen, liegen dabei widersprüchliche Befunde vor. Der britische Neuropsychologe Aric Sigman etwa ist der Überzeugung, dass eine hohe Bildschirmzeit bei Kindern negative Auswirkungen habe und eine hohe Suchtgefahr darstelle. Die amerikanische Gamedesignerin Jane McGonigal stuft die Bildschirmzeit bezüglich Computerspiele als nützlich ein und empfiehlt diese als Therapie gegen Depressionen und als Werkzeuge für den Aufbau von Beziehungsfähigkeit.
Liest man nur diese wenigen differenten Ansätze, stellt sich umso mehr die Frage: Soll gerade Kindern eine Offline-Bildung, d.h. ohne digitale Begleiter, hohe Bildschirmzeit und medialen Einfluss geboten werden? Die Antwort ist ausgewogen: Es müsse auf die richtige Mischung geachtet werden, so Susanna Öllinger. Laut ihr sei es nicht die Zukunft, alles Haptische zu streichen und rein auf digitalem Wege zu gehen, jedoch müsse trotzdem der digitale Fortschritt in Schulen gefördert und ausgebaut werden, da dieser für das spätere Leben der Schüler*innen ausschlaggebend sei.
Digitalen Medien wird oft ein großes Potential zur Steigerung schulischer Leistungen beigemessen. Bereits in den 1990er Jahren wurde, unter anderem von Ronald D. Owston, Professor an der York University in Toronto, dem Internet ein Potential für den Lernerfolg zugeschreiben. Dennoch ist es wichtig, auf das Alter und die Entwicklung der Schüler*innen einzugehen, möchte man di-
gitale Medien im Schulalltag einsetzen. So sieht Öllinger keine Dringlichkeit, bereits in der Volkschule den Unterricht mit digitalen Begleitern zu bereichern. Die Aufklärung über mögliche Gefahren und Risiken sei dafür umso wichtiger. Weiters sieht Öllinger viel mehr Potential, das Internet und den Laptop in Schulstunden in der Oberstufe miteinzubinden und aktiv zu verwenden, da komplexere Inhalte didaktisch anders gelehrt und anspruchsvollere Texte gelesen oder verfasst werden könnten.

Veränderung durch Covid-19: Fernlehre bis hin zur Einsamkeit?
Trotz beziehungsweise gerade wegen digitaler Mediengeräte und Techniken konnte im vergangenen Jahr die Schulbildung aufrecht erhalten bleiben. Geprägt von Fernlehre, Online- Schulstunden und Videokonferenzen stellt sich die Frage: Kann der „neue“ und digitale Schulalltag weitergehen? Der Schulalltag, der nun zum neuen „Normal“ geworden ist? Einsamkeit und Antriebslosigkeit seien nur einige der Faktoren, die für Kinder und Jugendliche zur Belastung werden, konstatiert Zajec. Ihr zufolge haben weiters Ängste, wie Zukunftsangst oder das Gefühl der Perspektivenlosigkeit, zugenommen. Auch sei die Neugierde und die direkte Begegnung fundamental, die vor Allem für die Jüngsten maßgeblich ist, um neue Dinge zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Dieser wichtige Faktor lasse speziell in Zeiten der Fernlehre zu wünschen übrig. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass die neuen Klassenzimmer zu Hause die Eigenständigkeit und die Selbstdisziplin fördern können. Selbstorganisation ist das A & O, wenn der gesamte Schulalltag vor einem Bildschirm verbracht wird.
Laut der oberösterreichischen Kindermedienstudie aus dem Jahr 2020 verbringen etwa 45% der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ihre Freizeit mit Spielen auf elektronischen Mediengeräten. Auch wenn dies nicht die ersten Ränge, wie draußen spielen oder mit Freund*innen Zeit verbringen, vom Podest stößt, darf nicht vergessen werden, dass während der Pandemie die schulische Bildschirmzeit noch dazu kommt. Speziell für jüngere Kinder sei die Handhabung eine Herausforderung und die – oftmals fehlende – Konzentration ein wichtiges Thema. Die Anstrengung gestalte sich nochmals deutlich höher als etwa bei Jugendlichen und die Motorik leide meist unter dem zahlreichen Einsatz digitaler Medien im Klassenraum, weiß Psychologin Zajec. Auch die Bewegung, die ohnehin im Schulunterricht zu wünschen übriglasse, werde dadurch nicht gefördert.
Die berüchtigte Frage nach Veränderung
Veränderung. Ein vielgebrauchtes Wort, das einen Zwiespalt zwischen Anerkennung und großem Misstrauen hervorruft. Susanna Öllinger beginnt mit einer langen Liste von Aufzählungen, als die Frage nach Veränderung fällt. Bezüglich digitaler Medien in der Bildung meint sie, dass es an Aufklärung über diese mangele. Auch Karin Zajec pocht auf die Medienkompetenz mit Nachdruck. Diese müsse sowohl für Schüler*innen als auch für die Eltern und das Lehrpersonal gefördert werden und Möglichkeiten für die Weiterbildung sollten eröffnet und auch wahrgenommen werden. Den Ausführungen Öllingers erfolgend fordert auch die Sichtweise auf digitale Medien im Unterricht eine Veränderung. Die Thematik des Handys als „Störfaktor“ solle überdacht werden, sowie die Sicht auf digitale Endgeräte,
die unzählige Chancen böten, den Unterricht attraktiver und reichhaltiger zu gestalten. Information könne multimedial oder interaktiv aufbereitet und die Lerninhalte könnten so auf verschiedenen Ebenen wiederholt und besser verarbeitet werden. Weiters betont Susanna Öllinger, dass die Freiheit zwischen „Ich möchte am Laptop mitschreiben“ und „Ich kann besser in Heften mitschreiben“ unbedingt geboten sein müsse. Die Präferenzen der einzelnen Schüler*innen sollten respektiert werden, denn schlussendlich gelte es, die angestrebten Leistungen der Auszubildenden zu erzielen – ob dies digital oder auf klassische Art mit Papier und Stift passiert, sei je nach Lerntyp variabel. Für das Leben lernen wir schließlich auch individuell.


 Katrin Döveling / Copyright: Katrin Döveling
von Theresa Zahradnik
Katrin Döveling / Copyright: Katrin Döveling
von Theresa Zahradnik
Bill Gates’ vielzitierte Aussage „Content is King“ erweist sich im Entwicklungsrahmen der Digitalisierung als strategisches Leitmotiv vieler Medienorganisationen. Insbesondere Filmlizenzen stellen hierfür eine wichtige Wettbewerbsfacette im audiovisuellen Mediensektor dar. Die Bedeutung des Filmlizenzhandels und Rechtemanagements diskutiert SUMO basierend auf jeweiligen Programmstrategien mit Frank Holderied, Head of Strategic Programming and Acquisition Department von „Servus TV“, Christian Zabel, Professor für Unternehmensführung und Innovationsmanagement an der TH Köln, und mit der „The Walt Disney Company“.
Filmlizenzen seien als jenes Recht aufzufassen, das Nicht-Besitzer*innen die Erlaubnis zur Ausstrahlung bzw. Verwendung von filmischen Werken einräumt. So definiert Prof. Zabel die inhaltliche Ausprägung von Filmlizenzen und erkennt sie gleichzeitig als wesentlichen Baustein im Aufbau von Programmangeboten an: „Der Erfolg von ‚Netflix‘ wäre beispielsweise ohne Film- und Programmlizenzen, insbesondere von ‚Disney‘-Produktionen, nicht möglich gewesen.“ Dementsprechend hätten die Lizenzierungen von Filmen in Zusammenspiel mit fundiertem Rechtemanagement einen wesentlichen Beitrag zur heute gegebenen Marktmacht von „Netflix“ geleistet. In Anbetracht des anhand der „Netflix“Historie angedeuteten Stellenwerts von Filmlizenzen versucht der nachfolgende Artikel den voranschreitenden Wandel im Filmlizenzhandel sowie Rechtemanagement zu eruieren und damit einhergehende Veränderungen in der Programmgestaltung von Bewegtbildanbietern aufzuzeigen.

„Es herrschte eine Goldgräberstimmung mit riesigen Verträgen“, denkt Frank Holderied an den Filmrechtemarkt Ende der 90er Jahre zurück. „Damals war ein unheimlicher Bedarf an
Content gegeben; es ging nur darum, wer den Content bekommt und nicht darum, was man eigentlich bekommt.“ In diesem Zusammenhang seien Output Deals – spezielle Lizenzverträge, die gewisse Rechte an sämtlichen Produktionen eines Studios innerhalb eines bestimmten Zeitraums sichern – vor allem mit US-Studios gängige Praxis gewesen. Unter den aktuell vorherrschenden Marktbedingungen seien solche Vereinbarungen völlig undenkbar; heute zeichne sich seine berufliche Tätigkeit vielmehr durch handselektierte Auswahl der Inhalte aus. Dadurch wird bereits deutlich, dass das Rechtemanagement im audiovisuellen Medienmarkt – wenngleich in abgewandelter Form – seit jeher von hoher Bedeutung ist. Zabel bestätigt diese Einschätzung aus medienökonomischer Perspektive insofern, dass Lizenzrechte für Medienunternehmen schon immer ein wesentliches Core Asset gewesen seien, weil es sich einerseits um einen markanten Ausgabenfaktor und andererseits um einen wesentlichen Differenziator im Wettbewerb handle. Ebenso sei der Konnex zwischen Rechte- respektive Programmmanagement und der daraus resultierenden Effizienz nach wie vor ausschlaggebend, wobei sich für Filmlizenzen heute eine allgemein höhere Komplexität am Markt abzeichnen lasse. Diese sei primär auf die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und Plattformen zurückzuführen, die
nunmehr als Distributionskanäle zur Verfügung ständen. So nennt Zabel als Beispiel für diese aufgekommene Komplexität etwaige Werteinschätzungen in Bezug auf neuartige Rechtebündel. Demzufolge verweist er auch auf gestiegene Anforderungen an das Rechtemanagement selbst und artikuliert diese wie folgt: „Während der Prozess des Rechtemanagements früher ein stark handwerklich getriebener Prozess war, ist er heute vor dem Hintergrund der Digitalisierung stärker professionalisiert.“
Holderied beschreibt diese neue Marktkomplexität und die damit einhergehenden Veränderungen am Markt – aus Sicht seiner beruflichen Praxis im Filmlizenzhandel – in ähnlicher Art und Weise: Die „Goldgräberstimmung“ am Lizenzmarkt habe sich mit leichter Verzögerung auf den TV-Markt ausgewirkt. Dadurch sei der übermäßige Serienboom in den 90er Jahren ausgelöst worden, wobei Serien plötzlich wieder in den Hauptabend rückten. Und als dieser Trend langsam abflachte, sei parallel das anfängliche Entstehen des Streaming-Booms zu beobachten gewesen. Über diese wellenförmigen Entwicklungen am Bewegtbildmarkt hinweg, erkennt Holderied eine weitere Veränderung auf Seiten der Filmproduktion mit maßgeblichen Auswirkungen auf den Filmlizenzhandel: „Früher gab es zum einen Top-Blockbuster und zum anderen Direct-to-DVD ActionContent, Arthouse- oder IndependentFilme und Ähnliches. Zwischen diesen beiden Polen gab es einen ausgeprägten Mittelmarkt, in einer Größenordnung von rund 70%.“ Heute sei dieser Mittelmarkt fast vollständig weggebrochen, was Holderied leicht überzeichnet veranschaulicht: „Heute gibt es eigentlich nur noch den Mega-Blockbuster mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar oder den anspruchsvollen Independent-Film mit einem Budget von 8 Millionen US-Dollar.“
Trotz der unterschiedlichen Veränderungen im Handel mit Filmrechten – auf Basis eines digitalisierten Bewegtbildmarkts – erweist sich auf Filmfestivals und -messen eine ungebrochene Konstante des Lizenzhandels. Als Drehscheibe für Filmrechte sieht Zabel diese Veranstaltungen nach wie vor als wichtigen Ort, wo sich die Branche treffe und direkt miteinander verhandeln könne. Vor allem besonders seltene Inhalte würden mitunter eher persönlich
gehandelt werden. Hierzu teilt Holderied eine sehr ähnliche Einschätzung: „Filmfestivals und Filmmessen werden immer eine Bedeutung haben, weil der Filmlizenzhandel letztendlich immer ein People’s Business ist.“ Trotz der digitalen Möglichkeiten bleibe es auch ein People’s Business; man kenne sich in der Branche untereinander, könne so Auge in Auge miteinander verhandeln und das persönliche Screening von Filmen – als emotionale Erlebnisse –würde Kaufanbahnungen sowie -entscheidungen erleichtern. Dennoch könne man aber als nationaler TV-Sender wie „Servus TV“, insbesondere aus Zeitund Kostengründen, nicht alle kleineren Filmfestivals besuchen. Auch „The Walt Disney Company“ erachtet Film- sowie Serienfestivals und zugehörige Messen, laut schriftlicher Stellungnahme gegenüber SUMO, als „wichtige Orte des Zusammenkommens und Austauschs für die gesamte Branche“. Dabei werde die Präsenz von „Disney“ bei solchen, zum Teil historischen Events auch als Chance gesehen, um dem interessierten Publikum (Neu-)Produktionen vorstellen zu können.

Im Zusammenhang mit globalen Rechten sei die Zugangsweise für TV-Veranstalter wie „Servus TV“ laut Holderied überwiegend gleichgeblieben: „Wenn weltweite Player einen Film kaufen, dann kaufen sie diesen für globale Rechte. Solche Inhalte sind dann einfach vom Markt weg; das ist demnach für uns nicht mehr interessant. Hierin hat sich für uns nicht viel verändert.“ Da sich früher alle TV-Veranstalter sämtliche Filmpakete absichern wollten, und dementsprechend intensive Konkurrenz unter den Nachfrager*innen von Filmlizenzen gegeben war, schätzt Holderied den aktuellen Handel von Filmrechten im Vergleich zu früher als überwiegend entspannter ein. Demgegenüber sieht Zabel im vereinfachten Zugang zu Filmrechten über digitale Plattformen mit gleichzeitig komplexer werdender Abwicklung der Geschäfte eine eher ambivalente Intensität in der Entwicklung des Filmlizenzhandels.
Die mitunter augenscheinlichste Veränderung des Bewegtbildmarkts, mit entsprechender Auswirkung auf den Filmlizenzhandel, stellt die delineare Distribution dar. „Streaming-Anbieter haben die Komplexität im Filmlizenzhandel nochmals deutlich vorangetrieben, wodurch Online- und Digitalrechte
merklich an Bedeutung gewonnen haben“, wie Zabel die Streaming-Revolution sehr eindringlich beschreibt. Seinen Expertisen zufolge bestehe nun für herkömmliche Medienorganisationen am audiovisuellen Bewegtbildmarkt ein Wettbewerb mit Streaming-Plattformen, die global skaliert seien. Wegen der gegebenen Finanzkraft jener Plattformen zeige sich dadurch auch ein treibender Einflussfaktor auf den Filmlizenzhandel, wobei dieser Effekt durch Eigenproduktionen zusehends ausgeglichen werde.
Grundsätzlich erweise sich laut Holderied im Zuge der Streaming-Revolution ein massives Überangebot an fiktionalen Inhalten bzw. an Bewegtbild-Content generell; und „in diesem Überangebot, das wir zurzeit haben, gibt es nur noch wenige Unterscheidungsmerkmale“. In diesem Status Quo sei prinzipiell klar, dass die TV-Lizenz, speziell auf einem solch kleinen Markt wie Österreich, immer eine preisgünstige Art und Weise sei, um das Programm zu füllen; ein eigenproduzierter Film koste im Verhältnis viel mehr als ein eingekaufter.
Dennoch ist es essenziell, auf Basis eines adäquaten Rechte- und Programm-

managements, gezielt Unterscheidungsmerkmale herauszuarbeiten, zu konstituieren und diese zu bedienen, um sich als lokaler TV-Anbieter gegenüber globalen Streaming-Diensten behaupten zu können. Holderied bestrebt in seiner Funktion als strategischer Programmplaner von „Servus TV“ drei primäre Vorgehensweisen: (1) Zum einen müsse lokaler Content forciert werden; Filme oder Produktionen mit österreichischer DNA, die StreamingDienste (noch) nicht anbieten. Aktuelle Programmerfolge im TV seien ein Beweis für den Boom solcher lokalen, fiktionalen Inhalte. (2) Darüber hinaus stelle Live-Content, sogenannter Not-to-miss-Content eine nachhaltige Möglichkeit zur Differenzierung dar. Deutlich werde dieser Stellenwert anhand der Sonderstellung von Sport-Inhalten mit implizitem Aktualitätsvorteil.

(3) Und zum dritten sei es vor allem der kuratierte Content: „Jede/r sieht sich nach wie vor gerne einen guten Spielfilm im TV an, aber die Personen sind selektiver geworden und deshalb müssen auch wir im Einkauf selektiver werden; es geht darum, zielgruppenspezifisch einzukaufen.“ Für Holderied seien Eigenproduktionen neben Live-Sport der einzige Weg, um sich gegenüber
„Netflix“ und Co. behaupten zu können. Diese Einschätzung gelte für sämtliche Content-Bereiche; eigenproduzierte Inhalte von Fiktion über Information bis hin zur Dokumentation. Hierin erkennt Zabel überdies die einfließende Tendenz, dass Exklusivrechte hinkünftig, aufgrund des übermäßigen Kostenfaktors, nicht mehr umsetzbar wären – ausgenommen Sport-Inhalte.
Äquivalente Konkurrenz- und Positionierungskämpfe zeigen sich ebenso auf Seiten der Streaming-Dienste mit ihrem jeweils bestrebten Rechte- und Programmmanagement. So analysiert Zabel aktuelle Programmüberlegungen von „Netflix“ folgendermaßen: „Zunehmende Teile des Programms von ‚Netflix‘ sind ein aktualisiertes Aufwärmen und Kombinieren von popkulturellen Themen, um das Risiko zu senken.“ So würden global skalierte Plattformen viel stärker internationalen Content probieren (können). Auch Holderied sieht die internationale Serie als sehr großes Asset der Streaming-Dienste, wenngleich er dabei eine Verzerrung der jeweils zugehörigen Popularität
aufgrund von Imageeffekten der Plattformen wahrnimmt.
Dass wegen der „Streaming Wars“ laufend weniger Titel zum Lizenzieren angeboten werden und daher Eigenproduktionen bei Streaming-Diensten an Bedeutung gewinnen, verdeutlicht auch eine Studie des britischen Marktforschungsunternehmens „Ampere Analysis“ aus dem Jahr 2019. Demnach wurden im Jahr 2018 erstmals mehr Eigenproduktionen (51%) als Lizenzwaren (49%) auf „Netflix“ neuveröffentlicht. Dies entspricht einer Verdopplung der eigenproduzierten Neuerscheinungen im Vergleich zum Jahr 2016. Damit stieg der Anteil an „Netflix-Originals“, in Relation zum US-Programm, im Jahr 2018 auf insgesamt 11% an.
Auch „The Walt Disney Company“ versucht sich durch gezielte Programmgestaltung eigenständig zu positionieren, wobei auf einige der erfolgreichsten Studios und Marken mit einem umfangreichen Pool an Inhalten zurückgegriffen werden könne. Deshalb seien für Verwertungen und Lizenzierungen sowohl große Freiheit als auch Unabhängigkeit gegeben. Schon frühzeitig habe sich „Disney“ für ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Zugangsformen entschieden, wobei sich „die Gewichtung in den letzten Jahren stetig verschob, sodass das Direct-toConsumer Geschäft heute sicherlich eine große Bedeutung hat“. Im Zuge der vorherrschenden „Streaming Wars“ fokussiert die „The Walt Disney Company“ mit dem konzerneigenen Streaming-Dienst „Disney+“ auf Qualität und bestmögliches Storytelling im Rahmen exklusiver „Originals“. Eigenproduzierte Spielfilme, Dokumentationen, LiveAction- und Animationsserien sowie Kurzfilme würden um lokale Inhalte aus Europa ergänzt werden. Gerade die Produktionen aus Europa seien essenziell, um ein lokales Publikum gewinnen zu können; vor allem bedingt durch Identifikation und Wiederfinden der Zuseher*innen in den lokal verankerten Geschichten und Figuren.
Der Handel mit Filmlizenzen:
Ein Ausblick
Zabel verdeutlicht, dass Eigenproduktionen auch hinkünftig eine sehr große Rolle in der Differenzierung spielen würden, wobei „vieles, was Rezipient*innen als Eigenproduktionen der Streaming-Dienste wahrnehmen, ebenfalls lizensierte Ware ist“. Demzufolge sieht er nicht nur ein längerfristiges Bestehen des Machtkampfs zwischen Streaming-Anbietern unter-
einander, sondern antizipiert, dass sich jene „Streaming Wars“ hinkünftig noch stärker zuspitzen würden.
Auf Seiten der TV-Veranstalter greift Holderied die Chance neuer, digitaler Verwertungsmöglichkeiten auf: „Diese dienen nicht nur einer Zweitverwertung im Sinne von Catch-up-Rechten, sondern können einem Sender zusätzliches, eigenständiges Profil verleihen.“ Dabei gelte es aber anzumerken, dass man externe Rechte für die Ausspielung auf Mediatheken nur ganz selten bekomme. Dementsprechend würden sich Mediatheken, bezogen auf auszuspielende Lizenzware, auch zukünftig als „nice-to-have“ erweisen, wobei ihnen zur Verwertung von Eigenproduktionen ein durchaus hoher Stellenwert zukomme und noch weiter zukommen werde. Zabel bewertet jene neuen Möglichkeiten hingegen differenzierter. So bestehe in digitalen Verbreitungswegen eine aktuelle Chance für Urheber*innen der Inhalte, da Marktstrukturen aufbrechen würden, aber langfristig stelle sich die Frage, ob der Markt insgesamt bzw. das Produktionsvolumen nachhaltig wachsen würde. Man gewinne im digitalen Bereich zwar neue Vermarktungsformen, aber man könne den Rückgang der besserbezahlten, analogen Vermarktungsformen dadurch nur schwer kompensieren. In diesem Kontext bedient er sich eines Zitats von Fred Wilson: „Zurzeit werden am Markt analoge Dollars gegen digitale Pennies getauscht.“
Holderied umschreibt die Funktionen der Programmplanung, der Programmgestaltung und des Programmeinkaufs abschließend als ein „Abhilfe Schaffen von Entscheidungen“ in einer komplexer werdenden, schnelllebigen Welt. In Ausprägung eines solchen Lean BackService sei es als audiovisueller Bewegtbildanbieter essenziell, ein klares Profil zu haben, um nicht austauschbar zu sein. – Daher sei im Lizenzhandel und Rechtemanagement der vergangenen 25 Jahren vor allem eine Sache gleichgeblieben: „Content is King“

von Paul Frühwirt
Copyright:
Copyright: TH Köln


Terrorismus ist wohl eines der heikelsten Themen der Berichterstattung und betrifft auch Medienschaffende selbst. SUMO diskutierte deren Erfahrungen mit Florian Klenk, Österreichs Journalist des Jahres 2021 und Chefredakteur der Wochenzeitung „Falter“, und mit dem USA-Korrespondenten der russischen Zeitung „Gazeta.ru“ Alexander Braterskyi.
„Menschen saßen in einem Café, sahen fern, doch es herrschte Stille; weder Gabeln noch Löffeln klapperten. Das Fernsehen war die Hauptquelle der Information.“ Alexander Braterskyi schildert seine Eindrücke von 9/11, als sei es gestern erfolgt. Er war ein Zeuge von einem der weltweit größten Terroranschläge, bei dem insgesamt 3.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Am 11. September 2001 sei Alexander im Internet-Café „Easy Everything“ nahe der Canal Street gewesen, beide Türme des World Trade Centers waren in Sichtweite. Ein Gebäude war schon im Flammen, niemand wusste, was passierte. „Ich rannte zum Münzfernsprecher, habe die Nummer des Nachrichtendienstes eingetippt, die kannte ich auswendig. Obwohl unsere Rundfunkstation – „Nasche Radio“ – ein Musik-Radio war, hat sie aber eine große Reichweite in ganz Russland. ‚Lasst mich live berichten‘, schrie ich. Sie haben den Livestream abgebrochen, und ich habe angefangen zu berichten, was rund um mich war.“
Wie der Journalist SUMO erzählte, hätten die Medien damals einen anschwellenden Fluss, teils widersprüchlicher Informationen geliefert. „Die Massenmedien dürfen nicht immer alles überprüfen“, so Braterskyi. Die konservativen Informationskanäle hätten versucht, die öffentliche Meinung zu steuern, und er betont: „Die Journalist*innen benehmen sich nicht immer verantwortungsbewusst gegenüber der Gesellschaft“. Es gebe immer wieder Menschen, die so schnell wie möglich verschiedene Sensationen erheischen wollen. Alexander Braterskyi hebt dabei die Problematik des nicht-professionellen Online-Journalismus, besser gesagt:
der Social Media-Posts hervor. Viele Journalist*innen sagen, heute streben alle nach Likes, ohne beim Lesen oder Sehen auf die Inhalte zu achten. „Clickbaiting hat die Medien stark verändert“, so Braterskyi. „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk schwenkt im SUMOInterview um auf einen anderen, doch ähnlichen Aspekt: Terrorist*innen würden auch in einer quasi-redaktionellen Gesellschaft leben und eigene Medien (Websites, Accounts, Social Media) erschaffen können. „Sie haben anders als Terrorist*innen vor zehn oder 15 Jahren die Möglichkeit, über Social Media einerseits an Sympathisant*innen heranzukommen, aber auch Schrecken zu verbreiten“. Klenk weist darauf hin, dass am Beginn der IS-Bewegung Terroristen ihre Propagandavideos unzensuriert über „Facebook“ und „Twitter“ verbreitet hätten. Nunmehr zögen klassische Medien Schlüsse: Die Bildsprache der Terroristen solle nicht mehr reproduziert und eins zu eins übernommen werden. „Aber nicht alle, viele Medien verwenden noch diese Ikonographie“.
Ein Dilemma stelle der Aspekt der Begrenzung der Arbeit der Medien bei einem Terrorakt dar. „Die Menschenrechtskonvention postuliert, dass es die Pressefreiheit gibt und dass wir über alles berichten können, was passiert“, so Klenk. Er betont, dass die Arbeit der Presse zum Schutz der Rechte anderer, aber auch zum Schutz der nationalen Sicherheit begrenzt werden könne. Beispielsweise bitten die Behörden, keine Geiselnamen und auch deren Fotos nicht zu veröffentlichen. Der Chefredakteur denkt, dass der Staat ausnahmsweise bei der Gefahr eingrei-
fen dürfe: „Sonst halte ich das für keine gute Idee, die Presse einzugrenzen.“ Alexander Braterskyi hat eine andere Meinung dazu. Er nennt als Beispiel den Film „Stirb langsam“. Bei einem Terrorakt im Flugzeug rennt ein Journalist zum Telefon, er will vom Terrorort berichten und sagt, auf seine Berufspflicht beharrend: „Put me on there“. Bruce Willis hindert den Journalisten daran, über die aktuellen Ereignisse zu berichten. Die Terroristengehilfen hätten andernfalls eine Möglichkeit, sich darüber informieren zu lassen, Menschen hätten sterben können. „Solch ein Dilemma erscheint oft in diesen Situationen. Die Rolle der Massenmedien soll auf Staatsebene begrenzt werden, wenn eine Antiterroroperation durchgeführt wird“, fordert Braterskyi. Der Journalist stellt fest, dass Massenmedien – hierbei lassen sich definitiv interkulturelle bzw, mediale Unterschiede erkennen – einigermaßen dem Staat untergeordnet seien und nach dessen Spielregeln agieren. Wenn Journalist*innen verstünden, dass ihre Worte die Menschen beschädigen können, müsse man nicht nur nach Interessen der Zeitschriften, Zeitungen oder Blogs handeln, sondern auch achten, dass die Information die Geiseln in Gefahr bringen könne.

Journalistinnen stehen oft unter Bedrohungen, werden entführt oder sogar ermordet. 2020 wurden laut „Reporter ohne Grenzen“ zumindest 50 Medienschaffende getötet (die Dunkelziffer ist hoch) – und dies nicht „bloß“ durch Terrorgruppen. SUMO-Chefredakteur Roland Steiner erinnert sich hierzu an seinen Forschungsaufenthalt in Italien und Interviews mit Journalist*innen 1997: „Historisch betrachtet waren mir die Sicherheitsvorkehrungen römischer Medienbetriebe logisch vorgekommen, in der Realität erschien es mir – gerade im Vergleich mit Österreich – gespenstisch. Ich hatte große kommerzielle wie kleine nicht-kommerzielle Betriebe im Fokus, da gab es alles: pedante Registrierungen bei Besuchen, zu passierende Schleusen, teils schon sensorisch ausgestattet, Zigaretten waren abzugeben. Erst durch die Gespräche mit Medienschaffenden wurde mir klar, warum.“ Terroranschläge rechts- wie linksextremistischer Gruppierungen: das gezielte Durchschießen von Beinen und Knien bis hin zu Granaten in Redak-
tionen mit vielen Opfern. Andererseits – mit vorgenannten Beispielen unvergleichbar – hätten etwa Radiosender eine*n Besucher*in nur nach klandestiner Bekanntgabe eines Codeworts eingelassen. Interviewfragen wurden mehrfach geprüft – von wem?
Alexander Braterskyi meint: „Die Aussagen zu einem Terrorakt müssen vorsichtig gewählt werden“. Er hebt hervor, dass hierbei Journalist*innen eine äußerst diffizile Verantwortung der Berichterstattung übernähmen. Denn dadurch würden oft Medienschaffende zum Ziel der terroristischen Bedrohungen. „Die Verbrecher versuchen nicht, eine offene Diskussion mit Hilfe der Massenmedien zu führen. Sie nehmen Journalist*innen als Feinde wahr“. Florian Klenk erklärt SUMO, was gemacht werde, wenn Journalist*innen ernsthaft bedroht würden: „Man ruft die Polizei zur Hilfe, bittet die Polizist*innen um Einschätzung der Lage. Ist es nur ein Verrückter oder ist es wirklich gefährlich? Dann bekommt man Verhaltenstipps“. Er schildert auch die Arbeit von Journalist*innen, die in Kriegsgebiete fahren. Sie haben Bodyguards und technische Infrastruktur. Der Chefredakteur betont aber, dass die JournalistInnen relativ schwach geschützt seien und es in diesem Feld noch Verbesserungen gebe. Florian Klenk erwähnt auch der Fall von „Charlie Hebdo“, mafiöse sowie terroristische Anschläge und dass immer wieder Journalist*innen entführt würden: „Den Schutz der Journalist*innen in dem Sinne gibt es eigentlich nicht“.
Alexander Braterskyi sagte SUMO, dass in den 1990ern Interviews mit den Vertretern der Terroristenspitze getätigt wurden, als Beispiel nennt er eines mit dem tschetschenisch-islamistischen Schamil Bassajew. „Die Menschen müssen Verständnis erlangen, was für Menschen das sind.“ Jedoch müsse die Information über Terrorist*innen an die Gesellschaft angepasst vermittelt werden. Florian Klenk betont, dass bei solchen Interviews die Propaganda der Terrorist*innen nicht übernommen werden dürfe. Die Medien könnten deren Lebensgeschichten erzählen, um allfällig die Antwort auf die Frage zu geben, warum sie zu solchen geworden

sind. Es müsse auch beachtet werden, wer die Fragen beim Interview stelle und wie sie gestellt werden. „Was lerne ich als Zuseher*in daraus? Wofür soll es das Interview eigentlich dienen? Was ist der Info Value?“, so Klenk. Es sei aber für die Medien wiederum wichtig, die Grenze zwischen reinen Fakten und Propaganda nicht zu verletzen.
 von Elizaveta Egorova
von Elizaveta Egorova
„Guten Abend zur ZiB2“. Eine Glocke läutet, „Hier ist das Erste deutsche Fernsehen“. Anmoderationen der wichtigsten Nachrichtensendungen im deutschsprachigen Fernsehen. Sind sie nach wie vor führend in puncto Agenda Setting? SUMO diskutierte über deren Rolle mit Tanja Köhler, Professorin für Digitalen Journalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Matthias Schrom-Kux, Chefredakteur von ORF 2.

Die erste „Tagesschau“ bestrahlte am 26. Dezember 1952 nur wenige Zuseher*innen in Deutschland. Die Idee dahinter war es, Nachrichten für das Fernsehen und nicht für das Kino zu produzieren. Zu Beginn wurde sie dreimal pro Woche gesendet, am folgenden Tag wurde sie jeweils wiederholt. Die erste „Zeit im Bild“ in Österreich wurde erst am 5. Dezember 1955 ausgestrahlt. Diese wurde sehr schnell zu einem der beliebtesten Programme des neuen Mediums. Vorbild für die Sendung war die Nachrichtensendung „Nine O’Clock News“ der „BBC“. Der Name geht auf den Fernsehjournalisten Teddy Podgorski zurück. 1975 wurden die Nachrichten um die „Zeit im Bild 2“ ergänzt. Diese wurde unter dem Titel „Zehn vor zehn“ bis 1984 gesendet. Ab den 2000ern wurden diverse „Spin-off“ aufgesetzt – etwa „newsflash“ oder „ZIB20“. Warum? Nachrichten sind das härteste Geschäft, ein teures – und für öffentlich-rechtliche Sender die Hauptlegitimation. Und zu legimitieren bedeutet sich zu behaupten, eben öffentlich und rechtlich. Das kommt teuer.
Der privat-kommerzielle Konkurrent „PULS 24“ startete Mitte 2019 in der App „ZAPPN“. Dieser wurde als Popup-Kanal für Breaking-News-Inhalte geplant. Ende 2019 verkündete das Unternehmen, dass der Sender via Antenne, Kabel und Satellit ohne Zusatzkosten verbreitet werde, Bundespräsident Van der Bellen drückte den roten Startknopf. Das Alleinstellungsmerkmal: 24 Stunden, 7 Tage die Woche live. Auch Zeitungsverlage – 1964 initiierten sie ein Volksbegehren gegen den Rundfunk-Proporz (und für eine Liberalisierung) – setzten nach, vor allem im Boulevard-Segment. Warum aber im Nachrichten-Segment?
Das Zusammenspiel von Nachrichtenarten und -vorbereitung
Das wichtigste Kriterium für die Verständlichkeit von Medieninhalten ist die Sprache. Schrom-Kux sowie Köhler erwähnen, dass seit dem Beginn der Corona-Pandemie deutlich geworden sei, wie wichtig der Zugang zu journalistischen Informationsangeboten ist. Köhler betont, dass die Verständlichkeit im Auge der/s Rezipientin/en liege. Deshalb hätten in den letzten Jahren Konzepte der Leichten und Einfachen Sprache an Bedeutung gewonnen. „Leichte Sprache“ wendet sich an Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten, „Einfache Sprache“ an Menschen mit geringen Kenntnissen der Mehrheitssprache sowie geringer Lese- und Schreibkompetenz. Die Anzahl dieser potentiellen Nutzer*innen sei nicht zu unterschätzen. In Österreich sind es bis zu eine Million Menschen, in Deutschland laut der LEOStudie der Universität Hamburg 15 Millionen. Nachrichten in leichter und einfacher Sprache sorgen für stärkere Diversität im Journalismus. Aber zu welchen Nachrichten?
Köhler erklärt, dass es in der Medienund Kommunikationswissenschaft unterschiedliche Theorien gibt, die erklären, warum aus einem Ereignis eine Nachricht wird. Eine davon sei die Nachrichtenwerttheorie. Diese habe unterschiedliche Merkmale zusammengetragen, die verantwortlich dafür seien, ob ein Ereignis zu einer Nachricht wird. Je stärker diese Nachrichtenfaktoren auf ein Ereignis zutreffen, desto höher ist der Nachrichtenwert und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es für die Nachrichten ausgewählt wird.
Die Nachrichtenaufbereitung gehe allerdings weit über die Nachrichtenfaktoren hinaus, Faktentreue oder fundierte Recherche spielten beispielsweise ebenso eine Rolle, so Köhler. Zudem ginge es bei der Nachrichtenproduktion zwar immer auch um Schnelligkeit, wichtiger aber sei Genauigkeit. Denn Vertrauen und Glaubwürdigkeit seien schneller verspielt als aufgebaut.
Köhler weist darüber hinaus darauf hin, dass es ein Mythos sei, vom Journalismus als Talentberuf zu sprechen. Journalismus sei ein Handwerk, welches man erlernen könne, sonst würde es keine Journalistenschulen geben. Insofern sei auch der Nachrichten-Journalismus erlernbar. Nachrichten im TV und Radio seien übrigens auch von der Sendezeit abhängig, betont die ehemalige stellvertretende Nachrichtenchefin des Deutschlandfunks. Bei TV-Nachrichten sei darüber hinaus das Zusammenspiel von Text und Bild ein wesentlicher Faktor. Auch Schrom-Kux betont, dass das Bild den Text unterstützen müsse. So soll der Text Eindeutigkeit schaffen, und somit keine Irritation entstehen.

sei ein langes Interview. Schrom-Kux erwähnt dazu auch ein Beispiel: Bei einer Lawinenkatastrophe erfährt man in der „ZiB1“, was passiert ist. In der „ZiB2“ hingegen werde darauf eingegangen, warum es Lawinenabgänge gibt. Generell jedoch sei die besondere ethische Verantwortung zu bedenken. Ein Beispiel sei der Terroranschlag vom 2. November 2020. Einige Nachrichtenplattformen veröffentlichten Videos währenddessen, der ORF hatte sich dagegen entschieden. Man diskutiere abwägend und entscheide hernach.
264.000. Auch in Deutschland wird die 20 Uhr Ausgabe der „Tagesschau“ immer noch von Millionen Menschen im linearen TV gesehen. Die Herausforderung für Medienunternehmen sei daher, so Köhler, einerseits bestehende reichweitenstarke Formate nicht zu vernachlässigen, andererseits flexibel auf den Wandel der Nachrichtennutzung zu reagieren. Für junge Menschen seien Soziale Medien DER Ort, um mit Nachrichten in Kontakt zu kommen. Deshalb müssten Medienunternehmen dorthin gehen, wo sich ihre Zielgruppen aufhalten. Auch hier diene die „Tagesschau“ als gutes Beispiel, da sie es geschafft habe, sehr erfolgreich auf unterschiedlichen Drittplattformen, wie „Instagram“, „YouTube“ oder „TikTok“ neue Nachrichtenformate zu etablieren.

Junge Menschen haben eine andere Erwartungshaltung an Nachrichtenangebote. Aber sie erwarten – und nutzen sie.
Im ORF 2 unterscheidet man zwischen der „Zeit im Bild 1“ und der „Zeit im Bild 2“. „ZIB1“ sei laut Schrom-Kux tagesaktuell: Einordnungen, Analysen, sowie Korrespondentenschaltungen sind vor allem hier zu finden. Die „ZiB2“ ist von der Sendezeit länger und tiefgründiger. Im Unterschied zur „ZiB1“, wo es sieben bis acht Beiträge gebe, spiele man nur vier Beiträge aus. Der Kern der „ZiB2“
Ein anderes, technologisch wie ökonomisches Wagnis für den ORF war die Erstellung eines „TikTok“-Kanals. Er solle als neue Informationsquelle für die jungen Menschen im Land werden. Diesem folgen 22% der 16- bis 24-jährigen in Österreich. Wird es funktionieren? Die Zukunft von TV-Nachrichten kann niemand voraussehen, im Zuge des Interviews hat Prof. Köhler jedoch eine Prognose gewagt. Mediennutzung und damit auch die Nachrichtennutzung verlagere sich zunehmend ins Digitale, also Nicht-lineare. Immer mehr Personen informieren sich im Netz und in den Sozialen Medien über aktuelle Ereignisse. Gleichwohl: Traditionelle Produkte seien noch immer erfolgreich und haben eine große Reichweite. Die Tagesreichweite der „Zeit im Bild1“ beträgt 1,4 Millionen, von „PULS 24“


Kaum eine Branche ist so sehr vom technologischen Wandel betroffen, wie die der Medien. Dieser Prozess betrifft nicht nur die redaktionellen Mitarbeiter*innen, sondern lässt sich auch am Marketing erkennen. SUMO sprach mit Daniel Kupka, Head of Marketing & Communications bei „FM4“, und Judith Zingerle, Marketing-Leiterin bei „DER STANDARD“, über das Berufsbild, Veränderungen und Zukunftsaussichten.
Wo „damals“ noch Info-Flyer verschickt wurden, finden sich heute „Instagram“ Werbespots. Das Wort „Damals“ steht hier bewusst unter Anführungszeichen, denn eigentlich galt diese Realität noch in den frühen 2000er-Jahren. Bei Medienmarketing handelt es sich um eine Sonderform des Marketings, denn das Medium an sich ist das Produkt, das es zu promoten gilt. Anders als im klassischen Marketing geht es nicht um Dienstleistungen oder materiell fassbare Gegenstände, deren Verkauf leicht messbar und bezifferbar ist, sondern es geht um die Services und inhaltlichen Angebote eines Medienunternehmens. Doch auch wenn Medienunternehmen eine besondere Position in der Marketingwelt einnehmen, ist das Ziel des Marketings analog zu anderen Unternehmen: Es gilt die Bekanntheit der Marke zu steigern. Wie Daniel Kupka als Head of Marketing & Communications bei „FM4“ betont, gebe es keine reguläre „Kaufentscheidung“ für ein Produkt, sondern die Zeit jedes einzelnen Kunden und jeder Kundin sei der zu vermarktende Faktor. Ein ähnlich wichtiger Aspekt wird auch von Judith Zingerle, Leiterin des Marketings der Tageszeitung „DER STANDARD“, zum Ausdruck gebracht: die Wissensvermittlung als Kernaufgabe der Zeitung und Treiber des Marketings. Diese werde etwa bei wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen oder Wahlen umso relevanter, so Zingerle.
Auch der Auftritt auf digitalen Plattformen ist zu einer Herausforderung geworden. Vor etwa 15 Jahren bestand die Aufgabe darin, den Hauptkanal des Radiosenders und eine radioeigene Website mit Sendeinhalten und Programmübersichten zu bespielen. Doch
mittlerweile, so beschreibt es Kupka, müsse man sich als Medienunternehmen des 21. Jahrhunderts positionieren und vielfältige digitale Kanäle miteinbeziehen. „FM4“ habe nach Kupka einen gut besuchten Auftritt in Sozialen Medien, insbesondere auf „Instagram“ und „Facebook“ eine hohe Durchdringung in der jungen Zielgruppe des Jugendkultursenders, vornehmlich auch im Vergleich zur Größe des Senders respektive im Reichweitenvergleich. Laut Radiotest 2021 wird der Sender von 3,4% der Hörer*innen täglich rezipiert, wohingegen sein „Instagram“-Kanal 93.000 Follower*innen zu verzeichnen hat. Judith Zingerle spricht in diesem Zusammenhang auch davon, offen für die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Medien zu sein und Veränderungen zuzulassen. Ob und inwiefern digitale Kanäle für ein Medienunternehmen funktionieren, könne nur durch Ausprobieren herausgefunden werden.
Dennoch gibt es auch eine Kehrseite der Medaille: Wenn Informationen lediglich über „Instagram“ abgerufen werden, leben die Nutzer*innen in einer „Informationsblase“, verweist Zingerle. Medienimmanent erlauben Soziale Medien kompakte, komplexitätsreduzierte und speziell auf „Instagram“ bildlastige Informationen. Ergänzende Fakten und Facetten sind erst im genuinen Online„STANDARD“ abrufbar. Wer nicht weiterklickt und dort nachliest, bleibt auch beim „Instagram“-Auftritt der „Zeitung für Leser“ oberflächlich informiert. Das Marketing der Medienhäuser kann auf Basis der Clickrates, der Verbleibdauer auf der Site sowie der demografischen Analysen die Zielgruppe kennenlernen und die Inhalte – nutzerorientiert passend – aufbereiten. Das Nutzungsverhalten online und in Sozialen Medien ist deutlich präziser messbar als jenes der Zeitungsleser*innen im analogen Format.
Der mittlerweile große Auftritt vieler Medienunternehmen in Österreich auf Sozialen Medien bringt auch Druck mit sich. Druck, der selbstverständlich im Marketing bereits davor existierte und auch weiterhin existieren wird, doch mit Sozialen Medien als Werbetreiber eine neue Perspektive geschaffen hat. Um seine Marke an die Öffentlichkeit zu bringen, sei gegenwärtig viel Arbeit und Denkvermögen erforderlich, erzählt Kupka. Auch die Ausbreitung der Sozialen Medien scheine dazu beizutragen und Kupka verdeutlicht: „Wenn man nur klassisch denkt, dann wird man irgendwann untergehen“. Auch eine gewisse Beständigkeit im Marketing und in der Kommunikation fördere die Bekanntheit, führt Judith Zingerle aus. Jedoch verneint sie die Annahme, dass sich das Marketing und die Art der Kampagnen in den letzten Jahren – auch auf Grund von Sozialen Medien – geändert habe. Im Kern bestehe die Herausforderung immer noch darin, individuell zu agieren. Das Bewusstsein über die Kernwerte und das Selbstverständnis des Mediums müsse vorhanden sein und diese Botschaft nach außen an die Leserschaft auf den diversen Kanälen transportiert werden. Wenn der Transfer dieses Bewusstseins gelinge, dann ergebe sich die Individualität der Marke wie von allein, erklärt Zingerle SUMO.
Der permanente Wandel in dieser Branche macht es nicht einfacher, haltbare Zukunftsaussagen zu tätigen. Es stehen einige Spekulationen im Raum, etwa über die Neustrukturierung oder Auslagerung der Marketingabteilung im Allgemeinen bzw. ein Umdenken bezüglich des Marketings. Zingerle verneint diese Aussagen rasch und ist der Ansicht, dass in der Marketingabteilung das Fachwissen konzentriert vertreten ist. Die Kommunikation – sowohl unternehmensintern als auch nach Außen – findet im Marketing statt und auch die Nähe des Produkts sei wichtig: „Marketing kann nicht abgekapselt und weit weg vom Kernprodukt stattfinden“, betont sie. Auch das rasante Wachstum der Unternehmensabteilung und der Boom der Marketingbranche wirft die Frage auf, ob dieses Business noch weiterwachsen kann, oder ob die Sättigungsgrenze bereits überschritten ist. Diese Thematik löst auch für Insider Unwohlsein aus und wirft Fragen auf, die schwierig zu beantworten sind. Kupka unterstreicht diesbe-
züglich die Tatsache, dass es schwierig sei, Annahmen zu treffen, wenn man selbst in diesem „Marketing-Boot sitzt“ und kaum Möglichkeit hat, andere beziehungsweise fremde „Boote“ diverser Unternehmen zu beobachten. Jedoch kann festgehalten werden, dass rapide Veränderungen rasche Entscheidungen erfordern. Zögerliches Agieren ist hierbei nicht erwünscht und die Anpassung an neue Werte und Phänomene – etwa der noch nicht prognostizierbare Erfolg von „TikTok“ – sollte an oberster Stelle stehen. Denn: So rasch die Veränderung kommt, so rasch kann diese auch wieder vom Markt verschwinden und die Adaption ist hierbei das A & O. Jedoch kann eines gesagt sein: Offen für neue Ideen sein, vieles ausprobieren, neugierig bleiben und nicht zu weit in die Zukunft blicken sind die Ratschläge von Judith Zingerle. Sich an neuen Plattformen und Strategien versuchen und am Zahn der Zeit zu bleiben ist hierbei mitunter die wichtigste Empfehlung.


 von Theresa Zahradnik
von Theresa Zahradnik
Trafiken finden sich im Zwiespalt einer traditionalistischen Historie und digitalen Moderne wieder. Im zeitlichen Verlauf zeigen sich Probleme und Potenziale, die auf einem ursächlichen Freiheitsgedanken beruhen. Daraus resultierende Auswirkungen auf die einhergehende Distributionsfunktion von Printmedien diskutiert SUMO mit Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung GmbH, Josef Prirschl, WKO-Bundesobmann der Trafikant*innen, und anonym mit einem Wiener Trafikanten.
Seit jeher stellen Trafiken eine wichtige Institution im österreichischen Handelswesen dar. Die historische Bedeutung verdeutlicht sich unter anderem durch das von Kaiser Josef II. bereits im Jahr 1784 eingeführte Tabakmonopol. „Ich glaube, es gibt niemanden in Österreich, der/die nicht weiß, wo die nächste Trafik ist.“ Durch die kollektive Bekanntheit der Marke „Trafik“, die als Alleinstellungsmerkmal zu betrachten sei, beschreibt Hannes Hofer den ungebrochenen sozialen Stellenwert. In ökonomischer Hinsicht zeigen sich jedoch umfangreiche Herausforderungen und es stellt sich – im medialen Kontext – die Frage, inwieweit Trafiken im Zeitalter der Digitalisierung noch als Distributionskanal von Printmedien dienlich sein können.
„Die größte Branchenveränderung der vergangenen 30 Jahre ist mit dem EU-Beitritt auf uns zugekommen“, wie Josef Prirschl die damals maßgebende Herausforderung einer EU-konformen Abbildung des Tabakmonopols erklärt. Dabei sei Tabak in weiterer Folge stets der Hauptgeschäftszweig geblieben, denn bei durchschnittlich 50% Umsatzanteil und 70% Anteil am Deckungsbeitrag bestehe ohne Tabak keine Grundlage. Glücksspiel habe sich darüber hinaus als zweite Säule etabliert, während Zeitungen eine gegenteilige Entwicklung aufweisen.
Der Wiener Trafikant sieht jene Entwicklung differenzierter und beschreibt die Trafik früher wie heute als „CentGeschäft“, das sich durch den EU-Beitritt merklich manifestierte. Aufgrund von konkurrierenden Markteintritten – über den Zweck des reinen Tabakvertriebs selbst hinausgehend – durch Handelsketten, Supermärkte oder Tankstellen und den generell strenger werdenden Tabak-Gesetzen hadert er mit der „guten Zeit der Trafik“ vor 1995. Für Prirschl, der selbst eine Tra-
fik in Pöchlarn (NÖ) betreibt, zeigt sich grundlegend ein großes Spannungsfeld zwischen Gesundheits- und Finanzpolitik. In diesem Sinne bestrebt die Monopolverwaltung GmbH (MVG) auch einen Konsens zwischen gesundheitspolitischen, sozial-, fiskal- und regionalpolitischen Zielsetzungen beizutragen.
Stellenwert von Zeitungen: Einst und heute
Vor diesem Hintergrund haben sich auch Printmedien, betrachtet als Teil der Produktpalette von Trafiken, gewandelt. In jenem Kontext schlugen sich diverse Markt- und Geschäftsmodellveränderungen im Verlagswesen merklich auf den Handel nieder. „Wir haben früher ‚Kronen Zeitungen‘ stapelweise verkauft“, denkt Prirschl an vergangene Tage in seiner Trafik zurück. Aufgrund von „Digital First“-Paradigmen und dem damit einhergehenden Aktualitätsvorteil von Schnellinformationen über digitale Kommunikationsmittel haben Tageszeitungen für Trafiken sehr stark an Bedeutung verloren. Demzufolge hätten sich laut Prirschl auch die Hauptbesuchszeiten der Trafiken von der Früh und dem Vormittag weg verlagert. Innerhalb der Printlandschaft habe es hingegen eine markante Veränderung in Richtung Spezialtitel gegeben, weshalb sich die Produktpalette vor allem bei Fachzeitschriften stark verbreitert habe.
Aus der im Jahr 2019 gemeinsam von MVG und WKO beauftragen Studie „Die Trafik der Zukunft“ geht hervor, dass sich Kund*innen in einer Trafik nach Tabak am ehesten Zeitungen sowie Zeitschriften erwarten. Dieser hoch eingeschätzte Stellenwert der Nachfrage nach Printprodukten geht jedoch mit niedriger Zahlungsbereitschaft einher, wodurch Trafikant*innen an (Tages-) Zeitungen nur marginal verdienen. Die rückläufigen Umsätze dieser Produktsparte werden von Prirschl wie folgt konkretisiert: „Der Umsatz bei Zeitungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren halbiert.“

Grundsätzlich erkennt er für die prekäre Profitsituation, wie sie sich für Trafikant*innen aktuell im Zeitungsvertrieb darstellt, eine Ursachenabfolge in drei Schritten: (1) Beim Zeitungsverkauf habe man ursächlich bereits vor rund 20 bis 30 Jahren im starken Trend zum Abonnement eine große Entwicklung erlebt. Während es früher nur sehr geringe Abo-Anteile gab, seien laut ihm mittlerweile Abo-Anteile von 90 bis 95% im Tageszeitungsgeschäft vorherrschend. (2) In weiterer Folge habe sich die Distribution per Hauszustellung etablieren können, „das hat für enorme Einbußen von Trafiken am Tageszeitungsmarkt gesorgt.“ (3) Als sich der Tageszeitungsmarkt schließlich bereits unter massivem Druck befand und für Trafiken gewissermaßen zum Erliegen kam, hätten neue Titel an Gratistageszeitungen wie „Heute“ und Co. den Markteintritt gewagt. Jene Gesamtentwicklung zeichnete sich laut dem Wiener Trafikanten bis 2005/2006 ab, ehe sie durch digitale Distributionswege (inkl. E-Papers und Digital-Abos) zusätzlich befeuert wurde. Hofer erkennt hierbei für Trafiken größere Herausforderungen bedingt durch digitale Geschäftsmodelle der Verlage denn im Angebot von Gratiszeitungen. Letztlich konnte auch der sich anbahnende Aufschwung von Magazinprodukten den markanten Rücklauf der gedruckten (Tages-)Zeitungen nicht ausgleichen. „Unter dem Strich haben wir schon deutlich verloren“, resümiert Prirschl die vergangenen 20 Jahre im Vertrieb von Printprodukten.
Zeitungen spielen aber heute, trotz der angeführten Schwierigkeiten, eine nach wie vor wichtige Rolle für das Trafikwesen; nämlich in teils neu ausgerichteter, zwischen Trafiken und Zeitungsverlagen wechselseitig zu verstehender Art und Weise. Die Trafik als Distributionskanal für Zeitungen weist zwar heute geringe Reichweitenstärken bzw. geringere Breitenwirksamkeit auf, wenngleich sie in dieser Funktion aber einen qualitativ hochwertigen Touchpoint innerhalb der Customer Journey und
Trafikant*innen: Die analogen Influencer*innen unserer Zeit



P egeberuf und P egeausbildung.



Jetzt bewerben!

Mein Job mit Zukunft. Ein Leben lang. Gesundheit und P ege zählen zu den absoluten Zukunftsbranchen. Wir, die NÖ Landesgesundheitsagentur, bieten unseren MitarbeiterInnen zahlreiche Weiterbildungsund Karrieremöglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Wir bieten sichere Arbeitsplätze mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Damit jede und jeder seine eigene Zukunft in der LGA mitgestalten kann.









MEHR ALS EIN JOB. MEIN LEBEN LANG. In unseren Kliniken und P egezentren –in ganz Niederösterreich.



einen vermehrten Wettbewerbsvorteil darstellt.
In diesem Zusammenhang versteht Hofer die Trafiken zusehends als „Schaufenster einer Zeitung“, indem die jeweilige Markenpräsenz hierdurch gefördert werden könne: „Auch der Trafikant ist für die Zeitung eine Werbefläche.“ Überdies betrachtet Prirschl das angebotene Zeitungs- und Zeitschriftensortiment in seiner Tätigkeit als Trafikant, neben den standardisierten Angeboten von Tabakwaren, als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Mitbewerber*innen. Dahingehend sei das Zeitungs- respektive Zeitschriftenangebot in Trafiken eine gewisse Wettbewerbsschiene innerhalb des Monopolmarkts. Prirschl sieht in diesem Kontext die Pressefreiheit und die diesbezüglich freie Zugänglichkeit zu Zeitungen und Zeitschriften als originäres Motiv der Systemrelevanz von Trafiken.

Rollenbild der Trafikant*innen: Positionierung als eigenes Medium
„Da Trafikant dazöht de Schlagzeiln, ea woa auf sein Fenstaplotz mit dabei.“ So reflektierte der Schriftsteller Günter Brödl bereits 1989 den Lokalkolorit der Wiener Trafikant*innen. Aus heutiger Sicht sind sich die beiden interviewten Interessenvertreter einig, dass sich das Rollenbild des/der Trafikant*in im Kern nicht gewandelt habe. Dieses fundiere seit jeher auf persönlicher Information, persönlichen Kontakten und Bindungen zwischen Trafikant*innen und Kund*innen.
Prirschl spricht, in Anbetracht der lokalen Handelsstrukturen mit flächendeckendem Trafiken- Netzwerk, sogar von einer wichtiger werdenden sozialen Rolle: „Der Trafikant ist als Ansprechpartner ein starkes Kommunikationszentrum; vielleicht noch stärker als früher.“ Denn es lasse sich langsam wieder ein Trend zurück in Richtung kleinstrukturierte Geschäfte absehen, den die Trafiken eigentlich nie verlassen haben. Und vor allem hätten die beiden vergangenen Jahre gezeigt, wie sehr Kund*innen persönliche Ansprache und Direktkontakte benötigen würden. „Dieser Faktor kommt wieder viel stärker“, hofft Prirschl auf eine Renaissance der persönlichen Beratungsfunktion von Trafikant*innen.
Hofer erkennt in Folge dieser gewandelten Beratungsfunktion sehr innovative
Chancen im Rollenbild der heimischen Trafikant*innen: „Der Trafikant ist aus meiner Sicht der größte analoge Influencer, den wir in Österreich haben.“ Da Trafikant*innen lokale Meinungen und Geschichten aus erster Hand wahrnehmen, etabliere sich der/die Trafikant*in zusehends in der Rolle als Content-Anbieter*in. Der Geschäftsführer der MVG sieht darauf aufbauendes Potenzial, dass sich Trafikant*innen hinkünftig als interessante Sparring-Partner*innen von Journalist*innen erweisen könnten. Grundlegend gewinne die besondere, durch persönliche Beratungs- und Sparring-Partnerfunktion avancierte Positionierung im digitalen Zeitalter an Wert. Dieses Alleinstellungsmerkmal gelte es in weiterer Folge zu monetarisieren, um neue Geschäftsmodelle sowie Geschäftsmodellansätze zukunftsfit konstituieren zu können.
Während der Wiener Trafikant sentimental auf den früheren Printhandel, ohne Gegebenheiten digitaler Substitutionsgüter, zurückblickt, ergeben sich durch die Digitalisierung ebenso Potenziale. So beschreibt Prirschl etwa einen hinkünftigen Trend im „Zurück zum Haptischen“. Als Gegenspiel zu digitalen Arbeitsweisen werde das Haptische vermehrt gesucht; dabei sei die große Zukunftshoffnung der Branche, dass das Haptische auch bei jüngeren Generationen an Bedeutung gewinnt. Tageszeitungen seien zwar eine ungebrochene Herausforderung, aber für sämtliche andere Printprodukte bestehe aufgrund der beiden Faktoren des Haptischen und der Entspannung, die implizit mit dem von Trafiken dargebotenen Genusscharakter einhergeht, großes Potenzial.
Außerdem stellen Trafiken einen Gegenpol zur digitalen Informationsflut dar, wie Prirschl seine Erfahrungen schildert: „Ich muss sagen, es kaufen auch viele Kund*innen Printprodukte zur Information, weil sie in der weiten Welt des Internet viel zu viele Antworten erhalten und die Orientierung fehlt.“ Dies sei mitunter ein Mitgrund für eine leichte, durch Corona bedingte Trendwende, indem die Zeitungsumsätze von Trafiken ein einstelliges Plus verzeichnen konnten. Weiteres Potenzial bestehe laut ihm in der Großzahl an innovativen Produkten, die am österreichischen Zeitschriften- bzw. Magazinmarkt vorzufinden sind. Die Zukunft der Trafik beruhe aber klar in einer „Schnitt-
stellenfunktion der analogen und digitalen Welt“. Marktchancen würden hierin – konkret für den Zeitungsvertrieb – in Form eines integrierten Angebots verschiedener Abonnementvarianten bestehen. Wie Hofer beschreibt, dürfe in diesem Wandlungsprozess der einhergehende Freiheitsgedanke als Symbiose von Genussmitteln einerseits und Zeitungen sowie Zeitschriften andererseits nicht vernachlässigt werden, um Trafiken als österreichisches Kulturgut hinkünftig bewahren zu können.
 von Paul Frühwirt
von Paul Frühwirt
Lokaljournalismus ist eine unabdingbare Säule der Medienlandschaft. SUMO sprach mit Univ.-Prof. Horst Pöttker (Technische Univ. Dortmund), dem Chefredakteur und Herausgeber des Online-Magazins „dolomitenstadt.at“ Gerhard Pirkner, und dem Journalisten Florian Eder („Kleine Zeitung“) über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Lokalmedien.

Lokaljournalist*innen informieren Bürger*innen über die Geschehnisse in der Region, ihr Nachrichtenwert ist spezifisch. Über die Inhalte des Geschriebenen wird mit Freund*innen, Verwandten und Bekannten diskutiert, diese Inhalte bewegen, verbinden, führen aber auch zu Meinungsverschiedenheiten. Kaum ein anderes Ressort holt Menschen auf einer dermaßen emotionalen Schiene ab. Kaum ein anderes Ressort hat dermaßen mit dem digitalen Wandel zu kämpfen. Oft sind Lokalredaktionen sehr klein, die dort arbeitenden Journalist*innen schon seit Jahren, teils Jahrzehnten, dort tätig. Die Nachwuchsredakteur*innen zieht es in die großen Redaktionen in den Metropolen. Sie wollen über Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur berichten, sie wollen die großen Geschichten schreiben, die das ganze Land lesen will, nicht darüber, was in ihren Heimatorten vor sich geht. Doch das eine schließe das andere nicht aus, meint Gerhard Pirkner, Herausgeber und Chefredakteur von „dolomitenstadt.at“. „Eigentlich muss man als Lokaljournalist*in genau gleich agieren wie bei einem großen Medium. Mit dem einen Unterschied, dass man in der Lokalberichterstattung diese Geschichten auf einen Punkt herunterbrechen muss, der lokal vor Ort stattfindet.“ So lautet seine Herangehensweise: „Das Große klein und das Kleine groß zu machen.“
„Wenn ‚Oben‘, auf Bundes- und EUEbene beispielsweise über ein Glyphosatverbot diskutiert wird, berichten wir, wie die Gärtnerei und der Gemeinderat der Stadt Lienz mit diesem Pflanzengift umgehen. Das Große wird so also klein gemacht.“
Naheverhältnisse: Segen und Fluch
Beim Umlegen der großen Geschichten auf lokale Vorkommnisse und auch bei ihrem generellen Handeln und Tun sind Lokaljournalist*innen Naheverhältnissen ausgesetzt. „Man begegnet hier den Personen, über die man – auch kritisch – berichtet doch öfter, als ein/e Innenpolitikredakteur*in dem Bundeskanzler begegnet“, so Florian Eder, Osttiroler Lokaljournalist bei der „Kleinen Zeitung“. „Bei den Naheverhältnissen darf man aber auch nicht auf die Personen vergessen, die man kennt, die auf eine/n zukommen und Themen vorschlagen. Frei nach: ‚Ja, da könntest du etwas darüber schreiben‘. Denn in solchen Situationen verwechseln Personen oft redaktionelle Berichterstattung mit klassischen Werbeeinschaltungen.“
Der Tatsache, dass Lokaljournalist*innen besonders mit dem Geschehen, über das sie berichten, verbunden sind, stimmt auch der Sozialwissen-
schaftler, Professor und Publizist Horst Pöttker zu. Der Lokaljournalismus sei nach seiner Auffassung „ein Teil des Geschehens, über das berichtet wird.“ Und genau deshalb ortet Pöttker die Unabdingbarkeit der „professionellen Unabhängigkeit“ auch hier. „Die Redakteur*innen dürfen sich nicht für Partikularinteressen instrumentalisieren lassen, sondern müssen immer an die Wichtigkeit für das Publikum und an die Richtigkeit denken.“ Dass man einander kennt, wird sich in der lokalen Berichterstattung nie vermeiden lassen, und es muss auch nicht unbedingt vermieden werden. So fassen etwa die – selten in der heimischen Medienbranche – auf der Website offengelegten Redaktionsrichtlinien des Online- und Print-Magazins „DOSSIER“ diese Problematik treffend zusammen: „Dennoch ist nicht jedes Naheverhältnis eine Gefahr für die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. (…) Vertrauen zu Ansprechpersonen aufzubauen, steht nicht im Gegensatz dazu.“
Ein weiteres Problem, mit dem der Lokaljournalismus ebenfalls zu kämpfen hat, ist der digitale Wandel und die damit einhergehende Erwartung der Rezipient*innen, dass lokale Publikationen online mit einer Geschwindigkeit
„Die Zukunft der Lokalmedien ist anspruchsvoller als ihre Vergangenheit.“
und einem Volumen publizieren, wie es die großen Medienhäuser tun. Das Ziel, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden, bringe es laut Pöttker mit sich, dass Redakteur*innen weniger hinausgehen und sich mehr auf extern zugelieferte Inhalte verlassen. Diese Entwicklung bezeichnet er als „die Gefahr, dass die Schuhsohle immer weniger zur journalistischen Recherche verwendet wird.“ Dem zu Grunde liege die Tatsache, dass Anzeigeneinnahmen dem Journalismus als Einnahmequelle zunehmend wegbrechen. „Durch die moderne Kommunikationstechnologie müssen Werbende den Journalismus nicht mehr mitfinanzieren, denn die Streuverluste bei der Zielgruppenansprache sind in den digitalen Netzwerken deutlich geringer“, konstatiert Pöttker.
Komplett auf digitale Inhalte umzustellen kann hier aber auch nicht als Musterlösung verstanden werden. So ist Gerhard Pirkner davon überzeugt, „dass die großen Medien ihr Geld immer noch primär mit der gedruckten Zeitung verdienen.“ „dolomitenstadt. at“ als reines Online-Magazin kann sich so nicht finanzieren. Deshalb sah man dort die Digitalmedien-Förderung
des Bundes, welche sich laut Rechtsvorhaben der derzeitigen Regierung
„die Absicherung einer eigenständigen österreichischen Medienlandschaft im digitalen Zeitalter und Gewährleistung für Konsumentinnen/ Konsumenten, dass österreichische Medieninhalte, insbesondere auch regionale Inhalte, auch weiterhin verfügbar bleiben“ zum Ziel setzt, als willkommene finanzielle Unterstützung. Allerdings wurde „dolomitenstadt.at“ von dieser Förderung kategorisch ausgeschlossen. Grund: „dolomitenstadt.at“ sei ja schon vollkommen digital. Hier liege laut Pirkner der Denkfehler vor, dass Medien, die ohnehin nur online publizieren sich nicht trotzdem weiterentwickeln müssen. „Mit dieser Förderung will man Printmedien das Umsatteln auf digitale Plattformen erleichtern. Was dabei vergessen wird, ist, dass es beispielsweise 2010, als wir mit ‚dolomitenstadt‘ online gingen, ‚WhatsApp‘, ‚Instagram‘ und Co. noch gar nicht gab. Ich glaube, fast niemand kann sich vorstellen, was sich hinter dem Backend eines digitalen Mediums tut. Wir mussten 2015 das gesamte Layout neugestalten, um eine ansprechende Darstellung auf mobilen Endgeräten zu gewährleisten. Das unterstreicht, dass sich jede Publikation
im digitalen Mediensegment ununterbrochen weiterentwickeln muss.“
Die mächtigen Bezahlschranken und die Welt dahinter
Eine Form dieser Weiterentwicklung sind Paywalls. Also Bezahlschranken für alle, oder bei manchen Publikationen lediglich ausgewählte Inhalte. Das Prinzip ist eigentlich simpel, es ist dasselbe wie beim Erwerb einer gedruckten Tageszeitung. Der/Die Rezipient*in entrichtet ein Entgelt und erhält im Gegenzug eine Publikation unabhängiger, aktueller und faktenbasierter Berichterstattung. Und doch bezahlen User*innen für viele digitale Inhalte jener Publikationen, für die sie am Kiosk ein Entgelt entrichten würden, im Internet gar nicht und wenn „lediglich“ mit ihren Daten. Auch die „Kleine Zeitung“, die schon seit längerer Zeit mit Paywalls arbeitet, erntete laut Florian Eder nach der Implementierung einiges an Unmut der Leser*innen. „Mittlerweile wurde daraus eine Art Resignation. Die Rezipient*innen haben sich entweder damit abgefunden, oder sich abgewandt.“ Jene, die übrig geblieben sind oder in der Zwischen-
*


Unsere Smartphone-Tarife:
schon ab

zeit erst zu Leser*innen der „Kleinen Zeitung“ wurden, seien aber laut Eder dankbar für den schnellen, gut recherchierten, unabhängigen Journalismus, der sie hinter der Bezahlschranke erwartet. Laut Hannah Suppas „7 Thesen für einen Lokaljournalismus, der Zukunft hat“, die 2019 auf „journalist.de“ veröffentlicht wurden, entscheide es sich jetzt, ob Menschen auch in Zukunft für Lokaljournalismus Geld bezahlen werden. Einzige Möglichkeit, um den Trend noch hin zur Akzeptanz für Paywalls zu drehen sind laut ihr „Texte über das Wohnen, die Stadtentwicklung, das Familienleben, den Verkehr und die Kinderbetreuung, für die Menschen bereit wären, Geld auszugeben. (…) Es sind Analysen, Hintergründe, Meinungsstücke, Service und auch immer wieder ein überraschend neuer Blick auf die eigene Nachbarschaft.“ Leider stand Hannah Suppa für ein Interview nicht zur Verfügung, doch auch Horst Pöttker sieht die Sache mit den Bezahlschranken ähnlich wie Suppa. Er sieht ihre Potenziale weniger im täglichen News Business, sondern beim „erklärenden Journalismus“. Genau dieses Modell der Paywalls für ausgewählte, investigativ recherchierte, erklärende und in der Produktion aufwändigere Beiträge wird bei „dolomitenstadt.at“ bald Realität werden. Denn dort werden solche Beiträge ab dem Frühjahr 2022 hinter der Paywall verschwinden, während tagaktuelle News-Meldungen weiterhin kostenfrei zugänglich bleiben.

Doch ist lokale Berichterstattung durch unabhängige Lokalmedien langfristig gesehen überlebensfähig? „Jein“, meint Florian Eder. Er glaubt, dass dieses Modell in der Zukunft von überdurchschnittlich treuen Leser*innen und langfristigen Anzeigenpartnern abhängig sei. „Ohne diese wird es nicht möglich sein, auf dem gewünschten Niveau zu berichten.“ Er hofft aber, dass diese ausschließlich lokal agierenden Medienplattformen überleben. Denn „Konkurrenz belebt das Geschäft. Es wäre schrecklich, wenn es irgendwann nur mehr die großen Medienhäuser geben würde. Denn gerade diese Fülle an verschiedenen Blickwinkeln und Meinungen im lokalen Tagesgeschäft regen einen selbst dazu an, reflektierter zu arbeiten. Genau diesen Pluralismus schätze ich sehr an der Osttiroler Medienlandschaft und ich wünsche mir, dass der noch lange Zeit erhalten bleibt.“ Darüber, dass die Vielfalt an Me-
dien in Osttirol – so beherbergt der Bezirk neben Redaktionen der „Tiroler Tageszeitung“, der „Kleinen Zeitung“, des „OsttirolJournal“, des „Osttiroler Boten“ und „Radio Osttirol“ auch ein Büro des ORF Tirol und die Redaktion von „dolomitenstadt.at“ – einzigartig sei und unbedingt erhalten werden müsse, sind sich Eder und Pirkner einig.

Es ist den verschiedenen Lokalmedien zu wünschen, dass sie noch Jahrzehnte lang bestehen können. Eines sei laut Horst Pöttker aber sicher: „Die Zukunft der Lokalmedien ist anspruchsvoller als ihre Vergangenheit.“

Copyright:
Copyright:
Copyright:

Community Management verbindet User*innen und deren Site-Betreiber*innen. Als Teilbereich des Social Media-Managements fokussiert es aktive User*innen, die auf öffentliche Inhalte reagieren. Zu dessen Herausforderungen sprach SUMO mit Gabriela Greilinger, Community Engagement Managerin bei „DER STANDARD“.
Community-Management bedeutet auch, die Beziehung zwischen WebsiteBesucher*innen, potenziellen Kund*innen, Fans und Follower*innen in Foren oder auf Social Media-Kanälen aktiv zu gestalten und den Austausch zwischen allen Parteien zu sichern. Bei größeren Unternehmen sind oft mehrere Community-Manager*innen für diese Aufgaben verantwortlich, oder das Unternehmen teilt die Berufe auf in Community- und Social Media-Manager*in.
Community- und Social Media-Manager*in werden oft begrifflich vermischt. Ein Community-Manager und eine Social Media-Managerin haben sehr ähnliche, aber nicht die gleichen Aufgaben. Der Fokus von Community-Manager*innen liegt auf dem Online-Forum. Der/Die Social Media-Manager*in hingegen behält die Social Media-Kanäle im Blick und kümmert sich um die inhaltlichen Punkte. In einigen Unternehmen wurden diese zwei Berufe zu einem vereint. Eine weitere Unterscheidung liegt darin, dass der/ die Community-Manger*in in der Community „unterwegs“ ist, wohingegen der/die Social Media-Manager*in diese aufbaut.

Das Berufsbild Community-Manager*in ist noch wenig geläufig, oftmals fragen innovative Unternehmen oder junge Start-Up‘s diesen Beruf nach. Häufig liegt es daran, dass der Job noch unbekannt ist, bisweilen wird er unterschätzt. Im deutschsprachigen Raum war es just „DER STANDARD“, der als erstmals online verfügbare Zeitung diesen Beruf miterschuf.
Die Entwicklung jedoch ist mehr als auf Online gerichtet. Neue digitale Geschäftsmodelle entwickelten sich, Kund*innen sind längst nicht mehr via Website zu adressieren. Via Online-Marketing können Dienstleistun-
gen oder Waren auch ohne Kontakt mit Kund*innen gewinnbringend verkauft werden. Der/Die CommunityManager*in kann einen Teil des Medienmarketings ergänzen, ein direkter Austausch zwischen Kund*innen und Anbieter*innen wird ermöglicht.
Aufgaben
Eine der Hauptaufgaben eines/r Community-Managers/in ist es, die Benutzer*innen eines Forums im Blick zu behalten, neue Mitglieder in die aktive Gemeinschaft einwerben und damit auch auf die Wünsche der User*innen zur Kenntnis zu nehmen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Gestaltung und der Aufbau einer virtuellen Gemeinschaft. Etwas konkreter ausgedrückt, geht es dabei um die Administration, Optimierung und Betreuung des Forums. Im besten Fall entwickelt sich durch die tägliche Arbeit ein virtuelles Forum und damit eine Gemeinschaft, die den Redakteur*innen mitunter Feedback auf ihre Arbeit liefert und so etwa die gestreuten Inhalte der Tageszeitung „DER STANDARD“ weiterdiskutiert. Wissenshappen und InsiderInformationen sind der Weiterbildung des Forums dabei durchaus zuträglich. Wie bei jeder gut moderierten Diskussion braucht auch ein Online-Forum ein praktikables Regelwerk: „Unser Forum besitzt eigene Richtlinien, an denen sich die User*innen halten müssen. Dies zu kontrollieren, obliegt mir als Community-Managerin und das Ermahnen von Störenfrieden zu meiner Aufgabe“, erzählt Gabriela Greilinger. Damit die Debatte im Forum lebt, die Community motiviert und dabei bleibt, habe sie eine praktikable Strategie entwickelt: „Gut recherchierte Postings voranstellen, sowie jene Punkte aufgreifen, welche im Artikel nicht erwähnt wurden oder auch Postings, die eine andere Sichtweise bieten.“ Auch können Bilder oder Beiträge von User*innen geteilt werden, um diese weiter in die Communi-
ty einzubinden. Kurzum: Online-Foren sind Räume für Öffentlichkeit und Diskurs und die Community Manager*innen die ModeratorInnen der Debatte.
Nicht zuletzt sind Community-Manager*innen auch Ansprechpersonen für Kritik, Fragen, Tipps und Lob der gesamten Plattform. Es ist der direkte Kontakt mit Fans und Nutzer*innen der Plattform, der zur Job Description gehört. Die Community erfährt durch sie/ ihn alle neuen Funktionen beziehungsweise Neuheiten der digitalen Plattform ebenso wie von Gewinnspielen oder Wettbewerben zur Stärkung der emotionalen Bindung an das Unternehmen.
Der/die Community-Manager*in persönlich
Eine wichtige Eigenschaft des/der Community-Managers*in sollte sein, dass diese/r über ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen verfügt, denn sie/er ist eine Schnittstelle, um Leute zusammenzubringen. Ein/e Community-Manager/in sollte Selbstbewusstsein und Souveränität mitbringen. „Vor allem auf Social Media oder auch in Foren ist der Umgangston oftmals rau. Es ist nicht immer einfach, gute Laune und positive Stimmung beizubehalten“, erzählt Greilinger. Es braucht also souveränes Auftreten und einen professionellen Umgang, um schwierigen Nutzer*innen und Nörgler*innen gegenüberzutreten. Kreativität sei eine weitere wichtige Eigenschaft. Die Konzepte und Strategien, welche das Unternehmen mit den Community-Manager*innen festlegt, werden virtuell umgesetzt.
Je stärker die Online-Präsenz ausgebaut und je größer die Community ist, desto schwieriger sei es, den Überblick über alles zu behalten. Als Hilfe, um keine Anfragen oder Kommentare zu übersehen, stehen eine Vielzahl von unterschiedlichen Social Media-Management-Tools zur Verfügung. Diese können Prozesse vereinfachen und auch Abläufe analysieren. Hilfreich sind auch die Möglichkeiten des Monitorings. Diese Tools zeichnen auf, wann und von wem das Unternehmen erwähnt wird, und dementsprechend kann darauf reagiert werden. Doch nicht alle Tools sind für alle Unternehmen gleicherma-
ßen sinnvoll. Jedes Unternehmen muss schauen, welche Anforderungen es an das Tool hat und wie dieses die Arbeit erleichtern kann. Einige Beispiele wären Sociality.io, Hootsuite, Agorapulse, Sprout Social.

In der Zukunft wird Community-Management eine immer wichtigere Rolle spielen. „Schon die letzten zwei Jahre, die geprägt von Corona waren, haben die Zahl der Postings enorm ansteigen lassen“, so Greilinger. Dieser Trend werde sich ihrer Meinung nach fortsetzen, denn das Bedürfnis nach Diskurs sei ungebrochen, die Möglichkeiten der realen Begegnung aber nicht immer gegeben. Foren kompensieren also Defizite. Auch werden immer mehr Projekte ausgearbeitet, den User*innen neue Möglichkeiten zu bieten und damit sie in den Foren bleiben und weiterhin aktiv an den Diskussionen teilnehmen. Der/die Community-Manager*in sitzt an der vordersten Front und weiß, was den/die User*in beschäftigt. Diese Information wird immer mehr in die Kommunikation des Unternehmens miteingebunden und bleibt nicht nur in den digitalen Channels, sondern wird auch in unterschiedliche Unternehmensbereiche zurückgespielt. Damit zeichnet sich ab: Die Rolle eines/r Community-Managers/in wird immer wichtiger werden, denn er bzw. sie kennt von Lob bis hin zur Kritik alles, und diese Informationen kann das Unternehmen nutzen.
von Katharina Pöschl
Ein Jahr gratis Kreditkarte mit ¤ 25,– Startbonus.* Jetzt loslegen mit allen Vorteilen und Ermäßigungen aus der Raiffeisen Club-Vorteilswelt. Auch online eröffnen auf meinstudentenkonto.at

„Ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat“, sagte einst Karl Kraus. Ist diese Polemik noch gültig in unseren Filterblasen? Wie sich die journalistische Arbeitsweise auf Grund von Social Media verändert hat und welche Rolle dabei Fake News spielen, besprach SUMO mit Alexandra Halouska, Chefredakteurin der „Kronen Zeitung“ Oberösterreich, und Isabella Nittner, Journalistin der Tageszeitung „Heute“.
Recherche in Echtzeit, Push-Benachrichtigungen und Leser-Diskussionen auf jeglichen Plattformen: Soziale Netzwerke wirbeln die Welt der klassischen Medien durcheinander. Schreibmaschinen, Fax-Geräte, Druckschluss und festgelegte Uhrzeiten, zu welchen Nachrichtensendungen laufen sind Schnee von gestern. Nachrichten tickern in Echtzeit auf sozialen Kanälen, sekündlich erscheint neuer Content, die Verbreitung funktioniert mit einem Klick. Mittlerweile kann jede/r Inhalte im Netz veröffentlichen oder verbreiten, dies stellt eine große Bereicherung, aber auch eine enorme Herausforderung für Rezipient*innen dar. Die Mediennutzung wird zu immer größeren Teilen auf digitale Plattformen umgelegt. Diese Art der Informationsvermittlung sorgt nicht nur für eine Konkurrenz auf Seite der klassischen Medien, sondern auch für ein verändertes Aufgabenspektrum und Rollenbild der Journalist*innen. Nie hatten Journalist*innen so viele Quellen zur Verfügung, ohne auch nur den Arbeitsplatz verlassen zu müssen, aber auch noch nie wurde ihnen so genau auf die Finger geschaut. Gleichzeitig gilt es, dass die Quellen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden müssen – aber wer sagt was und warum etwas wahr ist?
Die Recherche stellt den Kernaspekt des journalistischen Handelns dar. Grundsätzlich sollen innerhalb dieses Prozesses Informationen über Geschehnisse detailliert und umfassend in Erfahrung gebracht werden, die Relevanz, Gültigkeit und Verstehbarkeit der Informationen ermittelt und entsprechend publizistisch bewertet werden. Im Prinzip haben sich die journalistischen Verfahren seit Jahrzehnten nicht verändert. Unabhängig von welchen Kanälen Informationen bezogen werden, ist es notwendig, dieselbe Vorgehensweise zu wahren. Ohne Faktencheck und mögliche Verifizierungen gehe gar nichts, erklärt „Krone“-Chef-
redakteurin Halouska. Heutzutage beginnt die aktive Suche nach Informationen in sozialen Netzwerken und via Suchmaschinen. Der Zugang zu Quellen und das Auffinden von Inhalten wird grundlegend vereinfacht und beschleunigt. Von besonderer Bedeutung sind in erster Linie Microblogging-Dienste (z.B. „Twitter“), Podcasts, Social MediaPlattformen („Facebook“, „Instagram“ und Co.), Videoplattformen wie „YouTube“, Suchmaschinen (v.a. „Google“) und Online-Enzyklopädien („Wikipedia“). Hierbei werden soziale Netzwerke und Suchmaschinen unter dem Begriff „Suchhilfen“, mittels welcher öffentlich zugängliche Informationen gefunden werden können, zusammengefasst. Suchhilfen sind relevant, wenn Journalist*innen über keinen direkten Zugang zu Quellen verfügen, um geeignete Quellen zu identifizieren oder auch, um Informant*innen zu kontaktieren, hält Christian Nuernbergk fest („Journalismus im Internet“, 2018). „Twitter“ fungiert als wichtige Informationsquelle – nicht per se für Leser*innen, umso mehr jedoch für Recherchezwecke. Hier sei das journalistische Medienumfeld relevant, da man sich Inspiration von Kolleg*innen holen könne. Für Leserbeobachtungen, Meinungen und Stimmungsbilder sei „Facebook“ besonders wichtig. Halouska exkludiert dabei „Instagram“ weitgehend, da der Nachrichtenfokus keinen hohen Stellenwert habe wie bei anderen Plattformen. So vorteilhaft diese Aspekte auch sind, muss man sich bewusst sein, dass das Internet eine Umgebung darstellt, in der Beiträge auch ungeprüft verbreitet und von Falschinformationen oder Halbwahrheiten strategisch platziert sowie geteilt werden können. Da der Journalismus die Geschehnisse der Umwelt nicht immer nur auf primären Quellen stützten kann, ist es notwendig, Sekundarinformationen zu beziehen. Quellen verfolgen partikulare Interessen: Damit Fehlinformationen ausgeschlossen werden können, ist eine gründliche und kompetente Prüfung der Inhalte unabdingbar, so Nuernbergk. Die „Heute“-Journalistin Isabella Nittner unterstreicht im SUMO-Gespräch, dass ihre
Vorgehensweise ganz nach dem Motto „Check, Re-Check, Re-Re-Check“ funktioniere, sprich, dass vermeintlich falsche Informationen zuerst verifiziert würden. Im Anschluss werde versucht, mit zuständigen Behörden, Expert*innen beziehungsweise Wissenschaftler*innen Kontakt aufzunehmen, um die Inhalte korrekt aufarbeiten zu können.


In der Alltagssprache wird der Begriff „Fake News“ für alles verwendet, was dubios oder falsch erscheint. Im wissenschaftlichen Kontext sind gezielt lancierte Falschmeldungen gemeint, also ein Handeln aus Vorsatz. Um die Assoziation zu vermeiden, spricht man besser von Desinformation. Keineswegs sind sie eine Erfindung der Neuzeit, bloß kann heute jeder Mensch mit Internetzugang wahre und falsche Inhalte verbreiten. Viele Rezipient*innen sehen daher die Aufgabe des Journalismus darin, Nachrichten zu verbreiten, die der Wahrheit entsprechen, konstatierte Tanjev Schultz („Frankfurter Hefte., Identität vs. Identitätspolitik, 2018“). Dennoch benötigen Rezipient*innen Hilfe beim Einordnen jener Informationsflut. Guter Journalismus müsse bei dieser Einordnung unterstützen und Meinungen von unterschiedlichen Quellen sowie Expert*innen wiedergeben.
Die Leser*innen suchen sich dann entweder ein Stimmungsbild aus oder machen einen Faktencheck. Die Schnelligkeit und die Schnelllebigkeit von Informationen können dazu verleiten, Inhalte allzu rasch einzuordnen, ohne vorher alle relevanten Inhalte zusammengetragen zu haben, so Halouska. Isabella Nittner erzählt aus der Praxis ebenso, dass rund um die Uhr mit höchster Vorsicht gearbeitet werden müsse: Eine unkonzentrierte Arbeitsweise könne man sich nicht leisten, da die daraus resultierenden Konsequenzen fatal sein könnten. Es sei ein gewisser Druck da, der dazu führe, dass Medien nicht vorsichtig genug mit Informationen umgehen und diese schneller ausspielen. Das führe dazu, dass andere Medien sich bemüßigt sehen, nachzuziehen und Inhalte schnell auszuspielen, meint Halouska. Journalist*innen sind heutzutage gezwungen, unter enormen Zeitdruck eine Flut an Informationen durchzuarbeiten, um relevante Inhalte herauszufiltern. In weiterer Folge müssen die Geschichten auf ihre Echtheit geprüft, Fakten recherchiert und in der Regel für diverse Kanäle aufbereitet werden. Als Nährboden und Brandbeschleuniger für Falschinformationen gelten soziale Netzwerke. In der Realität haben Journalist*innen freilich auch unwahre Nachrichten verbreitet. In der Demokratie kommt der Druck nicht unbedingt vom Staat, sondern vom Markt, da Auflagen, Quoten und Aufmerksamkeit die stärksten Treiber im journalistischen Geschäft darstellen. In den meisten Fällen handelt es sich aber um unabsichtliche Fehler und Verzerrungen der Realität, die mit journalistischen Routinen zu tun haben. Diese Fehler resultieren öfters aus fehlender Kompetenz und Tempowahn. Der Druck der Echtzeit-Veröffentlichung kann dazu führen, dass Medien ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigen (Schultz, 2018).
Nichtsdestotrotz seien soziale Netzwerke laut Isabella Nittner nicht aus dem Redaktionsalltag wegzudenken. Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang ist weiterhin die rasante Geschwindigkeit der Branche. Gerüchte und Unwahrheiten können sich zweifellos im Netz verbreiten, die Quellen sind allerdings halbseidene Akteur*innen und nicht seriöse Journalist*innen (Schultz, 2018).
Prinzipiell ist es allen Menschen, die ein Smartphone besitzen und Zugang zu freien, nichtkommerziellen Medien haben möglich, eine journalistische Rolle einzunehmen. Hierbei spricht man von partizipativem Journalismus. Die Akteur*innen können Informationen produzieren, verbreiten und austauschen. Dabei handelt es sich um eine große Bandbreite an aktuellen Themen, allgemeinen Interessen bis hin zu individuellen Belangen. Diese Personen können sich einmalig aktiv oder regelmäßig beteiligen. Häufig fehlt jegliche Verifizierung und Überprüfung der Fakten, zudem verfügen die Verfasser*innen oftmals über keine einschlägige Ausbildung im jeweiligen Ressort, stellte Rene Foidl 2017 („Eine Vorwärtsrolle in den partizipativen Journalismus“) fest. Das Internet bietet in vielerlei Hinsicht neue Optionen und Potentiale für den Journalismus. Das Publikum kann bei der redaktionellen Arbeit unterstützen, indem es Bildmaterial zuliefert und Informationen zur Verfügung stellt. Ebenso erleichtert das Internet das Sammeln von Publikumsanregungen bei der Themenfindung. Die Resonanz der Leserschaft gibt einen Überblick über die Stimmungslage zu aufkommenden Inhalten.
Unter anderem bietet das Web mehr Transparenz bei der Recherche, einen verbesserten Datenaustausch und eine einfachere Zugangsmöglichkeit zu Quellen, so Nuernbergk (2018). Laut Isabella Nittner wäre die Relevanz der einzelnen Kanäle sehr stark von der Zielgruppe abhängig. Bei „Heute“ werde „Facebook“ von der „älteren Generation“ stärker frequentiert, im Verhältnis zu „TikTok“ und „Instagram“. Will man eine große Bandbreite an Menschen erreichen, ist es unabdingbar, alle dieser Kanäle zu bedienen. Die „Kronen Zeitung“ sei laut Halouska besonders gefordert.

Da sie ein sehr breites Leserspektrum habe, werde das Medium dazu angehalten, alle Kanäle zu bespielen, die für die Lebensqualitäten der Menschen relevant sind. „Das ist eine Menge Arbeit, weil natürlich auch beim Inhalt selbst und dessen Aufbereitung für die Alters- und Zielgruppe eingegangen wer-
den muss“, unterstreicht auch Nittner. „Facebook“, „Instagram“ und „TikTok“ sind jene Plattformen, die sowohl im News-Bereich als auf Rezipient*innenSeite am häufigsten genutzt werden. Soziale Medien haben den Journalismus grundlegend verändert, somit mussten sich Medienunternehmen mit ihren Produkten neu anpassen. Diese Ausprägungen bieten aber auch neue Chancen, indem beispielsweise personalisierte Angebote ausgespielt sowie Kosten und Ressourcen reduziert werden. Die Verzerrung der Rollenbilder führte dazu, dass komplexe Spannungsfelder zwischen Journalist*innen, Leser*innen, Quellen und Publikationsmedien entstanden. Der partizipative Journalismus zwingt Journalist*innen, sich innerhalb dieses Rollenmodells bewusst zu positionieren, stellten Meckel, Fieseler & Grubenmann bereits 2014 fest („Social Media – Herausforderungen für den Journalismus“).
Damit Medienhäuser entsprechend Inhalte an die Rezeptionsinteressen ausspielen können, ist es notwendig, sich an den kundenspezifischen Anforderungen zu orientieren. Die Herausgeber*innen ermöglichen es, der Leserschaft einen hohen Grad der Kontrolle darüber zu bieten, welche Informationen sie rezipieren und wie die Nachrichten übermittelt und präsentiert werden. „Demand Content“ stellt hierbei eine Form dar, in welcher die Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse maximal erreicht wird, indem Inhalte nicht nur auf die Nutzerinteressen zugeschnitten, sondern auch die Bedürfnisse bei der Erstellung von Nachrichten einbezogen werden. Beispielsweise werden Beiträge über Themen, die oft gelesen werden, herausgefiltert und weitere Inhalte dieser Art ausgespielt, so Meckel u.a. Für die „Kronen Zeitung“ sei „Facebook“ ein relevanter Kanal, da nicht nur viele Nutzer*innen Informationen von dieser Seite beziehen, sondern auch frequentiert Feedback geben, erläutert Halouska. Zudem gewinnt die größer werdende Datenmenge (Big Data) an Bedeutung, da sich Journalist*innen mit der Interpretation dieser Daten auseinandersetzen. Diese Datenmen-
gen müssen aufbereitet und analysiert werden, damit Themenstränge sichtbar werden und um den tatsächlichen Nachrichtenwert herauszufiltern. Diese Prozesse durchzuführen, benötigt es von Seiten der Journalist*innen neue Kompetenzen, um dem Datenjournalismus gerecht werden zu können, befanden Meckel u.a. 2014. Algorithmisch personalisierte Nachrichtenkanäle funktionieren nach einem Prinzip: Die Systeme erfassen kontinuierlich und automatisch die Präferenzen der Nutzer*innen und ihre Randdaten, beispielsweise ihr Verhalten, ihren Standort und ihre Netzwerkkontakte.
Diese Daten liefern ein Präferenzprofil der Rezipient*innen und dazu werden inhaltsbezogene Parameter, sogenannte Meta-Informationen, verknüpft. Algorithmen verarbeiten all diese Daten und treffen eine Reihe von Entscheidungen in Echtzeit, resümiert u.a. Schweiger 2019 („Algorithmisch personalisierte Nachrichtenkanäle“). Automatisierte Berichterstattung spielt in diesem Kontext auch eine erhebliche Rolle. Bislang funktionierte diese – laut Andreas Graefe und Mario Haim („Wenn Algorithmen Journalismus machen“, 2016) – vor allem in den Ressorts Sport und Finanzen gut, weil auf Basis der Daten Texte automatisch erstellt werden können. Sind die Algorithmen erstmals entwickelt, kann eine unendliche Anzahl von Artikeln schnell und günstig erstellt werden.
Bedacht werden sollte, dass die Medienrealität wegen der notwendigen Auswahl an Themen und Aspekten nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden darf. Medien verwenden bestimmte Frames (Bedeutungsrahmen), die den Blick auf die Verhältnisse prägen. Die Wahrheitsorientierung jedoch steht nach wie vor im Fokus. Soziale Netzwerke setzen heutzutage auf Themen, die von publizistisch-professionellen Medien aufgegriffen werden, wodurch diese zur standardmäßig abzufragenden Recherchequelle von Journalist*innen wurden. Auch wenn der Journalistenberuf einem Bedeutungsschwund unterliegt und nicht mehr als allmächtiger Gatekeeper angesehen wird, fügt er sich laut Volker Lilienthal („Social Media
– eine Substitution von Qualitätsjournalismus?“, 2013) in die Rolle des Gatewatchers, der Informationen aus dem Internet entnimmt und im Idealfall die Kernaspekte herausfiltert. Die Digitalisierung hat dazu verholfen neue Kanäle zu schaffen, um Falschinformationen und Gerüchte zu verbreiten. Was früher Mund zu Mund verbreitet wurde, wird heutzutage mit einem Tastendruck und Mausklick um den Globus geschickt. Es ist wichtig, sich von einem naiven Realismus zu distanzieren und zu bedenken, dass Medien nicht die Wirklichkeit in der Form zeigen, wie sie wirklich ist: „Jeder Versuch, Fake News zu verbreiten, ist ein Beleg dafür, wie sehr auch in der digitalen Ära kritischer, sorgfältiger Journalismus gebraucht wird“ (Schultz, 2018). Wenn Medien auch in Zukunft als eine Instanz für Aufklärung, Kritik und Kontrolle fungieren sollen, muss dafür gesorgt werden, dass die Rahmenbedingungen diese Aufgabe auch ermöglichen. Aus diesem Grund müsse auch das Zusammenspiel von Journalismus und sozialen Medien funktionieren, unterstreicht Alexandra Halouska.


von Viktoria Ecker

Ein bekanntes Zitat sagt, man solle für sich selbst einen Beruf wählen, den man liebt. Denn dann brauche man keinen Tag in seinem Leben mehr zu arbeiten. Wer im Journalismus tätig ist, für den scheint der Beruf ohnehin mehr zu sein, als „nur“ eine Arbeit – so ist jedenfalls der Eindruck nach mehreren Interviews mit Journalist:innen. Einige haben ihre Branche besonders geprägt, oder tuen es heute noch. SUMO hat sich auf die Suche nach Journalist:innen-Legen-den gemacht – und große Persönlichkeiten gefunden.
Wenn sich Heinz Nussbaumer an sein erstes Zusammentreffen mit Hugo Portisch erinnert, dann ist es eine Erinnerung an den „unendlich Großen“. „Aus dem Versuch ihn nachzuahmen, haben wir uns angezogen wie er, mit denselben hellblauen Hemden und einem Trenchcoat. Wir wollten alle Portisch sein“, sagt er. Nussbaumer ist selbst Journalist, der im April 2021 verstorbene Hugo Portisch war sein Wegbegleiter. Dass der Name Portisch nicht fehlen darf, wenn es um Journalist:innen-Legenden geht, scheint außer Frage zu stehen. Für Heinz Nuss-baumer war Hugo Portisch schon zu Lebzeiten eine Legende: „Als ich noch Student war, ha-ben Freunde von mir meine Beiträge aus einer Salzburger Zeitung immer wieder an Hugo Portisch geschickt“, erzählt Nussbaumer. Eines Tages folgte die Einladung, schließlich kam er als 23-Jähriger zur Außenpolitik bei der Tageszeitung Kurier. Portisch wurde sein Vorge-setzter – und Lehrer: „Er hat mich in die Welt hinausgeschickt.“
Die drei Ratschläge des Hugo Portisch
Journalist zu sein, sei Portischs Lebens- und Berufswunsch gewesen, habe ihm eine Freiheit wie kein anderer Beruf gegeben, sagt Nussbaumer. Welches Verständnis des Berufes Portisch hatte, verdeutlicht ein Zitat von ihm: „Ein Privileg, als Chronist mitzuerleben, wenn der erste Rohentwurf der Zeitgeschichte geschrieben wurde.“
Dazu komme Ernsthaftigkeit, ein hoher ethischer Anspruch, positive Neugierde und Unbestechlichkeit, erinnert sich
Heinz Nussbaumer: „Er war frei von Besserwisserei und Vorurteilen, war enorm tolerant.“ Was Por-tischs Arbeit geprägt habe, sei auch die Ansicht gewesen, dass man die Zukunft nur bewälti-gen könne, wenn man die Vergangenheit verstehe: „Das war der Kern seiner ORF-Dokumen-tationsserien.“
Dazu kamen freilich die persönlichen Erfahrungen aus dem Aufwachsen wäh-rend des Zweiten Weltkrieges, in der Nachkriegszeit und das Miterleben des Wiederaufbaus Österreichs. Aber:
„Er war eine stille Autorität hinter den Kulissen. Ich glaube, bis heute könnte niemand sagen, welcher Parteigänger er war.“ Hugo Portisch habe seinen Kolleg:innen gerne drei Ratschläge mit auf den Weg gegeben. „Sage nie jemandem ungefragt, welchen Beruf du hast – so angesehen ist er nicht. Wer immer dich hofiert, merke dir: Er meint nie dich, er meint immer nur das Medium. Vergiss nie, Journalismus ist immer nur geborgte Macht“, sagt Nuss-baumer. Dass sich das Berufsbild von Journalist:innen – und damit auch die Aufgaben – verändert haben, sei allerdings auch Hugo Portisch bewusst geworden: „Er hat zu mir gesagt: ‚Ich kann nicht über etwas reden, das für junge Journalisten irrelevant geworden ist.‘ Zeitungen werden anders gemacht, das ist nun einmal so.“
Zugegeben: Die Suche nach Journalist:innen-Legenden ist keine einfache. Wer gehört unbe-dingt dazu? Welchen Namen darf man keinesfalls vergessen? Wie definiert man „Legenden“ überhaupt? Alleine im deutschsprachigen Raum wäre die Liste lang. Mit Blick auf Europa, die USA oder gar global noch um einiges länger. Darunter auch Journalist:innen, die für ihren Beruf das Leben lassen mussten. Der Slowake Ján Kuciak ist einer von ihnen. Er war Redak-teur der Nachrichtenplattform aktuality.sk und beschäftigte sich im Zuge dessen hauptsächlich mit Korruption in der slowakischen Politik und Wirtschaft. Nachdem Kuciak bereits mehrmals Drohungen erhalten hatte, wurde er gemeinsam mit seiner Verlobten Martina Kušnírová im Februar 2018 tatsächlich ermordet aufgefunden. Erst danach wurden weitere Recherchen Ku-ciaks veröffentlicht, in denen es um Verbindungen zwischen slowakischen Politikern zu orga-nisierter Kriminalität ging. Diese Berichte sorgten für große Bestürzung in der Bevölkerung – mit dem Ergebnis, dass Politiker bis hin zum damaligen Ministerpräsidenten Robert Fico zu-rückgetreten sind. Fast drei Jahre später wurde Miroslav Marcek für den Mord an den beiden zu
25 Jahren Haft verurteilt. Seit dem Bekanntwerden des Todes von Ján Kuciak stand die Vermutung eines Auftragsmordes im Raum.
Im Film „Die Unbestechlichen“ aus dem Jahr 1976 geht es um zwei Journalisten, die ebenfalls einen Legendenstatus erreicht haben: Carl Bernstein und Bob Woodward. Ihre Recherchen führten zur Aufdeckung der „Watergate-Affäre“ und in der Folge zum Rücktritt von Richard Nixon, damals Präsident der USA. Bernstein wurde 1944 geboren und wuchs in Washington D. C. auf. Seine journalistische Laufbahn hat im Alter von 16 Jahren begonnen, mit 19 war er bereits Reporter. Woodward stammt aus Illinois und wurde 1943 geboren. In den 1960er Jah-ren hat er Geschichte und englische Literatur an der Yale University studiert. Nach einigen Jahren bei der US-Navy kam er Anfang der 1970er Jahre zur Washington Post. Bernstein und Woodward berichteten ab 1972 über den US-Wahlkampf – und über missbräuchliche Vor-gänge in der Amtszeit von Richard Nixon. Im Sommer 1974 erklärte er seinen Rücktritt. Für ihre investigativen Recherchen wurden Carl Bernstein und Bob Woodward gemeinsam mit der Washington Post mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
Anneliese Rohrer: Eine Legende als Vorbild
Zurück nach Österreich. Weiter auf der Suche nach Journalist:innen-Legenden. Anneliese Rohrer – auch sie darf nicht fehlen. „Ich bin zu zwei Überzeugungen gelangt. Für den Beruf des Journalisten brauchen Sie unglaubliche Leidenschaft, sonst zahlt es sich nicht aus. Und Sie brauchen ein Motiv, warum Sie es machen. Das kann alles Mögliche sein: Bekanntheit, Ruhm, Leute kennenzulernen, Schreiben. Mein Motiv war immer zu verhindern, dass die Leute von der Politik hinters Licht geführt werden“, sagt sie. Das helfe auch, mit Kritik umzugehen. Oder mit Anfeindungen, die im Internet geäußert werden. „Am besten für die eigene psychi-sche Hygiene ist, man liest das gar nicht erst.
Vor allem wenn der Tonfall nicht konstruktiv ist“, sagt Rohrer. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung im Journalismus, war unter anderem bei den Tageszeitungen Kurier und Presse – für die schreibt sie auch heute noch – tätig. Ein journa-listisches Vorbild hatte auch sie: „Erreicht habe ich es nie: die legendäre Chefredakteurin von ‚Die Zeit‘, Marion Gräfin Dönhoff.“ Die Frage liegt nahe, wie Anneliese Rohrers Einstieg in den Beruf ausgesehen hat. Wieder schwingt in der Antwort mit, dass sich die Branche verändert habe, ihre Anfangszeit mit der heutigen Situation schwer zu vergleichen sei. „Es gab überhaupt keine Journalistenausbildung in Österreich“, erinnert sie sich. „Völlig unerfahren“ habe sie die Chance bekommen, bei der „Presse“ zu arbeiten. Heute sei ein Studium oft sogar eine Vo-raussetzung für einen Job in der Branche. Nicht die beste Entwicklung, findet Anneliese Roh-rer: „Durch diese Formalisierung verliert man Menschen, die etwas Besonderes für den Beruf mitbringen. Das wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen.“

Ein Leben lang mit dem Beruf verbunden. So soll das sein, meint Anneliese Rohrer: „Man muss nicht unbedingt so politiksüchtig sein wie ich. Aber man muss die Neugierde und das Interesse behalten. Und dazu die Quintessenz des Journalismus, der Wahrheit – was auch immer das ist – ein Stück weit näher zu kommen.“ Man müsse sich die Vertrauenswürdigkeit behalten, sagt sie. Denn: „Ein Journalist hat kein anderes Kapital als seine Glaubwürdigkeit, das kann man nicht aufs Spiel setzen. Nicht alle sehen das so, aber dann geht es meistens auch nicht gut aus.“ Der Blick auf die Zukunft der Branche fällt auch der erfahrenen Journalistin nicht leicht. „Sie wird davon abhängen, ob die Medienhäuser eine Antwort darauf finden, wie man guten Journalismus wirklich finanzieren kann. Das wird das Um und Auf sein“, betont Rohrer. Einsparen könne auf Dauer jedenfalls nicht der richtige Weg sein. Für junge Kolleg:innen hat sie – auch abseits des Findens eines richtigen Motives – einen wichtigen Rat: „Man muss sich Gedanken darüber machen, in welcher Mediensparte man sich am wohlsten fühlt. Weil dann kann man die nötige Leidenschaft und Energie entwickeln.“ Anneliese Rohrer lehrte an der Fachhochschule Wien, die Weitergabe des Wissens per se sei dabei aber nicht das Ausschlaggebende. Vielmehr gehe es darum, Studierenden vor Augen zu führen, unter wel-chen Rahmenbedingungen Journalismus als Beruf funktionieren könne.
Wer als Journalist:in tätig ist, dem kommen im Rahmen des Berufes mehrere Funktionen zu: Informationsvermittlung, Aufklärung, Kritik und Kontrolle. Vor allem in den drei Letztgenannten sei das Bedürfnis, sich einzubringen, bei vielen auch im journalistischen Ruhestand groß, sagt Kommunikationswissenschaftler Markus Behmer von der Universität Bamberg. Der Beruf en-det eben nicht zwingend mit der Pension. Es kommt vor, dass Journalist:innen noch vor dem Ruhestand in Talkrunden zu Gast sind. Das sei auch kritisch zu sehen, meint Behmer: „Oft – vielleicht sogar zu oft – erlebt man dann, dass Journalist:innen Journalist:innen befragen. Ei-gentlich sollten sie aber mit Expert:innen sprechen und Journalist:innen nicht den Anspruch haben, Expert:innenwissen zu ersetzen.“ Spätestens an diesem Punkt stellt sich auf der Suche nach Journalist:innenLegenden die Frage, wie wichtig die einzelnen Persönlichkeiten eigent-lich sein dürfen. Schließlich hat Hugo Portisch gesagt, man hofiere keine Person, sondern ein Medium. „In der Journalismusforschung war die Systemtheorie sehr lange en vogue. Die ein-zelne journalistische Persönlichkeit ist eher vernachlässigt worden – und das auch völlig zu-recht. Denn das redaktionelle System innerhalb eines Mediums bestimmt viel stärker als ein-zelne Personen, wie und was berichtet wird“, erklärt Behmer. Was nicht heißen soll, dass es keine Vorbilder geben darf. „Hier wäre es wichtig, ein diverses Bild zu zeichnen. Zum Beispiel mit Journalistinnen, die dann wiederum Vorbild für junge Frauen sein können“, sagt er. Was Journalist:innen zur Legende macht, muss übrigens nicht unbedingt ein großer Name sein: „Es können auch die Leute sein, die zum Beispiel in den Lokalredaktionen ihre tägliche Arbeit machen. Es müssen nicht unbedingt die großen aufklärerischen Leistungen sein – sondern auch die Personen, die ganz einfach Informationen vermitteln“, betont Markus Behmer.
Noch einmal zurück zu Hugo Portisch, der Mitte Februar 95 Jahre alt geworden wäre. Sein Wissen hat er unter anderem auch an Heinz Nussbaumer weitergegeben. Naheliegend also, dass Nussbaumer etliche Laudationes auf Portisch gehalten hat. Trotz des Legendenstatus: Die posthume Erinnerung von Heinz Nussbaumer an den „unendlich Großen“ ist letztlich doch eine ganz persönliche: „Wir hatten eine Lebens-
 Von Anna Hohenbichler
Von Anna Hohenbichler

freundschaft – die manchmal etwas näher, manchmal etwas entfernter war.“Heinz Nussbaumer und Hugo Portisch Copyright: privat Markus Behmer Copyright: Universität Bamberg Anneliese Rohrer
Medieninhaberin:
Fachhochschule St. Pölten GmbH
c/o SUMO
Campus-Platz 1
A-3100 St. Pölten
Telefon: +43(2742) 313 228 - 200
www.fhstp.ac.at
Fachliche Leitung:
FH-Prof. Mag. Roland Steiner
E-Mail: roland.steiner@fhstp.ac.at







Telefon: +43/676/847 228 425
sumomag.at facebook.com/sumomag instagram.com/sumo.mag
Das Team der Ausgabe 38 und des Online-Magazins
Infobox

Sales: alle



Textredaktion: alle







Wissen, was morgen zählt.
Jetzt informieren: fhstp.ac.at
Neun Themenbereiche
• Medien
• Informatik


• Security
• Digitale Technologien
• Bahntechnologie
• Kommunikation
• Innovation
• Gesundheit
• Soziales
Juliana Kinnl Studentin Medientechnik