
Abenteuer
Kajaktour auf der Aare



Abenteuer
Kajaktour auf der Aare










Kostenlose Muster vorbestellen



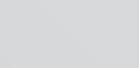



Der elastische Griff und die trockene Schutzfolie machen das Einführen leicht – ohne den Katheter berühren zu müssen.
Die fl exible Spitze und der weiche Katheter gleiten sanft und sicher durch alle Biegungen der männlichen Harnröhre. Die fl exible Spitze zentriert den Katheter beim Einführen.
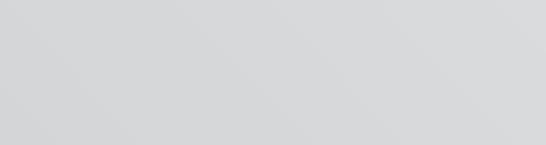
Die Verpackung ist einfach zu öffnen und sieht nicht medizinisch aus. Nach Anwendung kann der wieder verschlossene Katheter in die Verpackung zurückgesteckt werden. Die Verpackung kann ebenfalls wieder verschlossen werden, um sie später klein gefaltet zu entsorgen.

SpeediCath® Flex erleichtert jeden Schritt des Katheterisierens – neu mit einer noch einfacheren Verpackung.
Die neue Verpackung vereinfacht das Öffnen, Transportieren und Verschliessen und ist umweltfreundlicher.
Registrieren Sie sich jetzt um bei Markteinführung kostenlose Muster zu erhalten:
www.coloplast.ch/muster oder 0800 777 070 (kostenlos)
Coloplast AG
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Eine meiner ersten Aufgaben vor 21 Jahren war, die SPV auf die Zukunft und das Wachstum und auf die Herausforderungen mit dem BSV und der IV vorzubereiten. Die Grössenordnungen haben sich seither betrieblich praktisch verdreifacht (Personal und Finanzen). Neben den operativen Aufgaben wurde ich von Guido A. Zäch mit immer weiteren für die Schweizer Paraplegiker-Gruppe wichtigen Aufgaben betraut, sei dies als Mitglied der Geschäftsleitung der SPG, als Vizepräsident im Verwaltungsrat des SPZ, in Verwaltungsräten bei der Informatik oder bei Paramobil, mit dem Präsidium der Pensionskasse SPG oder dann durch den Stiftungsrat später z. B. als Delegierter des Hotels Sempachersee. Das Präsidium von Swiss Paralympic kommt dazu. In guter Erinnerung bleiben mir die nationale Leitung und der Gewinn des Referendums gegen die Abschaffung der IV-Viertelsrente im 1999 oder danach die Verfassungsinitiative für die Gleichstellung. Eine Zeit, in der mich meine Familie zu Hause weniger gesehen hat, als mir heute lieb ist.
Stets hatte ich ein Ziel vor Augen: eine autonome und unabhängige SPV, die finanziell einen derartigen Rückhalt hat, dass die 27 Rollstuhlclubs als zentrale Pfeiler dieser Organisation auf demokratischem Wege an der Delegiertenversammlung über ihre eigene Organisation unabhängig und mit einem finanziellen Freiraum bestimmen und deren Ausrichtung festlegen konnten. Und ich

wurde in diesen 21 Jahren nie enttäuscht, denn die Delegierten und die Rollstuhlclubs haben immer den gesunden Menschenverstand walten lassen und die SPV mit qualifizierten Mehrheiten immer sicher geleitet. Und das zählt für mich letztlich: das Teamwork auf allen Ebenen, das die SPV bei einer sachlichen Betrachtung zu einer blühenden Organisation gemacht hat. Mein Herzblut bleibt bei der SPV. Ich danke allen herzlich für die wertschätzenden, spannenden und persönlichen Begegnungen. Eine prägende und bereichernde Zeit bleibt mir in bester Erinnerung.
Betrübt bin ich über die Vorkommnisse der letzten Zeit, die mich sehr belastet und schweren Herzens bewogen haben, die SPV zu verlassen. Es werden sich auch vier von sechs Vorstandsmitgliedern zurückziehen. Ebenso ist Ruedi Spitzli und werden meine GL-Kollegen Michael Weissberg, Urs Styger und Erwin Zemp bis im Dezember 2019 teilweise frühzeitig in Pension gehen. Jede Erneuerung ist immer eine Chance für einen Verband. Mit jedem Abgang geht aber Wissen, Erfahrung und Netzwerk verloren, das es wieder aufzubauen gilt. Ich wünsche der neuen Crew hierfür Kraft, Ausdauer und Erfolg und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, von Herzen alles Beste.
Herzlichst, Merci und Adieu
Dr. Thomas Troger




Bereits 1983 revolutionierten wir den Kathetermarkt mit LoFric®. Nun wollen wir das gleiche im Bereich der transanalen Irrigation (TAI) tun. Lassen Sie uns Navina™ Smart vorstellen, eine clevere Lösung, die es mehr Menschen ermöglicht die TAI durchzuführen. Navina Smart verfügt über eine elektronische Pumpe und ein Display mit dem Sie Ihre persönlichen Einstellungen abspeichern können und das auch von Personen mit eingeschränkter Handfunktion ganz einfach zu bedienen ist. Navina Smart in Verbindung mit der Navina Smart App, wurde entwickelt um mehr Anwender über einen längeren Zeitraum zur Anwendung zu motivieren, damit die Therapie die Chance erhält, erfolgreich greifen zu können.
Erfahren Sie mehr unter navinasystems.ch
Einfach und intuitiv Erleichtert die Therapie Präzise persönliche Einstellungen





















«Ihre Mobilität liegt mir am Herzen»




Baumann Leiter Fahrzeugumbau

Ihr kompetenter Autoumbauer mit 30 Jahren Erfahrung, insbesondere bei Querschnittlähmung.
Umbauten aller Fahrzeugtypen und Marken für mobilitätseingeschränkte Menschen
Komplexe Einzelanfertigungen nach Mass Abklärungen rechtlicher, technischer und ergonomischer Fragen
Ausbildung in eigenen umgebauten Fahrschulautos
Enge Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten des Schweizer Paraplegiker-Zentrums und mit Strassenverkehrsämtern
Rufen Sie mich an, ich berate Sie gerne.
Orthotec AG | Fahrzeugumbau | Eybachstrasse 6 CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 52 52 | F +41 41 939 52 50 info@orthotec.ch | www.orthotec.ch Ein Unternehmen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
Herausgeberin
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil
Telefon 041 939 54 00
E-Mail spv@spv.ch www.spv.ch
Chefredaktor
Dr. iur. Thomas Troger
Redaktion
Urs Styger, Felix Schärer, Roger Getzmann, Erwin Zemp, Evelyn Schmid, Gabi Bucher
Koordination, Grafik, Inserate Tina Achermann
Fotos
SPV, fotolia.com, Rapperswiler Kinderzoo, Stadler Rail, Orthotec, Heinz Meier, Andreas Gautschi, Silvia Junker, Urs Sigg, JUSKILA Jugendskilager, SPS
Druck
Brunner Medien AG, www.bag.ch
Redaktionsschluss
Ausgabe Sommer 2019: abgeschlossen Ausgabe Herbst 2019: 24.5.2019
Auflage
8 600 Exemplare deutsch 4 450 Exemplare französisch
In dieser Publikation wird zur Vereinfachung die männliche Form stellvertretend für die weibliche und männliche Formulierung verwendet.
Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Namentlich gekennzeichnete Fremdbeiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder. Ein Abdruck von unverlangt eingesendeten Manuskripten ist nicht gewährleistet.


WIR BEWEGEN
AKTUELL 6
THOMAS TROGER
Macher und Netzwerker 8
VERABSCHIEDUNG
Christian Betl: Es war mir eine Ehre 11 NACHGEFRAGT
Im neuen Kleid 13
LEBENSBERATUNG
HINDERNISFREIES REISEN
Zug zusammen bauen 14
ROLLSTUHLWARTUNG
Den Rollstuhl auf Vordermann bringen 16
GUIDED CARE
Ein Pilotversuch der SPS 17
IM BALGRIST
SPV-Höck 17
RECHTSBERATUNG INVALIDENRENTE
Unfall hätte ich Karriere gemacht 18
über ein Nabelstoma 20
HINDERNISFREIES
PFLEGELEISTUNGEN
Viele Suva-versicherte SPVMitglieder haben im Dezember 2018 ein Schreiben erhalten, in welchem die monatlichen Überweisungen der Suva aufgezählt sind. Es wird erwähnt, dass neu Leistungen, welche nicht durch die Hilflosenentschädigung abgegolten sind, direkt der Spitex vergütet werden. Zudem seien Rechnungen der Spitex betreffend Leistungen der Grundpflege direkt durch den Versicherten zu begleichen.
Diese Aussage, wonach Leistungen der Grundpflege vollumfänglich durch die Hilflosenentschädigung abgegolten und daher vom Versicherten zu bezahlen seien, entspricht nicht der Rechtsauffassung der SPV. Weiter führt die Aufgliederung finanziell zu einer Verringerung der Suva-Leistungen für jene SPVMitglieder, deren Spitexkosten bis anhin integral von der Suva übernommen wurden. Eine derartige Modifikation der Leistungen ist gemäss der Rechtsauffassung der SPV nur möglich, wenn die Voraussetzungen für eine revisionsweise Anpassung derselben gegeben wären. Dies dürfte beim Grossteil der Versicherten nicht der Fall sein.
Handeln Sie jetzt! Vor diesem Hintergrund bieten wir betroffenen SPVMitgliedern die Möglichkeit, sich an unser Institut für Rechtsberatung (IRB) zu wenden, damit dieses sie betreffend das weitere Vorgehen gegen die Suva beraten und unterstützen kann.
Rollstuhlclubs gab es in der Schweiz schon lange bevor die SPV gegründet wurde. Sie lebten damals wie heute den Gedanken der Selbsthilfe und bieten eine Vielzahl an Aktivitäten für ihre Mitglieder.
2019 feiern 4 der 27 regionalen Organisationen ein Jubiläum. Der RC Züri Oberland, ein Zusammenschluss aus RC Uster und RC Wetzikon, blickt auf 50 Vereinsjahre. Der RC Bern und der GP Ticino feiern beide ihr 40-jähriges Bestehen. Der CFR Jura freut sich 2019 über das 30-JahrJubiläum.
Informationen zu den Clubs auf spv.ch unter «Unsere Rollstuhlclubs»
KÖPFE
Newcomer und Behindertensportler des Jahres
Swiss Paralympic vergab den Newcomer-Award 2018 an die Rollstuhlfahrerin Nora Meister. Die 15-jährige Aargauerin wurde im August in Dublin Europameisterin über 100 m Rücken und 400 m Freistil.
Behindertensportler des Jahres 2018 wurde Théo Gmür. Er gewann drei Goldmedaillen an den Paralympics in Pyeongchang. Der Walliser, der seit dem dritten Lebensjahr wegen eines Hirnödems halbseitig gelähmt ist, erhielt diese Auszeichnung zum ersten Mal.
Die Mitarbeitenden am Empfang der Schweizer Paraplegiker-Stiftung sind nicht nur telefonische Anlaufstelle für Kunden, Mitarbeiter und Besucher, sondern begrüssen oft auch Gäste direkt am Hauptsitz in Nottwil. Seit Ende 2018 werden alle Besucher standesgemäss und gleichberechtigt empfangen.
Innerhalb zweier Arbeitswochen wurden die Räume im November 2018 unter der Leitung des ZHB hindernisfrei umgebaut. Speziell ist der rollstuhlgängige Empfangsschalter mit grosser verglaster Schiebefront. Daneben gibt es einen attraktiv gestalteten Wartebereich.


An der DV vom 27.4.2019 müssen vier neue Personen in den Zentralvorstand gewählt werden. Von den bestehenden Mitgliedern stellen sich Thomas Schneider (Vizepräsident) und Stephan Bachmann (Mitglied) zur Wiederwahl. Thomas Schneider ist selbst Rollstuhlfahrer und Präsident des RC Bern und Stephan Bachmann vertritt als Direktor des REHAB Basel die Schweizer Paraplegikerzentren.
An der Präsidentensitzung vom 26.1.2019 wurden die 13 eingereichten Kandidaturen vorgestellt. Der aktuelle Zentralvorstand gibt ein Fünferticket als Wahlempfehlung ab. Dieses berücksichtigt, dass alle in den Profilfächern definierten Kompetenzen und Funktionen abgedeckt werden. Dazu gehören z. B. die Vertretung aller Sprachregionen, beider Geschlechter, Clubpräsidium und der Angehörigen.
Zur Wahl empfohlen sind:
– Claudia Hüttenmoser, Paraplegikerin, Goldach
– Walter Lisetto, Clubpräsident und Angehöriger, Lugano
– Olga Manfredi, Paraplegikerin, Clubpräsidentin, Wald
– Annick Meystre, Angehörige, Saxon
– Philippe Moerch, Paraplegiker, Collombey
UNSER ANGEBOT
Früher oder später kommt jeder in Kontakt mit einem Menschen mit Behinderung.
In unseren Sensibilisierungskursen zeigen Referenten, dass eine Querschnittlähmung, neben vielen Herausforderungen, ebenso viele Möglichkeiten und Chancen mit sich bringt. Im vergangenen Jahr haben 1765 Per-
sonen in 102 Kursen von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Ein wichtiges Ziel ist es, den natürlichen Umgang mit und die Empathie für die Betroffenen zu fördern.
Informationen
Mehr dazu auf spv.ch unter «Kultur und Freizeit»

In der Sport Arena wird eine Rollentrainingshalle geplant, die primär für das Indoor-Ausdauertraining genutzt werden soll. Ein Ort also, an dem Spitzen-, Breiten- und Nachwuchssportler im Rollstuhl gemeinsam trainieren können.
Das ZHB wurde von der SPS mit der Erstellung des Konzepts «Hindernisfreiheit» beauftragt. Dieses soll die Funktion einer Umsetzungshilfe zu den gültigen Normen erfüllen. Die planenden Architekten können in der Projektumsetzung daraus Empfehlungen entnehmen.
Initiiert wurde die Idee von der Orthotec. In die Ausarbeitung der Halle werden Rollstuhlsport Schweiz und Vertreter der Sportarten einbezogen.
Der von Rollstuhlsport Schweiz ausgeschriebene Schwimmkurs ist auch dieses Jahr gut besucht. 15 begeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwanzig Jahren treffen sich jeden letzten Samstag im Monat im Hallenbad des Schweizer Paraplegiker-Zentrums und trainieren unter fachkundiger Leitung. Sie erhalten nach erfolgreichem Bestehen der adaptierten Tests die Schwimmabzeichen von swimsports.ch.
THOMAS TROGER
Ende 1997 übernahm Dr. Thomas Troger die Führung der Schweizer ParaplegikerVereinigung von Werner Waldispühl. Über 21 Jahre führte und prägte Thomas Troger die SPV. Am 1. Mai übergibt er die Leitung seinem Nachfolger.
Von Gabi Bucher
Nachfolgend ein paar Geschichten und Erinnerungen von Menschen, die Thomas Troger in diesen Jahren begegnet sind.
Thomas Troger, der Unterstützer Es gibt eine kleine Anekdote aus meinem Sportlerleben, an die ich gerne denke in Bezug auf Thomas Troger. Obwohl ich die Geschichte nur vom Hörensagen kenne, erinnere ich mich – verständlicherweise –gerne daran: Es war während den WinterParalympics in Vancouver 2010. Thomas Troger war angereist, um sich die Spiele anzuschauen. Er fliege erst wieder nach Hause, wenn die Schweizer eine Goldmedaille geholt hätten, soll er erklärt haben. Er musste sich dann aber geschlagen geben, sein Flug erwartete ihn. Er stand schon am Flughafen, als Roger Getzmann ihn anrief, um ihm mitzuteilen, dass ich die Goldme-
daille in der Abfahrt gewonnen hatte. So gesehen ist alles so gelaufen, wie er es geplant hatte!
Es gibt für mich aber auch einen anderen, sehr wichtigen Bezug zu Thomas Troger: Kurz nach Vancouver habe ich eine Auszeit genommen und bin auf Weltreise gegangen mit meiner Frau. Ich hatte meinen Job bei der Bank gekündigt und wusste nicht genau, wie es nach meiner Reise weitergehen sollte. Als ich mich mit Thomas Troger darüber unterhielt, schlug er mir eine Anstellung bei der SPV vor. Ich könne dort als Key Account Manager diverse Aufgaben übernehmen und daneben trotzdem weitertrainieren. Im 2011 habe ich meine Arbeit bei der SPV aufgenommen, diverse Sportevents mitorganisiert, Sponsoren betreut, Referate gehalten. Ich schätzte die grosse Flexibilität enorm, so konnte

Übergabe der Auszeichnung «Recognised for Excellence 5 star» durch Dr. Christian Grabski von ESPRIX Excellence Suisse
ich im Winter trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen und dafür im Sommer, wenn weniger los war, mehr arbeiten. Das Angebot gelte einfach, solange ich Goldmedaillen nach Hause bringe, meinte Thomas Troger im Spass. Viereinhalb Jahre profitierte ich von diesem grosszügigen Angebot, bis ich mich dann als Profi voll auf den Sport konzentrierte, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können. Christoph Kunz, mehrfacher ParalympicsMedaillengewinner
Thomas Troger, der Motivierer Wo ig bi agfrogt worde, ob ig es Erläbnis won ig zäme mit dir, Thomas, heig gha, chönnt ufschriebe, hani mi scho zersch hinger mine grosse Ohre kchratzet. Das isch nid so eifach, hani dänkt, u glich isch mer plötzlech s einte oder s angere z Sinn cho. Aus chani do nid verzöue, das würd dr Rahme schpränge, und i Schriftsproch fasse, wett igs scho gar nid. I has drum gäng bsungers gnosse, we mir zäme diskutiert, gredt u ou glachet hei. Dis Walliserdiitsch isch für mi mängisch grad so schwär z verstoh gsi wie ne wäutschi Predigt u ig ha müesse ufpasse wie ne Häftlimacher, das ig aus Bärner gäng bi drus cho.
Es isch ungfähr im Johr 2000 gsi, wo mir üs s erscht mou begägnet si. Ig bi grad TKChef Rollstuehlliechtathletik worde u du hesch üsi Delegation a der EM in Assen bsuecht. D Resultat wo d Athlete erzielt hei, weiss ig nümm aui, aber eis isch mer bliebe: Du hesch mitghulfe, die Medaille im
grosse Feschtzält mit üs z fiire u wo üsere zwee de «Trueberbueb» agstumme hei, hesch du chräftig mitgsunge.
Dini Ungerstützig a dene 6 SM, de Juniore WM 2009 u de 6 ParAtheltics wo, ig aus Mitglied vom OK ha dörfe gspüre, isch einmalig gsi. S Erschte, wo gäng gfrogt hesch, we mir üs gseh hei, isch: «Dü wie hesches? Wie geits dier und dr Fröi?» Do drzue hesch mer fescht i d Ouge gluegt, Du hesch wöue merke u gschpüre, wie dis Gägeüber druff isch. I dene 25 Johr, wo ig ha dörfe mit dr SPV z tüe ha, ha ig nid einisch e unmotivierti Mitarbeitere oder Mitarbeiter vo dir atroffe. Die Hilfsbereitschaft, die Fachkompetänz u ou die grossi Ungerstützig vo aune, het mi gäng schtarch beidruckt. U weisch was? Wie der Chef, so die Mitarbeiter! Du heschs verstange, gäng aui z motiviere u bisch mit dr SPV-Fahne vorus gloffe. Das hei mir «Milizler» gspürt u ig wär sicher

Oft unterwegs als Referent
nid so lang bir Stange bliebe, wes wär angersch gsi. Ig als Üsserschwiizer und Grüezeni hoffe fescht, das mir uf irgend e Art i Kontakt bliebe, di Dialäkt, di Humor u dis Lache würde mer süsch fähle. Sami Lanz, OK-Präsident ParAthletics und SM
Thomas Troger, der Macher Im September 2004 fahre ich mit Thomas Troger und Urs Styger nach Litauen, um dem Paraplegiker-Zentrum in Vilnius einen unserer alten SPV-Busse zu übergeben. Unsere Gastgeber zeigen uns einige inte-
ressante Sehenswürdigkeiten ihres Landes. Während wir von Palanga nach Trakai fahren, überlegen wir gemeinsam, wie wir unser anstehendes 25-Jahr-Jubiläum gebührend feiern und mit welchem Ereignis wir diesen Event markieren könnten. Thomas Troger schlägt vor, einen europäischen Verband für die Querschnittgelähmten zu gründen. Er war bereits in Kontakt mit Vertretern verschiedener Länder, diese zeigten sich sehr interessiert, denn untereinander kannte man sich kaum. Wir beschlossen, dieses Abenteuer anzugehen und machten uns nach unserer Rückkehr an die Arbeit. Die Idee war, eine Organisation zu schaffen, deren Mitglieder sich austauschen können über ihre Aktivitäten und dabei gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren. Die Querschnittgelähmten sollen zudem die Möglichkeit haben, sich Gehör zu schaffen für ihre Anliegen und Ansichten betreffend Rehabilitation, Wiedereingliederung in die Gesellschaft und in die Familie und sich informieren können über die Arbeit der politischen Behörden und internationalen Organisationen von Ärzten, Therapeuten und Forschern.
Im Oktober 2005, kurz nach der Einweihung des Guido A. Zäch Instituts, treffen sich Vertreter aus zwölf Ländern im neuen Auditorium, um über das Projekt zu diskutieren. Dieses wird mit viel Enthusiasmus aufgenommen. Es wird intensiv über Strukturen und Ziele dieser Organisation mit dem Namen ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) diskutiert und deren Sitz wird in Nottwil festgelegt. Thomas Troger hilft während des kommenden Winters bei der Finalisierung der Statuten und Reglemente und im März 2006 wird die Organisation offiziell mit 16 Mitgliedern gegründet. Heute zählt ESCIF 33 Organisationen aus 28 Ländern. Ich durfte ESCIF während vier Jahren als Präsident vorstehen, Urs Styger ist heute noch Sekretär. Aber Thomas Troger war der Initiant dieser Vereinigung, die schon sehr viel erwirkt hat auf internationalem Niveau. Daniel Joggi, Präsident SPS
Thomas Troger, der Grenzgänger Seit meiner Zeit in den 90er-Jahren als Personalleiter im SPZ Nottwil kenne ich Thomas Troger. In den letzten Jahren erfolgte
die Zusammenarbeit im Rahmen meiner Funktionen als Mitglied des Zentralvorstandes der SPV, wo ich die Paraplegikerzentren CH vertrete sowie als Direktor des REHAB Basel.
Immer wieder kommt mir das Stichwort Grenzen bzw. Grenzen überwinden in den Sinn im Zusammenhang mit Thomas Troger. In seinen über 20 Jahren als SPVDirektor hat er für die SPV viele Grenzen überwunden, Grenzen verschoben, andere an die Grenzen geführt. Unter seiner Leitung erfolgte u. a. die konsequente Zusammenarbeit der SPV mit allen vier Paraplegikerzentren der Schweiz (Balgrist, Basel, Nottwil und Sion). Hier hat er bestehende Grenzen abgebaut.
«Wir brauchen Grenzen, um uns nicht zu verlieren. Wir müssen Grenzen überwinden, um uns zu finden.»
Thomas Troger hat die letzten gut 20 Jahre konsequent nach diesem Zitat gearbeitet. Er hat NEIN gesagt und Grenzen gezogen, was ihm Freunde und Feinde einbrachte. Er hat bestehende Grenzen thematisiert und verschoben, was ihm ebenfalls Freunde und Feinde einbrachte.
Thomas Troger, ein Machtmensch, der polarisiert. Ein Macher, der seine Macht für die SPV einsetzte – schier grenzenlos. Die Mitarbeiter der SPV und viele andere Menschen schätzten diesen hartnäckigen Walliserkopf, andere führte die Zusammenarbeit mit ihm an Grenzen. Thomas Troger – er hat bewegt, die SPV und die Gemüter.
Stephan Bachmann, Mitglied Zentralvorstand
Thomas Troger, der Lösungsorientierte Vor 20 Jahren haben wir zusammen mit der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung in Nottwil unsere erste OM-Verbandsversion entwickelt. Thomas Troger sprach uns sein Vertrauen aus, obwohl wir damals im
Bereich der Verbände noch nicht sehr bekannt waren. Bei der SPV wird OM als zentrales CRM, für die Verwaltung der Mitglieder, als Auftrags- und Debitorentool, als direkter Zugang der Clubs auf die Datenbank, für die Durchführung von Anlässen und Reisen, für die Dokumentation von Bauprojekten, die Lizenzierung von Rollstuhlsportlern sowie die Abwicklung von Sport-Events eingesetzt. Es gab immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Thomas Troger haben wir dabei als stets konstruktiven und lösungsorientierten Menschen kennengelernt. Er kommuniziert klar, fordert, fördert, befähigt, vernetzt und investiert Vertrauen. Er hat es in all den Jahren geschafft, mit seiner wertschätzenden Art auch in schwierigen Situationen die gemeinsamen Kräfte zu mobilisieren. Beeindruckt hat mich bei meinen Besuchen der SPV in Nottwil immer das gute Betriebsklima!
Andreas Schwengeler, CEO Creativ Software AG
Thomas Troger – der Chef Wir haben mehr als 20 Jahre zusammengearbeitet. Thomas Troger hat mich in jungen Jahren gefördert, mich aber auch immer wieder gefordert. Wir haben viel erlebt und oft verstehen wir uns fast blind. Das war anfänglich nicht immer der Fall, im wahrsten Sinn des Wortes: Wie oft musste ich damals meine Kollegin fragen, wenn mir ein Satz im Walliser Dialekt Spanisch vorkam! Heute könnte ich wahrscheinlich selber als Übersetzerin aushelfen! Als Assistentin habe ich auch viel für Thomas Troger erledigt. Ich habe seine ITProbleme bewältigt oder während seiner Ferien die Pflanzen gegossen, wobei ich beim Ersteren erfolgreicher war. Die Pflanzen habe ich mit so viel Hingabe getränkt, dass die Hälfte dabei eingegangen ist.
Es gibt auch eine amüsante Erinnerung: Ich habe meinen Chef mal vergessen. Wenn er sein Auto in die Garage brachte für den Service, holte ich ihn manchmal auf meinem Arbeitsweg dort ab. Eines Morgens rief er mich an und fragte, ob ich ihn vergessen habe. Nein, sagte ich, ich bin noch unterwegs. Ich wagte nicht zuzugeben, dass ich bereits im Büro war. Ich machte mich sofort wieder auf, um ihn abzuholen. Etwas
1. 1998: Unternehmensreorganisation und Einführung einer modernen Führungsstruktur
2. 1998/1999: Schweizweite Gesamtleitung des Referendums gegen die Abschaffung der IV-Viertelsrente
3. 2000: Abschluss von Unterleistungsverträgen mit den Rollstuhlclubs (vorher direkt beim BSV)
4. 2002: Einführung der Verbandswebseite www.spv.ch und www.rollihotel.ch (rollstuhlgängige Hotels)
5. 2006: Gründung der europäischen Paraplegiker-Vereinigung (ESCIF), die SPV führt das Head Office
6. 2007: Gründung des Rollstuhlclubs CSFR Carouge
7. 2007: Einführung der Webseite www.rollstuhlsportevents.ch für sportliche Grossevents
8. 2008: Gründung der Begleitgruppe Sozialpolitik
9. 2009: Aufbau des Geschäftsbereiches Lebensberatung
10. 2009: Strategische Zusammenarbeitsvereinbarung mit der SPS mit einem Leistungsauftrag
11. 2009: Zusammenarbeit mit der Clinique romande de réadaptation (CRR) im Bereich der Betreuung von Querschnittgelähmten. Eröffnung eines Büros in Sion
12. 2010: Die SPV bekommt 4 Sterne für Business Excellence (EFQM)
13. 2013: Gründung des Tessiner Rollstuhlclub InSuperAbili
14. 2013: Aufbau des neuen Fachbereichs «Angewandter Wissenstransfer» und Kooperation mit der Universität Luzern
15. 2013: Der Geschäftsbereich Rechtsberatung wird verstärkt 16. 2014: Einsitznahme im Vorstand von Intégration Handicap 17. 2014: Übernahme und Ausbau der Webapplikation Paramap
18. 2015: Mit der Präsentation eines neuen rollstuhlgerecht umgebauten Reisebusses wird das Jubiläumsjahr der Organisationen der Schweizer Paraplegiker-Gruppe eröffnet
19. 2015: Para-cycling-Weltmeisterschaft in Nottwil
20. 2016: Die SPV bekommt 5 Sterne für Business Excellence (EFQM) und den Swiss Arbeitgeber Award
21. 2017: Aufbau Sport Akademie, Neulancierung von paramama.ch, Startschuss für das Nationale Leistungszentrum für Rollstuhlsport (NLR) in Kooperation mit der Sportmedizin und Aufbau der Koordinationsstelle Innovation und Entwicklung für die SPS
Gutes hatte die ganze Sache: Während des Wartens hat Thomas Troger einen kleinen, roten Bus entdeckt; so ist der Rollstuhlsport eigentlich dank mir zu seinem ersten Transport-«Büssli» gekommen!
Die 20 gemeinsamen Jahre mit «meinem» Chef haben mich geprägt und ich konnte mich weiterentwickeln, habe immer wieder neue Aufgaben erhalten. Ich bin heute mit der SPV eng verwachsen und werde das auch in Zukunft bleiben.
Fatis Cantürk, Leiterin Verbandsdienstleistungen
Im Namen der Autoren und aller Mitarbeitenden danken wir Thomas Troger für sein grosses Engagement zugunsten der Querschnittgelähmten. Es sind in den beiden letzten Jahrzehnten zahlreiche wichtige Ideen und Projekte in Angriff genommen worden, die auch künftig die Integration unserer Mitglieder positiv beeinflussen werden.
Fünfzehn Jahre hat Christian Betl im Zentralvorstand (ZV) mitgearbeitet, neun Jahre davon war er Präsident der SPV, im April steht sein Rücktritt an.
Von Gabi Bucher
Durch einen Skiunfall im Jahr 1992 kam Christian Betl in den Rollstuhl und trat 1993 dem Rollstuhlclub St. Gallen bei. Dort übernahm er relativ schnell das Amt des Kassiers. 1998 wurde der Rollstuhlclub Thurgau gegründet und aufgrund der geografischen Nähe trat er diesem ebenfalls bei.

Dort traf er auf Monika Rickenbach, welche damals bereits im Zentralvorstand der SPV war. Sie überzeugte Christian, sich für den ZV aufstellen zu lassen. «Ich wusste nicht genau, was das beinhaltet, aber die neue Aufgabe hat mich interessiert und ich habe mich beworben.» Zwei Kandidaturen waren vorhanden. Dass er derjenige war, der gewählt wurde, schreibt er seiner Anwesenheit an der Versammlung zu. «Ich konnte mich vorstellen und Fragen beantworten.»
Als Kassier hatte er bereits mit der SPV zu tun gehabt, vor allem auch durch das Erstellen der Abrechnungen mit dem Bundes-
amt für Sozialversicherungen. Als Mitglied des Zentralvorstandes ging es um grössere Aufgaben: Gemeinsam wird bestimmt, wo die Reise der SPV hingeht, strategische Entscheide werden getroffen und der Delegiertenversammlung vorgelegt. «Der ZV kümmert sich weniger um Detailfragen als darum, Weichen zu stellen, zu klären, ob die einzelnen Dienstleistungen für die Rollstuhlclubs noch zeitgerecht sind. «Die Welt verändert sich, mit ihr auch die Bedürfnisse unserer Mitglieder.» Heute sei Individualität vielen wichtiger. «Aber für mich ist der solidarische Gedanke immer noch etwas vom Wichtigsten. Allein erreichen wir wenig, wir brauchen einen starken Rückhalt, um auf solider Basis etwas zu erreichen.»
Anspruchsvoller Einstieg
Im November 2009 wurde Christian als Nachfolger von Daniel Joggi zum Präsidenten der SPV gewählt. «Meine erste Aufgabe war eine Ansprache an den Feierlichkeiten zum 30-Jahr-Jubiläum der SPV. Das war nicht ganz einfach. Frei referieren ist zugegebenermassen nicht meine Stärke und dies vor 400 Leuten …» Aber Christian hat sich der Herausforderung gerne gestellt. «Man kann immer etwas lernen und ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich gewählt worden bin.» Er sei sich bewusst, dass man wohl nur einmal im Leben eine so interessante und verantwortungsvolle Aufgabe bekomme. «Ich hatte grosses Glück, dass man mir so viel Vertrauen geschenkt hat.»
Als Präsident der SPV galt es, vermehrt Veranstaltungen zu besuchen. Das Zentralfest, sportliche Grossanlässe, aber auch die Generalversammlungen der verschiedenen Clubs gehörten ins Programm. «Da haben
wir die Daten jeweils aufgeteilt unter der Geschäftsleitung und dem Zentralvorstand. Es ist schlichtweg unmöglich, innerhalb von zweieinhalb Monaten bei allen GVs der 27 Rollstuhlclubs mit dabei zu sein.» Aber der Dialog mit den Clubs sei zentral, da könne man viel herausholen. Da das Präsidentenamt damals auch einen Einsitz im Stiftungsrat mit sich brachte, mehrten sich die Sitzungen. «Von St. Gallen nach Nottwil fahre ich zwei Stunden. Das heisst, eine Sitzung dauert für mich sozusagen einen ganzen Tag.» Aber das habe er gerne auf sich genommen und er habe das Glück gehabt, dass es sich immer gut vereinbaren lassen habe mit seinem Arbeitgeber.
«Ich habe sehr viele gute und interessante Momente erlebt in diesen Jahren.» Aber es habe auch anspruchsvolle Zeiten gegeben, die ihn emotional und körperlich gefordert hätten. «Das gehört dazu und man lernt sehr viel in solchen Situationen. Man lernt die Menschen im eigenen Umfeld gut kennen und weiss, wer hinter einem steht.» Es sei wichtig, eine eigene Meinung zu haben und diese auch zu vertreten. Man sollte aber alle Seiten anhören, sich nicht nur einseitig informieren und sich dann eine Meinung bilden. «Aber es ist wie im Bundesrat: Wenn ein Entscheid getroffen worden ist, muss man dazu stehen und diesen vertreten. Wenn man das nicht kann, sollte man nicht in einem solchen Gremium mitarbeiten.»
Wir danken Christian Betl für sein engagiertes Mitarbeiten in all den Jahren und wünschen ihm alles Gute.
WEITERE RÜCKTRITTE
Unser Zentralvorstand arbeitet ehrenamtlich und setzt sich aus aktuell sechs Mitgliedern zusammen. Neben Christian Betl treten an der Delegiertenversammlung vom 27.4.2019 auch Marie-Thérèse FischerBise, Monika Rickenbach und Martin Cotting von ihrem Amt zurück. Wir danken allen für ihr grosses Engagement und ihren Einsatz für die Querschnittgelähmten in der Schweiz.



Unter Verwendung ausgewählter Materialien sowie gewichtsoptimierter Komponenten bietet unser neues High-End Produkt im Starrrahmensegment besonders hohe Effizienz bei der Kraftübertragung. Ein Rollstuhl für aktive Nutzer mit sportlicher Fahrweise, die Wert auf gutes Design legen.
Der Zenit R ist in Alu oder Carbon sowie als fest verschweisste CLT-Variante in Alu verfügbar.
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.
Emotionen, kurze Geschichten und eine klare Leseführung –das zeichnet das neue Layout unserer Printprodukte aus.
Von Gabi Bucher
Das Paracontact kommt seit Sommer 2018 in einer völlig neuen Aufmachung daher. Welches war die Motivation für dieses Redesign?
Seit 15 Jahren ist an unserer Zeitschrift Paracontact wenig geändert worden, die Medienwelt und der Medienkonsum haben sich aber enorm verändert. Die sozialen Medien, die sehr bildlastig sind und kürzere Formate bevorzugen, werden mehr und mehr benutzt und der Trend geht hin zu kürzeren Texten. Zudem ist, was man Neudeutsch «Infotainment» nennt, gefragt. Man will nicht nur Informationen, man möchte gleichzeitig unterhalten werden. Kommt dazu, dass unsere Mitarbeitenden generell mehr und qualitativ bessere Bilder
machen. Das alles führte zu einer Veränderung des Layouts. Gleichzeitig haben wir eine schönere, lesbarere Schrift gewählt.
Es geht aber nicht nur um Bilder und Schriftarten, sondern auch um neue Textformen?
Unsere Mitglieder nehmen unsere Leistungen aus anderen Gründen in Anspruch als früher. Bei unseren Reisen oder Sportkursen beschreiben wir nicht mehr nur unser Angebot, da verkaufen wir ein Erlebnis. Die Texte brauchen mehr Emotionalität. Enorm wichtig ist auch die Heftdramaturgie, sie ist das A

und O einer erfolgreichen Zeitschrift. So änderte sich der Rhythmus im Paracontact: sogenanntes «Kurzfutter» wechselt sich ab mit reportageartigen, emotionalen oder informativen Artikeln oder Interviews mit Fachartikeln.
Wie haben die Autoren auf diese Veränderungen reagiert?

Wir führten die Autoren dazu, sich zu überlegen, wo der Nutzen ist für unsere Leser. Wie können wir unsere Leistungen besser verkaufen? Hier kommt das Crossmediale zum Zug: Am Ende der Artikel gibt es nun sehr oft Hinweise auf weiterführende Informationen, zum Beispiel auf Webseiten, Videos oder andere multimediale Inhalte. Wir haben unsere Autoren, alles Laien übrigens, selber und teilweise durch einen Journalisten geschult. So konnten wir das Vertrauen stärken, Hemmungen abbauen und zeigen, wie man mit Lust und Spass schreiben kann.
Nun kommt ja auch der Ferienkatalog im neuen Kleid und mit dem neuen Namen «ParaReisen» daher. Sind noch andere Printmedien durch diese Veränderungen betroffen? Es war von Anfang an die Idee, das neue Layout auch für andere Produkte anzuwenden. Nach dem ParaReisen und dem Jahresbericht werden nun Schritt für Schritt auch alle anderen Printmedien angepasst.
Im Gespräch mit Evelyn Schmid, Leiterin Marketing und Kommunikation SPV
HINDERNISFREIES REISEN
Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) ersetzt ihre Voralpen-Express-Züge mit Rollmaterial von Stadler Bussnang AG. Für die SPV war Harald Suter beratend bei der Entstehung dabei.
Von Peter Bruderer (SOB), Norbert Melzer und Christoph Knöpfel (Stadler Rail)
Neben den Wünschen und Vorgaben der SOB und der Behörden wurden auch die Schweizer Behindertenorganisationen unter der Schirmherrschaft von Inclusion Handicap intensiv in die Fahrzeugdefinition mit eingebunden. Eine nicht immer konfliktfreie, aber konstruktive Zusammenarbeit entstand.
Projektgestaltung
Nach einer über ein Jahr dauernden Ausschreibungs-, Angebots- und Verhandlungsperiode bestellte die SOB bei Stadler Rail im Juni 2016 Rollmaterial. Die sechs 8-teiligen Traverso FLIRT3 und die fünf 4-teiligen FLIRT3 Fahrzeuge ersetzen und er-
gänzen Rollmaterial auf der Voralpen-Express- und der St. Galler S-Bahn-Strecke. Mittlerweile konnten weitere Lieferverträge für 23 zusätzliche Fahrzeuge für die Gottardo- und Aare-Linth-Linien abgeschlossen werden.
Eine frühzeitige Einbindung von Entscheidungsgremien und Interessengruppen (Lokführerkommissionen, Designer, Verbände usw.) ist in der Projektabwicklung oberstes Gebot. Als industriellem Dienstleister ist es Stadler Rail ein Anliegen, seine Fahrzeuge nicht nur zuzulassen und pünktlich zu liefern, sondern auch attraktiv und für jedermann passend zu gestalten. Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge der Facharbeitsgruppen sollten bereits bei der konstruktiven Ausarbeitung gezielt und bedarfsgerecht eingearbeitet werden. In der Konstruktionsphase bedingt es dazu nur eines kleinen Aufwandes. Anpassungen zu einem späteren Zeitpunkt bringen allerdings Verzögerungen, hohe Kosten und meist rote Köpfe mit sich. Zugegebenermassen gab es diese auch in diesem Projekt, konnten aber in Grenzen gehalten werden. Nicht alle Bedürfnisse konnten berücksichtigt werden. Ein akzeptabler Konsens ist jeweils das Ziel, welches dank cleveren Ansätzen, aber auch mit Zugeständnissen aller Parteien erreichbar ist.

Projektziele
Die Zulassung der Fahrzeuge auf den vertraglich festgelegten Termin (Betriebsaufnahme ist im zweiten Quartal 2019 geplant) ist in der Projektabwicklung in Stein gemeisselt. Verständlicherweise gibt bei diesem Thema auch keiner unserer Vorgesetzter nach. Der Termindruck kann aber auch zu schnellen, schlecht abgestimmten Lösungen führen, welche im Nachgang zu Verzögerungen führen. Der Abgleich zwischen «Vorwärts mache!» und Konsultation bedingt einer feinen Abstimmung.
Zur Zielerreichung gilt es in Bezug auf Personen mit eingeschränkter Mobilität die europäische TSI PRM (Technische Spezifikation für die Interoperabilität; Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität) sowie das schweizerische Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) zu beachten. Im europäischen Ausland ist eine Erfüllung der TSI PRM meist ausreichend, mit dem umfassenden BehiG kommt eine zusätzliche Komponente in der Schweiz hinzu. In der Abstimmung zeigten sich vielfach Lücken, wenn nicht sogar Gegensätze in den beiden Werken. Als Beispiel seien hier Kontrastunterschiede von Haltestangen angeführt. Dazu wird eine pragmatische Herangehensweise im BehiG verfolgt. In der TSI PRM sind konkrete und detaillierte Vorgaben enthalten. In einem solchen Fall obsiegte die Ausführung der TSI PRM, weil sonst eine Erlangung der Fahrzeugzulassung schwierig wäre.
In den verschiedenen Stadien der Projektabwicklung wurden zur Erläuterung verschiedene Medien verwendet. Anfänglich begrenzte sich die Vorführung auf schlichte Typenskizzen und Erläuterungen. Im weiteren Verlauf kamen virtuelle 3D-Modelle, Holz-Maquetten, Begehung ähnlicher Fahrzeuge, Sichtung der «fast» fertigen SOBFahrzeuge bis hin zu einer (noch ausstehenden) Testfahrt mit voller Funktion hinzu. Entsprechend den Gegebenheiten wurden anfänglich generelle, konzeptionelle Punkte miteinander besprochen, mit Fortdauer der Fokus auf Details gelegt und die (hoffentlich) korrekte Ausführung der besprochenen Punkte verifiziert.

Anpassungen und Verbesserungen Als Erstes wurde die grundsätzliche Anordnung der Wagenkasten angepasst, sodass das für alle zugängliche, sprich rollstuhlgängige WC neben der 1. Klasse eingereiht wurde. Diese Platzierung, welche von SOB und Stadler Rail ursprünglich als wenig relevant erachtet wurde, brachte für Inclusion Handicap und die RöV (Rollstuhl und öffentlicher Verkehr), beziehungsweise für Menschen mit Behinderungen einen grossen Mehrwert. Ähnlich verhielt es sich mit der Gestaltung des Familienabteils. Eine Layoutanpassung für eine bessere Rollstuhlpositionierung wurde umgesetzt.
Anpassungen in der Ausführung der WCs brachten grössere Diskussionen mit sich. Kommerzielle Überlegungen auf Seiten Stadler Rail (Verwendung von Standardteilen) oder eine einfache Wartungsmöglichkeit und die Verwendung von möglichst wenigen elektrischen Komponenten durch SOB, standen teils im Widerspruch zu den Forderungen und Wünschen von Inclusion Handicap. Als solches sei hier die Positionierung und Anbringung weiterer Spültaster oder die Ausführung des Türöffnungsmechanismus erwähnt.
Zusammen bauen
Markus Koller von Inclusion Handicap (IH) brachte zusammen mit den Fachgruppen RöV, SöV (Sehbehinderte öffentlicher Verkehr) sowie HöV (Hörbehinderte und öffentlicher Verkehr) während der Abstim-
mungssitzungen über 100 Anregungspunkte ein. Fast allen Punkten konnte nachgekommen werden. Von den nicht oder nur teilweise erfüllten Punkten blieb immerhin die Erkenntnis einer gemeinsamen Sicht der Dinge. Somit war ein Gesamtbild geschaffen, welches durch alle Parteien akzeptiert werden konnte. Peter Bruderer, Projektleiter der SOB, zum Projektablauf: «Die Zusammenarbeit mit IH und den Facharbeitsgruppen kann rückblickend als sehr erfolgreich betrachtet werden. Mit den erzielten Lösungen hoffen wir, unsere Fahrgäste vorzüglich bedienen zu können und schauen gebannt den ersten Fahrten entgegen.» Ergänzend dazu erklärt Norbert Melzer, technischer Projektleiter bei Stadler Rail: «Die Erkenntnisse aus dem SOBProjekt werden als Grundlage für weitere Projekte herangezogen werden.» Auch Markus Koller zeigt sich weitestgehend positiv: «Die Interessenvertreter konnten dank der Offenheit der Firmen SOB und Stadler Rail dem Projekt wertvolle Inputs für die Fahrzeuge liefern.»
Die gemeinsam ausgearbeiteten Lösungen können spätestens ab Fahrplanwechsel 2019 auf der Voralpen-Express-Strecke geprüft werden. Vorgängig werden die Fahrzeuge sporadisch in den Betrieb eingereiht, um die Betriebstauglichkeit zu eruieren.
Als ständiger Begleiter will unser Rollstuhl gehegt und gepflegt werden. Mindestens einmal pro Jahr sollte er in einem professionellen Service gründlich gecheckt werden. Rollstuhlfahrer können auch vieles selber machen, um ihr Gefährt «in Schuss» zu halten.
Von Peter Reichmuth, Orthotec AG
Ein langer Winter hat es in sich: Nicht nur die Gemüter leiden in der dunklen Jahreszeit, auch den Rollstühlen setzen Kälte, gesalzene Strassen und Schneematsch zu. Der Frühlingsbeginn ist ein idealer Zeitpunkt, um das Hilfsmittel wieder auf Vordermann zu bringen.
Wartung gleich Sicherheit
Werden Rollstühle nicht regelmässig (mindestens einmal im Jahr) gewartet, sind die Sicherheit beim Transfer bzw. die unfallfreie Fortbewegung von A nach B nicht voll gewährleistet. Es gilt: Je stärker ein Rollstuhl beansprucht wird, desto häufiger ist ein Fahrtüchtigkeitscheck nötig.
Im Profi-Service werden Bremsen getestet, die Bereifung und die Lenkgeometrie kontrolliert. Es wird überprüft, ob die Räder frei drehen, wobei die Räder gereinigt und von eingeklemmten Haaren oder anderen Rückständen befreit werden. Ebenso werden der Rahmen geputzt und alle beweglichen Teile geölt.
Etwas aufwändiger ist der Service bei den Elektrorollstühlen, wo neben der mechanischen Wartung zusätzlich die Elektronik und die Batterien kontrolliert werden.
Vorsicht Versicherung
Ihre Sicherheit im Rollstuhl sollte auf jeden Fall erste Priorität sein. Diese kann aber nur mit einer regelmässigen Wartung garantiert werden. Werden die Sicherheitsvorkehrungen nicht befolgt, kann es gar zu

einem Unfall kommen. In diesem «WorstCase-Szenario» kommt die Versicherung nicht für die Folgekosten auf. Der Rollstuhlfahrer trägt diese aufgrund seiner Nachlässigkeit selber. Eine unschöne Situation, die Sie mit einem Check vermeiden können.
Was Sie selber tun können Präventiv können Sie einiges selber tun. Grundsätzlich gilt: Gehen Sie sorgfältig mit Ihrem Hilfsmittel um. Vor jeder Fahrt können Sie kurz checken, ob der Luftdruck in den Reifen optimal ist und ob Beleuchtung und Bremsen funktionieren. Auch den Rahmen können Sie regelmässig reinigen und
eingeklemmte Haare aus den Rädern selber entfernen. Ideal ist, alle paar Wochen die beweglichen Teile des Rollstuhls zu ölen. Wichtig sind auch die Schraubenverbindungen, die vor allem bei den Rückenund Sitzteilen am Seitenrahmen sowie bei den Fussplatten am Seitenrahmen gut angezogen sein müssen.
Wartung beim Profi Informationen zum Service, den Tarifen sowie zur Kostenbeteiligung durch die IV erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Händler.
Koordinatorinnen für eine integrierte Versorgung leisten in einem Pilotversuch zusätzliche Hilfestellungen bei der Abstimmung der verschiedenen Leistungserbringer innerhalb und ausserhalb der Paraplegiker-Gruppe.
Von Nadja Münzel
Querschnittgelähmte stehen durch ihre individuelle Gesundheitssituation besonders oft vor der grossen Herausforderung, die verschiedenen Leistungserbringer (Spitex, Hausarzt, Therapie, Spital, Spezialarzt, Sozialberatung usw.) untereinander zu koordinieren. So zum Beispiel, wenn zur bestehenden Querschnittlähmung im Verlaufe der Jahre noch eine chronische Erkrankung dazu kommt, oder die pflegerische, soziale oder gesundheitliche Situation an Komplexität dazugewinnt (Mehrfachbelastung). Es wird schwierig, die einzelnen Leistungserbringer untereinander mit eigener Kraft zu koordinieren, auch das grosse Leistungsnetz der Schweizer ParaplegikerGruppe wird unübersichtlich.
Um diese Betroffenen noch mehr zu unterstützen, testet die Schweizer ParaplegikerStiftung in einem Pilotversuch, ob es eine schweizweite Fallsteuerung direkt aus dem Leistungsnetz der SPG langfristig braucht.
Eine erfahrende Koordinatorin übernimmt die Fallsteuerung der verschiedenen involvierten Leistungserbringer und ist Ansprechperson für multikomplexe Fälle.
Welche Vorteile bietet Guided Care, und für wen ist es geeignet?
– Einfacherer und koordinierter Zugang zum umfassenden Leistungsangebot der SPG und den externen Leistungserbringern.
– Fokussierung auf Ihre individuelle Situation, dadurch erhalten Sie ein massgeschneidertes Unterstützungsangebot.
– Eine direkte Ansprech- und Begleitperson über lange Zeitdauer, welche über die verschiedenen Abläufe informiert ist.
– Betroffene mit Mehrfachbelastungen: Zu den mehrfachen gesundheitlichen Einschränkungen kommen soziale oder psychosoziale Herausforderungen dazu.
– Bei komplexen Situationen sind viele unterschiedliche Fachpersonen bereits involviert, die Kommunikation untereinander funktioniert oft nicht zufriedenstellend.
Haben Sie Bedarf für dieses Angebot? Dann können Sie sich schon jetzt bei der ParaHelp melden (Tel. 041 939 60 60).
Der Pilotversuch startet im August 2019 und wird in der Romandie und der Ostschweiz durchgeführt.
Weitere Informationen unter www.parahelp.ch/guidedcare.

Die SPV bietet in der Uniklinik Balgrist regelmässig Infoveranstaltungen an.
Offene Runde: Stammtisch Lebensberatung SPV, Donnerstag, 28. März 2019, 16.00 –18.00 Uhr
Die Gesprächsgruppe «Mit Querschnittlähmung leben» trifft sich monatlich und diskutiert und informiert jeweils zu verschiedenen Themen. Interessierte treffen sich im Restaurant der Uniklinik Balgrist. In lockerer und unkomplizierter Gesprächsrunde werden Erfahrungen und Ideen ausgetauscht.
Reisen – öffentlicher Verkehr (Freizeitangebote im Sommer) Lebensberatung SPV, Montag, 29. April 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
Reisen ist für Menschen im Rollstuhl vielfach eine Herausforderung. Deshalb führen wir ein spezialisiertes Reisebüro. Sie erhalten wertvolle Informationen zur sinnvollen Freizeitgestaltung im Sommer. Im Weiteren informieren wir Sie zum Thema öffentlicher Verkehr.
Offene Runde: Stammtisch Lebensberatung SPV, Donnerstag, 27. Juni 2018, 16.00 –18.00 Uhr
Diese Veranstaltung findet im gleichen Rahmen wie jene vom März 2019 statt.

INVALIDENRENTE
Den Leserinnen und Lesern des Paracontact muss ich nicht erklären, dass einem Unfälle oder Krankheiten gehörig einen Strich durch die Karriererechnung machen können.
Michael Bütikofer, Rechtsanwalt und Notar
So kommt es nicht von ungefähr, dass wir vom Institut für Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Berentung unserer Mitglieder die eingangs erwähnte Aussage oftmals zu hören bekommen.
Ob beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen diese Aussage zu einer höheren Rente verhelfen kann, davon handelt dieser Artikel. Im Fokus liegt dabei das Urteil vom 22. Oktober 2018 des Kantonsgerichts Luzern. Das Gericht sah es in diesem Fall für einmal als erwiesen an, dass sich die betroffene Person ohne den folgenschweren Motorradunfall mit Querschnittlähmung beruflich und einkommensmässig weiterentwickelt hätte und sprach ihr nach über 26 Jahren erstmals eine Invalidenrente zu.
Ohne ausreichenden Invaliditätsgrad keine Rente
Erleidet eine berufstätige Person eine Behinderung, stellt sich umgehend die Frage, ob ihr eine Invalidenrente zusteht. Sowohl die Invalidenversicherung, die Unfallversicherung als auch die Berufliche Vorsorge (Pensionskasse) machen die Beantwortung dieser Frage vom sog. Invaliditätsgrad der
betroffenen Person abhängig. Währenddem die Invalidenversicherung und die berufliche Vorsorge erst ab einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % eine Rente zusprechen, entrichten die Unfallversicherungen eine Rente bereits ab einem Invaliditätsgrad von lediglich 10%. Den drei Sozialversicherungen gemeinsam ist, dass sie den Invaliditätsgrad alle nach der gleichen Methode herleiten, nämlich nach dem sog. Einkommensvergleich.
Nach dieser Methode wird «das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre» (Art. 16 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts). Mit anderen Worten wird untersucht, welches Einkommen die behinderte Person trotz ihres Handicaps noch zu erzielen in der Lage ist. Dieses sog. Invalideneinkommen
wird alsdann mit dem Einkommen in Beziehung gesetzt, welches die behinderte Person ohne Behinderung erzielen könnte (sog. Valideneinkommen). Allgemein kann dabei gesagt werden, dass sich der Invaliditätsgrad und damit auch der Rentenanspruch erhöht, wenn das Valideneinkommen im Vergleich zum Invalideneinkommen ansteigt. Umso wichtiger ist es daher, gegenüber den Sozialversicherungen ein möglichst hohes Valideneinkommen durchsetzen zu können. Bei dieser Ausgangslage liegt dann jeweils die Behauptung nahe, die zu berentende Person hätte ohne den invalidisierenden Unfall Karriere gemacht und könnte heute ohne Behinderung ein höheres (Validen-)Einkommen erzielen.
Das Problem dieser Behauptung liegt darin, dass es sich um eine Hypothese handelt. Denn letztlich kann kaum jemand mit Sicherheit sagen, wie er oder sie sich beruflich und einkommensmässig ohne Behinderung tatsächlich entwickelt hätte. Kommt dazu, dass die versicherte Person ihre Behauptung einer verpassten Karriere mit entsprechendem Lohnanstieg beweisen muss. In der Regel also kein leichtes Unterfangen.
Das Valideneinkommen
Für die Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Gesundheitsfall tatsächlich verdienen würde und nicht, was sie bestenfalls verdienen könnte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten Verdienst angeknüpft, da erfahrungsgemäss die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen von diesem Erfahrungssatz müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein.
Heisst das nun, dass sich der Maurerlehrling, der einen schweren Unfall erleidet und sich fortan nur noch im Rollstuhl fortbewegen kann, bei der Berechnung seines Invaliditätsgrades und damit seines Rentenanspruchs darauf behaften lassen muss, er hätte ohne den Unfall und bis zu seiner Pensionierung immer einen Maurerlohn verdient? Grundsätzlich sieht die strenge Rechtsprechung des Bundesgerichts dies genauso vor. Es sei denn, der betroffene Lehrling vermag anhand von konkreten Anhaltspunkten darzulegen, dass er ohne die gesundheitliche Beeinträchtigung ein beruflicher Aufstieg und ein entsprechend höheres Einkommen tatsächlich realisiert hätte. Hierzu genügen aber blosse Absichtserklärungen nicht. Vielmehr müssen bereits bei Eintritt des Gesundheitsschadens entsprechende konkrete Anhaltspunkte beziehungsweise Schritte wie zum Beispiel Kursbesuche, die Aufnahme eines Studiums, das Ablegen von Prüfungen usw. kundgetan worden sein. Der versicherten Person wird ihre Aussage «Ohne Unfall hätte ich Karriere gemacht!», somit nur dann abgenommen, wenn sie hierfür ganz konkrete Anhaltspunkte ins Recht zu legen vermag. Genau daran scheitert es in der Praxis aber regelmässig.
Von den Rückschlüssen aus der Invalidenkarriere Stellen wir uns einmal vor, der soeben erwähnte Maurerlehrling, welcher in jungen Jahren eine Querschnittlähmung erleidet, lässt sich nach dem Unfall zum Informatiker umschulen und betreibt irgendeinmal erfolgreich ein Informatikunternehmen mit mehreren Angestellten. Kann nun allenfalls anhand der zurückgelegten Invalidenkar-
riere etwas für die Beurteilung desjenigen Einkommens gewonnen werden, welches der erfolgreiche Informatiker ohne seinen Unfall heute erzielen könnte, oder bemisst sich sein Valideneinkommen auch weiterhin nach dem (tieferen) Einkommen eines Maurers?
Das Bundesgericht hält hierzu Folgendes fest: «Eine trotz Invalidität erlangte besondere berufliche Qualifizierung erlaubt allenfalls (weitere) Rückschlüsse auf die mutmassliche Entwicklung, zu der es ohne Eintritt des (…) Gesundheitsschadens (…) gekommen wäre» (vgl. BGer 8C_503/2015 E. 3.1.2 vom 26. Oktober 2015). Präzisierend fügt das Bundesgericht jedoch an, dass aus einer erfolgreichen Invalidenkarriere in einem neuen Tätigkeitsbereich nicht ohne Weiteres abgeleitet werden dürfe, «die versicherte Person hätte ohne Invalidität eine vergleichbare Position auch im angestammten Tätigkeitsbereich erreicht» (vgl. BGer a.a.O.).
Übertragen auf den fiktiven Fall des Maurerlehrlings bedeutet dies, dass allein der Umstand, dass der Lehrling nach dem Unfall als Informatiker erfolgreich war, noch nichts zu seinen Gunsten abgeleitet werden kann. Denn hierbei handelt es sich zweifelsohne um einen neuen Tätigkeitsbereich, weshalb gemäss Bundesgericht nicht ohne Weiteres abgeleitet werden darf, der Maurerlehrling hätte ohne Invalidität eine vergleichbare Position auch im angestammten Tätigkeitsbereich, das heisst im Maurerberuf, erreicht.
Aktuelle Rechtsprechung aus Luzern Im Urteil vom 22. Oktober 2018, welches mittlerweile in Rechtskraft erwachsen ist, hat sich das Kantonsgericht Luzern mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzungen denn nun Rückschlüsse aus einer zurückgelegten Invalidenkarriere zulässig sind. Die Kantonsrichter haben dazu ausgeführt, dass bei der Prüfung der mutmasslichen beruflichen Entwicklung unter Umständen «aus einer besonderen beruflichen Qualifizierung im Invaliditätsfall Rückschlüsse auf die hypothetische Entwicklung gezogen werden [können], zu der es ohne Eintritt des Gesundheitsschadens gekommen wäre».
Die «besonderen beruflichen Qualifizierungen» erkannten die Kantonsrichter etwa in den verschiedenen Funktionen, welche der Beschwerdeführer bisher ausgeübt hatte. Diese zeugten «von einer hohen Flexibilität sowie beruflichem Ehrgeiz und bestätigen, dass er [Anm.: der Beschwerdeführer] auch nach seiner Umschulung zum Maschinenzeichner ohne weitere Unterstützung der Sozialversicherungen aus eigenem Antrieb heraus sich weiterentwickelte, neue Anstellungsverhältnisse antrat und diese zur vollsten Zufriedenheit der Arbeitgeber ausführte». Auch der Umstand, so die Kantonsrichter weiter, dass der Beschwerdeführer zum stellvertretenden Gruppenleiter befördert worden ist, sei als Hinweis dafür zu werten, «dass er es trotz gesundheitlicher Einschränkung gewagt hat, seinen beruflichen Werdegang zu optimieren».
«Nach 26 Jahren im Rollstuhl erstmals eine Rente»
In Würdigung dieser Umstände kamen die Luzerner Richter zum Schluss, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sei, wonach der Beschwerdeführer «auch im Gesundheitsfall einen mindestens ähnlichen beruflichen Werdegang zurückgelegt und sich (…) weitergebildet hätte». Im Ergebnis gestanden die Richter dem Beschwerdeführer ein höheres, der zurückgelegten Invalidenkarriere entsprechendes Valideneinkommen zu. Im Falle des Beschwerdeführers hatte dies zur Konsequenz, dass ihm – infolge einer gesundheitsbedingten Pensumsreduktion – erstmals nach 26 Jahren Rollstuhlabhängigkeit eine Rente der Unfallversicherung zugesprochen worden ist.
Wenngleich das Bundesgericht die Hürden für die sozialversicherungsrechtliche Anerkennung einer absolvierten Invalidenkarriere hoch angesetzt hat, verdeutlicht der hier beschriebene Fall aus Luzern, dass diese Hürden nicht unüberwindbar sind!
Institut für Rechtsberatung (IRB) www.spv.ch
Für Menschen mit einer Querschnittlähmung kann die Alternative eines Nabelstomas mehr Selbständigkeit im Alltag bringen.
Von Dr. med. Jens Wöllner
Eine Rückenmarkschädigung beeinträchtigt die Nervenbahnen zwischen Gehirn und Blase. Alle wesentlichen Informationen über den Füllungszustand der Blase, Harndrang sowie Impulse zur aktiven Entleerung der Blase werden über diese Nervenbahnen geleitet. Ist dieser Kommunikationsweg gestört, resultiert eine neurogene Blasenfunktionsstörung. Durch die Funktionsstörung oder als Folge der Therapie ist insbesondere die Entleerungsfunktion der Blase nachhaltig gestört. Die Durchführung des intermittierenden Selbstkatheterismus stellt wenn möglich die Methode der Wahl dar. Aufgrund körperlicher Einschränkungen (mangelnde Handfunktion, Einschränkung der Beweglichkeit, Spastik) stellt die Anlage eines katheterisierbaren Stomas eine Alternative zur Blasenentleerung dar.
Hintergrund
Die neurogene Blasenfunktionsstörung nach einer Rückenmarkschädigung beinhaltet zwei wesentliche Funktionsstörungen. Zum einem kann sich als Folge der fehlenden zentralen Kontrolle eine überaktive, spastische Blase entwickeln. Dies äussert sich durch ungewollten und unkontrollierbaren Urinverlust (Inkontinenz), reduzierte Blasenkapazität und erhöht Drücke in der Blase während der Speicherphase. In der Regel lässt sich diese Problematik durch Medikamente oder das Einspritzen von Botulinumtoxin (Nervengift) in den Blasenmuskel behandeln. Zeigt sich durch diese Therapien keine Besserung der Blasenfunktionsstörung, kann eine operative Behandlung, z. B. eine Blasenaugmentation, notwendig werden.
Bei dieser Operation wird aus einem Teil des Dünndarms eine Platte konstruiert, die dann auf die eröffnete Blase genäht wird. Hierdurch wird eine Grössen- und Volumenzunahme der Blase erreicht. Ist die Durchführung des Katheterismus durch die Harnröhre erschwert, kann es sich anbieten, während dieser Operation einen neuen Zugang zur Blase zu schaffen. In der Regel wird hierfür der Blinddarm (Appendixstoma) verwendet. Mit Hilfe des Blinddarms wir eine «rohrartige» Verbindung zwischen Bauchdecke (zum Beispiel Bauchnabel) und Blase geschaffen. Durch diese Verbindung (Stoma, Bauchnabelstoma) kann die Blase mit einem Katheter alle drei bis vier Stunden entleert werden.

Zum anderen kann die Funktionsstörung der Blase auch in einer schlaffen, nichtkontraktionsfähigen Blase bestehen. Bei tiefen Läsionen des Rückenmarks kann zusätzlich auch die Funktion des Schliessmuskels beeinträchtigt sein, sodass ein permanenter Urinverlust resultiert. Um in dieser Situation eine vollständige Kontinenz zu erreichen, besteht die Option, den Blasenausgang operativ zu verschliessen. Um eine regelmässige Entleerung der Blase durch einen Katheter zu gewährleisten, wird in dieser Situation auch ein Nabelstoma angelegt, um die Blase sicher über den Einmalkatheterismus entleeren zu können. Somit stellt die Anlage eines (Bauch-)Nabelstomas eine sichere Form der Harnableitung durch intermittierenden Katheterismus sicher.
Operation/Technik
Unabhängig davon, ob bei der Operation lediglich ein katheterisierbares Stoma angelegt wird oder in der gleichen Operation auch die Blasenkapazität mit Darm vergrössert wird, handelt es sich bei dieser Operation um einen grossen Eingriff im Bauchraum. Je nachdem, ob der Blinddarm (Appendix) noch vorhanden ist, oder ein Stoma aus einem Teil des Dünndarms konstruiert

Katheterismus über den Bauchnabel
Harnleiter
schen Blase und Bauchwand genäht. Diese Verbindung kann entweder in den Bauchnabel eingenäht werden, sodass dann die Blase (vergösserte = augmentierte Blase) über das Bauchnabelstoma entleert werden kann. Alternativ kann dieses Stoma aber auch an anderer Stelle im Unterbauch angelegt werden. Die Position ist so zu wählen, dass die Betroffenen dieses gut erreichen können und ein Katheterismus problemlos möglich ist. Am Ende der Operation ist der Darm wieder verschlossen und der Urin wird zunächst über einen Dauerkatheter über das Stoma ausgeleitet.
Der Heilungsverlauf dauert zwei bis drei Wochen. Während dieser Zeit ist es wichtig, die Darmfunktion wieder in Gang zu bekommen und nach Katheterentfernung (ungefähr drei Wochen nach der Operation) die Katheterisierung über das neue Stoma zu erlernen.
Nachsorge/Komplikationen
Die Anlage eines katheterisierbaren Bauchnabelstomas wird meistens in Kombination mit einer Vergrösserung der Blase durch Darmanteile (Augmentation) durchgeführt.
Blasenersatz aus Blinddarm (Appendix) oder Dünndarm
werden muss, wird ein Teil des Darmes verwendet. Dieses wird aus dem eigentlichen Darmverlauf ausgeschaltet und es erfolgt eine neue, operativ geschaffene Verbindungstelle im Darm, um die Darmpassage wieder herzustellen. Der Blinddarm oder der Teil des Dünndarms werden nur als «rohrartige» Verbindung zwi-
Da es sich um eine grosse Operation im Bauchraum handelt, können einige Komplikationen im unmittelbaren Verlauf nach der Operation auftreten, anderseits sind auch erst nach Jahren auftretende sogenannte Langzeitkomplikationen möglich. Zu den Komplikationen nach der Operation zählt man Entzündungen und Infektionen im Operationsgebiet, Nachblutungen, die eine erneute Operation erfordern, sowie ein Darmverschluss. Dieser Darmverschluss kann entweder durch Narbenbildung entstehen (mechanischer Darmverschluss) oder durch fehlende Tätigkeit des Darms (paralytischer Darmverschluss). Da die Darmfunktion schon durch die Querschnittlähmung eingeschränkt und verlangsamt ist, tritt diese Problematik bei Querschnittgelähmten häufiger auf. In der Regel kann man durch Medikamente, die den Darm stimulieren, die Darmtätigkeit wieder anregen. Bei einem mechanischen Darmverschluss ist eine erneute Operation notwendig, um die Darmpassage wieder in Gang zu bringen. Eine Langzeitkomplikation kann das Stoma betreffen. Durch die Katheterisierung kann es durch Narbenbildung zu einer Verengung des Stomas kommen (Stomastenose), sodass die Katheterisierung erschwert ist. Zum Teil ist es möglich, durch Aufdehnung das Stoma
Der Eingriff stellt eine grosse Operation dar, die meist erst nach Versagen der konservativen Therapie (Medikamente) oder nach Durchführung minimalinvasiver Therapiever fahren (z. B. Injektion von Botox in die Blase) angewendet wird. Nach diesem Eingriff ist die Entleerung der Blase über Katheterisierung des Stomas möglich. Verengungen oder eine Erweiterung des Stomas mit Urinverlust sind relevante Langzeitkomplikationen.
Vor der Operation muss eine ausführliche neuro-urologische Diagnostik erfolgen, um die individuellen Probleme des Patienten zu erfassen und das richtige Therapieverfahren auszuwählen.
wieder zu erweitern oder durch endoskopische Verfahren die Engstelle zu beseitigen. Ist dies nicht möglich, bedarf es unter Umständen einer grösseren Operation mit einer Neukonstruktion des Stomas. Auch kann sich im Verlauf die Fixierung des Stomas in der Bauchdecke lockern, sodass das Stoma nicht vollständig dicht ist, und es zu einem Urinverlust über das Stoma kommt. In dieser Situation ist meist eine operative Neuanlage des Stomas notwendig.
Autor
Dr. med. Jens Wöllner, Leitender Arzt Neuro-Urologie
Facharzt Urologie
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
Sitzplatzausgänge sind ein oft vernachlässigter Teil beim Wohnungsumbau. Es gibt jedoch gute Lösungen für fast alle Situationen.
Von Marcel Strasser
Im Jahre 2002 wurde von der Bundesversammlung das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) beschlossen. Dieses untersagt die Benachteiligung von Behinderten und legt den Grundstein für die Gesetzgebung zu diesem Thema. Es definiert auch, was als Benachteiligung zu verstehen ist und erwähnt speziell bauliche Gründe, die den Zugang nicht erschweren dürfen.
Auf der Grundlage des BehiG wurde 2009 vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» herausgegeben. Viele kantonale Gesetzgebungen nehmen inzwischen Bezug auf diese Norm. Die Ausführung von Türen und Durchgängen wird in dieser Norm geregelt. Artikel 9.2.2 besagt, dass Türen und Durchgänge vorzugsweise ohne Absätze auszubilden sind und dass maximal 25 mm hohe, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deckschienen zulässig sind. In der Norm SIA 271, Ziffer 5.2 ist festgehalten, wie dies unter Einhaltung der Anforderung an die Dichtigkeit realisierbar ist.
Da ein Balkon oder eine Terrasse, wie ein aktuelles Bundesgerichtsurteil vom September 2018 bestätigt, zum Wohnbereich gehört, gilt Artikel 9.2.2 auch für den Zugang zu Balkon oder Terrasse. Bei Bauprojekten, die gemäss gültiger Gesetzgebung hindernisfrei erstellt werden müssen, ist daher diese Regelung einzuhalten. Leider sind sich diesem Umstand nicht alle Bewilligungsbehörden, Planer und Bauherr-
schaften bewusst, sodass auch heute noch oft zu hohe Schwellen realisiert werden, und dies auch bei Neubauten.
Bei Balkon- und Terrassentüren ist eine hindernisfreie Ausführung deutlich schwieriger umzusetzen als bei Innentüren, da diese noch verschiedene andere Anforderungen zu erfüllen haben. Es müssen auch Anforderungen betreffend Schallschutz, Luft- und Wasserdichtigkeit sowie Wärmeschutz berücksichtigt werden. Dies macht dieses Bauteil zu einem recht komplexen Planungsthema.
Zum Glück gibt es Firmen, die sich mit der Suche nach guten Lösungen beschäftigen und diese heute auch schon anbieten.
Lösungen für Neubauten Für Ausgänge zu Balkonen werden verschiedene Fenstertypen verwendet. In der Regel sind dies ein- oder mehrteilige Flügeltüren oder Schiebetüren.
Flügeltürlösungen:
Schon seit vielen Jahren bietet die deutsche Firma Alumat Schwellenprofile an mit einer Magnetdoppeldichtung für Flügeltüren (Bild). Diese gibt es in verschiedenen Versionen für Neubau und Renovation sowie für verschiedene Fenstermaterialien. Das System hat sich schon in vielen Umund Neubauten bewährt und ist auch bei zweiflügeligen Türen einsetzbar.
Von den Firmen Planet und Athmer sind ebenfalls Dichtungssysteme entwickelt worden, die sich sowohl für einflügelige Hauseingangstüren als auch für einflügelige Balkon- und Terrassentüren einsetzen lassen. Diese dichten nicht wie andere Absenkdichtungen nur nach unten, sondern auch seitlich links und rechts die Ecken ab und sind auch bei Schlagregen geprüft.
Bei vielen Fensterbaufirmen gibt es rollstuhlgängige Schwellenlösungen mit einer Schwellenhöhe von max. 25 mm. Der In-



einer Schwellenlösung ohne Absatz
nerschweizer Fensterhersteller 4B hat als erster Fensterhersteller eine eigene Schwellenlösung ohne Absatz (Nullschwelle) entwickelt (Bild oben).
Schiebetürlösungen:
Bei Schiebetüren werden Lösungen mit Kippschiebetüre oder mit Hebeschiebetüre angeboten. Kippschiebetüren erfüllen wegen der hohen Schwellenprofile die Anforderungen der Hindernisfreiheit nicht. Sie sind auch schwer anpassbar, weil innen wegen des sich beim Öffnen nach innen bewegenden Flügels keine festen Rampen angebracht werden können.
Hebeschiebetüren können hingegen bodeneben eingebaut werden und sind dadurch bereits fast schwellenlos. Es bleibt nur die Führung der Rolle, auf der der Schiebeflügel steht (Höhe ca. 1 cm). Es gibt auch Schwellenausführungen, bei denen diese Führung in einer Nut ausgeführt ist und die damit schwellenlos sind.

Oft besteht jedoch auf der Aussenseite noch eine Höhendifferenz, welche bei Bedarf mit einem speziellen Profil oder mit einem zusätzlichen Blech als Überbrückung eliminiert werden kann.
Speziell bei Schiebetüren kommt häufig noch das Problem dazu, dass diese wegen des hohen Flügelgewichtes von Personen mit körperlichen Einschränkungen nicht geöffnet werden können. In diesem Fall ist es möglich, automatische Antriebe zu verwenden. Diese werden für Hebeschiebetüren von verschiedenen Firmen angeboten und sind auch im System integriert erhältlich. Die Bedienung erfolgt über Taster, Fernbedienung oder das Smartphone.
Bei allen hindernisfreien Balkon- und Terrassentüren muss die Entwässerung beachtet werden. Die wasserführende Ebene muss mindestens 6 cm tiefer liegen als die Oberkante der Schwelle. Die Höhendifferenz kann mit einem Rost ausgeglichen

werden. Ist die wasserführende Ebene gleichzeitig der Bodenbelag, muss in der Regel eine Entwässerungsrinne vor der Türe eingebaut werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
Schwellenanpassungen – Innovation Wenn eine bestehende Türe eine mit dem Rollstuhl nicht überwindbar hohe Schwelle aufweist, kann nicht in jedem Fall die Türe ersetzt werden, weil der Aufwand dafür oft sehr gross wäre. Oft wird das Problem dann mit Rampen gelöst. Angeboten werden feste Rampen und Schwellenkeile aus Holz, Gummi oder Metall und verschiedene standardisierte Systeme mit festem Rampenteil auf der einen Seite und klappbarem Rampenteil für die Überwindung der Höhendifferenz auf der anderen Seite.
Für Personen, die Klapprampen wegen körperlicher Einschränkungen nicht bedienen können, hat eine innovative Basler Metallbaufirma ein automatisches System mit einer verschiebbaren inneren Rampe mit elektrischem Antrieb entwickelt (Bild).
An der Fachhochschule Nordwestschweiz wird derzeit eine höhenverstellbare Rampe entwickelt, die von einer Schweizer Firma angeboten werden soll, sobald diese serienreif ist.
Merkblatt zu Fenstertürschwellen www.hindernisfreie-architektur.ch (unter Normen und Publikationen, MB 031 «Fenstertürschwellen»)
FREIZEITTIPP FÜR AKTIVE
Für Rollstuhlfahrer Heinz Meier und seine Partnerin Alexandra ist kein Weg zu lang und fast keiner steinig genug.
Von Alexandra Bättig

«Geht nicht, gibt es nicht», denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – wenn teils auch etwas kräftezehrend und holprig. So sind wir, das heisst Rollstuhlfahrer Heinz und ich, Lebenspartnerin Alexandra, Fussgängerin, im In- und Ausland unterwegs.
Handbike und Swiss-Trac sind dabei unsere unverzichtbaren Begleiter. Sie erweitern unseren Bewegungsradius deutlich. So konnten wir locker in Hamburg die Binnen- und Aussenalster umrunden und danach die Hamburger Altstadt sowie die HafenCity erkunden. Der Swiss-Trac ermöglicht es uns zusätzlich, unsere Spaziergänge zu Wanderungen in die Alpen auszudehnen. Mit dem Handbike und Tourenrad trifft man uns viel entlang von Flüssen und Seen. Wir haben den Bodensee umrundet, sind entlang dem Inn im Oberengadin wie auch in der Region Passau geradelt und sind den Reschenpass bis nach Bozen entlang der Etsch gefahren.
Dehnbarer Begriff «barrierefrei»
Doch ohne intensive Recherchen im Vorfeld kämen wir nie so weit. Bereits die Anreise – teils mit öV – erfordert mehrere Anrufe und Mails. Das Finden von geeigneten Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel mit oder auch ohne SwissTrac bzw. Handbike will ebenso geübt sein. Denn die Begriffe «barrierefrei» und «rollstuhlfreundlich» sind dehnbar und fordern unsere Flexibilität und Kreativität immer wieder, umso mehr, wenn sie in Kombination mit dem Prädikat «bedingt» stehen. Das hindert aber Heinz und mich nicht, unterwegs zu sein. Wir probieren aus und dürfen zum Glück immer wieder auf die Mithilfe von Mitarbeitern bei Bergbahnen, Postautos, in der Gastronomie und beim Zugspersonal wie auch auf die tatkräftige Unterstützung von Mitmenschen zählen. Und wir bleiben hartnäckig, wenn beispielsweise wieder einmal der Aufzug zum Perron am Bahnhof nicht funktioniert oder im Hotel keine Sitzgelegenheit in der Duschnische vorhanden ist.
Steinige Angelegenheit
Grindelwald war unsere diesjährige Herbstdestination. Das verlängerte Herbstwochenende starteten wir mit einem Besuch im
Freilichtmuseum Ballenberg, wo wir mit Patenkind und Familie in herbstlich leuchtender Stimmung und bei sonnig-warmer Witterung unterwegs waren. Mit vielen neuen Eindrücken und sogar einem Glas unter fachlicher Anleitung eigens hergestelltem Sauerkraut verliessen wir den Ballenberg fast als letzte Besucher in Richtung Interlaken. Bereits zum zweiten Mal übernachteten wir in der dortigen Jugendherberge. Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung «Denk an mich» stehen
«Der Ausdruck barrierefrei ist dehnbar»
dort barrierefreie Doppelzimmer mit Dusche/WC zu moderaten Preisen zur Verfügung. Nach einem feinen Frühstück, bei welchem mich die angebotene Misosuppe an meine Japanreise erinnerte, ging es weiter nach Grindelwald. Dort erkundigten wir mit Wanderschuhen und Swiss-Trac die Umgebung. Gleich nach Ankunft gings
bzw. Füsse. Dank Swiss-Trac und meiner entschlossenen Schubkraft nahmen wir die zahlreichen Hürden, besonders steile Wegabschnitte und Schwellen, die aus dem Boden herausragten und wo sich die Stützrädchen immer wieder zu verfangen drohten. Nichtsdestotrotz: Das Ziel Männlichen mit der Möglichkeit für einen feinen Imbiss lockte. So haben wir dank zusätzlicher tatkräftiger Unterstützung von zwei Wanderern auch das steilste Wegstück gemeistert. Ein tolles Erlebnis, aber nicht wirklich zur Nachahmung empfohlen, es eignet sich nur für «berggängige» Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen. Uns war schnell klar: Wir wollen nicht mit der Bahn ins Tal runter, sondern nehmen den Rückweg wieder unter die Räder bzw. Füsse. Glücklich, aber auch müde genossen wir in der Jugendherberge Grindelwald unser Abendessen mit Blick auf die Eigernordwand.

Geschafft:
hinunter zum Bahnhof. Spontan entschieden wir uns, gleich die in wenigen Minuten fahrende Bahn zur Kleinen Scheidegg zu nehmen. Höchst freundlich ermöglichte uns das Bahnpersonal den reibungslosen Ein- und Ausstieg. Nur unsere Mitreisenden waren leicht erstaunt über unsere Anwesenheit. Das fantastische Herbstwetter lockte und wir nahmen den Wanderweg zur Bergstation Männlichen unter die Räder

Mit wunderschönen Herbstwandererlebnissen zum Bachalpsee und weiter zur Grossen Scheidegg sowie vom Bergrestaurant Bussalp hinüber zur Bergstation Bort und hinunter ins Dorf verabschiedeten wir uns nach drei Tagen von Grindelwald. Das nächste Mal wollen wir Wengen und das Lauterbrunnental erkundigen. Vielleicht ist dann auch ein Ausflug zur Schynigen Platte mit dem botanischen Alpengarten möglich. Denn da scheiterten wir bei Tourismus Grindelwald, wo die Mitarbeitenden uns unterschiedlich engagiert Beratung und Unterstützung boten.
Wir sind gerne für Sie da. Rufen Sie uns an: 061 487 99 11

Doris Lutz Beratung Inkontinenz/Urologie
Für eine bessere Lebensqualität
Ob leichte, mittlere oder schwere Inkontinenz, wir finden für Sie das passende Produkt.
Ihre Vorteile
• 24 Stunden Lieferung (Bestellung bis 15.30 UhrAuslieferung am Folgetag, ausgenommen vor Feiertagen und am Wochenende)
• Diskreter Versand
• Versandfrei ab einem Warenwert von CHF 50.00 innerhalb der Schweiz
• Kostenlose Muster
• Abrechnung zum Teil über Krankenkasse möglich
Rehatec AG ▪ Ringstrasse 15 ▪ 4123 Allschwil ▪
10 office@rehatec.ch ▪ www.inko-reha.ch
Ein revolutionärer faltbarer Carbon-Rollstuhl

Lindsey F. 43 Jahre. Seit 6 Jahren im Rollstuhl
“Der Carbonrahmen absorbiert Vibrationen, was meinen Muskeltonus in den Beinen verringert.”
Der Rahmen und das Faltsystem im neuen Motion Composites Veloce sind technologisch einzigartig. Es entstand einer der leichtesten, faltbaren CarbonRollstühle der Welt. Das Transportgewicht beträgt nur 5.4 kg. Der Veloce lässt sich wie ein Aktivrolltuhl bewegen und hat gleichzeitig alle Vorteile eines faltbaren Aktivrollstuhls.




REISEN
Haben Sie Ihre Ferien schon geplant? Falls nein, dann hätten wir noch den einen oder anderen freien Platz für Sie.
Sei es eine Bus- oder eine Flugreise, sei es eine Destination in Europa oder Übersee: Im ParaReisen 2019 (vormals Ferienkatalog) findet jede und jeder eine spannende Reise für sich.
Einige sind zwar bereits ausgebucht, dafür warten andere noch auf ein paar reiselustige Teilnehmer. Informieren Sie sich über unsere Reisen mit freien Plätzen oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
www.spv.ch/freieplaetze
Telefon 041 939 54 15, kf@spv.ch

WANDERTOUR
Am 12.5.2019 gibts eine Premiere: Die SPV organisiert eine Wandertour für Rollstuhlfahrer (Verschiebedatum 18.5.2019).
Für eine Teilnahme muss sowohl der Rollstuhlfahrer wie auch seine Begleitperson körperlich fit, gesund und sportlich sein. Der Rollstuhl muss zudem mit robusten Pneus, einem grossen dritten Vorderrad, Lenker sowie guten Bremsen ausgerüstet sein. Die Begleitperson zieht oder bremst den Rollstuhl mit Seil und Gummischlauch, das Seil wird an einem gepolsterten Klettergurt befestigt.
Die Route unserer Jurawanderung im Naturpark Thal sieht wie folgt aus (Maximalroute, wird je nach Gruppe angepasst): Bremgarten (908 m ü. M.) – Brunnersberg (1118 m ü. M.) – Güggel – Obere Tannmatt Mieschegg – Hinterer Brandberg – Malsenberg – Gänsbrunnen (719 m ü. M.).
Geleitet wird die Tour von Wanderleiterin Anita Panzer, unterstützt und begleitet von Mitgliedern des SAC Weissenstein.
Informationen und Anmeldung
www.spv.ch/veranstaltungskalender

Der Frühlings-Handbike-Trail mit Andreas Gautschi führt uns ins Greyerzerland. Achtung, neues Datum: Der Trail findet am 11.5.2019 (vorher 15.6.2019), Verschiebedatum ist der 19.5.2019. Der Herbst-Handbike-Trail findet voraussichtlich am 7.9.2019 in Engelberg statt.
OFFENES SINGEN Musik vereint
Zusammen musizieren und singen entspannt und macht Freude. Notieren Sie sich die Daten fürs erste Halbjahr. Rosa Zaugg freut sich auf Sie: 9./23. März, 6./20. April, 4./18. Mai sowie 1./15. und 29. Juni 2019.
PENSIONIERUNGSKURS
Möchten Sie sich auf Ihren Ruhestand vorbereiten? Dann machen Sie den Anfang mit diesem Kurs. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich ganzheitlich mit der Thematik zu befassen. Inhaltlich werden u. a. Finanzen, Gesundheit, Partnerschaft und Wohnsituation beleuchtet. Der Kurs findet am 14. Mai 2019 in Nottwil statt.
ERFÜLLENDES HOBBY
Silvia Junker, Tetraplegikerin, hat dieses innere Strahlen. Das liegt sicher an ihrer positiven Art, aber auch an ihrem geliebten Hobby: Sie macht Perlenketten.
Von Gabi Bucher
Angefangen hat alles im Schweizer Paraplegiker-Zentrum. Silvia Junker, seit 2003 Tetraplegikerin durch einen Baum, der auf ihr fahrendes Auto gestürzt ist, musste sich im Jahr 2010 einer Rückenoperation unterziehen. Danach war ihr strikte Bettruhe verschrieben worden. «Mir isch derewä läng wilig gsy», erzählt sie in ihrem breiten Berndeutsch. Da habe man sie im Bett ins Atelier für Gestaltung gebracht. «Dort redeten sie immer vom Quetschen.» Sie habe sich erkundigt, worum es gehe, und erfahren, dass man dabei bei selbstgemachten Ketten die Perlen am Draht fixiere. «Ich habe sehr gerne Perlenketten, das wollte ich auch machen.»
Eigene Technik ist alles Silvia wurde dann aber schnell auf den Boden der Realität geholt, sanft, aber bestimmt: Sie dürfe nicht enttäuscht sein, das ginge nicht mit ihren Händen. «Aber wenn man mir sagt, etwas gehe nicht, will ich es umso mehr!» Und so hat sie sich auf die Suche gemacht. «Ich habe mir Bücher gekauft, im Internet recherchiert, Material angeschafft». Kurse habe sie nicht besuchen
können, sie sei viel zu langsam. Aber Zeit dürfe keine Rolle spielen, sie versuche einfach diverse Techniken, bis sie eine Lösung finde. Wenn ihr etwas gefalle, bringe sie die nötige Geduld auf, dann schaffe sie meistens, was sie sich vornehme. «Klar gibt es Grenzen», meint sie, «ich kann mir tausend Mal vornehmen, wieder zu gehen oder die Hände zu bewegen, das klappt nicht. Aber im Rahmen des Möglichen kann man mit Geduld und viel Zeit einiges erreichen.»
Zähne statt Zange
Sie hat sich alles selber beigebracht und ist stolz darauf. Ihr unglaublicher Wille bringt sie immer wieder weiter, so weit, dass sie mittlerweile nicht nur diverse Ketten aus Perlen aller Art auffädelt, sondern auch mit winzig kleinen Glasperlen näht und ja, sogar das Einfädeln habe sie sich beigebracht. «Zuerst mache ich den Faden flach mit meinen Zähnen, eine Zange kann ich ja nicht bedienen. Dann halte ich die Nadel an den Faden, wenn dieser durch ist, lege ich die Nadel hin, drücke das «Stümpeli» auf der einen Seite auf den Tisch und ziehe an der Nadel auf der anderen Seite.»

Kaninchen versus Ketten
Ihr Ehemann Urs hat ein Zimmer eingerichtet, wo sie arbeiten kann. «Wenn ich nicht mindestens einmal pro Tag Perlenluft schnuppern kann, werde ich grantig», sagt sie mit einem herzhaften Lachen. Und da Urs nicht immer zur Verfügung steht, will sie so selbstständig wie möglich sein. Da «chnüblet» sie dann, bis sie erreicht, was sie will. Sie setzt ihre Handmanschette ein wie andere einen Fingerhut, ihr Bauch hilft ihr, wenn sie etwas Druck auf den Daumen aufsetzen muss. Nur das Quetschen, das muss Urs übernehmen, dazu fehlt ihr die Kraft. Nein, sie könne nicht sagen, wie lange sie für eine Kette brauche. «Oder doch, wenn ich es mir überlege, meist gehe ich arbeiten, wenn Urs zu den Kaninchen geht. Dort verbringt er etwa eine Stunde, in dieser Zeit schaffe ich eine Kette, eine mit grossen Perlen.»

Die Ketten bringen Silvia unglaublich viel Freude, Bestätigung und Genugtuung. Und wenn sie diese dann auch noch verkaufen kann, zum Beispiel am Weihnachtsmarkt der SPV, dann ist sie glücklich. «Man darf sich einfach nicht beirren lassen. Man hat mir bei meiner Erstrehabilitation gesagt, ich würde nie mit einer Literflasche einschenken können. Wir haben zu Hause 1½-Liter-Flaschen und ich schenke mir selber ein.» Es sei zwar gut, den Patienten nicht zu viel Hoffnung zu machen. «Aber es ist wichtig, alles auszuprobieren, was man im Kopf hat. Wenns nicht geht, gehts nicht, aber man hat es mindestens probiert!»
Mehr zu Silvia Junker facebook@paraplegikervereinigung
DER PERFEKTE AUSFLUG
Von zu Hause bis zum Zoo – ein toller Event für die ganze Familie. Die Ausflüge in den Kinderzoo Rapperswil bleiben nicht nur dank der Barrierefreiheit der Anlage in bester Erinnerung.
Von Janine Gassner (im Gespräch mit Nicolas Hausammann)
Die fünfköpfige Familie von Nicolas Hausammann lebt in Schönenwerd, nahe Aarau. Da liegt Rapperswil nicht gerade um die Ecke. Er beschreibt, weshalb für sie der Zoobesuch trotzdem ein Highlight ist: «Wir machen jeweils schon bei der Anfahrt einen kleinen Event aus dem Ausflug. Mit dem Auto gehts nach Horgen, wo wir die Fähre über den See nehmen. Ab Meilen ist es eine knappe halbe Stunde bis zum Zoo. Warum gerade der Kinderzoo? Wir schätzen die familiäre Atmosphäre und die Nähe zu den Tieren sehr. Es ist alles sehr übersichtlich und nah zusammen, verglichen mit den Zoos in Zürich oder Basel. Und, da es ihn schon seit 1962 gibt, kommt ein bisschen Nostalgie auf, vor allem bei der Betrachtung meiner eigenen Kinderfotos.
Vorfreude bei der Anreise
Meine drei Kinder sind im Alter von einem, vier und sechs Jahren. Die beiden Grossen lieben die Fahrt über den See und sind voller Vorfreude auf den Tag. Ich stecke den Kopf zum Fenster hinaus und geniesse die frische Seeluft. Die ganze Überfahrt dauert kurze 15 Minuten. Schon rollen wir auf unseren eigenen Rädern weiter. Die Kleinste plappert fröhlich vor sich hin und unterhält uns mit ihrem Baby-Slang. «Rappi» ist leider auch am Mittwochnachmittag nicht vor Verkehrschaos gefeit, aber das gehört nun mal dazu.
Im Zoo angekommen
Endlich sind wir da! Als Rollstuhlfahrer erhalte ich einen Rabatt von 7 Franken auf den Eintrittspreis. Meine Frau bezahlt den normalen Preis von 19 Franken und für die grösseren Kinder ab vier Jahren kostet das Ticket 6 Franken.

Die Elefantenfamilie lässt es sich schmecken
Pferde und Flamingos erwarten uns gleich als Erstes bei der Ankunft. Auch das Selbstbedienungsrestaurant mit 70 Sitzplätzen findet sich beim Eingang, alles perfekt befahrbar mit dem Rollstuhl. Was mir besonders auffällt ist, dass alles schön flach gelegen ist. Wenn ich so an den Zoo Zürich denke mit seinen Steigungen, sind die Wege hier doch angenehmer zu befahren. Die sanitären Anlagen sind ebenfalls rollstuhlgängig, ich kann überall mit den Fussgängern mitfahren und muss keine anderen Wege suchen.
Viel Unterhaltung geboten
Meine Kinder möchten natürlich unbedingt zur Seelöwenvorführung. Hier gibt es eine Rampe, und von meinem Standort aus habe ich einen super Überblick über die auch für Erwachsene unterhaltsame Show. Neu gibt es einen spektakulären Höhenweg. Von der Rampe aus ist die Sicht über das Elefanten- und Giraffengehege grossartig. Der Elefantenpark wird Himmapan genannt und bietet eine Lodge mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten
wie dem Thai-Restaurant oder der Thisiam Lounge. Die Räumlichkeiten, wunderschön am See gelegen, sind sehr grosszügig gebaut und ohne Probleme befahrbar.
Das einzige kleine Manko, das mir auffällt, ist der Kinderspielplatz. Der ist mit Holzschnitzeln ausgelegt und für mich als Rollstuhlfahrer ist da kein Durchkommen. Dieses Detail würde mich aber nicht daran hindern, auch alleine mit meinen Kindern diesen Ausflug zu machen.
Langsam etwas müde nach dem ereignisreichen Tag gelangen wir zum Parkplatz. Auf der Heimfahrt ist die Lautstärke im Auto deutlicher geringer, denn alle Kinder schlafen nach kurzer Zeit tief und fest. Meine Frau hat die Augen geschlossen und ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Der Gedanke, dass unsere Familie einen perfekten Tag erleben durfte, macht mich tief zufrieden.
Nützliche Infos www.knieskinderzoo.ch www.citymaps.ch


Sind Sie gespannt, wie es mit dem Projekt «Beratungscenter Handicap Nottwil» weitergeht? Erfahren Sie zudem, welche Dienstleistungen Ihnen als Rollstuhlfahrer schon heute geboten werden.
Von Angela Addo
Die Arbeitsgruppe um René Künzli (SPZ), Angela Addo (SPV) und Marius Christ (Gemeinde Nottwil) entwickelte in den letzten Monaten die passenden Partnerschaftsmodelle und kontaktierte potenzielle Partner (Paracontact 2/2018). Leider musste mangels Anmeldungen der Informationsabend im November 2018 abgesagt werden. Im Frühling 2019 startet ein weiterer Versuch.
Phase 2
Nichtsdestotrotz ist das Projekt bereits in die nächste Phase übergegangen: Der Umbau am Schalter wurde im Juni 2018 abgeschlossen und das Verkaufs- und Beratungspersonal geschult, um Kunden mit speziellen Bedürfnissen bestens zur Seite stehen zu können.
Reise von Tür zu Tür
Hier ein Beispiel, welche Art Dienstleistung Sie in Nottwil erwarten können: Für Peter Muster aus Eich wird ein Ausflug auf die Rigi geplant. Neben allen Tickets bestellt die Beraterin auch ein Tixi-Taxi von Peters
Zuhause bis zum Bahnhof Sursee. Für die gewünschte Verbindung ab Sursee (kein Niederflurzug) wird ein «Mobi-Helfer» der SBB organisiert, der Peter in den Zug hilft. In Luzern erhält er Hilfe beim Ausstieg und nimmt den Niederflurzug nach Küssnacht. Die Beraterin klärt ab, ob die Busverbindung von Küssnacht nach Vitznau rollstuhlgerecht ist. Die instruierten Rigi Bahnen halten die nötige Unterstützung für Peter bereit. Ein vollumfänglicher Service, der natürlich auch für die Rückreise gilt.
Sie sind nicht aus Nottwil oder der Region Sempachersee? Kein Problem, das Fachpersonal des Beratungscenters Handicap Nottwil kann Ihnen auch z. B. per Skype Hilfestellungen leisten. Anfragen können auch via Mail oder Telefon gemacht werden. www.nottwil.ch
Schreiben heisst erleben
Wieso schreibe ich eigentlich? Wie schreibe ich packend oder verständlich? Was brauchts für eine gute Geschichte?
Mit diesen und weiteren spannenden Fragen setzte ich mich während der Schreibwerkstatt vom 17./18. November 2018 auseinander. Peter Ackermann, Journalist, hat auf eine spielerische und kompetente Art das nötige Fachwissen vermittelt. Es ging aber nicht nur ums Texten. Mir wurde klar, wie wichtig nebst Fantasie auch die Beobachtungsgabe ist. Mittels Fotos oder Filmausschnitten wurden ganze Geschichten zum Leben er weckt. Das blosse Drauflosschreiben bildete wunderbare Vorlagen für weitere Texte.

Die Stimmung während des Kurses war äusserst angenehm. Wir konnten voneinander profitieren und uns über diverse Schreibstile austauschen. Dank dem wohlwollenden Feedback von Peter konnte ich meine Leidenschaft zu Worten weiter ausbauen. Ich kann jedem raten: Habt den Mut und nehmt häufiger Stift und Papier zur Hand. Ihr werdet staunen, was dabei herauskommen kann.
Vanessa Leuthold, Kursteilnehmerin
BEHIND THE SCENES SRF
Schafft Lorenzo Parisi seine Challenge?
Das SRF begleitet ihn bei seinem Weg zurück auf die Skipiste.
Von Nicolas Hausammann
Monoskibob fahren ist kein leichtes Unterfangen, als Tetraplegiker mit eingeschränkten Arm- und Handfunktionen gar eine grosse Herausforderung. Lorenzo hat sich dieser Challenge gestellt. Er lässt sich dafür aber nicht etwa mehrere Saisons Zeit, für ihn heisst es «Jetzt oder nie – Lebe deinen Traum». Für das gleichnamige Sendeformat des SRF hat er sich zum Ziel gesetzt, vor Ablauf der Wintersaison 2018/2019 selbständig die Pisten herunter zu kurven.
Optimales Monoskibob-Tuning
Unterstützt wird Lorenzo bei sei ner Challenge von Skilehrer Richard Studer, einem der erfahrensten Schweizer Monoskibob-Lehrer der Basis von Rollstuhlsport Schweiz auf der Sörenberger Rossweid. Der 44-jährige Studer führt Lorenzo behutsam an die Herausforderung des selbständigen Skifahrens, wie er dies schon mit vielen früheren Sportlern gemacht hat. «Ich nehme wahnsinnig viele positive Erlebnisse aus dem Kurs mit», erzählt Lorenzo. Überzeugt ist der gebürtige

Tessiner Tetraplegiker vom kompetenten Personal von Rollstuhlsport Schweiz und von seinem Sportgerät: «Der Schweizer Impulse-Bob lässt sich optimal tunen. Diese zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten am Sportgerät sind für mich als Tetraplegiker besonders wichtig. Denn der Bob muss wirklich perfekt eingestellt sein auf meine Funktionen, um meine Schwünge sicher und zielgerichtet auslösen zu können.»

Die Herausforderung beim Skifahren mit einer hohen Querschnittlähmung liegt vor allem bei der Auslösung der Schwünge und der seitlichen Stabilisierung mittels «Stabilos», wie die kleinen Stöcke mit ihren Mini-Skis genannt werden. Bei eingeschränkten Handfunktionen werden diese mit einer Manschette am Griff fixiert, sodass der Fahrer dennoch volle Kontrolle über den Stock hat, um sich seitlich abstützen zu können. Die Monoskibob-Basis Sörenberg ist für das Abenteuer Skifahren ideal ausgestattet. Im Materialraum lagern über 50 Monoskibobs der Marken Impulse, Tessier und Prasch-
berger. Somit findet sich für fast jede Postur und Behinderung ein geeignetes Sportgerät, welches dann noch auf den Fahrer individuell eingestellt wird. Vom Materialraum geht es direkt auf die Piste, wo vorerst jedoch die erfahrenen Skilehrer die Zügel noch fest in der Hand halten, um allfällige Fehler korrigieren zu können. Spezielle Gegebenheiten, auf die sich auch das SRF erst einstellen musste.
Spontaneität über Planung
Wer nun denkt, das Schweizer Fernsehen reise mit einem bis ins Detail ausgeklügelten Drehplan an und schaue daneben weder rechts noch links, der hat weit gefehlt. Mit der Begleitung von Lorenzo Parisis Challenge betritt das Produktionsteam von SRF Neuland. Noch nie haben sie einen Rollstuhlsportler begleitet, schon gar nicht auf Schnee. Auffällig sind vor allem die aufwändigen Vorbereitungen, die nötig sind, um dann auf der Piste wirklich Spass haben zu können. Die Auswahl des Bobs, der Transfer, das Befestigen im Sportgerät und der Stabilos – all dies verschlingt extrem viel Zeit. Wenn das Filmteam dann noch seine Kameras befestigen muss und die


nächsten Abfahrten besprochen werden, schrumpft die Zeit auf dem Schnee beträchtlich zusammen. Erwartungen an einen solchen Dreh hat das Filmteam aber keine, und das hat auch seine Gründe. Erstens werden die Erwartungen meist nicht erfüllt und zweitens will das Team auch offen sein für spontan entstehende Situationen. So wird die Reportage authentisch und lebendig. Eine zu starke Vorstellung würde Lorenzo eventuell beeinflussen und so spontane Begebenheiten verhindern.
Leben mit, nicht trotz Behinderung Überrascht hat das Produktionsteam die positive Einstellung ihres Protagonisten. Der 26-jährige Tessiner Arzt, der sich gemeinsam mit seiner Partnerin in Bern niedergelassen hat, war für das Team eine Inspirationsquelle. In keinster Art und Weise stellt die Fernsehcrew Verdruss oder Wut fest über das, was nicht mehr geht. Sein Fokus liegt voll auf der Herausforderung und dem, was mit seinen Voraussetzungen als Tetraplegiker noch möglich ist. Das Filmteam hat Lorenzo bereits beim Rugby begleitet. Auch beim Teamsport wird ihm von Rugby-Nationalcoach Adrian Moser
durchaus Talent attestiert. Daher ist er auch in dieser Sportart im Nachwuchsfördergefäss «Basic Rolli». Sein Fokus liegt aber klar auf seiner Karriere als Arzt. Der Sport bleibt ein willkommener Ausgleich.
Beim Rugby geht es so richtig hart zur Sache. Krachende Zusammenstösse und die Geschwindigkeit des Spiels stehen dann auch im Fokus der Reportage und haben tolle Bilder ergeben. Das Skifahren strahlt dagegen eher Ruhe aus und ist ein spannender Ausgleich zu den Bildern aus der Sporthalle des SPZ Nottwil. Die Abgeklärtheit und Begeisterung, mit welcher Lorenzo seine Sportarten betreibt, hat die ganze Crew in seinen Bann gezogen. Er lebt sein Leben nicht trotz, sondern mit seiner Behinderung, das spürt man.
Mit jedem Schwung steigt der Spassfaktor
Ob Lorenzo seine Challenge schafft und seine Schwünge bis Ende Saison selbständig in den Schnee zieht, wird sich in Airolo entscheiden. «Mit jedem selbständigen Schwung steigt der Spassfaktor, noch bin ich aber vom ganz selbständigen Fahren
etwas entfernt. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass ich mein Ziel bis Ende Saison erreichen werde», erklärt Lorenzo den Stand seiner Challenge. Eine kleine Reserve hat sein Skilehrer Richard Studer vorsichtshalber noch eingebaut. Falls es in Airolo doch noch nicht ganz alleine klappen sollte, werden sich die beiden nochmals zu einem Kurs in Sörenberg treffen. Denn Lorenzo absolviert bereits selbständige Schrägfahrten und löst auch seine Schwünge selber aus, sein Skilehrer sichert ihn aber noch an den Seilen.
Mit dem Kurs vom 31. März 2019 beenden wir die Wintersaison 2018/2019 in Sörenberg. Herzlichen Dank an unsere Mono- und Dualskibob-Lehrer, die Bergbahnen und das Team des Restaurants Rossweid für die tolle Saison. www.soerenberg.ch
Was ist neu?
Das von Rollstuhlsport Schweiz organisierte «fun for wheelies» ermöglicht Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren ein gemeinsames Wochenende in der Schweiz. Neben den sportlichen Aktivitäten wird auch die Geselligkeit gross geschrieben. Die Teilnehmerzahl ist in den letzten Jahren leider geschrumpft.

Anhand der Ergebnisse einer Umfrage unter potenziellen Teilnehmenden wird das «fun for wheelies» reorganisiert. Neu darf jeder eine Begleitper son (Kollege, Geschwister usw.) in ähnlichem Alter mitnehmen. Der sportliche Teil kann von den Fussgängern ebenfalls im Rollstuhl absolviert werden. Somit wird Inklusion auch am «fun for wheelies» gefördert.
Die Unterstützung durch Pflegefachpersonen ist weiterhin gewährleistet. Auf vielseitigen Wunsch, das «fun for wheelies» in Nottwil durchzuführen, wird es dieses Jahr am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni stattfinden. Die Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm.

Fund
Foto: Michael
Der wichtigste Meilenstein vor Tokyo 2020 findet in Holland vom 3. bis 9. Juni 2019 statt.
Seit der WM 2017 in China mit 250 Athleten sind die internationalen Machtverhältnisse unverändert geblieben. China, Russland, Iran und Grossbritannien werden auch an diesem Titelwettkampf voraussichtlich mehr als die Hälfte der Podestplätze belegen.
Wie die anderen Länder mit Mini-Beteiligungen kann die Schweiz diese WM mit lediglich einer kleinen Delegation beschicken – wenn überhaupt. Die frühe Durchführung in der Saison bietet zwar wenig Möglichkeiten, die geforderten Selektionsanforderungen zu erreichen.

«Ha-llo, will-kom-men in To-ki-o» wird die Computerstimme eines Empfangs-Roboters etwas holprig, dafür aber in jeder gewünschten Sprache, unsere Schweizer Athleten am Flughafen empfangen. Die Japaner werden ihre Vormachtstellung im Bereich der Digitalisierung der ganzen Welt präsentieren. Auch sportlich warten die Paralympics mit einer Weltpremiere auf, die uns Schweizern entgegenkommt: Badminton – eine Sportart, in der die Schweiz über Topathleten verfügt – wird paralympisch. Der Schweiz kann somit neben Handbike und Leichtathletik in einer dritten Sportart Medaillenpotenzial attestiert werden. So bleibt zu hoffen, dass es bei der Siegerehrung aus dem Roboter spricht: «Go-ld me-da-list, from Swi-tzer-land »
Im Hinblick auf Tokyo 2020 kommt dieser WM allerdings wegen der Jagd nach Quotenplätzen eine Schlüsselstellung zu.
Die Schweizer Damen-Nationalmannschaft im Rollstuhltennis hat wiederum den Exploit geschafft, sich dank ihrem sechsten Platz im vergangenen Jahr direkt für das Finale des World Team Cup zu qualifizieren. Das Herren-Team kann sich im April bei der europäischen Qualifikation in Vilamoura (POR) noch qualifizieren. Allerdings müssten sie den ersten Platz erreichen, um den Finaleinzug zu schaffen. Die selektionierten Spieler
für dieses Qualifikationsturnier sind in diesem Jahr Daniel Pellegrina, Herbert Keller und Yann Jauss. Das Team der Frauen besteht aus Nalani Buob, Gabriela Bühler und Angela Grosswiler. Die Schweiz hat seit Beginn des Jahres spezielle Doppel-Trainings in die Vorbereitung integriert, um sich optimal auf das Finale vom 13. bis 18. Mai 2019 in Ramat Hasharon vorbereiten zu können.
WINTERSAISON ROMANDIE
Beim ersten Kids Day in Villars-sur-Ollon suchen Teilnehmende und ihre Familien neue Perspektiven im Skisport – und finden diese unter strahlendem Sonnenschein.
Von Nicolas Hausammann

Für eine Familie steht die Schulbildung des eigenen Kindes natürlich im Zentrum. In einer integrativen Schule werden viele Möglichkeiten der Integration geboten, der Sportunterricht und die damit verbundenen Skilager sind jedoch oft eine vergessene Disziplin. Turnhallen sind nicht rollstuhlgängig oder Lehrer nicht adäquat ausgebildet, einen Jugendlichen im Rollstuhl in die Sportlektion einzubinden.
Eine Familie, deren Kind am Kids Day teilnimmt, hat sich zum Ziel gesetzt, diese Ungleichheit zu beseitigen. Dafür muss ihr Sohn allerdings selbständig Skifahren können. Um die genauen Voraussetzungen zur Teilnahme am Skilager der Regelklasse zu besprechen, ist sogar extra Joelle Remis angereist. Sie ist Sozialpädagogin beim Kanton Waadt und will das hochgesteckte Ziel gemeinsam mit der Familie Michelet erreichen. Der Kids Day ist als Plattform für diesen Besuch ideal, kann sich doch die Pädagogin ein Bild von den Skikünsten des Teilnehmers machen und gleichzeitig die Zeit zwischen den Pistenfahrten für Gespräche mit den Eltern nutzen.
Ein Stück Freiheit auf der Piste Selbständig die Kurven in den Schnee ziehen, um mit der gesamten Familie auf die Piste zu können, ein grosses Ziel für die kleinen Teilnehmenden. Vorher waren alle
Impressionen
Eindrücke aus Villars im Video www.youtube.com/spv6207
im geführten Dualskibob unterwegs, doch nun ruft die grosse Freiheit, wenn auch vorerst im kleinen Schneegarten der Skischule Villars. Noch verschwinden die Jungs manchmal in der Staubwolke ihrer bremsenden Skilehrer, was zu herzlichen Lachanfällen führt. Der 10-jährige Walliser Noa Michelet hat das Tal durchquert in den Kanton Waadt, um seine ersten eigenen Schwünge
zu wagen. Tatsächlich schafft er es am Ende des Tages, selbständig im Bob einige Kurven in den Schnee zu ziehen. Das Lob des Skilehrers kommt prompt, er schwingt ab, kommt zum Stillstand und – fällt um. Vor Freude über das Erreichte hatte er ganz vergessen, dass er nicht mehr geführt im Dualskibob unterwegs ist, sondern sich selbst mit den Stabilos im Gleichgewicht halten muss. Glücklich liegt er im Schnee und lacht ob seiner neu gewonnenen Freiheit.


LEICHTATHLETIK-JUNIOREN-WM 2019
Vom 1. bis 4. August sind die World Para Athletics Junior Championships zum zweiten Mal zu Gast in Nottwil. Die teilnehmenden Nachwuchstalente haben grosse Ziele.
Von Nicolas Hausammann
Rollstuhlsport Schweiz organisiert nach 2017 die zweite Junioren-WM der Geschichte. Für Schweizer Erfolge soll natürlich die Vorjahressiegerin Licia Mussinelli sorgen. Die 18-jährige Absolventin der Sport Akademie von Rollstuhlsport Schweiz holte sich bei der ersten WM-Ausgabe in der Sport Arena des Schweizer Paraplegiker-Zentrums zwei Medaillen, eine davon in Gold. «Bei den Juniorinnen gehört Licia zu den Besten, für den Sprung zur Elite braucht es aber noch eine Leistungssteigerung», schätzt Andreas Heiniger, Chef Leistungssport von Rollstuhlsport Schweiz, die Chancen auf erneutes Edelmetall ein. Für die anderen Schweizer Athleten geht es vor allem darum, internationale Wettkampferfahrung zu sammeln. Vor heimischem Publikum unter den Augen von Fans, Familien und Freunden macht dies natürlich doppelt Spass. Wer weiss, vielleicht hilft die Stimmung in Nottwil ja dem einen oder anderen Athleten, über sich hinauszuwachsen.
Eröffnung zum Nationalfeiertag Für ein Feuerwerk werden am 1. August für einmal nicht Raketen, sondern die Athleten sorgen. Beim gemütlichen Brunch direkt auf dem Eventgelände mit bestem Blick auf die Leichtathletikbahn, kann sich das Publikum auf die WM einstimmen und dennoch einen stimmungsvollen Nationalfeiertag geniessen. Gleich nach dem Brunch findet die Eröffnungsfeier statt, gefolgt von den ersten Rennen der Nachmittagssession, an der die Athleten ihre Nachbrenner auf der Bahn zünden.
Die Familien-WM
Damit es auch den Kleinsten nicht langweilig wird, ist im Rahmenprogramm für Kinderunterhaltung gesorgt. Der Kidsund Family-Park von Funnyhouse Eventvermietungen bietet Hüpfburgen, Ballonkünstler und Kinderschminken, Zuckerwatte sowie Softeis. Kinderkonzerte runden das Familienprogramm ab. Zusammen mit
Stay young – be a volunteer! Wir suchen sie, die engagierten Arbeitswilligen, die Spass haben, die Athleten aus aller Welt bei der Verwirklichung ihres paralympischen Traums zu unterstützen.
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil eines einzigartigen Erlebnisses: www.nottwil2019.ch/volunteer
der Rennaction auf der schnellen Nottwiler Rundbahn ist der Anlass ein Muss für jeden Familienkalender, in dem die Sommerferien zu Hause eingetragen sind.
Sprungbrett für Überflieger
Bei rund 60 Wettkämpfen über die verschiedenen Sprung-, Wurf- und Bahnwettkämpfe sind die USA nach ganzen 36 Medaillen 2017 klarer Favorit. Grossbritannien und Iran waren ebenfalls mit grossen Delegationen vor Ort und zeigten ihre beeindruckende Dichte an Nachwuchsathleten. Wie hoch die Leistungen an der JuniorenWM vom Niveau her einzuordnen sind, zeigt die Tatsache, dass bei der Premiere vor zwei Jahren diverse Weltrekorde gemessen wurden. Einer der Stars war damals der südafrikanische «Blade Runner» Ntando Mahlangu, der sich im Sprint über 100 Meter den Weltrekord holte. Der heute 17-Jährige wird, sollte er in Nottwil wieder mit von der Partie sein, ganze vier Titel zu verteidigen haben.
Dies sind Resultate, von denen die Schweiz nur träumen kann. Doch Träume beginnen mit unvorstellbaren Leistungen, und wer weiss, vielleicht sitzt ja der nächste Schweizer Topathlet vom Format einer Manuela Schär oder eines Marcel Hug bereits im Publikum.
Vorbei die Zeit, in der Trainer mit Fachwissen und Erfahrung Athleten beurteilen –es wird getestet, ausgewertet und Massnahmen definiert!
Von Nicolas Hausammann
An einem Dienstagnachmittag sind sechs Basketballer der Nationalmannschaft in der Halle des SPZ Nottwil zusammengekommen. Für einmal nicht um Würfe auf den Korb zu donnern oder gegeneinander zu spielen, sondern um sich in heissen Fahrduellen zu messen. Noch wird locker über den Ausgang der letzten Partien gespasst, denn oft sehen sich die vier (Halb-)Profis und zwei Schweizer Amateure auch nicht. Mit Philipp Häfeli und Maurice Amacher stehen sich zwei der Akteure in der deutschen Bundesliga gegenüber. Zwei weitere spielen in Italien beim HS Varese und diskutieren kräftig mit über das Geschehen in Basketball-Europa. Nebenan hat Gregor Boog, Performance-Experte des Nationalen Leistungszentrums für Rollstuhlsport (NLR), den Parcours aufgebaut. Heute gilt es, verschiedene Fahrwege, Drehungen, Kontakte und schnellstmögliche Stopps zu absolvieren. Er ruft die Athleten zusammen und gibt Anweisungen zur Ausführung der Tests.

Erster Push entscheidet
Wer im modernen Rollstuhlbasketball gewinnen will, muss nicht nur den Korb treffen. Athletik wird gross geschrieben, vor allem die Explosivität. «Beim ersten Push am Rad entscheidet sich bereits, ob du deinen Gegenspieler überholst oder er dich stoppen kann», erklärt Janic Binda, Captain der Nationalmannschaft. Der 28-jährige Aargauer ist für seine Athletik bekannt und der schnellste Spieler seines Vereins in der italienischen «Serie A». Heute ist jedoch einer schneller als er und alle anderen. Husein Vardo, Spitzname «Rössli Hü». Doch warum schafft es der eingebürgerte Bosnier, die 3-Meter-Sprints deutlich schneller durchzuführen und rascher als alle anderen zu stoppen beziehungsweise wieder loszufahren? Dafür steht Gregor Boog hinter der Videokamera und filmt die zuvor mit Markern beklebten Athleten. Noch kann er erst Vermutungen äussern, verglichen wird später im Videostudium. Doch zuerst müssen sechs verschiedene

Fahrmuster mit Kurven, vor- und rückwärtsziehen mit knallendem Stuhlkontakt am Schwedenkasten, Starts und Stopps absolviert werden.
«Heute war Vardo schneller»
Massnahmen aus Analyse Nationaltrainer Nicolas Hausammann will vor allem wissen, wo die Defizite seiner Spieler in Mobilität, Technik und Athletik liegen. Da die Tests im Labor der Sportmedizin nicht ausreichend waren, um die Komplexität der Teamsportart Basketball zu erfassen, wurde in enger Zusammenarbeit mit dem NLR ein eigener Test kreiert. Dieser spiegelt die häufigsten Fahrmuster der Athleten aus realen Spielsituationen wider. Bis zu den nächsten Testing Days im Mai wird nun für die verschiedenen Spieler ein Technikleitbild anhand der besten Athleten mit ähnlichen Voraussetzungen erarbeitet. Beim Zusammenzug, welcher gleichzeitig als Kick-off für die EM-Vorbereitung 2019 dient, werden die Athleten mit Performance-Experte Boog die Videos anschauen und Massnahmen für das weitere Athletiktraining bis zur EM in Polen definieren. Dort will die Schweiz den Bann des 10. Platzes endlich brechen und erstmals in ihrer Geschichte in die Viertelfinals vorstossen.
Lehrreich und dazu noch cool! Unsere Active
Motion Days bieten für jeden Geschmack etwas. Ob Wasser oder Berge, eher actionreich oder ruhig –Spass und Bewegung sind überall garantiert.
Von Martina Meyer
Wer gerne draussen in der Natur ist, dem bieten sich viele Möglichkeiten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Kite-Einführungstag? Bei diesem Tageskurs werden grundlegende Informationen zur Sportart vermittelt. Worauf muss der «Rollikiter» bezüglich Infrastruktur, Ausrüstung, Zugänglichkeit zum Wasser usw. achten? Im praktischen Teil machen die Teilnehmenden erste Erfahrungen mit einem kleinen Kite, im Rollstuhl oder am Boden sitzend. Dieser Kurs findet «an Land» statt und ist die optimale Vorbereitung für den Kitesport auf dem Wasser.


Segeln ist mehr als nur Sport. Es ist das Gefühl von Freiheit inmitten der Elemente Wasser und Wind. Die Hansa303-Boote der Vereinigung «Velabili» in Lugano sind perfekt zugänglich für Menschen im Rollstuhl und für Personen mit einer Einschränkung in Armen und/oder Händen.
Paddeln oder Rudern? Sich rückwärts oder vorwärts bewegen? Beides hat sei nen Reiz. Das herrliche Gefühl, über den See zu gleiten, erleben Sie sowohl im Kajak als auch im Ruderboot. An unserem Schnuppertag auf dem Sempachersee können diese beiden Sportarten mit Nutzung
einer perfekten Infrastruktur des nationalen Zentrums für Para-Rowing ausprobiert werden.
Geschwindigkeit und Action
Mit einem Cimgo, Explorer oder Quadri IBEX die Bergwelt erobern? Diese verschiedenen Geräte machen den Mountainbike-Schnuppertag für alle möglich. In Airolo und Conthey können die mehr als 10 Kilometer langen Abfahrten entweder selbständig oder geführt absolviert werden. Nervenkitzel ist so oder so garantiert.
Auch beim Wasserskifahren geht es rasant zu und her. Wer den Dreh einmal raus hat, flitzt schon mal mit 30 km/h über den See. Nebst Gleichgewicht werden auch die Armund Handmuskeln besonders gefordert. Eine gute Handfunktion und Kraft in den Armen sollten deshalb vorhanden sein.

Taktisch kämpfen
Wie kann ich mich als Rollstuhlfahrer selber verteidigen?
Beim Kyusho lernen Sie nebst der Selbstverteidigung viel Wissenswertes um die Vitalpunkte im Körper und ihre Benutzung in den Kampfkünsten kennen. Sie werden staunen, wie Sie mit wenig Aufwand grosse Wirkung erzielen können. Eine gute Taktik ist auch beim Bocciaspielen gefragt.
Diese paralympische Sportart hat in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen und ist ideal, um Team- und Wettkampfgeist zu fördern. Beide Angebote sind auch für Menschen mit einer höheren körperlichen Beeinträchtigung problemlos machbar.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen zu unseren Active Motion Days erhalten Sie schon bald in der de taillierten Ausschreibung auf der Webseite www.spv.ch/breitensport. Auch telefonisch geben wir gerne Auskunft: Tel. 041 939 54 30. Neben den Schnuppertagen fehlen natürlich auch unsere Camps und Kids Days nicht in unserem Jahresprogramm.

DATEN ZUM VORMERKEN
18.5.2019 Kite Einführungstag, Alpnach
8.6.2019 Segeln Schnuppertag, Lugano 22.6.2019 Kajak und Rudern Schnuppertag, Sempach
29.6.2019 Mountainbike Schnuppertag, Conthey 6./7.7.2019 Wasserski Schnuppertage, Mols 7.9.2019 Mountainbike Schnuppertag, Airolo 14.9.2019 Boccia und Kyusho Schnuppertag, Sion
Camps/Kids Days
31.3.2019 Kids Day, Bulle 7.–9.6.2019 «fun for wheelies», Nottwil 15./16.6.2019 Kids Camp, Nottwil 5.10.2019 Kids Day, Tenero 7.–12.10.2019 Sportcamp «move on», Nottwil (Änderungen vorbehalten)

RENNSERIE 2019
Die Weltelite kommt auch dieses Jahr wieder in die Schweiz, um sich zu messen und Welt- und Europarekorde zu brechen. Mit dabei viele erfolgreiche Schweizer.
Von Evelyn Schmid
Triumpfe und Niederlagen sind immer nah beieinander. Das wird dieses Jahr nicht anders sein als im letzten Jahr. Damals hatte Marcel Hug im Vorfeld der ParAthletics einen neuen Weltrekord über 5000 Meter im Visier. Es gab zwar wirklich eine neue Bestzeit, aber nicht für den Schweizer, sondern den Amerikaner Daniel Romanchuk. Es blieb Marcel Hug der Europarekord und zwei Schweizer-Meister-Titel. Der in Nottwil lebende Topathlet kündete im letzten Jahr an, dass er nicht kampflos aufgebe, sondern auch dieses Jahr wieder nach dem Weltrekord greifen werde. Er wird eine Gelegenheit in Nottwil haben am World Para Athletics Grand Prix und dann zwei weitere Chancen in Arbon anlässlich des Daniela Jutzeler Memorials und der offenen Schweizer Meisterschaften.
Frauenpower
Wie bei den Männern gab es im letzten Jahr auch bei den Frauen ein extrem grosses und dichtes Feld in der Kategorie von Manuela Schär. In den meisten Rennen
musste sie sich den schnellen Amerikanerinnen Tatyana McFadden und Susannah Scaroni sowie der Australierin Madison de Rozario stellen. Sie machte das mit Erfolg: zwei Europarekorde, vier Schweizer-Meister-Titel und insgesamt acht Podestplätze. Eine beeindruckende Bilanz. Da dürfen wir auch dieses Jahr einiges erwarten.
Aber auch die anderen Schweizer haben Beachtliches gezeigt. Beat Bösch war in hervorragender Form, Bojan Mitic, Alexandra Helbling und Patricia Keller sowie ein paar jüngere Athleten präsentierten sich in einem guten Licht. Insbesondere auch Tanja Henseler, Anita Scherrer und Fabian Blum sind gute Zeiten gefahren. Es ist davon auszugehen, dass auch sie wieder am Start sein werden.
Sieben Welt- und sechs Europarekorde
Es ist faszinierend, dass es an Anlässen auf der Sport Arena Jahr für Jahr neue Topergebnisse gibt. 2018 wurden sieben Weltund sechs Europarekorde gefeiert. Auch die
WETTKÄMPFE AN ZWEI ORTEN
Im vergangenen Jahr wurde die komplette Rennserie – sprich der World Para Athletics Grand Prix, das Daniela Jutzeler Memorial und die Schweizer Meisterschaften – in Nottwil ausgetragen. 2019 findet hier unter dem Namen ParAthletics nur der Grand Prix vom 24. bis 26. Mai 2019 statt, während die anderen beiden Wettkämpfe in Arbon unter dem Titel «Weltklasse am See» ausgetragen werden – am 30. Mai respektive am 1. und 2. Juni 2019.
Für die drei Anlässe haben sich insgesamt rund 300 Athleten angemeldet. In Nottwil werden neben den Rollstuhlrennen Wettkämpfe für Seh- und Lernbehinderte sowie Athleten mit Amputationen angeboten. Zu sehen sind auch Sprung- und Wurfdisziplinen. In Arbon gibt es hingegen nur Bahnwettkämpfe.
Ein vielseitiges Programm. Kommen Sie vorbei und feuern Sie die Athleten an.
Bahn in Arbon, auf der dieses Jahr Rennen gefahren werden, gilt als eine der schnellsten der Welt. Das Zusammentreffen von Topathleten mit optimaler Infrastruktur und oft idealen Wetterbedingungen im Juni lässt vermuten, dass es dieses Jahr wieder Rekorde zu feiern gibt. Wir werden es sehen.
Vielseitiges Rahmenprogramm
Während der ParAthletics in Nottwil bietet das OK um Samuel Lanz ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auf dem Selbsterfahrungs-Parcours können Kinder und Erwachsene im Rollstuhl kleine Hindernisse überwinden. Am Samstagnachmittag, wenn die wichtigsten Wettkämpfe ausgetragen werden, können sich Kinder auf der Hüpfburg austoben und schminken lassen. Bei allen Anlässen gibt es zudem vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten.
Informationen
Laufend Aktuelles auf www.rollstuhlsportevents.ch
FERIENTIPP
Mit viel Liebe, Tatkraft und Lebensfreude verfolgt die «Fondation au fil du Doubs» mit ihrem Ferienund Erholungshaus im historischen Städtchen SaintUrsanne ihren Einsatz für Menschen mit Behinderungen.
Am Ufer des Doubs gelegen, bietet die Unterkunft mit den elf Zimmern vollständig angepasste Räumlichkeiten, ausgewiesenes Hilfspersonal und familiäre Atmosphäre. Ob für eine kurze Luftveränderung oder für einen längeren Aufenthalt, das «Au fil du Doubs» bietet verschiedene Möglichkeiten mit garantiertem Wohlfühleffekt. Es werden Ausflüge in die Umgebung, sportliche Aktivitäten, Picknicks, Massagen, tägliches Qigong und liebevoll zubereitete Mahlzeiten angeboten.

Mehr dazu auf www.aufildudoubs.com
VERKLEINERT

Die Tetraplegikerin Jordan Bone hat für ihr Video «My beautiful struggle» über sechs Millionen Views erreicht. Schon vor ihrem Autounfall teilte sie auf Youtube ihre Leidenschaft für Make-up, als Tetraplegikerin verschwieg sie anfänglich jedoch ihr Handicap. Nach einigen negativen Kommentaren über die Steifheit ihrer Hände entschied sie sich, die Wahrheit zu veröffentlichen und ihren Fans den Kampf mit den Arbeitsinstrumenten zu demonstrieren. Es hat ihr nicht geschadet, dank ihrem Mut hat sie heute nahezu 200 000 Abonnenten und lebt ihren Traum als Visagistin und Beauty-Bloggerin.
Die Schweizer ParaplegikerStiftung hat anlässlich der Stiftungsratssitzung vom 19. September 2018 vier langjährige Mitglieder verabschiedet: Vizepräsident Hans Jürg Deutsch, Susy Brüschweiler, Ulrich Liechti und SPVBereichsleiter Erwin Zemp.
Das Gremium hat die beiden neuen Mitglieder Aline Isoz und Martin Werfeli einstimmig gewählt. Laut den Aussagen von Präsident Daniel
Joggi ist bewusst ein kleineres Gremium angestrebt worden. Dies steigere die Effizienz und die Handlungsfähigkeit. Neuer Vizepräsident wird Luca Stäger, der schon seit 2014 Stiftungsrat ist. Der Stiftungsrat der Schweizer Paraplegiker-Stiftung setzt sich neu wie folgt zusammen: Präsident Daniel Joggi, Vizepräsident Luca Stäger, Christian Betl, Jacqueline Blanc, Heinz Frei, Aline Isoz, Barbara Moser Blanc, Kuno Schedler und Martin Werfeli.
PARA ROMANDIE
Der einzigartige Begegnungsevent
Zum zweiten Mal veranstaltet die «Clinique romande de réadaption» (CRR) einen Tag rund um verschiedene Themen von Menschen im Rollstuhl. Der Event ist einzigartig in der französischen Schweiz. Er bietet die Möglichkeit, sich in einem familiären Umfeld austauschen zu können, zum Beispiel über technische Neuheiten oder Hilfsmittel. Gleichzeitig sensibilisiert er die Öffentlichkeit für Themen der Rollstuhlfahrer. Die CRR stellt in ihren Räumlichkeiten in Sion verschiedenen Akteuren wie Firmen, Vereinen, Rollstuhlfahrern, Angehörigen und Menschen aus der Gesundheitsbranche eine kostenlose Plattform zur Verfügung.

Der Anlass findet am 4. Mai 2019 von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. Die SPV unterstützt den Anlass als Hauptsponsor. Mitarbeitende der Lebensberatung und des Sports stehen vor Ort für Beratungen zur Verfügung. Es werden zudem verschiedene Sportarten vorgestellt.
Sind Sie an einer Teilnahme interessiert? Dann melden Sie sich bei Beat Eggel, beat.eggel@crr-suva.ch, Tel. 027 603 31 00.
Wussten Sie, dass Sie für Ihr Motorfahrzeug Amortisationsbeiträge der IV beantragen können? Dieser ist für 2019 unverändert auf CHF 3000.–festgesetzt worden. Amortisationsbeiträge werden nur vergütet, wenn Sie im Sinne der IV eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ausüben. Das zu erzielende Mindesteinkommen liegt bei CHF 1778.–.

Der ESCIF-Kongress findet vom 27. bis am 29. Mai 2019 in der schwedischen Hafenmetropole Göteborg statt. Ziel des Anlasses ist es, Wissen über die Querschnittlähmung zu verbreiten und es in diversen Organisationen und Ländern zu vermitteln. Dazu passt das diesjährige Thema «Empowerment – Knowledge is Power». In der Tat, die Vermittlung von Informationen und Tipps kann den Alltag eines Querschnittgelähmten erleichtern. Falls Sie an einer Teilnahme interessiert sind, können Sie sich über die Webseite www.escifcongress.org informieren.

Eine Woche Schneesport und Lagerleben mit 600 Jugendlichen für nur 120 Franken? Dies ermöglicht das JUSKILA – und zwar schon seit 1941.
Es ist das grösste J+S-Winterlager. In einer fröhlichen und unbeschwerten Atmosphäre lernen die Kinder viel mehr als nur Schneesport. Sie lernen Gleichaltrige aus der ganzen Schweiz kennen und durchbrechen dabei Sprach- und andere Barrieren. Mit dabei sind jeweils zwei jugendliche Rollstuhlfahrer von Rollstuhlsport Schweiz.
INCLUSION HANDICAP

Der Dachverband der Behindertenorganisationen, Inclusion Handicap, zieht die Beschwerde gegen die befristete Betriebsbewilligung des neuen SBB Doppelstockzuges (FV-Dosto) an das Bundesgericht weiter. «Die neuen Züge missachten das Behindertengleichstellungsgesetz», so die Aussage der Präsidentin Pascale Bruderer.
Dieses Jahr verbrachten Eskil Hermann und Noah Remund vom 2. bis 8. Januar eine erlebnisreiche Schneesportwoche an der Lenk. Die SPV finanziert dazu jeweils zwei Mono- oder Dualskibob-Lehrer aus unserem Team in Sörenberg. Dank den beiden engagierten Skilehrern Pascal Achermann und Hans Peter Hertig konnten die beiden Jugendlichen auf und neben der Piste enorm viel profitieren.
Bilder und Informationen www.swiss-ski.ch (unter Events)
AHV- UND IV-RENTEN
Der Bundesrat passt die AHVund IV-Renten per 1. Januar 2019 der aktuellen Preisund Lohnentwicklung an. Die Minimalrente erhöht sich um 10 Franken und die Maximalrente um 20 Franken pro Monat. Bei einer vollen Beitragsdauer beträgt die Minimalrente neu 1185 Franken und die Maximalrente 2370 Franken. Ebenfalls erhöht sich die Höchstgrenze für die Renten eines Ehepaares (Plafonierungsgrenze) von 3525 Franken auf 3555 Franken. Dies bewirkt auch eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung der IV von max. 1880 auf 1896 Franken.

Schutz durch 100% berührungsfreie Anwendungwas Sie auch berühren, berührt nicht Ihren VaPro Einmalkatheter.
Alle VaPro Katheter verfügen über eine Schutzhülse und eine sterile Folienumhüllung. Für Schutz durch 100% berührungsfreie Anwendung. Mehr unter www.hollister.ch.

Berührungsfreie, hydrophile Einmalkatheter

UNSERE HELFER
Die Sensibilisierungskurse der SPV sind nach wie vor sehr gefragt. In drei bis vier
Modulen erfahren die Teilnehmenden mehr über das Leben im Rollstuhl.
Von Gabi Bucher
Um ein authentisches Erlebnis zu garantieren, leiten Rollstuhlfahrer die Sensibilisierungskurse. Mathias Studer, 36, Tetraplegiker, ist einer dieser Referenten. Anlässlich eines Feierabendbiers habe Harry Suter, Lebensberater der SPV, ihn gefragt, ob er mitmachen möchte. «Das wäre doch was», habe er gedacht. Seither informiert und sensibilisiert er Gruppen für die Belange der Rollstuhlfahrer.
Cool im Stuhl

Die Anfragen für solche Kurse kommen von unterschiedlichsten Organisationen: Kirchgemeinden, Firmen, Berufsschulen, Vereine usw. Mathias begleitet vor allem die jährlichen Kurse der Lehrlinge der Verkehrswegbauer und der angehenden FAGEs der XUND (Bildungszentrum Gesundheit Alpnach). Die Ausbildungsrichtung dieser zwei Gruppen könnte nicht unterschiedlicher sein, aber für die einen wie die anderen ist es oft das erste Mal, dass sie mit einem Rollstuhlfahrer konfrontiert werden. «Nach einer Lektion Rollstuhlhandling mit Lernenden habe ich jeweils fast einen Tinnitus», erzählt er lachend. «Anfänglich finden sie es cool im Rollstuhl, wenn es dann später darum geht, einen Randstein oder eine Stufe zu bewältigen, wird es oft laut.»
Da sei ein gewisser Spassfaktor dabei, gibt er zu. «Das darf durchaus sein. Wenn ich ihnen dann aber sage, sie dürften eine Stunde lang nicht aufstehen, fangen sie an, den Ernst der Lage zu erfassen.» Und wenn das Gelände uneben werde, kämen auch starke Jungs an ihre Grenzen. «Das ist ja überhaupt nicht lustig», habe mal einer
fast etwas aufgebracht gesagt. Und wenn er dann noch erzähle, wie eingeschränkt manche Tetraplegiker seien, dass sie sich weder um die eigene Körperpflege kümmern, noch selber essen, nicht mal sich selber kratzen könnten, da würde es jeweils ziemlich ruhig. «Einer hat mal ganz entsetzt gefragt: «Also die ganze Zeit, den ganzen Tag?» «Einige realisieren erst an einem Kurs, dass so eine Querschnittlähmung für immer ist und man nicht einfach am Freitag um 17.00 Uhr ausstempeln und Wochenende machen kann», meint Mathias lachend.
Viel geht, aber anders
Auch im Modul «Fragerunde» gehe es manchmal ziemlich hoch her. Wenn mal das Eis gebrochen sei, kämen die unterschiedlichsten Fragen, und oft sei die Zeit viel zu schnell um. Mathias ist ein sehr positiver Mensch und vermittelt den Kursteilnehmenden immer wieder und mit
Nachdruck, dass eine Querschnittlähmung nicht das Ende des Lebens sei. Er selber hat sehr viel Selbstständigkeit zurückerlangt nach seiner Rehabilitation. «Sie ist mein höchstes Gut», sagt er. «Es ist auch nicht so, dass nichts mehr geht, aber es geht anders. Es braucht nur einiges an Zeit und Geduld, um zu erkennen, wie sich die verbleibenden Möglichkeiten am besten nutzen lassen.»
In diesen Kursen sieht Mathias die Möglichkeit, ein Bewusstsein zu schaffen für alltägliche Probleme. Da fügt er dann gerne das Beispiel jenes Autofahrers an, der seinen Smart auf einem Rollstuhlparkplatz zwischen zwei Autos von Rollstuhlfahrern parkiert habe, weil diese je rechts und links eine Lücke gelassen hatten.
Wir danken Mathias und allen anderen Referentinnen und Referenten für ihre engagierte Mitarbeit in diesen Kursen.
Infos zu Sensibilisierungskursen www.spv.ch (Kultur und Freizeit)
Verkehrswegbauer im Rollstuhl unterwegs

Das SPZ baut aus. Die Bettenzahl wird von 150 auf 190 erhöht. Ein erster Teil wurde in Betrieb genommen. Wir haben mit Direktor Hans Peter Gmünder über das Projekt gesprochen.
Von Evelyn Schmid und Felix Schärer
Vor Kurzem hat das Schweizer Paraplegiker-Zentrum neue Operationssäle (OPS) und eine vergrösserte Intensivstation (IPS) in Betrieb genommen. Weitere Gebäude sind in Bau. Ein Projekt, das viele interessiert und bewegt.
Hans Peter Gmünder, die neue Klinik wird von 150 auf 190 Betten ausgebaut. Weshalb vergrössert man das Spital? Es gab zwei Überlegungen. Wenn wir unseren Querschnittgelähmten eine Top-Wirbelsäulenchirurgie anbieten wollen, dann brauchen wir eine ausreichend grosse Anzahl an Operationen von Querschnittge-
lähmten und Nicht-Querschnittgelähmten. Nur dann finden wir einen Top-Chirurgen. Voraussetzung dafür ist wiederum eine erstklassige Infrastruktur. Ist das erfüllt, stimmt die Qualität und es rechnen sich die Investitionen in die Infrastruktur.
Der zweite Aspekt betrifft den Erhalt der bestehenden Gebäude. Die Klinik ist in weiten Teilen fast 30 Jahre alt. Wir wussten, dass da Kosten auf uns zukommen. Dann war da noch das Thema Starkstrom. Das Starkstrominspektorat muss uns eine Bewilligung für die IPS und OPS geben. Die hätten wir ohne Erneuerung nicht mehr er-


halten. Auf dieser Grundlage haben wir erste Kalkulationen gemacht für eine Erneuerung ohne Vergrösserung. Gleichzeitig haben wir uns die strategische Frage gestellt, ob wir damit auch für die Zukunft gerüstet wären.
Wir haben überlegt, ob wir weiterhin Rehabilitation und Akutmedizin mit Intensivstationen und Operationssälen brauchen. Oder machen wir nur noch Rehabilitation. Etwas zwischendrin, zum Beispiel mit zwei kleinen Operationssälen und einer kleinen IPS, das geht nicht, dafür findet man keine top ausgebildeten Mediziner. Das haben wir mit dem Stiftungsrat diskutiert.
Und welche Meinung hat der Stiftungsrat vertreten?
Das Gros der Querschnittgelähmten sagt, dass sie alles unter einem Dach haben wollen. Das hat der Stiftungsrat berücksichtigt, schliesslich ist dies die Philosophie von Guido A. Zäch. Der Patient soll nicht an drei oder vier Orten behandelt werden. Und wenn man eine gute Wirbelsäulenchirurgie und eine gute Akutmedizin will, dann musste es einen Ausbau von 145 auf mindestens 170 Betten mit einer deutlich grösseren und modernen Intensivstation und einer neuen OP-Plattform geben.
Dann haben wir mit der Planung begonnen. Wir wollten keine Provisorien für die Patientenzimmer. Es sollte ein Trakt gebaut und dann komplett von den Abteilungen eines alten Traktes bezogen werden, der da-

nach erneuert wird. Dabei kam die Diskussion in eine neue Phase. Wir überlegten, wie gross der Neubau sein sollte: 2, 3, 4 Stockwerke? Wenn wir die 170 Betten so realisiert hätten, wäre nach allen Rochaden ein Stockwerk übrig geblieben. Das hätten wir als Reservestation behalten können.
Das hat man anders entschieden, oder? Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir analysiert, wo genau unsere Querschnittgelähmten akutmedizinisch behandelt werden. Das heisst nicht in der Erstrehabilitation, sondern später, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung. Diese landen überwiegend in den Kantonsspitälern. Datenanalysen zeigten, dass nur rund ein Viertel, oder sogar weniger, dieser akutmedizinischen Patienten zu uns kommen. Dabei ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen: Von 5000 Querschnittgelähmten werden nur 900 bei uns behandelt. Wir haben uns deren Diagnosen angeschaut und gesehen, dass es viele Harnwegsinfekte, Lungenentzündungen, Knochenbrüche, Thrombosen, Dekubitus und ähnliches sind. Also nichts, das eine hoch spezialisierte Medizin benötigt, wie zum Beispiel die Herzmedizin mit Herzkatheterlabor und Herzchirurgie. Es sind in Verbindung mit der Querschnittlähmung komplexe medizinische Themen, mit denen wir bestens vertraut sind. Deshalb sind wir nochmals über die Bücher.
Mit welchem Ergebnis?
Von diesen rund 4000 Patienten können, ja müssen wir einen Teil hierherholen.
Dazu haben wir die Reservestation neu analysiert. 600 bis 700 Querschnittgelähmte mit akutmedizinischen Erkrankungen könnten wir mit den zusätzlichen 20 Betten jährlich behandeln. Aber dazu muss man Akut- und Notfallmedizin auf höchstem Niveau anbieten und die Rehabilitation und Akutmedizin räumlich, organisatorisch und ein Stück weit eben auch fachlich trennen und dadurch beide Bereiche weiter professionalisieren. Der renovierte alte Teil wird die Rehabilitation beherbergen und der Neubau die Akutmedizin.
Sie nehmen künftig also anderen Spitälern Patienten weg?
Genau. Aber wir können die Querschnittgelähmten besser behandeln, weil wir Akutund Querschnittmedizin optimal kombinieren. Wir bieten dem Patienten etwas, was andere Kantons- oder Unispitäler nicht können.
Werden die Prozesse nach dem Neubau noch die gleichen sein?
Aktuell haben wir vor allem drei medizinische Kernprozesse: die Querschnittmedizin, die Rückenmedizin und die Beatmungsmedizin. Wenn ich die Klinik nach diesen medizinischen Feldern streng prozessual aufbaue, brauche ich in allen drei Bereichen eine Intensivstation, Operationssäle und eine Rehabilitation. Wenn ich aber nach Akutmedizin und Rehabilitation trenne, dann kann ich im Akutbereich Unterschiedliches machen, z. B. die Erstversorgung nach einem Unfall, die Ent-
wöhnung von beatmeten Patienten oder eine akute Lungenentzündung behandeln. Als dritter Teil kommt noch die lebenslange Versorgung dazu, die machen wir wie bisher vor allem ambulant.
Die Ärzte sind zwar bestmöglich einem dieser drei Bereiche zugeteilt. Ein Urologe beispielsweise muss aber überall arbeiten. Der Sportmediziner oder Lungenspezialist auch. Es interessiert einen Patienten wenig, welchem Bereich ein Arzt zugeordnet ist. Er will einfach jederzeit die beste Versorgung und dafür brauchen wir eine optimale Vernetzung der Spezialisten.
Wie hat man die verschiedenen Interessengruppen in die Planung eingebunden?
Es gab zahlreiche Gremien, Nutzersitzungen und Workshops. Wichtig waren auch die drei Testzimmer. Die haben wir 2011 oder 2012 gebaut und über Jahre im Betrieb getestet. Sie waren mit unterschiedlichen Schränken, Raumaufteilungen, technischen Einrichtungen und Badezimmern ausgestattet. Neben den Patienten haben wir auch die Pflege immer wieder befragt. Und wissen Sie, was dabei rausgekommen ist? Die alten Zimmer haben am besten abgeschlossen. Ist doch schön zu wissen, dass das, was schon fast 30 Jahre im Einsatz ist, einfach gut ist. Daher haben wir in den Zimmern einerseits nur «kosmetische» Renovationsarbeiten gemacht, beispielsweise die Böden und Wandbeläge erneuert, andererseits eine fast komplette technische Erneuerung durchgeführt und Kühldecken mit Seewasserkühlung eingebaut. Vieles ist noch original von 1990. Aus Respekt vor dem Bestehenden sind wir so vorgegangen, obwohl es manchmal einfacher gewesen wäre, etwas Neues reinzustellen.
Diskutiert haben wir mit den Betroffenen auch die Frage, ob Vierbettzimmer gut sind, oder ob Zweibett- und sogar Einbettzimmer Vorteile hätten. Aber es kam nichts Schlüssiges raus. Den einen war der Austausch wichtig, die anderen wollten Privatsphäre. Das ist nachvollziehbar. Frischverletzte wollen nämlich eher alleine sein, in der späten Phase der Reha suchen sie dann mehr soziale Kontakte.
Händler in Ihrer Nähe: www.swisstrac.ch

Das Logo von Rolland Bregy drückt anders als viele Rollstuhlpiktogramme Dynamik und Modernität aus. Es zeigt den Rollstuhlfahrer als aktiven Menschen in Bewegung.







Sie erhalten die schönen Aufkleber bei der Schweizer ParaplegikerVereinigung. Informieren Sie sich auf www.rolliwelt.ch über das gesamte Angebot und die Bestellmöglichkeiten.


Telefon 062 751 43 33 www.reha-hilfen.ch info@reha-hilfen.ch
Reservieren Sie sich einen Termin für eine unverbindliche Probefahrt
Stricker-Rollstuhlbikes
Sport- und Leichtrollstühle, Aufricht- und Elektrorollstühle, Zug- und Schubgeräte für Rollstühle, Scooter, Gehhilfen, Badehilfen, Bewegungstrainer etc.
Reha Hilfen AG 4800 Zofingen 5405 Baden-Dättwil

Wir erleichtern Ihnen das Leben. Mit Sicherheit. Kontinenzversorgung ist Vertrauenssache. Wir bieten Ihnen dazu seit über 19 Jahren Kompetenz, erstklassige Produkte und persönlichen Service. Damit Sie sicher und mit Leichtigkeit das Leben geniessen können. Wir sind für Sie da.
041 360 25 44 info@orthomedica.ch
Ortho Medica AG Grabenhofstrasse 1 Postfach 2242
6010 Kriens 2
Tel 041 360 25 44
Fax 041 360 25 54 www.orthomedica.ch
Wie gross war der Einfluss des Architektenteams von Hemmi Fayet?
Das Architekturbüro hat schon früher verschiedene kleinere Projekte auf dem Campus Nottwil gemacht. Sie verstanden dadurch unsere Prozesse rasch. Mir ist vor allem ein Moment in Erinnerung, als Projektleiter Serge Fayet zu uns und dem Verwaltungsrat gesagt hat: «Ich baue für euch eine Maschine; eine Maschine, die funktioniert.» Was er damit sagen wollte ist, dass ein Spital nicht primär schön sein muss. Klar soll das Gebäude schön ausschauen, aber es soll vor allem bestmögliche Rahmenbedingungen für unsere Prozesse bieten.

Die neuen Operationssäle und die Intensivstation sind nun schon seit ein paar Monaten in Betrieb. Haben sie sich bewährt?
Ja, definitiv. Neben der verbesserten technischen Einrichtung überzeugen die moderne Lichttechnik und die Fensterfronten vom Boden bis zur Decke. Wir haben hervorragende Rahmenbedingungen für Operationen und bessere Apparate. Jetzt gibt es die Möglichkeit der CT-gesteuerten Navigation, was noch mehr Sicherheit und Präzision für den Chirurgen bringt. Auch die Raumaufteilung ist optimal. So sind die Zimmer, in denen der Patient auf den Eingriff vorbereitet wird, am richtigen Ort. Auch der direkte Übergang zur Intensivstation ist ideal.
Auf der Intensivstation haben wie in den Operationssälen alle Zimmer wandhohe Fensterflächen. So kann der Patient am Leben draussen teilhaben. Früher hatten nicht alle Zimmer Tageslicht. Es hat mehr Flä-
che, das Personal hat mehr Platz. Und die Arztvisiten können dank Erkern teilweise von ausserhalb des Zimmers gemacht werden. So sieht man den Patienten und hat durch Monitore die wichtigsten Informationen im Blick. Wir stören die Personen im Zimmer nicht mit unseren Diskussionen. Nun gehen wir erst zum Patienten ins Zimmer, wenn wir die wichtigsten Punkte besprochen haben und geben gezielt Informationen. Dann gibt es neu einen «Wintergarten», den Angehörige und IPSPatienten nutzen können und trotzdem überwacht sind.
Gibt es auch negative Punkte?
Die Wege sind viel weiter. Den Patienten stört das nicht, aber das Personal teils schon. Da die Station grösser ist und die Pflegefachpersonen in den Patientenzimmern meist hinter geschlossenen Türen arbeiten, begegnet man sich weniger und anders als früher. Für Sozialkontakte sorgen wir nun mit angepassten Aufenthaltsbereichen. Dafür haben wir im Logistikbereich, bei den Lagerräumen, einen grossen Schritt nach vorne gemacht und viel automatisiert, was Arbeit und Wege spart. Aber auch hier muss man sich erst einmal an ein neues Ordnungssystem gewöhnen.
Es gab auch Kritik, zum Beispiel zum Umzug der Sportmedizin. Weshalb kommt die vom GZI ins SPZ? Die Sportmedizin ist ein Teil der Rehabilitation und der ambulanten Medizin, die beide hier im Gebäude sind. Im SPZ hat die Sportmedizin direkten Zugang zur Diagnostik, zum Röntgen. Es gibt eine engere Verzahnung mit der Paraplegiologie, der Rehabilitation. Wir errichten zudem eine medizinische Trainingstherapie mit vielen neuen Apparaten. Da ergeben sich Synergien durch weniger Doppelanschaffungen.
Dann gab es Kritik an der Atmosphäre der neuen Gebäude. Wie stehen Sie dazu? Die kann ich nachvollziehen. Es gibt ein Gestaltungskonzept, das wird aber erst noch umgesetzt. Die Möblierung ist noch nicht fertig, weil vieles noch fehlt oder mit dem bisherigen Mobiliar bestückt wurde. Es hat noch keine Bilder, keine Pflanzen. Ich freue mich beispielsweise auf Foto-
galerien sowie Mooswände und Mooskugeln, die wir als natürliche Elemente einsetzen werden. Jetzt schaut es teilweise kalt und leer aus. Es wäre schön, wenn man erst 2020 eine Bilanz ziehen würde. Ich bin überzeugt, dass dann die Begeisterung für das Neue gross sein wird. Doch die Entwicklungen und Verbesserungen werden danach weitergehen. So eine Klinik ist nie fertig, das ist der «Spirit von Nottwil».
Welche Projekte stehen nun noch an? Ende 2019 werden die meisten Abteilungen am richtigen Ort sein. Es fehlt dann noch die Sportmedizin, die kommt ganz am Schluss. Fehlen tut auch noch der Multispace für Management und Medizin. Die Klinik wird immer grösser. Wir begegnen uns nicht mehr einfach so. Heute muss ich manchmal lange auf einen Termin warten, um eine kleine Frage mit jemandem zu klären. Gehe ich aber in so ein Grossraumbüro, dann sind die Wege kurz. Aber jeder muss ein Gespür entwickeln, wen ich wann ansprechen kann. Auch ich werde dort einen Arbeitsplatz haben und freue mich darauf!
Dann entsteht auch der neue Therapietrakt, in welchem wir auf drei Stockwerken stärker thematisch und interprofessionell arbeiten. Und nicht mehr in Physio- und Ergotherapie sowie räumlich durch geschlossene Stockwerke getrennt, sondern verbunden durch ein grosses Atrium und verglaste Deckenöffnungen. Dann kommt die ganze Aussengestaltung, zum Beispiel die Gartentherapie und Freizeitmöglichkeiten. Zudem wird es einen «Weg der Hoffnung» geben, der durch die Klinik und aussen wieder herum geht. Dieser bietet eine Möglichkeit zur Reflexion. Im Frühling 2020 sind wir dann ganz fertig. Das ist eine lange Zeit und nicht immer einfach für das Personal. Aber unsere Mitarbeitenden machen das hervorragend und professionell.
Zur Person Hans Peter Gmünder ist seit 2011 Direktor des Schweizer ParaplegikerZentrums, 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern.
QUERSCHNITTGELÄHMTE DES JAHRES
Bereits zum 26. Mal hat die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) zwei Querschnittgelähmte in Nottwil geehrt.
Von Gabi Bucher
Der Thuner Unternehmer Max Jung und die neugewählte Kantonsrätin Manuela Leemann aus Zug wurden am 9. Dezember 2018 in Nottwil zu den Querschnittgelähmten des Jahres 2018 gewählt.
Geboren: 3. Dezember 1952
Behinderung: Paraplegiker
Beruf: gelernter Feinmechaniker, Geschäftsführer Hobbys: Fitness, Handbike fahren, Alphorn spielen, alte Uhren reparieren
Max Jung wurde zum Querschnittgelähmten des Jahres 2018 gewählt als Würdigung für sein Lebenswerk. Er hat eine unglaubliche Schaffenskraft an den Tag gelegt und mit seinem Ideenreichtum und seinen Innovationen nicht nur seine, sondern auch die Lebensqualität und Selbstständigkeit zahlreicher anderer Betroffener massgeblich gesteigert.
Max wuchs in Bern auf mit den Brüdern Peter und Hene. Er war äusserst sportlich und bewegte sich gerne und viel. Schier alles musste ausprobiert werden, sogar als Klippenspringer setzte er sich in Szene. Nicht weiter verwunderlich, war er doch ein passionierter Kunstturner. Sein Leben veränderte sich grundlegend vor 50 Jahren, genauer gesagt im September 1968. Max führte eine Trainingsübung am Reck aus,
sie missglückte und er prallte unsanft am Boden auf. Er turnte damals auf sehr hohem Niveau, war talentiert und motiviert, da bleibt man nicht liegen. So stand er sofort wieder auf, aber nur kurz. Danach verbrachte er lange Zeit im Gips.
Rückschläge als Motivation
Die Lehrzeit absolvierte er in einem kleinen feinmechanischen Betrieb. In dieser Zeit zeigten sich erneut Lähmungserscheinungen, er wurde ins Inselspital eingeliefert und musste ab diesem Zeitpunkt ein schweres Korsett tragen. Bei einem unglücklichen Sturz 1974 verletzte er seine rechte Schulter schwer. Von da an arbeitete er in der Behindertenwerkstatt Bandgenossenschaft in Bern. So richtig heimisch fühlte er sich dort aber nicht, bereitete sich in seiner Freizeit auf die Selbstständigkeit vor und realisierte diese im Frühjahr 1978. Da er sein Leben vermehrt im Rollstuhl verbringen musste, weil die Lähmungserscheinungen immer stärker wurden, sollten diese Vehikel auch bequemer, wendiger und leichter werden. Er eröffnete seine eigene Firma für Hilfsmittel. Die bittere Konsequenz: Die IV unterstützte ihn fortan nicht mehr. Die Firma wuchs und vergrösserte sich. Im Jahr 2001 wurde sie zu einer Aktiengesellschaft. Nebst eigenen Rollstühlen entwickelte Max einen Duschrollstuhl, einen Sitzneigestuhl, ein Handkurbelgerät, Spezialbremsen und vieles mehr.
Gesundheitliche Probleme in den letzten zehn Jahren mit praktisch jährlichen Aufenthalten im SPZ zwangen ihn, 2013 seine Firma abgeben. Sie läuft jedoch unter seinem Namen erfolgreich weiter und er arbeitet teilweise immer noch mit.

Zu Hause im Norden und Süden Max lernte Barbara kennen (liebevoll Bärbeli genannt) und heiratete sie im Mai 1978. Zusammen mit ihr geht er gerne auf Reisen: Griechenland lockt die beiden seit über 30 Jahren. Aber auch an der Nordsee fühlen sie sich heimisch. Und selbst in der Winterzeit, wo doch Schnee, Eis und Kälte nie Freunde werden mit dem Rollstuhl, wagt sich Max mit geeigneten Hilfsgeräten nach draussen! Daneben spielt er leidenschaftlich gerne sein Alphorn und repariert mit Freude und Hingabe alte Uhren.
Max Jung musste sich seit seinem Unfall 23 Operationen unterziehen. Diesen stellte er sich mit einer unglaublichen Gelassenheit. Das erforderte seine ganze Energie, beeinträchtigte aber seinen Humor nicht. Diese Haltung macht aus Max Jung einen speziellen Menschen, wie Heinz Frei in seiner Laudatio bestätigt: Mit ihm in lockerer Atmosphäre Zeit verbringen zu dürfen, ist für jeden ein Glücksfall. Trübsal und Selbstmitleid haben keinen Platz. Max Jung geniesst stets die schönen Seiten des Lebens.
MANUELA LEEMANN
Geboren: 23. August 1981
Behinderung: Tetraplegie
Beruf: Rechtsanwältin, derzeit als Juristin tätig
Hobbys: Reisen, Handbike, Tischtennis, Rollstuhlrugby, feines Essen
Zum Zeitpunkt, als Manuela Leemann für die Auszeichnung als Querschnittgelähmte des Jahres nominiert wurde, wusste noch niemand von ihrer glänzenden Wahl in den Kantonsrat des Kantons Zug und der gleichzeitigen Wahl in das Parlament der Stadt Zug am 7. Oktober 2018. Umso herzlicher gratulierte Guido A. Zäch der jungen Frau in seiner Laudatio.
Manuela erlebte eine glückliche Kindheit mit ihren Geschwistern Harry, Angelika und Rainer in Zug. Sport treiben war der Familie wichtig, Manuela spielte Volleyball, Handball, Tennis und fuhr auch sehr gut Ski. Dann, vor 21 Jahren, verunfallte sie bei einem Wettkampf ihres Skiclubs. Die Diagnose: Tetraplegie. Manuela war gerade mal 16 Jahre alt.
Kampf gegen die Abhängigkeit
Mit Eifer trainierte und kämpfte die sportliche Manuela in der Rehabilitation mit aller Kraft gegen die Abhängigkeit, die sie richtiggehend nervte und liess sich schon früh alle Tricks zeigen, um die bestmögliche Selbstständigkeit trotz ihrer hohen Lähmung zu erreichen. Nach neun Monaten Erstrehabilitation konnte sie in ihre Klasse zurückkehren. Nach erfolgreich bestandener Matura am Gymnasium Zug entschied sie sich für ein Jus-Studium in Fribourg. Vier Jahre lebt sie während der Woche in einem Foyer nahe der Universität, dies dank fachkundiger Pflegeassistenz. Sie schloss das Jus-Studium mit Zusatz Europarecht in der kürzest möglichen Zeit mit hervorragendem «cum laude» im Master-Examen ab. Nach Praktika beim Kantonsgericht, beim Strafgericht und in einer Anwaltskanzlei in Zug bestand sie das Rechtsanwalts- und Notariatspatent des Kantons Zug. Danach arbeitete sie als Gerichtsschreiberin beim Verwaltungsgericht Luzern.

Respektables Pensum
Für ein weiteres Studienjahr flog sie nach Brisbane in Australien. Sie schloss das Zusatzstudium auf Englisch mit dem Master of Laws LL.M. in Australischem
Recht, Wirtschaftsrecht und Sportsrecht ebenfalls glänzend ab. Im Herbst 2013 begann sie bei der Direktion des Innern in Zug als juristische Mitarbeiterin. Die Möglichkeit, etwas zu leisten, sich zu bewähren, das ist für Manuela Leemann enorm wichtig. Zu dieser Leistung gehört auch eine eigene Wohnung und die möglichst selbstständige Organisation ihres Arbeitsalltages. Hier wird sie unterstützt durch ihren Partner und Pflegeassistenz. Der 24-StundenSpitex-Dienst, den Zug inzwischen anbietet, ist dabei ein grosser Fortschritt und gibt ihr Flexibilität. Zusätzlich zum respektablen Berufspensum war und ist Manuela Leemann vielseitig engagiert in diversen Kommissionen, Arbeitsgruppen und Vorständen. Unter anderem ist sie Mitglied der Begleitgruppe Sozialpolitik der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung.
Durch ihren Einsatz will Manuela Leemann bessere Voraussetzungen für das öffentliche Leben von Menschen mit Behinderung schaffen und die Chancengleichheit fördern. Trotz ihrer schweren Behinderung stellt sie sich mutig neuen Herausforderungen und geniesst das Leben in seiner ganzen Fülle. Sie sieht immer das Licht am Ende des Tunnels. Diese positive Lebenseinstellung ist Ansporn für uns alle und verdient hohe Bewunderung und Anerkennung.

Herzliche Gratulation
Die Schweizer ParaplegikerVereinigung gratuliert den beiden Querschnittgelähmten des Jahres 2018 und bedankt sich für das grosse Engagement zugunsten aller Rollstuhlfahrer.

Seit gut zwanzig Jahren unterstützt Iris Fuchser ihre Kolleginnen und Kollegen im Rollstuhlsport.
Von Gabi Bucher
Iris Fuchser ist sozusagen eine Wiederholungstäterin. Sie ist – mit Unterbrüchen –drei Mal in die Schweizer ParaplegikerGruppe eingetreten. Nach einer Banklehre arbeitete sie zuvor bei der Schweizerischen Volksbank, der heutigen Credit Suisse. Ihre erste Stelle trat sie 1998 in der Abteilung Rollstuhlsport an. Dort kümmerte sie sich während rund drei Jahren um die Organisation der Auslandwettkämpfe. Budget und Abrechnungen gehörten ebenfalls zu ihrem Gebiet. Dann ist sie auf eine Weltreise mit ihrem heutigen Ehemann aufgebrochen.
Rollstuhlsport zum zweiten
Nach der Reise kehrte sie nach einem kurzen Gastspiel beim Schweizer Schiesssportverband zurück in die Schweizer Paraplegiker-Gruppe als Sachbearbeiterin Orthopädie und Rehabilitationstechnik bei der Orthotec. Als ihre Nachfolgerin im Rollstuhlsport kündigte, bot ihr der damalige
Bereichsleiter RSS, Ruedi Spitzli, die Stelle wieder an. «Zuerst habe ich abgelehnt, ich meinte, zurückkommen sei nie gut.» Die Arbeit damals habe ihr enorm gut gefallen. «Eine gewisse Erwartungshaltung war da, ich hatte etwas Bedenken, es habe sich vielleicht zu viel verändert.» Es hat ihr aber keine Ruhe gelassen. Das tolle Team und die interessante Arbeit lockten sie und so kehrte sie 2003 zurück und kümmerte sich wieder um denselben Arbeitsbereich wie vor ihrem Weggang.
Am Ball bleiben
Ein erstes Kind kündigte sich an. Nach dessen Geburt 2006 hat Iris ihr Pensum auf 20% reduziert. Dies blieb auch so nach der Geburt des zweiten Kindes. Aber Kinder werden bekanntlich älter und Iris hatte wieder mehr Kapazität. Heute kümmert sie sich in ihrem 40 %-Pensum um die Abrechnungen der Inlandkurse der Technischen
Kommissionen. Sie erledigt Spesenauszahlungen und Honorare für die Kursleiter und unterstützt den Bereich Nachwuchs bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Zudem ist sie für die Organisation der Ausbildungs- und Weiterbildungskurse der Abteilung und die Kursauswertungen zuständig. Die laufen über SurveyMonkey und MailChimp. «Leicht gewöhnungsbedürftig für jemanden wie mich», erklärt sie. «Ich bin etwas altmodisch und darum relativ papierlastig, aber so bleibe ich am Ball.» Und dann ist da noch die ziemlich aufwändige und etwas langatmige Abrechnung fürs Bundesamt für Sozialversicherungen. «Reine Fleissarbeit», sagt sie. Aber generell sei ihr Arbeitsbereich spannend und sie schätze es sehr, wie selbständig sie arbeiten könne.
In ihrer Freizeit spielt Iris gerne Alphorn, jasst, backt und freut sich immer über ein feines Essen mit Freunden oder der Familie. Auch ist sie viel an den Fussballspielen ihrer beiden Jungs anzutreffen. Überhaupt geht sie gerne an Sportveranstaltungen.
Iris hat so die eine oder andere kleine Eigenart. So reserviert sie sich jeweils etwas von den zahlreichen SPV-Znüni, da sie vor dem Mittag nichts Süsses essen kann. Ein bisschen schusselig sei sie auch, gibt sie selber zu, besteigt falsche Züge und nimmt falsche Jacken mit nach Hause. Und ab und zu tritt sie in Fettnäpfchen, tut dies aber auf eine so charmante Art, dass man ihr nie böse sein kann.

X-TREME INNOVATION: BEREITS AKTIVIERT UND SOFORT EINSATZBEREIT

Für Ihre Unabhängigkeit - schnell, einfach und sicher anzuwenden Das neue außergewöhnlich clevere Kathetersystem ist nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Ausgestattet mit unserem SafetyCat Sicherheitskatheter mit innen und außen weich gerundeten Soft Cat Eyes, der flexiblen Ergothan-Spitze und der neuen, bereits aktivierten Beschichtung, ermöglicht der Liquick X-treme eine behutsame und schonende Katheterisierung.
Testen Sie jetzt die neue Katheterinnovation von Teleflex. Kostenlose Muster und weitere Produktinformationen erhalten Sie bei:





Der Octane Sub4 setzt im Bereich der Adaptivrollstühle neue Massstäbe. Leistung und Technik auf höchstem Niveau –bis ins kleinste Detail.
Das klassische Design haben wir neu definiert und weiter verfeinert, indem wir die Sub4-Technologie mit einem handgefertigten, massgeschneiderten Titanrahmen (Titan Grad 9) kombiniert haben. Das Ergebnis: Ein ultraleichter, äusserst stabiler Rollstuhl.
TITAN GRAD 9: – TOPP FESTIGKEITS-/GEWICHTSVERHÄLTNIS – SANFTES FAHREN – KEINE KORROSION – LANGLEBIG



