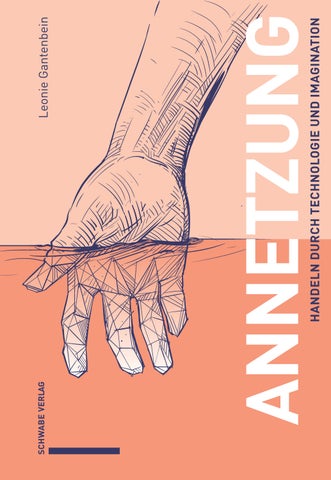Leonie Gantenbein
Annetzung
Handeln durch Technologie und Imagination
Schwabe Verlag
Doktortitel im Jahr 2024 vergeben von der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern. Betreut durch die Gutachter Prof. Dr. Martin Hartmann und Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger der Universität Luzern.
Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.
Open Access:Wonicht anders festgehalten, ist diese Publikationlizenziertunter der Creative-CommonsLizenz Namensnennung, keine kommerzielleNutzung, keine Bearbeitung 4.0 International (CCBY-NC-ND 4.0)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Leonie Gantenbein, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages.
Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Abbildung Umschlag:Isuru Sandeep
Korrektorat:Constanze Lehmann, Berlin Cover:icona basel gmbh, Basel
Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Prime Rate Kft., Budapest
Printed in the EU
Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7965-5359-2
ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5360-8
DOI 10.24894/978-3-7965-5360-8
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
14.3.1.
15.1.
15.2. Weltwechsel
Vorwort und Dank
Ich schreibe aus der Sicht einer Philosophin, eines Millennials und einer Gamerin. Mit allen nach 1990 Geborenen gehöre ich zu den born-digital kids,die zusammen mit dem Internet und den Smartphones gross geworden sind. Ich tauschte mein Spielzeugauto gegen eines der ersten Nokia-Handys ein und spiele seitdem fast täglich Videospiele. Zuvor und während meiner Kindheit haben meine Eltern sich selbstständig gemacht und unter anderem Kurse mit Mindmachines im Bereich der Out-of-Body-Experience angeboten. Durch unsere Wochenendausflüge zu Kraftorten und Channeling-Demonstrationen beschäftigte mich schon früh und existenziell die Frage, ob es mehrere Realitäten gibt, was ihr Unterschied zur Fiktion ist und wann eine solche Unterscheidung überhaupt objektiv oder sinnstiftend ist. Bis heute balanciere ich zwischen verschiedenen Glaubensinhalten und habe gelernt, dass kritisch zu sein und kritisch zu bleiben, bedeutet, Denkunruhen auszuhalten. Die Übersetzungsleistung zwischen Weltansichten und damit auch zwischen Sprachen und Denkstilen besteht darin, sie jeden Tag neu zu erbringen. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie wurde das mittlerweile von mir lieb gewonnene Burning Man in Nevada online abgehalten. Das Gesellschaftsexperiment der Popup-City wurde damit 2020 und 2021 mit Computern erbaut und nur in kleinem Rahmen lokal abgehalten. Auch wenn ich meinen Avatar gestalten konnte, auf einer riesigen digitalen Karte über den ausgetrockneten Salzsee spazierte, während ich Leute kennenlernte, und es sich dann und wann tatsächlich so anfühlte, als wäre man vor Ort, wurde mir deutlich:Eshandelt sich für mich, wie auch beim Mind-Wandering,nicht nur um eine abstrahierte Form eines bestimmten Ortes, sondern vielmehr um etwas anderes, etwas Neues. Und mir fehlten die passenden Begriffe, um den Unterschied zwischen beiden Orten und den dort gemachten Erfahrungen zu beschreiben.
Viele Gedanken im Zusammenhang dieses Projekts sind damit schon seit frühester Kindheit in mir angelegt:Wie wir Orte und damit räumliche Systeme wahrnehmen, seien es Orte der eigenen Vorstellungskraft, durch technologische Hilfsmittel generierte Welten oder ein Teil von beidem –sogenannte Weltwechsel sind etwas Individuelles, Intimes und gehen unter die Haut. Erfahrungen, die wir in solchen Systemen machen, sind emotional und nicht selten Grenzerfahrungen. Mit diesem Hintergrund ist es für mich schon lange ein Bedürfnis, alle diese Systeme (Träume, Vorstellungen, Gedanken mit oder ohne technologische
Prothesen und computergenerierte Räume), in denen wir interaktiv sein und Erfahrungen machen können, einander gegenüberzustellen. Welches Wissen wir in solchen Systemen schöpfen, wie wir dies tun und welche Handlungsreichweiten und Verantwortungen damit verbunden sind, ist bis heute ein offenes Feld, auf das ich mich hiermit nun einlassen möchte.
Für die Umsetzung bin ich einer Reihe von Freunden und Kollegen zu Dank verpflichtet. Ich danke meinem Partner Leander Gantenbein für seine Unterstützung und dafür, dass er mir immer wieder während meiner weitläufigen Forschungsreisen, der Covid-19-Pandemie und nicht zuletzt anlässlich des Burning Man Festivals aufgezeigt hat, wie real das Computergenerierte tatsächlich sein kann. Meinem Vater Adolf Mathis danke ich für die unendlich vielen und langen Gespräche über diese Themen. Ein besonderer Dank geht ausserdem an meinen besten Freund John Schmid –der mir immer wieder Mut macht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich danke der Schmid Unternehmerstiftung für die grosszügige Unterstützung dieses Projektes.
Ich danke Prof. Dr. Martin Hartmann, meinem Doktorvater, der mich mit viel Vertrauen unterstützt hat, dieses Vorhaben trotz meiner Tendenz, manchmal wilde Wege einzuschlagen, umzusetzen. Ich danke meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Peter Kirchschläger, der sich täglich für die Ethik im Digitalen einsetzt, für den wertvollen Austausch. Ich danke meinen beiden Gast-Supervisoren für die Gastfreundschaft und die hilfreichen Diskussionen während meiner Forschungsaufenthalte an der New York University NYU und der University of Tokyo UTokyo:Prof. David Chalmers und Prof. Dr. Shinji Kajitani. Weiter danke ich für den Austausch und die anregenden Diskussionen des philosophischen Kolloquiums der Universität Luzern, dem philosophischen Department und der Graduate School in Art and Science sowie dem Virtual Reality Lab der NYU und dem University of Tokyo Center for Philosophy UTCP, dessen Mitgliedern und dem Zexaverse Tokyo. Namentlich möchte ich mich abschliessend für die wertvollen Gespräche bei folgenden Personen bedanken:Akihiro Miyata, Koichiro Kokubun, Sho Saito, Rie Yamada, Satoko Akiba, Kohei Saito, Leila Cassim, Ren Nishina – Arigatou-gozaimasu! Ken Perlin, Nouriel Roubini, Liam Ryan, Ned Block, Jasmine Hediger, Franz Kalbermatten, Philipp Zeder, Silvan Bürgler und Leander Leuenberger – Thank you!
Mein Dank gebührt nicht nur Synergenten: Ich danke allen Konvergenten, Apparenten und Prothesen –und deren Entwicklern, die mir viele Stunden der Annetzung ermöglicht haben.
I. Einleitung
Die Welt ist nah und wir sind angenetzt.
Wir explorieren mit Robotern den Weltraum und die Tiefsee, Quarks und der Mikrokosmos sind uns durch technologische Prothesen und Simulationen näher gerückt, die Begegnung mit verstorbenen Angehörigen1 wird durch deren Avatare simuliert, in Real Dolls2 wird Software implementiert, mit Hologrammen werden Beziehungen geführt und digital werden Feste gefeiert und geheiratet. Der digitale Zwilling der Welt wird durch das Internet of Things immer reichhaltiger; der Handel mit Kryptowährungen, digitalem Eigentum und NFTs3 boomt. Immer mehr Bildungs- und Lerninhalte werden virtualisiert und gamifiziert, woraus neue Lernformen und Genres –wie die serious games –entstanden sind und weiter entstehen. Interaktive Museen, XR4-Technologien im Klassenzimmer und eine breite Bevölkerung erproben derzeit die ersten Prototypen einer generativen Sprach-KI5.Kinder und Wissenschaftler6 kommunizie-
1 Ein Studio in Seoul ermöglichte es durch eine Simulation einer Mutter, ihrer verstorbenen siebenjährigen Tochter zu begegnen und mit ihr zu sprechen. Anhand von Daten über das Aussehen, die Stimme und das Verhalten der Tochter wurde ein Avatar kreiert, der diese tief emotionale Begegnung ermöglichte. Siehe Vivestudio (o.A.): Vivestudio,verfügbar unter: https://www.vivestudios.com [15. 10. 2023]. Weitere ähnliche Beispiele werden im Kapitel 15.3. Weltnähe näher besprochen.
2 Es handelt sich dabei um menschlich aussehende, lebensgrosse Puppen, meist aus Silikon. RealDolls heissen auch die von Abyss Creations, LLC,inNevada hergestellten Sexpuppen.
3 NFT’s(engl. non fungible token) sind nicht ersetzbare (engl.: non-fungible), digital geschützte Objekte, mit welchen Handel betrieben werden kann.
4 XR ist ein Überbegriff aller immersiven Technologien, darunter fallen auch alle Technologien von virtual reality VR, augmented reality AR und mixed reality MR, die computergenerierte Umgebungen und Objekte herstellen und mit der gegebenen Welt kombinieren.
5 KI steht für künstliche Intelligenz. KI subsumiert eine Vielzahl von verschiedenen Technologien, die es Computern erlauben, menschliche Intelligenz zu imitieren mithilfe von machine learning ML, rollenbasierten Systemen, natürlichen Sprachmodellen (engl. natural language processing)NLP und computer vision. Deep learning DL gehört zum machine learning ML, basierend auf neuronalen Netzwerken.
6 In dieser Abhandlung wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Dies geschieht insbesondere deshalb, weil es oft auch um Akteure geht, die geschlechtslos sind, und um den Lesefluss vor häufigen sprachlichen Unterbrechungen zu bewahren.
ren in Chats, Videomeetings, sozialen Medien7 und treffen sich auf (hybrid‐) digitalen Geburtstagen und Konferenzen. Es wird telepräsent an offenen Organen operiert, durch Drohnen angegriffen und Tieren werden Augmented-Reality-Brillen aufsetzt. Deep Fakes und persuasive Medieninhalte werden mit Rekordbildschirmzeiten8 von allen Altersgruppen konsumiert und die Views der E-Sport-Weltmeisterschaften konkurrieren die Zuschauerzahlen des Sports.
Wo wir überall Raum einnehmen,mit was wir interagieren und wie wir präsent sein können, hat sich durch die Technologie in den letzten Jahrzehnten ausdifferenziert. Wir bevölkern soziale Plattformen, bewohnen computergenerierte Räume und verleben unseren individuellen Alltag mit Algorithmen, Robotern und technologischen Prothesen, die wir auf unseren Körpern und unter der Haut tragen. Die Distanz zu digitalisierten Objekten und virtualisierten Systemen scheint kürzer geworden zu sein, die Handhabung leichter, die Designs reflektierter, wir beginnen, uns daran zu gewöhnen, Avatare zu steuern und uns mit ihnen zu identifizieren. Kurz:Wir befinden uns inmitten eines Prozesses, in dem sich das individuelle und kollektive Handeln durch Technologie sozialisiert und habitualisiert. Dem chinesischen Philosophen Yuk Hui zufolge befinden wir uns in einer Technologieekstase,ohne Richtung und mit viel Beschleunigung.9 Manche sehen in der Digitalisierung das Ende der Geschichte, andere den Anfang einer neuen Weltordnung.10 Alle Zeichen deuten darauf hin, dass sich die Tatsachenwelt, wie wir sie kennen, durch die Technologie in ihren
7 Vgl. Haar, Rebecca: Simulation und virtuelle Welten. Theorie, Technik und mediale Darstellung von Virtualität in der Postmoderne. 1. Auflage. Bielefeld:transcript (Edition Kulturwissenschaft, v. 186), 2019, S. 161 ff.
8 Gemäss einer Studie von E-Sports Schweiz und der ZHAW von 2019 gaben 33.9 Prozent der Schweizer Bevölkerung an, mindestens einmal wöchentlich Videospiele zu spielen. (Vgl. ZHAW School of Management and Law:«eSports ist in der Schweiz beliebt», in: School of Management And Law,29. 04. 2019, verfügbar unter:https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/ medien/bildmaterial/MM_eSports_def.pdf [20. 12. 2022]. Schweizerische 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler verbringen an Schultagen ungefähr 4.5 Stunden vor dem Bildschirm, am Wochenende liegt die durchschnittliche tägliche Dauer bei 8Stunden. (Vgl. Bundesamt für Gesundheit BAG: Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen,2022, Online :https ://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/ver haltenssuechte/medienkonsum-von-kindern-jugendlichen.html [01. 05. 2024]. Die Studie steht unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO –Regionalbüro für Europa)und wird alle vier Jahre durchgeführt).
9 Yuk Hui nennt es Kosmotechnik (engl. cosmotechnics); er geht davon aus, dass sich Kosmos auf das Lokale bezieht, da jede Kultur ihren eigenen Kosmos an Moral und alltäglichem Leben habe. Vgl. Hui, Yuk/Stiegler, Bernard: On the existence of digital objects. Minneapolis/ London:University of Minnesota Press (Electronic Mediations, 48). 2016, S. 47, und Hui, Yuk: Art and cosmotechnics. Minneapolis,MN: University of Minnesota Press, 2020, S. 41. 10 Vgl. Gugerli, David: Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit. Frankfurt am Main:S.Fischer (S.Fischer Geschichte), 2018, S. 196.
Strukturen erweitert hat und sich Räume mit anderen Gesetzen über Raum und Zeit über die empirische Welt legen. Wir können also von einem neuen Weltmodus sprechen, der sich als ein neu strukturierter Raum der Ordnung verselbstständigt und verstetigt hat. Und zwar so kontinuierlich, dass dem Technikhistoriker David Gugerli zufolge die Frage nach der Entstehung einer digitalen Wirklichkeit von der Frage der Autonomie des Digitalen abgelöst wurde.11 Und ebendiese Autonomie der digitalen Wirklichkeit stellt eine historische Zäsur und tiefgreifende Herausforderung dar.12 Seit einigen Jahrzehnten haben wir einen neuen Weltmodus,inden wir uns begeben, durch den wir handeln und interagieren können –mit dem wir uns angenetzt haben. Diese Annetzung mit dem Weltmodus des Digitalen ist weder einheitlich noch folgt sie klaren Regeln, sie ist weder liberal noch demokratisch noch homogen. Sie ist ebenso verbindend wie trennend, gleichzeitig befreiend und verpflichtend. Wie wir sehen werden, ist die Annetzung zudem soziomateriell und kaum rückgängig zu machen. Es ist aber nicht erst die Annetzung mit dem neuen Weltmodus des Digitalen, die uns lehrt, die Welten zu wechseln –das können wir seit jeher: Seit zig Jahrtausenden leben wir durch unsere Vorstellungen, Träume, mentalen Zustände und Erfahrungen im Weltmodus der Imagination –das Menschsein geht mit der Fähigkeit der Imagination einher. Ein Mensch träumt im Durchschnitt 43.800 Stunden in seinem Leben, das sind fünf Jahre. Der Konsum von Halluzinogenen (+ 0.2 Prozent pro Jahr in der Schweiz, 2015)13 und deren parallele Anwendung mit technologischen Hilfsmitteln boomt. Die Implementierung der Technologie in die Imagination hat schon vor über hundert Jahren ihren Anfang genommen14,einige Prothesen und Neurotechnologien wie sogenannte Human Brain Interfaces,mit denen versucht wird, durch Elektroden am Gehirn digitale Handlungen zu steuern, werden im Moment intensiv beforscht.
11 Laut Gugerli handelt sich dabei um eine individuelle und eine kollektive Autonomie nebst den Algorithmen, die autonom agieren. Vgl. Gugerli: Wie die Welt in den Computer kam,Ebd. S. 197.
12 Vgl. ebd., S. 198.
13 Vgl. Sucht Schweiz:«Halluzinogene –Konsum», in:Sucht Schweiz, 16. 01. 2024, verfügbar unter:https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/andere-illegale-substanzen/halluzi nogene/halluzinogene-konsum [01. 05. 2024], und Gmel, Gerhard/Kuendig, Hervé/Notari, Luca/Gmel, Christiane: Suchtmonitoring Schweiz –Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2015. Lausanne:Sucht Schweiz, 2016.
14 Selbst dem Schlaf und dem Träumen wird seit bald über hundert Jahren mit technologischen Prothesen beigeholfen. In den 1930er-Jahren entwickelte sich die Elektroschlaftherapie, welche durch Elektronarkose schwache elektrische Ströme einsetzte, um Schlaf zu induzieren. 1981 wurde das CPAP-Gerät (engl. Continuous Positive Airway Pressure)zur Behandlung von Schlafapnoe und Schlafstörungen von dem australischen Arzt Colin Sullivan erfunden. Vgl. Pack, Allan I.: Sleep Apnea:Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. 2. Auflage, New York: Informa Healthcare, 2012.
Angesichts der epistemischen und kategorialen Verwirrung durch die verschiedenen Räume und Welten, die Erweiterung des Handlungsraums durch die Technologien und durch die Welthybriden,die wir durch Vermischungen konstituieren, befinden wir uns heute in einer grossen deskriptiven, epistemologischen, ja vom Kern beginnend ontologischen Erklärungsnot. In Anbetracht der Konsequenzen der Technologieentwicklung und -anwendungen stockt uns der Atem. Wenn wir Luft holen wollen, stellen wir fest, dass uns die Sprache fehlt, um diese Phänomene annähernd greifbar zu machen oder um sie zu vergleichen. Selbst beim Versuch einer blossen Beschreibung, wie uns ein digitales Objekt erscheint, stossen wir auf eine epistemologische Lücke und fehlende Begrifflichkeiten. Der kanadische Philosoph Marshall McLuhan fasste 1964 mit seinem Slogan The Medium is the Massage zusammen, dass die Art, wie wir Technologien verwenden, unsere Wahrnehmung, Ordnung und Beziehung zur Welt prägt. Die Versprachlichung dieser Prozesse war für ihn schon in den 1960ern unzureichend, da man sich an die Ausdrucksformen älterer Medien klammert.15 In Anbetracht der begrifflichen Verwirrung stellen neu gewählte Begriffe den Versuch dar, die Sprache konkreter auf das anzuwenden, womit wir es zu tun haben. Neue Be-griffe sollen besser greifen. Eine der grossen Herausforderungen beim Verfassen dieser Abhandlung bestand somit darin, eine funktionierende Sprache zu finden. So gibt es eine Reihe von Begriffen, deren Verwendung ich vermeide:Wie lässt sich beispielsweise über Realität nachdenken, ohne den Begriff der Realität allzu stark zu postulieren?Wie lässt es sich gegen eine Dichotomie argumentieren, wenn die Sprache selbst dichotomisch strukturiert ist? Gleichzeitig haben wir für so vieles nicht nur unzureichende, sondern gar keine Begriffe. Oder es gibt zwar Terminologien –beispielsweise in den Gamer Communities –, sie finden jedoch keinen Eingang in die Wissenschaft oder die Medien. Versuche zur Überwindung dieser Sprachnot sind in der Philosophie vielzählig. Martin Heidegger hat bereits 1953 in seinem Essay Die Frage nach der Technik den Begriff des Gestells16 eingeführt, um die moderne Technik besser
15 Marshall McLuhan hat uns vor 70 Jahren dazu eingeladen, unter anderem den Begriff der Innovation neu zu verhandeln. Vgl. McLuhan, Marshall/Quentin, Fiore: The Medium Is the Massage. London:Penguin, 2008. 16 Unter Technik versteht Heidegger ein «gefertigtes Mittel zu einem von Menschen gesetzten Zweck». Die Technik assimiliert Heidegger mit dem Begriff des Gestells: «Aber das Wort ‹Gestell›meint jetzt kein Gerät oder irgendeine Art von Apparaturen. Das Ge-stell ist eine geschickhafte Weise des Entbergens, nämlich das herausfordernde. […]Erschliessen, umformen, speichern, verteilen, umschalten sind Weisen des Entbergens. Dieses läuft jedoch nicht einfach ab. Es verläuft sich auch nicht ins Unbestimmte. Steuerung und Sicherung werden sogar die Hauptzüge des herausfordernden Entbergens». Durch die Verwendung technischer Mittel, des Gestells das Gestell?,wird die Natur zum blossen Mittel. Heidegger spricht dabei von einer Eroberung der Welt als Bild Vgl. Heidegger, Martin:«Die Frage nach der Technik», in: Martin Heidegger. Vorträge und Aufsätze. Pfullingen:Verlag Günther Neske, 1954, S. 2ff.
beschreiben zu können. Ausserhalb der Heidegger-Forschung verwendet jedoch kaum jemand diesen Terminus. Unsere Begriffsarmut in so vielen Sachverhalten ist bemerkenswert:Wie lassen sich beispielsweise körperliche Übergriffe an einem Avatar bzw. Übergriffe auf einen digitalen Körper, mit dem man sich als zweitem Körper identifiziert, beschreiben?Wie kann man die ausgelösten Emotionen und Erfahrungen beim sogenannten Tea-bagging17 und andere körperliche Belästigungen und Übergriffe auf Avatare fassen?Inwelcher Weise fühle ich mich bedroht, wenn mein Avatar sabotiert oder körperlich misshandelt wird?Verspürt mein biologischer Körper dieselben Emotionen, als wäre er in derselben Situation wie mein Avatar, weil ich in derselben Situation wie der Avatar –weil ich mein Avatar bin? Wie verändern sich meine Wahrnehmung und meine Handlungsmöglichkeiten bei mehr und mehr Embodiment durch Prothesen –bis hin zum Exoskelett?Ist es dann leichter, Quasigefühle als echte Gefühle anzuerkennen?Braucht unsere Fähigkeit, über Emotionen zu sprechen, das Taktile, um das Quasi von Gefühlen für einen anderen Körper endgültig ablegen zu können? Was ist mit dem ontologischen Status eines NPCs18,inden ich mich verliebe?Wie lässt sich das angetroffene Gegenüber in seiner Seinsweise und seinen Handlungsmöglichkeiten beschreiben und beurteilen?Mit welcher Handlungsreichweite agiere ich im imaginären oder technologischen Raum und was sickert durch und beeinflusst möglicherweise andere Weltmodi?Wie real ist das Computergenerierte?Sind alle diese Spiele, die immer immersiver werden, noch Spiele,oder haben sie längst den ernst zu nehmenden Status einer weiteren Realität?
Es macht keinen Sinn, sämtliche Technologien und die daraus evozierten Systeme, die wir im Moment haben und die noch folgen werden, anhand der Kategorien real und virtuell einzuteilen und unsere ganze Erlebniswelt mit einer historisch gewachsenen Dualität zu zerschneiden. Ich beabsichtige deshalb, neue Linien zu ziehen.
Uns fehlt das begriffliche Werkzeug für die Beschreibung von Wahrnehmungen, Stufen der Körperlichkeit, Abstraktionslevel dafür, wie es sich anfühlt, solche oder solche Handlungen vorzunehmen, wie uns Entitäten erscheinen und
In anderen Schriften dient das Gestell für Heidegger als ausdrückliches Leitwort für das Wesen der modernen Technik. Siehe Heidegger, Martin: Holzwege. 9. Auflage. Frankfurt am Main: Klostermann. (Die Einzelausgabe der Holzwege ist seit der siebten Auflage (1994)mit dem Band 5der Gesamtausgabe wort- und seitengleich), 2015, S. 72.
17 Tea-bagging ist die Verhaltensweise, bei dem Spieler sich wiederholt über einen am Boden liegenden, besiegten Avatar ducken. Dies wird als provokative, despektierliche Geste verstanden und gilt im Onlinegaming als symbolische Handlung des Dominierens und Herablassens.
18 Ein NPC (engl. non-player-character) ist ein vom Computer automatisch gesteuerter Charakter oder Avatar.
wie wir angetroffene Entitäten in allen Weltmodi anhand ihrer ontologischen Charakteristika beurteilen können. Der Turing-Test zeigt eindrücklich auf, dass selbst grundlegende Experimente und Analysen die Unsicherheit nicht beheben können und vorhandene Begriffe, Konzepte und Methoden für neue Technologien in vieler Hinsicht unzureichend sind. So fallen unter den Begriff der künstlichen Intelligenz gegenwärtig das Forschungsfeld der KI, gleichermassen aber auch die dazugehörigen Methoden sowie die Software, die diese Methoden verwenden.19 Ausserdem wird versucht, künstliche Intelligenz kategorial in spezielle künstliche Intelligenz ASI (engl. artificial specific intelligence)und künstliche allgemeine Intelligenz AGI (engl. artificial general intelligence)bzw. schwache oder starke KI oder generative KI einzuteilen. Dabei wird bei der Handlungsfähigkeit eine Linie gezogen, was aufgabenspezifisch trivial und dementsprechend einfach ist oder was komplexe Fähigkeiten der Transferierung und Generalisierung verlangt. Es werden noch viele Definitionsvorschläge und Taxonomien von künstlicher Intelligenz, LLMs (engl. large language models)und neuronalen Netzwerken in den kommenden Monaten und Jahren folgen. Im Moment wird besonders zwischen generativer und diskriminierender KI unterschieden. Die generative KI erschafft neue Inhalte (Bilder, Videos, Text, Musik etc.) aus Datensätzen und die diskriminierende KI diskriminiert/entscheidet in einem wertfreien Sinn und clustert auf diese Weise Inhalte und erkennt Muster. Ich verstehe im Moment unter künstlicher Intelligenz ein datenbasiertes System, welches durch hohe Rechenleistung im Stand ist, komplexe Aufgabenstellungen zu lösen und/oder durch selbst erlernte Gesetzmässigkeiten und Muster neue Inhalte generiert. Wir dürfen der KI einen Namen geben, uns zu ihr hingezogen fühlen oder sie beleidigen, aber sie ist nicht im Stande wie wir Menschen zu denken,zu fühlen oder zu wollen.Weil KI-Systeme im besten Fall Konvergenten und wir Menschen Synergeten sind. Aber mehr dazu später. Mit unserer Sprache haben wir etliche Begriffsmonster und -geister geerbt und pflegen sie weiter, wenngleich sie nicht zielführend sind, wenn man über Technologien wie KI sprechen möchte. Der Begriff Intelligenz ist ein solcher Begriffsgeist;erwird am besten noch mit relativ umschrieben, und selbst Nick Bostrom beispielsweise verzichtet weitgehend darauf, ihn zu definieren. Auch die geschuldete Interdisziplinarität ist für eine präzise Sprache nicht immer hilfreich, was zu Unverständnis und Irritationen führt. Nach Ockhams’ Rasiermesser-Manier scheint es umgekehrt nicht dienlich, allzu viele neue Begriffe zu bilden und damit weitere Tiere in den ohnehin schon platonischen Zoo aufzunehmen, die man durchfüttern muss.
19 Vgl. Zweig, Katharina A.: Die KI war’s! Vonabsurd bis tödlich:die Tücken der künstlichen Intelligenz. Originalausgabe. München:Heyne, 2023, S. 32.
Darüber hinaus sind zahlreiche Begriffe –wie Intelligenz, Bewusstsein, Denken oder Lernen –, die wir auf Technologien anwenden, anthropozentrisch. Ein Algorithmus lernt anders als ein Mensch, und auch andere Lebewesen sind umgeben von und selbst (Mit‐)Nutzer von Technologien –auch sie sind, wie wir sehen werden, Weltwechsler. Ein weiteres Problem besteht darin, dass wir dieser epistemologischen Verwirrung auch insofern ausgesetzt sind, als wir nicht einmal ihre Ursachen verbalisieren können. Warum sich bisher kaum allgemeingültige Antworten etabliert haben, könnte damit zu tun haben, dass sowohl in den Begriffen als auch in den thematischen Ausrichtungen Uneinigkeit herrscht und entsprechende Diskurse bisher viel zu selten und wenn, dann allzu geschlossen geführt wurden. Zahlreichen Studien und Ansätzen, die neues Terrain betreten, ist eine sprachliche Verunsicherung zu eigen. Man entlehnt zwar Begriffe aus anderen Disziplinen, konkludiert dann aber, dass es an Vergleichen fehle. Die Dünnhäutigkeit und Vorsicht solcher Publikationen täuschen über ihre Notwendigkeit hinweg. Es sind gerade solche ersten Bemühungen, die den Grundstein für einen wissenschaftlichen Diskurs legen. Es braucht ungleich mehr Anstrengung, sich einem noch wenig greifbaren Forschungsgegenstand zu nähern, Fachkollegen zu motivieren oder Ressourcen einzuholen, weil das Resultat nicht wirklich absehbar ist und immer zunächst viel gesagt werden muss und nur wenige Inhalte einem selbstverständlichen Kanon folgen können. Aber egal wie neu das Forschungsfeld ist –umeinen solchen Kanon sollte man sich von Anfang an bemühen, sonst wird der Diskurs zusätzlich hinausgezögert. Der amerikanische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn hat diesen Zustand ausserhalb oder vor einem wissenschaftlichen Paradigma ausführlich beschrieben und nennt ihn dekonstruktiv-konstruktive Paradigmenwechsel.20 Dem amerikanischen Informatiker Edward Ashford Lee zufolge handelt es sich bei der Digitalisierung der Natur und gewissermassen auch des Geistes um gleich mehrere Paradigmenwechsel im kuhnschen Sinne.21
Bei aller Verwirrung und allem Pluralismus herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass diese epistemologischen und ethischen Problemstellungen einer Lösung entgegengeführt werden können:Wir müssen den interdisziplinären Dialog suchen. Und Interdisziplinarität bedeutet in diesem Zusammenhang möglicherweise auch, dass es bei der kritischen Auseinandersetzung mit Technologien eines gewissen Grades individueller Annetzung mit dem Forschungsgegenstand bedarf. Diese Abhandlung soll deshalb keine Lobrede des Mundus Imaginatus oder des Mundus Computatus sein. Die Gefühle, die sich bei mir nach Momentannetzungen mit beiden Weltmodi einstellen, reichen von fast ab-
20 Vgl. Kuhn, Thomas: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Übersetzt von Hermann Vetter, 24. Auflage. Frankfurt am Main:Suhrkamp, 2014, S. 79 f.
21 Vgl. Lee, Edward Ashford: Plato and the nerd:the creative partnership of humans and technology. Cambridge, MA:The MIT Press, 2017, S. 184.
surden Glücksgefühlen, wohligem Schwelgen über Angst, Frustration bis hin zu fataler Übelkeit. Weil wir durch die eigene Annetzung begreifen, wie differenziert und komplex sich die Annetzung für einen selbst konstituiert, ist es wichtig, vor allem als Angenetzte über sie zu sprechen und auch zu forschen. Die Aussenperspektive hat nicht funktioniert.
Festzuhalten ist also:Die Vermischung von verschiedenen Technologien, deren rasante Entwicklung, ohne dass eine funktionierende Begrifflichkeit mithalten könnte, der fehlende selbstbezogene und trotzdem interdisziplinäre Diskurs und die unserem Denken anhaftende Sprache mit ihren überholten Dualismen und Terminologien für nicht zeitgemässe Phänomene haben die bisherige epistemologische Untersuchung erschwert. Die Beforschung dieser Lücken entspringt somit sowohl der herrschenden Unsicherheit als auch der abenteuerlichen Neugier einer Entdeckerin, die in der Begreifung des Neuen erste Schritte gehen will.
Ich möchte mit der folgenden Abhandlung einen Beitrag zu jenem Forschungszweig leisten, der sich Human Computer Interaction –kurz HCI –nennt. Die folgenden Überlegungen sollen sich damit unter die wenigen ersten Versuche mengen, welche die Ausarbeitung von epistemologischen und ethischen Grundlagen für den Diskurs der HCI bezwecken. Historisch füge ich mich damit in eine Reihe von interdisziplinär arbeitenden und denkenden Autorinnen und Autoren ein, die versuchen, das Phänomen der Digitalisierung und die damit verbundene Beziehung von Mensch und Computer auf der Ebene des Individuums und der Gesellschaft besser zu verstehen. Im Kontext der aktuellen Forschung der HCI liegt mein Schwerpunkt dabei in einer grundlegenden Analyse der Interaktion in und durch Technologien –wofür ich den Begriff der Annetzung gebrauche, um die Prozesse und Strukturen, die sich daraus ergeben, besser darzustellen. Mein Ansatz wird die Technologien zunächst nicht-technologiegebunden betrachten, was innerhalb der HCI eher selten geschieht. Auch wurden die Handlungsräume der Imagination bisher kaum mit den Handlungsräumen, die durch Technologien evoziert werden, verglichen, und dies, obwohl zurzeit eine Verschmelzung von neuen technologischen Prothesen mit selbst generierten imaginierten Inhalten stattfindet und wir vor der Herausforderung stehen, solche Welthybriden und Inhalte richtig einzuschätzen. Durch Anfügungen wie diese versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, um die epistemologische Verwirrung und die ethische Unsicherheit zumindest begrifflich neu auszurüsten. Annetzung mit einem neuen Weltmodus bedeutet Entfremdung, Verwirrung oder positiv formuliert:Neuverhandlung. Das Ziel ist also nicht weniger als eine Neuverhandlung der Sprache und damit eine Umwälzung des Denkens an konkreten Stellen. Hier setzt mein wissenschaftlicher Beitrag an. Diese Neuverhandlungen sind auch Entfremdungen,die nicht immer bequem sind. Das Subjekt, unsere Beziehung zu unserer Natur –auch zu unseren Gefühlen –oder unserem Körper neu zu verhandeln, heisst, sich in eine Welt voller andersartiger
Akteure neu einzureihen. Meine vorgenommene Neuverhandlung umfasst keine erschöpfende Darstellung der Systeme und Technologien und ihrer Geschichte. Die Genealogie und Entwicklung von Technologien, Prothesen und neuen Medien wird bereits erfolgreich erzählt.22 Ich werde es deshalb vermeiden, die komplexe Diversität aller Systeme und ihre Entwicklung detailliert nachzuzeichnen. Stattdessen habe ich eine Typologie ihrer Epistemologie im Sinn.23
Die Neuverhandlung beginnt also mit einem theoretischen Teil, der eine Grundlage vorstellt, um die folgende Frage adressieren und in philosophische Begriffe übersetzen zu können:Wie strukturiert und konstituiert die Annetzung in einen anderen Weltmodus das Handeln und die Interaktion?Methodisch ist dies zu erreichen, indem wir die Annetzung an sich kategorisieren und mit neuen begrifflichen Werkzeugen ausrüsten, mit denen wir sie beschreiben können. Mein primäres Anliegen besteht darin, die wesentlichen und grundlegenden Aspekte der Annetzung als Übergänge zwischen Systemen und ihren Weltmodi zu durchleuchten. Dazu werden in Weltmodus (Kapitel II) die drei verschiedenen Weltmodi zunächst eingeführt, auf deren Überlappungen und Vermischungen wird in Welthybriden (Unterkapitel 2) eingegangen. Die dafür notwendigen Begriffe werden historisch-systematisch von bereits existierenden Begriffen vorwiegend aus der phänomenologischen und sprachphilosophischen Tradition abgeleitet. In Komplementarität der Weltmodi (Kapitel 3) räume ich trotz des Weltpluralismus der Tatsachenwelt eine Sonderstellung ein und differenziere die Weltmodi anhand ihrer ontologischen, kausalen und substanziellen Unterschiede. So viel zum Weltmodus. Um über die breite Vielfalt der Systeme hinaus die Handlungen, Interaktionen und Eigenschaften zu identifizieren, die ein Akteur konstruiert, wenn er sich in einen anderen Weltmodus annetzt, muss in Annetzung (Kapitel III) die Annetzung an sich beschrieben werden. Die Metapher des Wasserspiegels (Kapitel 5) verhandelt das Bild als Metapher und setzt, was sich diesbezüglich oberhalb und unterhalb des Wasserspiegels befindet. Die Weltwechsler (Kapitel 6) bestimmen, welche Akteure sich dabei annetzen. Die
22 Eine Kulturgeschichte der neuen Medien bietet Park, David W./Nick Jankowski/Steve Jones (Hrsg.): «The Long History of New Media:Technology, Historiography, and Contextualizing Newness», in: Digital Formations,vol. 76. New York et al.: Lang, 2011. Eine historische Erzählung über Prothesen und Posthumanismus bietet Smith, Marquard/Joanne Morra: The prosthetic impulse:from aposthuman present to abiocultural future. Cambridge, Mass: MIT Press, 2006, und eine Geschichte des Posthumanismus bietet Krüger, Oliver: Virtualität und Unsterblichkeit:Gott, Evolution und die Singularität im Post- und Transhumanismus. 2. Auflage. Rombach Wissenschaft. Reihe Litterae, Band 123. Freiburg i. Br:Rombach Verlag, 2019. Eine neue und gelungene Klassifikation technischer Prothesen liefert Myers, Brad A.: Pick, Click, Flick!The Story of Interaction Techniques. First edition. New York, NY:Sociation for Computing Machinery, 2024.
23 Vgl. Gugerli, David: VomVerschwinden der Technik. 1. Auflage. Zürich:Chronos, 2024, S. 121.
Arten der Annetzung (Kapitel 7) analysieren, welche grundlegenden Arten von Annetzungen es gibt. Bei drei Weltmodi gibt es insgesamt sechs Übergänge, wobei jeweils drei die Annetzung vom selben Weltmoduspaar mit entgegengesetzter Annetzungsrichtung sind. Die Stufen der Annetzung (Kapitel 8) beschreiben, mit welcher Intensität sich ein Akteur annetzen kann bzw. metaphorisch gesprochen, wie tief man im Wasser steht. Um die Art und Weise beschreiben zu können, wie unsere eigenen Avatare, andere Akteure, Objekte und Systeme in anderen Weltmodi erscheinen können, liefert Abstraktion (Kapitel IV) eine Typologie der Abstraktionslevel (Kapitel 11).
Die geforderte Neuverhandlung ist demnach eine epistemologische Beschreibung des Weltmodus (Kapitel II),der Annetzung (Kapitel III) und der Abstraktion (Kapitel IV). Wir werden sehen, dass sich das Begriffstrio wechselseitig bedingt. Epistemologisch deshalb, weil die Frage, wie wir wissen, ob etwas ein Mensch oder ein Roboter ist, oder wie wir Abstraktionslevel einteilen, nicht zuletzt eine Frage der Erkenntnistheorie darstellt. Es geht um die Art und Weise, wie Unterscheidungen in unserem Wissen verankert sind und welche Informationen, Urteile und Kategorien wir dafür nutzen. Was wir mit der Welttransparenz und damit mit dem Wissen über den Weltmodus anfangen, hängt viel davon ab, was für einen Wahrheitsbegriff wir verwenden. Und deshalb ist die Frage nach dem Weltmodus auch eine erkenntnistheoretische Frage. Die Typologien, die durch diese begrifflichen Werkzeuge entstehen, kategorisieren Systeme und ihre Technologien auf eine spezifische Weise. Das Projekt einer solchen methodischen Typologie ist demnach von zwei Hypothesen durchdrungen:
1) Die Systeme, die durch Technologien entstehen, sind durch Vergleichspunkte und neue Begriffe beschreib- und miteinander vergleichbar;2)eine solche Untersuchung kann zu einem ethischen Verständnis beitragen, wie wir mit solchen Technologien handeln, forschen –kurzum leben sollen und wollen.
Wir halten fest:Wir sind Weltwechsler, wir haben uns durch Technologien mit einem neuen Weltmodus angenetzt, es gibt zahlreiche Welthybriden und Mischsysteme aus mehreren Weltmodi. Wo ist das Problem?
Der Einsatz, die Kontrolle, die Fragen nach Verantwortung und Regulierung sowie die Möglichkeiten der Manipulation sind mittlerweile ebenso unüberschaubar wie die Anwendungen selbst. Die Opferzahlen sind gross: Laut Schätzungen wurde jeder Sechste schon einmal online schikaniert, jeder Zweite hat online bereits schlechte Erfahrungen gemacht und jeder Fünfte hat online Inhalte gesehen, die ihm Angst bereitet haben. Laut einer deutschen Studie von 2022 ist jeder fünfte Schüler von Cybermobbing betroffen. Allein in Deutschland entspricht dies 1,8 Millionen Schülerinnen und Schülern.24 Es gibt bereits
24 Siehe die Studie vom Bündnis gegen Cybermobbing von 2022:Beitzinger, Franz/Leest, Uwe/Süss, Daniel:«Bündnis gegen Cybermobbing», 10.2022, verfügbar unter:https://www. buendnis-gegen-cybermobbing.de/wp-content/uploads/2022/10/Cyberlife_Studie_2022_end-
erste Todesopfer durch selbstfahrende Autos.25 Über Technologien zu sprechen, heisst auch, über die Zukunft zu verhandeln. In Anbetracht der damit verbundenen ethischen Herausforderungen befinden wir uns in einer normativen Handlungsnot, die den Ausgangspunkt für den praktischen Teil dieser Abhandlung darstellt. Da die Grundbedingung für jedes ethische Verhalten die «Bestimmung der jeweiligen Realität»26 ist, geht der moralphilosophischen Reflexion eine Erkenntnistheorie im ersten Teil dieser Abhandlung voraus, gefolgt von einer Begründung und Einordnung einer angewandten Ethik (Kapitel VI). Es besteht eine grosse interdisziplinäre und methodische Übersetzungsleistung darin, einen ganzen Bereich und damit die möglichen Situationen, Fälle und Herausforderungen ethisch zu beurteilen. Die ethische Beurteilung ist deshalb mit den formulierten Begriffswerkszeugen vom ersten Teil durchzogen, welche induktiv durch die angetroffenen Fälle und Herausforderungen, die sich durch die Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand ergaben, entstanden sind. Methodologisch wurden die vier Schritte des ethischen Entscheidens27 des schweizerischen Ethikers und Theologen Peter Kirchschläger –genannt SAMBA –innerhalb der gesamten Abhandlung chronologisch umgesetzt. Während der theoretische Teil zunächst auf einer deskriptiven Ebene anhand einer neuen Typologie und der neuen begrifflichen Werkzeuge die Interaktion mit Technologien und Imaginationen beschreibt, wird auf dem eigenen Wissens-, Denk-, Sprach- und Weltanschauungshorizont aufbauend der Versuch einer Darstellung der aktuellen virtualisierten Systeme unternommen. Dies umfasst das S von SAMBA: See and unterstand the reality28 . Das A und M (Analyse the reality from a Moral standpoint)29 sowie das B (Bethe ethical judge)30 werden im ersten Teil der Ethik der Annetzung (Kapitel VII) von der Verständigung des ethischen fassung.pdf [01. 05. 2024]. Für die Untersuchung hat das Bündnisgegen Cybermobbing Berlin 355 Lehrpersonen, 1.053 Eltern und3.011 Lernendebundesweit zumThema Mobbing undCybermobbing befragt.
25 Einer der ersten Todesfälle mit einem autonomen Fahrzeug ereignete sich 2018, als ein selbstfahrendes Auto in einem Pilotprojekt von Uber, ausgestattet mit Sensortechnologie, nachts eine Fussgängerin namens Elaine Herzberg erfasste und tödlich verletzte. Vgl. Zweig: Die KI war’s,S.141, und National Transportation Safety Board:«Collision Between Vehicle Controlled by Developmental Automated Driving System and Pedestrian», in: Highway Accident Report, Accident Report, National Transportation Safety Board,2019, Online:https:// www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HAR1903.pdf[01. 05. 2024].
26 Wiegerling, Klaus: Medienethik. Sammlung Metzler, Band 314. Stuttgart:J.B.Metzler, 1998, S. 45.
27 Vgl. Kirchschläger, Peter G.: Ethisches Entscheiden. 1. Auflage. StudienkursEthik.BadenBaden:Nomos,2023.
28 Kirchschläger: Ethisches Entscheiden,S.64.
29 Ebd., S. 66.
30 Ebd., S. 119.