Visuelle Geschichtsvermittlung

Zur Medialität historischer Lehrwerke für Kinder und Jugendliche im langen 18. Jahrhundert


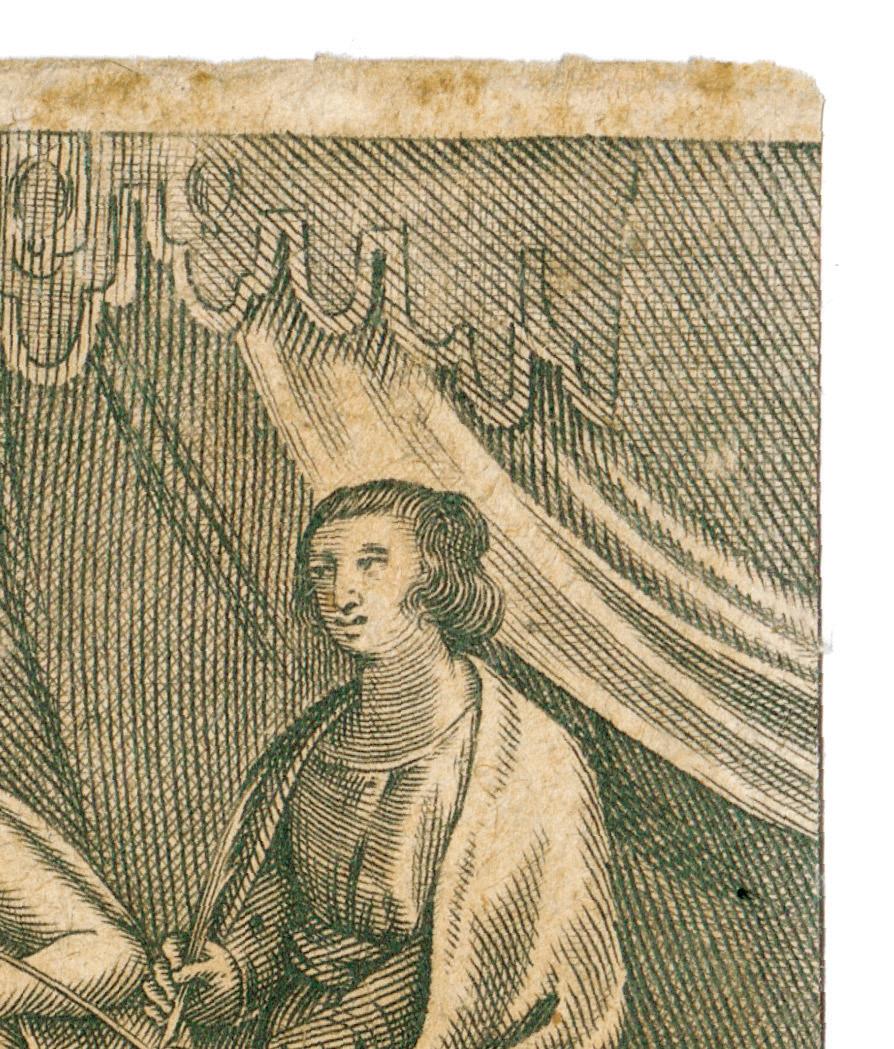
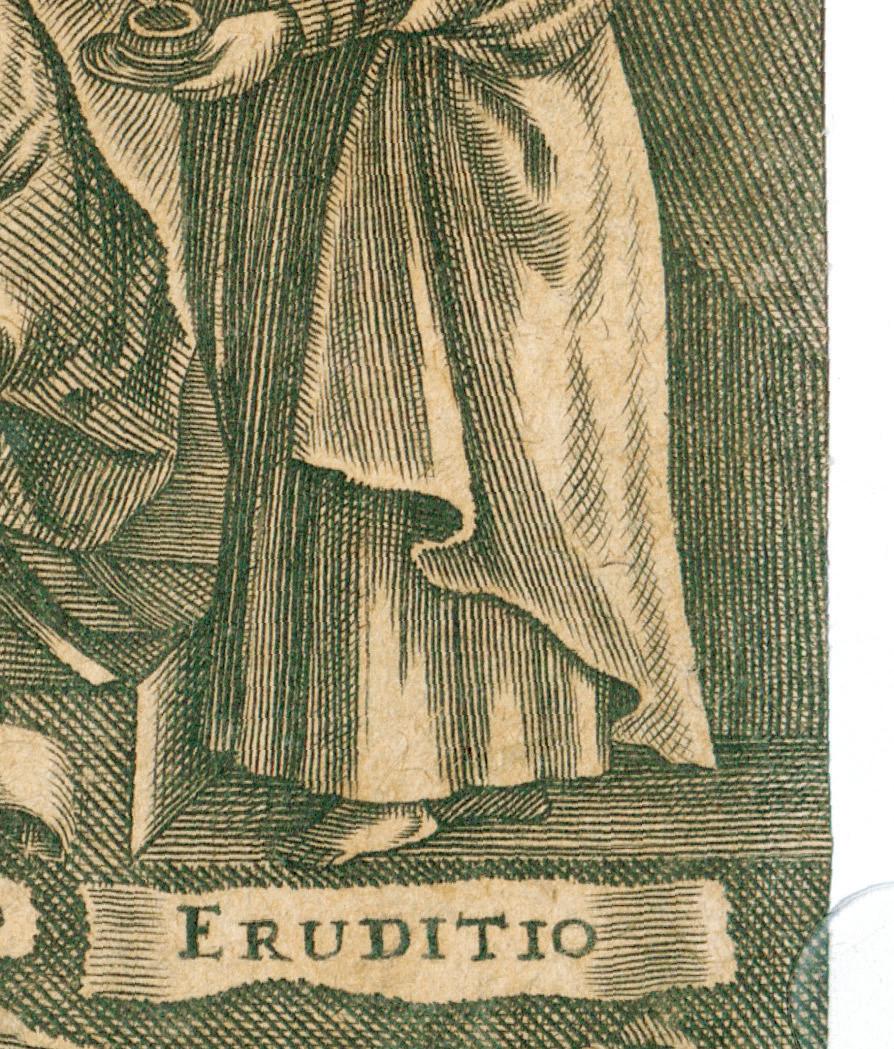


Zur Medialität historischer Lehrwerke für Kinder und Jugendliche im langen 18. Jahrhundert


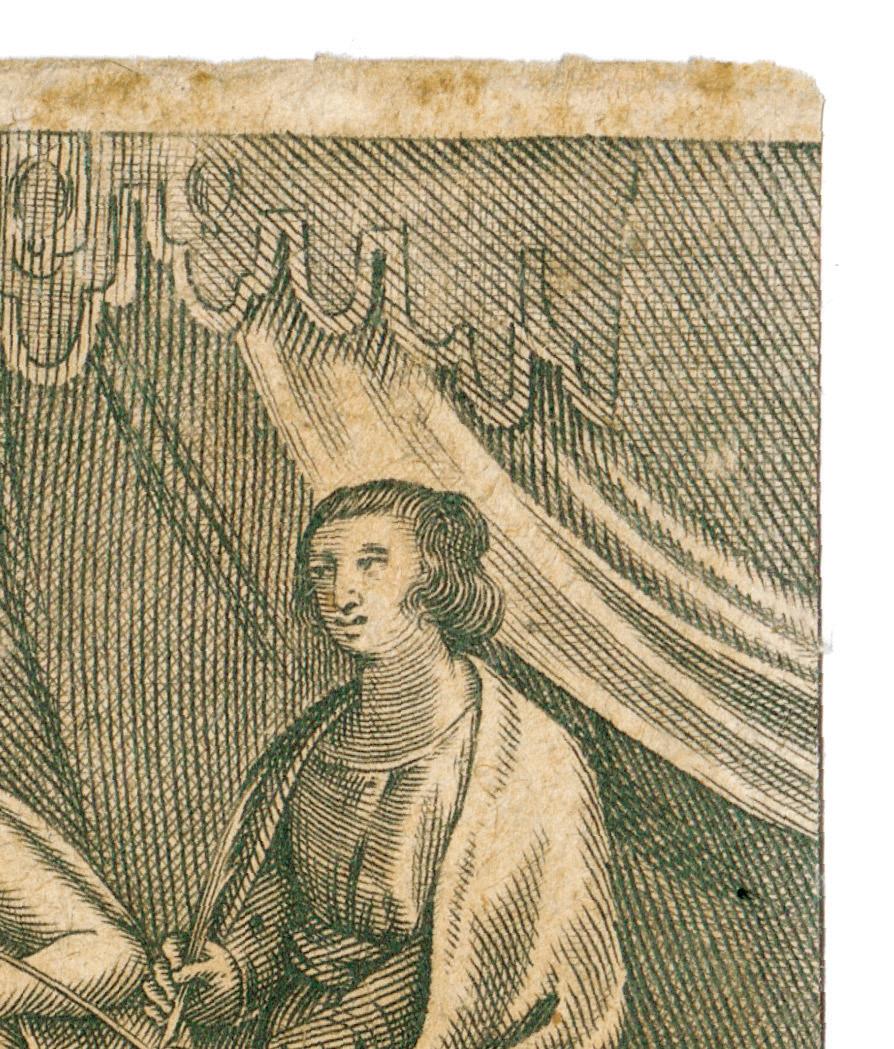
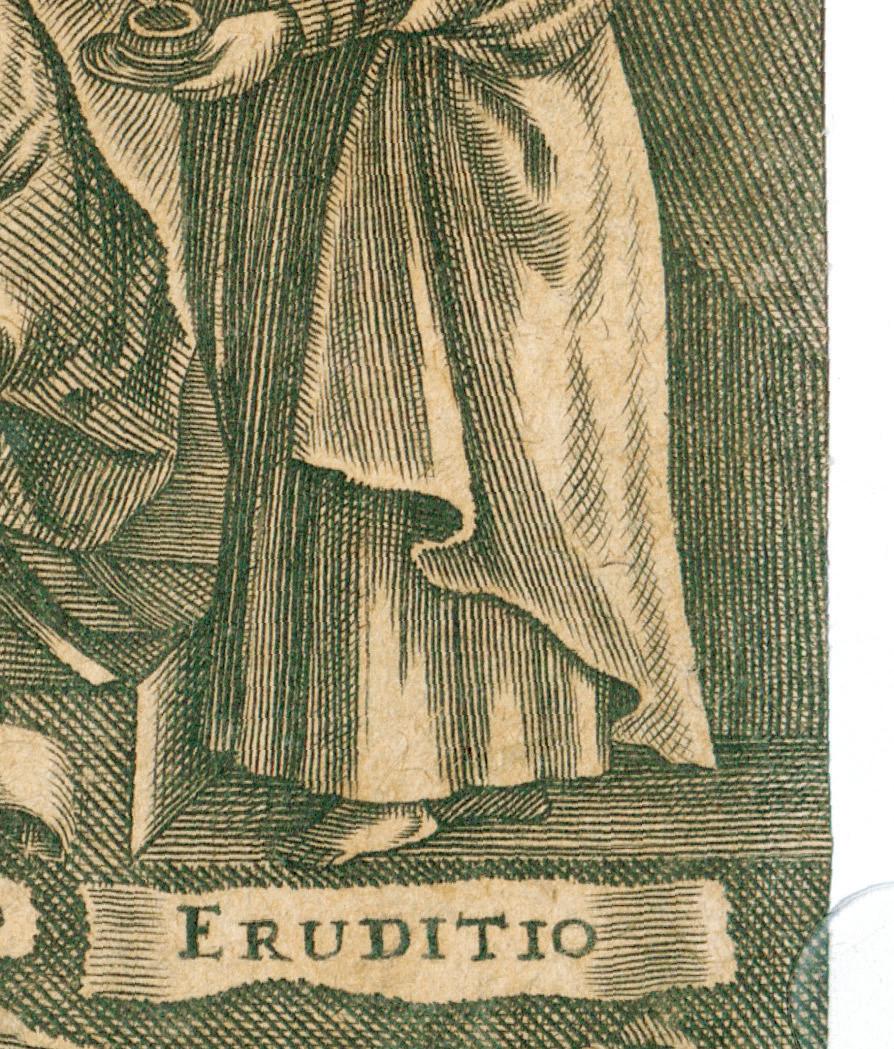
The Long Eighteenth Century
Herausgegeben von /dirigé par /edited by Nathalie Ferrand, Claire Gantet, Marian Füssel, Helmut Zedelmaier
Volume 5
Kristina Hartfiel
Zur Medialität historischer Lehrwerke für Kinder und Jugendliche im langen 18. Jahrhundert
Schwabe Verlag
Gedruckt mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf und der Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post e.V.
Die Publikation wurde als Dissertation mit dem Titel «Esist dieses nur eine historische Milch-Speise für Kinder?» Annäherungen an die Medialität historischer Lehrwerke im 17. und 18. Jahrhundert an der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität angenommen. – D61
Open-Accessveröffentlichtmit Hilfe des Open-Access-Fonds der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Open Access:Wonichtandersfestgehalten, istdiese Publikation lizenziert unterder Creative-CommonsLizenz Namensnennung-Share Alike4.0 International(CC BY-SA 4.0)
BibliografischeInformation der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Kristina Hartfiel, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigenEinwilligung des Verlages.
Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Coverabbildung :Titelkupfer von TobiasWagner:Institutionum historicarum libri septem, Ulm 1663. Mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Staatsbibliothek München, H.un. 664, Titelkupfer.
Korrektorat:Thomas Lüttenberg, München
Cover Gestaltungskonzept :icona basel gmbh, Basel
Cover:Kathrin Strohschnieder, stroh design, Oldenburg
Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Hubert& Co., Göttingen
Printed in Germany
Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Grellingerstrasse 21, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7965-5265-6
ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5266-3
DOI 10.24894/978-3-7965-5266-3
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
4.1 «Mit aufrichtiger Unparteilichkeit» –Nürnberger Geschichtsbücher für die «studierendeJugend» und ihr Vertrieb im süddeutschen Raum
4.2 «Früchte des Verlangens» –Historische Lehrwerke als lukrative Geschichtsschreibung
5.1 Spuren des Neu-eröffneten Historischen Bilder-Saals
5.1.1 Des Kaisers alte Bücher: Der Bilder-Saal aus dem Bestand der FamilienFideikommissbibliothek des Hauses Habsburg-Lothringen ..
5.1.2 Materialität und Immaterielles: Die Bilder-Saal-Exemplare aus dem Bestand der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
5.1.3 Der säkularisierte Bilder-Saal: Der Bestand der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität
Verzeichnis und Nachweis der Abbildungenund Tabellen
Dieses Buch ist die leicht überarbeitete Fassung meiner im Mai 2023 unter dem Titel «Esist dieses nur eine historische Milch-Speise für Kinder?» Annäherungen an die Medialität historischer Lehrwerke im 17. und 18. Jahrhundert eingereichten Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Achim Landwehr, Sebastian Hansen und TobiasWinnerling haben diese Arbeit von Beginn an begleitet. Ohne die unzähligen Diskussionen und Gespräche, ohne ihre Tipps und Netzwerke wäre dieses Buch nie zu dem geworden, was es ist – ganz herzlichen Dank dafür. Überhaupt habe ich während meiner Qualifikationszeit am Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit stets vielfältige Unterstützung erfahren dürfen, namentlich erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang besonders:Silvia Osada, Laura Seithümmer, Lena Geisel und Tristan Wehner. Ein besondererDank gilt zudem meinerZweitgutachterin Christine Haug, die mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hat sich seit unserer ersten Begegnung im November 2014 für mein Projekt interessiert und mir die Möglichkeit geboten, meine Arbeit vorzustellen. Zudemmöchteich mich herzlich bei den Herausgeber*innen für die Aufnahme in diese Reihe bedanken: Das 18. Jahrhundertals ein langes, «inplurale Vergangenheiten und Zukünfte verweisendes Jahrhundert» zu begreifen, ist mir ein Anliegen.
Forschung und ihre Aufbereitung muss auch finanziert werden, und so danke ich dem Open-Access-Fonds der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post e.V. und der Gerda Henkel Stiftung Düsseldorf für die Übernahme der Open-Access-Kosten bzw. für die gewährten Druckkostenzuschüsse. Der Gerda Henkel Stiftung Düsseldorf danke ich zudem für ihre großzügigeUnterstützungwährend der ersten Jahre meiner Promotionszeit. Ohne ihr Promotionsstipendium hätte ich mich nie so ausgiebig und intensiv mit den Quellen auseinandersetzen können. Das Stipendium ist das Fundament dieser Arbeit. Mein Dank gilt dementsprechend auch den unzähligen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die mir freundliche Auskunft über ihre Bestände gegeben haben. Unter anderem in der Herzog August BibliothekWolfenbüttel, der Universitätsbibliothek München und der ÖsterreichischenNationalbibliothekWien habe ich zahlreiche Stunden verbracht, um die Materialität der untersuchten Bände zu prüfen. Insbesondere der Dr.Günther Findel-Stiftung aus Wolfenbüttel und dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien/Georg-EckertInstitut in Braunschweig bin ich zu Dank verpflichtet, da sie mir umfassenden
Einblick in ihre Bestände gewährt und mich mit Forschungsstipendien unterstützt haben. Die Frauenförderung der Philosophischen Fakultät der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf ermöglichte mir weitere Forschungsreisen nach Nürnberg und Wien. Als Eltern von drei Kindern wurden mein Mann Jan und ich dabei stets durch ein grandioses familiäres Netzwerkunterstützt:Petra und Wolfgang Dille sowie Elke Hartfiel und Detlev Rein – was würdenwir ohne euch tun?Meinen Eltern danke ich zudem von ganzem Herzen, dass sie mich meinen Weg gehen ließen. Annika Dille brachte ihr kulturwissenschaftliches Interesse und ihr großes Herz als Schwester, Tante und Babysitterin ein, mit Matthias Dille teilte ich die Freuden und Sorgen einer akademischen Karriere. Jan, ich danke dir für deine unermüdliche Unterstützung und Liebe;Mascha, Juri und Ava – ihr habt diese Arbeit von der Milch bis zur festen Speise begleitet, weshalb ich sie euch widme.
Willich, im Herbst 2024
Historia magistra iuventutis –Ausgangsbefund und Ausgangsüberlegungen
Für die studierendeJugend – ein Forschungsanlass
«Unverwischt und bis in den kleinsten Zügen anschauen, schweben mir noch die Figuren vor der Seele, die ich in meinem 12ten Jahr in Kieburzens Kinderbibel, Gottfrieds Chronik und Imhofs Bildersaal gesehn, und deren Anblick in mir die Begierde erweckte, die Beschreibung dieser Szenen im Texte zu lesen. Ich ahndete damals nicht, daß ich ein System in den Händen hielt, und hätte ein schulgerechter Lehrer mir den Zusammenhang und die Zeitfolge dieser Begebenheiten einprägen wollen, er würde mir meine Freude verbittert, und den mächtigen Eindruck der sinnlichen Intuition zuverlässig geschwächt haben.»1
Dieser Auszug aus einem anonymen Brief, abgedruckt im siebten Stück des gelehrten Journals Ephemeriden der Menschheit (1781), deutet wesentlicheAspekte an, die Ausgangspunkte dieser Arbeit sind:Erstens, dass es die Idee eines «Systems», eines Gesamtzusammenhangs von der Geschichte – und nicht mehrerer Historien – schon vor dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gab. Gemeinhin sieht die Forschung in der Zeit zwischen Aufklärungshistoriographie und Historismus (also in den Jahrzehnten um 1800)den Beginn moderner Geschichtswissenschaft und macht das unter anderem an der narrativen, kausal wie medial nachzuvollziehenden Darstellungsweise von Geschichte fest, die eben diesen Kollektivsingularermöglichte und Sinn stiftete.2 Der anonyme Autor deutete darüber hinaus jedoch auch an, dass sich diese diskursive wie praktische Innovation nicht nur zeitlich früher, sondern auch abseits des literarisch-künstlerischen Hö-
1 Anon., «Vorbereitung zum Unterricht in der Geschichte durch Biographien»/Ephemeriden (1781), 162 f. In den Fußnoten erfolgt grundsätzlich nur die Nennung von Autor*innenname und Jahreszahl. Ist allein damit eine bibliographische Differenzierung nicht möglich, wird darüberhinaus mit der Angabe des Kurztitels oder – bei gleichen Titeln – mit Bandnummern gearbeitet.
2 Dazu immer noch grundlegend:Koselleck 2004 (zuerst 1975); ders. 2020 (zuerst 1967). Zur Forschungsdiskussion s. weiter unten, 22–26.
henkammsinpopulären Lehrbüchern wie Kinder-Bibeln vollzogbzw. dort zu finden sei. Dies klingt auch bereits bei Johann Paul Röder (1704–1766)und Georg Philipp Schunther (1722–1768)am30. des Wintermonats (Dezember)1751 an:
«Man schrieb für die Gelehrten, diese musten auch die Sprache der Gelehrten verstehen, um andere Leute bekümmerte man sich wenig, hatten sie nicht studieret, glaubte man, so brauchten sie ia auch keine Erkäntnus der Geschichte. Die Jugend war dabei am schlimmsten daran. Sie musten aus einigen magern Zeit- und Geschichtsbüchern, die fast alle lateinisch und noch dazu in möglichster Kürze und Dunkelheit abgefasst waren, die ersten Anfangsgründe der Geschichte erlernen.»3
Die beiden Männer resümierten in ihrer Vorrede zum elften Band des Neu-eröffneten Historischen Bilder-Saals den Anfangund Fortgang dieses Werkes, dessen Autoren sich seit dem ersten Band von 1692 zum Ziel gesetzt hatten, dass die oben beschriebenen dunklen und mageren Zeitenvorbei sein sollten. Gemäßder aufklärerischen Licht-Metaphorik waren diese Akteure im langen 18. Jahrhundert bemüht, das Leben aller Menschen mittels historischer Kenntnisse zu erhellen, und dafür setzte man schon bei den Jüngsten an.4
«Keine Geschichte, die vor Gelehrte geschrieben ist, wird man hier nicht finden, aber wohl ein Buch, das die studierende Jugend und solche Personen wol gebrauchen können, welche Liebhaber der Geschichte sind, und in denen Dingen […]nicht ganz unwissend sein wollen.»5
Dementsprechend bereiteten die Autoren den historischen Stoff adäquat für junge Leser*innen auf. Insbesondere mit Bildern («Figuren»), erweckten sie, wie das auch bei dem eingangs zitierten anonymen Autor der Fall war, die Begierde der Heranwachsenden. Hier knüpft meine Arbeit an. Mein Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf diese visuelle, geschichtsvermittelnde Literatur für Kinder und Jugendlichezurichten und Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundertzubefragen, um der medialen Verfasstheit von Geschichte in diesem Zeitraum aus einer anderen Perspektive als der Analyse der gängigen Arbeitender Aufklärungshistoriker auf die Spur zu kommen.6
3 Röder/Schunther 1752–11, Vorrede.
4 Fulda, Die Geschichte trägt der Aufklärung die Fackel vor 2016. Die Altersspanne der «studierenden Jugend»ist nicht konkret bestimmt. Es geht vielmehr um die Grenzziehung zu einem gelehrt-erwachsenen Adressatenkreis. Dazu ausführlich Kapitel 1.
5 Röder/Schunther 1752–11, Vorrede.
6 Als «Aufklärungshistoriker»beschreibt Fulda 1996, 53, «diejenigen deutschsprachigen Historiker und Geschichtsschreiber samt ihrer geschichtswissenschaftlichen oder historiographischen Tätigkeit, die seit etwa 1760, also in der ‹Ausbreitungsphase› der Aufklärung in Deutschland, die überkommene polyhistorische, reichsgeschichtliche oder ‹galante› Historie zu
Der genannte Neu-eröffnete Historische Bilder-Saal kann mit seiner Adressatenspezifizierung als ein frühes Beispiel für die «Pädagogisierung»7 der Historie im 18. Jahrhundert gelesen werden. Wie in anderenTeilbereichen des Lebens rückte auch die angemessene Bearbeitung der Vergangenheit in den Fokus pädagogischer Bemühungen, und so erschienen zahlreiche historiographische Medienprodukte zu Zwecken der Bildung und Erziehung.
«Die Vorliebe des Publikums für weltgeschichtliche Synthesen, die sich – nicht selten mit dem Signalwort ‹für die Jugend›– an eine nicht-wissenschaftliche Leserschaft wenden, begleitete die Prozesse der Verwissenschaftlichung und Spezialisierung der Geschichtswissenschaft wie auch die Popularisierung wissenschaftlichen Wissens bis heute […]»8 , erläutern Susanne Popp und Marko Demantowskyinihrer Einleitung zu August Ludwig von Schlözers (1735–1809) Vorbereitungzur Welt-Geschichtefür Kinder. Der Neu-eröffnete Historische Bilder-Saal ist somit keineswegseinzigartig geblieben. Auch ein Blick in einschlägige Bibliographienund Datenbanken, wie zum Beispiel in die Verzeichnisse der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts (VD17/VD 18)zeigt, dass die muttersprachliche historiographische Kinder- und Jugendliteratur für den deutschsprachigen Raum seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zahlenmäßig stark anwuchs.9 Muttersprachliche historiographische Kinder- und Jugendliteratur meint hier im weitesten Sinne zunächst alle deutschsprachigen geschichtserzählenden Texte,
reformieren unternahmen […].» Grundlegend zur Aufklärungshistorie:Blanke/Fleischer 1990–1/2.
7 Hruby 1986, 154. Vgl. Reble 1999, 141. Dazu auch Benz 2001, 109.
8 Demantowsky/Popp/Schlözer 2011, 16.
9 Wegehaupt 1977;HKJL–1/2. Grundlegend dazu Michels 1981. Eine vergleichbare Entwicklung konstatieren Demantowsky/Popp/Schlözer 2011, 8wie auch 21 Anm. 1. Ebenso Jacobmeyer 2011–1, 20;Schmideler 2012, 18. Die beiden letztgenannten Autoren behandeln aufgrund der wenigen Quellenfunde des 17. Jahrhunderts insbesondere die Zeit ab 1700. Die zahlenmäßige Entwicklung blieb dabei nicht nur auf die historiographisch ausgerichtete Kinder- und Jugendliteratur beschränkt, wie sich auch aus einem bereits viel zitierten Satz in Gedike 1787, 3ablesen lässt:«Indessen wird itzt in Deutschland nicht leicht irgend ein Feld der Litteratur so eifrig gedüngt und bearbeitet, als die Schriftstellerei für Kinder und Schulen, und keine einzige litterarische Manufaktur ist so sehr im Gange als die Büchermacherei für die Jugend nach allen ihren Gradationen und Klassen.» Europäische, zum Teil epochenübergreifende, Perspektiven und Überblicke liefern:Hunt 2004;Immel/Witmore 2006;Lerer 2008;Immel 2009;Grenby 2011. Zur Kinderliteratur in transnationaler Perspektive – vor allem für die Zeit nach 1750 – Appel/Christensen/Grenby 2023.
«die Teil einer sacherzählenden bzw. informationsorientierten Darstellung von historischen Wissensbeständen sind und sich zugleich mit einem deutlich erkennbaren Adressatenbezug an junge Leser beiderlei Geschlechts richten.»10
Für das 17. Jahrhundertsind hier beispielsweise so bekannte und verbreitete Bücher wie die Historischen Bilder (1672)von Johann Buno (1617–1697)oder Johann Hübners (1668–1731) Kurtze Fragen aus der Politischen Historia (1697)zu nennen.11 Für das beginnende 18. Jahrhundert ist an Christoph Cellarius (1638–1707) Kurtze Fragen aus der Historia Universali (1714)zudenken.12 Dazu zählen aber auch die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Werke: Der Neu-eröffnete Historische Bilder-Saal (zuerst 1692)und die Sculptura Historiarum et Temporum Memoratrix (1697)mit ihren verschiedenen Ausgaben, die im Verlauf des 18. Jahrhunderts erschienen.
Einher ging die quantitative Zunahme der Geschichtsbücher für Heranwachsende mit der Bedeutung, die der Realie Historie nun als eigenständiges Lehrfach zugesprochen wurde:
«Die Historie hatte [ ]bereits im 16. und 17. Jahrhundert einen Platz im protestantischen Schulwesen. Entweder wurde sie als Vorlesung verordnet oder als Ergänzung zur grammatisch-rhetorischen Unterweisung betrieben. Man kann also nicht davon sprechen, dass die Historie erst im späten 17. Jahrhundert in die Schule eingezogen ist. Sie hat sich lediglich verändert und institutionell verselbstständigt.»13
Auch am Druckort des Bilder-Saals sowie der Sculptura Historiarum et Temporum Memoratrix,inder ReichsstadtNürnberg, erhielt die Universalhistorie –also die Historien «vom Anfang der Welt bis auf unsere Zeit»14 – um 1700 Einzug in den gymnasialen Fächerkanon – und zwar schon in den unterenKlassen. Geschichte als Unterrichtsfach setzte sich folglich allmählich im höheren Bildungswesen durch und wurde mit der Ausrichtung auf die prudentia politica im
10 Schmideler 2012, 14. Als historiographisch ist damit die Abhandlung über vergangene Ereignisse, die narratio rei gestae,gemeint und nicht lateinische Klassiker, die durchaus auch Historien behandelten, vor allem aber der Rhetorik dienten. Auch wenn das (generische)Maskulinum in der Ansprache der Zeit und auf den Titelblättern und in den Vorreden überwiegt, dem Wortlaut nach also Jungen und junge Männer gemeint sind, wird sich in der Arbeit zeigen, dass auch Frauen die Bücher rezipierten. Deshalb werde ich an den Stellen, an denen Frauen explizit oder vermutlich «mitgemeint»sind, dies sprachlich deutlich machen.
11 Buno 1672;Hübner 1697.
12 Cellarius 1714.
13 Nagel 2014, 47 f. Nagel selbst plante eine dringend notwendige Überblicksstudie zum Geschichtsunterricht in der Frühen Neuzeit (1650–1750). Alte, aber dennoch bislang grundlegende Überblicksdarstellungen sind:Paulsen 1885;Scherer 1926;Hösch 1961. Zum Geschichtsunterricht an Universitäten auch:Engel 1959;Huttner 2007 sowie für die Universität Ingolstadt als «katholisches»Beispiel Dickerhof 1971.
14 Vgl. das Titelblatt von Faber/Weigel 1699.
Verlauf des 18. Jahrhunderts – auch in den katholischen Territorien – immer deutlicher zu einem wichtigen Bildungsgut «für die studierendeJugend», «für junge Leute»oder «für Kinder».15 Obwohlsich an Heranwachsende adressierte und gedruckte Werke geschichtlichen Inhalts beispielsweise als «ouvrage nécessaire aux jeunes gens»16 in Frankreich oder in England «for the instruction of youth»17 finden, hat dieses Phänomen in den deutschsprachigen «Bildungslandschaften»basierend auf dem Prinzip der «Konkurrenz» – betreffend Konfessionen, Schultypen und Erziehungsmodelle – seine breiteste Wirkungentfalten können.18 Der antike Topos von der Geschichte als Lehrmeisterin des Lebens (historia magistravitae)richtete sich vor allem an Heranwachsende: Historia magistra iuventutis.
15 Während an den protestantischen Universitäten im Reich «Geschichte»als Unterrichtsfach schon im 16. Jahrhundert eingerichtet wurde, zogen die katholischen Hochschulen erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts nach. S. dazu auch Kapitel 4. Zur prudentia politica siehe Kapitel 1.1.
16 Vgl. Renaudot 1765. Bereits Charles Rollin, Jansenist und ehemaliger Rektor der Pariser Universität, plädierte in den 1720er Jahren für die Einführung von Geschichtsunterricht. Seine Histoire ancienne (1742)war bereits einem breiten Publikum zugänglich, so Grell 2008, 150. Dies zeigt sich auch an deutschen und italienischen Übersetzungen des Werks.
17 Vgl. Stackhouse 1770. Wichtig war auch Nathaniel Crouch, der unter dem Pseudonym Richard Burton jungen Leser*innen, auch über Illustrationen, Zugang zur Geschichte bot. S. Mayer 1994. Woolf 2000 machte für England deutlich, dass sich das Publikum historischer Arbeiten im Verlauf der Frühen Neuzeit von kleinen Gelehrtenzirkeln auf eine breitere, gebildete Öffentlichkeit ausweitete. Die Durchsicht der Datenbanken ergab für England dementsprechend Treffer, allerdings sind die Werke mit einer expliziten Adressierung an Heranwachsende dort wie auch in Frankreich vor allem auf die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zu datieren. Vgl. Grenby 2011, 5; Woolf 2012. Ein Beispiel aus Italien ist Antonio Fulgoni, Compendio della storia santa ad uso de’ fanciulli, Rom 1782.
18 Der Begriff Bildungslandschaften zuerst bei Schindling, 3. Daran anschließend und diskutierend unter anderem Rutz 2010. Wichtig ist mir die Betonung der räumlichen und zeitlichen Dynamik von Bildungslandschaften (23). Einen jüngeren Überblick der Forschung zu diesem Thema bei Walter 2021, 2f.Zum «Vorherrschen des Konkurrenzprinzips»imfrühneuzeitlichen deutschen Schulwesen zuerst Schmale 1991, 631 f. Darauf aufbauend Ehrenpreis 2003, 31 f. Er betont, dass neben der konfessionellen Konkurrenz «inden Städten die Konkurrenz einzelner Bildungsinstitutionen ein vielfach belegbares Phänomen»sei. Die dritte KonkurrenzKategorie sei die zwischen privat-familiärer und öffentlich-schulischer Bildung. Zur entsprechenden Schulbuchproduktion der Zeit vgl. Haug 2015, 14.
Historische Lehrwerke –
Geschichtenvon Wirklichkeiten und Möglichkeiten
Betrachtet man die Vorworte bzw. Titelblätter der historiographischenKinderund Jugendliteratur, tritt – entsprechend der Lehrmeisterin-Metapher – in diesen Werken ein Merkmal der heranwachsenden Adressaten besonders hervor: Heranwachsende müssen unterwiesen und belehrt werden. Die Werke verstanden sich als propädeutische Werke, um «einem andern eben diejenige Erkäntnuß von einer Sache [indiesem Fall der Geschichte, Anm. KH], die man selber hat, beizubringen und mitzuteilen suchen»19 , wie es in Zedlers Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste unter dem Lemma«Unterweisung» heißt. Die Medien der Unterweisung hatten somit im Wesentlichendie Intention, heranwachsende, gleichsam unwissende Menschen in das studium historicum einzuführen, und sie wollten über grundlegende Ereignisse der Weltgeschichte informieren, belehren und erziehen, kurz:Sie wollten aufklären 20 Unter diesem Aspekt einer möglichen Wissensvermittlung und eines möglichen Bildungserwerbs berührt meine Arbeit Aspekte der historischen Bildungsgeschichte, speziell der historischen Bildungsmedienforschung. In diesem Themenbereich entstehen und entstanden in den letzten Jahren und Jahrzehnten für den deutschsprachigen Raum Arbeiten, die sich speziell mit der «Schulwirklichkeit»bzw. der «Schulbuchwirklichkeit»auseinandersetzten, obwohl generell die Verengung dieser Begrifflichkeiten auf den schulisch-institutionellenKontextreflektiert wird und insbesondere für die Zeit vor 1800 die Frage zu stellen ist, was denn überhaupt ein Schulbuch ist.21
19 Anon., Unterweisung/Zedlers Universal-Lexicon 1746, 2299.
20 Vgl. Brunken 1991, 30:Die Geschichtsbücher für Kinder und Jugendliche gehören zu jenen Werken «(schulisch‐)propädeutischen Charakters [ ], die zur sprachlichen und rhetorischen Erziehung dienen, in die sog. Realienfächer einführen oder auch künstlerische und technisch-praktische Fertigkeiten vermitteln wollen.» Alzheimer-Halle 2004, 29–31, nennt unter Forschungsstand und Perspektiven explizit Kinder-und Jugendliteratur als Aufklärungsobjekt –und dies gilt transnational, wie Appel/Christensen/Grenby 2023, 9, betonen:«Avery important factor, and something largely specific to books published for children, was the drive to educate young people.»
21 Geprägt wurde der Begriff «Schulwirklichkeit»von Neugebauer 1985. Jünger Töpfer 2012, 4. Er spricht von «Schul-und Bildungswirklichkeit»; ebenso Pietzko 2020, 14 f. Die Frage, was ein Schulbuch sei, stellen explizit:Baldzuhn 2005;Grafton 2008. Kümper 2009 spricht von Lehrmitteln für die historische Unterweisung. Eine Zusammenfassung der Forschung findet sich bei Pietzko 2020, 15–18. Ein Dank gilt den Anregungen für die Planungen meines Promotionsprojektes auf der Nachwuchstagung zur historischen Bildungsforschung, Zürich 2011.