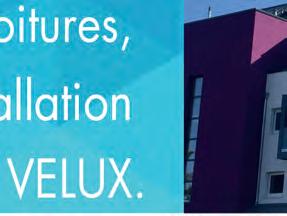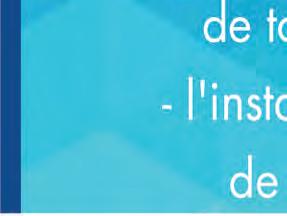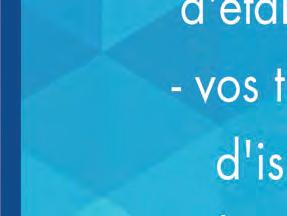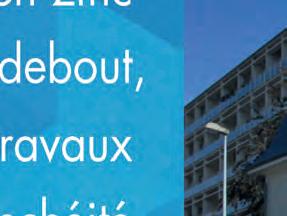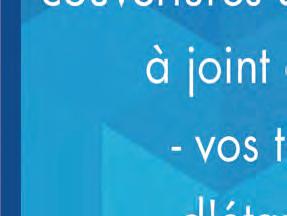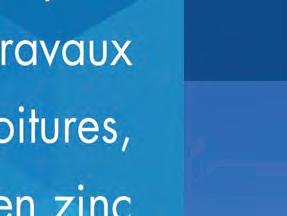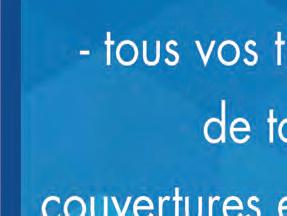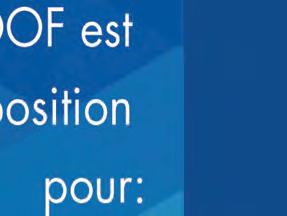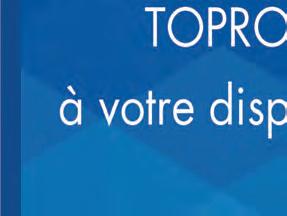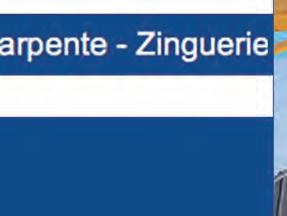6 minute read
Digitalisiertes Haus: Wie smart denn noch?
Brauchen wir smarte Häuser?
Die Digitalisierung macht auch vor unseren Wohnhäusern nicht Halt. Das kann durchaus hilfreich sein. Oder aber völlig übertrieben.
Als vor ein paar Jahren die Redaktionsräume der revue renoviert wurden, bekamen wir dimmbare LED-Balken über die Schreibtische, die per App zu bedienen sind. Seitdem machen sich hin und wieder ein paar Kollegen den Spaß, einzelne Lampen an oder aus, hell oder dunkel zu stellen – unerkannt und von Ferne, versteht sich. Doch nur etwa die Hälfte aller Kollegen hat die App überhaupt heruntergeladen. Das grenzt zwar den Kreis der Verdächtigen ein, gleichzeitig müssen genau die aber auch wieder dafür sorgen, das Licht hinterher einzustellen. Allen AppVerweigerern bleibt nämlich nur die Option, den Lichtschalter zu betätigen. Diesen gibt es zwar noch, aber er schaltet das Licht lediglich an oder aus, und
das bei allen Lampen gleichzeitig, was zwangsläufig zu neuen Querelen führt.
Über eine App zu steuerndes Licht gehört längst zum normalen Equipment von Großraumbüros und Wohnhäusern. Denn der Trend zum „intelligenten“ oder „smarten“ Haus ist nicht mehr aufzuhalten. Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man sich durch die Webseiten der Hausbau- und Elektrofirmen klickt. Die Digitalisierung macht auch vor Heizungsanlagen, Kühlschränken und Fenstern nicht halt. Es sei denn, man kann mit der Schmach leben, dass sein popeliges Auto klüger ist als das zwanzigmal teurere Eigenheim. Aber wer will das schon?
Smarte Häuser können fast alles. Sie öffnen, schließen und verriegeln die Fenster selbstständig, sie merken, wenn sich eine Person zu lange auf dem Boden aufhält und vielleicht Hilfe benötigt, sie regeln die Heizungsanlage, stellen den Herd auf Null, bestellen Essen, wenn der Kühlschrank leer ist, lassen wohltemperiertes Badewasser ein, schmeißen die Kaffeemaschine an, saugen Staub, mähen den Rasen, zerkleinern den Müll usw. Kurzum: Smarte Häuser ersetzen das Personal, das sich früher nur die oberen Zehntausend leisten konnten und versprechen ihren Bewohnern ein sorgenfreies, entspanntes Leben. Zudem helfen sie mit, auch im Alter noch selbstständig und sicher allein leben zu können. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen.
Nun ja, vielleicht doch. Ein paar Worte könnte man sicher verlieren. Zum Beispiel darüber, dass die Gedächtnisleistung von Menschen tatsächlich nachlässt, wenn sie sich darauf verlassen, dass ein anderer (in dem Fall eine Maschine) für sie die Organisation des Alltags übernimmt. Etliche Studien haben ergeben, dass man sich an Dinge, die man an andere abgegeben hat, oft genauso schlecht erinnert wie an eine Konferenz, bei der man alles Gesagte mitgeschrieben hat. In beiden Fällen gibt es auch keine Notwendigkeit dafür. Im ersten Fall hat man die Verantwortung abgegeben, im zweiten hat man alles schriftlich. Das Gedächtnis darf also aussortieren.
Sicher, man kann sein Gehirn anders trainieren. Zum Beispiel, indem man Sudokus löst. Oder sich in
Onlineportalen mit schwierigen Denksportaufgaben beschäftigt. In einem Haus, das nur noch über das Tablet oder per Sprachanweisung gesteuert wird, hat man viel Zeit, gezielt Körper und Geist zu trainieren, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Doch wozu extra Gedächtnisjogging betreiben, wenn das wahre Leben die täglichen Übungen frei Haus liefert?
Einkaufen zu gehen, daran zu denken, den Herd auszuschalten, den Rasensprenger abzudrehen – genau diese Sachen sind es doch, die unsere


Großeltern fit gehalten haben. Das ist technikfeindlich? Nicht wirklich. Es geht nicht darum, die Zeit zurückzudrehen. Aber es geht darum, sich mit gesundem Menschenverstand zu fragen, was man wirklich braucht. Sein Eigentum zu schützen und digital zu überwachen? Unbedingt. Seine Heizungsanlage, Rollläden oder Springbrunnen in Luxemburg auch aus dem Urlaub in Peru steuern und überwachen zu können? Nun ja, wer Spaß dran hat. Doch wer bitte schön braucht intelligente Fenster, die dem Fensterbauer übermitteln, wann die nächste Reparatur fällig ist? Und was passiert eigentlich mit dem ganzen Kram, wenn der Strom mal wieder ausfällt? Und wer kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass mir Alexa zwar jeden Wunsch von den Lippen abliest, aber immer genau dann die Ohren verschließt, wenn sie es soll?
Das gute an Forschung und Wissenschaft ist, dass sich Forscher und Wissenschaftler nichts verbieten. Sie forschen in alle Richtungen und entwickeln in jedem Bereich. Die Entscheidung darüber, welche Dinge sinnvoll sind, müssen wir Verbraucher selbst treffen. Tun wir es nicht, begeben wir uns in eine totale Abhängigkeit. Denn dann können wir ohne Smartphone gar nichts mehr tun. Weder die in die Wand integrierten Lautsprecher bedienen noch unsere Kaffeemaschine. Und die Lampen im Großraumbüro schon gar nicht. Aber vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis wir das alles ohnehin nicht mehr brauchen.
Elon Musk hat letztens schon den ersten Chip vorgestellt, der Querschnittsgelähmten zu einer besseren neuronalen Übertragung der Impulse verhelfen soll. Der Chip wird unter die Kopfhaut gepflanzt. Es ist ein ehrenwertes Projekt, weil es Hoffnung in einem hoffnungslosen Bereich verspricht. Doch wieso da aufhören? Wieso nicht auch die Neuronen von anderen Menschen beeinflussen? Wieso nicht von allen? Dann bräuchten wir nicht einmal mehr intelligente Häuser. Dann könnten wir uns einfach vormachen lassen, in einem Palast zu wohnen, während wir tatsächlich in irgendeiner Höhle stecken. Ohne Licht, ohne Strom, ohne Thermomix und ohne Flachbildschirm. Die Matrix lässt grüßen.