



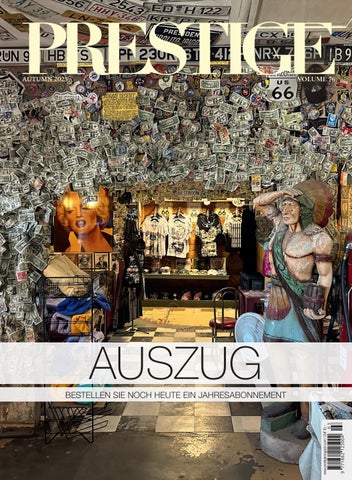





Launched in 1953, the Fifty Fathoms is the first modern diver’s watch. Created by a diver and chosen by pioneers, it played a vital role in the development of scuba diving. It is the catalyst of our commitment to ocean conservation.




erscheint vierteljährlich
OWNER
Schweizer Fachmedien GmbH
Pfeffingerstrasse 19
CH-4153 Reinach
Telefon +41 61 711 13 93 info@schweizerfachmedien.ch www.schweizerfachmedien.ch
PUBLISHER
FRANCESCO J. CIRINGIONE
PUBLISHING DIRECTOR
HASAN DURSUN
HEAD OF PRESTIGE
BORIS JAEGGI
b.jaeggi@schweizerfachmedien.ch
EDITOR IN CHIEF
URS HUEBSCHER
u.huebscher@schweizerfachmedien.ch
HEAD OF SALES
HAZIM JUNUZOVIC h.junuzovic@schweizerfachmedien.ch
SALES
VIRGINIE VINCENT v.vincent@schweizerfachmedien.ch
HEAD OF PRODUCTION & ART DIRECTION
MELANIE MORET m.moret@schweizerfachmedien.ch
PRODUCT PUBLIC RELATION info@schweizerfachmedien.ch
EDITORS
KONSTANTIN ARNOLD
BETTINA BÄCK
NATHALIE BECKER
DETLEF BERG
GISBERT L. BRUNNER
ALEXANDER CHETCHIKOV
VIVA CRUISES
NORBERT EISELE-HEIN
VIVIEN GRÜNDEMANN
THOMAS HAUER
MARIO HETZEL
SILVA IMKEN
BEAT KRENGER
VAS MUSCA
NELA PANIC
GABRIELA RÖTHLISBERGER
BETTINA SCHMID
MAURA WASESCHA
SKNIFE
SWENJA WILLMS
CORRECTOR
MARIO HETZEL
COVER Visit Arizona
PHOTOGRAPHS
Matthieu Ronsse, Stefan Rohner, Fotografis, Omega, Cartier, Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Die Gestalten Verlag GmbH, Nube, White Wall, Image database, Gucci, Vacheron Constantin, Tornaghi, Al Coro, Pomellato, IsabelleFa, Gübelin, Hermès, Hublot, Swarovski, Hamilton, Venezianico, Ralph Lauren, IWC, Glashütte, Sinn,Porsche Design, Roger Dubuis, Favre Leuba, Bvlgari, Thomas Sabo, Audemars Piguet, Chopard, Audi, Baume&Mercier, Montblanc, Minase, Astion Martin, Jaguar, McLaren, Porsche, Loberon, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Tsatsas, Crocs, Windsor., Jimmy Choo, Longchamp, Replay, Barbour x Farm Rio, Falke, Fila, Viky x Lodenfrey, Tommy Hilfiger, Hackett, Moscot, Calvin Klein, JM Vetement Manufaktur, Frama, Dolce&Gabbana, La Prairie, Brioni, Infiniment Coty Paris, Louis Vuitton, Tom Ford, Rivoli, Coco Mademoiselle, Rituals, Zwilling Beauty, Douglas, Prada, Birkenstock, Molton Brown, Nivea Men, Lalique, Zebra, La Prairie, Zwiesel und Glas, Laufen, Sweef, Roberto Cavalli Home Interiors, Stylish Club, Bucherer Fine Jewellery
ADMIN, COORDINATION & SUBSCRIPTIONS
SERPIL TÜRKMEN s.tuerkmen@schweizerfachmedien.ch
PRICE
Issue CHF 10.–/€ 11.–Year CHF 39.–/€ 40.–
is a registered trademark. (IGE 596.147)
ISSN Print: 1662-1255
ISSN E-Mag: 2813-1495
A PART OF FIRST CONSULENZA AG

Ihre exklusive Flusskreuzfahrt auf der Seine.
Informationen zu Ihrem Boutique-Hotel auf dem Fluss finden Sie unter: www.viva-cruises.com/vivaboutique






20 OZZY FOREVER Dreamer, Madman oder Prince of Darkness?
26 STREET SCENES
Metropolen durch das Objektiv von Phil Penman
32 DER ETIKETTEN(-SCHWINDEL) Wo ein Jackett zum Eklat wird
37 EDITOR’S CHOICE
Entdeckungen im Zeichen der Kultur
38 EINE FRAU, DIE GESCHICHTE MALTE UND AUS IHR VERSCHWAND Das Kunsthistorische Museum in Wien
40 BLÜHENDE MUSE
Eine Hommage an die Rose
47 SHORTCUT BOOKS
Buch-Highlights auf einen Blick
48 LAS VEGAS’ FANTASTISCH FUNKELNDER FRIEDHOF Das Neon Museum

54 LUST AUF LUXUS(-UHREN) Wenn Leidenschaft stärker als der Markt ist
63 WUSSTEN SIE SCHON ...? Harry Winston
66 DER FEURIGE RUBIN
Der König der Edelsteine
70 NEXT GENERATION DIAMONDS Der Diamant im Wandel der Zeit
Gewinnen Sie eine Leica Q3
Fotografieren Sie wie Phil Penman – eindrucksvoll.
Leica Ambassador Phil Penman begeistert mit seiner faszinierenden Bildstrecke aus Biel-Bienne und zeigt eindrucksvoll, wie ausdrucksstark Fotografie sein kann. Entdecken auch Sie die Welt der ambitionierten Fotografie – mit Ihrer Teilnahme an einem Leica Entdeckerkurs.
Scannen Sie den QR-Code, um am Gewinnspiel teilzunehmen oder sich direkt für einen Entdeckerkurs anzumelden. Anmeldeschluss bis am 31.10.2025






74 DIE ERFINDUNG DES AUTOS Eine kleine Zeitreise auf vier Rädern
78 MOTORSPORT TRIFFT LEGENDEN Goodwood Festival of Speed 2025
86 GEBOREN UND AUFGEWACHSEN IN SANT'AGATA
Lamborghini zeigt den Temerario GT3
88 LAMBORGHINI AUF REKORDKURS Im Gespräch mit Stephan Winkelmann
90 ROUTE 66
Unterwegs auf dem legendären Highway
95 WUSSTEN SIE SCHON ...? Kicks an der Route 66 in Missouri
96 DIE STILLE GLUT DER GESCHWINDIGKEIT Genesis GV60
100 DER FÜNF-STERNE-FLUGHAFEN Hamad International Airport Katar
102 GADGETS
Mehr als nur Accessoires
104 STILSICHER Modeklassiker, die bleiben
114 SKINNY JEANS
Das grosse Comeback der figurbetonten Jeans
118 GASTFREUNDSCHAFT
TRIFFT HAUTE COUTURE Luxus neu definiert
122 FASHION MADE IN SWITZERLAND Jelena Zoric bringt die Fashionweek nach Basel
125 WUSSTEN SIE SCHON ...? Die Geschichte von Denim
126 FÄDEN DER ZEIT Spitzenkunst von Nevena Couture
130 MEISTER DER COUTURE Cristóbal Balenciaga
136 DER WINTER WIRD ICE PINK Die Winterkollektion von ELHO
BALGACH Eggenberger Wohnen BASEL Möbel Rösch, Passion for Beds BÜLACH Scheidegger Möbel KRIENS Möbel Amrein LUZERN Buchwalder-Linder, Colombo la Famiglia OLTEN Möbel Kissling ROLLE Styles Interiors SCHATTDORF Muoser WILL Gamma Einrichtungshaus ZOLLIKON Colombo la Famiglia ZÜRICH Zingg-Lamprecht ZWEISIMMEN Müller-Hirschi Interieur



138 IM BANN DES JASMINS
Daphné Bugey über die Entstehung von Gelsomino
144 SCHÖNHEIT AUS DER HÖHE DER ALPEN 20 Jahre Alpeor
146 DR. HAUSCHKA Long Lasting Mascara
148 HAUTVERJÜNGUNG FÜR ZU HAUSE
FAQ™-400-Kollektion
152 ERGEBNIS: NICHT 100, SONDENR 120 PROZENT! Wenn Ruebli als Augenbooster versagen
156 UNIQ LINE
Wo Schönheit, Präzision und Wohlbefinden eins werden
158 DIE NEUE ÄRA DER HAUTGESUNDHEIT Skingevity
159 INNOVATION FÜR GESTRESSTE HAUT
Le Visage N°02

160 RAUM FÜR GENUSS
Wo Architektur und Kulinarik Hand in Hand gehen
167 TRADITION TRIFFT SCHLAFLUXUS Hästens
168 KOLUMNE Maura Wasescha
169 HANDWERKSKUNST AUS DER UHRENSTADT BIEL sknife
172 DER MIT DEM FALKEN TANZT Faszination Falknerei in den Emiraten
178 NATURVERBUNDENER LUXUS Wiesergut
180 DIE ERSTE WELTUMSEGLERIN DER GESCHICHTE Jeanne Baret
182 DREI FLÜSSE, DREI WINTERMÄRCHEN Festtage auf Seine, Donau und Rhein
186 STEWARDESSENMODE Ein Flug durch die Geschichte der Uniformen
192 KAMBODSCHA Faszinierendes Königreich in Südostasien
195 MADE IN ITALY Florenz, die Wiege der Haute Cuture
196 WUSSTEN SIE SCHON ...? Hilton Hotels
198 WO GESCHICHTE WOHNT UND LUXUS LEBT Rosewood München
200 DIE WELTWEITE ANERKENNUNG DES CARLTON HOTEL SINGAPORE Interview mit Darren Ware
202 WUSSTEN SIE SCHON ...? Motorworld Mallorca
203 «ICONS TESTED» Kompromisslos zur IKONE

DESIGN YOUR HOME GYM
Technogym Boutique
Pelikanstrasse 5, 8001 Zürich
Technogym Showroom
Werkstrasse 36, 3250 Lyss Tel 032 387 05 12
Mehr entdecken


209 SYNONYM FÜR PREMIUMSCHOKOLADE und Sprüngli
210 STILVOLLE BARKULTUR
Bar
NEUER WEG
GOLS: Die Handschrift Paul Achs
213 WUSSTEN SIE SCHON ...? faszinierende Geschichte Champagners
VISION VOM PERFEKTEN JAHRGANG Laurent-Perrier
64 JEWELLERY
68 WATCHES MEN
72 WATCHES WOMEN
116 FASHION WOMEN
134 FASHION MEN
150 BEAUTY WOMEN
154 BEAUTY MEN
170 LIVING
204 REISE DURCH RAUM UND AROMEN ConTanima
216 CHAMPAGNER DER ZUKUNFT Louis Roederer präsentiert Vintage 2018
219 PRICKELNDER GENUSS Paladin bringt Dolce Vita ins Glas
220 ANNA ROS Botschafterin der besten Küche Sloweniens
222 ZU FUSS IN DEN MILLIARDENMARKT

Investment
EIGENMIETWERTS den Wandel


MAURA WASESCHA AG: DIE KUNST DES LUXUS, DIE ESSENZ DER EXZELLENZ IN ST. MORITZ
Seit über 47 Jahren steht Maura Wasescha AG für höchste Eleganz und Prestige im Luxusimmobilienmarkt von St. Moritz. Mit tiefem Wissen über die Region und einem exklusiven Netzwerk bieten wir außergewöhnliche Residenzen an den schönsten Orten des Engadins und darüber hinaus. Unser Anspruch geht über klassische Vermittlung hinaus: Wir gestalten maßgeschneiderte Erlebnisse – von individueller Beratung über diskrete Verwaltung bis hin zu stilvollem Interior Design und Concierge-Services auf höchstem Niveau. Jede Immobilie ist ein Meisterwerk, in dem Komfort, Privatsphäre und natürliche Schönheit eine perfekte Einheit bilden. Mit Maura Wasescha AG wird Luxus zur gelebten Realität – einzigartig, stilvoll und unvergleichlich.



Im laufenden Jahr erlebt die Luxusbranche rasante Fortschritte wie die Hyperpersonalisierung, bei der künstliche Intelligenz Produkte und Dienstleistungen auf den individuellen Geschmack zuschneidet. Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema: Upcycling-Materialien und ethische Praktiken werden zum neuen Standard. Luxusmarken werden heute nicht mehr nur nach Ästhetik und Handwerkskunst, sondern auch nach ihrem ökologischen Fussabdruck und ihrer ethischen Beschaffung beurteilt. Verbraucher fordern Transparenz, und Luxusanbieter müssen sich daran halten. Umweltfreundliche Materialien, nachhaltige Lieferketten und ethische Arbeitspraktiken sind nicht nur «nice to have», sondern unverzichtbar. Darüber hinaus werden Innovationen im Bereich Öko-Luxus – von biologisch abbaubaren Stoffen bis hin zu kohlenstoffneutralen Produktionsprozessen – zum Markenzeichen erstklassiger Marken. Die Philosophie «Grün ist das neue Schwarz» stellt sicher, dass die Pracht von Luxusgütern heute nicht auf Kosten des Wohlbefindens von morgen geht.
Darüber hinaus gewinnen «phygitale» Erlebnisse – die Kombination aus physischer Präsenz und digitaler Erweiterung – an Bedeutung und verwischen die Grenzen zwischen stationärem und Online-Shopping. Ein weiterer aufkeimender Trend ist die Kreislaufwirtschaft: Secondhand-Luxusartikel zelebrieren Langlebigkeit und Geschichte. Und schliesslich ist mit einem Aufschwung des Erlebnisluxus zu rechnen: Vermögende Privatpersonen entscheiden sich für Produkte und Erlebnisse voller Exklusivität, Geschichten und kulturellem Reichtum.
Der moderne Luxuskonsument legt also viel Wert auf Zweckmässigkeit wie auch auf Prestige. Er definiert Luxus neu und bevorzugt Marken, die seinen Werten entsprechen – sei es Nachhaltigkeit, Innovation oder eine persönliche Note, die seine Individualität unterstreicht.
Viel Lesevergnügen!
Urs Huebscher Editor in Chief





Das Füllhorn des Lebens wurde von Ozzy Osbourne –Frontman von Black Sabbath, Pionier der Heavy- Metal-Szene, Solokünstler, Skandalrocker mit bizarren Auftritten und Reality-TV-Star – mit Sicherheit mehrfach zum Bersten gebracht. Am 22. Juli 2025 verliess der an Parkinson erkrankte Weltstar im Alter von 76 Jahren die irdische Welt. Die Retrospektive auf seine knapp acht Jahrzehnte
Lebenszeit, in denen er unter anderem vielen das Weltbild kräftig vom Sockel gestossen hat, ergibt eine unglaubliche Summe an bemerkenswertem Material zu seiner schillernden Persönlichkeit.
Autorin_Gabriela Röthlisberger
Seine Präsenz in der Öffentlichkeit hielt er bis fast zuletzt aufrecht, denn am 5. Juli 2025, lediglich 18 Tage vor seinem Tod, hatte Osbourne seinen letzten öffentlichen Auftritt bei einem mit Bestimmtheit in die Geschichte eingehenden Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen sass er dabei auf einem schwarzen Thron – selbstredend in Fledermaus-Optik. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Originalbesetzung von Black Sabbath wieder gemeinsam auf der Bühne stand. Karten für das Konzert, bei dem auch Metalbands wie Metallica, Guns N’ Roses, Tool und Slayer auftraten, waren im Februar innerhalb von 16 Minuten ausverkauft. Für alle, die keine Tickets mehr ergattern konnten, bestand die Möglichkeit, das Abschiedskonzert online als Livestream miterleben zu dürfen.
ABSCHIEDSSHOW HINTERLÄSST BLEIBENDEN EINDRUCK
Nun sind Black Sabbath – die Band verkaufte während der Zeit ihres Bestehens satte 75 Millionen Alben – und der gute alte Ozzy Osbourne also Geschichte, und zwar eine, die mit purer Selbstlosigkeit endet: einer vorbildlichen Dimension der Werteorientierung, die fremde Vorteile priorisiert, anstatt in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Bei der Benefizveranstaltung wurden schätzungsweise 190 Millionen Dollar eingespielt. Und die Sache ging sogar noch weiter, schliesslich verfolgten zusätzlich rund fünf Millionen Zuschauende das legendäre Konzert der wiedervereinten Kultband Black Sabbath im Pay-per-View-Livestream, was wiederum einen Umsatz von stolzen 150 Millionen Dollar einbrachte. Die Frage eines Fans auf Facebook, ob die Einnahmen aus dem Livestream zusätzlich zu den Einnahmen aus der Live-Veranstaltung selbst für wohltätige Zwecke gespendet werden würden, beantwortete Osbournes Team einstimmig: «Die gesamten 100 Prozent der Einnahmen aus dem Livestream werden an Acorns Children’s Hospice, das Birmingham Children’s Hospital und Cure Parkinson’s gehen.» In unserer aktuell schnelllebigen, oberflächlichen und leider zum grössten Teil konsumorientierten Gesellschaft ein richtiggehender Lichtblick auf den Sozialhumanismus und die damit zusammenhängende hoffnungsvolle Zukunft.

Die kursierenden Spendeneinnahmen sind logischerweise nur Schätzungen. Fakt ist jedoch, dass eine enorme Menge Geld für den guten Zweck zusammengekommen ist – und zwar konkret für Kinderheime und Kinderkrankenhäuser.
IST EINE DERARTIGE KARRIERE HEUTZUTAGE NOCH REALISIERBAR?
Die Musikwelt trauert also um eine ihrer grössten Ikonen – Ozzy Osbourne, prägende Figur der Heavy-Metal-Szene, ist diesen Sommer im Alter von 76 Jahren verstorben. Geboren 1948 in Birmingham, verliess er die Schule mit 15 Jahren. Als Frontman von Black Sabbath drückte der «Prince of Darkness» mit seiner theatralischen Bühnenpräsenz dem Ruhm der Band und der Heavy-Metal-Szene seinen Stempel nachhaltig auf – letztendlich gelten die Musiker von Black Sabbath als Pioniere des Heavy Metal.
Den Titel, Heavy Metal erfunden zu haben, gaben sich die Musiker keinesfalls selbst, sondern diejenigen, die die Musik dieses Genres mitgestalteten, bezeichneten Black Sabbath als die erste Metal-Band.
Der weltweit bekannteste Song und die Single mit der höchsten Chartplatzierung von Black Sabbath ist der 1970 entstandene Song «Paranoid». Auch mit «Iron Man» und «War Pigs» feierten sie grossartige Erfolge. Mit ihrem düsteren, schweren Sound, den harten Gitarrenriffs und den zynischen Texten wurden Black

Sabbath wahre Meister dieses neuen Genres. Man höre und staune: Die Band verkaufte während ihrer jahrzehntelangen Karriere mehr als 75 Millionen Alben.
Der hohe Wiedererkennungswert von Osbournes markanter nasaler Stimme war neben dem ausgesprochen düsteren Gitarrensound von Tony Iommi die kennzeichnenden Elemente der Musik. Ozzy riss die Bühnenshow buchstäblich an sich, denn der exzessive Showman wirkte neben dem eher introvertierten Leadgitarristen und dem fast stoischen Bassisten Geezer Butler wie ein in Rage geratener Wahnsinniger, indem er auf der Bühne herumhüpfte und wild in die Hände klatschte. Sein überwiegend unkontrolliertes Verhalten blieb nicht ohne Konsequenzen: Wegen Drogen- und Alkoholproblemen feuerte ihn die Band 1979.
VOM BERÜCHTIGTEN ROCKSTAR ZUM ERFOLGREICHEN SOLOKÜNSTLER
Dank seiner Managerin und späteren Ehefrau Sharon Arden startete Osbourne eine senkrechte Solokarriere. Mit Hits wie «Crazy Train», «Mr. Crowley» oder «I Don’t Know» wurde sein Debütalbum «Blizzard of Ozz» (1980) unmittelbar nach dem Erscheinen ein kommerzieller Erfolg. Insgesamt soll der Rockstar trotz seiner regelmässigen Alkohol- und Drogeneskapaden etwa 100 Millionen Platten verkauft haben.
Skandale zogen sich wie ein roter Faden durch das Leben von Ozzy Osbourne. Wer erinnert sich nicht mit leichtem Schaudern an eine der berühmtesten Rock’n’Roll-Geschichten aller Zeiten, als er am 20. Januar 1982 bei einem Konzert im Des Moines Veterans Memorial Auditorium in Iowa einer lebenden Fledermaus den Kopf abbiss, weil er sie für ein Gummitier hielt? Diese hatte ihm ein Zuschauer auf die Bühne geworfen, der sie zuvor aus dem naturwissenschaftlichen Bereich der hiesigen High School gestohlen hatte.
In seinen Memoiren «I am Ozzy» beschreibt der Musiker den Vorfall: «Es hat sich sofort falsch angefühlt. Sehr falsch. Mein Mund war plötzlich voll mit einer warmen, glibberigen Flüssigkeit mit dem schlimmsten Nachgeschmack, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe gespürt, wie sie meine Zähne verfärbt hat und mein Kinn runterlief.» Nach dem Konzert suchte Ozzy sofort einen Arzt auf, um sich gegen Tollwut impfen zu lassen.
GERÜCHT UM «SCHWARZE MAGIE»
HAFTETE ZEITLEBENS AN OZZY
Zu diesem Zeitpunkt hatte der «Madman» unglaublicherweise bereits Übung im Abbeissen von Tierköpfen. Als er im März 1981 in einem Plattenfirmen-Meeting mit CBS Records sass, sollte der Musiker als besondere Geste drei Tauben fliegen lassen, welche er bis zu dem grossen Moment in der Tasche aufbewahrt hatte. Doch zu diesem ursprünglichen Plan kam es nicht mehr. Beim wieder einmal schwer betrunkenen Osbourne stellte sich Langeweile ein und es kam zu einem heftigen Streit mit einer Angestellten des Labels, der eskalierte – Ozzy sah rot. Laut Musikjournalist und OzzyBiograf Mick Wall soll der Musiker später gesagt haben: «Ich habe eine der Tauben rausgeholt und ihr den Kopf abgebissen, nur damit sie die Klappe hält.» Das reichte dem «Madman» damals allerdings noch nicht: «Dann habe ich das Gleiche mit einer weiteren Taube gemacht und ihren Kopf auf den Tisch gespuckt. Daraufhin haben sie mich rausgeworfen.»
Folglich erscheint «Diary Of A Madman» nicht via CBS Records – die nächste Platte «Bark At The Moon» (1983) allerdings schon. Seit diesen Vorfällen wurde ihm immer wieder vorgeworfen, ein Teufelsanbeter zu sein, was der Musiker jedoch vehement von sich wies. Stets beteuerte er, mit schwarzer Magie nichts am Hut zu haben.


FAMILIENMENSCH, REALITY-TV-STAR
ODER BEIDES?
So skurril und vollgepackt mit Exzessen sein Leben auch gewesen sein mag, die eigene Familie hatte für Ozzy Osbourne immer einen besonders hohen Stellenwert. Aus seiner Ehe mit Sharon gingen drei Kinder hervor, darunter die Sängerin Kelly Osbourne, zwei Kinder brachte er aus erster Ehe mit. Mit der Doku-Soap «The Osbournes» zelebrierte er sein Alltagsleben im Kreis seiner Familie, doch auch heikle Themen wie Ozzys Alkoholprobleme und Sharons Krebserkrankung wurden thematisiert. Die Sendung wurde zwischen 2002 und 2004 in drei Produktionsstaffeln produziert und zwischen 2002 und 2005, je nach Zählweise, in vier oder fünf Sendestaffeln auf MTV ausgestrahlt. Die Soap wurde sogar mit einem Emmy-Award ausgezeichnet.
KAMPF GEGEN PARKINSON ENDET
MIT TRIUMPH FÜR OZZY
Ozzy Osbourne hatte sich mehreren Operationen an Rücken und Nacken unterziehen müssen, nachdem er 2019 bei einem Unfall in seinem Haus in Los Angeles eine Wirbelsäulenverletzung erlitten hatte – noch im selben Jahr wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. In einem emotionalen Interview

mit «Good Morning America» gab er 2020 öffentlich zu, an Parkinson zu leiden, einer Erkrankung des zentralen Nervensystems, die langsam, aber kontinuierlich fortschreitet.
Überraschenderweise trat Osbourne 2022 dennoch bei den Commonwealth Games in Birmingham auf. Nicht lange bevor er den Kampf gegen seine Krankheit aufgeben musste, erfüllte sich sein grösster Traum: das finale Black-Sabbath-Konzert am 5. Juli 2025!
PLATZ IM PANTHEON DER ROCKGÖTTER
Acht Tage nach dem Tod von Ozzy Osbourne versammelten sich Tausende Fans der Heavy-Metal-Legende zu einem Trauerzug durch dessen Heimatstadt Birmingham, wobei der Bürgermeister Safar Iqbal offiziell betonte, wie wichtig es sei, Ozzy als «Sohn der Stadt» angemessen und würdevoll die letzte Ehre zu erweisen. Die Stadtverwaltung hatte Osbournes letztes Geleit nach eigenen Angaben gemeinsam mit dessen Familie geplant. Mit Stolz blickt man nun in der zentralenglischen Stadt darauf zurück, den respektvollen Abschied der Rocklegende gemeinsam mit seiner Familie begangen zu haben – an dem Ort, an dem alles angefangen hatte.
Auf Plakaten in der Stadt war allerorts «Ozzy forever» zu lesen.

Am 9. September 2022 wurde das 13. Studioalbum «Patient Number 9» des britischen Rockmusikers Ozzy Osbourne veröffentlicht. Für den Titelsong, der am 24. Juni 2022 als erste Single erschien, designte Todd McFarlane das Musikvideo. Der selbstreflexive Text handelt von Osbournes Klinikaufenthalten und verarbeitet den Suizidversuch seiner Frau Sharon.
Wie bereits beim Vorgängeralbum «Ordinary Man» versammelten sich Gastmusiker und ehemalige Weggefährten um Osbourne, wie etwa Chad Smith und Duff McKagan. Als Zeichen einer grossen Ehrerbietung wirkten erstmals Musikgrössen wie Mike McCready, Eric Clapton und Jeff Beck an einem Osbourne-Soloalbum mit. Ebenso lieferte der im März 2022 verstorbene Foo-FightersSchlagzeuger Taylor Hawkins Gastbeiträge, der bereits 2010 mit Osbourne «Crucify the Dead» auf Slashs Soloalbum sang.
Robert Trujillo, der mit Ozzy bereits «Down to Earth» mit der Hit-Single «Dreamer» aufnahm, und Zakk Wylde kehrten zurück, Letzterer erstmals seit «Black Rain» (2007). Ex-Black-Sabbath-Kollege Tony Iommi komplettierte die grandiose Besetzung. Die Produktion übernahmen erneut Andrew Watt sowie Louis Bell, und Alexandra Tamposi wirkte einmal mehr am Songwriting mit.

Ganz ohne Frage sind feine und luxuriöse Armbanduhren en vogue – und zwar bei Menschen beiderlei Geschlechts. Daran ändert auch die Tatsache grundsätzlich nichts, dass sich das Firmament über dieser Szene seit 2024 sukzessive eingetrübt hat. Zu den auslösenden Faktoren gehören einmal die geopolitische Weltlage und mehr oder minder gravierende ökonomische Verwerfungen. Zum anderen schwächeln jahrelang extrem starke Märkte in Festland-China und Hongkong. Offensichtlich zur Schau gestellter Luxus kommt bei den kommunistischen Herrschern nicht mehr so gut an. Ob sich in dieser bevölkerungsreichen Region über kurz oder lang eine Erholung oder gar Trendwende einstellt, lässt sich gegenwärtig nur schwer vorhersehen. Zu diesen Problemen gesellte sich Anfang April 2025 die Ankündigung massiv auf 31 Prozent steigender Zölle auf Exporte in die Vereinigten Staaten von Amerika. So heiss wie gekocht musste die Suppe dann vorerst doch nicht gegessen werden. Mit Blick auf bilaterale Verhandlungen räumten die Amerikaner auch den Eidgenossen ein 90-tägiges Zoll-Moratorium ein. Während dieser Zeit lagen die Einfuhrabgaben bei verschmerzbaren zehn Prozent. In den ersten Augusttagen zerbarst die Hoffnung, dass sich letztlich alles zum Guten wenden möge, jedoch wie auf einen Steinboden gefallenes Glas. Statt der ursprünglich angedrohten 31 Prozent standen über Nacht deren 39 im Raum, zahlbar auf alle Importe ab dem 7. August 2025. Damit gehört die Eidgenossenschaft mit ihrer exportabhängigen Industrie zu den am härtesten getroffenen Ländern.
Autor_Gisbert L. Brunner

Ganz leicht hat es die Uhrenindustrie derzeit nicht. Aber die Lust auf tickenden Luxus am Handgelenk schmälert das keineswegs.
EXTREM WICHTIGER US-MARKT
Neben Pharmazeutik und Maschinenbau leidet die Schweizer Uhrenindustrie besonders stark, denn der US-amerikanische Markt rangiert bei den Exporten schon lange an erster Stelle. Aus den monatlich veröffentlichten Exportstatistiken geht hervor, dass sein Anteil seit 2019 ständig gewachsen ist, während Festland-China und Hongkong deutlich nachgaben. 1999 exportierte die Uhrenbranche Erzeugnisse im Wert von rund 21.7 Milliarden Franken in alle Welt. Davon flossen wertmässig gut elf Prozent in den Spitzenreiter USA. 2023, im bisher besten Uhrenjahr, lag der US-amerikanische Marktanteil bei knapp 15.6 Prozent. Im schwächeren Jahr 2024 waren es sogar knapp 17 Prozent. Die immense Bedeutung des Uhrensektors geht daraus hervor, dass er fast sieben Prozent der gesamten Ausfuhren erlöst. Daher taten die Verantwortlichen genau das, was in einer derart heiklen Situation geboten und verständlich ist: Sie exportierten Uhren in die USA, was das Zeug hält. Im April kletterten die Ausfuhren in die USA gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 150 Prozent. Zwar sanken die Ausfuhren im Mai 2025, aber sie taten das moderater als erwartet. Ähnliches gilt auch für den Juni. Neuere Exportzahlen standen bei Redaktionsschluss nicht zur Verfügung. So oder so ist davon auszugehen, dass Uhrenhersteller ihre Lager in der Neuen Welt mit Zöllen von «nur» zehn Prozent nach Kräften auffüllten.
BUMERANG ODER CHANCE?
Von diesen Beständen können die amerikanischen Händler vermutlich einige Monate zehren. Der amerikanische Einzelhandelsanalyst Luxury Watch Barometer (LBW) spricht von bemerkenswerten Umsatzsprüngen bei den Verkäufen an uhraffine Konsumenten, die ihren Hedonismus noch zu den günstigeren alten Konditionen befriedigen wollen. Sollte sich indes keine Zolleinigung zwischen den Regierungen der Schweiz und der USA erreichen lassen, ist das böse Erwachen nur eine Frage der Zeit. Weil Asien, Europa, der Mittlere Osten, Afrika und Ozeanien die amerikanische Lücke definitiv nicht füllen können, steht der Schweizer Uhrenindustrie eine schmerzhafte Durststrecke bevor. Die bekannten starken Player werden diese überstehen, wenn auch womöglich mit einigen Blessuren. Anders gestalten sich die Dinge bei weniger gut aufgestellten Marken mit starkem USA-Fokus sowie bei Zulieferern beispielsweise von Armbändern, Gehäusen, Zeigern und Zifferblättern. Insolvenzen oder Liquidationen scheinen vorprogrammiert. Aber womöglich hat das gegenwärtige Zolldesaster auch seine positiven Seiten. Kluge Firmenlenker werden zur Erkenntnis kommen, dass die Uhrenpreise in den Boomjahren zu sehr ins Kraut geschossen sind, und entsprechend handeln. Ausserdem stünde der über Jahre hinweg erfolgsverwöhnten Branche etwas Demut gut zu Gesicht. Die potenzielle Klientel würde beides freuen und zudem motivieren, ihrer Passion für feine Luxusuhren treu zu bleiben.
NEUE UHREN
Angesichts der misslichen gegenwärtigen Situation bleibt der Branche keine andere Wahl, als in die Offensive zu gehen. Attraktive Neuheiten stimulieren zum Erwerb einer neuen Begleiterin fürs Handgelenk. Und genau das demonstrieren die nachfolgend vorgestellten Armbanduhren.

SPRUNGHAFTES WESEN
Grundsätzlich neu ist das «Zeitwerk» von A. Lange & Söhne nicht. Bereits seit 2009 gibt es diese markante Armbanduhr mit grossflächiger Anzeige von Stunden und Minuten. Aber die Zeit ist seitdem auch in Glashütte nicht stehengeblieben. 2019, also pünktlich zum zehnten Geburtstag, erhielt die sächsische Zeitikone eine Datumsanzeige. Weil sich das bekannte Grossdatum technisch nicht realisieren liess, umrundet eine eigens auf das Zeitwerk-Design abgestimmte Indikation das Zifferblatt. Ein gläserner Datumsring trägt die Zahlen 1 bis 31. Jeweils rot hervorgerufen ist der aktuelle Tag. Das darunterliegende rote Farbsegment springt täglich mitternachts um eine Position weiter. Korrekturen erfolgen per Drücker bei «8» in der linken Gehäuseflanke. Ein Pendant bei «4» gestattet Stundenkorrekturen unabhängig von den Schaltvorgängen des Uhrwerks. Dabei trennt eine ausgeklügelte Kupplung den zugehörigen Ring bei jedem Tastendruck vom Sprungziffermechanismus. Von aussen nicht erkennbar ist die 24-Stunden-Indikation. Schliesslich verdoppelte sich bei dem aus 516 Teilen assemblierten Manufaktur-Handaufzugskaliber L043.8 die Gangautonomie von 36 auf beruhigende 72 Stunden. Nichts geändert hat sich am sogenannten Nachspannwerk für die blitzartige Ausführung der täglich 1440 Zeitsprünge ohne Auswirkungen auf die Unruh-Amplitude. Seit Juli 2025 gibt es besagtes «Zeitwerk Date» in einer augenfälligen Kombination aus rotgoldener Schale und einem dezent grauen Zifferblatt.
SCHNELLER BANDWECHSEL
Zur Uhrenkollektion von Blancpain gehört die Linie «Fifty Fathoms» wie das Salz zum Meer, für dessen Eroberung sie vor rund 70 Jahren entwickelt wurde. Neu im Jahr 2025 ist die «Fifty Fathoms Tech 45 mm», deren Titangehäuse, wie der Name unschwer erkennen lässt, 45 Millimeter misst. Zur Herstellung der 14.1 Millimeter hoch bauenden und bis zu 30 bar wasserdichten Sichtbodenschale findet Titan Grad 23 Verwendung. Bei diesem Werkstoff handelt
es sich um eine Variante der Ti-Grad-5-Legierung. In der Medizintechnik schätzt man sie wegen ihrer guten Biokompatibilität sowie ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Salzwasser und Korrosion. Die Rändelung der breiten, natürlich nur einseitig drehbaren Tauchzeit-Lünette ermöglicht eine präzise Handhabung, selbst wenn die Träger dieser Armbanduhr dicke Taucherhandschuhe tragen. Ein Heliumventil lässt das beim Auftauchen entstehende Gas gefahrlos aus dem Gehäuseinneren entweichen. Da es bis zu 97 Prozent des Lichts absorbiert, leistet das schwarze Leuchtzifferblatt einen bedeutenden Beitrag zur unmissverständlichen Ablesbarkeit unter Wasser. Nicht minder wichtig sind die drei Leuchtzeiger zur Darstellung von Stunden, Minuten und Sekunden. Als Antrieb dient das Manufakturkaliber 1315A mit Rotor-Selbstaufzug. Fünf Tage oder 120 Stunden kommt es nach Vollaufzug ohne Energienachschub aus. Aus 227 Komponenten erfolgt die Assemblage des mit Fensterdatum ausgestatteten Uhrwerks. Gleichermassen schnelles wie unkompliziertes Tauschen der beiden mitgelieferten Kautschukbänder gestattet das neue werkzeuglose Wechselsystem.
1918 debütierte bei Cartier die von martialisch anmutenden Kampfpanzern inspirierte «Tank». Dabei handelt es sich ohne Wenn und Aber um eine der am längsten ununterbrochen hergestellten Armbanduhren. Im Laufe von mehr als 100 Jahren entstanden ganz unterschiedliche Ausführungen, darunter «Tank Etanche», «Tank Savonnette, «Tank Allongée», «Tank à Guichets» oder «Tank Asymétrique». Das Jahr 1989 stand im Zeichen der länglichen und gewölbten «Tank Américaine». Eigens für die anspruchsvolle europäische Klientel entwickelten die Produktgestalter eine spezielle Ausführung dieser amerikanischen «Tank». Zu ihren Merkmalen gehören ein gestrecktes Platingehäuse. Die flachere Ausführung kombiniert mit balancierterer Wölbung verleiht diesem Zeitmesser am Handgelenk mehr Harmonie. Den distinguierten Auftritt unterstreicht zudem ein in Blautönen gehaltenes und vom Art déco angeregtes Zifferblatt. Eine Gravur auf der Rückseite des Gehäuses weist auf die limitierte Edition hin. Nach 120 Exemplaren endet die Produktion. Um die Anzeige von Stunden und Minuten kümmert sich das exklusive Kaliber 1899 MC mit rund 40 Stunden Gangautonomie. Die Bezeichnung dieses 2019 eigens für die «Tank Américaine» kreierten Automatikwerks verweist auf das Eröffnungsjahr der Boutique in der Pariser Rue de la Paix Nummer 13. Von hier aus eroberte der einzigartige Cartier-Stil die ganze Welt.
TIEFGANG MIT TRADITION
Zweifellos kann die Breitling «SuperOcean» als gelungenes Beispiel für die Verbindung von Funktionalität und Stil gelten. Im Jahr 1957, als Willy Breitling auf 25 Jahre erfolgreicher Unternehmensführung zurückblickte, stieg das Interesse an professionellen Taucheruhren. In der Nachkriegszeit waren derartige Armbanduhren unverzichtbar für die Erforschung und Erschliessung der Ozeane. Aus dieser Notwendigkeit heraus entwickelte Breitling seine «SuperOcean» als Dreizeigeruhr und dazu auch als Chronograph. Beide Varianten besassen eine rastende Drehlünette. Augenfällige Leuchtziffern und -zeiger gestatteten präzises Ablesen der Zeit selbst unter widrigen Bedingungen. Seitdem nimmt besagte «SuperOcean» einen festen Platz in der vielfältigen Breitling-Kollektion ein. Nach einem Relaunch im Jahr 2017 präsentiert sich die Breitling SuperOcean Heritage aktuell mit markanterem und dennoch eleganterem Design. Die nun mit einem kratzfesten Keramikinlay ausgestattete Drehlünette lässt sich aus Sicherheitsgründen nur entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen. Neu am Markt ist unter anderem eine Edelstahl-Version mit 40 Millimetern Durchmesser. Samt bombiertem und beidseitig entspiegeltem Saphirglas misst das Gehäuse nur 11.73 Millimeter in der Höhe. Die Wasserdichte reicht bis zu 20 bar Druck.

©Breitling

Ein echtes Highlight ist das neue Manufaktur-Automatikkaliber B31, welches aus 181 Komponenten besteht. Es zeigt sich durch den Sichtboden des Gehäuses. Seine Unruh oszilliert mit vier Hertz. Der Kugellagerrotor spannt die Zugfeder in beiden Drehrichtungen. Nach Vollaufzug beträgt die Gangautonomie etwa 78 Stunden. Vor dem Einschalen muss jedes der verbauten Uhrwerke die offizielle COSC-Chronometerprüfung bestehen.
KLEIN, ABER FEIN
Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet die Omega «Seamaster Aqua Terra» sportiven Stil mit präzisen inneren Werten. Während dieser Zeit hat sie sich als Allrounder im tickenden Luxussegment etabliert. Zum weiteren Wertespektrum gehören ausgewogen gestaltete Zifferblätter, applizierte Indizes, filigrane Dauphine-Zeiger, Fensterdatum bei «6» sowie ein Saphirglas-Sichtboden im klassisch runden Gehäuse, welches den Blick auf die verbauten Uhrwerke freigibt. Neu in dieser Produktfamilie ist eine kleine, aber feine 30-Millimeter-Version explizit für das weibliche Geschlecht. Trotz Mini-Dimensionen macht Omega keine Abstriche beim mechanischen Innenleben. Die präzise Indikation von Stunden, Minuten und Sekunden obliegt den neu entwickelten Automatikkalibern 8750 und 8751. Ihr Durchmesser von nur 20 Millimetern und ihre



weniger als vier Millimetern Bauhöhe demonstrieren, dass eine kompakte Bauweise keine technischen Kompromisse bedingt. Jedes der beiden Werke verfügt über die exklusive Co-Axial-Hemmung, eine vollkommen amagnetische Silizium-Unruhspirale, beidseitig wirkenden Selbstaufzug sowie gut 48 Stunden Gangautonomie. Die Master-Chronometer-Zertifizierung garantiert Resistenz gegen Magnetfelder bis zu 15’000 Gauss. In den Stahl- und BicolorModellen der neuen Linie findet sich das Kaliber 8750. Für die Ausführungen in Sedna- oder Moonshine-Gold ist das 8751 mit veredeltem Finish reserviert.
ERINNERUNGEN AN DIE 1960ER-JAHRE
Während des «Kalten Kriegs» propagierte Amerika die «Polaris» getauften Raketen als wirksames Machtsymbol des Westens gegenüber der Sowjetunion. Daneben symbolisierte dieser Terminus aber auch das menschliche Entdeckungsstreben der 1960er-Jahre. Bei Sammlern geniessen die damals von Jaeger-LeCoultre lancierten «Polaris»-Armbanduhren absoluten Kultstatus. Schliesslich vereinen sie die robusten und praktischen Eigenschaften einer sportlichen Uhr mit einem gerüttelten Mass an Eleganz. Hinzu gesellt sich der heutzutage sehr geschätzte Vintage-Charme. Das trifft auch auf den funktionalen «Polaris-Chronographen» zu. Dessen 2025erAusführung mit 42-Millimeter-Gehäuse aus edlem Stahl besticht durch ein komplexes Zifferblatt. Insgesamt 35 Lackschichten, ergänzt durch drei verschiedene Veredelungen und eine äussere Tachymeterskala, tragen massgeblich zur starken Optik dieses sportlichen Zeitmessers bei. Hinzu gesellen sich ausdrucksstarke Stundenziffern und -indexe. Zu diesem Ensemble passen bestens ablesbare Leuchtzeiger. Weniger prominent tritt hingegen das fürs Messen und Stoppen der Zeit zuständige Uhrwerk in Erscheinung. Es nennt sich 761, besteht aus 248 Komponenten, besitzt etwa 65 Stunden Gangautonomie, vier Hertz Unruhfrequenz, ein Schaltrad zum Steuern der drei zeitschreibenden Funktionen Start, Stopp und Nullstellung sowie eine vertikale Reibungskupplung. Die bis zu zehn bar wasserdichte Sichtbodenschale hält ein Armband aus schwarzem Kautschuk sicher und komfortabel am Unterarm. Zum Lieferumfang gehört ein zusätzliches Armband aus grauem Stoff. Die zugehörige Faltschliesse lässt sich ohne grossen Aufwand tauschen.




Bei Patek Philippe hat die 1976 lancierte «Nautilus» über all die vielen Jahre nichts an Aktualität eingebüsst. Femininen Luxus verkörpert die neue Referenz 7010 / 1G-013 mit lediglich 32 Millimeter grossem Gehäuse. Funkelnden Glanz ohne Einbusse der Identität dieses Uhrenklassikers verleihen 46 Diamanten im Brillantschliff. Einträchtig versammelt sind die besten Freunde anspruchsvoller Frauen auf dem breiten Glasrand der Schale. Als Hingucker erweist sich auch das azurblau lackierte Zifferblatt mit wellenförmiger Textur. Die augenfällige Scheibe trägt applizierte arabische Ziffern und dazu noch neun Strich-Indexe. Wie die Zeiger, das Gehäuse sowie das Armband mit satinierten und polierten Flächen sind sie in Weissgold ausgeführt. Nachleuchtendes Super-LumiNova erleichtert das Ablesen bei Dunkelheit. Um die Anzeige der Uhrzeit und des Datums kümmert sich in diesem Fall keine Mechanik, sondern ein flaches Quarzwerk vom Kaliber E 23-250 S C. Der hohe Anspruch des Hauses Patek Philippe äussert sich dadurch, dass die Veredelung des elektronischen Innenlebens nach den gleichen Kriterien wie bei konventionell tickenden Uhrwerken erfolgt.
FLACH DANK MIKROROTOR
Von der unentwegten Weiterentwicklung einer renommierten Luxusmarke zeugt die Richard Mille «RM 33-03 Automatic». Dieser prägnante Zeitmesser baut auf der bewährten technischen wie ästhetischen Marken-DNA auf. Zudem zeigt er sich in einem neuen runden Design, welches jedoch die bemerkenswerte Ergonomie der Vorgängerversion RM 33-02 bewahrt.
Im Inneren des Gehäuses bewahrt das innovative skelettierte Automatikkaliber RMXP3 mit 33 Millimetern Durchmesser die kostbare Zeit. Ablesen lassen sich die Stunden, Minuten und Sekunden. Anders als bei Richard Mille bislang üblich, dreht der Zeiger für «secunda diminutiva pars» bei «6» und nicht im Zentrum. Die halbspringende Indikation des Datums erfolgt auf die charakteristische Weise, bei der die Ziffern unter- und nicht nebeneinander angeordnet sind. Mitverantwortlich für die geringe Werkshöhe von nur 3.28 Millimetern ist ein dezentral positionierter Mikrorotor aus massivem Platin. Im Zentrum besitzt die Schwungmasse ein Keramik-Kugellager. Die Energieerzeugung erfolgt in einer Drehrichtung. Rund 42 Stunden beträgt die Gangautonomie dieser Zeitmechanik mit Platine und Brücken aus Titan Grade 5. Für die unverzüglich ins Auge stechende Optik sorgen schwarze Beschichtungen. Stündlich vollzieht die Masselot-Unruh mit variabler Trägheit 21’600 Halbschwingungen. Schutz für das kostbare Uhrwerk bietet ein dreiteiliges Titangehäuse mit 41.7 Millimetern Durchmesser. Am Handgelenk trägt es lediglich 9.7 Millimeter auf. Bis zu drei bar Druck reicht die Wasserdichte.
PISTAZIE FÜRS HANDGELENK
2025 übt sich Rolex einmal mehr in Farbe, und zwar bei der Uhrenlinie «Oyster Perpetual», welche drei wichtige Leistungen der bedeutenden Schweizer Uhrenmanufaktur in sich vereinigt. Gemeint sind offiziell geprüfte Chronometer, wasserdichte Schraubgehäuse und Rotor-Automatikwerke. Das Thema signifikanter Zifferblattfarben hat das 1905 gegründete Unternehmen bei den stählernen Einstiegsmodellen ohne Datumsindikation 2020 aufgegriffen und damit spontan echte Begeisterungsstürme ausgelöst. 36 Millimeter Gehäusedurchmesser wenden sich in erster Linie an Vertreterinnen des zarten Geschlechts, aber auch an Männer mit sehr schlanken Handgelenken. Mit dem neuen Farbton Pistachio oder Pistazie hat Rolex nun erneut einen echten Hit gelandet. Markenfans stehen Schlange, um eine dieser sportlich-eleganten Armbanduhren mit dem dezent grünen Zifferblatt erwerben zu können. Alternativ zum 36-Millimeter-Modell gibt es auch eine 41 Millimeter messende Version. In der wie auch immer gearteten Schale aus Edelstahl 904L, welche dem Druck des nassen Elements bis zu zehn bar widersteht, tickt das natürlich selbst entwickelte und gefertigte Kaliber 3230. Das mit amagnetischer Parachrom-Unruhspirale und moderner Chronergy-Hemmung ausgestattete Automatikwerk läuft rund 70 Stunden am Stück. Nach der amtlichen Chronometerprüfung durchlaufen die eingeschalteten Werke noch einen internen Zertifizierungsprozess. Nur wenn die fertige Uhr täglich nicht mehr als zwei Sekunden falsch geht, darf sie die Genfer Fabrikationsstätte verlassen.
HOMMAGE AN DIE VERGANGENHEIT
1963 schlug die Geburtsstunde des legendären Heuer-«CarreraW»Chronographen. Die darauffolgenden Varianten und Evolutionsstufen würden ein ganzes Buch füllen. 2015 ergänzt TAG Heuer, wie das Unternehmen seit 40 Jahren heisst, die breit gefächerte Carrera-Palette um ein limitiertes Modell, dessen Auflage nach der Herstellung von summa summarum 500 Stück endet. 42 Millimeter beträgt der Durchmesser des charakteristischen Edelstahlgehäuses mit bis zu zehn bar reichender Wasserdichte. Durch den Sichtboden zeigt sich das «Calibre TH20-00». Dieses Automatikwerk aus den eigenen Ateliers verfügt über einen beidseitig wirkenden Kugellagerrotor, Schaltradsteuerung für den Chronographen mit 30-Minuten- und Zwölf-Stunden-Zähler sowie die von Firmengründer Edouard Heuer erfundene Schwingtrieb-Kupplung. Wirklich neu an dieser Edition ist das mitternachtsblaue opalisierende Zifferblatt. An den um 1950 von Heuer für den amerikanischen Kunden Abercrombie & Fitch entwickelten «Seafarer»-Chronographen mit Regatta-Minuten-Countdown erinnert die farblich abgesetzte Gestaltung des Felds für den Minutentotalisator bei «3». Die Vergangenheit lebt ferner in den Dreiecken auf der äusseren Sekundenskala auf. Dass sich beim Uhrwerk stündlich 28’800 Unruh-Halbschwingungen zählen lassen, geht aus jeweils drei kleinen Indexen zwischen den längeren Strichen für die vollen Sekunden hervor. Sie tragen den vier Herz Unruhfrequenz Rechnung. Aus blau gegerbtem Kalbsleder besteht das durchbrochene Armband mit kontrastierender Naht und stählerner Faltschliesse.
Weisse Keramik nutzt Zenith zur Produktion von Gehäuse
Gliederband der auf 100 Exemplare limitierten «Defy Skyline
Skeleton White Surfer Ceramic». Bis zu einem Druck von zehn kann das nasse Element nicht ins Innere der 41 Millimeter gros Sichtbodenschale vordringen. Dort tickt das hauseigene Automatik kaliber El Primero 3620 SK mit einer Hochfrequenz von Hertz. Folglich vollzieht die Unruh jede Stunde flotte 36’000 Halb schwingungen. Durch die spezielle Konstruktion des Uhrwerks erfolgt der Antrieb des kleinen Sekundenzeigers bei «6» per Ankerund zusätzlichem Zwischenrad. Alle zehn Sekunden dreht er einmal um seine Achse. Diesem Sachverhalt trägt die zugehörige Indexierung selbstverständlich Rechnung. Zwischen den grösseren Sekundenstrichen lassen sich jeweils neun kleinere BruchteilIndexe zählen. Präzises Richten der drei Zeiger ermöglicht ein Sekundenstopp. In beiden Drehrichtungen liefert der Kugellagerrotor Energie ans Federhaus, das Kraft für rund 60 Stunden Gangautonomie speichern kann.


Bemerkenswert ist die durchbrochene und an das bekannte Zenith-Logo erinnernde Gestaltung der 30 Millimeter messenden Manufakturmechanik. Die leuchtend blaue Beschichtung zieht Blicke magisch an. Bei Dunkelheit verstärkt sich das Schauspiel noch, denn Zenith zeichnet die Konturen mit Super-LumiNova nach. Durch dessen nachleuchtende Eigenschaften sticht der Stern immer dann ins Auge, wenn das Umgebungslicht schwindet. Natürlich besitzt die Rückseite des 3620 SK mit sternförmig ausgeführter Schwungmasse die gleiche blaue Farbgebung.

KLANGVOLLES AUS GENF
Seit 1996 bietet Vacheron Constantin die «Overseas» an. Für ihr Design zeichnete eine interne Abteilung verantwortlich. Während der anschliessenden Jahrzehnte entstanden Versionen ohne und mit uhrmacherischen Zusatzfunktionen. Eine Minutenrepetition, also ein Modell, das die lautlos verstreichende Zeit auf Wunsch durch Schläge auf Tonfedern minutengenau akustisch wiedergibt, umfasste die Kollektion allerdings noch nicht. Diesem Manko hilft die Traditionsmanufaktur im Jahr ihres 270. Geburtstags unüberhörbar ab. Möglich macht’s das gerade einmal 7.9 Millimeter hoch bauende Kaliber 2755 QP mit rund 58 Stunden Gangautonomie. Für ein Exemplar dieses Handaufzugswerks benötigen die Uhrmacher 602 Teile. Zu ihnen gehören auch 45 funktionale Steine. Wie die Kaliberbezeichnung zu verstehen gibt, besitzt das Œuvre auch einen ewigen Kalender, der theoretisch erst Ende Februar 2100 einer manuellen Korrektur bedarf. Die zugehörige Kadratur zeigt sich bei jedem Blick aufs transparente Saphirglas-Zifferblatt mit blauen Ringen für die jeweilige Beschriftung oder Indexierung. Bei «6» dreht zudem ein Minutentourbillon seine Pirouetten. Nur 9000-mal schwingt die darin untergebrachte Unruh pro Stunde in jede Richtung. Das entspricht einer Unruhfrequenz von 2.5 Hertz. Aus antiallergischem Titan Grade 5 bestehen das bis drei bar wasserdichte Gehäuse und das integrierte Gliederband. Dieser leichte Werkstoff bewirkt ein eindrucksvolles Klangverhalten. Ein Schieber in der linken Gehäuseflanke löst das Minutenschlagwerk aus. Zum Lieferumfang der 44 Millimeter grossen und mit dem Genfer Siegel qualifizierten Armbanduhr gehören zwei zusätzliche Armbänder: eines aus blauem Alligatorleder und das andere aus gleichfarbigem Kautschuk. Der Austausch lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst vornehmen.



Harry Winston, auch «König der Diamanten» genannt, soll den Stil des Edelsteinschleifens revolutioniert haben und ist dafür bekannt, dass er den HopeDiamanten im Wert von 250 Millionen Dollar dem Smithsonian Museum schenkte, nachdem sich dieser ein Jahrzehnt lang in seinem Besitz befunden hatte.

Sein Schmuckimperium nahm 1926 mit dem Kauf der Schmuckkollektion von Arabella Huntington für 1.2 Millionen Dollar Gestalt an. Arabella, die Frau des Eisenbahnmagnaten Henry E. Huntington, hatte es geschafft, eine der prestigeträchtigsten Schmuckkollektionen der Welt zusammenzustellen, die grösstenteils aus Stücken berühmter Pariser Juweliere wie Cartier bestand.
Harry Winstons Vater Jacob gründete ein kleines Juweliergeschäft, nachdem er mit seiner Frau aus der Ukraine in die Vereinigten Staaten ausgewandert war. Winston, der 1896 in New York geboren wurde, wuchs in der Atmosphäre der Werkstatt seines Vaters auf, wo er schon in jungen Jahren in die Geheimnisse der Edelsteine eingeweiht wurde. Mit gerade einmal zwölf Jahren zeigte er einen bemerkenswerten Instinkt für Schmuck: Er entdeckte einen zweikarätigen Smaragd in einem Pfandhaus, kaufte ihn für nur 25 Cent (zusammen mit einem beliebigen Stein, um den Verdacht des Antiquitätenhändlers nicht zu erregen) und verkaufte ihn zwei Tage später für 800 Dollar weiter, obwohl sein Vater zunächst dachte, es handle sich um ein einfaches Stück Glas.
Richtig los als Unternehmer ging es 1932 mit der Eröffnung seines ersten Geschäfts in New York – damit begründete Winston seinen legendären Namen in der Luxusschmuckbranche. Innert kurzer Zeit hatte er sich einen guten Ruf erworben und sein Unternehmen etablierte sich in der Elite des New Yorker Edelsteinhandels. Auf Kundenwunsch begann er, Schmuck unter seinem eigenen Namen herzustellen, und gründete die Firma Harry Winston, Inc. Damit legte er den Grundstein für eine Marke, die zum Synonym für absoluten Luxus werden sollte. Bei seinem Tod im Jahr 1978 hinterliess Harry Winston, der sein Leben lang immer einen Edelstein in seiner Brusttasche trug, ein wahres Edelsteinimperium im Wert von etwa 150 Millionen Dollar. Heute gehört die Marke zum Portfolio der Swatch Group.


Autor_Urs Huebscher

Es braucht wirklich eine Menge Vorstellungskraft, um sich unser Leben ohne die Erfindung des Autos auszumalen. Aber mal ehrlich, das wollen wir auch gar nicht, denn noch nie waren wir so mobil und damit so frei wie heute. Spannend wird es allerdings, wenn wir nur für wenige Minuten vom PW mobils

Die Geschichte von Carl Benz ist zweifellos die eines Visionärs, der an seine Ideen glaubte, auch wenn es andere nicht taten. 1871 gründete er als gelernter Maschinenbauer mit den finanziellen Mitteln seiner zukünftigen Ehefrau die Eisengiesserei und die mechanische Werkstätte in Mannheim. 1879 gelang es ihm, einen verdichtungslosen Zweitaktmotor zu konstruieren. Später gründete er die Benz & Cie. – ein deutsches Maschinenbau- und Automobilunternehmen. Seine Gasmotoren verkauften sich zunächst sehr erfolgreich als Stationärmotoren, doch das war dem deutschen Ingenieur Carl Benz nicht genug. Er wollte einen praxistauglichen Wagen schaffen, bei dem Motor und Fahrgestell eine Einheit bilden. Das Resultat: ein Zweisitzer auf drei Rädern, der als erstes «richtiges» Auto in die Geschichte einging. 1886 meldete Benz das «Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb» zum Patent an und wurde zu Beginn für «die motorisierte Kutsche ohne Pferde» belächelt. Heute wissen wir: Die Geburtsstunde des modernen Fahrens wurde von ihm eingeläutet.
Dampfwagen waren die ersten «selbst fahrenden» Kraftwagen, die mittels Dampfmaschine, -motor oder -turbine durch einen Dampferzeuger (meistens Kessel) angetrieben wurden. Als Brennmaterial liessen sich zum Beispiel Brennholz, Kohle oder Teeröl nutzen. Nicholas Cugnot stellte bereits 1769 eine schwer lenkbare und nur Schrittgeschwindigkeit fahrende Artilleriezugmaschine der europäischen Öffentlichkeit vor – und damit einen enormen industriellen Fortschritt. Es folgten das erste in Serie gebaute Dampfautomobil von Amédée Bollée mit 50 Exemplaren sowie das Modell «Stanley Rocket Steamer» von Fred Marriott, welches 1906 mit 205.5 km / h einen Geschwindigkeitsrekord aufstellte. Dampfbetriebene Fahrzeuge kamen noch bis in die 1950er-Jahre zum Einsatz – beispielsweise als Strassenwalzen.
Allgemein kann man aber sagen, dass ein Dieselmotor für weniger Verbrauch und mehr Leistung steht. Und genau das wollte Rudolf Diesel mit seiner Erfindung erreichen. 1897 konstruierte der Ingenieur einen ersten Prototyp, der allerdings 4.5 Tonnen schwer und drei Meter hoch war. Nach Verbesserungen im Bereich der Einspritzung und Gemischbildung setzte sich Diesels Erfindung durch. Bei Schiffs- und Stationärmotoren gab es keine Alternative mehr. 1936 (und damit 50 Jahre nach der Erfindung des Autos) ging der Mercedes 260 D als erster PW mit einem Dieselmotor in Serie und wurde zum Liebling der Taxifahrer.



Am Silvesterabend des Jahres 1879 lief zum ersten Mal der von Carl Benz entwickelte stationäre Benzinmotor. Diese Erfindung von Benz verkaufte sich erfolgreich, weshalb er sich seinem nächsten grossen Traum widmen konnte: der Konstruktion eines praxistauglichen Automobils. Im Januar 1886 meldete Carl Benz aus Mannheim ein «Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb» zum Patent an – den ersten Benziner mit einem schnell laufenden EinzylinderViertaktmotor, der liegend im Heck eingebaut wurde.

Holländer Sibrandus Stratingh und Christopher Be1835 (also schon viele Jahre vor der Erfindung des einen Elektromotor, der ein kleines Modellfahrzeug Ereignis gilt als erste nachweisbare Nutzanwendung Motors, der elektrische in mechanische Energie umwandelt. Das weltweit erste Patent holte sich aber Jahre später Thomas Davenport in den USA. Mit dem von ihm entwickelten Elektromotor baute er ein Modell eines elektrisch angetriebenen Schienenfahrzeugs. Heute wird der Elektromotor zum Zukunftsmotor. Aufgrund des Klimawandels setzen wir immer mehr auf E-Mobilität und umweltfreundliche Alternativen im Alltag.



Zum Glück gibt es Kleider und Accessoires, die uns ein Leben lang begleiten. Ohne sie wäre die Grundlage einer zeitlosen Garderobe schlicht undenkbar. Neun Klassiker haben die letzten Jahrzehnte besonders nachhaltig geprägt.

Wir sind, was wir tragen. Unsere Kleidung zeugt von unserem Innenleben, aber auch von unserem sozialen Umfeld. Erst dort wird sie zur Mode. Zu einem Phänomen. Einer Industrie. Zur Norm und Autorität. Durch unseren Kleidungsstil können wir nonverbale Signale senden und Einfluss auf unsere Interaktionen und Beziehungen nehmen.
Was wären wir ohne Poloshirt, Jeans oder Sneaker? Viele von uns würden mit grosser Wahrscheinlichkeit ziemlich nackt dastehen. Und je älter wir werden, umso wichtiger sind makellos geschnittene, saisonunabhängige Basics von bester Qualität. Sobald das Bedürfnis nach Tradition und Konservatismus wächst, sehnen wir uns nach zuverlässigen Werten.
Folgende neun Fashion-Ikonen geben uns Halt und Sicherheit, als wären sie unsere besten Freunde. Sie schirmen uns
ab, schmücken uns dezent, scheinbar mühelos. Doch sie stehen nicht nur für Vertrautheit, sondern spiegeln auch die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft wider.
Die genaue Herkunft des »Urstoffs« für die Jeans wurde nie vollumfänglich geklärt. Überliefert ist, dass die Norditaliener im Mittelalter führend in der Produktion von Barchent, einem robusten Stoff aus Leinen und Baumwolle, waren. Dieser diente zur Herstellung von Seemannshosen oder Segeln und wurde in ganz Europa gehandelt. Der Stoff soll in Grossbritannien und später in den USA als «Jeanes» bezeichnet worden sein, nach dem Hafen in Genua, von dem aus er verschifft wurde. Gesichert ist hingegen, dass im 18. Jahrhundert in Frankreich der »Serge de Nîmes« entwickelt wurde, ein Stoff aus


Wolle und Seide, gewoben aus beigen und indigoblauen Fäden. Davon inspiriert, wurde später die Produktion eines weicheren Baumwollstoffs entwickelt. Die Herkunftsbezeichnung «de Nîmes» wurde erst durch die Amerikaner zum Begriff »Denim« abgeändert.
Im 19. Jahrhundert produzierten britische Textilfirmen neben dem robusten Denim einen anderen ähnlichen Stoff, der weniger steif und einfarbig blau war. Dieses beliebte Material wurde bis in die USA verkauft und dort nachproduziert, um Arbeitsmonturen für Farmer, Cowboys, Minenarbeiter und Goldgräber zu fertigen.
Am 20. Mai 1873 liessen Jacob Davis und Levi Strauss in den USA eine Hose aus Denim mit Taschen und Kupfernieten patentieren – die Geburtsstunde der ersten Jeans. 1890 lief jedoch das Patent ab, woraufhin neue Unternehmen wie H.D. Lee Mercantile und später Wrangler ihre Version der Hose auf den Markt brachten.
Der Name «Jeans» wurde in den USA erstmals in den 1930er-Jahren in einer Werbekampagne verwendet. Davor wurde
die damalige Arbeiterhose einfach «Overall» genannt. Marktführer Levi’s selbst bezeichnete seine blauen Hosen erst ab 1959 als «Jeans».
Im Zuge der Grossen Depression in den 30er-Jahren begann der Siegeszug der Blue Jeans. In dieser Zeit präsentierte Levi’s auch sein erstes Damenmodell, dem die «Vogue» ein ganzes Editorial widmete. Und 20 Jahre später? Da standen Jeans für Rebellion, Subkultur und – Kleinkriminalität. Deshalb wurden Jeans teilweise sogar an Schulen verboten.
Im Kino sah man den Jeanslook zuerst an Cowboys, danach an den Rock’n’Roll-Stars der 1950er-Jahre und später sogar an Marilyn Monroe und Clark Gable im Film «The Misfits» (1961), doch erst mit den Hippies und dem Slogan «Love, Peace and Happiness» erreichte der von Kopf bis Fuss zelebrierte Jeanslook auch die Strasse.
Jeans als Uniform zu tragen, war für die Friedensbewegung ein Manifest gegen den Kapitalismus. Die klassische Jeans wurde nun auch zum Zeichen der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Designer wie Calvin Klein etablierten das ehemalige Symbol der Unterschicht auch in gehobenen Kreisen. Heute wird weltweit alle 73 Sekunden eine Jeans verkauft.
KELLY BAG
1837 gründete der Sattler Thierry Hermès sein Geschäft für Pferdeausrüstung. Zur Jahrhundertwende widmete sich das Haus zunehmend dem Handel mit edlen Lederwaren, insbesondere Reisekoffern. Eine der ersten Kreationen von Hermès war die Tasche «Haut à Courroies», mit der Pferdesattel und Reitstiefel transportiert wurden.
In den 1930er-Jahren entwarf Robert Dumas, der in die Familie eingeheiratet hatte, eine kleinere, feminine Variante davon als Handtasche für Damen. Sie war trapezförmig und hatte zwei gürtelartige Riemen, die mithilfe eines Drehverschlusses (samt Schloss) verbunden werden können, der wiederum auf kleinen Metallplatten sitzt. Die reduzierte Formgebung entsprach der Ästhetik der damaligen Zeit, die strikt jedes noch so kleine Detail würdigte.
Doch erst 1959 wird die Handtasche über Nacht berühmt, als ein Foto von Grace Kelly um die Welt geht. Darauf gibt die amerikanische Schauspielerin ihre Verlobung mit Fürst Rainier von Monaco bekannt. Der Clou: Die ersten Rundungen ihres Babybauchs kaschiert sie darauf mit einer schwarzen Hermès-Tasche. Dies markiert den Beginn einer veritablen Erfolgsgeschichte. Der stets elegant auftretenden Fürstin Gracia Patricia zu Ehren wird die Handtasche von «Sac à dépêches» in «Kelly Bag» umbenannt und zum begehrten Luxusobjekt.


Um die Entstehung des kleinen Schwarzen ranken sich unzählige Legenden. Gabrielle Chanel soll das Kleid erfunden haben, das später zur Quintessenz der Damengarderobe wurde. Doch die ganze Wahrheit liegt wesentlich länger zurück in der Vergangenheit der Modegeschichte.
Die Farbe Schwarz galt Ende des 15. Jahrhunderts als Inbegriff von Luxus, eine kostbare Rarität, denn nur wenige konnten sich den aus Galläpfeln gewonnenen Farbstoff überhaupt leisten.
Philipp der Gute, Herzog des Burgunds von 1419 bis zu seinem Tod 1467, galt geradezu als Trendsetter, weil er sich mit seiner farblichen Vorliebe vom opulenten Purpur der damaligen Monarchie abgrenzte. Schwarz verkörperte für ihn und seine Anhänger stets auch tugendhafte Werte wie Rechtschaffenheit und Würde.
Ob in den Ländern der Reformation oder im alten Spanien: Schwarz repräsentierte den sozialen Stand und die hohen Werte von Aristokraten. Erst im 19. Jahrhundert sorgten günstigere Färbetechniken dafür, dass das Tragen schwarzer Kleidung immer beliebter wurde. Sie fand vor allem Eingang in die Herrengarderobe, weil sie sich über längere Zeit treu blieb.
Das kleine Schwarze hat jedoch auch in weniger feudalen Schichten eine Rolle gespielt. Im 19. Jahrhundert entwickelte es sich, kombiniert mit einer praktischen Schürze, zu einer Art Uniform für Dienstmädchen. Als nach der industriellen Revolution neue Berufe entstanden, wurde es von den Verkäuferinnen in den Warenhäusern und den Näherinnen der Haute Couture getragen, um ihre Kundinnen damit nicht in den Schatten zu stellen.
Seit dem 19. Jahrhundert ist Schwarz auch die Farbe der Witwen. Dann machte Gabrielle Chanel sie sich zu eigen und kreierte 1926 daraus einen neuen, schlichten Look, der die Modepresse mit dem in Serie produzierten Automodell Ford T verglich. Ein tragbarer Mythos war geboren.
Der unvergessliche Auftritt von Audrey Hepburn als Holly Golightly in «Breakfast at Tiffany’s» machte 1961 das kleine Schwarze endgültig weltberühmt. Das rückenfreie Abendkleid von Hubert de Givenchy, das sie im Film trug, wurde zur Ikone.


Zweifellos gab es bereits zu Beginn der Menschheitsgeschichte erste Exemplare des Slippers, denn leichte Lederschuhe wurden schon seit vielen Generationen gerne getragen. In Nordamerika waren die Ureinwohner seit dem 17. Jahrhundert mit «Mokassins» unterwegs, bereits eine stark vereinfachte Variante des Pennyloafers. Doch auch in Norwegen besass die ländliche Bevölkerung im 19. Jahrhundert weiche Schuhe aus Veloursleder, die später bei Freizeitanglern aus aller Welt grossen Anklang fanden.
Daraus wurde im Jahr 1926 der «Aurlandskoen» vom Schumacher Nils Tveranger weiterentwickelt. Er liess sich von norwegischen Traditionen inspirieren, um einen bequemen und stilvollen Schuh zu kreieren. Ein charakteristisches Merkmal ist die kleine «Tasche», die über die Oberseite des Schuhs reicht und ursprünglich für eine Zehn-Öre-Münze gedacht war –als Notgroschen für wichtige Telefonate oder den Bus nach Hause nach einem langen Abend. Bis heute gilt der eher unbekannte Aurland-Schuh bei Modeprofis als Original-Pennyloafer.
MATROSENSHIRT
Ende des 18. Jahrhunderts tauchte der adaptierte Matrosenlook erstmals in der Kinderkleidung auf. Als sich später in der Belle Époque der Badetourismus entwickelte, übernahm die Damenwelt Schnittformen und Muster der französischen Marine, die ein Hauch von Abenteuer umwehte.
Im 20. Jahrhundert trug die emanzipierte Elite zum Schaulaufen in den französischen Seebädern blau-weiss gestreifte Marineshirts aus Baumwolle mit natürlichem Indigo bedruckt – was damals von der Masse geradezu als rebellisch interpretiert wurde. Wer zu maritim inspirierter Kleidung griff, entpuppte sich automatisch als Freigeist.
In den 1920er-Jahren verbreitete sich das Ringelshirt weiter. In der Pariser Bohème trug es der Dramatiker Jean Genet, gefolgt von Pablo Picasso und Andy Warhol. Coco Chanels Jerseys erinnerten an Matrosenuniformen, und sie selbst zeigte sich in den 30er-Jahren in einer typischen «Marinière», dazu trug sie eine elegante, weite Hose.
Das gestreifte Oberteil verlieh später nicht nur den französischen Filmstars Jean Seberg oder Brigitte Bardot eine Aura von Freiheit, sondern machte es zum Objekt erotischer Fantasien, beispielsweise im Roman «Der Tod in Venedig» von Thomas Mann oder in Werbekampagnen von Jean Paul Gaultier für sein Männerparfum «Le Male».
Erst 1936 begann die Firma Bass & Co. in den USA mit der Fertigung eines ähnlichen Typus, der ebenso eine feste Sohle hatte. Er entwickelte sich schnell zum Bestseller. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er besonders begehrt, als der konservative Ivy-League-Stil aufkam. 1953 lancierte schliesslich Gucci einen Loafer mit Horsebit-Elementen aus dem Reitsport, der den damaligen JetsetLebensstil perfekt verkörperte. Von SocietyHotspots wie Saint-Tropez, Portofino oder Acapulco aus entwickelte sich der Schuh rasch für Männer ebenso wie für Frauen zum unverwechselbaren Statussymbol.



Kein Wunder, dass sie zu den Lieblingsschuhen von Prinzessin
Diana, Steve McQueen und John F. Kennedy gehörten. Die Zeitlosigkeit der Pennyloafers ist Teil ihres Erfolgs, der in jede Naht des Schuhs eingearbeitet ist.
POLOSHIRT
Ein kurzärmeliges Jersey-Oberteil mit Kragen und kurzer Knopfleiste: Das Poloshirt erhielt erst in den 1920er-Jahren seinen weltbekannten Look. Davor war das Shirt einfach nur ein bequemes Hemd, das seinen Ursprung auf den Sportplätzen der britischen Kolonisten in Indien hatte.
Ende des Jahrhunderts wurden Poloshirts dank der USMarke Brooks Brothers populär und zu einem wichtigen Bestandteil des American Look. Aus praktischen Gründen, um besser auf dem Court zu agieren, liess sich 1926 der französische Tennisspieler René Lacoste Kurzarm-Trikots mit weichem Kragen schneidern, damit er so die Ärmel während des Spiels nicht mehr hochkrempeln musste. Teils waren sie aus Wolle gefertigt, teils aus luftigerem Baumwollpikee. Passend zu seinem Spitznamen «Alligator» heftete sich der Tennisprofi ein animalisches Logo an den Sportblazer, das heutige Markenzeichen der Lacoste-Poloshirts.
Das Kleidungsstück fand auch bei anderen Turnierspielern Anklang, sodass sich Lacoste 1933 mit dem Trikothersteller André Gillier zusammenschloss, um seine Erfindung in grossem Umfang
zu vermarkten. In den 1950er-Jahren erweiterte die Marke die Farbpalette und das Polohemd wurde zum Attribut der Reichen und Schönen, die auch in zwangloser Kleidung ganz adrett aussehen wollen.
Die Erfindung der Vulkanisation im Jahr 1839 – wodurch Kautschuk mithilfe von Schwefel zu elastischem, wasserabweisendem Gummi wird – führte zur Entstehung des Turnschuhs. In Grossbritannien und den USA übernahmen die Gummihersteller das Verfahren für die Fertigung von Sohlen für Strand- und Kricketschuhe. Das Verfahren gab Mitte des 19. Jahrhunderts den Startschuss für die Entwicklung des Turnschuhs, der um 1860 seine Entstehung feierte. Modelle aus Segeltuch mit Gummisohle waren für die Rasenplätze besser geeignet als Lederschuhe. Zunächst nur von Profisportlern getragen, verbreitete sich das Modell erst in den 1920er-Jahren mit den adaptierten Modellen von Keds und vor allem mit dem «All Star» von Converse.
Mit der Kommerzialisierung der Olympischen Spiele waren immer mehr Zuschauer*innen von sportlichen Höchstleistungen fasziniert – und Turnschuhe wurden bald auch von Amateursportlern getragen.
1924 gründeten die deutschen Brüder Adolf und Rudolf Dassler eine Sportschuhfabrik. 1947 entzweite sie ein starkes Zerwürfnis, woraufhin der eine Bruder die Marke Adidas, der andere wiederum seine eigene Firma mit dem Namen Puma gründete.
1916 lancierte Thomas Burberry einen Regenmantel fürs Militär –und der Trenchcoat war geboren.

Die praktischen Mäntel aus dem strapazierfähigen Material wurden schnell ein Verkaufshit.
Auch in der Popkultur feierten die Schuhe ab den 50er-Jahren grosse Auftritte, sei es auf Musikbühnen oder in Spielfilmen. Die Fans von Bruce Lee oder der TV-Serie «Drei Engel für Charlie» wollten genau die gleichen Turnschuhe ihrer Idole auch tragen – und sorgten für Verkaufsrekorde der Marken Nike, New Balance oder Reebok.
Der Sportswear-Stil, der durch den 1981 gegründeten Musiksender MTV propagiert wurde, prägte neue, jugendliche Looks. Turnschuhe – in den USA bereits seit 1887 Sneakers genannt, weil man mit den damaligen Modellen im Gegensatz zu Schuhen mit Ledersohle geräuschlos «schleichen» (englisch: to sneak) konnte – waren dabei der Gipfel der Coolness. Ab 2010 machte sich die Designermode Sneakers zu eigen. Sie entwickelten sich zu teuren Objekten der Begierde, die bis heute nicht nur millionenfach getragen, sondern auch als Sammlerstücke gehandelt werden.
TRENCHCOAT
1823 entwickelte der Schotte Charles Macintosh einen wasserabweisenden Stoff aus gummierter Baumwolle, der ursprünglich für das Militär konzipiert wurde. Die praktischen Mäntel aus dem strapazierfähigen Material wurden schnell ein Verkaufshit.
Der Schneider John Emary, Inhaber der Marke Aquascutum London, entwarf 1853 die Silhouette eines eleganten Regenmantels. Doch vor allem das Design von Thomas Burberry, der 1856 ein Modehaus unter seinem Namen eröffnet hatte, ging in die Modegeschichte ein. 1880 entwickelte er ein relativ leichtes, wasserabweisendes Material: den Gabardine. 1888 patentiert, durfte bis ins Jahr 1917 exklusiv nur Burberry diesen Stoff verwenden.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs lieferten sich Burberry und Aquascutum einen erbitterten Konkurrenzkampf. Beide Häuser kleideten damals vor allem hochrangige Offiziere ein. 1916 lancierte Burberry einen Regenmantel für das Militär, der als «wärmender Trench» vermarktet wurde und damit perfekt für die Schützengräben (englisch: trenches) geeignet war.
Es war die Geburtsstunde des Trenchcoats. Seine Details wurden zu Klassikern: mittellang, mit doppelter Knopfreihe, Schulterklappen, einem Gürtel und in der Farbe Khaki, die bis heute eines der Markenzeichen des Burberry-Trenchcoats geblieben ist. Als Futter wurde das typische Karomuster bereits ab 1922 eingesetzt, doch erst in den 60er-Jahren wurde es zu dem heute unverkennbaren Burberry-Akzent.
Schön schlicht: Schauspieler Paul Mescal als Gucci-Botschafter.
WEISSES T-SHIRT
1898 nahm das T-Shirt bereits seine Form an. Die US-Armee integrierte das Unterhemd in ihre Uniform, und so wurde es zum Liebling vieler Soldaten, die es besonders bei Einsätzen in tropischen Ländern auf nackter Haut zur Kampfhose trugen. Das weisse T-Shirt, das einst zur Kategorie der Unterwäsche gehörte, wurde als bequemes, praktisches und universelles Kleidungsstück in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Inbegriff eines FashionAllrounders.
Der Schriftsteller F. Scott Fitzgerald soll als Erster die Bezeichnung «T-Shirt» schriftlich festgehalten haben, und zwar 1920 bei der Beschreibung eines Kofferinhalts in seinem Roman «Diesseits vom Paradies». Im Duden ist die Entlehnung aus dem Englischen seit 1980 zu finden.
Das weisse T-Shirt ist so banal wie einzigartig und repräsentiert damit die gegenseitigen Pole der Modeindustrie. James Dean hat es im Spielfilm «Denn sie wissen nicht, was sie tun» als rebellische Uniform zu Jeans und roter Harrington-Jacke getragen, obwohl die Farbe Weiss sonst eher mit Unschuld, Frieden und Reinheit in Verbindung gebracht wird.
Gerade weil es so schlicht wirkt – kurzärmlig bis zum Bizeps, hüftlang und anschmiegsamer Stoff über dem Oberkörper –, wertet ein weisses T-Shirt jeden Look mit wenig Aufwand auf. Die Meinungen, wer das beste weisse T-Shirt fabriziert, gehen auseinander, wie so oft in der Modewelt. Immer wieder fallen in diesem Zusammenhang jedoch die Namen der US-Sportwarenhersteller Hanes, Russel Athletic und Gildan (besonders was ihre VintageStücke betrifft), aber auch Zimmerli und Hanro – beides Schweizer Traditionsfirmen, die für beste Qualität und Passform stehen.
Ob in der Luxusausführung oder im erschwinglichen Multipack: Das weisse T-Shirt gilt heute als eines der beliebtesten Kleidungsstücke schlechthin. Sogar Victoria Beckham ist ein Fan. «Im Zweifelsfall passt alles zu einem weissen T-Shirt», so das Fazit der Designerin. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Jede Kelly Bag von Hermès ist ein Unikat. Sie wird von einem Lederspezialisten von Hand gefertigt – mit 2600 Stichen. Die Fertigung einer Tasche beansprucht etwa 25 Stunden.
Den Trenchcoat von Burberry gibt es in fünf unterschiedlichen Silhouetten: Kensington, Westminster, Chelsea, Waterloo und Pimlico. Sie sind alle nach geschichtsträchtigen Bezirken Londons benannt.
Das von René Lacoste und André Gillier 1933 erfundene Poloshirt war eine Revolution. Der ursprüngliche Name dafür lautete «L.12.12». L stand für Lacoste, 1 für den Stoff Petit Piqué, 2 für zwei kurze Ärmel und die 12 für den schliesslich verwendeten zwölften Prototyp.
Das weisse T-Shirt hat heute unzählige Fans, darunter viele prominente. Zum kommerziellen Durchbruch verhalf ihm Marlon Brando, der 1951 im Film «Endstation Sehnsucht» seine Muskeln darunter spielen liess.
Die älteste perfekt erhaltene Jeans stammt von Levi’s. Sie ist eine klassische 501 und wurde 1879 hergestellt. Damals betrug der Kaufpreis der Hose fünf Franken, heute ist sie ein Vermögen wert: 150’000 US-Dollar.



der Welt. Kaum ein Sinneseindruck hat einen vergleichbar grossen Einfluss auf uns wie ein Duft. Er ist Ausdruck von Charakter, Stil und Haltung.


Autorin_Nathalie Becker Bilder_Acqua di Parma
Die Parfümeurin Daphné Bugey erschafft mit ihrer einzigartigen Gabe traumhafte Duftwelten und entwickelte zusammen mit Acqua di Parma einen unvergesslichen Jasminduft. Im folgenden Interview spricht sie über den kreativen Prozess, die Herstellung und die Einflüsse hinter der Entstehung von Acqua di Parmas neuem Duft «Gelsomino».
PRESTIGE: Was war Ihr kreativer Prozess bei der Entwicklung dieses Dufts?
DAPHNÉ BUGEY: Die Idee war, einen Jasminduft zu kreieren – aber einen mit Substanz, etwas Charismatisches, Kraftvolles und Unvergessliches. Nicht die zarte Art von Blütenduft, nicht einfach etwas Leichtes und Transparentes, sondern ein Jasmin mit Tiefe und viel Charakter. Was mich an Jasmin fasziniert, ist, dass diese winzigen weissen Blüten einen unglaublich intensiven Duft verströmen. Die Herausforderung war es, einen geschlechtsneutralen Duft zu schaffen. Ich begann also, mit Kontrasten zu arbeiten. Das ist die DNA der «Signatures of the Sun»-Kollektion: die Zerbrechlichkeit weisser Blütenblätter mit etwas Strukturierterem, etwas Dunklerem zu verbinden.
So entsteht ein Spiel: Die Leichtigkeit der Blüte trifft auf die Tiefe rauchiger Hölzer. Es ist etwas sehr Visuelles – das Weiss des Jasmins und die zarten Blüten im Kontrast zur reichen Tiefe der Hölzer, sowohl in Farbe als auch in Textur. Natürlich gibt es weitere Elemente, die dem Duft seinen besonderen Charakter verleihen, aber wenn man sich an eine zentrale Idee halten möchte, dann ist es diese: weisser Jasmin und dunkles Holz, Licht und Schatten.

«Jasmin hat eine unglaubliche Strahlkraft, und wir haben diese Weichheit genommen und sie mit strukturierten, rauchigen und warmen balsamischen Hölzern kombiniert.»
Können Sie mehr über die Spannung zwischen der Helligkeit des Jasmins und der Tiefe des Holzes erzählen?
Es geht um die Begegnung dieser beiden Elemente. Jasmin hat eine unglaubliche Strahlkraft, und wir haben diese Weichheit genommen und sie mit strukturierten, rauchigen und warmen balsamischen Hölzern kombiniert. Visuell stellt man sich die Zartheit feiner Blütenblätter vor – und dann etwas Raues, Dunkleres, Strukturierteres. Es geht um Kontraste, nicht nur im Duft selbst, sondern auch in der Art, wie man ihn erlebt.
Gibt es ein Element italienischer Inspiration in dieser Kreation?
Für mich ja und ich denke, das kommt ganz natürlich, wenn man mit Acqua di Parma arbeitet. Es ist immer eine gewisse Eleganz da, immer die hochwertigsten Inhaltsstoffe. Wenn ich an Italien denke, fällt mir natürlich Zitrus ein, aber ich wollte auch Hölzer einbeziehen, denn holzige Noten können unglaublich edel sein. Für mich geht es um die Balance: helle, frische Elemente neben tiefen, eleganten Holznoten.
Der Duft basiert auf einer uralten Extraktionstechnik. Was macht sie so besonders?
Es ist eine sehr alte und zugleich eine der kostbarsten Techniken. Es ist ein langwieriger, empfindlicher Prozess, bei dem jede einzelne Blüte von Hand platziert wird, sodass der Duft ohne Hitze und ohne Beeinträchtigung seiner Schönheit eingefangen werden kann. Das macht ihn so aussergewöhnlich – man erhält die reine Essenz der Blume, fast so, als wäre man der Natur ganz nah. Und spannend ist, dass diese traditionelle Methode hier mit modernen Elementen kombiniert wird. Es entsteht ein Dialog zwischen tief verwurzelter Geschichte und zeitgenössischer Innovation.
Wie lange hat es gedauert, den Duft zu entwickeln?
Monate voller Intensität. So bin ich eben – wenn ich ein Projekt liebe, wenn ich mit den Menschen und dem Haus eine Verbindung spüre, werfe ich mich mit voller Energie hinein. Zeit wird dabei zweitrangig – wichtiger ist, wie viel Energie ich hineinstecke.
Hatten Sie eine bestimmte Geschichte oder ein Bild im Kopf, als Sie über den Hauptinhaltsstoff nachgedacht haben?
Es war für mich weniger eine Erzählung, mehr ein visuelles Bild. Wie gesagt: der Kontrast – die zarte Blüte gegen das tiefe Holz, in Farbe und Textur. Und vielleicht liegt es daran, wo ich wohne, aber Jasmin ist überall um mich herum. Selbst an unerwarteten Orten nehme ich den Duft plötzlich wahr – er dringt überall durch. Die Blüten sind winzig, kaum sichtbar, aber der Duft ist unglaublich stark.
Lustige Geschichte: Mein Mann wollte alle Kräuter auf unserem Balkon durch Jasmin ersetzen – und ich bin fast in Panik geraten! Weil wir ihn schon im Garten haben und er so intensiv ist. Ich dachte: Wenn ich von zu Hause aus arbeiten muss, kann ich mich nicht mehr konzentrieren! So präsent ist Jasmin – er übernimmt einfach alles.
Wen stellen Sie sich vor, wenn Sie an die Trägerin oder den Träger dieses Dufts denken?
Jemand Charismatisches. Jemand, der sofort auffällt – aber auf eine einnehmende, nicht überwältigende Art. Eleganz mit Ausstrahlung.
Wie würden Sie diesen Duft jemandem beschreiben, der neu in der Welt der Parfümerie ist?
Ich würde nicht zu sehr auf die Duftpyramide eingehen –es ist kraftvoller, es einfach zu halten. Im Herzen steht Jasmin –
hell, leuchtend, frisch. Dazu kommen dunkle, rauchige Hölzer –erdig, strukturiert, tief. Und dann ist da noch Honig – etwas, das man wirklich spürt, wenn man den Duft trägt. Er verleiht eine gewisse Fülle, etwas Suchtartiges. Und natürlich würde ich die Zitrusnote erwähnen, besonders die Zitrone – sie macht etwas sehr Interessantes mit dem Jasmin: Sie verstärkt die Leuchtkraft, bringt diese frische, diffus strahlende Qualität. Es geht darum, den Kontrast im Herzen des Dufts zu verstärken.
Was ist Ihnen bei der Kreation eines Dufts am wichtigsten?
Neugier. Leidenschaft ist selbstverständlich – ich wollte das schon machen, als ich zehn war, und habe Chemie studiert, um Parfümeurin zu werden – aber was mich wirklich antreibt, ist das Lernen. Jeden Tag teste ich, probiere neue Kombinationen, gehe über meine Komfortzone hinaus. Und ich liebe es, zuzuhören –wirklich zuzuhören. Wenn ich arbeite, höre ich gerne verschiedene Perspektiven. Ich halte jemandem einen Duftstreifen unter die Nase, ohne etwas zu sagen – einfach um zu hören, was die Person wahrnimmt. Denn wir alle sind geprägt von unseren Erfahrungen. Ich rieche etwas und denke an Safran und Vanille, jemand anderes nimmt etwas völlig anderes wahr. Das fasziniert mich. Und ehrlich gesagt: Manchmal bin ich meinem eigenen Werk zu nah. Ich sehe nur noch die Formel, die Struktur – und übersehe Dinge. Deshalb liebe ich den Austausch – weil er mir hilft, den Duft mit neuen Augen zu sehen.



Autorin_Swenja Willms

Das Auge isst bekanntlich mit. Und diese Restaurants nehmen es wörtlich. Hier gehen Architektur und Kulinarik Hand in Hand.
Wer das «Central» betritt, spürt sofort die Schwingungen vergangener Tage. In den 1980er-Jahren war das Café im Herzen des Kölner Bohème-Viertels Treffpunkt der Avantgarde: Künstler*innen, Intellektuelle und Provokateur*innen wie Martin Kippenberger, Günter Förg oder Udo Kier gaben sich hier die Klinke in die Hand. Nun hat die Galerie «GATHERING» diesem einstigen Epizentrum künstlerischer Freiheit neues Leben eingehaucht. Das «Central» ist ein Ort der Erinnerung, der Auseinandersetzung und des Aufbruchs. Kippenbergers berühmte Spiegel-Installation von 1991 kehrt zurück, ergänzt durch pointierte, zeitgenössische Werke von Künstler*innen wie Stefan Brüggemann und Tai Shani. Letztere prägt mit einem eigens entworfenen Teppich das intime Ambiente der neuen Peters Bar, die in samtiges Rot getaucht und von nostalgischem Licht durchflutet wird – eine Hommage an Dr. Werner Peters, den damaligen Betreiber und engen Vertrauten der Kunstszene.
Brüggemanns Aluminium-Installation über der Bar ist ein visuelles Statement, das Vergangenheit und Zukunft miteinander verwebt. Die Küche unter Leitung von Sigfredo Scuticchio orientiert sich an nord- und mitteleuropäischen Aromen mit mediterranen Einflüssen – eine subtile Referenz an «Mira», das gefeierte Schwesterrestaurant von «GATHERING» auf Ibiza, dessen räumliche Gestaltung ebenfalls einem Gesamtkunstwerk gleicht. Die Architektur des Ortes – mit hohen Decken, offenen Galerien und natürlichem Licht durchflutet – bietet Raum für Ausstellungen,

Gespräche und Kontemplation. Turner-Preisträgerin Tai Shani setzt mit ihren charakteristischen, brustförmigen Glaslampen und skulpturalen Kerzen Akzente, während Stefan Brüggemanns gespiegeltes Spray Painting das Äussere des Hauses prägt. Das Ambiente wandelt sich mit Einbruch der Dunkelheit zum entspannten Late-Night-Hotspot mit 70er-Jahre-Vibes, unterlegt von einem facettenreichen Musikprogramm von Vinyl-DJs bis zu digitalen Sets. Kulinarisch steht hier Vielfalt auf der Speisekarte: Neben einer mediterranen Basis laden Four-Hands-Dinner mit Gastköch*innen aus aller Welt zu immer neuen Geschmackserlebnissen ein. Begleitet wird das gastronomische Programm von kulturellen Veranstaltungen, darunter Künstlergespräche, Mode-Pop-ups und Residenzen, die den Ort lebendig halten und zur künstlerischen Weiterentwicklung beitragen.
Ein minimalistisches Statement aus Sichtbeton, Glas und Holz –und das direkt über dem Meer: Mit dem neuen Restaurant im «Museo Marítimo del Cantábrico» in Santander an der spanischen Nordküste haben die mehrfach ausgezeichneten Architekten von «Zooco Estudio» ein visionäres Raumgefühl mit brutalistischer Architektur geschaffen. Der gläserne Neubau scheint über der Bucht zu schweben und bietet nicht nur kulinarisch, sondern auch visuell ein Erlebnis der besonderen Art. Das Restaurant befindet sich im Obergeschoss des denkmalgeschützten Museumsbaus aus den 1970er-Jahren, der ursprünglich von Vicente Roig Forner und Ángel Hernández Morales entworfen wurde. Das neue Volumen ergänzt die historische Architektur subtil, geometrisch präzise, dabei ganz im Dialog mit der ursprünglichen Formensprache. Vier moderne Dreiecke schliessen die paraboloiden Betonstrukturen des Altbaus harmonisch ab und verleihen dem Raum seine ikonische Silhouette. Innen sind diese wuchtigen Elemente bewusst inszeniert: Holzvertäfelte, dreieckige Decken fassen die massiven Betonbögen wie Kunstwerke ein. Doch trotz der architektonischen Dominanz bleibt das Meer der wahre Star. Die gläserne Aussenhülle öffnet den Blick weit über die Bucht von Santander. Je nach Sonnenstand lässt sich das Lichtspiel mit leichten Stoffvorhängen modulieren. So entstehen Räume voller Ruhe und Licht, die fast schwerelos wirken.
Nur wenige Kilometer vom ikonischen Place des Lices in Saint-Tropez entfernt, scheint sich «Lily of the Valley» sanft in die provenzalische Hügellandschaft zu schmiegen, als wäre es schon immer da gewesen. Der Designer Philippe Starck hat hier eine Art Dorf entworfen, das nicht nur architektonisch, sondern auch atmosphärisch neue Massstäbe setzt. Inspiriert von den Hängenden Gärten Babylons, den Linien provenzalischer Abteien und dem entspannten Chic kalifornischer Villen entstand ein Ort, an dem Architektur, Natur und Lebenskunst in vollkommenem Einklang stehen. Mitten in dieser Oase liegt das Restaurant «Vista», ein kulinarischer Treffpunkt zu jeder Tageszeit. Ob Frühstück mit Blick auf das glitzernde Mittelmeer oder ein letzter Drink am Kaminfeuer – «Vista» lebt vom Wechselspiel der Stimmungen, von Licht und Landschaft, von Nähe und Genuss. Die Küche: eine Liebeserklärung an das mediterrane Terroir, fein nuanciert mit provenzalischen Akzenten. Küchenchef Vincent Maillard, einst Schüler von Guy Savoy und Alain Ducasse, bringt in seinen Gerichten nicht nur Geschmack, sondern Geschichten auf den Teller – von Fischerbooten, Gemüsefeldern und den Menschen, die diese Region prägen. Doch was dieses Restaurant besonders macht, ist nicht nur, was serviert wird, sondern wo. Die Architektur von «Lily of the Valley» folgt keinem Trend, sondern einem tiefen Respekt für die Natur. Mit weichen Formen, warmen Farben und natürlichen Materialien erschafft Philippe



Starck Räume, die atmen. Orte, die sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern im Gleichgewicht mit ihrer Umgebung stehen. Seit den 1980er-Jahren hat Starck eine Vielzahl ikonischer Projekte realisiert, die vom Möbeldesign bis zur Architektur reichen. Dazu zählen etwa der revolutionäre «Louis Ghost Chair», der das klassische Rokoko neu interpretiert, oder die Gestaltung zahlreicher Hotels wie des «Royalton» in New York und des «Delano» in Miami, die beide zu kulturellen Hotspots wurden.
Herzog & de Meuron gehören zu Basel wie kein anderes Architektenduo. Sie prägen das Stadtbild und das kulturelle Bewusstsein mit ihren visionären, zugleich sensiblen Bauwerken: von der behutsamen Umgestaltung des historischen Rheinhafens über die Erweiterung des Kunstmuseums Basel bis hin zum innovativen Neubau des Fussballstadions St. Jakob-Park. Mit dem neuen Restaurant «BANKS» im Grand Hotel «Les Trois Rois» setzen die weltweit gefeierten Architekten einmal mehr ein Zeichen im Dreiländereck. Sie verwandelten den ehemaligen Ballsaal in einen runden, lichtdurchfluteten Raum, der durch seine elegante Schlichtheit und warme Atmosphäre besticht.
Im Zentrum des Geschehens thront eine skulpturale Bar, über der die kunstvolle Deckeninstallation von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger schwebt. Die harmonische Farbpalette verbindet klassische und zeitgemässe Akzente und schafft eine einladende, fast heimelige Stimmung. «BANKS» wird voraussichtlich im September 2025 eröffnen und verspricht, Basel mit einer euroasiatischen Grossstadtküche nicht nur kulinarisch, sondern auch architektonisch neu zu definieren.

Für das Grand Hotel am Rhein entwarfen Herzog & de Meuron ein lebendiges Interieur.

Das Enigma fasziniert mit dramatischer Lichtführung, dunklem Interieur und intimer Atmosphäre.
«Enigma», das avantgardistische Restaurant von Albert Adrià, befindet sich im Stadtteil Eixample in Barcelona. Schon beim Betreten spürt man die besondere Atmosphäre. Die Räume sind klar strukturiert und doch voller Überraschungen, mit Decken aus gewelltem Edelstahl, die wie Wolken schweben, und Wänden aus transluzentem Harz, die das Licht sanft filtern.
Das Interieur stammt von den renommierten «RCR Arquitectes», die mit ihrem filigranen Umgang von Materialien und Formen 2017 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurden. Jeder Raum hat hier seine eigene Handschrift, vom japanisch inspirierten «Ryokan» bis zur offenen «Plancha», wo das Essen direkt vor den Augen zubereitet wird. Albert Adrià, der Maestro hinter der Küche, entwirft hier ein saisonales Degustationsmenü mit rund 25 Gängen, das jeden Monat neu komponiert wird. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte, nicht nur durch seine komplexen Geschmackskompositionen, sondern auch durch die kunstvolle Präsentation und die spielerische Interaktion mit den Gästen.

Seit Generationen steht das schwedische Familien unternehmen Hästens bereits im Dienst seiner Kundschaft. Mit liebevoller Anfertigung und angetrieben von Leidenschaft bietet Hästens aussergewöhnliche Schlaferlebnisse und verfolgt das Ziel, mit jedem Bett Stück Lebensqualität zu schaffen.
Autorin_Nathalie Becker Bild_Hästens

Als Rückblick auf ein Jahrhundert voller unvergleichlicher Handwerkskunst und Innovation stellt Hästens die limitierte Jack-Ryde-Edition des 2000T-Betts vor. Dieses exklusive Bett ist eine Hommage an seinen Namensgeber Jack Ryde, welcher der Visionär und Schöpfer des ikonischen Blue-Check-Designs von Hästens ist. Diese Auflage, von der weltweit nur 2000 Stück erhältlich sind, verkörpert das Erbe und die zeitlose Exzellenz von Hästens. Die «Jack Ryde 100 Year Anniversary Limited Edition» des 2000T ist der Höhepunkt von Designpräzision und Spitzentechnologie und verbindet Form und Funktion nahtlos zu einem exquisiten Kunstwerk. Die Eckschutzleisten aus blauem Sattelleder und die dazu passenden Ledergriffe verleihen ihm eine raffinierte, einheitliche Ästhetik und verkörpern gleichzeitig zeitlose Eleganz und praktische Raffinesse. Die mittlere Matratze, verziert mit einer handgestickten Signatur, ist ein Beispiel für die berühmte und sorgfältige Handwerkskunst von Hästens. Bronze-Akzente und eine unverwechselbare Signaturplatte auf dem Sockel werten das Design weiter auf und sind eine eindrucksvolle Hommage an das bleibende Vermächtnis und den visionären Geist von Jack Ryde. Das 1978 auf den Markt gebrachte Hästens 2000T definierte den Schlafluxus als «das Bett von morgen» neu. Es war das erste Bett von Hästens mit dem ikonischen blauen Karomuster, welches sein Debüt auf der renommierten Stockholmer Möbelmesse feierte und seitdem zu einem bleibenden Symbol schwedischer Designkompetenz geworden ist.

Hästens’ EngageExzellenz der Marke. Die revolutionäre Vision von Jack Ryde stellte nicht nur die Konventionen der Branche infrage, sondern definierte auch die ästhetischen und funktionalen Standards der Schlafindustrie neu.
Das Hästens 2000T hat sich aus diesem Erbe entwickelt und setzt seit jeher den Massstab für innovative Schlafsysteme. Jede Schicht des mit viel Liebe zum Detail und in Handarbeit gefertigten Betts ist auf die Optimierung der Körperkontur und eine hervorragende Druckentlastung ausgerichtet. Das hochmoderne Federsystem ermöglicht die unabhängige Bewegung der Federn und sorgt für eine aussergewöhnliche Stützung, unvergleichlichen Komfort und eine verbesserte Luftzirkulation für ein erfrischendes Schlaferlebnis. Diese exquisite Balance aus Tradition, Handwerkskunst und Innovation macht das Hästens 2000T zum ultimativen Schlafinstrument für einen erholsamen und gesunden Schlaf. Bettentests in lokalen Sleep Spas können online unter www.hastens.com oder bei einem autorisierten Händler in der Nähe gebucht werden.
DIE DETAILS DES BETTS DER LIMITED EDITION 2000T
Stoff: Hästens-Baumwollgewebe
Farbe: Hästens Blue Check
Beine: Hästens Eiche natur mit Bronzefüssen
Grössen: erhältlich in Standardgrössen ab 90 x 200 Zentimeter oder nach Mass in Länge und Breite bis zu 400 x 400 Zentimeter
Härtegrad: weich, mittel, fest, extra fest und kombinierte Festigkeit


Die Emiratis lieben schnelle Autos, Pferde und Kamele … aber ihre wahren Favoriten sind die Falken. Sie beschleunigen schneller als Formel-1-Boliden und sind die uneingeschränkten Könige der Lüfte. Die Scheichs schätzen ihre Schnelligkeit, Präzision und Ästhetik.



Aus der Ferne betrachtet sieht es fast so aus, als würde Amanu Lah mitten in der Wüste eine Choreographie einstudieren. Mit wallender Dischdascha tanzt er über den knallrot leuchtenden Sand und dreht immer wieder Pirouetten. Nur wer genau hinsieht, erkennt das Federspiel, das er an einer etwa zwei Meter langen Stange montiert durch die Lüfte schwingt. Es dient als Köder für seinen Falken, der immer wieder pfeilschnell heranrast, um die Vogelattrappe zu schlagen. «Schon als Kind war ich ein Tiernarr und Greifvögel haben mich zeitlebens besonders fasziniert», sagt der 23-Jährige und streichelt seinem Falken über das Federkleid. «Schon im Punjab in meiner Heimat Pakistan habe ich die Falknerei gelernt. Seit über zwei Jahren bin ich jetzt schon hier in Abu Dhabi und kümmere mich um die Falken des Qasr-al-Sarab-Hotels. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für mich und meine Falken wie die Weite der Liwa-Wüste. Die Emiratis lieben ihre Falken, behandeln sie wie ihre eigenen Kinder. Und als Falkner geniesse ich bei den hier lebenden Beduinen und auch bei den Scheichs ein gewisses Prestige», verkündet er stolz. Die Jagd mit Greifvögeln, die sogenannte «Beiz» (stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet «beissen machen») entstand schon vor über 3000 Jahren in den zentralasiatischen Steppen. In den baumlosen Weiten der Mongolei werden heute noch Steinadler eingesetzt. Auch die alten Ägypter die Falkenjagd, war die oberste Horus – der Falke. Homer berichtet Odyssee von der Falkenaufzucht. Kreuzzüge gelangte arabisches auch in unsere Gefilde, und das der Falkenjagd im Hochmittelalter ner neuen Blüte. Friedrich II (1194 – 1250) war leidenschaftlicher Falkner. Staufer-Kaiser brachte sein Fachwis sen in seinem opulenten Werk venandi cum avibus» (deutsch: die Kunst mit Vögeln zu jagen»), ansehnlich illustriert zu Papier. «Es hat ungefähr drei Monate bis ich die nötige persönliche Beziehung Falken aufbauen konnte. Normalerweise schon, wenn die Falken fünf Monate mit der Hand und es dauert circa zubilden. Gut ausgebildete Falken und 25’000 Euro. Mittlerweile stammen tungen. Der Eierraub aus dem ten», erklärt Amanu mit strengem


Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Falknerei eine sehr lange Tradition und lässt sich bis ins 13. Jahrhundert vor Christi belegen. Als das Öl noch nicht so reichlich sprudelte, lebten die Beduinen von Datteln und Kamelmilch. Eine Trappe oder ein Kaninchen, erlegt vom Falken, bedeutete damals eine willkommene Aufbesserung der Speisekarte. So wie Söhne hierzulande mit ihren Vätern auf Berge steigen, gingen und gehen die Beduinen seit jeher mit ihren Söhnen zur Falkenjagd. Die Falknerei gehört unabdingbar zur beduinischen Tradition. Somit ist es kaum verwunderlich, dass die UNESCO im Jahre 2010 die Falknerei, das jahrtausendealte Kulturgut der arabischen Welt, zum immateriellen Kulturerbe erklärt hat. Heute helfen Falken zwar nicht mehr die Grundversorgung zu ergänzen, aber kraft ihrer Schnelligkeit und Schönheit sind sie begehrte und gleichermassen symbolkräftige Prestigeobjekte. Kein Wunder also, dass ein Falke das Wappen der Vereinigten Arabischen Emirate ziert.
In Amanus Show zeigen die Falken, was sie zu leisten vermögen. Er nimmt immer nur einem Falken die Haube ab und lässt ihn in die Höhe steigen. Dann kommt das Federspiel zum Einsatz. Es besteht meist nur aus einem Stück Leder, auf dem ein Vogelflügel fixiert wurde. Sobald er anfängt, das Federspiel durch die Luft zu wirbeln, weiss der Falke, was er zu tun hat. Mit über 100 Stundenkilometern eilt er horizontal heran. Wenn er in die Höhe steigt, bleibt er mit seinem charismatischen Rütteln quasi in der Luft stehen. Fixiert dabei die vermeintliche Beute. Saust dann vertikal im Sturzflug mit bis zu 300 km / h herunter. Amanu reisst das Federspiel in letzter Sekunde immer wieder zur Seite, dabei entstehen seine eingangs erwähnten Pirouetten. Erst nach etlichen Malen wirft er das Federspiel langsam nach oben und lässt

Im Jahr 2017 sorgte ein Prinz weltweit für Schlagzeilen, als er Flugzeugsitze für seine 80 Falken buchte und deren Komfort und Sicherheit während der Reise in den Vordergrund stellte. Ein virales Bild zeigt die vermummten Vögel, die ruhig in der Kabine sassen, was die tief verwurzelte kulturelle Bedeutung der Falknerei im Nahen Osten unterstreicht. Fluggesellschaften wie Qatar Airways lassen Falken an Bord, und an Orten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten diese geliebten Vögel sogar ihre eigenen Pässe für internationale Reisen.
den Falken die «Beute» erwischen. Dessen messerscharfe Klauen lassen erst los, wenn Amanu dem Falken ein Stück echtes Fleisch als Ersatz anbietet.
«Eigentlich läuft alles immer noch wie seit Tausenden Jahren», erklärt Amanu. «Einziger Unterschied: Die Falken tragen heute einen Mikrochip in der Brust, damit wir sie zur Not jederzeit orten können. Und jeder Vogel wird beringt. Über den eingravierten Code sind sie eindeutig identifizierbar und können im Notfall ihren Besitzern zurückgebracht werden.»
Falken fokussieren ihre Beute extrem genau. So kann es schon mal vorkommen, dass sie ein Hindernis, zum Beispiel einen Zaun, übersehen. Für diese Notfälle gibt es in Abu Dhabi seit 1990 das weltweit grösste Falkenhospital. Die deutsche Veterinärin Dr. Margit Müller leitet das hoch angesehene Tierklinikum. In der von Männern dominierten Welt der Falknerei wird sie ehrfurchtsvoll «Doktora» genannt. Sie operiert komplizierte Beinbrüche und setzt verunfallten Falken auch wieder neue Federn in die Schwingen ein, damit sie möglichst schnell wieder flügge werden. Das Falkenhospital kümmert sich natürlich auch um Prestigefalken höhergestellter Scheichs, die Olympioniken gleich trainiert werden und auch regelmässig zur Vorsorgeuntersuchung in die Klinik müssen. Sie konkurrieren bei zahlreichen internationalen Meisterschaften um stattliche Preisgelder und Luxuskarossen, aber in erster Linie um die Ehre des Scheichs. Wenn diese Falken auf Reisen gehen, wandern sie natürlich nicht in den Frachtraum, sondern sitzen neben dem Falkner – mindestens in der Businessclass, versteht sich. WWW.VISITABUDHABI.AE
Die Falken sind tief in der Geschichte der Vereinigten Arabischen Emiraten verwurzelt. Sie gelten als kulturelle Ikonen. Sehr beliebt sind Abbildungen von Falken auf Strassenschildern und der lokalen Währung.
Quellen berichten, dass die VAE mehr als 27 Millionen Dollar pro Jahr für die Erhaltung der wilden Falkenpopulationen ausgibt – und ihre fortgeschrittenen Zuchtprogramme und der Markt für speziell gezüchtete Vögel verringern die globale Nachfrage nach Wildvögeln radikal.
In Abu Dhabi, dem grössten und reichsten Scheichtum der sieben Emirate, ist der Falke mit den scharfen Augen mehr als Statussymbol und Wappentier. Er gehört zur Familie, wird verhätschelt.
Früher wurden die Raubvögel von den Beduinen als Jagdgehilfen eingesetzt, weil man mit ihnen besser an Beute kam als mit dem Gewehr. Heute ist die Falknerei meistens ein Hobby, wobei die Rolle der Tiere als Statussymbol keinesfalls zu unterschätzen ist. Unter 5000 Euro bekommt man keinen Falken, besonders prächtige können mehr als 100ʼ000 Euro kosten.







Autorin_Swenja Willms

Im Bozner ConTanima lädt Küchenchef Dario Tornatore zu einer Sinnesreise ein, die irgendwo zwischen den Grenzen verschwimmt.
Eigentlich war ich nur auf der Durchreise. Ein Abstecher in die Dolomiten, ein paar Tage Ruhe, Natur, Weitblick. Doch dem guten Essen entkommt man in Südtirol kaum. Zu tief ist es verwurzelt im Alltag, zu selbstverständlich serviert, zu überzeugend in seiner Qualität. Zwischen Bauernstuben und Designhotels, Knödeln, Kastanien, Kalbskoteletts und Kaiser schmarrn verschmelzen hier alpine Bodenständigkeit und italienische Leichtigkeit zu einer eigenen kulinarischen Identität. Das Beste hob ich mir für den Schluss auf. Auf dem Rückweg in die Schweiz machte ich halt in Bozen – jener Stadt, eingebettet in eine Bergkulisse und mit einer Aperitivo-Kultur auf architektonischen Altlasten. Ein Ort des Übergangs – geografisch, kulturell, sprachlich. Und genau in diesem Geist funktioniert auch das kulinarische Konzept des ConTanima.
VERTRAUTES UND NEUES
Mitten im satten Grün des Laurin-Parks steht ein Glashaus. Die gläsernen Wände spiegeln das Blätterdach der alten Bäume, während drinnen ein anderer Kosmos entsteht – filigran, fokussiert, fast filmisch. Ich sitze an einem massiven Eichentisch, darüber hängen Lampen aus alten Schiffen, unter mir Kiesboden. Dieser Raum zählt 110 Jahre – und nur 20 Plätze. Der Name ist eine Wortschöpfung aus «contaminate» (kontaminieren) und «anima» (Seele) – er hat sich nicht zum Ziel gesetzt, Sterne zu sammeln. Und genau darin liegt seine Stärke. Denn es geht hier nicht um Trophäen, sondern um Vertrauen. In Produkte. In Instinkt. In Emotionen. Die Teller erzählen Geschichten – von salzigem Meer, rauem Gestein, weichen Hügeln. Südtirol trifft Süden. Wer Platz nimmt, tut gut daran, sich fallen zu lassen. In die sanfte Musik, das leise Licht, die handverlesene Weinkarte mit einer klugen Auswahl an Naturweinen und kleinen Winzer*innen.


Die Küche atmet den Süden und ist zugleich tief in Südtirol verwurzelt. Die Menükarte ist flexibel – drei, fünf oder acht Gänge, dazu alkoholfreie Fermentate, Naturweine oder Cocktails. Wer mutig ist, wählt «Vertrauen Sie mir?» – sechs Gänge, spontan zusammengestellt von Küchenchef Dario Tornatore, abseits des Menüs. Seit 2023 steht der gebürtige Neapolitaner hier am Herd. In Rom aufgewachsen, von der Welt geformt, bringt er in seinem ersten Signature-Restaurant all das zusammen, was er gesehen, gelernt, geliebt hat. Japanische Präzision, britische Schule, mediterrane Intuition – all das spiegelt sich in seiner Küche wider. Doch am Anfang stand etwas anderes: seine Nonna Chiara und ihr Ragù. Tornatore spricht von ihr mit dieser Art von Respekt, wie man ihn nur dann empfindet, wenn Essen nie einfach nur Nahrungsaufnahme war, sondern Ritual, Erinnerung, Zuhause. Diese emotionale Tiefe spürt man auch im Menü. Hier geht es nicht um Spektakel, sondern um Substanz. Das beginnt
beim hausgemachten Brot aus Weizensauerteig, das mit selbst angesetztem Kombucha gereicht wird, und zieht sich weiter bis zu Gerichten wie dem Rote-Bete-Taco mit Tartar vom Dry-AgedRind – eine Reminiszenz an Japan, aber aus regionalen Zutaten gedacht. Oder dem Risotto mit Austernemulsion und Schnittlauchöl, das Meeresmineralität und alpenländische Frische auf einen Löffel bringt. Jeder Gang trägt hier einen doppelten Boden –auch visuell. Es wird angerichtet wie in einem nordischen FineDining-Tempel, aber serviert mit der herzlichen Gelassenheit einer italienischen Osteria. Der Service ist wach und unaufgeregt, aufmerksam, ohne steif zu wirken. Man merkt: Hier arbeiten Menschen, die nicht nur ihre Arbeit, sondern auch das Zusammenspiel mit der Küche ernst nehmen. Und dann folgt noch das Dessert: «Sacher ConTanima». Der Klassiker wird dekonstruiert und mediterranisiert – und bleibt doch irgendwie vertraut. Wie alles hier.
In einer eleganten Ecke von Zürich eröffnete in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein unternehmerischer Schweizer Konditor ein kleines Geschäft, das den Grundstein für eines der grössten Imperien in der Geschichte der Schokolade legen sollte.
Autor_Urs Huebscher
Es geschah im Jahr 1836, als der Konditor David SprüngliSchwarz gemeinsam mit seinem Sohn Rudolf eine bescheidene Konditorei an der Marktgasse im Herzen der Zürcher Altstadt eröffnete, aus der sich ein bis heute florierendes Schokoladenimperium entwickelte. Damals war Schokolade noch eine seltene Delikatesse, die fast ausschliesslich in flüssiger Form konsumiert wurde – ein Luxus, der den Reichen vorbehalten war. Doch Vater und Sohn erkannten eine Chance: Schokolade in eine festere, zugänglichere Form zu bringen und gleichzeitig den Gedanken an Exklusivität und Qualität beizubehalten. Im Jahr 1845 gehörten sie zu den ersten Herstellern in der Schweiz, denen es gelang, feste Schokolade herzustellen – und das zu einer Zeit, als die Lebensmitteltechnologie noch begrenzt und die Verarbeitungsmethoden rudimentär waren.
Nach dem Tod von David Sprüngli 1892 wurde das Geschäft unter seinen beiden Söhnen aufgeteilt: Einer behielt die ursprüngliche Konditorei, aus der später die Confiserie Sprüngli hervorging, und der andere, Johann Rudolf Sprüngli, erbte den Produktionsbereich und gründete die heutige Fabrik in Kilchberg am Ufer des Zürichsees. Der eigentliche Durchbruch des Sprüngli-Imperiums erfolgte im Jahr 1899, als man das Geschäft und die Geheimnisse von Rodolphe Lindt, dem Erfinder des Conchier-Verfahrens, aufkaufte.



Diese Technik machte das Produkt zu einem neuen Erlebnis. Lindt galt bereits damals als Innovator und sein Rezept war damals ein strenges «Industriegeheimnis». Die Übernahme war nicht nur eine technologische, sondern auch eine Markenentscheidung: Der Name Lindt wurde bereits mit Qualität in Verbindung gebracht. Somit behielt das neue Unternehmen Lindt & Sprüngli beide Identitäten – Sprüngli für das Schweizer Erbe der Exzellenz und Lindt für Innovation. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Unternehmen organisch und erschloss internationale Märkte. Lindt & Sprüngli wurde zum Synonym für Premiumschokolade – nicht nur durch das Produkt, sondern auch durch die Botschaft von erschwinglichem Luxus. Das Unternehmen ist heute ein globaler Riese mit über 14’000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 120 Ländern.





Luxusuhren, Vintage-Weine und seltene Edelsteine: Diese Luxusgüter dominieren seit einiger Zeit als alternative Investments. Doch in den letzten Jahren ist ein überraschender Herausforderer auf den Tradingmarkt getreten: der Sneaker.
Einst das Markenzeichen der Streetwear-Kultur, haben sich Sammler-Sneaker zu einer eigenständigen Anlageklasse entwickelt. Limitierte Auflagen von Marken wie Nike, Air Jordan, Adidas und Yeezy werden heute auf einem globalen Markt mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar gehandelt. Für einige Investoren hat sich das richtige Paar Sneaker als schneller wertsteigernd als traditionelle Vermögenswerte erwiesen, darüber hinaus bietet es ein zusätzliches Mass an kulturellem Prestige.
Von Tokio bis New York betrachten vermögende Sammler bestimmte Sneaker sowohl als modisches Statement als auch als Finanzinstrument. Sie sind tragbar, relativ einfach zu lagern, leicht zu authentifizieren – und im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen setzen sie getragen ein Statement.
DER AUFSTIEG VON SNEAKERN ALS WERTANLAGE
Der globale Primärmarkt für Sneaker wird 2024 auf rund 94 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2033 auf knapp 158 Milliarden wachsen. Noch rasanter entwickelt sich der Resale-Markt: von 11.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf prognostizierte 53.2 Milliarden im Jahr 2033 – ein jährliches Wachstum von über 16 Prozent. Plattformen wie StockX, GOAT oder Klekt haben dabei den Handel revolutioniert. Sie bieten transparente Preise, professionelle Authentifizierung und internationale Liquidität. Dies sind Strukturen, die früher nur hochspezialisierten Sammlerbörsen vorbehalten waren. Über StockX wurden bis 2024 mehr als 60 Millionen Trades abgewickelt, die Plattform zählt über 20 Millionen Käufer weltweit.

Autor_Vas Musca
WAS BESTIMMT DEN WERT EINES SNEAKERS?
Der Wert eines Sneakers ergibt sich aus einer Mischung aus Seltenheit, Zustand, kultureller Relevanz und Markenstärke. Limitierte Auflagen, oft in Zusammenarbeit mit prominenten Künstlern, Designern oder Luxuslabels, erzielen die höchsten Preise. Modelle wie die von Virgil Abloh für Nike entworfene Kollektion «The Ten» gelten inzwischen als Ikonen der Sneaker-Geschichte und sind bei Investoren ebenso begehrt wie bei Modefans. Der Zustand spielt eine zentrale Rolle: Nur ungetragene Paare in Originalverpackung (in der Szene als Deadstock bezeichnet) erreichen Höchstpreise. Auch kulturelle Bedeutung kann den Marktwert beflügeln. Nach der Netflix-Dokumentation
The Last Dance stieg die Nachfrage nach Michael Jordans «Air Jordans» sprunghaft an. Markenprestige und strategische Kooperationen wirken ebenfalls wertsteigernd, ebenso wie der Memorabilia-Status einzelner Paare: Sotheby’s versteigerte im Februar 2024 sechs von Michael Jordan getragene Championship-Sneaker für acht Millionen US-Dollar, was einen Rekord in dieser Kategorie bedeutete.

AUSBLICK FÜR 2025
WIE SNEAKER IM VERGLEICH ZU ANDEREN LUXUSGÜTERN ABSCHNEIDEN
Sneaker gehören zur gleichen Kategorie wie Luxusuhren, edle Weine und Kunstwerke, die sich durch eine hohe Streuung und Fachkompetenz auszeichnen. Die Modelle mit der besten Performance können überdurchschnittliche Erträge erzielen, aber Durchschnittswerte können täuschen.
Luxus-Sammlerstücke hatten ein durchwachsenes Jahr 2024: Der Knight Frank Luxury Investment Index fiel zum zweiten Mal in Folge um 3.3 Prozent, obwohl die Aktienkurse stiegen. Uhren bleiben seit über einem Jahrzehnt stark, aber die Volatilität hat zugenommen. Sneaker sehen sich derselben selektiven frage gegenüber, profitieren jedoch von einem schnelleren Umsatz und einer breiteren Anziehungskraft in der Popkultur.
RISIKEN UND ERWÄGUNGEN
Trotzdem ist der Markt nicht ohne Risiken. Nicht jeder vermeint lich exklusive Drop entwickelt sich zum Werttreiber, und ein kann schnell abflauen. Plattformgebühren, Versandkosten Zahlungsabwicklung können Margen deutlich schmälern. grösste Gefahr jedoch bleibt die Fälschungsproblematik. Laut Authentifizierungsdienst Entrupy waren 2024 rund neun Prozent der geprüften Paare Fakes, und auch grosse Plattformen wie StockX mussten Fälschungen im Millionenwert aus dem Handel nehmen. Angesichts dieser Risiken empfehlen Experten, nur verifizierte Plattformen zu kaufen oder geprüfte FractionalInvestment-Plattformen wie Splint Invest zu nutzen, die sich die Authentifizierung und Lagerung kümmern.
Der Ausblick für 2025 ist dennoch vielversprechend. Analysten erwarten ein besonders starkes Wachstum in Asien und im Nahen Osten. Limitierte Kollaborationen mit kleinen Auflagen, Reissues historisch bedeutsamer Modelle sowie signierte oder getragene Paare aus dem Auktionsmarkt gelten als besonders wertstabil. Auch digitale Besitznachweise über Blockchain und NFT-gebundene Echtheitszertifikate könnten künftig zusätzliche Sicherheit bieten. Dennoch ist Vorsicht geboten: Daten von UBS aus der Mitte des Jahres 2025 zeigen, dass die Preise auf dem Sekundärmarkt für Nike im Vergleich zum Vorjahr um 6.8 Prozent und für Jordan um 5.6 Prozent gefallen sind – ein moderater Rückgang im Vergleich zum Jahresbeginn, aber dennoch ein Hinweis darauf, dass auch Sneaker nicht immun gegen Marktkorrekturen sind.
WICHTIGE ERKENNTNISSE FÜR INVESTOREN
Der Sneaker-Markt verfügt nun über die Infrastruktur, transparente Preisgestaltung, globale Liquidität und professionelle Authentifizierung, um sich neben anderen alternativen Vermögenswerten zu behaupten. Der Erfolg hängt jedoch von Selektivität und Disziplin ab: Wer investieren möchte, sollte selektiv vorgehen, auf kulturell relevante Modelle setzen und Risiken realistisch einplanen.


FÜR CHF 39.– / € 40.– / JAHR
Das Leben, die Kleider und der Glamour von Valentino. Der Name steht seit über einem halben Jahrhundert für Eleganz und Luxus. Er kleidete die schönsten Frauen der Welt ein, darunter Elizabeth Taylor und Audrey Hepburn. Valentino gehört nach wie vor zu den glamourösesten Labels der Welt.
Die Sammlung Schlumpf in Mulhouse beherbergt mit über 600 aussergewöhnlichen Autos die grösste Automobilsammlung der Welt und besitzt viele symbolträchtige Modelle der grossen Hersteller, die unseren Lebensstil verändert haben: Bugatti, Panhard, Maserati, Rolls-Royce und viele mehr.
Die sich verändernde globale Dynamik und eine vorsichtige Konsumstimmung haben ein neues, überraschendes Epizentrum des Wachstums im Bereich des Luxus-Lifestyles und der Körpergüter geschaffen, und das nicht in den traditionellen westlichen Hauptstädten.

*HEV-Mitgliedschaft bis Ende 2025. Ab 2026 gilt der reguläre Jahresbeitrag der zuständigen Sektion. Die Aktion gilt nur für Neumitglieder und bis 31.12.2025. Hier anmelden: www.hev-schweiz.ch/prestige-magazin

Hauseigentümerverband Schweiz
Seefeldstrasse 60, Postfach, 8032 Zürich www.hev-schweiz.ch, info@hev-schweiz.ch
Skeletonised
