Ein umfassender Leitfaden für das Gesundheitswesen
Lesen Sie mehr unter www.zukunft-medizin.info

Lesen Sie mehr unter www.zukunft-medizin.info
Dipl.-Ing. Siegfried Gierlinger
Was muss man bei der Auswahl neuer technischer Geräte beachten?
Seite 04
Univ.-Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff Vor welchen Herausforderungen steht das Beschaffungsmanagement in Krankenhäusern heute?
Seite 10


Der Leiter der Sektion Schmerz in der ÖGARI über altbekannte Fragen im Gesundheitssystem und die vielschichtigen Antworten darauf.
Seite 02
Therapeutische Überwassermassage mit dem Wellsystem MEDWAVE Touch







e iziente Therapie für Bewegungsapparat, Sto wechsel, Psyche kontaktlos und ressourcenschonend, rasche Patientenwechsel vorbeugend: betriebliche Gesundheitsvorsorge für Pflegekrä e und andere belastete Berufsgruppen einfache Installation, rasch amortisiert













3D-NACKENMASSAGE





















ÖVKT- Präsident DI. Martin Krammer, MSc Innovationen für eine bessere Patient:innenversorgung

DUniv.-Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff Beschaffungsmanagement im Krankenhaus
VERANTWORLICH FÜR DIESE AUSGABE

Wiktoria Bieniek Project Manager
Project Manager: Wiktoria Bieniek
Business Developer: Paul Pirkelbauer, BA
Lektorat: Sophie Müller,MA Grafik und Layout: Daniela Fruhwirth
Managing Director: Bob Roemké Fotocredits wenn nicht anders angegeben bei Shutterstock.
Medieninhaber: Mediaplanet GmbH · Bösendorferstraße 4/23 · 1010 Wien · ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien
Impressum: mediaplanet.com/at/impressum/ Distribution: Mediaplanet GmbH Druck: Walstead NP Druck GmbH
Kontakt bei Mediaplanet: Tel: +43 676847785227
E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com ET: 13.09.2024 IN DIESER AUSGABE
Bleiben Sie in Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar Leiter der Sektion Schmerz in der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) und Buchautor zahlreicher Werke über Reformen des Gesundheitswesens.
as Gesundheitswesen von morgen steht vor jenen Herausforderungen, die auch schon Josef II. formulierte. Die grundlegenden Ziele sind und waren immer: die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung. Die zentralen Aspekte sind sich ähnlich, auch, wenn wir längst einer völlig anderen Arbeitsund Beschäftigungspyramide gegenüberstehen. Gesundheit bekommen wir auch heute nicht geschenkt und Innovationen wachsen nicht auf Bäumen. Es geht nicht nur um bloßes Fehlen von Krankheit oder Streben nach einem umfassenden Wohlbefinden, sondern auch um Anpassung und Optimierung des aktuellen Gesundheitssystems. Was können wir dazu beitragen? Die Antwort darauf ist vielschichtig. Eine Kampagne wie „Gesundheitswesen von morgen“ ist daher besonders wichtig, weil sie Ansätze bietet, die Ärzt:innen und Pfleger:innen, Krankenhausmanager:innen und IT-Spezialist:innen in den Erneuerungsprozess

Forum Spital: Digitalisierung im Krankenhaus
Ort: DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn Schlossallee 8, 1140 Wien
miteinbeziehen.
Im Fokus der Beiträge dieser Ausgabe stehen Medizintechnik, Hygiene und Facility Management – Begriffe, mit denen die zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitswesens zusammenhängen. Ebenso stellen uns die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel und die Digitalisierung allesamt vor komplexe Aufgaben. Die wachsenden Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in der Medizin müssen wir mit Bedacht, einem wachen Interesse an der demokratischen Struktur sowie mit einer großen Portion an ethischem Bewusstsein prüfen.
Gesundheit, wie Ernst Bloch es formulierte, sollte „genossen, nicht verbraucht“ werden. Das bedeutet, dass wir nicht nur die individuelle Gesundheit fördern, sondern auch das System, das sie unterstützt, pflegen und verbessern müssen. Das Gesundheitswesen von morgen ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, an dem wir täglich gemeinsam arbeiten sollten.
Forum Spital: Einkauf und Logistik im Krankenhaus
Ort: DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn Schlossallee 8, 1140 Wien
Forum Spital: Zukunftsfähiges OP-Management
Ort: DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn Schlossallee 8, 1140 Wien "Forum Spital: Zukunft Pflege"
Mehr Informationen finden Sie unter zukunft-medizin.info
Ort: DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn Schlossallee 8, 1140 Wien
Ort: Pörtschach am Wörthersee
Entgeltliche Einschaltung
Die Datenarchitektur eines Krankenhauses ist entscheidend für eine patient:innenzentrierte Versorgung und den Einsatz von neuen Technologien wie KI.

Die E-Health-Strategie Österreichs legt den Fokus klar auf „digital vor ambulant vor stationär“. Verhilft das der Digitalisierung im Gesundheitswesen nun endgültig zum Durchbruch?
In der Tat ist das ein großer Schritt nach vorne: Mit den operativen und strategischen Zielen liegen jetzt erstmals bundesweit einheitlich definierte Rahmenbedingungen vor. Aber da geht noch mehr. Meine Hoffnung ist, dass wir einerseits die Akzeptanz der ELGA, zum Beispiel durch niederschwellige Zugänge, weiter erhöhen und andererseits die Sekundärnutzung verfügbarer Gesundheitsdatenbestände sowohl für Forschung und Wissenschaft als auch für Planung und Steuerung unseres Gesundheitssystems durch die Optimierung der organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen nutzen können. Österreich verfügt im internationalen Vergleich bereits jetzt über eine gute Datenlage und eine etablierte E-Health-Infrastruktur. Allerdings werden wir die vollen Möglichkeiten nur ausschöpfen können, wenn Gesundheitsdaten ganzheitlich verfügbar sind und sinnvoll miteinander verknüpft werden.
Welchen Einfluss haben neue Technologien wie KI und das Thema Datennutzung auf das Gesundheitswesen in Österreich?
Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Gesundheitsversorgung. KI hat das Potenzial, die Patient:innenversorgung neu zu gestalten. Das sehen wir beispielsweise bereits in der Radiologie oder im Bereich Sprachverwertung in der Aufzeichnung und Auswertung von ärztlichen Gesprächen mit Patient:innen. Letztendlich ist es jedoch entscheidend, wie wir mit den Themen Integration und Analyse sowie Zusammenführung und Vereinheitlichung von Daten umgehen.
Deshalb liegt für mich die Zukunft in der Datenstrategie eines Krankenhauses. Immer öfter hört man von „Data Driven Hospitals“. Um Daten effektiv für die Patient:innenversorgung nutzen zu können, ist es erforderlich, komplexe IT-Strukturen und Datensilos aufzubrechen. Hier gibt es viel Potenzial, das wir längst noch nicht ausgeschöpft haben.
Wie gehen Sie als Unternehmen für Krankenhaussoftware damit um?
Wir verfolgen mit unserem Krankenhausinformationssys-

Michaela Kainsner, Geschäftsführerin Meierhofer Österreich GmbH, sieht den entscheidenden Faktor für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Datenstrategie der Gesundheitsdienste-Anbieter:innen.
tem M-KIS einen interoperablen und ganzheitlichen Ansatz. Diesem Grundsatz folgend unterstützen wir zum Beispiel auch die Anbindung an ein Clinical Data Repository (CDR). Ein CDR ist in der Lage, Daten von unterschiedlichen Systemen zentral entgegenzunehmen und anderen Nutzer:innen wie Ärzt:innen oder Pflegepersonal zur Verfügung zu stellen. KI ist selbstverständlich ebenfalls Teil unserer Entwicklungsstrategie und wird dort eingesetzt, wo sie unsere Anwender:innen am besten unterstützt und die verfügbare Datenlage es
zulässt. Unsere Lösungen richten wir zukunftsgerichtet nach den neuen Technologien aus. In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen – auch rund um das Thema Ablöse von i.s.h.med und IS-H – unterstützen wir mit unserer langjährigen Expertise Krankenhäuser bei der digitalen Transformation. Das geschieht sowohl mit unseren Lösungen als auch gemeinsam mit unseren Partnern, sodass sich Kliniken ganz auf ihre Kernkompetenzen, der Patient:innenversorgung, konzentrieren können.

Der Technische Direktor des AKH Wien, Dipl.-Ing. Siegfried Gierlinger, spricht im Interview über die enge Verwandtschaft von Medizintechnik und Forschung,
Herr Dipl.-Ing. Gierlinger, worauf kommt es bei der Anschaffung von technischen Geräten für die Medizintechnik im Krankenhaus an? Es gibt bei der Auswahl von Technik und Ressourcen im Gesundheitsbereich einige Prämissen, die es zu beachten gilt. Das fängt ganz zu Beginn mit der Überlegung an, welche Leistungen man erbringen will und muss und welche Diagnoseverfahren damit verbunden sind. Dann stellen wir uns die Frage, welche Geräte und Ressourcen für diese Leistungen nötig sind. Der schwierigste Punkt beim Auswahlverfahren ist aber nicht die Wahl der Technik, sondern der Blick in die Zukunft.
Wie kann das ohne Glaskugel gelingen?
Welche Geräte werden wir in Zukunft benötigen, um weiter vorne mit dabei sein zu können? In welche Richtung geht die Bildgebung bei der Computertomografie oder der Magnetresonanz, beispielsweise. Hierfür muss man sich den Einsatz der technischen Ressourcen überlegen. Für welche Bereiche muss man
welche Qualität liefern – und wo ist es generell vernünftig, Technik einzusetzen? All diese Fragen beschäftigen uns. Außerdem stimmen wir uns immer eng mit allen Mitarbeiter:innen aus Medizin, Pflege und den medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufen (MTDG) ab, die diese Behandlungen und Diagnosen durchführen. Denn natürlich gilt auch in der Medizintechnik: kleiner Preis, kleine Funktionalität; großer Preis, große Funktionalität. Hier hat das Personal den besten Blick dafür, was in Zukunft gebraucht wird. Für diesen Scharfsinn sind die richtigen Menschen, nämlich die, die dann damit arbeiten, essenziell. Aber natürlich spielen in einem Krankenhaus auch noch andere Faktoren eine Rolle.
Welche sind das?
Als Universitätsklinikum AKH Wien haben wir schon einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb Österreichs, beispielsweise in Bezug auf die Forschungsleistung, die wir hier forcieren. Im Zuge dieser Forschung wird entsprechend auch Medizintechnik
entwickelt. Auch das zuletzt veröffentliche Ranking zeigt, dass wir als Universitätsklinikum unter den 25 besten Spitälern der Welt sind. Um diesen Platz halten zu können, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was wir in Zukunft bereitstellen müssen.
Das betrifft auch die Entwicklung der Gesundheitsversorgung allgemein, oder? Genau, das ist ein wichtiger Bestandteil der Überlegungen. Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Wie kann man das mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen schaffen? Und wohin geht die Reise in der Medizintechnik? Vor Jahren noch hatte die Medizin eine Halbwertszeit von fünf bis sechs Jahren. Mittlerweile sind wir bei drei bis vier Jahren. Die IT ist defintiv ein starker Beschleuniger. Abschließend bleibt mir nur zu sagen: Österreich kann stolz sein auf sein Gesundheitssystem und auf die daraus resultierenden Möglichkeiten, was das breite Behandlungsangebot angeht – insbesondere auch im innereuropäischen Vergleich.

Dipl.-Ing. Siegfried Gierlinger Technischer Direktor des AKH Wien

DI. Martin Krammer, MSc
ÖVKT
Präsident
Die Gesundheitstechnik steht an der Schwelle zu einer revolutionären Transformation. In den kommenden Jahren werden wir eine Vielzahl von Entwicklungen erleben, die nicht nur die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern, sondern auch die Patient:innenerfahrung erheblich verbessern werden.
Bereits jetzt wirkt die Technik immer stärker in den Kernprozess der Medizin hinein. Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) wird diesen Trend noch beschleunigen. Sie ermöglicht es, große Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, die für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten entscheidend sein können. Administrative Aufgaben können außerdem automatisiert werden, was den medizinischen Fachkräften mehr Zeit für die Patient:innenversorgung verschafft.
Auch in der Technik werden entsprechende Technologien gemeinsam mit einer sich rasant entwickelnden Sensorik Anwendung finden und einen Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels liefern.
Telemedizin und Assistenzsysteme – z. B. für die Nachversorgung von Patient:innen nach einer stationären
Rehabilitation – werden eine stärkere Rolle in der Zukunft der Gesundheitsversorgung spielen. Dies wird nicht nur die Zugänglichkeit zur Spitzenmedizin erhöhen, sondern auch die Belastung der Krankenhäuser verringern.
Ein weiterer wichtiger Trend ist die Entwicklung tragbarer Technologien und IoT-Geräte
(Internet of Things). Diese Geräte ermöglichen es Patient:innen, ihre Gesundheitsdaten in Echtzeit zu überwachen und an Ärzt:innen zu übermitteln. Diese Technologien fördern eine proaktive Gesundheitsüberwachung, animieren Menschen zu einem gesünderen Lebensziel und ermöglichen frühzeitige Interventionen bei gesundheitlichen Problemen. Vielleicht entwickeln sich Krankenhäuser damit zu riesigen Datawarehouses, in denen mithilfe von KI der Gesundheitszustand tausender Patient:innen in Echtzeit überwacht werden. Robotik wird ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Krankenhaustechnik spielen. Roboter können in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses eingesetzt werden, von der Chirurgie bis zur Logistik. Chirurgische Roboter ermöglichen präzisere Eingriffe mit minimalen Einschnitten, was die Genesungszeit der Patient:innen verkürzt. Logistikroboter können Medikamente, Essen und Materialien effizient im Krankenhaus transportieren und damit Mitarbeiter:innen entlasten.
Schließlich werden darüber hinaus die durchgehende Digitalisierung der Patient:innenakten und die Nutzung von
Blockchain-Technologie die Sicherheit und den Datenschutz von Gesundheitsdaten verbessern. Damit können Gesundheitseinrichtungen den Zugriff auf Informationen optimieren und gleichzeitig die Privatsphäre der Patient:innen noch besser schützen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der Krankenhaustechnik von einer Vielzahl innovativer Technologien geprägt sein wird, die darauf abzielen, die Patient:innenversorgung zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Die Integration von KI, Telemedizin, tragbaren Technologien, Robotik und sicheren Datenmanagementsystemen wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir medizinische Versorgung erleben, sondern auch die gesamte Gesundheitslandschaft revolutionieren. Die kommenden Jahre versprechen spannende Entwicklungen in der Gesundheitstechnik, die das Potenzial haben, das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern. In einer immer älter werdenden Gesellschaft werden Technik und Technologien enorm dazu beitragen, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung aufrechtzuhalten, bzw. diese noch weiter verbessern.
Entgeltliche Einschaltung
Für Gesundheitseinrichtungen bedeuten strengere EU-Vorgaben mehr Prüfungen und Dokumentationsaufwand – TÜV AUSTRIA GmbHExperten Martin Kubec und Johann Dori im Interview.
Wie häufig müssen medizinische Geräte geprüft werden?
Dori: Die regelmäßige Prüfung von Medizingeräten wird vom Gesetzgeber in gültigen Rechtsmaterien wie Medizinproduktegesetz (MPG) und Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBV) festgehalten. Intervalle und Umfang legen Hersteller:innen bei der Entwicklung und Zulassung der Produkte fest.
Kubec: Die Prüfung muss durch Unternehmen, die diese auch korrekt durchführen können, erfolgen. Für die Auswahl dieser Unternehmen sind die Betreiber:innen verantwortlich. Eine akkreditierte Inspektionsstelle wie der TÜV AUSTRIA GmbH gilt per Gesetz als befähigt zur Durchführung der Prüfung. Als TÜV AUSTRIA GmbH können wir beinahe alle in Gesundheitseinrichtungen vorhandenen Medizingeräte prüfen. Dafür braucht es nicht nur das nötige Know-how – weswegen wir möglichst viele Hersteller:innenvorgaben in einer zentralen Datenbank erfassen –, sondern oftmals auch hochspezielle Prüfgeräte und Kenntnis des
Krankenhausbetriebs, um die Prüfungen möglichst ohne Störung des laufenden Betriebs durchführen zu können.
Auch Beschaffung und Eingangsprüfung sind mitunter komplexe Prozesse. Warum ist das so?
Dori: Bevor ein Gerät in einer medizinischen Einrichtung verwendet wird, muss es einer Eingangsprüfung unterzogen werden. Das ist alles klar im MPG und der MPBV geregelt. Die Beschaffung im Vorfeld wird aber zusehends komplexer. Durch die Umstellung auf die europäische Medizinprodukte-Verordnung und die mehrmalige Verlängerung der dazugehörigen Übergangsfristen ist es oft schwierig festzustellen, ob ein Medizinprodukt aktuell überhaupt zugelassen ist. Für die technischen Sicherheitsbeauftragten (TSB) bzw. die Medizintechniker:innen vor Ort ist das häufig zeitaufwendige Arbeit, gerade beim Zubehör: Auch bei Produkten von Nachbauhersteller:innen – etwa bei HF- oder EKGElektroden – muss überprüft werden, ob diese wirklich

Martin Kubec, Leiter Medizintechnik, TÜV AUSTRIA GMBH

Johann Dori, stellvertretender
Leiter Medizintechnik und Lead-Auditor für die EN ISO 13485 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte), TÜV AUSTRIA GMBH
FOTO: ZVG
kompatibel und in der EU zugelassen sind. Da wir als TÜV AUSTRIA GmbH die Funktion der TSB in vielen Einrichtungen – von kleinen Ambulatorien bis hin zu großen Kliniken – wahrnehmen, können wir auf eine umfangreiche Expertise zurückgreifen.
Welche Services bietet der TÜV noch für medizinische Einrichtungen an?
FOTO: ZVG
Dori: Wir sind nicht nur alleinig als Prüfer:innen oder als technische Sicherheitsbeauftragte unterwegs. Wissensvermittlung ist ein weiteres Standbein des TÜV AUSTRIA GmbH. Durch unser Know-how können wir flexibel auf das Informationsbedürfnis unserer Kund:innen eingehen – etwa im Rahmen von Workshops für Einkäufer:innen oder bei Schulungen für das administrative Personal.
Kubec: Wir können jederzeit auf die gesamte technische Expertise aller TÜV AUSTRIA GmbH-Fachabteilungen zurückgreifen. Allein in der Medizintechnik stehen wir unseren Kund:innen mit über 60 Mitarbeiter:innen an vier Standorten zur Verfügung. Als TÜV AUSTRIA GmbH haben wir so die Möglichkeit, unseren Kund:innen alles aus einer Hand anbieten und unser Service-Angebot maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse abstimmen zu können.
Als Betreiber einer Gesundheitseinrichtung sind Sie gesetzlich verpflichtet, die Sicherheit Ihrer Patienten sowie die Einhaltung aller relevanten Vorschriften zu gewährleisten. Dies umfasst unter anderem die regelmäßige Wartung und Prüfung aller medizinischen Geräte und Anlagen, die Sicherstellung der Qualifikation Ihres Personals sowie die lückenlose Dokumentation dieser Wartungs- und Prüfmaßnahmen.
TÜV AUSTRIA GmbH unterstützt Sie bei der Erfüllung dieser Pflichten durch regelmäßige Prüfungen Ihrer medizinischen Geräte, umfassende Beratungsdienste, sowie maßgeschneiderte Schulungen für Ihr Personal. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Patientensicherheit zu erhöhen, rechtliche Risiken zu minimieren und die Qualität Ihrer Gesundheitsversorgung zu sichern.
Medizinische Geräte: Regelmäßige
Sicherheits- und Messtechnische Kontrollen (STK, MTK) sowie Kalibrierung zur Sicherstellung von Betriebssicherheit und Präzision, Eingangsprüfungen zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen vor Inbetriebnahme
Elektrische Anlagen & Notstromaggregate: Überprüfung auf Sicherheit und zuverlässige Funktion.
PV-Anlagen & Ladesäulen: Regelmäßige Inspektionen zur Maximierung von Effizienz und Sicherheit.
Medizinische Gasanlagen: Inspektionen zur sicheren Versorgung. Röntgeneinrichtungen: Konstanzprüfungen zur Sicherstellung gleichbleibender Bildqualität.
Sicherheit: Unterstützung durch technische Sicherheitsbeauftragte und Gutachten.
Schulungen: Qualifizierung Ihres Personals durch die TÜV AUSTRIA GmbH Akademie.
IHR PARTNER FÜR
SICHERHEIT IN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN
Regelmäßige Prüfungen
Wir unterstützten Sie bei der Festlegung optimaler Prüfungsintervalle und führen regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass Ihre medizinischen Geräte und Anlagen stets den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.
Patientensicherheit
Wir gewährleisten durch umfassende Prüfungen, dass Ihre medizinischen Geräte und Anlagen stets sicher und zuverlässig funktionieren. Potenzielle Risiken werden frühzeitig erkannt und können durch gezielte Maßnahmen behoben werden, um die bestmögliche Sicherheit für Ihre Patienten sicherzustellen.
Transparenz
Sie erhalten detaillierte Prüfberichte und umfassende Dokumentationen, die Ihnen einen klaren Überblick über den Zustand Ihrer Geräte und Anlagen bieten.
Beratung & Unterstützung
TÜV AUSTRIA GmbH bietet Ihnen maßgeschneiderte Beratung und Unterstützung, um Prozesse zu optimieren, Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass Ihre Gesundheitseinrichtung stets auf dem neuesten Stand der Technik und Gesetzgebung ist.
Die Primärversorgung ist die erste Anlaufstelle im öffentlichen Gesundheitssystem und umfasst hausärztliche sowie kinderärztliche Einzel- und Gruppenpraxen sowie Primärversorgungseinheiten (PVE). Ziel ist eine integrierte Gesundheitsversorgung von der Geburt bis ins hohe Alter. Neben der Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen trägt sie zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention bei.
PVE erweitern die Primärversorgung um eine multiprofessionelle Organisationsform, in der Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde mit weiteren Gesundheits- und Sozialberufen zusammenarbeiten. PVE haben Kassenverträge mit allen gesetzlichen Krankenversicherungen.
Entwicklung der Primärversorgungseinheiten in Österreich
Die erste Primärversorgungseinheit wurde 2015 in Wien gegründet. Die Veröffentlichung des Primärversorgungsgesetzes (PrimVG) 2017 war
der Startschuss für die positive Entwicklung der Anzahl an Primärversorgungseinheiten in Österreich. Ein deutlicher Anstieg der PVE lässt sich seit der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) der Europäischen Union verzeichnen.
Noch ein Jahr PVEGründungsförderung Im Rahmen dieses Pakets fließen Gelder direkt in die Attraktivierung und Förderung der Primärversorgung. Noch bis 31. Juli 2025 gibt es Förderungen für die PVE-Neugründung sowie bis 31. Jänner 2026 Förderungen für bestehende PVE und Vertragsgruppenpraxen und selbständige Ambulatorien.
Eine weitere positive Entwicklung zeigte sich nach den Novellierungen des Primärversorgungsgesetzes. Seit 2023 ist es gesetzlich möglich, Primärversorgungseinheiten für die teambasierte Primärversorgung für Kinder und Jugendliche zu gründen. Mit Stand August 2024 gibt es österreichweit 69 allgemeinmedizinische Primärversorgungseinheiten und acht Primärversorgungseinheiten für Kinder und Jugendliche (Kinder-PVE).
Plattform
Primärversorgung
Ziel der RRF ist es, die Primärversorgung in Österreich nachhaltig zu stärken und resilienter zu gestalten. Neben den Investitionen für Gründung und Förderung von PVE erfolgt dies durch die Unterstützung der Plattform Primärversorgung als österreichweites Netzwerk für Vernetzung, Wissenstransfer und Partizipation. Die Plattform wurde im September 2022 gelauncht und besteht aus einer aktiven Community von über 2.000 Mitgliedern (Stand August 2024). Sie bietet vielfältige Veranstaltungsformate, eine interaktive PVE-Karte, interessante Neuigkeiten und vieles mehr in einem eigenen Mitgliederbereich auf der Website. Für weitere Informationen zum Projekt besuchen Sie die Website und Social-MediaKanäle der Plattform Primärversorgung!
Mit freundlicher Unterstützung von Gesundheit Österreich GmbH
Weitere Informationen auf: www.primaerversorgung.gv.at/














primaerversorgung.gv.at/meingrundzugruenden
Arbeiten im Team — deine PVE machts möglich!
Das Beschaffungsmanagement der Krankenhäuser ist mit Lieferengpässen, Preissteigerungen, unsicheren Lieferquellen und Anforderungen an die Arzneimittelsicherheit konfrontiert. Wie lässt sich dies mit Digitalisierung, grüner Transformation bei sicherer Patient:innenversorgung vereinbaren?

Univ.-Prof.
Dr. Dr. Wilfried von Eiff Centrum für KrankenhausManagement (Universität Münster) und Center for Health Care Management and Regulation (HHL Leipzig Graduate School of Management) von.eiff@unimuenster.de; wilfried.von. eiff@hhl.de
Lieferabrisse bei Medikamenten und Medizinprodukten sind bekannt. Um Lieferketten resilienter zu gestalten, sind sichere Versorgungsquellen, ein standardisiertes Produktportfolio und strategische Partnerschaften mit leistungsfähigen Lieferant:innen wichtig.
Grüne Transformation managen Krankenhäuser verbrauchen viele Ressourcen: Energie, teure Wertstoffe in medizintechnischen Geräten, Einwegprodukte, klinischer (radioaktiver) Sondermüll. Ressourcenschonender Einkauf und CO2-arme Logistik werden eine Herausforderung: klinisch kompostierbare Mehrwegtextilien, Verwendung reparierbarer Mehrwegprodukte und energiesparende Medizintechnik. Maßnahmen, die die Betriebskosten „out-of-pocket“ senken, müssen identifiziert werden.
Value-Based Procurement Kostengünstige Medizinprodukte mit limitierter Funktionalität bewirken Rationierung und Patient:innenrisiken. Das Beschaffungskonzept „ValueBased Procurement“ wendet sich von dieser Philosophie ab und stellt den Lebenszykluskosten eines Medizinprodukts die erzielbaren Effekte wie
Patient:innensicherheit oder Mitarbeiter:innen-Entlastung gegenüber.
Durch gezielte Auswahl an Medizinprodukten wird das Pflegepersonal entlastet und die Attraktivität klinischer Arbeitsplätze verbessert. Studien zeigen, dass arbeitsentlastende Technologien und handhabungsfreundliche Medizinprodukte als Wertschätzung empfunden werden und die Mitarbeiter:innenbindung erhöhen.
Medikationslogistik
Zwischen 19 % und 35 % aller Fehlereignisse mit patient:innenschädigender Wirkung entstehen durch Arzneimittelfehler. Unabhängig von gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursacht jeder nicht-fatale Medikationsirrtum ca. 3.000 € Kosten für Gegentherapien sowie Opportunitätskosten. Ziel ist daher, die Arzneimitteltherapiesicherheit durch „Closed Loop Medication Administration“ und UnitDose-Versorgung zu verbessern. Dieser Goldstandard der Medikationslogistik ist aber mit hohen Kosten bei großem Einführungsaufwand verbunden. Hilfestellung bieten Robotiktechnologien, die eine individuell auf Patient:innen abgestimmte Medikamentengabe über Smart Cabinets sicherstellen.
Angesichts multipler Krisenphänomene besteht die zentrale Aufgabe des Beschaffungsmanagements darin, die Lieferketten für Medizinprodukte und Medikamente resilient zu organisieren, um medizinische Qualität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Digitalisierung
Einkäufer:innen müssen die Digitalisierung der Beschaffungsprozesse vorantreiben: Automatisierung von Bestellund Wiederauffüllmanagement, KI-Software zur Bedarfsplanung kritischer A-Produkte, Plattformlösungen für indirekten Bedarf und elektronische Ausschreibung. Außerdem sind Google und Co. zu beobachten: Neue Formen der Versorgungsorganisation und Veränderungen in den Wettbewerbsstrukturen des Medizinmarkts zeichnen sich ab. mehr können Sie auf www.zukunft-medizin.info lesen.
Die Bedeutung der Händehygiene im Gesundheitsbereich kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Und auch auf diesem Gebiet kommt mittlerweile ein Mehr an Nachhaltigkeit und Umweltschutz zum Tragen.
Die Zahl der antibiotikaresistenten Keime steigt von Jahr zu Jahr – und damit auch die Wichtigkeit einer professionellen Händehygiene im Gesundheitsbereich. In den letzten Jahren standen in diesem Zusammenhang zwei Punkte ganz klar im Fokus: die Wirksamkeit der Desinfektion und die Hautverträglichkeit. Mittlerweile gibt es auf dem Gebiet der Händehygiene eine dritte Säule, der zunehmend Beachtung zuteilwird: die Nachhaltigkeit bzw. Umweltverträglichkeit der Desinfektionsmittel. Ein großer Punkt in der Nachhaltigkeitsoffensive bei diesen Produkten ist
der Einsatz von Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen. Der zu Desinfektionszwecken eingesetzte Agrar-Ethanol entspricht chemisch dem traditionellen Industrie-Ethanol, der nach wie vor aus fossilen Quellen hergestellt wird. Ein enormer Nachhaltigkeitsvorteil ist, wenn im gesamten Produktionsprozess 100% Ökostrom verwendet wird. Dies ist bei manchen Herstellern mittlerweile der Fall.
Desinfektionstücher
Wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht, ist auch der größtmögliche Verzicht auf Plastik wichtig.
Mittlerweile sind diverse Schnelldesinfektionstücher am Markt erhältlich, die alle Anforderungen hinsichtlich Desinfektionsleistung und Materialverträglichkeit bei medizinischen Geräten im klinischen Bereich erfüllen – jedoch vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Das spart sowohl Mikroplastik, das in die Umwelt gelangen könnte, wie auch umweltschädliche Emissionen bei der Verbrennung ein.
Nachhaltig sicher. desderman® care.
viruzide Händedesinfektion hautfreundliche Pflegeformel nachhaltige Ressourcen








Expertenmeinungen zu Bildgebung,
Behandlungstrends und Rehabilitationsstrategien
für Fuß- und Sprunggelenke

OA Dr. Florian WenzelSchwarz Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie Spezialteam Fußchirurgie
FOTO: ZVG
OA Dr. Florian Wenzel-Schwarz
Die Bildgebung spielt in der Diagnostik von Fuß- und Sprunggelenksproblemen eine große Rolle. Welche Innovationen gibt es hier?
Das klassische Röntgen ist unumgänglich. Komplexe Probleme wie Fehlstellungen, beispielsweise im Rückfuß, können im 3D-Weightbearing CT Scan optimal dargestellt werden. Hier wird unter Belastung eine detaillierte Aufnahme des Fußes und oberen-/unteren Sprunggelenks generiert. So können noch bessere Rückschlüsse auf pathologische Zusammenhänge gezogen und im Therapieverlauf Korrektur und Erfolg einer Behandlung evaluiert werden. Hier kann KI-gestützte Auswertungssoftware in der Behandlungsplanung künftig eine große Stütze sein.
Zur Beurteilung der Pathologie der Weichteile/Knorpel, Sehnen und Bänder ist die MRT auch am Fuß Mittel der Wahl. Die technische Entwicklung der 3-Tesla-MRT und im universitären Setting auch 7-Tesla-MR mit speziellen Untersuchungstools für Sprunggelenk und Fuß hat die Visualisierung von Pathologien enorm verbessert. Diese Geräte sind jedoch teuer und somit nicht immer verfügbar.
Welche innovativen Behandlungen gibt es in der Fußchirurgie der letzten Jahre?
Besonders in der MIS-Chirurgie („minimal invasive surgery“) werden laufend Studien publiziert und Fort- und Weiterbildungen abgehalten. Hallux valgus, Mittelfußschmerzen und Hammerzehenfehlstellung stehen aktuell im Fokus. Auch in der Arthroskopie hat sich das operative Indikationsspektrum durch immer kleiner werdende Arbeitsgeräte laufend erweitert.
Sogenannte Bio-Implantate, die vom Körper ab- oder umgebaut werden, kommen ebenso zum Einsatz. Neben bereits bestehenden Implantaten, z. B. aus Zucker oder Magnesium, sind das Schrauben aus allogenem Knochen. Diese Implantate finden u.a. Verwendung bei Umstellungsoperationen, aber auch Defekrekonstruktion bei Knorpelschäden. Eine Implantatentfernung, wie es bei Metallschrauben vorkommen kann, ist hier überflüssig.
Wie sieht es bei Nachbehandlung und Rehabilitationskonzepten aus?
Die postoperative Nachbehandlung und das Mitmachen der Patient:innen sind neben dem OP-Ergebnis bedeutend für den Behandlungserfolg. Frühmobilisierung und rasche Wiedereingliederung in den (Berufs-)Alltag sind wichtig. Einige OP-Verfahren sind letztendlich aber große Eingriffe, die eine längere Entlastung erfordern. Physiotherapie, ambulante/stationäre Rehabilitation und Psychotherapie, v. a. bei Patient:innen mit gravierenden Einschränkungen der Lebensqualität, sind bedeutend.
OA Dr. Boris Tirala
Wie gestaltet sich Innovation im Krankenhaus?
Für Innovation im KH braucht es Maß und Ziel: Nicht alle neuen, von der Industrie angepriesenen Produkte halten in der klinischen Anwendung stand. Das Konzept muss stimmig, die Anwendbarkeit sinnvoll und das Kosten-Nutzen-Verhältnis positiv sein. Hier braucht es aber auch Mut der Patient:innen, Innovation zuzulassen, wenn sie den Vorgaben entspricht! Ich sehe es als ärztliche Aufgabe, auf Basis der eigenen Erfahrung jene Materialen und Methoden herauszufiltern, von denen Patient:innen am meisten profitieren können.
Welche Vorteile hat die Innovation der humanen allogenen Knochenschraube?
Die Verhaltensweise des Knochens ist in der Unfallchirurgie/Orthopädie bekannt. Mit der humanen allogenen Knochenschraube können Trümmersituationen an der Fußwurzel biologisch überbrückt und Knorpel oder Bänder refixiert werden. Auch in der Orthopädie kann belastungsfähiges biologisches Material zum Halten von Korrekturen in den Knochen eingebracht werden. Der Nutzen ist für Patient:innen in geeigneten Fällen groß: keine Metallentfernung (keine zweite OP) und ein Material, das der Körper erkennt, umbaut und integriert. Der Vorteil für das Gesundheitssystem ist gewonnene Zeit: Jede eingesparte OP-Minute wird andernorts dringend benötigt und reduziert Krankheitstage der Patient:innen.
Gibt es Nachteile dieser Schraube?
Jedes Osteosynthese-Material hat Grenzen – und auch eine gewisse Lernkurve ist bei allen neuen Methoden und Materialien legitim. Die humane allogene Schraube kann zwar selbst keine Kompression erzeugen, diese kann aber durch andere Hilfsmittel ebenso erzielt werden!

OA Dr. Boris Tirala Abteilung für Orthopädie und Traumatologie BKH Schwaz Spezialteam Fuß und Sprunggelenk
FOTO: ZVG
Entgeltliche Einschaltung
TROX ist auf dem Weltmarkt führend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen und Experte im Bereich Sanierung von bestehenden Gebäuden im Gesundheitsbereich. Nicht zuletzt aufgrund jahrelanger Forschung verfügt TROX über umfassendes Knowhow hinsichtlich komplexer Planung von Gebäuden im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Labore, Reinräume etc.). Von leistungsfähigen Filtern und Luftdurchlässen über Luft-Wasser- und Regelsysteme bis hin zu RLT-Geräten und

Ventilatoren deckt TROX die gesamte Palette raumlufttechnischer Komponenten, Geräte und Systeme ab. Deshalb sind wir in der Lage, für den Neubau und die Sanierung von Krankenhäusern optimierte, ganzheitliche Lösungen für die Lüftungstechnik, den Brandschutz und die Entrauchung anzubieten.
Besonders in der Sanierung bestehender Gebäude stehen Planer:innen immer wieder vor verschiedenen Herausforderungen: lange Projektzeiträume von der Planung bis zur Baustelle, höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit, Nachhaltigkeit der eingesetzten Produkte,
Energieeffizienz im späteren Betrieb und geringer Platz für neue Anlagen in bereits bestehenden Gebäuden. Mit entsprechendem Fachwissen und einer intensiven Vorbereitung kann diesen Herausforderungen aber professionell begegnet werden, was die Risiken bei der Planung minimiert. In enger Abstimmung mit Ärzt:innen, Klinikhygieniker:innen und Krankenhaustechniker:innen und mit ganzheitlichen Konzepten und maßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Expert:innen von TROX mit größtmöglicher Erfahrung und Kompetenz.

Benötigen Sie eine detaillierte Planungshilfe? Unser Team berät Sie gerne: GESUNDES KLIMA IM KRANKENHAUS | TROX Austria GmbH.
Der Nr. 1 Online-Orthopäden-Finder: Finden Sie jetzt erfahrene Orthopädinnen & Orthopäden in Ihrer Nähe!



INSPIRATION
Roboterunterstützte Chirurgie und Laparoskopie haben sich in den letzten 20 Jahren stark weiterentwickelt und finden immer größeren Anklang. Prim. Shamiyeh erzählt über die Vorteile.

UFACS, FEBS
Klinikvorstand Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Kepler Universitätsklinikum
GmbH
nter Laparoskopie (LSK) versteht man Operationen im Bauchraum, die nicht über einen größeren Schnitt, sondern über einen oder wenige kleine Schnitte mittels Kamera im Bauch erfolgen. Die erste laparoskopische Operation in Europa fand 1985 statt und war eine Gallenblasenoperation. 2009/10 kam es zu einer Weiterentwicklung, durch die die Zugänge noch kleiner und weniger – bis zur 1-Port-Technik – geworden sind. Ob ein Eingriff laparoskopisch durchgeführt werden kann, liegt an Patient:in und Chirurg:in. Die erste laparoskopische Darmoperation wurde 1991 durchgeführt. Heute bestehen große Unterschiede in der Anwendung: Der Anteil an offenen Dickdarmeingriffen liegt bei ca. 20 %, während mittlerweile über 80 % der Dickdarmeingriffe laparo -















skopisch durchgeführt werden. Neu ist die robotische Chirurgie, wobei der Roboter ein Telemanipulator ist. Der Eingriff wird von einem Menschen an einer Konsole durchgeführt, über die Roboterarme gesteuert werden. Die erste dokumentierte Bauchoperation mit Roboterassistenz, wo der Chirurg weit weg vom Patienten war (transatlantisch: New York - Straßburg), war die Lindbergh-Operation, für die das Da-Vinci-Operationssystem verwendet wurde. Die OP fand 2001 in New York statt. Diese Technik bietet noch bessere Sicht und ein noch exakteres und schonenderes Präparieren. Während Urolog:innen bereits über 20 Jahre regelmäßig die Prostata mithilfe dieses robotischen Systems operieren, hat die Technik erst in den letzten Jahren in chirurgischen















Abteilungen Anklang gefunden. Mit dieser Entwicklung haben sich auch neue Ausbildungstools und Sicherheitsfeatures ergeben. So haben die Konsolen hochauflösende Simulationsprogramme, mit denen man neben einfacher Fertigkeitsübungen vollständige Operationen virtuell durchoperieren kann. Darüber hinaus gibt es eine Masterkonsole, bei der ein:e erfahrene:r Chirurg:in parallel zur/zum auszubildenden Chirurg:in sitzt und in Sekundenschnelle die Aktivitäten stoppen und in die Operation eingreifen kann. Dies bedeutet für die Ausbildung und Patient:innensicherheit einen enormen Vorteil und Fortschritt. Diese Technik muss daher laufend weiterentwickelt und die entsprechenden Fähigkeiten müssen der nächsten Generation beigebracht werden, damit möglichst viele Patient:innen eine moderne minimalinvasive Chirurgie in Anspruch nehmen können.



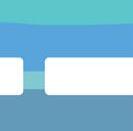
















Entgeltliche Einschaltung

Der Lexion AP 50/30 ist ein intelligenter Echtzeit-Insufflator, der bei der Laparoskopie eingesetzt wird, um ein stabiles Pneumoperitoneum zu gewährleisten. Er bietet mehrere wichtige Funktionen, die sowohl den Komfort von Patient:innen als auch die Arbeitsbedingungen von Chirurg:innen sowie dem OP-Personal verbessern.
HAUPTMERKMALE DES LEXION AP 50/30:
1. Stabiles Pneumoperitoneum:
Das Gerät stellt sicher, dass während der gesamten Operation ein konstanter intraabdomineller Druck aufrechterhalten wird. Dies ist entscheidend für eine sichere und effektive Durchführung der laparoskopischen Verfahren.
2. Kontinuierliche Befeuchtung:
Der Lexion AP 50/30 befeuchtet das zugeführte CO2 kontinuierlich und erreicht dabei eine relative Luftfeuchtigkeit von 95 %. Diese hohe Befeuchtung hilft, die Austrocknung und die daraus resultierende Schädigung des Gewebes zu verhindern, was besonders bei längeren Eingriffen von Bedeutung ist.
3. Erwärmung des CO2
Das zugeführte CO2 wird auf 35 Grad Celsius erwärmt. Die Erwärmung des Gases reduziert das Risiko einer Unterkühlung der inneren Organe und verringert postoperative Schmerzen und andere Komplikationen, die durch die Insufflation von kaltem CO 2 verursacht werden könnten.

VORTEILE FÜR CHIRURG:INNEN, PATIENT:INNEN UND OP-PERSONAL:
• Verbesserter Patient:innenschutz:
Durch die Kombination aus befeuchtetem und erwärmtem CO2 wird die Integrität des Peritoneums besser geschützt, was zu einer schnelleren Erholung der Patient:innen beiträgt.
• Bessere Sichtverhältnisse:
Ein stabiles Pneumoperitoneum sorgt für eine konsistente Sicht und Arbeitsfläche, was die Präzision der Chirurg:innen verbessert.
• Reduzierung postoperativer Beschwerden:
Die optimale Befeuchtung und die Erwärmung des CO2 tragen dazu bei, postoperative Schmerzen und Beschwerden zu reduzieren, was zu einer schnelleren Genesung und höherer Patient:innenzufriedenheit führt.
Dank des geschlossenen Systems wird das Risiko einer Kontamination der OP-Luft mit chirurgischen Rauchgasen minimiert. Dies sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung für das OP-Personal. Insgesamt stellt der Lexion AP 50/30 durch seine fortschrittlichen Funktionen eine wesentliche Verbesserung der Bedingungen für minimalinvasive chirurgische Eingriffe dar.

Der AP 50/30 ist das weltweit erste umfassende PneumoManagement-System, das für ChirurgInnen, OP-Personal und PatientInnen entwickelt wurde.


Bauprojekte
■ Entwicklung einer optimalen OP-Umgebung in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Planern, Ingenieuren, Architekten und weiteren Projektbeteiligten
■ Maßgeschneiderte, moderne und zukunftsorientierte OP-Lösungen nach individuellen Kundenanforderungen
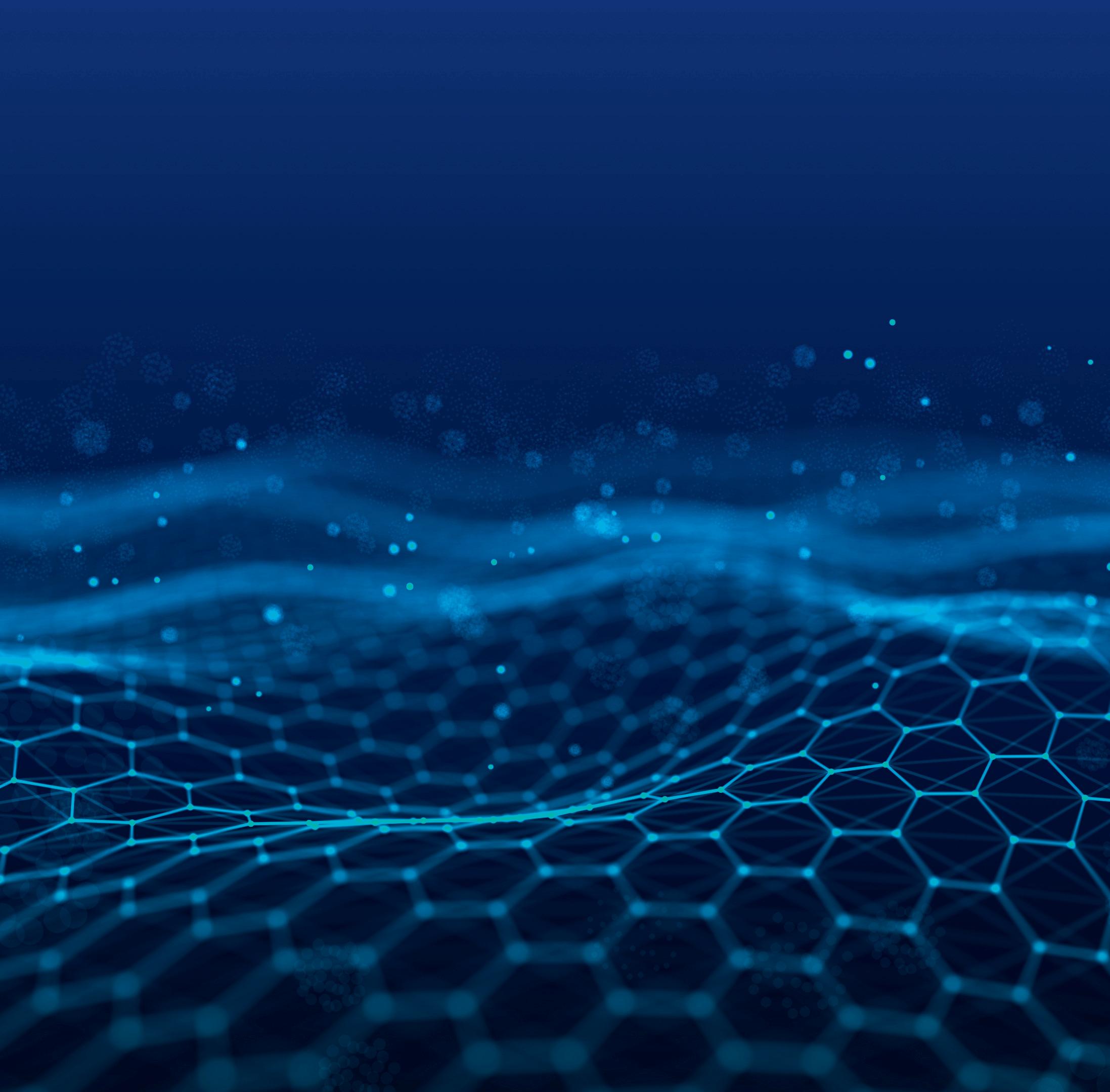
■ Einsatz der neuesten Technologien im Bereich von interdisziplinären Bildgebungssystemen, IT-Integration, Raumequipment, Leuchten sowie nahtloser Daten- und Videointegration
■ Management sämtlicher Projektphasen: Vorbereitung, Planung, Durchführung und Fertigstellung
Integrationsprojekte
■ Integration des medizinischen Equipments des Krankenhauses zur Verwaltung aller Bildgebungsmodalitäten innerhalb des OP-Saals und zur Maximierung der Patientenversorgung und Effizienz
■ Videointegration sämtlicher Bildgebungssysteme:
• Innerhalb des OP-Saals: endoskopische Kameras, C-Bögen, Ultraschallgeräte und andere Bildgebungssysteme
• Außerhalb des OP-Saals: Videokonferenzen, Streaming
■ Datenintegration und automatisierte Workflows zur effizienten Speicherung aller wichtigen Bildund Videodaten im PACS-, KIS- oder EPA-System des Krankenhauses arthrex.com © 2024-08 Arthrex GmbH. Alle Rechte
