Lesen Sie mehr unter dergesundheitsratger.info

Der Österreich-Torhüter über seine Hodenkrebs-Erkrankung – und wie er damit umgegangen ist. Männer & Krebs Nuklearmedizin
Movember


Lesen Sie mehr unter dergesundheitsratger.info

Der Österreich-Torhüter über seine Hodenkrebs-Erkrankung – und wie er damit umgegangen ist. Männer & Krebs Nuklearmedizin
Movember

Männer sind stark, belastbar, kontrolliert. Sie schaffen alles allein, brauchen keine Hilfe. Männer halten an dieser Vorstellung fest, bis ihr Körper widerspricht. Hier werden veraltete Männlichkeitsbilder deutlich. Dabei bräuchte es nur ein wenig Umdenken. Denn Männer können lernen, ihren Körper wichtig zu nehmen.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zweimal Krebs überlebt. Bei der ersten Diagnose schwieg ich. Es war mir peinlich, dass ich nun einen Hoden weniger hatte. Ich fühlte mich in meiner Männlichkeit beschnitten. Ich arbeitete weiter, sprach kaum darüber. Zwei Jahre später: Knochenmetastase in der Schulter. Schmerzhaft. Einschränkend. Erst nach dieser zweiten Diagnose verstand ich, dass Schweigen nicht schützt, sondern isoliert. Offenheit verbindet. Ehrlichkeit, auch mir selbst gegenüber, erleichtert.
Was Männer bremst Männer sterben in Österreich fast fünf Jahre früher als Frauen. Sie erkranken häufiger an Krebs und Herz-Kreislauf-Leiden. Sie verhalten sich riskanter und leben ungesünder. Zugleich suchen sie seltener ärztliche oder psychologische Hilfe. Männer nehmen Gesundheitsdienste weniger in Anspruch als Frauen. Dahinter steckt kein Mangel an Vernunft, sondern ein erlerntes Muster. Männlich sozialisierte Kinder werden früh dazu bewegt, Gefühle zu zerstreuen statt sie zu zeigen. Im Erwachsenenalter führen Leistungsdenken, Verantwortung und Arbeitsdruck dazu, dass die eigene Gesundheit nicht hoch genug priorisiert wird. Erschöpfung, Stress und körperliche Warnzeichen verschwinden aber selten von selbst.
Reden hilft mehr als gedacht Heute, acht Jahre nach überstandener Krebserkrankung, moderiere ich Gesprächsgruppen für Männer mit Krebs. Dort erlebe ich, was passiert, wenn Männer anfangen, Worte zu finden. Da sitzen Führungskräfte, Selbstständige, Arbeiter, Väter, Singles. Verschiedene Lebenswelten. Aber diese Männer erfahren dieselbe Erleichterung, wenn sie frei erzählen können und die Anwesenden ohne zu urteilen zuhören, Verständnis zeigen und Anteil haben.
Diese Männer sind dankbar, von einer Form der Gesprächskultur zu profitieren, die in ihrem sozialen Umfeld fehlt. Das kann ein Wendepunkt sein: wenn Männer merken,

Offenheit verbindet. Ehrlichkeit, auch mir selbst gegenüber, erleichtert.
dass es kein Kontrollverlust ist, etwas von sich preiszugeben, sondern Selbstfürsorge.
Sprache öffnet Türen Wer über seinen Körper, seine Ängste und Grenzen sprechen kann, stärkt seine Kompetenz zur Krankheitsbewältigung. Männer, die im Austausch stehen, – sei es mit Gleichbetroffenen oder Fachpersonen – berichten über eine bessere psychosoziale Anpassung an die Krankheit und eine stärkere Beteiligung an Entscheidungen und Behandlung. Doch dazu braucht es insgesamt mehr Räume, in denen es möglich ist, sich zu öffnen. Patientengruppen sind nur der Anfang. Es braucht Betriebe und Führungskräfte, die psychische Gesundheit ernst nehmen; Ärzt:innen, die wirklich zuhören; und Männer, die einander nicht über Leistung definieren, sondern in einer gesunden Lebensführung bestärken. Es braucht das persönliche Wissen über den eigenen Körper, Gesundheitsangebote und Anlaufstellen.
Diese Gesundheitskompetenz zu haben heißt aber nicht, immer alles wissen zu müssen, sondern rechtzeitig Fragen zu stellen, Unterstützung anzunehmen und die eigene Existenz wichtig zu nehmen. Männer, die das tun, sind keine Weicheier, sondern Vorbilder.
Bei sich selbst anfangen Männergesundheit betrifft Beziehungen, Familien und Unternehmen gleichermaßen.
MÄNNERGESUNDHEIT MIT DR. JONATHAN APASU
Jeder Mann kann damit beginnen, indem er sich selbst zuhört. Wer seinen Körper achtet, über Belastungen spricht und Vorsorgeuntersuchungen nutzt, kann nicht nur Lebensjahre gewinnen , sondern auch Lebensqualität. Ich habe erlebt, dass Stärke nicht im bedingungslosen Aushalten liegt, sondern im aufrichtigen Eingestehen, wann Hilfe nötig ist. Bei der Gesundheit ist Heldentum die falsche Lebenseinstellung. Besser ist eine Haltung, die mit einem Satz beginnt, den viele zu selten sagen – Es geht mir nicht gut. Und dann erzählt man, wie man sich wirklich fühlt: hilflos, traurig, ängstlich. So schaffen wir ein moderneres Bild von Männlichkeit.

ALEXANDER GREINER Gesundheitsjournalist, Podcast-Host „Männerkrebs – Was tut Mann mit Krebs?“ und „Das Herrenzimmer –der Männer-Podcast der Krebshilfe“, Moderator von Patientengruppen für Männer mit Krebs, Speaker und Workshop-Leiter für betriebliche Gesundheitsförderung
PODCAST-TIPP: adon-health.de/blogs/podcast
Im Podcast „Männergesundheit“ dreht sich alles um moderne Männergesundheit - ehrlich, fundiert und alltagsnah. Dr. med. Jonathan Apasu spricht mit Ärzten, Wissenschaftlern und Persön-
lichkeiten aus Sport und Medizin über Themen, die Männer wirklich betreffen: Testosteron, Ernährung, Training, Schlaf, Stress und Leistungsfähigkeit. Jede Folge bietet praxisnahe Impulse und
spannende Gespräche, die helfen, Gesundheit und Energie langfristig zu optimieren.

Wir müssen dringend über Männergesundheit reden. Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie am AKH Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie, liefert Zahlen und Fakten, die diese Forderung untermauern, – und eine Vorsorgestrategie, die die Männergesundheit verbessern kann.
Warum müssen wir über Männergesundheit sprechen, Prof. Shariat?
Die Awareness zu diesem Thema ist so wichtig, weil Männer
• ihre Lebenszeit kranker verbringen
• mit im Durchschnitt 78,8 Jahren fünf Jahre kürzer leben als Frauen
• häufiger an den zehn verbreitetsten Todesursachen weltweit sterben als Frauen.
Außerdem begehen fünfmal mehr Männer als Frauen Suizid; Herzerkrankungen treten bei Männern nicht nur häufiger auf als bei Frauen, sondern auch früher. Diabetes ist bei Männern verbreiteter; ebenso Verletzungen – die meisten davon berufsbedingt. Männer erhalten darüber hinaus häufiger eine Unisex-Krebsdiagnose und sterben auch häufiger daran.
Warum ist es um die Gesundheit der Männer generell schlechter bestellt? Männer leben ungesünder: Sie rauchen häufiger, sie trinken deutlich mehr Alkohol und sie ernähren sich ungesünder als Frauen. Wir wissen heute, dass von den fünf Jahren, die Männer Frauen gegenüber weniger haben, nur ein Jahr Lebenszeit biologisch begründet ist: Vier Jahre verlieren Männer wegen ihres Lifestyles. Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss: Mit Veränderungen desselben ließe sich die Lücke nahezu schließen!
Der Gender Health Gap bekommt damit eine ganz neue Bedeutung … Stimmt. Es ist deshalb von Relevanz, sich die Ursachen für die schlechtere Gesundheit von Männern näher anzuschauen: Ich sehe da zum einen die im Durchschnitt geringere (Gesundheits-)Bildung von Männern und zum anderen das über Jahrhunderte vom Patriarchat reproduzierte Männerbild, demzufolge das Zeigen von Gefühlen unmännlich ist. Männer kennen hier auch keinen Schmerz. Das ist toxische Maskulinität, die zu ungesunden Coping-Strategien führt: Ärger, der sich auch tätlich äußert, Missbrauch von Drogen, Einsamkeit etc.
Sie erwähnten eingangs Krebsdiagnosen, die sowohl Männer als auch Frauen betreffen. Doch welcher Krebs ist typisch Mann? Ganz klar: Prostatakrebs. Dieser ist in Österreich inzwischen der am häufigsten diagnostizierte Krebs überhaupt – Tendenz steigend. Wir erwarten künftig sogar eine weltweite Prostatakrebswelle: Die Zahl der jährlichen Diagnosen von 1 bis 4 Millionen im Jahr 2020 wird sich 2040 auf 2 bis 9 Millionen verdoppeln.
Welche Rolle spielt Vorsorge für Männergesundheit, welche für Frauen? Vorsorge sollte für Männer eine genauso wichtige Rolle spielen wie für Frauen. Tut sie aber aktuell nicht. Im Gegenzug ist die Frauengesundheitsvorsorge mit der Verbreitung der Antibabypille stark gewachsen, auch wenn ihre Akzeptanz inzwischen wieder sinkt. Das entsprechende Rezept führt Frauen regelmäßig in die ärztliche Praxis. Aus diesen Gründen sind ärztliche Besuche und die teils unangenehmen Untersuchungen und Behandlungen für Frauen selbstverständlich. Dieses Selbstverständnis fehlt bei Männern.
Zu welcher Strategie würden Sie Männern also raten?
Männergesundheit würde sich allein mit dem regelmäßigen Abnehmen von zwei Biomarkern erheblich verbessern: Testosteronwert und PSA für das Prostatakarzinom-Screening. Die Anteile des männlichen Sexualhormons Testosteron sinken mit dem Alter. Das verursacht vielfältige Gesundheitsprobleme, die Männer zum ärztlichen Besuch bewegen – doch meist erst dann, wenn sie sich schon sichtlich manifestiert haben: in Form von verringerter Vitalität, Knochendichte und Libido, Erektions- und Gewichtsproblemen, Schwitzen oder Konzentrationsschwierigkeiten. Spannend ist, dass ein Fünftel der Männer, die mit ernsthaften Erektionsstörungen zu Ärzt:innen gehen, auch Herzkreislaufprobleme aufweist. Der Zusammenhang ist folgender: Die Blutgefäße im Penis sind noch feiner

als jene im Herzen. Eine erektile Dysfunktion tritt deshalb schon 3 bis 6 Jahre vor einer kardiovaskulären Dysfunktion auf. Daher sollte ein Mann ab 45 einmal im Jahr ein Blutbild machen lassen, bei dem unter anderem auch der Testosteronlevel festgestellt wird. Ein Mangel kann einfach ersetzt werden. Bei den Spermien beobachten wir gerade einen massiven Rückgang: Die Zahl der Spermien in einem Milliliter Samenflüssigkeit hat sich von 101 Millionen (1973) auf 49 Millionen (2018) halbiert. Damit wackelt die Fertilität erheblich. Doch dies ist ein Tabuthema, da es das verbreitete Bild vom ‚potenten Mann‘ schwächt.
Ursächlich für den Spermienrückgang sind nach heutigem Kenntnisstand vor allem Lebensstil und Umweltfaktoren, allem voran Nano- und Mikroplastik sowie Chemikalien wie Phthalate, die hormonell wirken. Das sind Dinge, die wir mit entsprechenden Maßnahmen zumindest weniger in die Umwelt entlassen könnten.
Wie ließe sich Prostatakrebs, dem Männerkrebs schlechthin, rechtzeitiger beikommen?
Ein organisiertes, PSA-initiiertes risikoangepasstes Screening würde helfen. Männer müssen dazu wissen, dass die ‚Finger-in-denPo‘-Untersuchung, die viele vom Prostatacheck abhält, mit diesem PSA-Screening unnötig ist. Anders als beim derzeit praktizierten opportunistischen PSA-Screening würden wir mit einem organisierten Screening weniger PSA-Tests, weniger MRT, weniger Biopsien sowie weniger Überdiagnosen und Überbehandlungen von Tumoren erreichen, die keiner Behandlung (mehr) bedürfen. Zugleich würden wir Prostatakrebs in einem früheren Stadium entdecken und mit nebenwirkungsärmeren und die Lebensqualität weniger beschneidenden Therapien behandeln können.

Professor der Urologie, Head des Comprehensive Cancer Center an der MedUni Wien, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie, Präsident der Central European Urological Society (CEUS)
forschen für das Leben!
Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten.
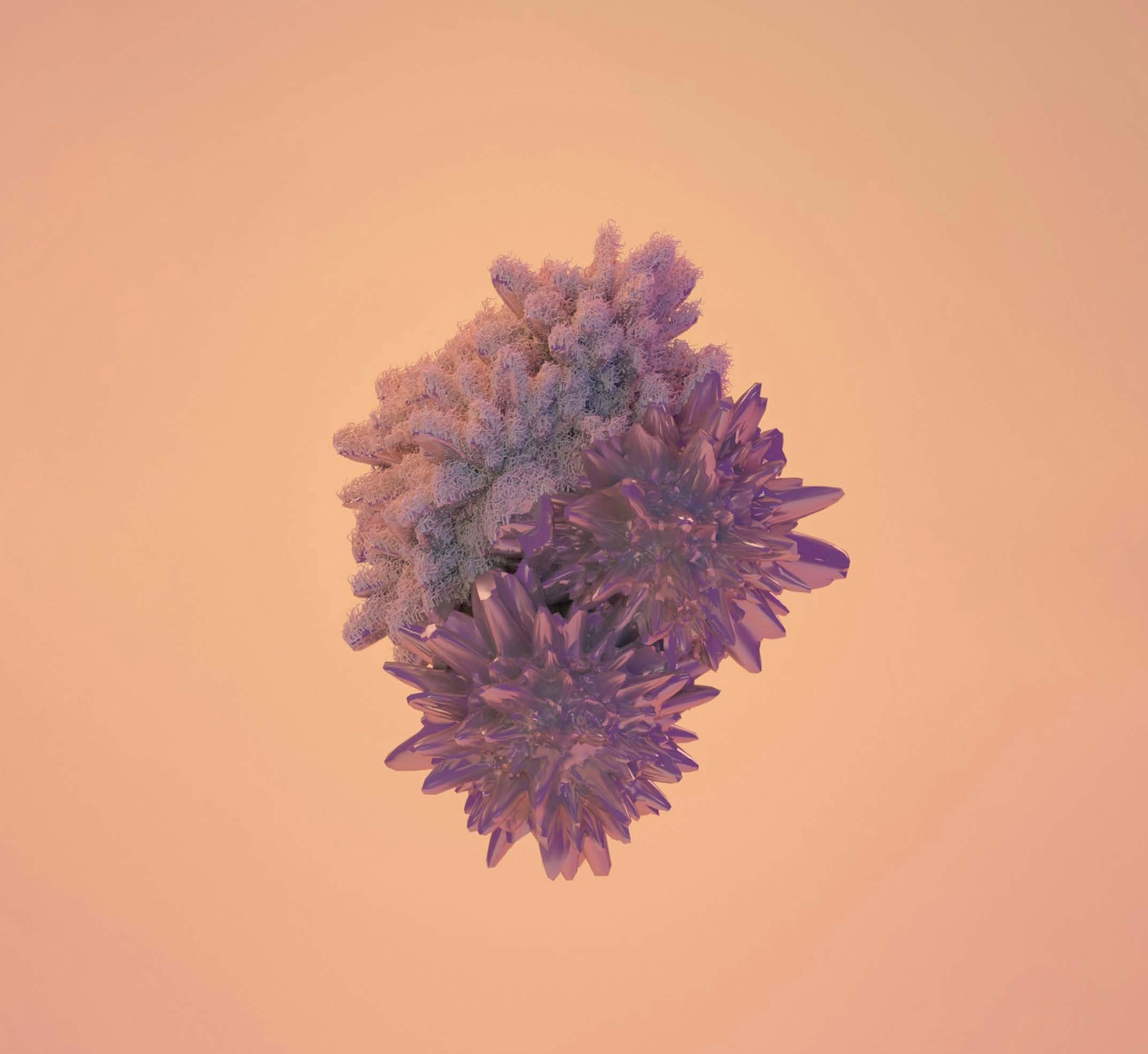
Was macht die nuklearmedizinische Anwendung Theranostik aus?
Wie verbessert sie die Behandlung des Prostatakarzinoms? Diese und weitere Fragen beantwortet Nuklearmediziner Michael Gabriel im Interview.
Was bedeutet „Theranostik“?


Bei Theranostik handelt es sich um eine nuklearmedizinische Anwendung, die sowohl bildgebend, diagnostisch, als auch therapeutisch eingesetzt werden kann: Aus Therapie und Diagnostik wird also Theranostik. Die Nuklearmedizin gibt es erst seit rund 80 Jahren und ist damit ein relativ junges Fach innerhalb der Medizin. Die Anfänge der Theranostik liegen in der Anwendung radioaktiver Jodisotope zur Behandlung von Schilddrüsenkrebs. Dank dieser konnte das Gesamtüberleben1 von Patient:innen deutlich verbessert werden. Die Radio-Iod-Behandlungen schreiben daher eine Erfolgsgeschichte, die sich bis heute fortsetzt. Sie sind nach wie vor State of the Art und tragen dazu bei, dass Schilddrüsenkrebs zu den Tumoren mit den größten Behandlungserfolgen zählt. Auch bei anderen Krebserkrankungen, allem voran bei Prostatakarzinomen, aber auch bei Nierenzell- und Leberkarzinomen oder gynäkologischen und endokrinologischen Tumoren, wird intensiv
daran geforscht, wie strahlende (radioaktive) Substanzen u.a. in Kombination mit anderen, etwa Chemo-, Hormon- und Immuntherapien, bestmöglich zum Wohle der Patient:innen angewandt werden können.
Was kann Theranostik im Bereich der Diagnose leisten?
Auf diagnostischer Seite konnte die Nuklearmedizin anfänglich ihren Nutzen bei neuroendokrinen Tumoren, einer seltenen Tumorart, die aus hormonproduzierenden Zellen entsteht und in verschiedenen Organen (z.B. Darm oder Lunge) vorkommen kann, unter Beweis stellen. Mittlerweile ist sie in diesem Bereich eine etablierte Behandlungsform. Dabei wird als strahlende Substanz das Gallium-68-Isotop verwendet: Es wird an ein Trägermolekül gekoppelt, das gezielt an Tumorgewebe bindet (‚Schlüssel-SchlossPrinzip‘), sodass Letzteres mit der Bildgebung (CT) sichtbar gemacht werden kann. Damit sind selbst kleinste Tumorabsiedelungen,
also Metastasen, zuverlässig auffindbar. Das ist Voraussetzung für die Durchführung einer effektiven Behandlung bei Krebserkrankungen im metastasierten Stadium. Mittlerweile wird sehr viel dazu geforscht, ob diese Vorgehensweise auch bei anderen Krebserkrankungen, etwa beim Lungen- oder Nierenkarzinom oder bei gynäkologischen Tumoren, anwendbar ist.
Strahlung gilt per se als gefährlich. Warum ist das hier anders?
Bei medizinischen Verfahren, z. B. Röntgen oder eben auch nuklearmedizinischen Anwendungen, werden strahlende Substanzen unter streng kontrollierten Bedingungen angewendet. In diesem Fall hat die Strahlung großen Nutzen für die Patient:innen – bei sehr überschaubaren Risiken. Im Gegensatz zu Zytostatika, wie sie etwa in der Chemotherapie zum Einsatz kommen, können wir Strahlung sehr gut messen und lokalisieren. Das ist ein großer Vorteil, der uns dabei hilft, Patient:innen und deren
Umgebung zu schützen. Natürlich braucht es aber auch Au lärung im sozialen Umfeld, vor allem bei jenen Personen, die im selben Haushalt wohnen. Außerdem sind strahlenhygienische Maßnahmen einzuhalten. Wesentlich ist dabei, dass Patient:innen für die Dauer nuklearmedizinischer Behandlungen, abhängig von der verwendeten Substanz, Abstand zu Kindern und schwangeren Frauen wahren. Das ist jedoch die einzige Einschränkung bei der Therapie. Die klinische Erfahrung zeigt, dass diese Art der Behandlung von den Patient:innen in den meisten Fällen gut vertragen wird.
Wodurch unterscheidet sich die Theranostik von der Strahlentherapie?
Anders als bei der Radioonkologie, bzw. der Strahlentherapie im eigentlichen Sinn, werden bei der Theranostik Tumore im Körper nicht von außen bestrahlt. Die Theranostik basiert auf einem systemischen Therapieansatz und verwendet offene radioaktive Stoffe. Diese werden in den Körper injiziert, verteilen sich dort und reichern sich im Tumorgewebe an. Das führt bei diagnostischen Anwendungen zur Sichtbarmachung, bei therapeutischen zum Absterben des Tumorgewebes. Der Überstand an strahlender Substanz wird einfach wieder ausgeschieden. Im Vergleich zur Strahlentherapie können damit bei einer Anwendung gleich mehrere Metastasen in unterschiedlichen Körperregionen behandelt werden.
Was macht die Theranostik so besonders?
Sie stellt eine sehr personalisierte Krebsbehandlung dar. Man behandelt das, was man zuvor in der nuklearmedizinischen Bildgebung sichtbar gemacht hat. Diese Kombination ist gerade am Beispiel des Prostatakarzinoms besonders gut nachvollziehbar. Dessen Diagnose und seine Behandlung mit den Mitteln der Nuklearmedizin haben sich in einem rasanten Tempo entwickelt, was sich überaus positiv auf beide Bereiche ausgewirkt hat. Dank der Theranostik kann man die Patienten vom Scheitel bis zur Sohle untersuchen und Metastasierungen aufspüren. In Folge ergibt sich dadurch auch eine effektive Behandlungsoption. Das ist sowohl in der Behandlung des Prostatakarzinoms, als auch für die Theranostik ein Meilenstein. Bislang konnten diese Methoden nur bei vergleichsweise seltenen Erkrankungen wie Schilddrüsenkrebs oder neuroendokrinen Tumoren angewendet werden. Das Prostatakarzinom ist hingegen eine weit verbreitete Krebserkrankung: Jährlich gibt es ca. 7.000 Neuerkrankungen. Das Theranostik-Prinzip ist dabei vor allem für Patienten relevant, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung befinden, in dem es bereits zur Bildung von Metastasen gekommen ist, und wo es zu einem Wiederanstieg des PSA-Wertes (prostataspezifisches Antigen) kommt, der in diesem Krankheitsstadium häufig mit einem Voranschreiten der Tumorerkrankung einhergeht, und wo etablierte antihormonelle Behandlungen nicht mehr ansprechen. Schätzungen zufolge könnten in Österreich künftig mehrere hundert Patienten pro Jahr von diesem Ansatz profitieren. Aus Sicht der Nuklearmedizin ist es eine Herausforderung, diese Anwendungen in einem so großen Umfang niederschwellig anbieten zu können. Wir sind hier aber auf einem sehr guten Weg.
Was kann die Theranostik bei Prostatakarzinomen leisten?
Seitens der Diagnostik wird im Fall des Prostatakarzinoms das prostataspezifische Membranantigen PSMA, nicht zu verwechseln mit dem PSA-Wert, mit einem Positronenstrahler, dem Gallium-68-Isotop, markiert. Mit einer radiologischen Computertomografie PET/CT können so auch kleinste Metastasen sichtbar gemacht werden. Neben der PSMA-Expression erhält man eine exakte anatomische Darstellung der Metastasen. Bisherige Studien belegen die hohe Treffsicherheit der Anwendung: 92 Prozent aller bösartigen Gewebeveränderungen können so mit einer Spezifizität von 82 bis 100 Prozent erkannt werden. Das bedeutet, falsch-positive Ergebnisse werden mit relativ hoher Sicherheit ausgeschlossen. Man muss bedenken, dass PSMA nicht nur bei Prostatakarzinomen auftritt. Auch Tumore der Leber, Brust und Lunge sowie spezifische Erkrankungen und Entzündungen können zur Bildung dieses Glykoproteins auf der Zelloberfläche
führen. Bei einem unklaren Befund ist deshalb eine Biopsie notwendig, um andere Ursachen als das Prostatakarzinom ausschließen zu können. Diese sind aber eher die Ausnahme. Weitere Studien bei Patienten, deren PSAWert nach einer Prostatakarzinom-Therapie erneut auf über 0,2 mg/ml angestiegen ist, haben gezeigt, dass man mit der PSMA PET/CT Untersuchung Metastasen in einem früheren Stadium oder bei niedrigerer Tumormasse erkennen kann – noch bevor diese eindeutig mit konventionellen Bildgebungsverfahren (CT oder MRT) erkannt werden können. Das kann für den weiteren Therapieerfolg von großer Bedeutung sein.
Welche Optionen eröffnet die Theranostik bei der Behandlung?
Auch bei der Therapie setzt man auf das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Wirkstoff ist so konzipiert, dass er sich spezifisch an die Oberflächen von PSMA-produzierenden Tumorzellen bindet. Die Therapie erfolgt also äußerst zielgerichtet. Während man die Strahlung bei diagnostischen Anwendungen gering halten will, benötigt man bei der Therapie Isotope, die ein hohe Strahlendosis abgeben können. Als besonders effektiv hat sich dabei Lutetium, ein Element der seltenen Erden, erwiesen. Das Isotop Lutetium-177 hat eine Halbwertszeit von nur 6,6 Tagen. Die Strahlung kann zudem nur maximal 2 mm Gewebe durchdringen. Damit wirkt die Strahlung selektiv an Tumorzellen und ist zudem zeitlich und räumlich begrenzt. Das minimiert die Strahlenbelastung für normales Gewebe und verbessert die allgemeine Arzneimittelverträglichkeit. Die Strahlung wird an die Tumorzellen abgegeben, wo sie zu einer Schädigung der DNA führt. Es werden also Fehler im Bauplan der Tumorzellen hervorgerufen, die zum Absterben der Zellen führen. Es gibt bereits zahlreiche klinische Studien, die die Wirksamkeit dieser Therapie belegen: Bei Patienten mit einem metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom – der Tumor spricht also nicht auf eine Hormonentzugstherapie an – konnte eine im Vergleich zu herkömmlichen Therapien effektivere Absenkung des PSA-Werts und eine Verbesserung der Überlebenszeit mit der Krebserkrankung erzielt werden, auch wenn eine Heilung durch diese Behandlung nicht möglich ist. Gleichzeitig bestand bei Patienten, die mit Lutetium-177 behandelt wurden, eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit, schwerwiegende Nebenwirkungen zu entwickeln. Weniger schwere Nebenwirkungen bedeuten für die Patienten eine höhere Lebensqualität während der Behandlung. Eine weitere Studie zeigte für diese Patienten-Gruppe zudem eine verbesserte Überlebensdauer. Die Behandlung mit Lutetium-177 wurde deshalb im fortgeschrittenen Prostatakrebs im Jahr 2022 sowohl in Europa als auch in den USA zugelassen.
In den aktuellen Studien liegt der Fokus nun darauf, bei welchen Tumorerkrankungen und zu welchem Zeitpunkt theranostische Therapien am besten wirken.
Wie profitieren die Patienten davon? Die Nuklearmedizin unter Anwendung der Theranostik verbessert sowohl Diagnose als auch Behandlung in einer für den Patienten schonenden Art und Weise. Diese Form der Diagnostik bietet nicht nur den Vorteil, dass man eine mögliche Metastasierung in der Bildgebung regelrecht herausleuchten sieht, sondern auch, dass dabei in den allermeisten Fällen Tumorzellen mit hoher Sicherheit korrekt erkannt werden. Auf therapeutischer Seite besteht die Möglichkeit, die Patienten auch im fortgeschrittenen Stadium behandeln, die Erkrankung hinauszögern und zugleich die Lebensqualität der Patienten verbessern zu können. Die Therapie wird im Regelfall sehr gut vertragen, ist nebenwirkungsarm und wirkt sich zudem meist positiv auf die Schmerzsymptomatik aus. Das trifft im Grunde auf alle nuklearmedizinischen Behandlungen zu. Dadurch sind die Patienten in geringerem Umfang auf Schmerzmittel angewiesen. Es kommt auch – anders, als bei der Chemotherapie – nicht zu Haarausfall. Zudem kann die Behandlung unter bestimmten Voraussetzungen einerseits ambulant erfolgen und andererseits auch bei älteren Patienten angewendet werden.
AUF EINEN BLICK
Kurzzusammenfassung des Interviews mit Prim. Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Gabriel
Was ist Theranostik?
Theranostik ist ein Kunstwort aus „Therapie“ und „Diagnostik“. Es beschreibt ein Verfahren, bei dem radioaktive Substanzen sowohl zur Diagnose als auch zur Behandlung von Tumoren eingesetzt werden. Die Methode stammt ursprünglich aus der Behandlung von Schilddrüsenkrebs, wo sie seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird. Heute wird sie zunehmend auch bei anderen Krebsarten wie Leber-, Nieren- oder gynäkologischen Tumoren erforscht – und ganz besonders beim Prostatakarzinom.
Wie funktioniert das Verfahren?
Die Theranostik nutzt das sogenannte „SchlüsselSchloss-Prinzip“: Eine radioaktive Substanz wird an ein Molekül gekoppelt, das gezielt an Tumorzellen bindet. Für die Diagnose wird meist das Isotop Gallium-68 verwendet. Es macht selbst kleinste Tumorherde im Körper sichtbar – mithilfe der PET/CT Bildgebung. So können Metastasen frühzeitig erkannt werden, was für den Therapieerfolg entscheidend ist.
Ist Strahlung nicht gefährlich?
Ein berechtigter Gedanke – doch in der Medizin wird Strahlung unter streng kontrollierten Bedingungen eingesetzt. Im Gegensatz zur Chemotherapie, bei der Zytostatika den ganzen Körper belasten, wirkt die Strahlung bei der Theranostik gezielt, sowie lokal und zeitlich begrenzt. Wichtig ist, dass Patient:innen während der Behandlung klar definierte Kontaktbeschränkungen mit Personen in ihrem Umfeld, insbesondere mit Kindern und Schwangeren, einhalten. Diese Therapieformen haben sich in klinischen Studien als sicher und gut verträglich erwiesen. Ihre Anwendung gilt als medizinisch gut kontrollierbar.
Was unterscheidet Theranostik von klassischer Strahlentherapie?
Während bei der klassischen Strahlentherapie Tumore von außen bestrahlt werden, wirkt die Theranostik von innen. Die radioaktive Substanz wird in den Körper injiziert, reichert sich gezielt im Tumorgewebe an und entfaltet dort ihre Wirkung. Das ermöglicht die gleichzeitige Behandlung mehrerer Tumorherde – ein großer Vorteil bei fortgeschrittenem Krebs.
Warum ist das besonders für Männer mit Prostatakrebs relevant?
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Österreich – rund 7.000 Männer erhalten jährlich diese Diagnose. Besonders für Patienten im fortgeschrittenen Stadium, bei denen sich bereits Metastasen gebildet haben und herkömmliche Therapien nicht mehr wirken, bietet die Theranostik eine zusätzliche Behandlungsoption.
Wie läuft die Behandlung konkret ab?
Zunächst wird das sogenannte PSMA (prostataspezifisches Membranantigen) mit dem Radioisotop Gallium-68 markiert und per PET/ CT sichtbar gemacht. Für die Therapie kommt dann Lutetium-177 zum Einsatz – ein Isotop, das gezielt Strahlung an die Tumorzellen abgibt. Die Strahlung zerstört die Krebszellen, ohne das umliegende Gewebe stark zu belasten. Studien zeigen: Die Methode senkt den PSA-Wert effektiv und verlängert die Überlebenszeit bei einem verträglichen Nebenwirkungsprofil.
Was kann der theranostische Therapieansatz bringen?
• Früherkennung und präzise Diagnose: Selbst kleinste Metastasen können in der Bildgebung sichtbar gemacht werden.
• Gezielte Therapie: Die Strahlung wirkt vorwiegend dort, wo sie gebraucht wird.
• Bekanntes Nebenwirkungsprofil
• Erhalt der Lebensqualität
• Auch für ältere Patient:innen geeignet
Fazit
Theranostik ist ein Meilenstein in der modernen Krebsmedizin. Sie bietet Männern mit fortgeschrittenem Prostatakrebs eine zusätzliche Behandlungsoption bei Erhalt der Lebensqualität.
INSPIRATION
„Das Beste aus der Situation machen, auch wenn es schwerfällt“
Im Mai 2023 wurde beim Österreich-Torhüter Heinz Lindner Hodenkrebs diagnostiziert. Warum es ihm wichtig war, offen mit der Erkrankung umzugehen, erzählt er im Gespräch.
Wie kam es zur Diagnose?
Ich hatte ein Schmerzgefühl in den Hoden, wie wenn man mit einem Ball angeschossen wird. Ich konnte mich aber nicht daran erinnern, dass das im Training passiert wäre. Die Schmerzen hielten zwei Tage an und verschwanden dann wieder. Sie kamen aber immer wieder und in immer kürzeren Abständen zurück. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und sie meinte, dass ich das abklären lassen sollte – um auf Nummer sicher zu gehen. Deshalb vereinbarte ich einen Termin im Krankenhaus. Nach der Ultraschalluntersuchung hat mir der Arzt schließlich erklärt, dass der Verdacht auf einen Tumor besteht. Drei Tage später wurde ich operiert.
Wie ist die Operation verlaufen?
Ich hatte wirklich Glück, weil der Tumor noch keine Metastasen gebildet hatte und die OP rechtzeitig stattfand. Ab einer Größe von 3 cm steigt das Risiko deutlich, weil der Tumor dann den Samenleiter berühren kann, was eine Metastasierung begünstigt. Da meiner nur geringfügig kleiner war, musste es sehr schnell gehen. Jedenfalls konnte das gesamte Tumorgewebe erfolgreich entfernt werden. Ich erfuhr dann erst nach dem Eingriff, dass der Krebs nicht gestreut hatte. Das war natürlich eine immense Erleichterung – auch aus dem Grund, weil eine Chemotherapie so nicht zwingend notwendig war. Ich entschied mich in Rücksprache mit den Ärzt:innen also für eine konservative Behandlung. Das bedeutete: im ersten Jahr einmal im Quartal zum Checkup mit Ultraschall, MRT und Blutabnahme. Ich konnte dann recht rasch wieder ins Training einsteigen, weil die OP aus körperlicher Sicht nicht viel anders war als eine Blinddarm-OP. Die psychische Belastung ist aber deutlich größer. In die eigenen Routinen zurückzufinden hilft aber dabei, wieder auf andere Gedanken zu kommen. Klar, die Checkups sind nie ein schönes Gefühl, weil sie die Zeit immer wieder hochkommen lassen, und man sich natürlich sorgt, dass doch noch etwas sein könnte.
Wie haben Sie die Diagnose aufgenommen?
Die schnelle Operation war gut für mich, denn dadurch hatte ich wenig Zeit, lange darüber nachzudenken. So eine Diagnose ist aber für jede:n eine Hiobsbotschaft. Ich war im Februar davor Vater geworden. Drei Monate später erfährst du dann, dass du an Krebs erkrankt bist. Das war keine leichte Situation für mich,


aber meine Frau und meine Familie halfen mir sehr dabei, alles durchzustehen. Ich habe ein enges Verhältnis zu meiner Familie und meinen Freund:innen – und es war sehr wertvoll und erleichternd für mich, mit ihnen offen über das Thema sprechen zu können.
Sie haben sich von Anfang an dazu entschieden, ihre Erkrankung offen zu kommunizieren?
Ich war zu dem Zeitpunkt Stammtorhüter beim FC Sion und auch österreichischer Nationalspieler. Das wäre aufgefallen, wenn ich plötzlich nicht mehr dabei gewesen wäre. Darum war es für mich alternativlos, mit der Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen – auch, um mögliche Spekulationen zu unterbinden. Im Nachhinein betrachtet war das der richtige Schritt, die Anteilnahme war beeindruckend: Mir haben so viele Menschen gute Besserung gewünscht, darunter auch Männer, die mir schrieben, dass sie sich jetzt ebenfalls durchchecken lassen. Wenn meine Erkrankung jemand anderen vor demselben Schicksal bewahrt hat, dann freut mich das
natürlich. Ich glaube, gerade bei Männern und insbesondere bei Beschwerden im Intimbereich besteht die Tendenz, das nicht wahrhaben zu wollen – und eine Untersuchung vor sich herzuschieben. Im Nachhinein kann ich nur allen raten, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und sich bei Beschwerden rechtzeitig durchchecken zu lassen.
Was möchten Sie Betroffenen noch mitgeben?
Auch wenn es sich sehr leicht sagt, obwohl es in Wirklichkeit sehr schwierig ist: Versuchen Sie, das Beste aus dieser Situation zu machen. Es hilft einem selbst und auch der Gesundheit nicht, wenn man sich unterkriegen lässt. Die aktuelle Lage lässt sich nun mal nicht ändern. Ich kann nur beeinflussen, wie ich damit umgehe – deshalb auf jeden Fall offen kommunizieren, versuchen, mit der Familie und Freund:innen zu sein, mit Menschen, die einem Kraft geben und Mut zusprechen. Es ist kein leichter Weg, und man braucht alle Kraft, um das durchzustehen.
Der deutsche Rugby-Nationalspieler Ben Ellermann ist Movember-Botschafter und spricht im Interview über Männlichkeit und mentale Gesundheit. Warum ein Schnurrbart mehr bewirken kann, als man denkt, lesen Sie hier.

Ben Ellermann
Deutscher RugbyNationalspieler und Movember-Botschafter
Herr Ellermann, Sie spielen Rugby, eine der härtesten Mannschaftssportarten überhaupt, und setzen sich gleichzeitig für mentale Gesundheit ein. Wie passt das zusammen?
Rugby hat mir beigebracht, dass Stärke nichts mit Schweigen zu tun hat. Auf dem Feld geht es um Teamgeist, Vertrauen, Verletzlichkeit. Jeder weiß: Wenn du nicht sagst, dass du verletzt bist, gefährdest du dich und das Team. Genau das gilt im Leben. Wir Männer glauben oft, wir müssen funktionieren – immer stark, immer souverän. Dabei ist wahre Stärke, Schwäche zuzulassen.
Sie engagieren sich seit Jahren für Movember. Warum liegt Ihnen das Thema so am Herzen?
Ich habe erlebt, wie viele Männer innerlich kämpfen und es niemand merkt. Freunde, Mitspieler, Kollegen. Einige haben den Kampf verloren. In Deutschland nehmen sich jeden Tag 19 Männer das Leben. Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Das ist keine Statistik, das sind Väter, Brüder, Söhne, Freunde.
Das Symbol von Movember ist der Schnurrbart. Wie wird dieses humoristische Detail zur Bewegung?
Humor ist ein Türöffner. Der Schnurrbart im November sorgt für Gesprächsstoff – und genau darum geht’s. Männer reden oft nicht über Gefühle, aber über Bärte schon. Der Schnurrbart ist nur der Anfang. Dahinter steckt Au lärung, Forschung, Prävention. Wir finanzieren Studien zu Prostata- und
Hodenkrebs, fördern Programme für mentale Gesundheit und bieten Plattformen, wo Männer lernen, über das zu reden, was sie belastet. Sie halten Vorträge in Unternehmen wie VW, Procter & Gamble und Dentons. Wie reagieren Manager auf Sie?
Anfangs sind sie skeptisch. Aber wenn ein Typ mit kaputter Nase über Angst redet, hört man zu. Ich spreche Klartext. Ich sage: ‚Ihr redet ständig über Leistung, aber nie über Druck.‘ Ich erkläre, dass psychische Gesundheit keine Privatangelegenheit ist, sondern eine Führungsaufgabe. Die meisten nicken dann, oft mit einem stillen Blick, der sagt: ‚Ich weiß, wovon du sprichst.‘
Was bedeutet Ihr Motto „Egal, wer du bist, wo du bist und was du tust – du und ich sind irgendwie gebrochen. Aber das ist okay, denn so kommt das Licht rein“?
Dieser Satz trägt mich durchs Leben. Wir alle tragen Risse – Verletzungen, Zweifel, Scham. Aber genau durch diese Risse scheint das Licht. Wenn wir au ören, Perfektion zu spielen, wird das Leben echter, tiefer, schöner. Ich will Männern zeigen, dass sie nicht allein sind. Dass es okay ist, nicht okay zu sein.
Wie sieht Ihre Vision für Männergesundheit aus – in zehn Jahren?
Ich wünsche mir, dass kein Mann mehr denkt, er müsse allein kämpfen. Dass jeder Junge in der Schule lernt, was mentale Gesundheit bedeutet. Dass Unternehmen über psychische Belastung so selbstverständlich sprechen wie über ihren Umsatz. Und dass der Satz ‚Wie
VERLOSUNGSAKTION
Gewinne ein original Merch-Package (T-Shirt, Basecap, Socken und Bart-Sticker) von Movember, das nicht im freien Verkauf erhältlich ist! Schick uns dazu einfach eine Email mit dem Stichwort „Männergesundheit“ an movember@milkandhoneypr.com. Unter den Einsendungen verlosen wir drei Merch-Packages.

geht’s dir wirklich?‘ nicht mehr ungewöhnlich klingt. Wenn wir das schaffen, hat der Schnurrbart mehr verändert als Mode – dann hat er Leben gerettet.
Und was sagen Sie jungen Männern, die das alles noch für „weich“ halten? Reden ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut. Wer über seine Gefühle spricht, kämpft – und wer kämpft, ist stark. Es braucht mehr Helden, die ehrlich sind, nicht unbesiegbar.

HINTERGRUND
Movember ist eine globale Bewegung, die sich seit ihrer Gründung 2003 dafür einsetzt, das Bewusstsein für Männergesundheit zu steigern und Aufmerksamkeit für wichtige Gesundheitsprobleme wie Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit und Suizidprävention zu schaffen. Die Movember-Kampagne fußt auf der Idee, Männer im November dazu zu bringen, sich Schnurrbärte wachsen zu lassen. Die humorvolle Umsetzung hat aber einen ernsthaften Hintergrund: Über die Schnurrbartaktion werden Spendengelder allokiert, die Forschung und Projekte zur Verbesserung von Männergesundheit refinanzieren. Über die Jahre hat sich Movember zu einer der größten Wohltätigkeitsorganisationen der Welt entwickelt. Mittlerweile wurden über 1 Milliarde Euro eingesammelt.
Entgeltliche Einschaltung
Wenn es nicht mehr richtig „läuft“:
Die gutartige Prostatavergrößerung (BPH) betrifft rund zwei Drittel aller Männer über 65 Jahre. Die Prostata liegt unterhalb der Blase und umschließt die Harnröhre. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr wächst sie bei allen Männern langsam weiter. Typische Beschwerden sind dabei häufiges oder nächtliches Wasserlassen, schwächerer Harnstrahl oder plötzlich einsetzender Harndrang. Dr. Julian Veser, Facharzt für Urologie am Universitätsklinikum Wien, unter der Leitung der Abteilung von Prof. Shahrokh Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie, spricht über die Vielzahl moderner Behandlungsmöglichkeiten.

Herr Dr. Veser, was raten Sie Männern mit Prostatabeschwerden? Es gibt keine „One-size-fits-all“Lösung. Der erste Schritt ist immer das persönliche Gespräch mit Ärzt:innen. Oft helfen schon einfache Maßnahmen: weniger Kaffee am Abend oder eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme über den Tag. Wenn das nicht ausreicht, stehen sehr wirksame und gut verträgliche Medikamente zur Verfügung, die die Beschwerden deutlich lindern können.

Abbildung: Die iTind-Methode von Olympus Medizintechnik kann mit einem kleinen ambulanten Eingriff ein BPS innerhalb weniger Monate kurieren.
Das heißt, die Tabletteneinnahme wird einer OP vorgezogen? Ja, wenn es möglich ist, vermeiden wir eine Operation. Manchmal ist sie dennoch notwendig. Dann besprechen wir gemeinsam mit dem Patienten die individuell beste Lösung. Heute gibt es nicht mehr die eine Standard-Operation, sondern viele verschiedene Verfahren, die wir gezielt einsetzen können.
Welche Alternativen bestehen zu klassischen Operationen? Neben den etablierten Methoden gibt es mittlerweile minimalinvasive, interventionelle Verfahren, die oft ohne Vollnarkose
auskommen und eine rasche Erholung ermöglichen. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie und zu verschiedenen Laser- und Resektionsverfahren bieten wir am AKH auch das sogenannte iTind an. Dank dieser Vielfalt können wir jedem Mann die individuell passende Therapie empfehlen. Entscheidend ist die persönliche Beratung.
Beim iTind-Verfahren wird ein kleines, einem Stent ähnliches Körbchen unter lokaler Betäubung in die Prostata eingesetzt. Es dehnt das Gewebe und verbessert so den Harnfluss. Nach etwa einer Woche wird der iTind-Stent ambulant entfernt – die meisten
Patienten können sofort wieder ihrem Alltag nachgehen. Manche spüren das Körbchen etwas, zum Beispiel durch leichtes Brennen oder Druckgefühl – doch diese Beschwerden verschwinden unmittelbar nach der Entfernung wieder.
Für wen ist iTind geeignet? Das Verfahren ist vor allem für Männer mit einer kleineren Prostata und mäßigen Beschwerden geeignet – und für jene, die Medikamente nicht gut vertragen oder nicht täglich Tabletten nehmen möchten. Ein großer Vorteil ist, dass die Sexualfunktion, insbesondere der Samenerguss, praktisch immer erhalten bleibt.
Wie etabliert ist das iTind-Verfahren?
In den USA ist es bereits weit verbreitet. Auch in Europa – vor allem in Deutschland, der Schweiz und England – wird es zunehmend eingesetzt. Aufgrund der guten Studienergebnisse haben wir uns entschieden, diese Methode auch am Universitätsklinikum anzubieten. Unser endourologisches Team unter der Leitung von Prof. Shariat ist dafür speziell geschult. Wir können Patienten deshalb ab sofort mit iTind behandeln.

Wir kümmern uns nicht nur im November um Männergesundheit. Sie wollen mitmachen? Melden Sie sich unter
hello-austria@mediaplanet.com