Lesen Sie mehr unter dergesundheitsratgeber.info


Lesen Sie mehr unter dergesundheitsratgeber.info

Infl uencerin und Aktivistin
Tanja Marfo im Interview
Seite 3
Depression verstehen – Sie sind nicht allein!
Eine Expertin, zwei Betroffene und ein Selbsttest: Erkennen, wann die Seele Hilfe braucht
Seite 4–5
Diffuses Gliom – Leben mit einer unsichtbaren Krankheit
Warum Ihr Gefühl so wichtig ist und Dr. Google niemals Expert:innen ersetzt
Seite 6–7
Unsichtbare Last, gemeinsames Schicksal Viele chronisch Kranke teilen dieselbe mentale Herausforderung – Zeit, auch darüber zu sprechen
Körper Psyche Lebensqualität
VORWORT

IN DIESER AUSGABE
Sauerstofftherapie: Fakten statt Vorurteile
Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht (Johannes-Kepler-Universität Linz) erklärt, wie Sauerstofftherapie funktioniert, wer davon profitiert – und warum Au lärung hilft, Vorurteile abzubauen.

rer. soc. oec. Jürgen Ephraim Holzinger Obmann des Vereins ChronischKrank Österreich Fachk. Laienrichter am BVwG Wien & Linz Geschäftsführer der Akademie

Das Herz im Blick behalten Warum Frauen in den Wechseljahren besonders auf ihre Herzgesundheit achten sollten, erklärt
Assoz.- Prof.in Dipl.-Ing.in Lena Tschiderer, PhD, Medizinische Universität Innsbruck.
Das Leben mit einer chronischen Erkrankung bringt diverse Herausforderungen mit sich – und nicht immer ist auf den ersten Blick ersichtlich, mit welchen Hürden und Stolpersteinen Betroffene konfrontiert sind.
Kein Tag ist wie der andere, und doch scheint es häufig so, als ob das Leben mit der Erkrankung in dieser schnelllebigen Zeit beinahe zur Selbstverständlichkeit wird. Sei es im Berufsleben, im privaten sozialen Umfeld oder auch grundlegend im Umgang mit der eigenen Krankengeschichte – Betroffene sind mit vielen Themen rund um die Erkrankung konfrontiert.
Wenn der Alltag von der Krankheit bestimmt wird Ein genauerer Blick hinter die Kulissen von Betroffenen mit einer chronischen Erkrankung bringt jedoch Klarheit und zeigt, dass vielfach ein „normaler“ Alltag kaum möglich ist und die chronische Krankheit bestimmend für die zeitliche Abfolge der Dinge an einem gewöhnlichen Tag ist. Dabei ist der Blick nicht nur auf die eigene Krankheit gerichtet – er muss alle Aspekte und Eventualitäten des täglichen Lebens mit der chronischen Krankheit miteinbeziehen. Unabhängig davon, um welches Krankheitsbild es sich genau handelt, kommen zumeist weitere belastende Faktoren zur Grunderkrankung hinzu.
Unterstützung zu suchen, sei es durch Gespräche mit Freund:innen, Familie oder auch professionelle Hilfe. Hierbei können auch Selbsthilfegruppen oder entsprechende Vereine eine Unterstützung bieten. Die Gewissheit, mit einer Erkrankung nicht allein zu sein, wirkt sich zumeist schon positiv aus. Das eigene Gefühl zuzulassen ist ein wichtiger Schritt, um mit psychischer Belastung umzugehen. Es bedeutet, sich selbst die Erlaubnis zu geben, Gefühle wie Traurigkeit, Wut, Angst oder auch Erleichterung zu spüren, ohne sie zu unterdrücken oder zu bewerten. Das kann manchmal schwer sein, weil viele Betroffene denken, sie müssten trotz der Erkrankung stark sein.
Leben mit chronischer Lebererkrankung
Univ.-Prof.in M.D. Vanessa Stadlbauer-Köllner und Pflegeexpertin (LiverNurse) Denise Schäfer, BSc geben Einblicke in Ursachen, Behandlung und Alltag mit chronischen Lebererkrankungen.

Gewinne eines von zwei Mental Health Bundles inkl. stylischer Glastrinkflasche – im Wert von je 100 €!
Für mehr Energie, gute Stimmung & innere Balance – mit Mood Formel, Magnesiumglycinat und stylischer Flasche. Jetzt mitmachen & Wohlfühl-Paket sichern!
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung:




Die unterschätzte psychische Belastung Die psychische oder auch emotionale Belastung einer chronischen Erkrankung ist nur ein Aspekt, der jedenfalls stark beachtet werden muss. Gerade die Psyche kann Symptome verstärken. Manche Aktivitäten oder Hobbys sind möglicherweise eingeschränkt, was das Gefühl von Selbstbestimmtheit beeinträchtigen kann. Dadurch leiden die Lebensqualität und der Selbstwert von Betroffenen. Regelmäßige ärztliche Besuche, Medikamente und Therapien erfordern Zeit und Organisation, was die negative Belastung erhöht. Betroffene ziehen sich dann häufig in die eigenen vier Wände zurück, auch, um Auff älligkeiten und in weiterer Folge soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Gefühle wie Frustration, Angst oder Depression können hervorgerufen werden. Dies alles ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich.
Die Bedeutung seelischer Gesundheit Dabei ist nicht jeder Tag gleich gut oder schlecht. Dementsprechend können chronische Krankheiten nicht nur den Körper, sondern auch die Seele stark beanspruchen. Das Stärken der mentalen Verfassung und seelischen Gesundheit stehen hierbei im Fokus, denn nur so kann auf lange Sicht trotz chronischer Erkrankung ein „gutes Leben“ ermöglicht werden. In unserer Gesellschaft wird zunehmend erkannt, wie bedeutend das seelische Wohlbefinden für ein erfülltes Leben ist. Dennoch bestehen nach wie vor viele Vorurteile und Missverständnisse rund um psychische Erkrankungen, was dazu führt, dass Menschen sich häufig scheuen, Hilfe zu suchen. Vor allem im Bereich der chronischen Erkrankungen braucht es noch mehr Entstigmatisierung, denn die Bereiche Psyche und chronische Erkrankungen dürfen nicht isoliert betrachtet werden.
Gefühle zulassen und Hilfe annehmen Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um die eigenen Gefühle zuzulassen und
Lebensqualität trotz chronischer Erkrankung Bei chronischen Erkrankungen ist vor allem der Bereich der Lebensqualität von großer Bedeutung. Damit verbunden ist das Lebensgefühl – auch mit einer chronischen Erkrankung sollte das Leben lebenswert sein. Es muss für Betroffene möglich sein, sich auch außerhalb von Krankenhäusern und Therapiezentren gewisse Strukturen aufzubauen, damit soziale Abläufe stattfinden können. Denn: Die Krankheit beeinflusst ohnehin häufig soziale Kontakte, etwa durch Einschränkungen bei der Arbeit oder im Privatleben. Jedoch sollten die Erkrankung und die damit verbundenen Einschränkungen nicht im Mittelpunkt stehen bzw. allumfassend den Alltag beherrschen.
Selbstbestimmter Umgang durch Krankheitsmanagement Um diesen Einschränkungen so gut wie möglich entgegenzuwirken, braucht es ein selbständiges Krankheitsmanagement. Darunter wird der systematische Ansatz verstanden, um eine chronische Krankheit bestmöglich zu steuern und zu behandeln. Es geht darum, die Erkrankung aktiv zu kontrollieren, um Beschwerden zu lindern, Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Beim Krankheitsmanagement werden verschiedene Maßnahmen kombiniert, wie zum Beispiel Therapie- und Medikamentenplanung, Veränderung von Lebensgewohnheiten oder Lebensstil, genauso wie regelmäßige Kontrollen und Beobachtung der Krankheitszeichen. Nicht zuletzt bringen auch das Verständnis und Erkennen der eigenen Erkrankung eine gewisse Form der Akzeptanz mit sich. Das steigert die Lebensqualität. Kurz gesagt ist Krankheitsmanagement eine Art „Plan“, um die Krankheit selbstbestimmt zu steuern und die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.
Ein erfülltes Leben ist möglich Werden die verschiedensten Bereiche der chronischen Krankheit berücksichtigt und wird der seelischen und mentalen Gesundheit genügend Raum gegeben – verbunden mit einem strukturierten Krankheitsmanagement – lassen sich die vielen und sicherlich herausfordernden Hürden überwinden. Ein erfülltes und gutes Leben mit einer chronischen Erkrankung ist letztlich möglich.
Die Parole der Gesellschaft „Einfach weniger essen und mehr bewegen“ hält sich in Bezug auf Übergewichtige hartnäckig. Doch Adipositas ist eine ernsthafte, chronische Erkrankung mit komplexen Ursachen und Folgen und verdient daher einen vorurteilsfreien Blick.
Adipositas hat ein hartnäckiges Imageproblem. Während Adipositas gesellschaftlich häufig noch als selbstverschuldetes Problem abgestempelt wird, sind sich Expert:innen längst einig, dass es sich dabei um eine chronische, komplexe und vielschichtige Erkrankung handelt. Dabei spielen sowohl Genetik, Stoffwechsel, Hormone, psychische Gesundheit als auch verschiedene Umweltfaktoren eine Rolle. Was also nach simpler Kilokalorienrechnung aussieht, braucht in der Behandlung Betroffener individuell abgestimmte Konzepte und medizinische Begleitung.
Komplexer gesundheitlicher Risikofaktor
Dabei ist Adipositas keine Seltenheit, sondern eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Als ernstzunehmende Erkrankung stellt Adipositas einen großen gesundheitlichen Risikofaktor dar. Die Risiken der Ernährungsund Stoffwechselstörung reichen von Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Gelenkschäden bis hin zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und bestimmten Krebsarten.
Versorgung mit Lücken In Österreich lebt rund ein Drittel der Erwachsenen mit Übergewicht im adipösen Bereich. Dennoch ist die flächendeckende Versorgung ausbaufähig. Sowohl auf Adipositas spezialisierte Ambulanzen und entsprechende Therapieplätze als auch finanzierbare Behandlungen sind rar. Das heißt, damit Betroffene jene Therapien erhalten, die sowohl ihre Lebensqualität als auch ihre Lebenserwartung verbessern, braucht es individuelle, strukturierte und spezialisierte
medizinische Angebote. Erfolgreiche Therapiekonzepte umfassen zumeist ein Zusammenspiel aus medizinischer Behandlung, Ernährungsberatung, Bewegungsprogrammen und psychologischer Begleitung. In schweren Fällen können auch Operationen sinnvoll sein.
Behandlung benötigt Ausdauer So verlockend Crash-Diäten klingen – derartige Schnelllösungen funktionieren leider nur selten. Spätestens, wenn der berühmtberüchtigte Jo-Jo-Effekt eintritt, ist der Frust größer als zuvor. Entscheidend ist daher eine langfristige medizinisch-therapeutische Begleitung, die innovative Behandlungsmethoden ebenso berücksichtigt wie den Alltag von Betroffenen. Denn zusätzlich zu den körperlichen Belastungen erleben viele Menschen mit Adipositas gesellschaftliche Vorurteile, Schamgefühl und Stigmatisierung, was den Gang zu Ärzt:innen erschweren und den sozialen Rückzug begünstigt kann.
Gesundheit und Lebensqualität im Fokus Neben der medizinischen Behandlung ist daher auch die psychosoziale Unterstützung ein bedeutender Faktor in der Therapie von Adipositas. Der Abbau gesellschaftlicher Vorurteile ermöglicht Betroffenen, selbstbewusst Hilfe zu suchen, um so die eigene Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Adipositas zu verstehen und zu behandeln heißt also, nicht einfach Gewicht zu reduzieren, sondern der Erkrankung holistisch zu begegnen. Nur auf diesem Weg kann eine nachhaltige Veränderung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene stattfinden.

Tanja Marfo ist Influencerin (@Kurvenrausch), Aktivistin und Stimme für mehr Sichtbarkeit und Respekt im Umgang mit Adipositas. In unserem Interview spricht sie über den gesellschaftlichen Druck, die Realität im Gesundheitssystem und ihren persönlichen Weg zu Selbstakzeptanz.
Tanja, wann hast du zum ersten Mal mitbekommen, dass dein Körper von der Gesellschaft anders behandelt wird? Wie hat dich das geprägt?
Schon als Teenagerin habe ich gemerkt, dass mein Körper ständig bewertet wird – im Alltag, in der Schule, beim Shoppen. Kleidung in meiner Größe gab es kaum, und statt Normalität habe ich immer das Gefühl vermittelt bekommen: ‚Du bist anders.‘ Das hat mich sehr geprägt, weil ich lange dachte, ich sei weniger wert, nur weil ich dicker bin. Heute weiß ich: Mein Wert hängt nicht von meiner Kleidergröße ab.
Wie hast du die Diagnose Adipositas erlebt?
Welche Erfahrungen hast du seither mit dem Gesundheitssystem gemacht?
Ich habe lange gedacht, ich sei weniger wert, nur weil ich dicker bin. Heute weiß ich: Mein Wert hängt nicht von meiner Kleidergröße ab.“
Wie bist du zu deiner Selbstakzeptanz und Selbstliebe gekommen? Welche Rolle spielen dabei mentale Gesundheit und gesellschaftlicher Druck?
Mehr über Adipositas erfahren: adipositas-austria.org
adipositasnetzwerk.at
Die Diagnose selbst war für mich erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe mich gefragt: ‚Bin ich jetzt eine Krankheit?‘ Gleichzeitig war es aber auch der Moment, in dem ich verstanden habe, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist – und nicht meine Schwäche. Leider wird im Gesundheitssystem oft nicht entsprechend vorgegangen. Man bekommt Vorwürfe statt Unterstützung, und Hilfen wie Therapien oder Operationen muss man sich mühsam erkämpfen. Das macht Betroffenen das Leben zusätzlich schwer.
Was entgegnest du Menschen, die Adipositas noch immer mit Faulheit oder mangelnder Disziplin gleichsetzen? Ich sage ganz klar: Adipositas ist eine komplexe, chronische Krankheit. Wenn es nur um ‚weniger essen und mehr bewegen‘ ginge, hätten wir kein weltweites Problem. Die meisten Betroffenen haben unzählige Diäten ausprobiert – oft mit großem Willen und viel Disziplin – und sind trotzdem gescheitert, weil ihr Körper gegen sie arbeitet. Faulheit hat damit nichts zu tun.
Das war ein langer Weg. Selbstliebe kam nicht über Nacht. Ich musste lernen, meinen Wert nicht über mein Gewicht zu definieren, und mir gleichzeitig ein Umfeld au auen, das mich stärkt – und nicht kleinmacht. Mentale Gesundheit war dabei entscheidend: Ich habe viel reflektiert, eine Therapie gemacht und mir erlaubt, Grenzen zu setzen. Der gesellschaftliche Druck ist riesig, aber je stärker mein eigenes Fundament wurde, desto weniger konnte er mich aus der Bahn werfen.
Was wünschst du dir für den Umgang mit Adipositas in Medizin, Medien und Politik? Was möchtest du anderen Betroffenen mitgeben?
Ich wünsche mir Au lärung und Respekt –in allen Bereichen. Medizinisch braucht es Zugang zu modernen Therapien, ohne dass Betroffene sich ständig rechtfertigen müssen. Von den Medien wünsche ich mir realistische Darstellungen statt Klischees. Und auf politischer Ebene braucht es mehr Anerkennung dafür, dass Adipositas eine Volkskrankheit ist, die ernst genommen werden muss. Meinen Mitbetroffenen möchte ich sagen: Ihr seid nicht allein! Holt euch Hilfe, schämt euch nicht dafür und vergesst nie, dass ihr mehr seid als euer Gewicht. Selbstliebe ist kein Ziel, das man irgendwann erreicht – sie ist ein Prozess.

Ein erholsamer Schlaf ist mehr als nur Regeneration – er ist die Basis für Gesundheit und Lebensfreude. Holen Sie sich ein Stück Natur ins Schlafzimmer: mit Bio-Schlafsystemen aus 100 Prozent Naturlatex und Bio-Bezügen, hergestellt in Österreich und Deutschland.

Feinfühlige Schlafsysteme passen sich Ihrem Körper in jeder Position optimal an. Ob Sie auf dem Rücken, der Seite oder dem Bauch schlafen – die hochwertige Verarbeitung sorgt für ein ideales Einsinken und garantiert eine lange Lebensdauer und bestmöglichen Komfort.
Gesunder Schlaf beginnt bei der richtigen Auswahl
Achten Sie beim Kauf eines Schlafsystems auf die Höhe der Matratze, die Festigkeit und die Belüftung! Verschiedene Härtegrade unterstützen Ihre individuellen Bedürfnisse. Schwere Personen profitieren von einem festeren Härtegrad, um ein Durchhängen der Wirbelsäule zu vermeiden. Dazu kommen metallfreie Lattenroste, die nicht nur für ein angenehmes Liegegefühl, sondern auch für eine optimale Luftzirkulation sorgen und ein trockenes und hygienisches Schla lima fördern.
Natürlich, schadstofffrei, nachhaltig
LaModula-Materialien sind auf Schadstoffe geprüft und ideal für Allergiker:innen geeignet. Mit einem Bio-Schlafsystem entscheiden Sie sich für einen gesunden Schlaf und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
ÖKO-TEST empfiehlt „Julian“ Die Zeitschrift ÖKO-TEST hat in ihrer Ausgabe 12/2024 elf Latexmatratzen getestet, unter anderem die LaModula-Naturlatex-Matratze „Julian“ im Härtegrad medium. Allein die Inhaltsstoffe wurden im Test mit der Note „sehr gut“ bewertet, und mit dem Gesamturteil „gut“ liegen Sie auf einer der besten Naturlatex-Matratzen.
www.lamodula.at
Dornbirn

Priv.-Doz.in DDr.in Lucie Bartova, Oberärztin an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien, erklärt im Interview, was eine Depression ist, wie sie sich zeigt und welche Therapieformen es gibt.
Was ist eine Depression und wie unterscheidet sie sich vom Stimmungstief?
Die Depression ist eine psychiatrische Erkrankung. Sie ist keine zeitweise Traurigkeit oder melancholische Stimmung, wie sie jede:r mal spürt. Wer an einer Depression leidet, hat Symptome, die mindestens über zwei Wochen anhalten – zu den klassischen zählen: niedergeschlagene Stimmung, Schlafstörungen, Antriebs-, Freud- und Lustlosigkeit, Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprobleme, innere Unruhe, Anspannung, Reizbarkeit … Wichtig ist ebenso das Wissen darüber, dass eine Depression eine Gehirnerkrankung ist. Das Gehirn reguliert den gesamten Körper, weshalb auch alle Organe in Mitleidenschaft geraten können (Multiorganerkrankung), beispielsweise der Bewegungsapparat, der Gastrointestinaltrakt und das Herz-Kreislaufsystem. Auch die Sexualität kann von einer Depression beeinträchtigt sein.
Lässt sich Betroffenen die Depression ansehen?
Häufig können Menschen mit einer Depression nicht mehr zurücklächeln, wenn sie angelächelt werden. Diese affektive Rückkopplung auf neuronaler Ebene ist bei ihnen gestört. Zudem bewegen Betroffene sich häufig langsamer. Anders ist es dagegen bei Patient:innen mit einer hochfunktionalen Depression – ihnen ist kaum etwas anzumerken. Das sind oft Menschen, die andere Menschen führen. Sie scheinen alles im Griff zu haben, lächeln … doch hinter der Fassade sind sie leer. Sie füllen
ihre innerliche Leere häufig mit Alkohol, Cannabis oder übermäßigem Essen. Nicht selten entwickeln Sie Essstörungen wie Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating. Die Suizidrate ist bei diesen Patient:innen besonders hoch –wobei ihr „selbst gewählter“ Tod ihr Umfeld meist sehr überrascht.
Wann ist es Zeit, ärztlichen Rat zu suchen, und an wen wenden sich Betroffene am besten?
Wenn die Symptome länger als zwei Wochen anhalten, ist es ratsam, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch milde Symptome sind ernst zu nehmen, denn unbehandelt kann sich daraus eine chronische Depression entwickeln. Die erste Anlaufstelle muss nicht sofort ein:e Psychiater:in sein, auch wenn diese:r das größte Fachwissen hat. Die österreichischen Leitlinien zur Behandlung von Depressionen befähigen jede:n Mediziner:in dazu, diese körperliche Erkrankung mit Medikamenten (Antidepressiva) adäquat zu behandeln. Idealerweise sollte die medikamentöse Einstellung durch eine:n Fachärzt:in für Psychiatrie oder Psychotherapeutische Medizin erfolgen.
Wie behandeln Sie Menschen mit einer Depression?
Jeder Mensch, jedes Gehirn ist einzigartig – so auch jede Depression. Wir haben inzwischen moderne Medikamente, die die Symptome einer Depression in wenigen Wochen deutlich lindern, ohne dabei abhängig zu machen. Dies sollte immer das erste Ziel der Behandlung sein. Denn wenn sich die Symptomatik bessert,
ist ein Mensch mit einer Depression viel eher in der Lage, eine Psychotherapie zu starten und Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
Warum muss psychische Gesundheit bei chronischen Erkrankungen mitgedacht werden?
Ich trenne Gesundheit ungern in physische und psychische. Das Gehirn ist zentraler Teil des Körpers. Für mich gibt es deshalb nur eine Gesundheit. Das ist wichtig, weil es auch erklärt, warum es unangebracht ist, Menschen mit Depressionen zu sagen: ‚Reißt euch einfach zusammen!‘. Diese Menschen sind körperlich krank, sodass sie nicht können, obwohl sie wollen. Chronische Erkrankte leben meist mit einer höheren Belastung als Gesunde. Zu der Krankheitsbelastung (Schmerzen, Einschränkungen, Behandlungen) kommt zusätzlich der Druck unserer Leistungsgesellschaft, der enormen Stress, Ängste und Sorgen auslösen kann. Diese erhöhen die Krankheitsbelastung und das Risiko, depressiv zu werden.
Welche Rolle spielt Schlaf bei Depressionen? Ist Schlafmangel eher Ursache oder Folge?
Depressionen können Schlafmangel verursachen – und umgekehrt. Es handelt sich also um eine bidirektionale Beziehung: Wer an einer Depression leidet, hat oft Probleme, ein- und durchzuschlafen, mitunter ist gar der Tag-Nacht-Rhythmus gestört. Im Grunde leidet dann alles, was im Leben Freude macht, darunter.
1. Fühlen Sie sich in letzter Zeit häufiger als sonst traurig oder niedergeschlagen?
Ja Nein
2. Haben Sie oft das Gefühl, keine Energie oder Motivation für Ihre täglichen Aufgaben zu haben?
Ja Nein
3. Interessieren Sie sich weniger für Dinge, die Ihnen früher Freude bereitet haben haben?
Ja Nein
4. Fällt es Ihnen schwer, sich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?
Ja Nein
5. Haben Sie Schlafprobleme, wie Einschlaf- oder Durchschlafstörungen?
Ja Nein
6. Fühlen Sie sich oft hoffnungslos oder haben negative Gedanken über sich selbst?
Ja Nein
7. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht verloren oder zugenommen?
Ja Nein
0–2 × Ja: hre Antworten deuten eher nicht auf eine Depression hin. Wenn Sie sich dennoch Sorgen machen, sprechen Sie mit einer Vertrauensperson oder holen Sie sich ärztlichen Rat.
8. Ziehen Sie sich vermehrt von Familie, Freund:innen oder sozialen Aktivitäten zurück?
Ja Nein
9. Haben Sie gelegentlich Gedanken, dass das Leben keinen Sinn mehr hat?
Ja Nein
10. Gibt es sonstige körperliche Beschwerden, die Ihnen zu schaffen machen – ohne, dass eine Erkrankung bekannt ist?
Ja Nein
3–5 × Ja: Es könnten Anzeichen für eine depressive Verstimmung vorliegen. Beobachten Sie sich weiter und ziehen Sie in Erwägung, professionelle Unterstützung zu suchen.
6+ × Ja: Ihre Antworten deuten auf eine mögliche Depression hin. Bitte zögern Sie nicht, möglichst bald ärztlichen Rat oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wolfgang Brunthaler
Vorsitzender der Klienten-Vertretung bei pro mente Wien & Gruppen-Leiter einer Selbsthilfe-Gruppe für Männer mit Depressionen
Wolfgang Brunthaler erlebte mit 18 Jahren seine erste Panikattacke. Wenig später kam die Depression dazu. Im Interview berichtet der heute 63-Jährige, der als Mediator im Behindertenbereich tätig ist und seit Jahren eine Selbsthilfegruppe bei pro mente Wien leitet, über seinen langen Weg mit den psychischen Erkrankungen. Welche Hilfe er bekam, lesen Sie hier.
Wann machte sich Ihre Depression erstmals bemerkbar?
Ich war gerade 18, hatte meine Matura in der Tasche und erledigte für meine Mutter – sie war Krankenschwester – kleine Aufgaben. Eines Tages war ich deshalb unterwegs, als mich plötzlich eine Panikattacke überkam. Ich dachte, ich würde den nächsten Moment nicht überleben. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt super gesund, spielte im Verein Fußball. Die Panikattacke fühlte sich an, als wäre ich von einem Blitz getroffen worden. Ich hatte Herzrasen, ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Kalter Schweiß kam aus allen Poren, die Beine gaben nach. Ich hatte Todesangst und rettete mich in ein Taxi und nachhause. Von dort aus rief ich meine Mutter an … Sie schob die Episode zunächst auf den Stressabfall nach der Matura: ‚Das wird sich schon geben.‘ Doch mein Zustand verschlechterte sich – ich konnte irgendwann das Haus nicht mehr verlassen, weil ich jedes Mal vor der Haustür in Panik und Angst

Lena Berger
Vierfachmutter, Content Creatorin & Mental Health
Adovocat für Frauen und Mütter
verfiel. Ich wurde schwer depressiv. Haben Sie sich helfen lassen? Als gar nichts mehr ging, rief meine Mutter den psychosozialen Dienst – und die Sozialarbeiterin, die darau in zu uns nachhause kam, direkt einen Arzt. Ich war dann drei Monate lang in einer psychiatrischen Klinik. Seitdem nehme ich Medikamente. So ging es mir lange recht gut.
Doch als im Jahr 2007 mein Lebensmensch, meine Frau, an Krebs starb, rutschte ich erneut in eine Depression. Diesmal suchte ich mir selbst Hilfe – bei pro mente Wien. Ich nahm deren Trainingshilfe in Anspruch und lernte innerhalb des einjährigen Programms, wieder Öffis zu benutzen. Ohne die professionelle Unterstützung der dort tätigen Psychotherapeut:innen wäre ich heute nicht der, der ich bin. Höchstwahrscheinlich hat mich meine Feigheit gerettet, sonst wäre ich gar nicht mehr da … Heute
leite ich im Rahmen von pro mente selbst eine Selbsthilfegruppe: Anfangs war das eine gemischte Gruppe, inzwischen ist es eine reine Männergruppe für 50+. Was würden Sie anderen Männern sagen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, sich aber schwertun, Hilfe anzunehmen/über ihre Depression zu sprechen?
Aus meiner eigenen Erfahrung und jener mit den Männern in meiner Gruppe kann ich einerseits sagen: Ja, Männer öffnen sich häufig schwerer als Frauen. Stattdessen fressen sie ihre Depression oder Angststörung eher in sich rein. Sie unterdrücken die Krankheit und damit auch sich selbst. Andererseits sage ich immer: ‚Männer, Hilfe ist nur einen Hilferuf weit entfernt!‘ Wer bereit ist, sich Unterstützung zu holen, der findet sie – und kann sein Leben wieder in die eigene Hand nehmen.
Lena Berger (35) leidet an einer Depression. Im Interview macht die Vierfachmutter und Content Creatorin, die ihre Geschichte auf Instagram (@mamakannnichtmehr) teilt, auf das Thema Frauen und Mütter mit mentalen Erkrankungen aufmerksam.
Lena, wann hast du gemerkt, dass irgendetwas nicht mit dir stimmt?
Ziemlich genau zu meinem 30. Geburtstag brach ich zusammen: Nichts ging mehr. Ich konnte meine Kinder nicht mehr fühlen. Ich lebte nur noch für die Familie, war 24/7 für meinen Mann, die Kinder und den Haushalt da. Ich selbst fand gar nicht mehr statt, ich war mir egal geworden – einfach ausgebrannt. Ich setzte mich neben meinen Mann und sagte ihm: ‚Ich weiß, dass ich eine Depression habe.‘ Zu diesem Zeitpunkt waren unsere vier Kinder alle schon geboren – die Geburt des jüngsten Kindes war 2018.
Wie schwer war es für dich, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wie hast du den Schritt
Hat die Depression dein Muttersein verändert?
Ich hatte nur noch eine sehr kurze Zündschnur, die bei der kleinsten Sache zündete. Ich hatte keinen Nerv, es reizte mich alles. Es gab Momente, da fiel es mir sehr schwer, mich zurückzuhalten, um nicht zu explodieren. Manchmal gelang es mir nicht, dann sprach ich sehr böse mit den Kindern. Doch nur ein Blick in ihre Augen erdete mich wieder. Ich verließ dann meist den Raum und atmete tief durch. Mir war klar, die Kinder konnten nichts dafür. Sie hatten keine Schuld an meiner Erkrankung.
Wie hast du deinen Kindern erklärt, was mit dir los ist?
tagsüber. Er macht auch reizbar und ungeduldig – und triggert die Depression. Die wiederum lässt mich nicht schlafen … Als Tipp kann ich nur sagen: Sprecht mit den Ärzt:innen eures Vertrauens und lasst euch über mögliche Behandlungen au lären.
Wie geht es dir heute? Ich nehme Medikamente, die mir etwas helfen. Die Depression ist mal lauter, mal leiser. Mit meiner Arbeit habe ich für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Damit entgifte ich mich gewissermaßen. Ich nehme Fortschritte an, die sich einstellen, und versuche, sehr geduldig mit mir zu sein.
Was rätst du Müttern, die in einer ähnlichen

„Nicht jeder Kampf ist sichtbar. Aber niemand muss ihn allein führen. Denken Sie daran: Es gibt jemand der auf Ihrer Seite steht. Jemand, der versteht, wie wichtig echte Unterstützung ist.“
Angelini Pharma ist ein aufstrebendes Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das zur Holding Angelini Industries gehört. Unser Ziel ist es, die Belastung durch psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, zu verringern und dabei die mentale Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu stärken.
Wir arbeiten jeden Tag daran, als führender europäischer Innovator im Bereich der psychischen Gesundheit zu wachsen und einen echten Unterschied im Leben von Patient:innen zu bewirken. Seit 1919.
www.mentalfitmachmit.at ist unsere Online-Plattform zur Förderung mentaler Stärke und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.

www.mentalfitmachmit.at

Die intensive Forschung eröffnet zunehmend mehr Behandlungsmöglichkeiten bei diffusen Gliomen. Worum es sich dabei handelt und welche Therapieformen es aktuell gibt, erklärt der Onkologe Univ.-Prof. Dr. Matthias Preusser.
Was ist ein diffuses Gliom?
Gliome gehören nicht zu den häufigsten Krebserkrankungen, kommen aber doch regelmäßig vor. Das Gliom ist ein Tumor des Gehirns, der sich aus Gliazellen – das sind Stützzellen des zentralen Nervensystems –entwickelt. Diffus bedeutet, dass der Tumor nicht abgekapselt wächst, sondern sich weit im Gehirn verbreitet. Dabei unterscheiden wir vor allem zwei Hauptkategorien: IDHmutierte und IDH-nicht-mutierte diffuse
Gliome – hauptsächlich handelt es sich dabei um Glioblastome. IDH-nicht-mutierte Gliome betreffen überwiegend Patient:innen im fortgeschrittenen Lebensalter, IDH-mutierte Tumore treten dagegen typischerweise zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf. Welche Symptome können auf ein diffuses Gliom hinweisen?
gehen. Es kann dann oftmals lange dauern, bis der Verdacht auf einen Tumor fällt. Besteht ein solcher, erfolgt zur Diagnosesicherung eine Magnetresonanztomographie. Kann ein Tumor nachgewiesen werden, erfolgt eine Operation oder Biopsie, um diesen auf histologischer und genetischer Ebene exakt bestimmen zu können.
nur ein Teil entfernt werden, um das Risiko von Schäden zu minimieren. Zurückbleibende Tumorzellen werden individuell angepasst mit Strahlen-, Chemo- oder zielgerichteter Therapie bzw. einer Kombination behandelt. Diese zielgerichteten Therapien eröffnen uns bei Patient:innen mit IDH-mutierten Tumoren neue Behandlungsmöglichkeiten.
Text Werner Sturmberger
Das Gehirn entwickelt in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Spezialsierungen. Die Art der Symptome und deren Intensität sind deshalb stark von der Lokalisation und Größe des Tumors abhängig. Tritt das diffuse Gliom im motorischen Zentrum auf, kann das die Bewegungsfähigkeit einschränken. Es kann aber auch zu Sprachstörungen, epileptischen Anfällen, Kopfschmerzen aufgrund einer Hirndrucksymptomatik, Konzentrationsstörungen und auch Wesensänderungen führen. Die Symptome können sehr subtil, bei schnell wachsenden Tumoren aber auch stark ausgeprägt sein. IDH-mutierte diffuse Gliome entwickeln sich oftmals über einen langen Zeitraum: Die Symptome kommen und
Wie verläuft die Erkrankung? Bei rapide wachsenden Tumoren wie dem Glioblastom ist die Überlebensprognose deutlich eingeschränkt. Bei IDH-mutierten diffusen Gliomen können Patient:innen oft jahre-, manchmal jahrzehntelang ein vergleichsweise normales Leben führen. Verlauf und Symptomatik der Erkrankung – und damit auch die Lebensqualität der Patient_:innen – sind wiederum von der Lokalisation, der Größe und dem Ansprechen auf die Therapie abhängig. Gerade, wenn Patient:innen Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen entwickeln und auf die Hilfe von Angehörigen oder Pflegepersonal angewiesen sind, kann das sehr einschränkend sein. Darum ist es so wichtig, weiter in die Forschung zu investieren, damit wird auch diese Patient:innen mit effektiveren Therapien unterstützen können.
Welche Behandlungsstrategien gibt es heute?
Prinzipiell versucht man in einem ersten Schritt immer, möglichst viel Tumorgewebe zu entfernen. Gerade wenn der Tumor in sehr wichtigen Arealen des Gehirns liegt, wie dem Bewegungs- oder Sprachzentrum, kann oft
Welche Fortschritte sind hier in den nächsten Jahren zu erwarten? Bei Hirntumoren haben wir uns lange Zeit
schwergetan. Mit den zielgerichteten Therapien machen wir jetzt deutliche Fortschritte. Es wird weiter intensiv daran geforscht, die Tumor-Biologie besser zu verstehen, um neue Angriffspunkte für Therapien zu finden. Auch in Österreich laufen klinische Studien in diesem Bereich. Wir können realistischerweise davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren neue Therapien hinzukommen und zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten verfügbar sein werden.
„Besser als Dr. Google“
Was Patient:innen mit IDH-mutiertem diffusen Gliom beschäftigt und wo sie zufriedenstellende Antworten auf ihre Fragen bekommen, erklärt die Onkologin Assoc. Prof.in Priv.-Doz.in DDr.in Anna Bergmeister-Berghoff im Interview.

Wie können Patient:innen mit einem IDH mutiertem diffusen Gliom kompetent umgehen?
Die Angst, dass der Tumor wieder kommt oder wächst, belastet die Patient:innen in sehr unterschiedlichem Ausmaß, da der Umgang individuell sehr unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die sich mit der Erkrankung beschäftigen und sie zu einem Teil ihres Lebens machen. Es gibt aber auch Patient:innen, die versuchen, die Erkrankung zu verdrängen und Termine auch mal aufschieben oder auslassen. Ich bleibe mit meinen Patient:innen im Gespräch und versuche so ihre individuelle Situation best möglich zu unterstützen.
Welche Au lärung und Unterstützung benötigen Patient:innen und Angehörige in Bezug auf das Symptom Epilepsie? Der Tumor verändert die Struktur des Gehirns, was eine sogenannte strukturelle Epilepsie verursacht. Viele Patient:innen mit IDH-mutiertem diffusen Gliom hatten zum Zeitpunkt der Diagnose schon einmal einen epileptischen Anfall. Darum ist eine frühzeitige neurologische Betreuung so wichtig. Auf diesem Weg erhalten Patient:innen eine effektive anti-epileptische Medikation. Das hilft, den Anfällen sowie den Ängsten davor – in Kombination mit fachlich fundierten Informationen – vorzubeugen. Es ist wichtig, Patient:innen und deren Umfeld für das richtig Verhalten bei einem Anfall zu sensibilisieren
und auch Angehörigen die Angst davor zu nehmen. Viele Patient:innen sind fast ihr ganzes Leben lang auf eine anti-epileptische Therapie angewiesen. Nur in engem Austausch zwischen Patient:in und Neurolog:in kann eine effektive und nebenwirkungsarme Therapie sichergestellt werden.
Wie gut sind Betroffene aktuell versorgt? Die Neuro-Onkologischen Zentren in Österreich bieten eine erstklassige medizinische Versorgung. Die Zentren sind eng miteinander vernetzt durch ihre gemeinsame Arbeit an klinischen Studien. Im Bereich der sozialen Beratung und Sicherung der Betroffenen gibt es aber noch Raum für Verbesserung. Man muss bedenken: Nicht alle Menschen, die an einem IHD-mutierten diffusen Gliom erkrankt sind, sind in der Lage, Vollzeit zu arbeiten. Das kann es schwierig machen, den Lebensunterhalt zu bestreiten.
An wen können sich Patient:innen und Angehörige bei Fragen wenden?
Ich sage meinen Patient:innen aber immer mit einem Schmunzeln: ‚Ich bin besser als Dr. Google und auch als ChatGPT. ‘ Viele der Informationen im Internet sind im falschen Kontext oder einfach veraltet: Bei der Diagnose von Gliomen hat sich im letzten Jahrzehnt vieles verändert und es gibt kein entsprechendes UpDate der Informationen auf zahlreichen Internet Seiten und Foren. Andere Informationen sind schlicht falsch.
Erste Anlaufstelle sollten daher immer die behandelnden Ärzt:innen, oder, wenn eine Zweitmeinung erwünscht ist, andere Spezialist:innen sein. Es ist unsere Aufgabe, aktuelle Informationen für die Patient:innen entsprechend aufzubereiten.
Was würden Sie Betroffenen mit auf den Weg geben? Selbst wenn man eine längere Anfahrts- oder Wartezeit in Kauf nehmen muss: Die Behandlung in einem spezialisierten Zentrum lohnt sich. Es ist eine seltene Diagnose. Darum ist es wichtig, von Ärzt:innen behandelt zu werden, die Erfahrung auf diesem Gebiet mitbringen. Ich würde Betroffenen auch raten, alles, was ihnen durch den Kopf geht, aufzuschreiben und mit den behandelnden Ärzt:innen zu besprechen. Bleiben diese wichtige Fragen unausgesprochen/ unbeantwortet, werden sie irgendwann zur Belastung.
BETROFFENER & ANGEHÖRIGE
Text Doreen Brumme

Florian (39) erhielt 2015 die Diagnose „diffuses Gliom“. Im Interview erzählen er und seine Partnerin Cathy, wie der Hirntumor entdeckt wurde und behandelt wird – und wie die beiden als Paar die Situation bewältigen.
Florian, wie kam es zu Ihrer Diagnose „diffuses Gliom“?
Ich bin jemand, der auf seinen Körper hört. Mir fallen deshalb schon kleine Veränderungen auf – dann suche ich nach rationalen Erklärungen dafür. Im Jahr 2014 bemerkte ich immer mal wieder einen leichten Schwindel, als hätte ich einen ‚Damenspitz‘. Das Gefühl war mir neu, ich konnte es nicht einordnen. Doch es störte mich zunehmend. Also schaute ich zuerst im Internet nach und fand zu Schwindel ein breites Spektrum möglicher Ursachen. Ich suchte deshalb meinen Hausarzt und Fachärzt:innen für HNO, Kardiologie, Urologie und Innere Medizin auf – und erhielt immer dieselbe Antwort: ‚Nein, da ist nichts.‘ Jede:r
Mediziner:in schickte mich mit einem Hinweis weiter, was ich noch checken lassen könnte. Viele vermuteten psychologische Ursachen, die sie auch dem Stress zuschrieben. Ich stand schließlich kurz vor meinem Examen. Doch damit gab ich mich nicht zufrieden. Ich hörte auf mein Bauchgefühl und ließ nicht locker. Der Internist empfahl mir schließlich, eine MRT vom Kopf und Hals machen zu lassen – es könnte an der Halswirbelsäule liegen. Auf den Schnittbildern war ein weißer Fleck zu sehen, der mir sehr groß vorkam.
Was dachten Sie im Moment der Diagnose „Hirntumor“?
Der Begriff fiel – doch ich konnte das alles noch gar nicht fassen. Ich fühlte mich extrem hilflos. Ich fragte mich: ‚Muss ich jetzt sterben?‘ und ‚Wie lange habe ich wohl noch?‘ Dann ging ich zurück zur Arbeit.
Welche Erklärungen zum diffusen Gliom bekamen Sie? Wie haben Sie die Erkrankung selbst verstanden?
Die Erklärungen fielen knapp aus und waren sehr sachlich. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, machte ich einen Termin im Krankenhaus: Ich hatte viele Fragen und brauchte Antworten. Ich hoffte, damit wieder die Kontrolle zurückzubekommen. Doch auch nach
Neurochirurg:innen mein Gehirn während der OP mit Stromstößen stimulieren wollten, um zu schauen, wie ich unter dieser Behandlung bestimmte Aufgaben löse. Denn mein Tumor grenzte direkt an das Sprach- und Bewegungszentrum. Das Risiko, durch die OP etwas zu beschädigen, war sehr hoch. Ich hatte fürchterliche Angst, zitterte am ganzen Körper und fragte mich: ‚Werde ich die Operation unbeschadet überstehen?‘.
Vor der OP hatte mich mein Arzt gefragt: ‚Wie weit sollen wir gehen?‘ Ohne zu zögern hatte ich ihm geantwortet: ‚So weit, dass ich noch leben und arbeiten kann.‘ Ich wollte nicht in Hilflosigkeit landen und fühlte mich wie im falschen Film. Ich wurde narkotisiert, damit der Schädel geöffnet werden konnte. Dann weckte man mich wieder. Ich erinnere mich daran, dass ich meinen Kopf nicht bewegen konnte (sogenannte Dreipunktfixierung mit Überdruck).
Ich hörte hinter mir die Stimme des Hirnchirurgen: ‚Er hat einen epileptischen Anfall …‘ –und vor mir die Stimmen der Neurolog:innen. Ich fragte mich, wer einen Anfall hätte?!
Nach der OP hieß es, sie sei schwierig gewesen. Man habe den Tumor – so gut es geht – entfernt. Es handelte sich um ein diffuses Gliom Grad 2, was man erst nach der Biopsie nach weiteren ca. 10 Tagen erfuhr. Das ist ein gutartiges Geschwür, das jedoch dazu neigt, immer wieder aufzutreten – und sich in ein bösartiges wandeln kann.
Nach der OP hatte ich kurz ein Problem mit meiner Zunge, das gab sich aber rasch wieder. Ich lebte mein Leben weiter und machte meinen Abschluss. Es folgten erst halb- und dann ganzjährliche Kontrollen. Im Frühjahr 2024 zeigte die MRT eine Auff älligkeit; die Ärzt:innen wollten sich das im Herbst 2024 noch einmal genauer ansehen. Meine Eltern und Cathi begleiteten mich zu dem Termin.
Cathy, was ging in Ihnen vor, als sie erfuhren, dass Florian einen Tumor hatte?
Ich hatte Florian kurz vor einem der jährlichen Kontrolltermine kennengelernt. Seine Narbe hatte ich zuerst gar nicht gesehen, da er zu dem Zeitpunkt die Haare noch länger trug. Jedenfalls beschäftigte dieser Termin Florian umso mehr, je näher er rückte. Er erzählte mir offen von seiner Diagnose. Ich hatte noch nie von einem diffusen Gliom gehört und recherchierte erstmal im Internet. Was ich dort las – von bis – änderte nichts daran, wie ich zu Florian stand – und stehe.
Was kam beim Termin im Herbst 2024 heraus?
F: Eine zweite OP wurde für Februar 2025 angesetzt. Um mich abzulenken, arbeitete ich bis kurz vor dem Termin. Meine Angst wuchs: ‚Wie wird es sein, wenn ich wieder aufwache?‘ Diese Frage ließ mich nicht mehr los.
C: Ich hatte großes Vertrauen in die Ärzt:innen. Und das nahm ich mit in unsere Kommunikation.
Wie gingen Sie beide mit Ihren Sorgen und Ängsten um?
plagten auch Verlustängste: ‚Werde ich anders aussehen nach der OP?‘, ‚Wird mein Gesicht entstellt sein?‘ und vor allem ‚Wird Cathy mich immer noch lieben?‘. Natürlich war das eine sehr belastende Situation aber wir haben beide versucht, bestmöglich damit umzugehen und objektiv zu bleiben.
C: Das Thema ist immer mit im Raum. Es kommt ja auch immer wieder hoch, allein schon wegen der ganzen ärztlichen Termine.
Wie war die Operation im Februar?
Diesmal blieb ich in Dauernarkose. Man machte eine intraoperative MRT. Unter der Elektrostimulation hatte ich wieder epileptische Anfälle. Nach der OP zeigte meine rechte Gesichtshälfte noch leichte Schlaganfallsymptome, die sich aber durch intensive Logotherapie legten. Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand waren anfangs taub, heute ist es nur noch die Kuppe des Zeigefingers, die an die OP erinnert. Ich fühle mich energieloser als früher, habe wiederkehrende starke Kopfschmerzen und bin nachwievor in Psychotherapie und Ergotherapie.
Zur raschen Bewältigung der OP trug mit Sicherheit bei, dass ich auf eigene Faust organisiert hatte, nach dem Eingriff direkt von der Intensivstation auf die neurologische Station verlegt zu werden. Dort ging das tägliche Programm mit Ergo-, Logo- und Physiotherapie sofort nach der OP nahtlos weiter.
Wie gehen Sie mit der Unsicherheit um, dass sich Ihr Gliom verändern kann? Zwischen meiner ersten und zweiten OP hatte ich zehn Jahre gute Lebenszeit. Diese Erfahrung werfe ich in die Waagschale, um meine Ängste und Sorgen aufzuwiegen. Das gelingt nicht immer. Bei der Nachkontrolle war die MRT auff ällig. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen – und ich bin auch derzeit noch schwer damit beschäftigt, wieder in die Spur zu kommen.
Was half und hilft Ihnen im Alltag, um mit dieser Belastung klarzukommen?
Ich habe ein interdisziplinäres Ärzt:innenteam an meiner Seite. Sie alle haben ein offenes Ohr für mich, ich bekomme immer eine Antwort. Angesichts meiner jüngsten MRT ist sich selbst das Tumorbord nicht einig gewesen: Die Radiologie wollte bestrahlen, die Onkologie ein Medikament verabreichen, die Neurologie operieren. Es bleibt abzuwarten, wie es weiter geht.
Ich stehe jeden Tag mit dem Wunsch auf, noch möglichst lange zu leben – mit Cathy, sie ist das Beste, was mir passieren konnte. Und alles, was diesem Wunsch im Wege stehen könnte, versuche ich bestmöglich zu bewältigen.
Unsere ganze Familie ist stets unterstützend an meiner Seite. Ich bin nicht allein, was auch immer kommt.
Was möchten Sie anderen Betroffenen und Angehörigen mitgeben, die gerade erst mit einer solchen Situation konfrontiert wurden?
diesem Termin stand ich wieder auf der Straße und wusste nicht, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. Erst ein Blick in meinen Kopf würde das klären können. Ich war sehr aufgeregt. Meine Eltern waren im Urlaub, meine Fernbeziehung weit weg. Mir war zum Heulen zumute – was ich auch tat.
Wie wurden Sie damals behandelt? Im Sommer 2015 wurde ich operiert. Eine Wach-Operation stand an, weil die
C: Wir haben immer offen darüber geredet. Einmal ausgesprochen, fragten wir uns: ‚Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?‘ Es ist wichtig, in so einer Situation genau hinzuhören, was beide sagen, und zu beobachten, wie beide sich geben. In den Momenten, in denen uns der Druck zu groß wird , geben wir den Gefühlen den nötigen Raum. Erst dann können wir wieder klar denken und sprechen.
F: Wir sprachen ehrlich miteinander und machten uns nichts vor. Die rosarote Brille setzten wir gar nicht erst auf. Ein ‚Es wird alles gut‘ hätte mir in diesen Momenten einfach nicht geholfen. Das Risiko, dass bei der OP Schäden bleiben würden, war immens. Mich
C: Hören Sie einander gut zu. Wichtig ist, dass jede:r sich bemüht, die Perspektive des Gegenübers mitzudenken und mitzufühlen, um wirklich zu verstehen, was gerade los ist. Und dann gilt es, für die Person da zu sein.
F: Es ist, wie es ist – das anzunehmen, ist schwer, aber unerlässlich. Man kann als Betroffene:r aber auch nicht den ganzen emotionalen Ballast bei den Liebsten abladen. Es hilft, eine psychoonkologische Begleitung zu haben. Am allerwichtigsten ist es, auf den eigenen Körper zu hören und nicht nachzulassen, wenn Sie sich Antworten wünschen. Seien Sie beharrlich – es geht schließlich um Ihr Leben!
Von Atemwegserkrankungen sprechen Mediziner:innen, wenn Atmungsorgane und obere sowie untere Atemwege krank sind. Meist handelt es sich dabei um Entzündungen im sogenannten Nasen-Rachen-Raum sowie in den Nasennebenhöhlen, der Luftröhre, den Bronchien und der Lunge. Von Viren oder Bakterien ausgelöste Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Schnupfen, Bronchitis, Rachenund Mandelentzündung sind akut. Ihr Verlauf ist eher mild und nach ein bis zwei Wochen sind sie in der Regel ausgeheilt. Heilt eine akute Atemwegserkrankung nicht vollständig aus, wird sie chronisch. Die Genesung dauert meist sehr lange – und im schlimmsten Fall bleibt die chronische Erkrankung als ständige Begleiterin. Typisch
für chronische Atemwegserkrankungen sind Gewebeschäden und eine beschränkte Funktionalität. Erkrankungen, bei denen die Atemwege verengt oder gar verschlossen sind, sodass der Luftstrom behindert wird, werden obstruktiv genannt. Zu diesen gehören die Schlafapnoe, bei der das Einatmen gestört ist, und die Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), eine fortschreitende Erkrankung der Lunge.
Schlafapnoe und COPD Mehr als 500.000 Österreicher:innen leiden an Schlafapnoe1, 400.000 bis 800.000 an COPD2, womit beide als Volkskrankheiten gelten. Sie können die Lebensqualität spürbar beeinträchtigen und erfordern spezifische Behandlungen wie Sauerstofftherapien.

„Schnarcherkrankheit “ Bei der Schlafapnoe kommt es zu wiederholten Atemstillständen und damit Sauerstoffengpässen, weil sich im Schlaf die Rachenmuskeln entspannen und die Atemwege dicht machen. Jedes Mal schlägt der Körper Alarm und unterbricht den Schlaf, damit die Atmung wieder einsetzt. Das Ganze geht einher mit lautem Schnarchen, häufig auch Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Risikofaktoren sind Übergewicht, Alter, Geschlecht (Männer sind häufiger betroffen als Frauen), Nikotin- und Alkoholkonsum sowie familiäre Veranlagung.
„Raucherlunge“ Bei der unumkehrbaren COPD sind die Atemwege andauernd verengt. Sie zeigt sich entweder als chronische Bronchitis mit anhaltendem Husten („Raucherhusten“) und Schleimbildung oder als Lungenemphysem, bei dem die Lungenbläschen Schaden nehmen, was den Sauerstoffaustausch massiv erschwert. Hauptursache der sich einschleichenden COPD ist das Rauchen – doch auch Personen, die über einen längeren Zeitraum Luftschadstoffen ausgesetzt sind, die die genetische Veranlagung haben oder die 40 Jahre und älter sind, können daran erkranken.
Sauerstoffmangel und die Folgen Treten beide Erkrankungen gleichzeitig auf, kommt es nachts zu einer kritischen Sauerstoffunterversorgung, die insbesondere das Risiko für Herz-Kreislauf-erkrankungen erhöht. Unter nächtlichen Atemaussetzern und andauerndem Aushusten von Schleim leiden neben dem Schlaf in weiterer Folge auch Körper, Geist und Seele. Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Depressionen sowie lebensgefährdende Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall sind häufig.
1 Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), https://www.ots.at/ presseaussendung/OTS_20250313_OTS0084/weltschlaftag-14-maerz-mehr-als500000-menschen-in-oesterreich-leiden-an-schlafapnoe 2 Österreichische Lungenunion, https://www.lungenunion.at/factsheet-volkskrankheitcopd
Gehirn: Schlafstörungen, Schlafmangel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, erhöhtes Risiko für Schlaganfall (Hirnschlag), Depressionen und Gereiztheit Herz: erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Polyglobulie, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz und Herzinfarkt
Haut: Blässe, bläuliche Verfärbung

Lunge: Lungenhochdruck, Kurzatmigkeit, Atemnot (Belastungsdyspnoe)
Muskeln: weniger Belastbarkeit, rasche Erschöpfung

Prim. Univ-Prof. Dr. Bernd Lamprecht Lungenfacharzt und Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie
Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht von der Johannes-Kepler-Universität Linz erklärt im Interview die Funktion und die Patient:innen-Zielgruppe einer Sauerstofftherapie. Damit liefert der Pneumologe fundierte Fakten und wirkt so der Stigmatisierung von Menschen mit Sauerstoff im Gepäck entgegen.
Was ist eine Sauerstofftherapie und wer braucht sie?
Luft hat einen Sauerstoffgehalt von 21 Prozent. Der genügt gesunden Menschen, um ihren Körper mit dem lebenswichtigen Element zu versorgen. Betroffene bestimmter Erkrankungen kommen mit dieser Sauerstoffmenge jedoch nicht aus, da ihre Lungen zu wenig davon ins Blut übergeben. Ihnen stellen wir mit der Sauerstofftherapie eine erhöhte Konzentration an Sauerstoff in der Einatemluft zur Verfügung.
Wie wird das technisch gelöst?
Das funktioniert über eine Nasenbrille – mit zwei dünnen Schläuchen, die, einer rechts, einer links, von den Ohren gehalten werden und in die Nase münden. Sie sind mit einer Sauerstoffquelle verbunden, entweder mit einem Konzentrator, der Umgebungsluft ansaugt, ihr Sauerstoff entzieht und diesen konzentriert in die Nase führt. Oder es handelt sich um einen Druckbehälter mit Flüssigsauerstoff, der dekomprimiert wird und als Gas zur Nase strömt.
Welche Technik ist besser?
Jede hat Vor- und Nachteile: Der Konzentrator läuft nur mit Strom aus Steckdose oder Akku. Einen Akku muss man regelmäßig aufladen. Auch ein Sauerstofftank muss regelmäßig gefüllt werden, ist jedoch unabhängig von Strom. Beide Lösungen erfordern eine sorgfältige Vorausschau auf jeden Weg, der gemacht werden soll.
Wie lange müssen Betroffene therapiert werden?
Das hängt vom individuellen Bedarf ab: Chronisch Kranke brauchen dauerhaft mehr Sauerstoff. Sie bekommen eine Langzeittherapie und sollten täglich mindestens 16 Stunden, wenn nicht sogar rund um die Uhr ihre Nasenbrille benutzen. Andere Patient:innen benötigen keine extra Portion Sauerstoff, wenn ihr Körper ruht, sondern nur bei alltäglicher Bewegung. Wieder andere brauchen ihn nur im Schlaf oder nur bei intensiver Belastung. Wie wirkt sich ein Sauerstoffmangel aus? Er fehlt jeder Zelle zum lebensnotwendigen Stoffwechsel. Muskeln schwächeln und schmerzen. Die Patient:innen sind müde und nur eingeschränkt belastbar – körperlich wie geistig.
Wie kommt es, dass Nasenbrillen-Träger:innen häufig stigmatisiert werden? Die Sauersto rille ist eine ‚Krücke‘ für die kranke Lunge, wie die Brille für das kranke Auge und das Hörgerät für das kranke Ohr. Viele glauben in diesem Zusammenhang, dass eine kranke Lunge nur vom Rauchen herrührt, also selbstverschuldet sei. Das ist ein Fehlurteil, denn auch eine Schadsto elastung oder Durchblutungsstörung können dahinterstecken. Die Vorurteile veranlassen Betroffene oft dazu, soziale Begegnungen zu meiden und sich zu verstecken. Ihre Psyche leidet darunter ebenso wie ihre Lebensqualität.
SECHS GRÜNDE FÜR EINE SAUERSTOFFTHERAPIE
Mehr Sauerstoff dank Sauerstofftherapie heißt:
• verbesserter Stoffwechsel
• weniger Muskelschmerzen
• höhere geistige und körperliche Belastbarkeit
• soziale Teilhabe
• höhere Lebensqualität
• höhere Lebenserwartung.
SAUERSTOFF


















BEATMUNG
SEKRETOLYSE & INHALATION
HUSTENASSISTENZ
SCHLAFTHERAPIE/ CPAP

Assoz. Prof. in Dipl.-Ing. in Lena Tschiderer, PhD Institut für klinische Epidemiologie, Public Health, Gesundheitsökonomie, Medizinische Statistik und Informatik, Medizinische Universität Innsbruck
FOTO: ZVG
Warum Frauen besonders auf ihre Herzgesundheit achten sollten, wenn sie in die Wechseljahre kommen, erklärt Assoz. Prof.in Dipl.-Ing.in Lena Tschiderer, PhD, vom Institut für klinische Epidemiologie, Public Health, Gesundheitsökonomie, Medizinische Statistik und Informatik der Medizinischen Universität Innsbruck.
Was sind Herz-Kreislauferkrankungen –und warum müssen wir darüber sprechen?
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, also von Herz und Blutgefäßen, sind weltweit die Haupttodesursache. In Österreich starben im Jahr 2024 30.386 Menschen daran. Alle HerzKreislauferkrankungen gemeinsam trugen mit 34,3 Prozent zum größten Anteil aller Sterbefälle bei.1
Welche Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen gibt es? Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren –darunter viele, die jede:r selbst beeinflussen kann, beispielsweise ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen und Übergewicht (Adipositas). Faktoren wie Diabetes mellitus (Zuckererkrankung) oder dauerhafter Bluthochdruck lassen sich medikamentös behandeln, um das daraus resultierende Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen zu senken.
Warum sind Herz-Kreislauferkrankungen gerade für Frauen ein wichtiges Thema? Herz-Kreislauferkrankungen sind sowohl für Frauen als auch für Männer die Haupttodesursache weltweit: Im Jahr 2024 waren 16.311 der an einer Herz-Kreislauferkrankung Verstorbenen in Österreich weiblich und 14.075 männlich.1 Interessant ist, dass Frauen etwa zehn Lebensjahre später als Männer an Herz-Kreislauferkrankungen erkranken – das Risiko steigt im fünften Lebensjahrzehnt deutlich an. Das ist die Zeit, in der Frauen in die Menopause kommen. Ganz wichtig: In den Wechseljahren finden auch viele andere Veränderungen im Körper statt. Frauen erleben beispielsweise vermehrt Schlafstörungen oder Veränderungen in Blutzuckeroder Cholesterinspiegeln, welche wiederum mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen einhergehen.
Warum sind erhöhte Cholesterinwerte gefährlich und wie hängen sie mit dem Risiko für Herzinfarkt und Co. zusammen?
Das Cholesterin ist ein wichtiger Baustoff der Zellmembran, also der Schicht, die jede Zelle
des Körpers umgibt und wichtig für den Stoffaustausch ist. Aber: Ein Zuviel an Cholesterin im Blut und in den Wänden der Blutgefäße führt zu Arteriosklerose. So nennt man Gefäßverkalkungen, die häufig auch die Ursache für Herzinfarkte oder Schlaganfälle sind. Wichtig zu wissen ist, dass das im Blut gemessene Cholesterin (Gesamtcholesterin) unteranderem in Low Density Lipoprotein (LDL) und High Density Lipoprotein (HDL) unterschieden wird, wobei das LDL-Cholesterin die Rolle des ‚Bösewichts‘ für das Entstehen von Gefäßerkrankungen innehat: Wir wissen, dass LDL-Cholesterin Gefäßverkalkungen verursacht und das Fortschreiten von Ablagerungen in den Gefäßen (Plaques) begünstigt. Es gilt: Je mehr LDL-Cholesterin im Blut ist, desto höher sind das Herzinfarktrisiko und die Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauferkrankungen.
Wie beeinflussen die Wechseljahre den Cholesterinspiegel? Es gibt unterschiedliche Phasen der Menopause: Die Prämenopause, die Perimenopase und die Postmenopause. In der Perimenopause beginnen unterschiedlichste Symptome der Wechseljahre und auch der Menstruationszyklus verändert sich. Studien haben gezeigt, dass speziell in dieser Phase ein signifikanter Anstieg von LDL-Cholesterin stattfindet. Dieser Anstieg flacht in der Postmenopase, also der Zeit nach der Menopause, wieder ab. Diese Veränderungen könnten eine zentrale Rolle für ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkankungen nach der Menopause spielen.
Warum wird das Herzinfarktrisiko bei Frauen in und nach den Wechseljahren oft unterschätzt – von der Medizin, aber auch von den Frauen selbst?
Der Herzinfarkt wird bis heute häufig als typische ‚Männerkrankheit‘ betrachtet. Da die Medizin Frauen viele Jahre lang vernachlässigt hat, sind die Anzeichen für einen Herzinfarkt bei Männern viel besser erforscht als bei Frauen. Das gilt ebenso für die Forschung zur
1,2 www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/gestorbene/todesursachen
3 www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/lifes-essential-8
4 doi.org/10.1186/s13063-022-07004-2
5 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066132













Wirksamkeit von Medikamenten. Frauen tauchen nur zu 22 Prozent in Studien auf4, gleichwohl sie mehr als 40 Prozent aller Herzinfarkte erleiden. Umso wichtiger ist es, dass sowohl Frauen selbst, als auch Mediziner:innen den typisch weiblichen Verlauf eines Herzinfarktes kennen, um ihn frühzeitig erkennen und richtig behandeln zu können.
Was kann getan werden, um das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen zu senken?
Die American Heart Association3 hat acht Maßnahmen zum Verbessern und Erhalten der Herz-Kreislaufgesundheit definiert:
1. Kein Rauchen
2. Gesundes Essen
3. Gesunder Schlaf
4. Ausreichend Bewegung
5. Normalgewicht
6. Cholesterinkontrolle
7. Blutzuckerkontrolle
8. Blutdruckkontrolle
Derzeit wird diskutiert, mentale Gesundheit5 als neunte Maßnahme in die Liste aufzunehmen.
Zu den Warnzeichen zählen unter anderem:
• Brustschmerz, der in Körper ausstrahlen kann
• Kurzatmigkeit
• Unwohlsein in Armen, Rücken, Schultern, Nacken oder Kiefer
Frauen haben häufig zusätzliche Symptome, die weniger bekannt sind, wie:
• Angstgefühl
• Übelkeit
• Erbrechen
• unerklärliche Müdigkeit und Schwäche.










































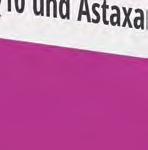


























Jeder 100. Mensch lebt mit einer chronisch kranken Leber. Im Interview klärt
Univ.-Prof.in M.D. Vanessa Stadlbauer-Köllner, Professorin für Translationale Mikrobiomforschung und Hepatologie, über chronische Lebererkrankungen auf.

Univ.-Prof.in M.D.
Vanessa StadlbauerKöllner Translationale Mikrobiomforschung und Hepatologie, MedUni Graz

Denise Schäfer, BSc Gründerin, Vorständin Liver Care Nurse Österreich, Pfl egeexpertin für Lebererkrankungen
Text
Was sind chronische Lebererkrankungen?
Zu den chronischen Lebererkrankungen gehören die alkoholbedingte Fettleber und die metabolisch assoziierte Lebererkrankung (MASLD, veraltet „Fettleber“), bei denen die Leber zu viel Fett einlagert. Mit fortschreitendem Verlauf kann sich die Leber entzünden (Hepatitis), verhärten (Fibrose) und vernarben (Zirrhose). Die Leberzirrhose kann Komplikationen verursachen, die tödlich sind.
Warum werden viele Lebererkrankungen erst spät erkannt?
Eine kranke Leber schmerzt nicht – sie leidet still. Deshalb führen bei zwei Dritteln der Zirrhose-Patient:innen erst Komplikationen zur Diagnose. Bei Frauen wird eine Lebererkrankung zudem häufig später diagnostiziert als bei Männern.
Wie zeigt sich eine Lebererkrankung?
Erste Anzeichen können sein: Müdigkeit, häufig infolge einer Tag-Nacht-Umkehr, Unsicherheit im Straßenverkehr oder Vergesslichkeit im Berufsleben. Eine Leberzirrhose kann sich auch mit einer „Gelbsucht“ zeigen; oder mit Bluterbrechen, weil sich Blut in der Pfortader staut und das zu Krampfadern in der Speiseröhre führt, die reißen können. Auch ein „Wasserbauch“ ist ein erstes Anzeichen einer Zirrhose: Dabei staut sich Bauchwasser (Aszites) im Bauchraum.
Was kann passieren, wenn eine chronische Lebererkrankung lange unbehandelt bleibt?
Das kann für Muskelschwund sorgen, sodass Betroffene nach und nach ihre Mobilität und damit ihre Unabhängigkeit verlieren. Die chronische Lebererkrankung kann unbehandelt
auch Nieren und Lunge in Mitleidenschaft ziehen, sodass diese Organe versagen. Versagt der Stoffwechsel der kranken Leber kommt es zur Anhäufung von Ammoniak, das ins Hirn gelangen kann, sodass eine Entzündung und Schwellung entsteht (hepatische Enzephalopathie). Dies zeigt sich durch Symptome wie Verwirrtheit oder Denkstörungen bis hin zum Leberkoma.
Wie ist die Früherkennung von Lebererkrankungen möglich – zu welchen Untersuchungen raten Sie?
Da sich die Lebererkrankung anfangs oft unbemerkt einschleicht, sind die Bluttests (Blutzucker, Blutfette und der Leberwert Gamma-GT) im Rahmen der jährlichen Gesundenuntersuchung äußerst wichtig. Erhöte Werte müssen weiter abgeklärt werden. Sie führen zur Früherkennung und damit zur frühzeitigen Behandlung. Impfungen schützen außerdem vor Infektionen.
Was bringt ein gesunder Lebensstil bei einer chronischen Lebererkrankung?
Die Leber ist das wichtigste Stoffwechsel- und Immunorgan. Chronische Lebererkrankungen können durch Stoffwechselerkrankungen (Diabetes) und einen ungesunden Lebenstils bzw (Alkohol, Rauchen zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, Übergewicht) bedingt sein. Auch chronische Viruserkrankungen (Hepatitis B und C), Autoimmunerkrankungen oder erbliche Erkrankungen schädigen die Leber. Bewegung, gesunde Ernährung und der Verzicht auf Alkohol und Rauchen können das Risiko reduzieren, zu erkranken, und den Fortschritt der Erkrankung zumindest bremsen.
WORAN ERKENNEN SIE EINE CHRONISCHE LEBERERKRANKUNG?
Chronische Lebererkrankungen entwickeln sich oft schleichend und bleiben lange unbemerkt. Erste Anzeichen sind meist unspezifisch:
• Müdigkeit und Erschöpfung
• Konzentrationsprobleme (häufig im Straßenverkehr)
• Vergesslichkeit
• Übelkeit, Appetitlosigkeit oder Völlegefühl
• Juckreiz
• Gelbliche Augen (frühe Form der Gelbsucht)
• Dunkler Urin, heller Stuhl
In fortgeschrittenen Stadien können weitere Symptome auftreten:
• Deutliche Gelbsucht (Haut und Augen)
• Flüssigkeitsansammlung im Bauch („Wasserbauch“, Aszites)
• Schwellungen an den Beinen (Ödeme)
• Blutiges Erbrechen
• Blutungsneigung oder blaue Flecken
• Verwirrtheit oder Bewusstseinsstörungen (Hinweis auf LeberEnzephalopathie)
• Leberkoma
Tipp: Wer zu einer Risikogruppe gehört, etwa bei Diabetes, starkem Übergewicht oder regelmäßigem Alkoholkonsum, sollte die Leber regelmäßig checken lassen. Ein Bluttest und Ultraschall können erste Hinweise liefern. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt des Vertrauens darüber.
leberundmehr.at
Sie sind nicht Ihre Erkrankung!
Die Pflegeexpertin für Lebererkrankungen BSC („LiverNurse“) Denise Schäfer erklärt, wie sie und ihr interdisziplinäres Team Leberkranke betreuen und worauf es ankommt, um Diagnose, Behandlung und das Leben mit einer kranken Leber zu bewältigen.
Wie erleben Ihre Patient:innen die Diagnose „kranke Leber“? Wie begleiten Sie sie dabei? Gerade bei denjenigen, deren Leber infolge von Alkoholkonsum erkrank ist, herrscht meist großes Unverständnis. Da folgt auf den ersten Schock schnell ein Verdrängen: ‚Ich habe doch kaum oder gar nichts getrunken…‘ Es ist dann meine Aufgabe, über die Erkrankung im Allgemeinen und nach der gründlichen Anamnese ebenso über den individuellen Verlauf aufzuklären sowie für eine gewisse Krankheitseinsicht zu sorgen. Viele Patient:innen mit einer Lebererkrankung, an der nicht der Alkohol schuld ist, haben neben der Angst vor den Krankheitsfolgen auch Angst vor Stigmatisierung. Das gesellschaftlich verbreitete Krankheitsbild „Leberschäden“ ist doch sehr einseitig auf Alkohol fokussiert. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im Leben mit einer chronischen Lebererkrankung? Welche Strategien helfen im Umgang damit?
Die Krankheitseinsicht ist der Schlüssel zum Bewältigen der Erkrankung. Einsicht erlangen die Patient:innen dank einer Schulung. Gemeinsam mit meinem Team schule ich sie im alltäglichen Umgang mit der Erkrankung und in der Früherkennung von Komplikationen und Notfällen. So wissen sie von Anfang an, was ist, was auf sie zukommen kann – und dank meiner Schulungsblätter auch, wie sie im Notfall richtig reagieren können.
Die größte Herausforderung und zugleich Last für alle ist sicher die Unvorhersehbarkeit des Krankheitsverlaufs. Deshalb sorgen wir für Strukturen: Wir fragen, was die Patient:innen wollen. Wir legen ein Therapieziel und die einzelnen Schritte dorthin fest. Klappt es mit Plan A nicht, haben wir Plan B und C in der Tasche. Alle Beteiligten wissen darüber Bescheid.
Wie stark ist die psychische Belastung für Patient:innen und Angehörige und welche Rolle spielt hier Ihre Betreuung?
Die Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung belastet Betroffene und Angehörige. Waren Alkoholkonsum oder lebensstilbedingtes Übergewicht eine Ursache der Lebererkrankung plagen die Betroffenen häufig auch Schuldgefühle.
Die sich kümmernden Angehörigen geraten gerade im fortgeschrittenen Stadium leicht in Gefahr, eine mentale sowie körperliche Rollenüberlastung zu entwickeln. Hier müssen wir sie stärken, damit sie nicht auch noch krank werden. Hinzu kommt, dass Lebererkrankungen mitunter auch Wesensveränderungen mit sich bringen: Die Patient:innen werden vergesslich, gereizt, aggressiv. Auch hier brauchen Betroffene und Angehörige Unterstützung.
Was geben Sie Betroffenen und ihren Angehörigen mit auf den Weg?
1. Das Wichtigste ist: Sie sind nicht Ihre Erkrankung!
2. Informieren Sie sich gründlich, fragen Sie Ärzt:innen und Betreuer:innen, was Sie wissen wollen!
3. Bringen Sie sich aktiv in die Therapie ein: Teilen Sie sich uns offen mit – nutzen Sie Ihre Stimme!
4. Suchen Sie Austausch in Selbsthilfegruppen – als Patient:in und als Betroffene:r.
Ein Service von Merz
Chronische Lebererkrankungen gehören zu den größten Gesundheitsproblemen der Welt und können jeden treffen. Die Ursachen von Lebererkrankungen können sehr vielfältig sein. Deshalb ist es wichtig, auf mögliche Warnsignale zu achten.
Teste dich:
leberundmehr.at

Erfahre mehr über die Gesundheit deiner Leber und wie du sie schützen kannst.
Höchster Reinheitsgrad, keine unnötigen Zusatzstoffe

Erfahrung und Innovation seit über 30 Jahren
Von Experten entwickelt nach fundierten Studien
Pure Encapsulations® – Erfahrung, Expertise und geprüfte Qualität in jeder Kapsel.
Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen oder besuchen Sie PURECAPS.NET/QUALITAET
Geprüfte Qualität durch laufende Kontrollen
Über 140 Produkte für eine individuelle & gezielte Anwendung
Optimale Aufnahme im Körper