Lesen Sie mehr unter seltenekrankheit.info

„Krise

Lesen Sie mehr unter seltenekrankheit.info

„Krise
David G. L. Weiss (47) ist von systemischer Sklerose (Sklerodermie) betroffen. Jeden Tag entscheidet er sich dafür, sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen – trotz Schmerz, Juckreiz und Rückschlägen.
Seite 06
Kinder mit Hämophilie
Zwei Expertinnen geben Tipps rund um den Start in Kindergarten oder Schule sowie für sportliche Aktivitäten.
Seite 03
NMD Community Day
Vortragende der Veranstaltung sprechen über Versorgung, gesellschaftliche Teilhabe und die Wichtigkeit von Informationsaustausch.
Seite 04–05
Kälteagglutininkrankheit Mastozytose Hereditäres Angioödem Epidermolysis bullosa
VERANTWORTLICH FÜR DEN
INHALT DIESER AUSGABE:

Kerstin Boder Industry Manager Health Mediaplanet GmbH
IN DIESER AUSGABE

Mastozytose
Neue Wirkstoffe und die MASTHAVE®-App eröffnen bessere Behandlungsmöglichkeiten. Prof.in Sabine Altrichter, Dermatologin und Venerologin, gibt Einblick in aktuelle Therapien.

Hautdiagnostik
KI-gestützte Smartphone-App Scarletred®Vision ermöglicht objektives Hautmonitoring für Patient:innen mit Epidermolysis bullosa. CEO und Gründer Harald Schnidar berichtet über die medizinische Innovation.
Industry Manager Health: Kerstin Boder Layout: Juraj Príkopa Lektorat: Joseph Lammertz Managing Director: Bob Roemké Fotocredits: Außer anders angegeben bei Shutterstock Medieninhaber: Mediaplanet GmbH • Bösendorferstraße 4/23 • 1010 Wien • ATU 64759844 • FN 322799f FG Wien
Impressum: mediaplanet.com/at/impressum Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co. KG Distribution: Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Kontakt bei Mediaplanet: +43 676 847 785 115 E-Mail: kerstin.boder@mediaplanet.com ET: 19.09.2025
VORWORT
Richtig handeln bei möglichen Zeichen für eine seltene Erkrankung
Eine seltene Erkrankung (SE) bedeutet für betroffene Personen oft einen langen und beschwerlichen Weg bis zur richtigen Diagnose und Therapie. Von einer seltenen Erkrankung spricht man der europäischen Definition folgend, wenn weniger als eine von 2.000 Personen das spezifische Krankheitsbild aufweist. Rund fünf Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen – in Österreich sind das vermutlich rund 450.000 Menschen.

Mag. Ella Rosenberger Geschäftsführung Pro Rare Austria

Eine Diagnose unklarer Symptome ist wichtig, um eine passende Therapie zu finden und die Situation von betroffenen Menschen zu verbessern. Seltene Erkrankungen können sich neben den gesundheitlichen Beschwerden und Risiken auf alle Bereiche des Alltags und des gesellschaftlichen Lebens auswirken und auch große psychische Herausforderungen darstellen. Die geringe Häufigkeit der Erkrankungen führt dazu, dass medizinisches Fachwissen, Versorgungsangebot und auch Forschung begrenzt sind. Durchschnittlich dauert es daher mehr als fünf Jahre bis zur richtigen Diagnose.
• Es gibt mehr als 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen.
• Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie weniger als eine Person von 2.000 betrifft.
• Selten und doch viele – rund 450.000 Menschen in Österreich (rund 5 %) sind von einer seltenen Erkrankung betroffen.
Wen kontaktiert man bei unerklärlichen, chronischen Symptomen?
Pro Rare Austria – „Helpline SE“
Pro Rare Austria – Allianz für seltene Erkrankungen ist die einzige Organisation in Österreich, die als Anlaufstelle und Informationsquelle für Menschen mit seltenen Erkrankungen, deren Angehörige oder Personen auf der Suche nach einer Diagnose fungiert. Für viele Betroffene sind wir „der letzte Anker“.
Alle Anfragen werden kostenfrei bearbeitet. Unser Team bietet gerne unter anderem zu folgenden Anfragen nach Möglichkeit Vernetzung, Hilfe und Unterstützung:
• wenn der Wunsch nach Austausch mit anderen Betroffenen besteht
• bei der oft langwierigen Suche nach einer Diagnose
• bei Fragen etwa zu Sozialleistungen, Erstattung und Systempartner:innen
• um Informationen zu Versorgungskontakten (Zentren, Ärzt:innen) zu erhalten
Erhöhung des Bewusstseins und Wissens über seltene Erkrankungen
Hilfreiche Links www.prorare-austria.org
www.prorare-austria.org/ kontakte/kontakt aufnahme-betroff ene
Die erste Anlaufstelle bietet meist die Allgemeinmedizin oder eine Fachärztin beziehungsweise ein Facharzt. Als zentrale Aspekte gelten das rasche Erkennen von ungewöhnlichen Symptomen, das „Out of the Box“-Denken dieser Ärzt:innen und ihr Wissen über die spezialisierten Angebote wie zum Beispiel Expertisezentren für seltene Erkrankungen. Im Bedarfsfall sollte durch niedergelassene (Fach-)Ärzt:innen der Kontakt zu einem spezialisierten Zentrum hergestellt werden.
Expertisezentren sind zentrale, hoch spezialisierte klinische Einrichtungen für definierte Gruppen von seltenen Erkrankungen. Dort erfolgen vor allem Erstdiagnostik und Therapieeinstellung, aber auch Kontrolluntersuchungen, um Menschen mit SE eine optimale Versorgung zukommen zu lassen.
Gerade für ein vergleichsweise kleines Land wie Österreich ist die Teilhabe an internationalen Netzwerken bedeutend. Die spezialisierten Zentren für seltene Erkrankungen Österreichs sind Mitglied bei allen fachspezifischen Europäischen Referenznetzwerken (ERN) – virtuelle europaweite Befundbesprechungen unter Spezialist:innen sind dadurch möglich.
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der International Rare Disease Day, der seit 2008 jedes Jahr am letzten Tag im Februar stattfindet. Die breite Öffentlichkeit und Vertreter:innen von Politik, Industrie, Forschung und Gesundheitswesen werden mit vielen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht.
Pro Rare Austria organisiert jedes Jahr ein Vernetzungstreffen für Betroffene einer seltenen Erkrankung und all jene, die an Informationen zu seltenen Erkrankungen interessiert sind.
Bestens etabliert hat sich mittlerweile auch der Österreichische Kongress für Seltene Erkrankungen, der sowohl medizinisches Fachpublikum als auch Laien beziehungsweise Betroffene einer SE anspricht und eine übergreifende Diskussionsplattform darstellt.
Pro Rare Austria stellt eine gemeinsame Stimme für seine aktuell rund 120 Mitglieder – Patient:innenorganisationen, Selbsthilfegruppen und von einer spezifischen SE betroffene Einzelpersonen – und alle Betroffenen in Österreich dar. Die Allianz bringt deren Anliegen in die politische Arbeit sowie in die Projekte und Kooperationen des Verbands ein, um Verbesserungen für Betroffene zu erzielen. Unser Ziel ist ein gleichberechtigtes Leben in der Mitte der Gesellschaft für alle Menschen mit einer seltenen Erkrankung.

„erkältet“
Der Internist Univ.-Prof. Dr. Bernd Jilma von der MedUni Wien stellt die seltene chronische Kälteagglutininerkrankung (CAD) vor.

Kälteagglutininkrankheit – womit bekommen Betroffene es zu tun? Das ist eine Knochenmarkserkrankung, bei der sich bestimmte weiße Blutkörperchen (sogenannte B-Zellen) übermäßig vermehren und Antikörper (Immunglobuline M; IgM) bilden. Diese bewirken ein Verklumpen roter Blutkörperchen, sodass die Blutzirkulation insbesondere in den feinen Gefäßen gestört wird – und damit auch die Sauerstoffversorgung der zugehörigen Körperareale. Das Risiko für Thrombosen steigt – es drohen vermehrt Lungenembolie, Herzinfarkt und Schlaganfall. Interessanterweise ist diese Verklumpung temperaturabhängig und geschieht, wenn das Blut sich unter 37 Grad Celsius abkühlt. Außerdem werden die roten Blutkörperchen durch Aktivierung des Immunsystems sehr rasch abgebaut, vor allem in der Leber (extravaskuläre Hämolyse).
Wie zeigt sich die Erkrankung?
Wegen der Kälteabhängigkeit findet die Verklumpung der roten Blutkörperchen vor allem in „kühleren“ Körperteilen statt: Fingern, Zehen, Nase. Diese färben sich bei Kälte typischerweise blau. Betroffene berichten dann
auch von Schmerzen – übrigens auch, wenn sie Eis essen, dann tut die Zunge weh. Mit dem verstärkten Abbau der roten Blutkörperchen geraten die Betroffenen in eine „Blutarmut“. Diese Anämie bringt allgemeine körperliche sowie geistige Leistungseinbußen mit sich.
Wen trifft die Kälteagglutininerkrankung? Die Krankheit ist selten: Etwa einer von 100.000 Menschen leidet daran. Da sich die Erkrankung im Laufe des Lebens entwickelt, handelt es sich bei den Patient:innen meist um ältere Erwachsene. Das Durchschnittsalter liegt bei der Diagnose in der Regel zwischen 60 und 70 Jahren.
Wie gut sind die Aussichten für ein Leben mit der seltenen Erkrankung?
Unbehandelt kann sie schwerwiegende Folgen haben. Betroffene zeigen häufig Symptome wie starke Müdigkeit, Schwäche oder Kreislaufprobleme, die die Lebensqualität erheblich einschränken – vergleichbar mit einer Krebserkrankung. Eine frühzeitige und wirksame Behandlung ist wichtig, um Komplikationen zu verhindern und lebensbedrohlichen
Situationen vorzubeugen.
Wie behandeln Sie die Kälteagglutininerkrankung? Sie kommt entweder alleine daher oder begleitet andere Erkrankungen, zum Beispiel Lymphdrüsenkrebs. Auch Infektionen können die Kälteagglutininerkrankung pushen. Hier gilt es, die Grunderkrankung oder die Infektion zu behandeln. Die Erkrankung selbst behandeln wir mit Therapien, die das Immunsystem unterdrücken und darauf abzielen, einerseits die Aktivität der B-Zellen zu verringern und andererseits den Abbau der roten Blutkörperchen direkt zu hemmen. Dank jüngster Fortschritte stehen inzwischen neue Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich die Krankheit rascher als bisher kontrollieren lässt. Diese Therapien setzen gezielt an den Mechanismen an, die zum Abbau der roten Blutkörperchen führen, indem sie einen frühen Schritt im Komplementsystem blockieren. Damit eröffnen sie den Patient:innen eine nebenwirkungsarme Therapie.
Erkrankung

Die eigenen Kinder in die Obhut von Betreuungspersonal und Lehrkräften zu geben, ist für Eltern immer ein besonderer Schritt. Leiden die Kinder an Hämophilie, stellen sich zudem viele medizinische und organisatorische Fragen. Im Interview sprechen Dr.in Katharina E. Thom und Eva Wissmann über die richtige Vorbereitung für Kindergarten und Schule und erklären, wie Freizeit- und Schulsport sicher gestaltet werden können.

Oberärztin Abteilung für Pädiatrische Kardiologie/ Kinderherzzentrum Wien und Gerinnungsambulanz für Kinder und Jugendliche, Spezialistin für Pädiatrische Kardiologie und Gerinnungsstörungen, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Wien

DGKP Eva Wissmann Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Wien
Wenn ein Kind mit Hämophilie in eine Krabbelstube oder einen Kindergarten kommt –welche Vorkehrungen sollten Eltern treffen, um eine sichere Betreuung zu gewährleisten?
K. Thom: Die Blutungsneigung ist abhängig vom Schweregrad der Hämophilie. Für die Prävention von Blutungen werden die Kinder mit einer schweren Hämophilie heutzutage bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter auf eine regelmäßige Behandlung (Faktor- oder NonFaktor-Therapie) eingestellt. In der Ambulanz wird die Effektivität der Therapie überprüft und die Eltern können Fragen zum Start in den Kindergarten besprechen. Zusätzlich gibt es in einem Ambulanzbrief eine Extrainformation für das Betreuungspersonal. Kinder mit einer Hämophilie können regulär in den Kindergarten starten und benötigen keinen gesonderten Integrationsplatz.
Wie können Eltern das Personal in der Kinderbetreuung am besten über die Hämophilie informieren, und was sind die wichtigsten Punkte, die das Betreuungsteam wissen sollte?
K. Thom: Das betreuende Personal wird von den Eltern über die Erkrankung informiert. Zusätzlich sollte eine Kopie des „Bluterpasses“ mit Informationen zur Erkrankung und Therapie im Kindergarten vorliegen. Kinder mit einer schweren Hämophilie erhalten ihre regelmäßige Therapie durch die Eltern. Alle Kinder mit Hämophilie können normal am Kindergartenalltag teilnehmen. Kleine Verletzungen oder Schürfwunden sind unkompliziert und können wie üblich versorgt werden. Bei Stößen an den Kopf, Schwellung eines Gelenkes oder neuen Schonhaltungen ist oft eine zusätzliche Faktorgabe nötig. Dann sollten zunächst die Eltern informiert werden,
die sich sehr gut mit der Behandlung und Einschätzung der Verletzung auskennen. Bei Rückfragen steht das Gerinnungsteam an der Kinderklinik/AKH Wien zur Verfügung.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Betreuung eines Kindes mit Hämophilie, und welche Maßnahmen sollten Eltern und Schule gemeinsam ergreifen?
E. Wissmann: Kinder mit Hämophilie benötigen den Schulbesuch wie andere auch. Die Lehrkräfte sind oft verunsichert durch die Diagnose „Bluterkrankheit“. Hier sind Erläuterungen durch die Eltern und Informationen aus der Gerinnungsambulanz hilfreich. Die Kinder können normal am Sport und an Ausflügen teilnehmen. Schulen erhalten erforderliche Bestätigungen, lagern oft Präparate für Notfälle und hinterlegen zusätzlich die Nummer des behandelnden Zentrums. Impfungen sollen nur subkutan erfolgen, Informationen gehen auf Wunsch an die Schulärztin oder den Schularzt.
Was sind die wichtigsten Empfehlungen für Eltern, um den Schulalltag ihres Kindes – inklusive Sportunterricht und Pausen – sicher zu gestalten?
E. Wissmann: Eine gute Information und Akzeptanz der Erkrankung vonseiten der Lehrkräfte wie auch der Mitschüler:innen ist wünschenswert und hilfreich. Durch ein Referat kann Information vermittelt und Interesse geweckt werden. Verletzungen und Rangeleien im Schulalltag können vorkommen. Kinder mit schwerer Hämophilie haben bei regelmäßiger Prophylaxe einen guten Schutz und erkennen meist selbst, ob eine zusätzliche Faktorverabreichung nötig ist.
Welche sportlichen Aktivitäten eignen sich besonders gut für Kinder mit Hämophilie, und welche sollten vermieden werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren?
K. Thom: Kinder mit einer schweren Hämophilie haben unter einer konsequenten, regelmäßigen Prophylaxe ein deutlich vermindertes Blutungsrisiko. Sportliche Aktivitäten sind wichtig für Körperbewusstsein, Muskelau au, Gelenksstabilität und zur Vermeidung von Verletzungen. Ideale Aktivitäten sind zum Beispiel Schwimmen, Laufen, Radeln, Krafttraining, Tischtennis.
Sportarten mit einem hohen Verletzungsund Blutungsrisiko sind Kontakt- und Ballsportarten. Andere häufige Aktivitäten wie Freizeitfußball, Skifahren oder Tennis haben unter regelmäßiger Prophylaxe ein mäßiges Blutungsrisiko. Bei Verletzungen muss eine zeitnahe Begutachtung und Therapie erfolgen. Eine gute Au lärung und Besprechung der Aktivitäten ist wichtig, wofür auch das Gerinnungsteam zur Verfügung steht.
Welche Ratschläge können Sie Eltern geben, die unsicher sind, ob ihr Kind an bestimmten sportlichen Aktivitäten teilnehmen soll?
E. Wissmann: Die Kinder sind durch ihre Prophylaxe gut geschützt und können regulär am Schulsport teilnehmen. Zumeist beurteilen die Eltern, welche Sportart für ihr Kind geeignet ist. Von riskanten Aktivitäten, wie Boxen, wird abgeraten. Eine zusätzliche Prophylaxe kann vor intensiven Einheiten geplant werden.

Bereits zum vierten Mal war die Ovalhalle des Wiener Museumsquartiers Ort für Vorträge, Begegnung und Austausch von Health Care Professionals, Patient:innen und Industrie. Im Fokus standen praxisnahe Informationen, die den Alltag von Menschen mit einer Muskelkrankheit (NMD) erleichtern sollen. Wie Vortragende und der Veranstalter Roche die aktuelle Situation sehen, lesen Sie hier.
Wie nehmen Sie die Situation in Österreich für Menschen mit einer Muskelerkrankung wahr, wenn es um die Teilhabe in der Gesellschaft geht?

Claas Röhl Gründer und Obmann der Patientenorganisation NF Kinder
Es war sehr schön, so viele Menschen kennenzulernen, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich das Leben Betroffener zu verbessern. Mit freundlicher Unterstützung von

Welche Verbesserungen würden Sie sich diesbezüglich wünschen?
Jeder Mensch mit einer chronischen Erkrankung verdient mehr Akzeptanz und Rücksichtnahme. Das Unbekannte macht den Menschen oft Angst oder überfordert sie. Ausgrenzung und Diskriminierung können die Folge sein.
Mehr Bewusstmachung von Kindheit an sowie mehr mediale Sichtbarkeit.
Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen kennen am besten die Bedürfnisse der Betroffenen und können an Lösungen mitarbeiten, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
Ich nehme inspirierende Gespräche mit faszinierenden Persönlichkeiten mit, die meine Perspektive sehr erweitert haben.

Was kann Ihre Organisation / Was kann Ihre Berufsgruppe konkret beitragen, um die Möglichkeiten zur Teilhabe und die Lebensqualität für Muskelkranke und deren Angehörige zu verbessern?
Was nehmen Sie vom NMD Community Day mit? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Lisa Puchberger Casemanagerin

In Österreich haben wir dafür gute Ansätze. Aber in der Praxis sehen wir leider vor allem beim „Erwachsenwerden“ weiterhin Barrieren, die die vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren.
Österreichweit einheitliche Leistungen, Versorgungsmöglichkeiten und finanzielle Hilfen.
Die Situation ist auf jeden Fall ausbaubar. Viele Leistungen werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Es gibt zwar viele Fördermöglichkeiten, diese sind aber leider nicht immer bekannt oder die Anträge sind mit viel Aufwand verbunden.
Eine breite Versorgung mit aktueller Unterstützungstechnik könnte die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung wesentlich stärken.
Assistronik und die AsTeRICS Foundation versuchen, mit neuen Produktionsmethoden (3D-Druck) kostengünstige Lösungen individuell zu entwickeln. Behinderungen sind individuell, genauso wie die Menschen, die dahinterstehen.
Der NMD Community Day bietet uns Austausch mit Betreuungsorganisationen sowie aktuelle Fallbeispiele von Betroffenen.
Das Casemanagement arbeitet nahe am Menschen, kennt die Reibungspunkte und kann diese aufzeigen und verbessern.


Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens (Kindergarten, Schule, öffentlicher Verkehr, Straßenbau), aber auch bei der Inklusion einiges verbessern können.
Eine größere Bereitschaft aller Beteiligten, Inklusion in Kindergärten, Schule und Ausbildung fortzusetzen und weiterzuentwickeln.
Ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Anliegen und Bedürfnisse aller Beteiligten.
Es war wieder schön zu sehen, wie Menschen durch ein gemeinsames Interesse an einem Thema neue Ideen entwickeln und sich gegenseitig unterstützen und beflügeln.


Die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Muskelerkrankung benötigt weitere Verbesserung und Aufmerksamkeit. Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet auch Zugang zu gleichberechtigten Karrieremöglichkeiten.
Es braucht einerseits die notwendigen Rahmenbedingungen bezüglich Barrierefreiheit und Unterstützung (zum Beispiel persönliche Assistenz), aber auch das Bewusstsein über die Vorteile von inklusiven Arbeitsweisen und Teams, sowohl für Unternehmen als auch Betroffene.

FOTO: PRIVAT

Als Kinderärztin liegen mir das Wohlergehen und die aktive Einbindung der Jüngsten besonders am Herzen. Kinder mit Muskelerkrankungen stoßen leider bereits beim Eintritt in Kindergarten und Schule immer wieder auf große Hürden, die sie häufig die gesamte Bildungslau ahn hindurch begleiten.
Wichtig ist ein chancengerechter Zugang zu Bildung und Freizeitunterstützung für alle Kinder und Jugendlichen. Assistenz muss über die Schule hinaus möglich sein, um Selbstständigkeit und Teilhabe zu fördern. Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden.
Neben medizinischer Versorgung bieten wir auch psychologische Begleitung. Darüber hinaus unterstützen wir Familien, Hürden im Alltag zu meistern. Ich habe viele wertvolle Informationen von den Teilnehmer:innen erhalten, die ich in meiner Arbeit weitergeben kann. Besonders bereichernd war der wertvolle Austausch mit Betroffenen, Angehörigen und Organisationen.

Was hat Roche dazu bewogen, den NMD Community Day ins Leben zu rufen?
Die Entscheidung von Roche, den NMD Community Day ins Leben zu rufen, basiert auf der Überzeugung, dass ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend ist, um das Leben von Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen nachhaltig zu verbessern. Im Fokus steht die Stärkung der gesamten Community.
Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung?
FOTO:
Das Feedback der Teilnehmer:innen ist für uns von unschätzbarem Wert. Nur so können wir sicherstellen, dass wir zukünftige Veranstaltungen noch besser gestalten und die Themen aufgreifen, die für die Betroffenen und ihre Familien am relevantesten sind. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4
Der NMD Community Day bietet eine einzigartige Gelegenheit für den persönlichen Austausch und das Networking zwischen Patient:innen, Angehörigen, Vereinen/Organisationen und Fachexpert:innen. Dieser direkte

& Trainings, myAbility Social Enterprise GmbH
Über unsere inklusive Jobbörse und unser barrierefreies Karriereprogramm ermöglichen wir direkten Kontakt von Jobsuchenden mit inklusionsoffenen Unternehmen. Dabei stehen die eigenen Kompetenzen und ein offenes Ohr für die individuellen Anforderungen an ein optimales Arbeitsumfeld im Fokus – für eine #KarriereOhneBarriere.
Wertvolle Begegnungen mit und für Expert:innen in eigener Sache, insbesondere für gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten am Arbeitsmarkt.
Im Umgang mit muskelkranken Kindern und Jugendlichen erlebe ich oft Ängste, Unsicherheiten und Vorurteile. So ergeben sich für Betroffene und Angehörige häufig Hürden, wenn es etwa darum geht, einen Kindergarten- oder Schulplatz, eine therapeutische Anbindung oder ein passendes Sport- oder Freizeitangebot zu finden.
Au lärung durch Fachpersonal, Patient:innen und Angehörige können Ängste und Vorurteile auflösen. Alle Patient:innen müssen in ihren individuellen Bedürfnissen wahrgenommen und behandelt werden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit kann dabei ein Schlüssel sein.
In der Ausbildung sind Muskelkrankheiten vermehrt ein Thema. Dadurch sollte es künftig leichter werden, passende Therapeut:innen zu finden.
Ich erlebe den NMD Community Day als Chance, miteinander in Austausch zu kommen, und das in offener und wertschätzender Atmosphäre.
Kontakt ermöglicht es allen Beteiligten, voneinander zu lernen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Die Vernetzung soll die Selbstbestimmung und Teilhabe der Betroffenen stärken und ihnen dabei helfen, ihr Leben bestmöglich zu gestalten.
Was nehmen Sie vom heurigen NMD Community Day mit?
David G. L. Weiss (47) ist von systemischer Sklerose (Sklerodermie) betroffen. Im Interview berichtet der Schriftsteller aus Wien, wie er in seiner „Reptilienhaut“ lebt, die ihn einengt, juckt und schmerzt – und wie er die teils lebensbedrohlichen Krisen seines Lebens mit seiner seltenen Erkrankung bislang bewältigte.
Text Doreen Brumme

Wie kam es zu Ihrer Diagnose Sklerodermie?
Ich war immer sehr sportlich, machte alle zwei Tage bis zu vier Stunden Kraft- und Ausdauertraining, sprang bis zu einer Stunde Seil zum Aufwärmen. Ich praktizierte seit meinem Studium japanischen Schwertkampf und wanderte viel. Im Jahr 2014 waren meine damalige Frau und ich in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Plötzlich verkrampften meine Beine so sehr, dass ich die Klettersteige und Leitern nur noch hinauf- und hinunterhangeln konnte. Ich hatte unsägliche Schmerzen. Wir sind dann mit der Straßenbahn zum Auto – als ich saß und nachdem ich ein Bier getrunken hatte, entspannten sich die Beine, der Schmerz ließ nach. Zurück in Wien, ging ich ins Krankenhaus – und hatte Glück: Eine Rheumatologin, die dort ihren letzten Tag absolvierte, erkannte, dass ich an systemischer Sklerose leide.
Wie zeigte sich die Krankheit im weiteren Verlauf?
Wenn ich mit meinem Wissen von heute Bilder von damals anschaue, erkenne ich typische erste Anzeichen an mir: Meine Finger waren geschwollen, mein Gesicht aufgedunsen. Dazu muss man wissen, dass die Sklerodermie eine seltene Erkrankung ist, bei der zu viel Bindegewebe gebildet wird, sodass die Haut sich verdickt und verhärtet. Mir wuchs demnach eine Art Reptilienhaut – die mir zwei Nummern zu klein geworden ist. Seit dem Ausbruch der Krankheit im Jahr darauf spüre ich bei jeder Bewegung Widerstand. Juckreiz und Schmerzen begleiteten mich ständig. Teils verfärbt sich die Haut auch: Am Rücken wurde sie damals dunkler, anderswo gesprenkelt (Salzund-Pfeffer-Syndrom). Mein Zungenbändchen verkürzte sich, ich konnte meinen Mund nicht mehr so weit öffnen wie früher.
Doch Bindegewebe steckt nicht nur in der Haut – es sitzt überall im Körper. Die Innenschicht von Gefäßen nimmt bei Sklerodermie Schaden, es kommt zu Durchblutungsstörungen, vor allem in Fingern und Zehen. Die Blutgefäße werden durchlässiger, die Einblutungen schimmern rot bis rostbraun durch die Haut (Teleangiektasien) – ich „roste“
Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Friedrich Nietzsche
beispielsweise an den Schienbeinen und im Gesicht. Meine Gelenke verkalken. Mein Skelett, meine Sehnen und meine Muskulatur „knarzen“ hörbar wie die Takelage eines Seglers. Meine Lungenfunktion ist eingeschränkt. Ich leide zudem am Raynaud-Syndrom – bei Stress oder Kälte verkrampfen meine Blutgefäße. Viele Betroffene verlieren deshalb Fingerspitzen, Zehen, Haare und Zähne. Zum Glück ich nicht – mir wachsen sogar nach wie vor Kopf- und Barthaare. Typisch Sklerodermie sind auch kleine Geschwüre an Fingern und Zehen (digitale Ulzera), die nur schwer verheilen, ich verlor fast meine rechte Hand deswegen. Ein Arzt aus Wien erinnerte sich Gott sei Dank an ein Heilmittel der alten Griechen: medizinischen Honig.
Wie wurden und werden Sie behandelt? Ein Arzt gab mir anfangs „noch fünf Jahre“. Eine Weile sah es aus, als ob ich nicht mal die schaffen würde. Mein Blut wird mir bis heute regelmäßig entnommen und mit UV-Licht bestrahlt, um die autoimmune Fehlreaktion zu bremsen. Zugleich unterdrückt man bis heute mein Immunsystem medikamentös, was mich anfällig für Infekte macht und auch die Wundheilung verlangsamt. Trotzdem baute ich 2015, 2016 körperlich ab, verlor in einem Jahr 24 Kilogramm Muskelmasse. Über einen beruflichen Kontakt meiner damaligen Frau hatte ich zwei Jahre nach meiner Diagnose die Chance, mich im Yale New Haven Hospital (USA) vorzustellen – der weltgrößten Sklerodermieforschungseinrichtung. Dort erlebte ich meinen Tiefpunkt: Von einst sportlichen 100 blieben mir erbärmliche 50 Kilo, meine Gelenke waren steif. Ich saß im Rollstuhl. Mir ging’s so schlecht, dass ich an Selbsttötung dachte. Ich gab den Ärzt:innen die Carte blanche und
ließ mir zuerst die Gelenke au rechen und dann ein vielversprechendes und bewährtes Medikament geben, das ich leider erbrach. Das nächste behielt ich bei mir.
Wie kamen Sie aus diesem Tief heraus? Frei nach Nietzsche* habe ich mir mein Warum gesucht und mein Wie verändert. Meine Karriere als Schriftsteller hatte einen Knick, die Frau war weg. Ich wohnte wieder bei meinen Eltern, schlief auf dem Klappbett. Ich fragte mich, was ich will, und wollte mein eigenes Leben zurück. Meine Psychotherapie hat mir dabei sehr geholfen. Ich begann wieder zu trainieren – mache inzwischen jeden Tag Sport. Ich gehe wieder wandern. Auf die Bergspitze brauche ich zwar länger als früher, dafür habe ich mehr vom Weg. Ich arbeite nach wie vor als Autor. Zudem bin ich evangelischer Seelsorger, bislang in der Gemeinde, künftig auch im Krankenhaus.
Das hört sich nach „geschafft“ an … Fast … Ich war auf dem Weg. Dann kam eine schwere Krise: 2024 bekam ich erst Herzrhythmusstörungen, dann Herzflimmern. Zum Glück war meine Schwester gerade da, sie setzte den lebensrettenden Notruf ab, und ich konnte rechtzeitig reanimiert werden. Der Hubschrauber brachte mich ins Krankenhaus, dort erhielt ich eine Herzablation und einen Defibrillator.
Wie meisterten Sie diese „Krise“? „Krise“ heißt ja auch „Entscheidung“ – ich war entschieden, mich davon nicht von meinem Weg abbringen zu lassen. Ich habe meine körperliche Leistungsfähigkeit von 60 bis 70 Prozent im Vergleich zu früher als meine neuen 100 Prozent akzeptiert. Ich übe mich in Selbstliebe und Verzeihen. Als ich nach diesem Eingriff mein Herz das erste Mal im Ultraschall sah, erfüllten mich tiefste Dankbarkeit und Zuneigung.
Wie geht es Ihnen heute? Ich lebe mein neues Leben. Ich arbeite, bin frisch verliebt und kann dank meines Trainings, mental wie körperlich, alles machen, was das Leben schön macht.
Mit freundlicher Unterstützung von Blueprint Medicines
Was die Erkrankung ausmacht und wie sie erfolgreich behandelt werden kann, erklärt Dermatologin Prof.in Sabine Altrichter.

Was passiert bei der Mastozytose?
Bei der systemischen Mastozytose, der häufigsten Form der Erkrankung, kommt es zu einer spontan auftretenden und nicht vererbten genetischen Veränderung. Dadurch vermehren sich die Mastzellen – das sind Immunzellen, die etwa bei Reaktionen wie Allergien eine wichtige Rolle spielen – stärker als bei gesunden Menschen. Die Symptome hängen davon ab, in welchen Organen sich diese Mastzellen ansammeln. Besonders häufig ist die Haut betroffen. Die Patient:innen werden oftmals mit braunen Punkten, die optisch Sommersprossen ähneln, vorstellig. Während Sommersprossen meist eher hellbraun sind, sind diese Flecken aber rötlich braun. Bei Temperaturveränderungen oder wenn man daran reibt, beginnen sie zu jucken und werden kräftig rot und erhaben. Die Erkrankung kann sich aber auch mit Verdauungsproblemen wie Durchfall äußern, besonders starken allergischen Reaktionen oder in ganz seltenen Fällen auch durch plötzlich auftretende Knochenbrüche.
Wie wird die Diagnose gestellt? Die Kombination dieser vielen sehr unterschiedlichen Symptome ist oft der
entscheidende Hinweis. Gerade bei vergleichsweise milden und unspezifischen Symptomen wie Juckreiz, Hautrötung oder Verdauungsproblemen ist es oft schwierig, die Erkrankung von häufigeren Allergien, Erkrankungen des Darms oder der Knochen abzugrenzen. Bei Verdacht kann im Blut die Serumtryptase bestimmt werden. Eine Erhöhung erhärtet dann den Verdacht auf eine mögliche Mastozytose. Zur Absicherung der Diagnose erfolgt eine Biopsie des betroffenen Organs oder des Knochenmarks, um die veränderten Mastzellen und die genetische Mutation nachzuweisen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen aktuell zur Verfügung?
Mastzellen setzen bei Aktivierung sehr viel Histamin frei. Antihistaminika sind daher in den meisten Fällen ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Zusätzlich können bei schweren allergischen Reaktionen allergiespezifische Therapien zur Anwendung kommen. Neue Therapieformen hemmen genetisch veränderte Mastzellen. Generell wird empfohlen, hautreizende Substanzen und Textilien sowie histaminreiche Nahrungsmittel zu meiden. Dabei muss man oft gemeinsam
mit den Patient:innen herausfinden, was diesen guttut. Als hilfreich hat sich dabei die MASTHAVE®-App erwiesen. Diese ermöglicht es Mastozytosepatient:innen, Symptome zu protokollieren. Damit erhalten die behandelnden Ärzt:innen wichtige Informationen über die Krankheitsaktivität und die Effektivität der Therapie. Gerade zu Behandlungsbeginn oder bei Therapieumstellungen ist das sehr wertvoll. Den Patient:innen kann es dabei helfen, spezifische Trigger, wie etwa Lebensmittel, zu identifizieren.
Wo finden Betroffene Spezialist:innen, die mit dieser seltenen Erkrankung vertraut sind? Es gibt an allen Unikliniken auf Mastozytose spezialisierte Anlaufstellen. Zudem kann es hilfreich sein, sich mit Selbsthilfeorganisationen zu vernetzen. Es ist eine seltene Erkrankung, und für viele Patient:innen ist es wichtig zu wissen, dass sie damit nicht allein sind. Gerade beim Thema Ernährung kann der Austausch hilfreich sein, weil es hier von medizinischer Seite keine eindeutigen, für alle Patient:innen gültigen Empfehlungen gibt.

Hier geht‘s zur MASTHAVE®-App masthave-app.com
Warum das hereditäre Angioödem (HAE) häufig erst spät erkannt wird, erklärt der Dermatologe Dr. Clemens Schöffl.

Was zeichnet das hereditäre Angioödem (HAE) aus?
Bei HAE kommt es genetisch bedingt zu immer wiederkehrenden Schwellungen an unterschiedlichsten Körperregionen. Teilweise tauchen diese spontan auf, manchmal sind sie Reaktionen auf spezifische Reize. Gerade im Mund- und Rachenraum können sie gefährlich werden, wenn sie die Atmung behindern. Anders als etwa allergische Reaktionen sind sie nicht mit Juckreiz verbunden. Aktuell betreuen wir in Österreich etwa 160 Patient:innen. Hat ein Elternteil diese Mutation, besteht eine 50-prozentige Chance, sie weiterzuvererben.
Wann macht sich die Erkrankung erstmals bemerkbar?
Häufig setzt sie in den ersten beiden Lebensjahrzehnten ein – bei Frauen beziehungsweise Mädchen tritt sie häufig erstmals mit der hormonellen Umstellung auf. In anderen Fällen sind es oft ungewohnte Aktivitäten, die die Schwellungen hervorrufen – etwa beim Skifahren, wo der Druck der Skischuhe diese auslöst, beim Rasenmähen durch das ständige Vibrieren der Hände oder beim Volleyballspielen.
Was erschwert die Diagnose?
Dass die Schwellungen überall auftreten können – auch im Abdomen, wo sie sich dann als Bauchschmerzen manifestieren. In seltenen Fällen können die Schwellungen auch gleichzeitig an zwei oder drei Stellen auftreten, was aber sehr selten vorkommt. Gerade bei Kindern denkt man bei Bauchschmerzen natürlich nicht als Erstes an das hereditäre Angioödem. Das gilt auch für Schwellungen im Lippen- oder Augenbereich. Darum dauert es in der Regel, bis andere Ursachen ausgeschlossen werden und die Behandelnden dann an HAE denken. Wenn Patient:innen einfällt, dass auch die Mutter, der Vater oder die Großeltern solche Schwellungen hatten, fällt oft der Groschen. Generell muss man sagen, dass sich die Situation in den letzten Jahren deutlich gebessert hat. Wir haben zuletzt einiges an Au lärungsarbeit leisten können – nicht nur unter Dermatolog:innen, die am häufigsten mit der Erkrankung zu tun haben, sondern auch unter Allgemeinmediziner:innen und Kinderärzt:innen. Für die Patient:innen ist es wichtig zu wissen, dass sie immer wiederkehrende Schwellungen mit unklarer Ursache abklären lassen sollten – gerade dann, wenn das in der Familie schon einmal aufgetreten ist.






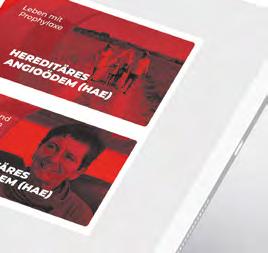


Wie wird HAE behandelt?
Auch hier wurden große Fortschritte erzielt. In den HAE-Zentren können die Patient:innen kompetent betreut werden. Zudem verfügen wir mit Inhibitor-Ersatzprodukten und monoklonalen Antikörpern über Präparate, die effektiv und weitgehend nebenwirkungsfrei die Anfallshäufigkeit reduzieren beziehungsweise diesen im Idealfall vorbeugen können. Neben Präparaten, die injiziert werden müssen, gibt es mittlerweile auch solche, die oral als Tabletten verabreicht werden. In der Akuttherapie sind die Patient:innen noch auf die Injektion der Wirkstoffe angewiesen. Wichtig ist auch entsprechende Prophylaxe bei medizinischen Eingriffen – der Mund- und Rachenraum reagiert hier oft besonders empfindlich. Wie kann man lernen, kompetent mit der Erkrankung umzugehen? Es gibt hier vielfältige Beratungs- und Schulungsangebote. Wir haben in unserem Team Mitarbeiter:innen, die zu den Patient:innen nach Hause kommen, über die Erkrankung au lären und auch praxisrelevante Fähigkeiten wie den Umgang mit Spritzen erklären. Auch die Patientenorganisation HAE Österreich ist hier sehr aktiv und bietet vielfältige Unterstützungs- und Vernetzungsangebote.




SCARLETRED setzt neue Maßstäbe in der Dermatologie, dank Smartphone-App und künstlicher Intelligenz. Mit Scarletred®Vision ermöglicht das österreichische MedTech-Unternehmen ICH-GCP- und datenschutzkonformes Hautmonitoring aus der Ferne – und verbessert die globale Versorgung seltener Erkrankungen wie Epidermolysis bullosa (EB).
Eine objektive Dokumentation und Beurteilung von EB-Läsionen ist entscheidend, um den Krankheitsverlauf präzise zu verfolgen und fundierte Therapieentscheidungen zu treffen. Doch für viele Patient:innen, vor allem Kinder, sind häufige Klinikbesuche zeitaufwendig, schmerzhaft und belastend. Scarletred®Vision, ein Softwaresystem entwickelt auf Basis von über zehn Jahren klinischer Forschung und validierter KI-Modelle, bietet eine sichere, mobile und skalierbare Lösung, die direkt auf Smartphones und somit barrierefrei für alle in grei arer Nähe ist.
Im Zentrum steht Scarletred®Vision – eine zertifizierte Software als Medizinprodukt (SaMD), bestehend aus Smartphone-App, Kalibrierungssticker und sicherer Cloudplattform. Anders als hardwaregebundene Systeme oder nicht zertifizierte Anwendungen ist die Lösung vollständig mobil, zu Hause wie in der Klinik einsetzbar und erfüllt höchste internationale Standards. Führende BioPharmaUnternehmen, akademische Einrichtungen und Ärzt:innen nutzen sie bereits weltweit – in über 100 klinischen Studien und der Marktüberwachung zugelassener Medikamente.
Seltene Erkrankung EB im Fokus
Diese Innovation ist besonders wichtig für EB – eine seltene genetische Erkrankung, die etwa eine von 50.000 Geburten betrifft, mit weltweit rund 500.000 Patient:innen. Die sogenannten „Schmetterlingskinder“ leben mit extrem empfindlicher Haut, chronischen
Wunden, Infektionsrisiken und oft schweren Komplikationen. Trotz Fortschritten durch Forschung und Patientenorganisationen bleibt die Versorgung aufwendig und inkonsistent, während Ärzt:innen und Familien oft verlässliche telemedizinische Werkzeuge fehlen. Hier setzt SCARLETRED an: Scarletred®Vision mit dem KI-Assistenten „Arora“ liefert hochqualitative Bilddaten, segmentiert Läsionen automatisch, erkennt Wunden, klassifiziert Gewebearten und verfolgt Blasenbildungen im Verlauf. Ein einziges kalibriertes Smartphone-Foto wird so zu einem zuverlässigen klinischen Datensatz – subjektive Beschreibungen gehören der Vergangenheit an.
Kooperation und praxisnahe Umsetzung Um die App optimal auf aktuelle Bedürfnisse bei EB anzupassen, arbeitet SCARLETRED bereits langjährig mit führenden Forschungseinrichtungen wie dem Universitätsklinikum Salzburg (SALK) und dem NIH sowie auch mit Patientenorganisationen zusammen. Studien und Feedbacks von Patient:innen belegen bereits die hohe Nutzerfreundlichkeit und das Vertrauen in die Datensicherheit – eine wesentliche Grundlage für KI-gestützte Entscheidungstools in klinischen Studien und künftig auch in der Telemedizin. Erste Ergebnisse, auf Basis der neuen KI-Tools, wurden kürzlich auf einem Fachkongress in Prag vorgestellt. Neben der Unterstützung von BioPharma-Unternehmen und Forscher:innen in der Entwicklung neuer EB-Arzneimittel

folgt die Mission des Unternehmens dabei jedoch stets einem zentralen Grundsatz: Medizinische Innovation muss Patient:innen dort abholen und unterstützen, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbringen – nicht im Krankenhaus, sondern im familiären Umfeld, zu Hause. „Bei seltenen Erkrankungen wie EB, bei denen herkömmliche Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen, ist zertifizierte medizinische KI somit nicht nur ein großer Durchbruch oder gar ferne Zukunft – gemeinsam mit unseren Partnern und den Patient:innen machen wir sie nun zum Standard und somit einer neuen medizinischen Realität“, so Schnidar.

Mit Ihrer Hilfe können wir für schwerstkranke Kinder und ihre Familien:
Hier geht’s zur Scarletred®Vision-App scarletred.com/ products/vision
MOMOgibtHalt. MOMO hört zu. MOMOpflegt. MOMO ist da. MOMO macht Mut. MOMOtherapiert.MOMOversorgtmedizinisch. MOMOweiß,wasZeitbedeutet. MOMO berät sozialarbeiterisch. MOMObegleitetpsychologisch. www.kinderpalliativzentrum.at
AT57 2011 1822 1426 4500

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Reg.-Nr. SO 2858