Lesen Sie mehr unter www.landundgemeinde.info/
Österreichische Landwirtschaft


70 Jahre Kelly’s Chips und Snacks: Nachhaltigkeit made in Austria
Seite 11
Urlaub am Bauernhof: Bäuerliche Betriebe in Österreich bieten Gäst:innen eine Auszeit mit Mehrwert. Warum das Konzept immer gefragter wird, lesen Sie hier.
Seite 16
Bio – Mehr als nur ein
EU-Biobäuerin 2024 Reinhild Frech-Emmelmann erzählt, wie sie die Vielfalt im Selbstversorgergarten ihrer Großeltern nachhaltig geprägt hat.
Seite 14

Digital Farming mit CLAAS connect.
Maschinendaten, Konnektivitätsfunktionen, Farmmanagementlösung, Ersatzteile, Lizenzen – mit CLAAS connect haben Sie die ganze Welt von CLAAS in Ihrer Hosentasche.
Mit Smart Farming mehr erreichen. connect.claas.com
IN DIESER AUSGABE
VORWORT
Lebensgrundlage Landwirtschaft
Martin Michael Lorenz von BASF im Interview

75 Jahre SaatbauRegional: verwurzelt und global erfolgreich
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER AUSGABE

Sophie Steindl Project Manager

Paul Prieler Project Manager
Project Manager: Paul Prieler
Project Manager: Sophie Steindl, BA Lektorat: Sophie Müller, MA Grafik, Layout: Daniela Fruhwirth
Managing Director: Bob Roemké
Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, Bösendorferstraße 4/23, 1010 Wien, ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien
Impressum: https://mediaplanet.com/at/impressum/ Distribution: Der Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co.KG
Kontakt bei Mediaplanet: Tel: +43 1 236 34380
E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com ET: 27.03.2025
Bleiben Sie in Kontakt:
Mediaplanet Austria
@mediaplanet.austria
@DerUnternehmensratgeber

Norbert Totschnig
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Österreichs Bäuerinnen und Bauern versorgen uns täglich mit hochwertigen Qualitätslebensmitteln, pflegen unsere Kulturlandschaft und produzieren nachhaltige Energie. Rund 154.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe bilden das Rückgrat des ländlichen Raums und tragen maßgeblich zur hohen Lebensqualität bei.
Doch gerade in Zeiten volatiler Märkte und globaler Unsicherheiten, wie z. B. durch den Krieg in der Ukraine, stehen die bäuerlichen Familienbetriebe vor großen Herausforderungen. Extremwetterereignisse, steigende gesellschaftliche Anforderungen und bürokratischer Aufwand fordern unsere nachhaltige Produktion; zusätzlich erschweren inflationsbedingte höhere Kosten wichtige Zukunftsinvestitionen. 2024 haben wir daher ein Paket zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und flächendeckende Landwirtschaft mit fairen Rahmenbedingungen zu ermöglichen.
Gerade unsere vergleichsweise kleinstrukturierte und bäuerliche
EVENTS 2025

WIESELBURGER MESSE
Land – Forst – Jagd Täglich von 9:00 – 18:00 Uhr
Ort: Messe Wieselburg Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg www.wieselburger-messe.at

Handelskolloquium 2025 10:00 – 16:00 Uhr
Ort: Apothekertrakt, Schloss Schönbrunn, 1130 Wien www.handelskolloquium.at
Landwirtschaft trägt zum Erhalt der Biodiversität und den steigenden Umweltleistungen bei. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe arbeiten somit stets im Einklang mit der Natur. Über 80 % der Bäuerinnen und Bauern nehmen freiwillig am Agrarumweltprogramm ÖPUL teil – und 10 % der heimischen landwirtschaftlichen Flächen sind Biodiversitäts- oder Naturschutzflächen. Zudem sind wir mit einem Bio-Flächenanteil von 27,4 % EU-weit führend. Österreichs Landwirtschaft steht für eine nachhaltige Produktion und höchste Lebensmittelqualität. Darauf können wir stolz sein! Es ist entscheidend, dass die Gesellschaft die harte Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern unterstützt und wertschätzt, etwa mit dem Kauf eines AMA-Gütesiegel-Produkts. Jede:r Einzelne kann zur Stärkung unserer Landwirtschaft beitragen, weshalb informative Publikationen wie „Österreichs Landwirtschaft“ ein wertvolles Bindeglied zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft bilden. Denn nur gemeinsam sichern wir eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Österreich. Eine spannende Lektüre wünscht
Norbert Totschnig

Nachhaltigkeitskommunikation und Green Claims
Ort: online www.weka-akademie.at/ nachhaltigkeitskommunikationund-green-claims/
Einführungsseminar Lieferkettengesetz
Ort: online www.weka-akademie.at/ einfuehrungsseminar-lieferkettengesetz/
Entgeltliche Einschaltung
Campus Francisco Josephinum: Spitzenreiter in Bildung, Forschung und Agrartechnologie
Als führende Institution in der Agrar- und Lebensmitteltechnologie vereint das Francisco Josephinum in Wieselburg zukunftsorientierte Ausbildung mit innovativer Forschung. Im Gespräch geben DI Martin Kerschbaumer, Direktor der HBLFA Francisco Josephinum, und Dr. Markus Gansberger, Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs „Agrartechnologie & Digital Farming“ in Kooperation mit der FH Wiener Neustadt, Einblicke in den Lehr- und Forschungsalltag.
Herr Kerschbaumer, das Francisco Josephinum ist eine Institution mit über 150 Jahren Geschichte. Was macht Ihre Schule besonders?
Die HBLFA Francisco Josephinum steht für eine praxisnahe Ausbildung kombiniert mit innovativer Forschung. Sie bietet vier maturaführende Ausbildungsrichtungen – Landwirtschaft, Landtechnik, Lebensmittel- & Biotechnologie sowie Informationstechnologie in der Landwirtschaft. Durch die Lehrtätigkeit unserer Forscher:innen fließen aktuelle Entwicklungen in Landwirtschaft, Landtechnik, Digitalisierung und Lebensmitteltechnologie direkt in den Unterricht ein. Der Campus mit dem historischen Schloss Weinzierl bietet eine erstklassige Infrastruktur und wird durch ein modernes Internat ergänzt, was unseren Schüler:innen ein ideales Lernumfeld schafft.
Neben der Ausbildung ist auch die Forschung ein zentraler Bestandteil. Woran wird hier gearbeitet?
Mit Josephinum Research verfügen wir über eine Forschungseinrichtung, die innovative Entwicklungen in den Bereichen Agrartechnik, Biomasse und Lebensmitteltechnologie vorantreibt. Die Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung und Anwendung



Dr. Markus
Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Agrartechnologie & Digital Farming
innovativer Technologien für die Landwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Precision Farming, Smart Farming, Sensortechnologien, Mechatronik und Robotik. Ein besonderes Highlight ist die Innovation Farm. Hier testen und demonstrieren wir neue Technologien für die Landwirtschaft und arbeiten wir eng mit Wirtschaft und Forschungspartner:innen zusammen.
Herr Gansberger, Sie leiten den Bachelorstudiengang „Agrartechnologie & Digital Farming“ am Campus Francisco Josephinum in Kooperation mit der FH Wiener Neustadt. Worum geht es im Studium, und wen sprechen Sie an?
Das Studium richtet sich an Absolvent:innen landwirtschaftlicher und technischer Schulen und kombiniert Agrarwissenschaften mit Informatik, künstlicher Intelligenz, Mechatronik und Robotik. Durch die enge Kooperation mit Josephinum Research und den Flagship-Projekten Innovation Farm (www.innovationfarm.at) und AgrifoodTEF (www.agrifoodTEF. eu) erhalten Studierende praxisorientierten Zugang zu modernster Technologie. Zusätzlich ermöglicht die Zusammenarbeit mit Unternehmen maßgeschneiderte Jobangebote, wodurch Studium und Beruf optimal verknüpft werden. Dank der berufsermöglichenden Organisation sind die Studierenden von Montag bis Mittwoch an der FH, während sie an den restlichen Tagen Praxiserfahrungen in Unternehmen sammeln können.
ermöglicht es beispielsweise, Satellitendaten so zu verarbeiten, dass daraus Düngewerte berechnet und mit der entsprechenden Düngetechnik gezielt Düngemittel ausgebracht werden können. Eine unserer Anwendungen heißt TerraZo (www.terrazo.at), mit der Düngekarten für ganz Österreich generiert werden können. An den Berufsbildern ändert sich grundsätzlich nichts, aber Hybridqualifikationen sind zukunftsträchtig und gefragt. Neben Agrar-Know-how braucht es technisches Verständnis, um digitale Lösungen gezielt einzusetzen. Absolvent:innen unserer Schule und unseres Bachelorstudiums arbeiten in der Agrar- und Landtechnikindustrie, in landwirtschaftlichen Betrieben, im Service & Vertrieb oder als Agrarberater:innen. Zusätzlich eröffnen sich Möglichkeiten in der

Was versteht man unter „Digital Farming“, und welche Berufsbilder entstehen dadurch in der Landwirtschaft?
Digital Farming nutzt digitale Technologien wie Sensorik, künstliche Intelligenz, Robotik und Datenanalyse, um landwirtschaftliche Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Die Präzisionslandwirtschaft
Forschung und Entwicklung sowie in der Gründung von Start-ups für innovative agrarische Technologien.
AgriPhotovoltaik: Nahrungsmittel und Energie vom Feld
Alexander Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Landtechnik der BOKU University, gibt einen Einblick in den Bereich der nachhaltigen Agrar- und Energiesysteme in der Landwirtschaft.

Dr. Alexander Bauer
wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Instituts für Landtechnik der BOKU University. Forscht in den Themenbereichen nachhaltige Agrarsysteme, Digitalisierung in der Landwirtschaft und Energiesysteme in der Landwirtschaft
Boden ist ein wertvolles Gut. Durch das Bestreben nach unabhängiger Energieversorgung wird auch landwirtschaftliche Fläche für die Stromerzeugung genutzt, z. B. durch Photovoltaik (PV). Untersuchungen zeigen, dass bereits versiegelte Flächen für PV genutzt werden können. Doch auch Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen werden benötigt, um den Energiebedarf zu decken. Beide Systeme bestehen aus Solarmodulen, wobei Freiflächenanlagen den Stromertrag maximieren, während Agri-PV-Anlagen weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Letztere befinden sich auf Ackerflächen und Grünland, in Obstplantagen oder auch in Weinbergen. Die Module sind so angeordnet, dass eine Nutzung von 70 –100 % der Fläche möglich ist. Flächen mit Agri-PV-Anlagen können mindestens gleich intensiv bewirtschaftet werden wie Flächen ohne: Acker bleibt weiterhin Acker.
Die PV-Module bieten Pflanzen Schutz vor extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Spätfrost oder Sonneneinstrahlung. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass sich die Pflanzen durch verminderte direkte Sonneneinstrahlung teilweise besser entwickeln.
Die Vorteile von Agri-PV-Anlagen für die Landwirtschaft sind vielfältig – von einer Einkommensquelle durch Stromverkauf, über die Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an extreme Witterungsbedingungen durch Veränderung des Mikroklimas bis hin zur Erhöhung der Biodiversität unter den PVModulen bei entsprechender Bewirtschaftung.
Agri-PV-Anlagen spielen künftig eine Schlüsselrolle in der Landwirtschaft. Sie bieten angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch Klimawandel und Co. eine nachhaltige Lösung für Energie- und Nahrungsmittelproduktion und tragen zur finanziellen Stabilität der Betriebe bei.

MERCOSUR-Handelsabkommen: Unsere
Kritikpunkte
bleiben

Georg Strasser Präsident des Österreichischen Bauernbundes

Seit gut einem Vierteljahrhundert verhandelt die EU mit dem MERCOSURStaatenbund – Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay – über ein Freihandelsabkommen.
Mit direkten Auswirkungen auf 800 Mio. Menschen wäre es weltweit das größte seiner Art. Doch Österreich warnt gemeinsam mit anderen EUMitgliedstaaten vor einem Abschluss dieses veralteten Abkommens, das wohl mehr Schaden als Nutzen bringen würde.
Ein Wort vorweg: Gerade wir
Bäuer:innen wissen, dass Freihandel notwendig ist, damit unsere hochwertigen Lebensmittel nicht nur in Österreich, sondern auch ins Ausland verkauft werden können. Für viele Betriebe ist der Export ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Doch Freihandel funktioniert nur mit
Entgeltliche Einschaltung
fairen Regeln.
Wir haben bei MERCOSUR viele Fragen gestellt – und kaum Antworten erhalten.
In der Landwirtschaft geht es vor allem um Zölle für RindfleischImporte aus Südamerika, die fallen sollen. Warum aber müssen wir überhaupt brasilianisches Rindfleisch importieren, wenn wir uns in Österreich selbst versorgen können – und das obendrein mit der nachhaltigsten Produktion der Welt? Pro Kilogramm Rindfleisch werde hierzulande 14,2 kg CO2 verursacht. Im EU-Schnitt sind es 22,2 kg CO2. Und auf der anderen Seite des Globus –in Brasilien – sind die Emissionen mit 80 kg CO2 fünf- bis sechsmal so hoch wie in Österreich. Hinzu kommt, dass die Standards dort nicht nur weit niedriger sind,
Nachhaltige Energie für eine zukunftssichere Landwirtschaft
Die Efficiency Projects GmbH macht mit ihren innovativen Photovoltaiklösungen Landwirt:innen zukunftsfit.
Aufgrund von hohen Strompreisen, erhöhtem Verbrauch durch den Ausstieg aus fossiler Energie und zusätzlichen Anwendungen – von Stalltechnik bis hin zu Bewässerungssystemen – steigen Betriebskosten in der Landwirtschaft. Dank attraktiver Fördermöglichkeiten für Photovoltaik (PV) werden Landwirt:innen deshalb selbst zu Stromproduzent:innen. Das verbessert die Umweltbilanz, senkt Betriebskosten, erschließt neue Einkommensquellen und schafft langfristige Planungssicherheit, weil die Risiken von Strompreisschwankungen minimiert werden. In Kombination mit Batteriespeichern kann PV kostspielige Betriebsstörungen durch Stromausfälle umgehen. Efficiency Projects GmbH bietet ein breites Portfolio an PV-Anwendungen, um Solarpotenzial und Bedarf bestmöglich gerecht zu
werden. Dazu zählt PV auf Dächern von Wohn- und Betriebsgebäuden: Hallen, Lagerflächen und Stallungen bieten ideale Voraussetzungen. Aber auch Agri-Photovoltaik gewinnt an Bedeutung. Dabei werden die Paneele vertikal oder aufgeständert montiert, sodass die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen weiterhin möglich ist. So gestaltete PV-Anlagen erhalten zudem einen Zuschlag von 30 Prozent auf den bestehenden
sondern auch intransparent kontrolliert werden. Während also Familienbetriebe in Österreich strengstens überprüft werden, sollen wir zugunsten dieses Abkommens unsere Prinzipien über Bord werfen? Das kann es nicht geben.
Wettbewerbsdruck, Umweltauswirkungen, Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie soziale Ungleichheit sprechen klar gegen das MERCOSUR-Abkommen. Während die EU mit anderen Ländern – wie zuletzt mit Neuseeland – auch für die Landwirtschaft fortschrittliche Partnerschaften eingeht, fehlt bei MERCOSUR ein klares Bekenntnis zu fairen Bedingungen. Damit ist und bleibt dieses Abkommen für Österreich nicht umsetzbar.
Abg. z. NR DI Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes


Fördersatz. Ebenso produzieren immer mehr Gewächshäuser neben Vitaminen nun auch Strom. Möglich wird das durch die Verwendung lichtdurchlässiger Paneele. Ein anderes Konzept setzt auf herkömmliche Paneele zur Beschattung und Temperaturregulation. Die Doppelnutzung bei Agri-PV wirkt sich positiv auf Erträge, Klimabilanz und Energieverbrauch aus.
Egal, welches Ziel angestrebt wird: Von der Beratung und Planung über Installation, Inbetriebnahme und Wartung sorgt Efficiency Projects GmbH für die effektive Umsetzung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.efficiency-projects. com/photovoltaik-landwirtschaft/
Entgeltliche Einschaltung

Pflanzenschutzmittel –zu Unrecht verteufelt?
Martin Michael Lorenz, Country Manager bei Agricultural Solutions Switzerland & Austria, spricht im Interview über die Bedeutung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft. Was es bedeuten würde, ganz darauf zu verzichten, lesen Sie hier.

Was muss ich mir unter dem Begriff Pflanzenschutzmittel vorstellen?
Den Begriff Pflanzenschutz kann man weit greifen. Das Gießen einer Pflanze ist schon Schutz vor dem Vertrocknen. Landläufig werden damit aber mechanische oder chemisch-synthetische Maßnahmen zum Schutz der Pflanze gemeint, beispielsweise ein Insektizid gegen den Erdäpfelkäfer, ein Fungizid gegen Pilze und deren Gifte oder ein Herbizid gegen die allergene Ambrosia. Hauptziel ist es, die Pflanze gesund zu halten und Lebensmittelverschwendung am Feld zu verringern.
Was würde ein Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel für die Landwirtschaft bedeuten?
Sowohl für die Bio-Landwirtschaft als auch für die integrierte Landwirtschaft wäre das dramatisch. Es würde zu hohen Ernteausfällen kommen, und wir müssten vermehrt ausländische Produzenten finden und Nahrungsmittel importieren. Das wiederum würde höhere Kosten und längere Transportwege bedeuten. Dabei sind die Produktionsstandards in Ländern außerhalb Österreichs oder der EU oft schlechter und vor allem weniger kontrollierbar. Ein Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide würde also das Ende großer Teile der momentan praktizierten Bio- und der integrierten Landwirtschaft bedeuten.
Woher kommt dann das schlechte Image von Pflanzenschutzmitteln?
Ich vermute zwei Gründe dahinter, einen generellen und einen länderspezifischen: Ich glaube, dass in den Anfangsjahren der chemisch-synthetischen Pestizide zu eingleisig gefahren wurde. Manche haben sich zu sehr auf die Chemie verlassen und die Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis nicht immer beachtet. Heute haben wir mit der integrierten Landwirtschaft dazugelernt, bessere Standards entwickelt und das Thema sehr gut im Griff. Leider werden, und das ist der zweite Grund, diese Fortschritte der Hersteller und Landwirt:innen nicht wahrgenommen. Der unglaubliche Erfolg unserer Chemiker:innen, Physiker:innen, Ingenieur:innen und Landwirt:innen ist ihnen zum Verhängnis geworden – ähnlich zu Impfungen, deren Wirksamkeit heute von vielen in Frage gestellt wird. Trotz unseres Anspruchs, eine Wissensgesellschaft zu sein, besteht in Österreich im Vergleich zu unseren EU-Partnern eine erschreckend hohe Wissenschaftsfeindlichkeit. Gleichzeitig ist der Anteil an alternativen Wirklichkeiten groß.
Ist das schlechte Image von Pflanzenschutz also nicht gerechtfertigt?
Ich persönlich glaube, dass es nicht gerechtfertigt ist. Wir müssen uns entscheiden, welchen Lebensstandard und welche Philosophie
wir leben wollen, inklusive der Konsequenzen. Für mich zählen qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, die sich alle Bevölkerungsschichten leisten können. Um fruchtbare Böden und gute Ernten für viele Jahre zu gewährleisten, brauchen wir Fortschritt. Das ständig propagierte alternative Bild eines natur-romantischen Ideals mit sprechenden Schweinderln und blonden Sennerinnen auf der Alm ist doch Unsinn. Man kann der Bevölkerung zutrauen, zu verstehen, dass die Milch im Supermarkt nicht vom Alm-Öhi kommt. Die österreichische Landwirtschaft ist voller kluger Köpfe und spannender Technik und produziert am Ende gesunde Nahrungsmittel.
Welche Konsequenzen würden auf Konsument:innen zukommen, sollte man auf Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft verzichten? Aus meiner Sicht sind folgende Punkte relevant: Qualitätsminderungen und Teuerungen bei Lebensmitteln aufgrund eines geringeren Selbstversorgungsgrades. Es käme darüber hinaus zu geringerer Wertschöpfung und zum Verlust von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und der ständigen Panikmache eine Absage erteilen werden.
Entgeltliche Einschaltung
75 Jahre SAATBAU: Regional verwurzelt, global erfolgreich

Sie feiern heuer 75 Jahre
SAATBAU: Welche Meilensteine haben Sie von einem regionalen Unternehmen zu einem internationalen Player gemacht?
Die gezielte Ausrichtung auf Innovation und nachhaltiges Wachstum hat die Marktpräsenz gestärkt und neue Chancen eröffnet. Ein entscheidender Schritt war der Einstieg in die Maiszüchtung, der die internationale Expansion einleitete.
Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, wurden weitere agrarische Sparten entwickelt. Die Einführung der Vertragslandwirtschaft und die Gründung von SAATBAU ERNTEGUT optimierten Vermarktung und Qualitätssicherung – was essenziell für Absatzsicherheit und Preisstabilität in einem globalisierten Markt ist.
Die EU-Erweiterung beschleunigte das Wachstum, insbesondere in Osteuropa. Mit 17 Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien ist SAATBAU heute in 35 Märkten erfolgreich etabliert. Die Gründung der Saatzucht Donau bündelte die Züchtungskompetenzen und schuf wettbewerbsfähige Strukturen in der Getreide-, Öl- und Eiweißpflanzenzüchtung. Dies ermöglichte die Entwicklung standortangepasster, ertragreicher und nachhaltiger Sorten – ein entscheidender Faktor für die heutige Spitzenposition in Europa.
Als Genossenschaft im Besitz heimischer Landwirt:innen verbindet SAATBAU Tradition mit Fortschritt. Wie gelingt es, die Balance zwischen bewährten und modernen Methoden zu halten?
SAATBAU vereint bewährte landwirtschaftliche Praktiken mit modernen Technologien. Unsere enge Zusammenarbeit mit Landwirt:innen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter:innen sichern den Praxisbezug, während Kooperationen mit Forschungseinrichtungen neue Erkenntnisse bringen.
Digitale Anwendungen wie

Precision Seeding optimieren den Saatguteinsatz und steigern die Effizienz, während das Projekt BROADSENS mit 5G-gestützten, KI-basierten Technologien zur präzisen Unkrautbekämpfung beiträgt. Gleichzeitig bewahren wir essenzielle Prinzipien wie Fruchtfolge und standortangepasste Sortenzüchtung, um Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität langfristig zu sichern.
Welche Rolle spielen die Weiterentwicklung der eigenen Genetik und moderne Züchtungsmethoden in Zeiten des Klimawandels? Wie stellt sich SAATBAU den Herausforderungen in diesem Bereich?
Die Weiterentwicklung unserer eigenen Genetik und der Einsatz moderner Züchtungsmethoden sind für die SAATBAU von zentraler Bedeutung, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Durch gezielte Selektion und Anpassung entwickeln wir Sorten, die widerstandsfähiger gegen Hitze, Trockenheit und neue Schädlinge sind. Unsere Beteiligung an Projekten wie KLIMAFIT unterstreicht unser Engagement, klimafitte Pflanzensorten für die österreichische Landwirtschaft zu entwickeln. Diese Initiativen sichern nicht nur die Erträge unserer Landwirt:innen, sondern tragen auch zur nachhaltigen Produktion bei, die der Umwelt und den Konsument:innen zugutekommt.
In einer Branche, die sich zunehmend konzentriert, bleibt SAATBAU als heimische Genossenschaft unabhängig. Welche strategischen Schritte sind geplant, um Eigenständigkeit, Wertschöpfung und internationale Anerkennung weiter zu stärken?
Unsere Unabhängigkeit ist die Grundlage unserer strategischen Ausrichtung. Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung in der Saatgutproduktion zu steigern, die Marke SAATBAU international zu stärken und durch die Weiterentwicklung unserer eigenen Genetik innovative Lösungen zu schaffen.
Angesichts zunehmender Marktkonzentration ist nachhaltiges Wachstum essenziell. Die Sicherung einer marktkritischen Größe und der Ausbau von Marktanteilen sind entscheidend, um unsere Position als international relevanter Akteur weiter zu festigen. Der gezielte Ausbau von Marktanteilen und Volumen sichert unsere Position als verlässlicher Partner in der Saatgutbranche.
Seit 75 Jahren ist SAATBAU ein verlässlicher Partner in der Landwirtschaft – ein Erfolg, der auf dem Fachwissen und Engagement unserer Mitarbeiter:innen basiert.
Ihre Kompetenz, Innovationskraft und Leidenschaft haben unser Unternehmen geprägt und sichern auch in Zukunft unsere Wettbewerbsfähigkeit.
Nähere Informationen finden Sie unter: www.saatbau.com/at /
PFLANZ DICH ZUM GENUSS!
CREMIGER GESCHMACK



Entgeltliche Einschaltung
FOTO: SCHEINAST

Als Nachhaltigkeitsmanager:in die Zukunft mitgestalten
Am Wildshut-Campus in Salzburg startet im Mai 2025 das neue, dreistufige Ausbildungsprogramm für Nachhaltigkeitsmanagement.



Nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wirtschaften ist mehr denn je eine unternehmerische Notwendigkeit, um Herausforderungen in volatilen Zeiten zu meistern. Am Campus des Stiegl-Gut Wildshut haben Fach- und Führungskräfte nun die Möglichkeit, sich gezielt in diesem Bereich weiterzubilden – berufsbegleitend, praxisnah und wissenschaftlich fundiert.
Gemeinsam mit dem Südtiroler Terra Institute und weiteren renommierten europäischen Bildungsinstitutionen* wurde ein dreistufiges Ausbildungsprogramm für Nachhaltigkeitsmanagement entwickelt, das vom zertifizierten Lehrgang über das Diplom bis zum international anerkannten MBA mit Schwerpunkt Sustainability Management absolviert werden kann. Hochkarätige Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln ihr Wissen praxisnah und zielgerichtet. Das flexible Unterrichtssystem aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen, Selbstlernphasen sowie Supervision ermöglicht eine nahtlose Integration in den Berufsalltag.
Ausbildungsstandort Wildshut-Campus
Mit eigener Brauerei, Bio-Landwirtschaft, Gastronomie und Gästehaus bietet das Stiegl-Gut Wildshut das perfekte Umfeld für diese hochwertige Ausbildung. Hier steht ein neues Wirtschaften mit zukunftsweisenden Projekten rund um Themen wie Kreislaufwirtschaft, Bodengesundheit und Artenvielfalt im Fokus.
Beginn: Mai 2025 –Informieren Sie sich jetzt und melden Sie sich an unter:

*Austrian Club of Management & Innovation (ACMI), Steinbeis-Hochschule School of Management and Technology (SMT) sowie Westminster Business School
Entgeltliche Einschaltung

Pflanzliche und tierische Bio-Milchprodukte von Leeb: Genussvolle Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus

Duttine Geschäftsführerin
Leeb bietet eine Balance aus tierischen und pflanzlichen Produkten – auch in Zukunft?
Nachhaltige und gesunde Ernährung bedeutet für uns Vielfalt. Auch in Zukunft wird also ein Gleichgewicht bestehen bleiben. Wir gehen mit unserem Sortiment auf die individuellen Bedürfnisse aller Menschen ein. Pflanzliche Alternativen spielen dabei eine große Rolle, da sie Ressourcen schonen und die Ernährungsgewohnheiten einer bewussten Generation abdecken. Gleichzeitig haben hochwertige tierische Produkte ihren festen Platz. In Österreich sind Milchprodukte ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Die heimische Landwirtschaft sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die Pflege der Natur- und Kulturlandschaft. Wir wollen nachhaltige und hochwertige tierische und pflanzliche Produkte entwickeln, die mit Geschmack überzeugen.
Sie beziehen Ihre tierischen Rohstoffe von österreichischen Höfen. Was bedeutet das für die heimische Landwirtschaft? Wir pflegen langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften, welche die Qualität sichern und eine verlässliche Perspektive bieten. Unsere Bio-Heumilch-Lieferant:innen setzen auf nachhaltige Bewirtschaftung: frische Gräser im Sommer, Heu im Winter. Das fördert die Artenvielfalt und erhält traditionelle Strukturen. Kurze Transportwege, gentechnikfreie Fütterung und faire Verträge
sorgen dafür, dass unsere Produkte höchsten ökologischen und ethischen Standards entsprechen. Durch diesen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen tragen wir dazu bei, die heimische Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten.
Leeb spricht sowohl Menschen mit Unverträglichkeiten als auch bewusste Konsument:innen an. Welche Trends beobachten Sie hier?
Wir sehen eine deutliche Bewegung hin zu bewusster Ernährung, bei der Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit gleichermaßen zählen. Konsument:innen wollen die besten Produkte für ihre Bedürfnisse und setzen gesundheitsbedingt oder aus Umweltgründen auf pflanzliche oder tierische Alternativen. Unsere Schaf- und Ziegenmilchprodukte sind z. B. eine wertvolle Lösung für Menschen mit Kuhmilchunverträglichkeiten.
Wie wichtig ist Biodiversität in der Landwirtschaft?
Mit welchen Maßnahmen fördern Sie diese?
Biodiversität ist grundlegend für eine nachhaltige Landwirtschaft. Unsere Bio-Heumilch-Lieferant:innen leisten ihren Beitrag, indem sie Wiesen erhalten, auf denen eine große Pflanzenvielfalt wächst. Das schafft Lebensraum für Insekten und Wildtiere. Auch bei den pflanzlichen Rohstoffen setzen wir auf nachhaltige Anbaumethoden: Hafer und Soja stammen aus Österreich, unsere Mandeln aus Italien; unser Kokoslieferant arbeitet mit
Fairtrade- und Naturland-Zertifizierung. Indem wir mit unseren Partner:innen langfristige Verträge schließen, schaffen wir Anreize für nachhaltige Bewirtschaftung und Artenvielfalt.
Welche Rolle spielen Innovationen in Ihrem Sortiment?
Innovation ist für uns der Schlüssel, um nachhaltige Ernährung für alle zugänglich zu machen. Unsere Becher mit über 99 % Recyclingfähigkeit sind ein Beispiel für umweltfreundliche Lösungen. Wir investieren in die Produktentwicklung, um Geschmack und Nährwerte stetig zu verbessern und stehen für eine Ernährungsindustrie, in der Nachhaltigkeit, Transparenz und Verantwortung selbstverständlich sind. Das erreichen wir, indem wir mit unseren Partner:innen die besten Lösungen für Mensch und Umwelt entwickeln.
ÜBER LEEB BIOMILCH
Name: Leeb Biomilch
Standort: Wartberg/Krems, Österreich
Produktion: Hochwertige und regionale Bio-Milchprodukte sowie pflanzliche Bio-Alternativen
Marken:
Leeb Vital: Bio-Schaf- und Ziegenmilchprodukte
MyLove-MyLife: Pflanzliche Bio-Joghurtalternative (Hafer, Soja, Mandel, Kokos) Verfügbarkeit: Bio-Fachgeschäfte und Online-Shops in Österreich und Deutschland, ausgewählte Supermärkte
Mitarbeiter:innen: 80–90
Partnerschaften: Enge Zusammenarbeit mit über 60 heimischen Bio-Bauerhöfen
Hier mehr zu Leebs Vision: https://youtu. be/94FbXvbgOsk

Österreich ist Bio-Weltmeister – auch im Handel


Nirgendwo sonst ist der Bio-Anteil der Landwirtschaft so hoch wie in Österreich. Werden im EU-Schnitt 10,5 % und in Deutschland 10 % aller landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet, so sind es hierzulande 27 %. Und auch im Lebensmitteleinzelhandel spielt Bio eine große Rolle: Mit einem Bio-Anteil von 11,5 % des gesamten Sortiments liegt Österreich europaweit auf Platz 3 – knapp hinter Dänemark (12 %) und der Schweiz (11,6 %). Regionale Produkte gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Sie fördern die Konsument:innenbindung und helfen Händler, sich vom Wettbewerb abzuheben. Die hohe Inflation der letzten Jahre hat in der Branche zwar für Herausforderungen gesorgt, doch mit dem Rückgang der Inflation im
Vorjahr ist auch der Absatz von Bio-Produkten wieder gestiegen: Mit einem Plus von 5,5 % wurde laut AMA ein neues Allzeithoch von 66,1 kg Bio-Lebensmitteln pro Haushalt erreicht – ein gemeinsamer Erfolg für Landwirtschaft, Handel und Konsument:innen. Das zeigt, dass Regionalität, Nachhaltigkeit und Tierwohl den Kund:innen so viel wert sind, dass sie die oft höheren Produktionskosten durch strengere Qualitätsstandards in Kauf nehmen. Zwei Beispiele: Gemäß den tierschutzrechtlichen Vorgaben der EU liegt die maximale Besatzdichte bei Masthühnern bei 42 kg pro Quadratmeter – in Österreich liegt sie hingegen bei 30 kg. Die Tiere haben somit in Österreich um 30 % mehr Platz sich zu bewegen – was die Aufzucht gleichzeitig aber teurer macht. Bei Puten existieren
auf EU-Ebene gar keine gesetzlichen Bestimmungen, in Österreich sehr wohl – mit der Folge, dass in manchen EU-Ländern mit nahezu doppelt so hoher Besatzdichte produziert wird wie hierzulande. Auch im neuen Regierungsprogramm wird dem Thema Regionalität im Lebensmittelbereich viel Raum gewidmet: Die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, eine zeitgemäße Herkunftskennzeichnung, die Unterstützung regionaler Produzent:innen und ein erleichterter Zugang zu regionalen Produkten sind Ziele, die der österreichische Lebensmittelhandel voll und ganz unterstützt. Denn Regionalität steht für Qualität, Nachhaltigkeit, die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Sicherung unserer Kulturlandschaft.

Entgeltliche Einschaltung
Kelly’s Chips und Snacks: Nachhaltigkeit made in Austria

Seit 70 Jahren lässt es die Kelly Ges.m.b.H. knistern: Chips und Snacks der Marke Kelly’s sind aus heimischen Regalen nicht mehr wegzudenken. Das Alleinstellungsmerkmal des Marktführers bei salzigen Snacks in Österreich? Kelly verarbeitet größtenteils heimische Rohstoffe und verzichtet auf Palmöl.
Rund 29.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet das Unternehmen Kelly jährlich zu Chips und Snacks. Angebaut werden Kartoffelsorten wie „Hermes“ und „Lady Claire“ von rund 90 landwirtschaftlichen Betrieben in den Regionen Absdorf, Hollabrunn, Tullnerfeld, Korneuburg, Marchfeld und Seewinkel. Dank der heimischen Produktion fallen die Transportwege kurz aus: Manche Kartoffelfelder sind nur sechs Kilometer vom Kelly-Werk in Wien-Donaustadt entfernt.
Die jährlich benötigten 1.100 Tonnen Salz für salzige Snacks, bei denen Kelly mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent in Österreich an der Spitze ist, kommen aus Salinen in Ebensee. Das Paprikagewürz liefert der heimische Gewürzspezialist Kotányi, während die pro Jahr benötigten 2.000 Tonnen Maisgrieß für Kelly’s Snips, Zirkusräder & Co.
aus Guntramsdorf stammen. Die kurzen Transportwege bedeuten schlussendlich nicht nur Produktfrische, sondern auch reduzierte CO 2 -Emissionen – und wirken damit der Erderwärmung und dem Klimawandel entgegen.
Nachhaltigkeit auf ganzer Linie –Zero Loss und PV-Anlagen Die Nachhaltigkeitsstrategie von Kelly umfasst neben den Lieferketten auch die gesamte Produktion. Vor allem in den beiden modernen Produktionsstätten Wien und Feldbach wird das sogenannte „Zero Loss Mindset“ gelebt. Das bedeutet, Lebensmittelabfall bestmöglich zu vermeiden und unvermeidbare Reste als Tierfutterrohstoff zu verwenden.
Dank des zweiten Hochregallagers am Standort Wien 22 spart Kelly sich zudem Außenläger – und damit 5.500 LKW-Fahrten über

66.000 km im Jahr, für die 21.780 Liter Treibstoff nötig wären. Das entspricht einer CO2-Ersparnis von 50 Tonnen. Weitere 229 Tonnen CO 2 spart das Unternehmen mit Photovoltaikanlagen an beiden Standorten.
Darüber hinaus setzt Kelly kontinuierlich Nachhaltigkeitsverbesserungen in der Produktion um und spart so Ressourcen ein. Damit will das Unternehmen noch effizienter werden, um das Klima noch besser zu schützen.
Innovative Kelly’s Produkte
Zu den Produktinnovationen, die sich aus laufenden Investitionen in die Forschung ergeben, gehören seit 2018 geschmackvolle Snacks aus Linsen, Bohnen und Kichererbsen mit hohem Proteingehalt und weniger Fett. Mit Kelly’s Popchips gibt es seit 2022 auch gepoppte Kartoffelchips, die bei vollem Geschmack 50 Prozent weniger Fett enthalten als frittierte Varianten. Auf Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe verzichtet Kelly grundsätzlich.
Soziales Engagement
Kelly schätzt seine Mitarbeiter:innen als wertvollste Ressource. Sie haben Wurzeln in rund 30 Ländern und sorgen für einen reibungslosen Ablauf in beiden Werken, den Lagern und im landesweiten Vertrieb. Die familiäre Unternehmenskultur fußt auf einem gemeinsamen Verständnis von Teamwork und zeigt sich durch das Miteinander auf Augenhöhe und Per-Du-Sein. Doch soziale Verantwortung übernimmt Kelly nicht nur innerbetrieblich. Das Unternehmen engagiert sich unter anderem als Partner von: Rotes Kreuz Österreich, CliniClowns und Tiergarten Schönbrunn.

Vom Korn zum fertigen Lebensmittel – die Qualität der österreichischen Landwirtschaft
Mein Name ist Katharina Köckenberger, ich bin 28 Jahre alt und lebe in Niederösterreich. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, weshalb mich die Landwirtschaft bereits mein ganzes Leben lang begleitet. Außerdem führt mein Partner gemeinsam mit seinen Brüdern einen Ackerbaubetrieb mit Lohnunternehmen, die Bogner GnbR, was meine Faszination für die vielseitige Welt der Landwirtschaft verstärkt hat. Zu unseren Hauptkulturen zählen Mais, Zuckerrüben, Dinkel, Soja und Raps.
Warum Regionalität bei Lebensmitteln so wichtig ist – für das Klima und die lokale Wirtschaft Regionale Lebensmittel sind sowohl aus ökologischer als auch aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht von großer Bedeutung für
unsere Gesellschaft. Ein Vorteil ist die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes: Durch kürzere Transportwege im Vergleich zu importierten Produkten wird weniger Treibstoff verbraucht, was die Umweltbelastung verringert. Zusätzlich wird die Abhängigkeit von globalen Lieferketten, die anfällig für Krisen und Schwankungen sind, reduziert. Darüber hinaus stärkt der Kauf regionaler Produkte die lokale Wirtschaft. Landwirt:innen, Verarbeiter:innen und kleine Betriebe in der Region profitieren direkt von der Nachfrage, was Arbeitsplätze sichert und zur regionalen Wertschöpfung beiträgt. Beispielsweise fließen unsere Zuckerrüben in die heimische Zuckerproduktion, der Dinkel wird in lokalen Mühlen verarbeitet und der Mais wird für heimische Biogasanlagen und Schweinefutter verwendet.
Aus dem Soja und Raps wird Öl gewonnen.
Hohe Standards und Ernährungssicherheit Österreichische Bäuerinnen und Bauern sichern mit hohen Standards bei Hygiene, Kennzeichnung, Tierschutz und Rückverfolgbarkeit das Vertrauen der Konsument:innen. Trotz Herausforderungen durch den Klimawandel und die damit verbundenen Wetterextreme wie Dürre oder Hagel bleibt es etwas Besonderes, das Korn von der Saat bis zum fertigen Lebensmittel zu begleiten. Regionale Lebensmittel tragen nicht nur zur Ernährungssicherheit Österreichs bei, sondern fördern auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte, die für eine nachhaltige und gesunde Gesellschaft wichtig sind.




Entgeltliche Einschaltung
BILLA –PIONIER FÜR HEIMISCHE QUALITÄT UND
TIERWOHL
100 % heimisches Frischfleisch, unsere höchsten Tierwohl-Standards – BILLA setzt Maßstäbe für verantwortungsvollen Fleischkonsum. Mit der TierwohlInitiative »Fair zum Tier!« sowie der Bio-Eigenmarke Ja! Natürlich gestaltet BILLA die Zukunft der heimischen Nutztierhaltung nachhaltig mit.
Als einziger Lebensmitteleinzelhändler bietet BILLA seit 2020 Frischfleisch ausschließlich aus Österreich an – egal ob Huhn, Pute, Schwein, Rind, Kalb, Wild oder Lamm. Das Frischfleischsortiment reicht von der Preiseinstiegsmarke Clever über hohe Standards unter dem »Fair zum Tier!«-Siegel bei Hofstädter in konventioneller Landwirtschaft bis hin zu unserer höchsten Bio-Qualität unter Ja! Natürlich.
Frischfleisch in Bedienung zu 100 % in Tierwohl-Qualität
Seit 2023 ist Frischfleisch in Bedienung bei BILLA und BILLA PLUS ausschließlich in 100 % TierwohlQualität. Mit der Bio-Eigenmarke Ja! Natürlich und dem »Fair zum Tier!«-Siegel baut BILLA das Angebot an hochwertigen Fleischwaren laufend aus. BILLA PLUS bietet das größte Tierwohl-Sortiment des Landes. »Tierwohl ist keine Nische mehr, belegen zahlreiche Studien sowie unsere Verkaufszahlen.
Bereits 50 Prozent vom Umsatz des verkauften Fleisches bei BILLA stammen aus unseren TierwohlProgrammen. Tendenz steigend«, so Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.
Ja! Natürlich – Bio-Pionier nach unseren höchsten Standards
Ja! Natürlich setzt seit 30 Jahren Standards, die meist weit über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgehen und strengstens kontrolliert werden. Fleisch stammt ausschließlich von österreichischen Bio-Bauernhöfen, die Tieren ausreichend Bewegungsmöglichkeiten
und Sozialkontakte zu Artgenossen bieten. Bei verarbeiteten Produkten wird auf Geschmacksverstärker und künstliche Aromen verzichtet.
Ja! Natürlich garantiert als einzige Bio-Marke des Landes ganzjährig rund um die Uhr Freilauf für einen Großteil der Tiere und unterstreicht damit die Vorreiterrolle. Einer von vielen Meilensteinen, die die heimische Landwirtschaft nachhaltig prägten: 2001 startete ein
Nachhaltigkeitsexpertin. Orientierung fällt bei BILLA leicht: Frischfleisch kommt zu 100 Prozent aus Österreich. Das »Fair zum Tier!«-Siegel kennzeichnet
Produkte der Eigenmarke Hofstädter mit Tierwohl-Standards in der konventionellen Tierhaltung, die über gesetzliche Vorgaben hinausgehen. So ist es einfach, Fleisch aus verbesserter Haltung zu erkennen. Die Kriterien umfassen mehr Platz, komfortablere Stallgestaltung mit eingestreuten Liegeflächen, Tageslicht und artgerechtes Beschäftigungsmaterial. Die ganze Wertschöpfungskette unterliegt strengen Kontrollen. Mit »Fair zum Tier!« beweist BILLA, dass nachhaltige Tierhaltung nicht teuer sein muss. Zudem gibt es mit der Eigenmarke Clever eine günstige, aber zu 100 % österreichische Alternative für Frischfleisch.
BILLA steht Landwirt:innen am Weg zum Tierwohl-Betrieb zur Seite BILLA sieht es als seine Verantwortung, Bedingungen für heimische

Projekt mit Freilandschweinen im Waldviertel, bis heute ein Vorzeigeprojekt für artgerechte Tierhaltung.
»Fair zum Tier!«: verlässliche Orientierung für bewussten Genuss
Ziel von BILLA ist es, auch in der konventionellen Nutztierhaltung Verbesserungen voranzutreiben. »Wir wollen hier eine klare Vorbildfunktion erfüllen, immer noch macht die konventionelle Tierhaltung einen Großteil der gängigen Haltungsformen aus. Jede kleine Veränderung in diesem Bereich ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung«, erklärt Tanja Dietrich-Hübner, BILLA
Nutztiere nachhaltig zu verbessern: »Die Umstellung in der Produktion und im Angebot gelingt nur durch starke Partner:innen. Langfristige Kooperationen mit österreichischen Erzeugergemeinschaften bzw. Landwirt:innen sind nichts Neues, sondern seit Jahrzehnten gelebte Praxis. Wir wollen weitere Betriebe dazu motivieren, auf Tierwohl zu setzen und die Produktion umzustellen. Wir unterstützen dabei mit garantierter Abnahme, langfristigen Verträgen und fairer Entlohnung inklusive Zuschlägen. Das umfasst auch die Nutzung des gesamten Tieres, also »›nose to tail‹«, betont Tanja Dietrich-Hübner.

Reinhild Frech-Emmelmann ist
Bio –Mehr als ein Trend
EU-Biobäuerin 2024 und Pionierin der österreichischen Bio-Bewegung. Im Interview erzählt die Gründerin von ReinSaat, wie sie die Vielfalt im Selbstversorgergarten ihrer Großeltern nachhaltig geprägt hat.

Reinhild FrechEmmelmann
EU-Biobäuerin 2024, Pionierin der österreichischen BioBewegung und Gründerin von ReinSaat
Frau Frech-Emmelmann, würden Sie sagen, die Art, wie Sie aufgewachsen sind, hat Ihren Karriereweg beeinflusst?
Ja, ich wuchs im Dreiländereck auf und denke gerne an die Zeit im großelterlichen Garten zurück. Damals waren Gemüsesorten wie Brokkoli oder Stielmangold noch unbekannt. 1979 verwirklichte ich mir mit meiner Leidenschaft für vielfältigen Gemüseanbau mit dem Erwerb eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebs in St. Leonhard am Hornerwald auf über 500 m Seehöhe einen Traum.
Mit welchen Herausforderungen waren Sie zu Beginn konfrontiert?
vielversprechendsten Ansätze, um mit den klimatisch schwierigen Bedingungen des Standorts zurechtzukommen. Wir führten Testreihen mit tradierten, frei erhältlichen und Genbank-Sorten durch und bauten wärmeliebende Kulturen wie Paprika und Melanzani an, die im Waldviertel damals kaum gediehen. Das Entdecken des Potenzials einer Sorte ist arbeits-, zeit- und kostenintensiv. Es braucht drei Jahre, um mit der züchterischen Arbeit überhaupt erst beginnen zu können.
eine weitere Vision: Ich sehe meine Aufgabe nicht nur im Bewahren des Alten, sondern auch im Entwickeln des Neuen. Deshalb habe ich 1998 ReinSaat gegründet – mit dem Ziel, auf drei Hektar Eigengrund in biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise genügend Saatgut zu erzeugen, um eine Fläche von 300.000 Hektar zu bebauen.
Was ist die Besonderheit an ReinSaat?
Text
Johanna Yagi
Damals waren wir der erste und einzige Demeter-Betrieb der Gegend. Zu Beginn stellte daher die Suche nach geeigneten Sorten eine große Herausforderung dar. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise bot die
Welche Vision hat Sie zur Gründung von ReinSaat veranlasst? 1995, nach dem EU-Beitritt Österreichs, verschwanden viele traditionelle Hofsorten vom Markt. Als Gründungsmitglied des Vereins Arche Noah habe ich mich einerseits für die Erhaltung dieses althergebrachten Genpools eingesetzt. Andererseits hatte ich
Wir züchten samenfestes, robustes, zu 100 % gentechnikfreies Gemüsesaatgut nach Demeter-Grundsätzen – speziell für den biologischen Profianbau. Nach wie vor ist kaum jemandem bewusst, dass ein Großteil der mit ‚Bio‘ deklarierten Nahrungsmittel im Handel Samen von Hybridsorten entstammt. Diese können sich den aufgrund der Klimakrise veränderten Umweltbedingungen nicht anpassen, sind steril und schaffen somit Abhängigkeiten von jährlich notwendigen Saatguteinkäufen. Die Symbiose aus biologisch gezüchteten Sorten und biologisch bewirtschaftetem Boden schafft Abhilfe. Sie ist resilient, tragfähig und steigert und sichert Ernteerträge.
Das heißt, regenerative Landwirtschaft ist das Stichwort? Ja, die regenerative Landwirtschaft
setzt genau hier an. Der adaptive Ansatz konzentriert sich auf die Gesundheit landwirtschaftlich genutzter Flächen und Pflanzen und erhebt die Bodenbiodiversität zum landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Humusaufbau ist die Devise.
Bei ReinSaat konnten wir unsere Böden mit biodynamischer Kreislaufwirtschaft, Zwischenund Unterfruchtanbau, dem Einsatz tragfähiger Kulturen und angepasster, schonender Bodenbearbeitung nachweislich stärken – und den pH-Wert des ursprünglich sauren Waldviertler Urgesteinsbodens (pH-Wert 4,9) in den letzten Jahrzehnten durch kontinuierlichen Humusaufbau auf 7 und mehr anheben. Jeder verantwortungsvolle Biobetrieb ist dafür verantwortlich, den Wasserund Kohlenstoffhaushalt durch innovative, standortangepasste Ansätze zu verbessern.
Entgeltliche Einschaltung
Wie sollte Ihrer Meinung nach die Zukunft der Nahrungsmittelproduktion aussehen?
Ich sehe großes Potenzial im Trend zu mehr regionaler Nahrungsmittelproduktion aus dem eigenen Garten, zu Marktgärtnereien und solidarischen Landwirtschaftsprojekten. Die Coronapandemie hat ein Umdenken in der Gesellschaft bewirkt. Viele junge Menschen engagieren sich für gesunde, regionale und ganzheitlich nährende Lebensmittel aus kontrolliertem Biolandbau.
Dabei ist die Preisspanne zwischen biologisch und konventionell hergestellten Produkten so gering wie nie. Für die Zukunft wünsche ich mir deshalb ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für biologisch gezüchtetes Saatgut und den Nutzen für die Bio-Landwirtschaft. Information, Leistbarkeit und Verfügbarkeit sind das Ziel!


Die Bedeutung regionaler Kartoffeln für Produktqualität
und Umwelt
Bei Weinbergmaier hat die Qualität des Rohstoffs „Kartoffel“ oberste Priorität. Sie ist entscheidend für den einzigartigen Geschmack und hohen Produktstandard der Pommes.

Warum ist Regionalität für Weinbergmaier so wichtig? Regionalität steht für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Mit heimischen Produkten stärken wir die regionale Landwirtschaft und Produktion, sichern Arbeitsplätze und fördern die Wertschöpfung in Österreich. Zudem gewährleisten kurze Transportwege die bestmögliche Frische der Rohware. Gleichzeitig setzen heimische Landwirt:innen verstärkt auf ressourcenschonende Techniken, die sowohl die Qualität als auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte verbessern.
Welchen Einfluss hat die enge Zusammenarbeit mit Produzent:innen der Region auf Qualität und Nachhaltigkeit?
Die partnerschaftliche Kooperation mit ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben, die strenge Qualitätsrichtlinien erfüllen, garantiert höchste Standards – von der Aussaat bis zur Verarbeitung. Der regelmäßige Austausch stellt zudem eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicher.


Dank moderner Kontrollsysteme und unserer BauernhofGarantie kann lückenlos rückverfolgt werden, woher jede Kartoffel

stammt – vom Feld bis zu den fertigen Pommes. Zertifizierungen wie das AMA-Gütesiegel garantieren darüber hinaus, dass die Kartoffeln aus kontrolliert nachhaltigem Anbau unter Einhaltung höchster Standards stammen.
Welche nachhaltigen Maßnahmen setzt Weinbergmaier?
Durch den Verzicht auf lange Transportwege reduzieren wir CO2-Emissionen. Doch unser Engagement für Regionalität beschränkt sich nicht nur auf Kartoffeln: Wo möglich, setzen wir für unser gesamtes Sortiment auf heimische Rohstoffe und schaffen so eine verlässliche Nachfrage für Österreichs Produzent:innen. Ebenso legen wir großen Wert auf ressourcenschonende Maßnahmen, wie den effizienten Einsatz von Wasser und Energie sowie die kontinuierliche Optimierung der Lieferketten.
Entgeltliche Einschaltung

Urlaub am Bauernhof: Wo Echtheit auf Erholung trifft
Von tierischen Erlebnissen bis zu hausgemachten Köstlichkeiten – bäuerliche Betriebe in Österreich bieten Gäst:innen eine Auszeit mit Mehrwert. Warum das Konzept immer gefragter wird, lesen Sie hier.
Welche Idee steckt hinter Urlaub am Bauernhof (UaB)?
Urlaub am Bauernhof Österreich entstand 1991 aus der Vision, bäuerliche Höfe als Orte authentischer Gastfreundschaft mit Alleinstellung im Tourismus zu positionieren. Regionale Vereine entwickelten sich aber schon früher, ausgehend von der traditionellen Sommerfrische. Gäst:innen sollten das Landleben hautnah erleben, Traditionen entdecken und echte Erholung finden. Unser Konzept verbindet sinnstiftenden Tourismus mit Landwirtschaft und der wirtschaftlichen Stärkung bäuerlicher Familien. Damit schaffen wir ein Erlebnis, das Werte vermittelt, den ländlichen Raum belebt und die bäuerliche Kultur erhält.
Wie gestaltet sich der Aufenthalt für Urlauber:innen? Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich für Betriebe? Für die Gäst:innen bedeutet der Aufenthalt Erholung in der Natur und Begegnungen am Hof, die Sinn machen. Sie genießen regionale Produkte, können in die bäuerliche Welt eintauchen und finden dadurch Entschleunigung. Für die Betriebe ist das ein zweites Standbein neben der Landwirtschaft. Herausforderungen liegen in steigenden Ansprüchen, Digitalisierung, Bürokratie und der Vereinbarkeit mit der Hofarbeit.
Worin liegen die Unterschiede zum klassischen Hotelurlaub?
Beim Urlaub am Bauernhof erleben Gäst:innen den echten Alltag am Hof – mit Tieren, Feldarbeit und hausgemachten Produkten, je nach Art der Bewirtschaftung. Im Gegensatz zum Hotel gibt es oft keine standardisierten Abläufe, sondern authentische Erlebnisse. Vieles ist möglich, nichts ist fix –wegen der bäuerlichen Notwendigkeiten. Landwirt:innen verbinden Landwirtschaft und Tourismus. Das heißt wenig Zeit, viel Einsatz. Doch die Freude, wenn Gäst:innen die harte Arbeit wertschätzen, macht den Unterschied – und stärkt den Betrieb nachhaltig.
Welche Voraussetzungen/Qualifikationen sind nötig, um als landwirtschaftlicher Betrieb UaB anzubieten?
Um Urlaub am Bauernhof anzubieten, braucht es einen Hof mit bäuerlichem Charakter und eine Betriebsnummer, sei es als Grünlandbetrieb, Ackerbau, Weinbau oder Almbetrieb. Auch Landhöfe, die einst bewirtschaftet wurden und ihren bäuerlichen Charme bewahrt haben, können Mitglied sein. Qualität und Authentizität sind entscheidend. Komfort in unterschiedlichen Preissegmenten, Sicherheit und herzliche Gastfreundschaft spielen eine zentrale Rolle.
Eine Zertifizierung nach Qualitätskriterien stellt sicher, dass Standards von Hofgestaltung bis Regionalität eingehalten werden. Erfolgreiche UaB-Betriebe investieren nicht nur in Infrastruktur,



sondern auch in Wissen und Gemeinschaft. Weiterbildung durch Webinare, Fachveranstaltungen oder Austausch mit Kolleg:innen hilft, die Bedürfnisse von Gäst:innen zu verstehen. Persönliche Treffen mit Verein, Funktionär:innen und Mitarbeiter:innen fördern den Zusammenhalt und Erfolg jedes einzelnen Betriebs. Wer sich einbringt, kann den Hof wirtschaftlich absichern, wertvolle Netzwerke aufbauen und von neuen Entwicklungen profitieren.
Welche Trends zeichnen sich für die Zukunft ab?
Urlaub am Bauernhof wird noch gefragter sein, weil er Sinn, Erholung und Authentizität bietet. Da Technokratie und Unsicherheit global zunehmen, wächst auch das Bedürfnis nach Bodenständigkeit, Naturverbundenheit und persönlichen Begegnungen. Nachhaltigkeit, Regionalität und Erholung werden immer wichtiger. UaBBetriebe treffen diesen Zeitgeist erfolgreich, weshalb sie zukunftssicher bleiben. Unterschiedliche Preissegmente bedienen ein breites Publikum. Wer also Freude an Tourismus hat, kann sich mit UaB ein stabiles zweites Standbein aufbauen. Qualität und Individualität sind gefragt, um sich als bäuerliche:r Gastgeber:in zu positionieren und von den aktuellen Trends zu profitieren.
Mehr Infos, wie Sie Mitglied werden können, finden Sie hier: www.urlaubam bauernhof.at/de/ mitglied-werden
Die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft –„Farmfluencer“ Bauernjohny teilt seine Geschichte
Von der Wirtshausküche auf den Traktor und danach gleich weiter auf die Bühne – das beschreibt mein Leben ziemlich gut. Auf Instagram bin ich unter @Bauernjohny bekannt, der Name verbindet meine Leidenschaft mit meinem Spitznamen. Neben Schnitzel- und DJ-Content gibt es auf meinem Account also vorwiegend Inhalte zur Landwirtschaft. Seit zwei Jahren bin ich stolzes Mitglied der @Farmfluencer_at, einer Gemeinschaft österreichischer Landwirt:innen, die in den sozialen Medien authentische Momente der landwirtschaftlichen Arbeit teilen, vom Acker bis in den Stall.
Mein Zuhause ist im wunderschönen Tullnerfeld, wo wir das familiengeführte Wirtshaus in vierter Generation und eine Landwirtschaft betreiben – und alle Generationen mithelfen. So schön wie sich das vielleicht anhört, ist es jedoch nicht immer. Manchmal kracht es auch, vor allem beim Thema Hofübergabe. In meinen Augen sind manch lang angewandte Methoden der älteren Generation längst überholt. Ich würde hier gerne innovativer arbeiten, selbst wenn das Risiko besteht, dass etwas schiefgeht. Im Leben gehören Fehler dazu, nur so kann man lernen. Erfolgreich umgesetzt ist bereits das Lenksystem unseres Traktors. Es ermöglicht mir das zentimetergenaue Arbeiten, ohne mich

großartig konzentrieren zu müssen. Überfahrten, Treibstoff und Pflanzenschutzmittel können dabei eingespart werden – und obendrein sind meine pfeilgerade angebauten Zuckerrüben schön anzusehen. Aufgrund strenger Auflagen ist es für uns aber oft schwer, im Vergleich mit anderen Ländern wettbewerbsfähig zu bleiben. Während beispielsweise heimische Rübenflächen schrumpfen, wird Billigzucker zollfrei importiert.
Österreichs Landwirtschaft lässt sich aber nicht unterkriegen: Wir setzen auf Regionalität, Innovation und Digitalisierung. In diesem Sinn möchte ich mich bei allen Landwirt:innen für ihre ehrliche Arbeit und bei den Konsument:innen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie können mit gutem Gewissen einkaufen und dabei definitiv stolz auf sich sein!
Perspektiven und Herausforderungen für landwirtschaftliche Unternehmen in Österreich

Univ. Prof. Dr. Jochen Kantelhardt
Leiter des Instituts für Agrar- und Forstökonomie am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität für Bodenkultur.

Dr. Andreas Niedermayr
Senior Scientist am Institut für Agrarund Forstökonomie am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität für Bodenkultur Wien.
FOTO: ZVG
FOTO: ZVG
Landwirtschaftliche Betriebe stehen vor großen Herausforderungen, die wirtschaftliche, technologische, ökologische und auch gesellschaftliche Aspekte umfassen. Österreich zeichnet sich durch eine im europäischen Vergleich eher kleinstrukturierte und vielfach vom Nebenerwerb geprägte Landwirtschaft aus, was wesentlich mit der Alpenraum-Lage zusammenhängt. In der Vergangenheit gelang es der heimischen Landwirtschaft, mit innovativen Lösungen erfolgreich auf große Herausforderungen zu reagieren und aus vermeintlichen Wettbewerbsnachteilen innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das wird auch zukünftig gefragt sein.
Wirtschaftlicher Druck und Marktdynamik
Landwirtschaftliche Märkte sind in Europa und weltweit stark vernetzt, was zu einem hohen Wettbewerbsdruck führt. Zudem wirken sich Handelskonflikte und geopolitische Krisen auf die Preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel, aber auch auf die Exportmöglichkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus. Schwankende Preise und volatile Rohstoffmärkte erschweren die Betriebs- und Produktionsplanung.
Digitalisierung und technologischer Wandel
Die fortschreitende Digitalisierung bietet der Landwirtschaft in Österreich große Chancen zur Effizienzsteigerung: Drohnen, Sensoren und KI-gestützte Analysetools ermöglichen präzisere Bewirtschaftungsweisen, schaffen neue Möglichkeiten der Ressourcenschonung und liefern wertvolle
Daten für das betriebliche Management. Die Implementierung digitaler Lösungen erfordert jedoch umfassendes Wissen, hohe Investitionen und wirft Fragen in den Bereichen Datenhoheit und -sicherheit auf.
Klimawandel
Wie die letzten Jahre eindrücklich gezeigt haben, ist auch Österreich vom Klimawandel betroffen. Anpassungsmaßnahmen wie nachhaltige Anbaumethoden, wassersparende Bewässerungstechniken oder klimaresistente Sorten werden zunehmend erforderlich. Darüber hinaus ist die Landwirtschaft angehalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Vor allem die Tierhaltung und auch der Pflanzenbau stehen hier vor großen Herausforderungen.
Gesellschaftliche
Entwicklungen und Agrarpolitik
Vegetarische und vegane Ernährungsweisen spielen eine immer größere Rolle und die Gesellschaft erwartet zunehmend nachhaltige, regionale und klimaschonende Produktionsweisen. Konsument:innen sind jedoch nur eingeschränkt bereit, höhere Produktionskosten durch höhere Endpreise mitzutragen. Landwirtschaftliche Betriebe müssen deshalb Strategien entwickeln, um nachhaltige Produktionsweisen rentabel zu gestalten und veränderte Konsumgewohnheiten zu berücksichtigen. Auch die Agrarpolitik hat eine
zentrale Aufgabe, nämlich die unterschiedlichen Zielsetzungen wie Ressourcen- und Klimaschutz, Ernährungssicherheit und Einkommenssicherung in der Landwirtschaft miteinander zu vereinbaren.
Fazit
Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, müssen landwirtschaftliche Unternehmen auch weiterhin innovative Strategien und Geschäftsmodelle entwickeln. Diversifikation, Investitionen in digitale Technologien, Direktvermarktung sowie Kooperationen mit anderen Betrieben und Branchen sind wesentlich. Es bieten sich aber auch neue Marktchancen, die es zu nützen gilt. Dabei sind Digitalisierung, nachhaltige Produktionsweisen und gesellschaftliche Erwartungen gleichermaßen zu berücksichtigen.

Lidl lohnt sich
Entgeltliche Einschaltung

Wie Startups die Landwirtschaft zukunftsfit machen
Wenn junge Landwirt:innen neue Produkte auf den Markt bringen, hängt ihr Erfolg auch von den strategischen Partnerschaften ab. Zwei Beispiele zeigen, wie Startups von Erste Bank und Sparkassen unterstützt werden.


www.gemuesebaujanisch.at/
Denise, Sie und Ihr Mann Matthias bauen in der Steiermark das Sojagemüse Edamame an. Wie kam es dazu?
Ich bin als Diplomkrankenpflegerin Quereinsteigerin. Mein Mann Matthias ist der erfahrene Gemüsebauer. Als er vor vier Jahren auf der Suche nach einer neuen Kultur war, die in unserem sich spürbar wandelnden Klima gut gedeiht, stieß er auf Edamame. Auf Japanisch bedeutet das Wort „Bohne am Zweig“. Wir starteten einen Versuch auf kleiner Fläche und schnell waren die grünen Sojabohnen unser Lieblingsgemüse. Ich machte daraufhin mit 35 noch eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin und arbeite jetzt in beiden Berufen. Zwischenzeitlich übernahm ich noch die Leitung des Landwirtschaftsbetriebs meiner Eltern, der zuvor verpachtet gewesen war. Zum Glück liegen unsere Betriebe nicht weit auseinander, sodass wir sie gut vereinen konnten.
Was ist die Herausforderung beim Anbau von Edamame?
Wir säen ab Ende Mai aus, da die Pflanze frostempfindlich ist. Die Aussaat läuft mehrere Wochen alle paar Tage, um im August und September immer wieder frische Edamame zu ernten. Das Erntefenster ist also klein: Die Bohnen sind nur ein paar Tage lang schön knackig reif. Dazu kommen


V.l.n.r. Robert Fuchs
Unternehmenskundenbetreuer Sparkasse Oberösterreich, Markus Rott (weißes Hemd) Geschäftsführer, Christoph Rott (blaues Polo) Geschäftsführer Hans-Jürgen Achleitner, Geschäftskunden Agrar Sparkasse Oberösterreich
Verbraucher:innen wussten damals noch zu wenig über das Gemüse und kauften weniger als erwartet. Wir realisierten also, dass wir Edamame in die Köpfe der Menschen bringen müssen. Wieder standen uns die Erste Bank und Sparkassen zur Seite: Bei der #glaubandich STARTUP ACADEMY trafen wir Marketingexpert:innen und konnten uns Wissen aneignen. Jetzt liegt die Umsetzung an uns: Wir glauben an unsere Edamame-Produkte und freuen uns über das langsam wachsende Interesse.











Wassertemperaturen zwischen 26 und 28 ° C. Außerdem fühlt er sich auch bei unserer Fischdichte wohl, das ist der Art eigen: Während der Trockenperioden in Afrika leben die Welse auf engem Raum zusammen. Ihre recht geringen Bedürfnisse erleichtern uns die Haltung.
Inwiefern wirtschaften Sie nachhaltig?
Wir gehen sehr bewusst mit der Ressource Wasser um: Dank unserer Kreislaufanlagen minimieren wir den Frischwasserbedarf. Biofilter bereiten das Fischwasser stetig wieder auf, wie in der Natur. Wir verzichten in der Zucht auf Arzneimittel und Zusatzstoffe. Die Prozesswärme erzeugen wir mit einem Hackschnitzelkessel. Der nachwachsende Brennstoff stammt aus der Region. Zudem nutzen wir Wärmerückgewinnungssysteme. Eine Photovoltaikanlage ist geplant.

Markus Rott (rechts)
Geschäftsführer
Christoph Rott (links)
Geschäftsführer
www.hoffisch.at/ FOTO:
landwirtschaftliche Unwägbarkeiten wie Unwetter oder Tiere, die der Ernte schaden. Mein Mann ist dank seiner Erfahrung zwar sehr gelassen, ich hätte mich aber am liebsten dauerhaft als Vogelscheuche aufs Feld gestellt, um die Krähen vom Aufpicken der frisch gekeimten Saat abzuhalten.
Verarbeiten Sie die Edamame auch weiter?
Ich liebe das Gemüse und experimentiere viel damit. Wir bieten es in unserem Hofladen nicht nur pur als loses oder außerhalb der Saison als tiefgekühltes Gemüse zum Dämpfen an, sondern verarbeiten es auch zu verschiedenen Produkten. Wir rösten die proteinreichen Bohnen z. B. mit Meersalz oder schokolieren sie in Zusammenarbeit mit Zotter Schokolade zu leckeren Snacks. Mit einer Nudelbäuerin mache ich aus Edamame Bandnudeln; und auch Edamame-Hummus biete ich an.
Wie läuft die Markteroberung?
Wir waren 2024 bei einem Treffen für Startups der Erste Bank und Sparkassen in Graz. Dort knüpften wir Kontakte zum Handel und brachten unsere frischen Edamame vom Feld in die Supermarktkühlschränke. Doch die
Christoph, Sie und Ihr Bruder Markus Rott betreiben die HOFFisch Fischzucht in Pötting, Oberösterreich. Wie kam es zur Gründung des Familienbetriebs? Ich liebe angeln und Fische. Mein Vater besaß ein paar Teiche, später habe ich selbst welche gepachtet. Die Idee der Fischzucht lag also nahe. Nach einem Jahr der Überlegungen war mir aber klar, dass in der Region nicht ausreichend natürliche Gewässer mit der nötigen Wasserqualität vorhanden sind, um z. B. Forellen zu züchten. Also entschied ich mich für IndoorFischzucht. Ich baute den alten Schweinestall meines Großvaters um. 2017 fischte ich hier den ersten Fisch. Ich gab meinen Vollzeitjob als Landschaftsgärtner auf und widmete mich intensiv der Fischzucht. Ich fragte meinen Bruder, ob er mir als technischer Zeichner und Planer bei der Errichtung einer größeren Anlage helfen würde, und er stieg mit ins Projekt ein. Wir gründeten unsere HOFFisch GmbH – und 2024 waren unsere Pläne umgesetzt. Heute haben wir eine große Halle mit 13 Mastbecken und rund 30.000 Fischen. Wir kommen im Jahr auf 50 t Fisch. Daneben gibt es ein Hauptgebäude, wo wir den Fisch schlachten und verarbeiten, ihn in unserem Hoflädchen verkaufen und auch direkt zum Verzehr auftischen.
Warum züchten Sie
Afrikanische Welse?
Diese Fischart liefert uns mildes, festes und nahezu grätenfreies Fleisch. Der Afrikanische Wels scheut von Natur aus Licht und mag das ganze Jahr über
Wie haben Sie den Aufbau Ihres Unternehmens finanziert?
Wir haben uns auf einen Finanzberater verlassen, der uns an die Erste Bank und Sparkassen verwies. Die Bank verstand im ersten Gespräch, was wir vorhatten, und unterstützte uns und unsere Finanzierung fortan. Im Rahmen der der #glaubandich STARTUP ACADEMY kamen wir auf verschiedenen Veranstaltungen immer wieder in Kontakt mit Profis für Handel und Vermarktung, die uns mit ihrer Expertise zur Seite standen.

Die #glaubandich STARTUP ACADEMY wartet auf Ihre Idee!
Die #glaubandich STARTUP ACADEMY am Erste Campus Wien bietet Landwirt:innen die Chance, ihre Ideen aus dem Agrarsektor und landwirtschaftliche Erzeugnisse weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Sie haben eine Startup-Idee?
Mit dem folgenden QR-Code können Sie sich auf der Website der Erste Bank und Sparkassen für das kommende Event im Herbst 2025 anmelden:




Entgeltliche Einschaltung
Der Tierwohlstall: Moderne Tierhaltung für Rinder und Schweine
Der Agrarbau-Experte WOLF unterstützt
Landwirt:innen mit langjähriger Expertise und innovativen Lösungen auf dem Weg zu mehr Tierwohl.
Strengere Auflagen bei der Tierhaltung und ein sich veränderndes Konsumverhalten erhöhen die Ansprüche an das Tierwohl. Verbraucher:innen sind bereit, für tiergerechte Haltungsformen mehr zu bezahlen. In Österreich setzen daher immer mehr Betriebe auf diese Art der Tierhaltung. Tierwohl ist dabei massiv von räumlichen und anderen Gegebenheiten abhängig. Entsprechende Stallungen müssen sowohl die Bedürfnisse der Tiere, als auch die Anforderungen der Landwirt:innen berücksichtigen.
Maßgeschneiderte Stalllösungen
Das oberösterreichische Familienunternehmen WOLF gilt seit Jahren als verlässlicher Partner der Landwirtschaft. Auch bei der Planung und Umsetzung von Tierwohlställen können Landwirt:innen auf die Expertise von Wolf Systembau vertrauen. Maßgeschneiderte Lösungen werden so den unterschiedlichen Bedürfnissen von Schweinen und Rindern gerecht. Bei Rindern verbessern Tierwohlställe dank großzügiger Liegeflächen mit Stroh oder gummierten Spaltenböden das Wohlergehen. Außenklimaställe, die Zugang zu frischer Luft und Tageslicht bieten, wirken sich positiv auf das Wohlergehen der Tiere aus. Tierwohl und Klimaschutz gehen dabei Hand in Hand: Eine effektive Ammoniakreduktion erlaubt es, Umweltbelastungen stark zu senken.
Das gilt auch für Schweineställe, wo die Trennung von Gülle und Kot Emissionen reduziert und nachhaltige Bewirtschaftung fördert. Mehr Platz pro Tier, strukturierte Buchten und organisches Beschäftigungsmaterial wie Stroh oder Heu erhöhen das Tierwohl. Offenfrontställe sowie moderne Fußbodenheizung und Güllekühlungen sorgen für angenehmes Stallklima und verbessern Hygiene und Wohlbefinden. Als Vorzeigeprojekt gilt der Tierwohlstall von Familie Holzinger im Hausruckviertel. In Zusammenarbeit mit WOLF entstand ein offener Stall, der allerhöchsten
Tierwohlstandards gerecht wird und mehr als 900 Schweinen eine behagliche Umgebung bietet.
Attraktive Förderungen für mehr Tierwohl Neben der Steigerung des Tierwohls ist die Senkung von Emissionen ein zentrales Anliegen im Agrarsektor. Da Tierwohlställe beides erfüllen, wird ihre Errichtung durch einige Förderprogramme unterstützt. Zum Beispiel sind Außenklimaställe und Entmistungssysteme mit kurzen Reinigungsintervallen besonderes förderfähig. Im Fokus ist auch eine Dachgestaltung, die Tiere vor Wärmebelastung schützt. Bei Neubauten sind daher Wärmedämmung oder Kaltdach erforderlich.
Dachflächen mit PV-Anlage verbessern die Umweltbilanz deutlich, weshalb es hier ebenso attraktive Förderungen gibt. Daneben ist die Ammoniakreduktion wichtig, da es, wenn es in umliegende Naturräume gelangt, in klimaschädliches Lachgas umgewandelt wird. Maßnahmen zur Verringerung der Freisetzung – Harnabfluss, Einstreu sowie Entmistungsroboter und Güllekühlungen – sind daher förderungswürdig.
WOLF Systembau bietet Landwirt:innen nicht nur Know-how zu Förderungen und Auflagen, sondern ist auch ein bodenständiger Partner für die Projektumsetzung. Egal ob bei Agrarhallen, Ställen oder auch Unterbau, Betonbehälter und Silos – Unternehmer:innen und Landwirt:innen vertrauen beim Bau auf die Qualität von WOLF System. Das Traditionsunternehmen aus Scharnstein legt großen Wert darauf, die „made in Austria“-Projekte von der Erstberatung bis zur Fertigstellung mit regionalen Ansprechpartnern in ganz Österreich zu begleiten. Ziel ist es, gemeinsam mit Landwirt:innen qualitativ hochwertige und wirtschaftlich sinnvolle Tierwohlställe umzusetzen – für eine tiergerechte Zukunft der österreichischen Landwirtschaft
WOLF SYSTEM
Ihr starker Partner im Agrarbau.





Seit knapp 60 Jahren ist WOLF Ihr kompetenter Baupartner für Hallen, Ställe und Behälter im Agrarbereich.
wolfsystem.at
Wolf Systembau
Gesellschaft m.b.H.
Fischerbühel 1 4644 Scharnstein



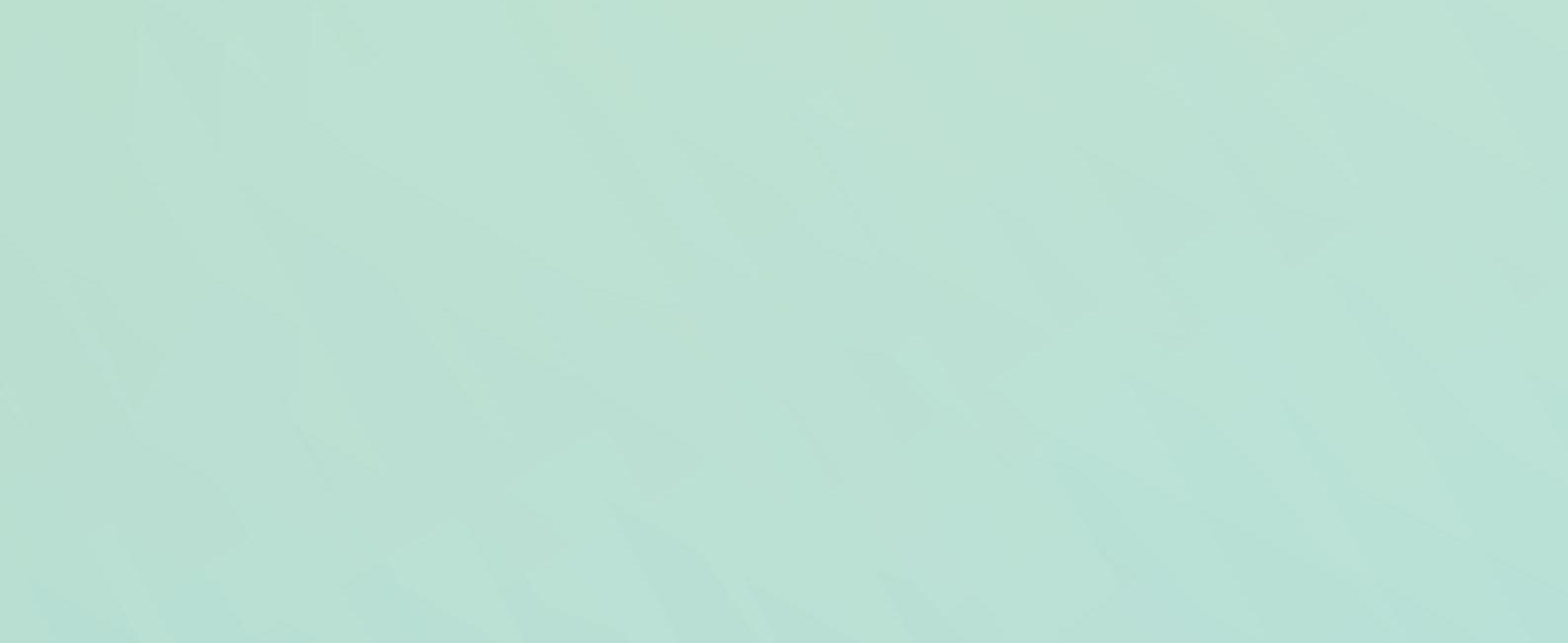






Mein Körper sagt Danke!





Mivolis
Zink + C
Depot
Kapseln
60 Stk.
245 €
0,04 € je 1 Stk.








Mivolis
Vitamin D3
Perlen
60 Stk.
3 €


dmBio
Nusskern
Mischung
200 g
415 €
20,75 € je 1 kg











0,05 € je 1 Stk.


IMMERGÜNSTIG seit 05.2023 2,45 €






IMMERGÜNSTIG seit 01.2025 4,15 €


























€














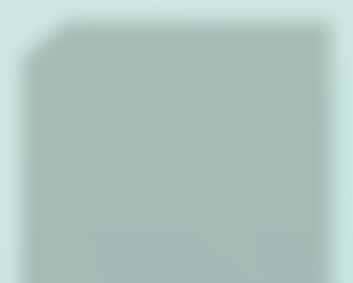








IMMERGÜNSTIG seit 01.2025 3,00 €




















































