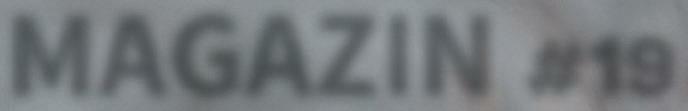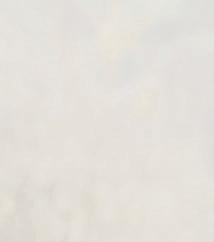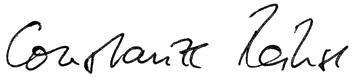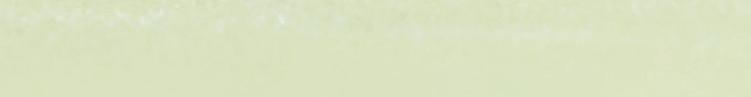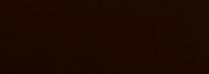MAGAZIN #19

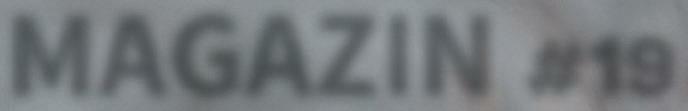
In den Fußstapfen von Mama Interview mit Nico Kertzinger
Der Hund beißt!

Ein Balanceakt mit 42 Zähnen
Eine Dame mit Erfahrung
Independent Spirit´s Isidora: VDH Deutsche Meisterin FH
Sicherheit und Management


VDSV Deutsche Meisterschaft 2022
mit Gewinnspiel & Rabattcoupons

∙ ∙ ∙ Hundesport-Themen ∙ kynolog. Fachbeiträge ∙ Interviews ∙ Produktvorstellungen ∙ ∙ ∙
Februar/März/April 2023
mit praktischer Rückentasche



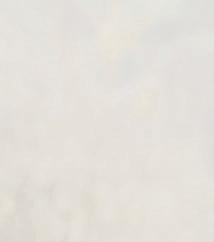








2 Foto: Constanze Rähse
sporthund.de
DOGGER Winterhoodies für ein kuschelig warmes Training oder einfach für schick!
EDITORIAL
Die Zeiten ändern sich. Ständig! Was leider bleibt sind im „Gestern“ verhaftete Meinungen und Vorurteile, hartnäckig und immun gegen Veränderung, selbst wenn die Ursprünglichkeit längst dem Wandel der Zeit erlag. Aktuelles Beispiel: der neue Podcast von Martin Rütter über den Schutzhundesport.
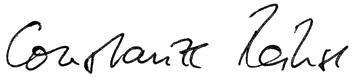
Bei allen Bemühungen der letzten zwei Jahrzehnte, unserer Sportart durch Umbenennungen und innovativer Umgestaltung ein sympathischeres Image zu verschaffen: Es sind die Schubladen geblieben, die scheinbar nach zwanzig Jahren noch immer keine frische Luft gesehen haben.
Wenn Tellerränder Mauern sind, bringen auch Shitstorms in Social-MediaKanälen keine Verbesserung. Wir können nur auf die Selbstverständlichkeit eines Sportes beharren, der uns und unseren Hunden Spaß und Auslastung bietet, der kynologisches Fachwissen und eine Menge Teamgeist erfordert und unsere Hunde kontrolliert das ausleben lässt, wofür sie oft Jahrhunderte gezüchtet wurden.
Autoren dieser Ausgabe
INKA STONJEK lebt in Schweden und arbeitet von dort als freie Fachjournalistin, PR-Beraterin und Konzeptionerin. Inhaltlich geht es bei der Ernährungswissenschaftlerin meist um das große Themenspektrum Essen und Trinken. Mit ihrem 7-jährigen Australian Shepherd ist sie im schwedischen Brukshundklubben u.a. im Agility aktiv.
FRANSI ROTTMAIER ist seit 1997 im Schlittenhundesport aktiv. Die gelernte „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ stieg 2005 als Zeitsoldatin auf die Arbeit mit Dienstgebrauchshunden um. Als Referentin und Beraterin über Aggressionsverhalten, Selbstschutz und Mikromuster-orientierter Verhaltensanalyse machte sie sich europaweit einen Namen.



Nun aber wieder viel Spaß beim Lesen und Rätseln!
Unser Titelbild „Rasantes Teamwork“ zeigt die Begeisterung für Zughundesport bei Musher und Hunden.

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 3
"Dem Hunde, wenn er gut gezogen, wird selbst ein weiser Mann gewogen."
Johann Wolfgang von Goethe (* 1749-1832)
Chefredakteurin SPORTHUNDMAGAZIN
Foto: Constanze Rähse
IN DEN FUSSSTAPFEN VON MAMA

Wenn sich Titel „vererben“ oder Nico Kertzinger dahintersteckt.

Foto: Jan Redder
INTERVIEW: INKA STONJEK
2017 hat die Schäferhündin
DEBBY VOM EISERNEN KREUZ als erste Hündin die WUSV-Weltmeisterschaft IGP gewonnen. Fünf Jahre später steht ihre Tochter im dänischen Randers nun ganz oben auf dem Treppchen: zusammen mit Nico Kertzinger hat NITRA VOM EISERNEN KREUZ wieder den Weltmeistertitel nach Deutschland geholt. Sporthund hat ihn zu seiner Strategie befragt.

Nico, herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel! Wie fühlt sich das an?
Nico Kertzinger: Für mich ist mit dem Weltmeistertitel ein Traum in Erfüllung gegangen.
Wie lief die Weltmeisterschaft für dich ab?
Nico Kertzinger: Wir waren insgesamt zehn Tage unterwegs. Am Samstag, dem 24. September, sind wir nach Dänemark angereist und haben uns abends das erste Mal mit dem deutschen Team getroffen. Der Sonntag war komplett für die Veterinärchecks geblockt, und Montag/Dienstag durften sich alle Teams mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen. Für jeden der insgesamt 122 teilnehmenden Hunde blieben etwa fünf Minuten, die Wettkampffläche zu begehen und die Geräte kennenzulernen. Außerdem wurden die Wettkampftage vorbereitet, also zum Beispiel die Startreihenfolgen ausgelost. Am Mittwoch ging es dann mit dem ersten Wettkampftag los. Ich bin am Mittwoch zunächst in der Fährtenarbeit gestartet, am Freitag im Schutzdienst und am Samstag in der Unterordnung.
Wie glücklich warst du mit deiner Auslosung?
Nico Kertzinger: Es waren im Großen und Ganzen die Startzeiten, die ich mir erhofft hatte. Somit war ich mit dem Los sehr zufrieden.
Nach der Unterordnungssparte standest du auf Platz 1 der Gesamtwertung. Wie groß ist die Anspannung danach, wenn man noch recht lang „zittern“ muss, ob es bei dieser Platzierung bleibt?
Mit 89 Punkten wurde die Arbeit in Sparte B belohnt, dann war schon relativ klar, dass dies für den Titel reichten könnte!
Nico Kertzinger: Die Spannung war kaum zu ertragen! Obwohl Nitra und ich bereits am Samstag mit allen Disziplinen durch waren und wir schon sehr gut vorgelegt hatten, hätten uns drei Starter mit einer sehr hohen Bewertung im „Vorzüglich“ im Schutzdienst noch überholen können. Ich habe mir jeden Kontrahenten, der mir noch gefährlich werden konnte, live im Stadion angesehen und mitgefiebert. Das war bei der gesamten Veranstaltung die größte Herausforderung für mich.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 5 In den Fußstapfen
HUNDESPORT
von Mama!
{ INTERVIEW
}
Foto: Jan Redder
Was hat die Veranstaltung in Randers ausgezeichnet?
Nico Kertzinger: Die Veranstaltung war wirklich in jeder Hinsicht gelungen. Der Ablauf war perfekt organisiert und im Stadion herrschte eine traumhafte Atmosphäre. Die Richter waren anspruchsvoll und streng, haben ihre Linie aber gleichmäßig über alle Wettkampftage beibehalten. Auch die beiden Helfer im Schutzdienst haben einen tollen Job gemacht und alle Hunde gleichmäßig, fair und korrekt gehetzt. Die Teilnehmer selbst waren allesamt hochkarätig. Die Weltspitze ist dicht gedrängt, sodass am Ende immer auch ein bisschen der


Glücksfaktor über den Sieg entscheidet. Aber ich hatte tolle Unterstützung von meinen Teamkollegen. Alles in allem daher eine tolle Erinnerung. Besser geht nicht.
Was waren die Herausforderungen der diesjährigen Weltmeisterschaft?
Nico Kertzinger: Eine Hürde war diesmal sicherlich die Fährte, die anspruchsvoll war und zu einigen Ausfällen geführt hat. Das Gelände war ein abgemähter Strohacker, auf dem zwischen den Stoppeln Gras gewachsen ist.
Nach 100 Punkten (LR: Peter Rohde) im Schutzdienst der BSP erreichte Nitra mit 97 Punkten (LR: Wilfried Tautz) auf der WUSV das beste Ergebnis der Veranstaltung.
Das trifft man so in Deutschland selten an, weil die Stoppeln hier meistens direkt untergepflügt werden. Hinzu kam die Witterung, die im Stundentakt von Sturm über Regen bis hin zu Sonnenschein wechselte. Viele Hunde sind deshalb über die Winkel hinausgeschossen oder hatten Probleme, bei Abbrüchen die Fährte wiederzufinden. Nitra jedoch war souverän, sodass wir mit 95 Punkten die zweitbeste Wertung erzielt haben.
6 Fotos: Jan Redder
Am Freitag haben wir beim Schutzdienst mit 97 Punkten sogar die höchste Wertung der Weltmeisterschaft erhalten. Da konnte Nitra ihre gesamten Qualitäten zeigen: ihre Schnelligkeit, ihre Griffqualität, ihre Führigkeit, die druckvollen Bewachungsphasen und ihre gewandten Angriffe. Nitras Unterordnung am Samstag war von viel Ausstrahlung und Schnelligkeit geprägt, wobei Kleinigkeiten zu Punktabzügen führten und wir mit 89 Punkten bewertet wurden. In der Einzelwertung kamen wir so mit 281 Punkten auf Platz 1, im Team zusammen mit Björn Giesen und Isabell Schmidt wurden wir Zweiter.
Was sind Nitras Stärken?
Nico Kertzinger: Nitra ist ein absolut umgänglicher, klarer Hund. Sie hat ein ausgeglichenes Wesen, ein tolles Sozialverhalten, ist souverän und hat gute Nerven. Das macht sie unkompliziert im Alltag, sodass sie ein toller Begleiter im Sport und Privatleben ist.


Im Wettkampf ist sie aktiv, schnell und ausdauernd, überdreht aber nicht. Nitras Stärke ist also die Ausgewogenheit zwischen Triebverhalten und Gehorsam. Nitra hat erst als zweite Hündin

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 7 In
Fußstapfen
HUNDESPORT
den
von Mama!
Fotos: Jan Redder
2017: Weltmeister
Debby
vom Eisernen Kreuz
HF: Rainer Naschke
Züchter: Nico Kertzinger
2022: Weltmeister


vom Eisernen Kreuz
HF: Nico Kertzinger
Züchter: Nico Kertzinger
überhaupt einen WUSV-Weltmeistertitel im Gebrauchshundesport gewonnen. Die erste Hündin war ihre Mutter Debby vom Eisernen Kreuz, die 2017 bei der Weltmeisterschaft in Tilburg zusammen mit meinem Vereinskollegen Reiner Naschke den Titel geholt hat. Debby vom Eisernen Kreuz stammt ebenfalls aus meiner Zucht.


Damit stehen in der WUSV-Geschichte, die 1988 begann, erst zwei Hündinnen auf dem obersten Podest, beide von dir gezüchtet. Welche Bedeutung hat das für dich?
Nico Kertzinger: Natürlich macht es einen als Züchter besonders stolz, wenn die einzigen beiden Hündinnen, die in der WUSVGeschichte Weltmeister geworden sind, aus der eigenen Zucht
stammen, zusätzlich noch selbst trainiert und vorgeführt. Dieser Erfolg bestärkt mich in meinen Kriterien für meine Zucht.
Welche Parallelen gibt es zu ihrer erfolgreichen Mutter?
Ist Nitra mutter- oder vatertypisch?
Nico Kertzinger: Optisch ähnelt Nitra mehr ihrem Vater Hercules. Aber mit ihrem Arbeitsverhalten und ihrem Wesen ist sie eine Kopie ihrer Mutter Debby. Mit ihrer Belastbarkeit, Schnelligkeit und ihrem extremen Triebverhalten ist sie für mich eine perfekte Mischung aus Vater und Mutter.
Warum gewinnen Hündinnen nicht so oft?
8
Foto: Jan
Foto: Jan
Foto: Claas Posser c-pics
Redder
Redder
Nitra
Nico Kertzinger: Hündinnen wurden in der Vergangenheit überwiegend für die Zucht eingesetzt. Für Wettkämpfe waren sie weniger interessant, da die Welpenzeit eine lange Pause im Sport bedeutet. Der Trend hat sich in meinen Augen geändert. Mittlerweile führen die Züchter ihre Hündinnen auch auf großen Ausscheidungen vor und gewinnen daher heutzutage auch häufiger Titel.
Du hast auch schon mit Justin vom Pendel Bach und Agent vom Wolfsheim zwei Rüden auf der WUSV geführt. Warum jetzt eine Hündin und ist das einfacher/schwieriger?
Nico Kertzinger: Wenn man züchten will, braucht man eine Hündin. Da ich unbedingt aus Debby einen Nachkommen für meine weitere Zucht habe wollte, habe ich mich für Nitra entschieden, die aufgrund ihrer Qualitäten unbedingt auch auf Wettkämpfen an den Start gehen sollte. Wenn die Hunde triebbeständig und belastbar sind, macht es für mich keinen Unterschied, ob man einen Rüden oder eine Hündin führt.
Justin vom Pendel Bach war Nicos erster WUSV-Hund. Mit ihm qualifizierte er sich 2003 als Vize-Bundessieger, wurde dann in Ravenna 18.. Insgesamt waren beide viermal bei der BSP dabei. (linkes Foto von 2005)


Mit Agent vom Wolfsheim war Nico zweimal Starter der BSP. Mit Platz 4 im Jahr 2010 (Foto) qualifizierte er sich auch mit Justins Sohn zur WUSV, wurde in Sevilla 52..
Findest Du es wichtig, dass Züchter auch ihre Zuchthündinnen auf der sportlichen Bühne zeigen?
Nico Kertzinger: Selbstverständlich, denn dadurch kann man einen Einblick in die Qualität der Hunde bekommen. Eine solche Großveranstaltung ist eine enorme Belastung. Aber der Hund mit den höchsten Punkten muss nicht zwangsläufig auch der bessere Vererber sein.
Du hast deine Mutterlinie konsequent auf Justin aufgebaut, obwohl er von anderen Züchtern zu seiner Zeit nicht wirklich „erkannt“ wurde. Wie bewertest du das heute?
Nico Kertzinger: Justin wurde zu seiner Zeit nicht so extrem in der Zucht angenommen, da viele Züchter ein schönes Gebäude oder eine tolle Farbe vor die wirklichen Arbeitsqualitäten gestellt haben. Für mich war Justin aber nicht nur durch seine Arbeitsanlagen und sein Wesen besonders interessant, sondern auch durch seine Blutlinie, was man heute noch durch seine Vererbungskraft sieht.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 9 In den Fußstapfen von Mama! HUNDESPORT
Foto: Constanze Rähse
Foto: Jan Redder
Debby stammt aus einem außergewöhnlich erfolgreichen Wurf: Von ihren vier Wurfgeschwistern waren mit Dinoso und Dina zwei Hunde auf der SV Bundessiegerprüfung und mit Dexter ein Bruder auf der WUSV Weltmeisterschaft dabei. Hat Nitra auch erfolgreiche Wurfgeschwister?
Nico Kertzinger: In Nitras Wurf waren nur zwei Hündinnen und beide haben sehr hohe Qualitäten. Nitras Schwester Nikita steht heute in Amerika, wird dort als Zuchthündin eingesetzt und verfügt bereits über hervorragende Nachzucht.
Wie viel Wettkampferfahrung hat Nitra schon sammeln können?
Nico Kertzinger: Nitra wird im Dezember fünf Jahre alt. Das war ihre erste Saison, in der wir gleich bei fünf großen Wettkämpfen angetreten sind. Unsere Saison begann im April auf der Landesgruppen-FCI in Niedersachsen. Dort haben wir uns mit unserem Sieg für die Bundes-FCI qualifiziert, die im Juni im Langenberg stattgefunden hat. Dort haben wir den zweiten Platz belegt und uns damit wiederum für die VDH Deutsche Meisterschaft IGP im August in Coswig qualifiziert. Unsere nächste Etappe war die Bundessiegerprüfung im September in Karlsruhe, wo wir uns mit einem tollen zweiten Platz schließlich als Vize-Bundessieger für die Weltmeisterschaft in Dänemark qualifizierten.
Wie trainierst du deine Hunde?
Nico Kertzinger: Ich beginne bereits im Welpenalter damit, den Futter- und Spieltrieb der Hunde zu fördern und sie so auf die einzelnen Übungen vorzubereiten. Später werden die einzelnen Übungen zusammengesetzt und durch viele Wiederholungen abgesichert.

Außerdem gehört zu unserem Training in Fährte, Unterordnung und Schutzdienst auch die körperliche Fitness, wodurch wir viele Abende am Baggersee verbringen, um den Hund schwimmen zu lassen oder mit ihm am Rad fahren.
Wie kamst du zum Gebrauchshundesport?
Nico Kertzinger: Ich war als kleiner Junge schon auf dem Hundeplatz und habe mich früh für die Ausbildung begeistert. Mein Vater hatte Hunde, hat aber selbst zeitmäßig nur unregelmäßig mit ihnen trainiert. Mit elf Jahren bekam ich dann endlich meinen ersten eigenen Hund. Von diesem Zeitpunkt an bin ich mit ihm jeden Samstag und jeden Sonntag zum Hundesportverein gelaufen und habe mit ihm trainiert. Wir sind sogar zusammen bei einer Deutschen Jugendmeisterschaft angetreten.
Das war zwar noch nicht von Erfolg gekrönt, aber dort ist der Wunsch entstanden, irgendwann auch bei
Herzlichen Glückwunsch!
10
größeren Meisterschaften erfolgreich anzutreten. Bis heute begeistert mich die Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer, die Lernfähigkeit der Hunde und immer wieder neue Möglichkeiten im Training zu erarbeiten, um besser zu werden.


Seit deinem ersten Auftritt auf WUSV-Ebene 2003 mit Justin vom Pendel Bach hat sich im Gebrauchshundesport viel verändert. Wie hast du diese Veränderung erlebt?
Nico Kertzinger: Die Ausbildung ist auf jeden Fall moderner geworden. Die Ausstrahlung und die Harmonie zwischen dem Team aus Hund und Hundeführer findet immer größere Bedeutung. Heute ist die Ausbildung mehr Detailarbeit, da viele Kleinigkeiten in die Bewertung mit eingehen.

Was wünschst du dir für die Zukunft der IGP?





Nico Kertzinger: Dass uns dieser tolle Sport noch lange in dieser Form erhalten bleibt.

Wie geht es jetzt bei dir persönlich weiter?
Nico Kertzinger: Als Weltmeister sind wir direkt für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert, die im Oktober 2023 in Ungarn stattfinden wird. Aber nun pausieren wir erstmal, denn Nitra ist belegt. Wir hoffen und freuen uns schon auf die schöne und spannende Welpenzeit und auf den Welpen, den wir aus diesem Wurf behalten.
Vielen Dank für das Gespräch!
15%


Hinweis: Einfach den Gutscheincode am Ende deiner Bestellung in das Gutscheinfeld eingeben und automatisch 15% Rabatt auf den Hetzarm RACE erhalten. Nur ein Rabattcoupon pro Person einlösbar. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Der Coupon ist gültig bis 30.4.2023.

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 11 In den Fußstapfen von Mama! HUNDESPORT
CODE: RACE15
in
und
Der
www.sporthund.de Rasant
Design
Technik:
Hetzarm RACE
DER HUND BEISST!

EIN ETHISCHER BALANCEAKT MIT 42 ZÄHNEN
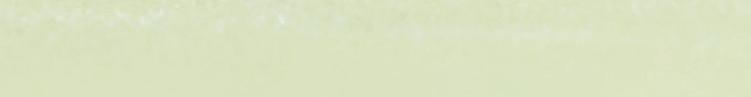
12
Foto: Jan Redder
TEXT: FRANSI ROTTMAIER
Und schon sitzt man mitten in einem argumentativen Dampfkessel: Das Für und Wider einer Hundesportart, deren Verhältnis zu unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung kaum ambivalenter sein könnte.

Niemand möchte in der heutigen Zeit mit „scharf gemachten Beißern“, sadistischen Quälereien, demütigenden Unterwerfungsszenarien im Kasernenhofton und zu egoistischen Imponierzwecken instru-mentalisierten Beutegreifern in einen Topf geworfen werden – ein Label, welches rasch und voller Empörung verteilt wird, wenn ein Hund „gewollt beißt“ und der Mensch dahinter sich auch noch unter sportlicher Motivation zu diesem Frevel bekennt.
Gleichzeitig rückte noch nie so deutlich das Recht zur freien Persönlichkeitsentfaltung in den moralischen Fokus. Dazu gehört auch ein bewusster Umgang mit tabuisierten, kontrovers
diskutierten Themen, die offen gegenüber anderer Komfortzonen fordern: Leben, und leben lassen.
Um überhaupt fundiert in diese Thematik einsteigen zu können, lohnt sich vorab eine sachliche Reflektion des deutschen Tierschutzgesetzes:
„§ 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“
Dieses aktuell so inflationär zitierte, aber oft sinnentstellend angewandte Gesetz ist seit Mai 2002 durch das „Staatsziel des Tierschutzes“, nach Artikel 20a Bestandteil des Grundgesetzes der Bundesrepublik:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.”
Bei aller Motivation und Begeisterung für „beißen“ ist die Wesensgrundlage aller „Gebrauchshunderassen“ der Wunsch nach enger Zusammenarbeit und stabilem Vertrauensverhältnis zu seiner Bezugsperson.
Jeder Gebrauchshundesport, gerade als Zuchtzulassungskriterium in Rassezuchtvereinen, baut auf diesem Wesenszug auf – und deswegen auch der Sport als Zuchtselektiv. Das drangvolle Beißen ist dem untergeordnet!
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 13
KYNOLOGIE
Der Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit 42 Zähnen
Foto: Sven Lober
Das bedeutet, wir sind durch unsere Verfassung zu der Fürsorge aufgefordert, unseren tierischen Mitlebewesen für nachfolgende Generationen noch „Platz zum selbstständigen Atmen“ einzuräumen und zudem zu verhindern, dass sie Dank unserem rücksichtslosen Zutun von der Bildfläche verschwinden. Differenziert wird dabei nicht. Definiert jedoch ebenfalls nicht.
Kollidieren wir nicht jedes Mal mit dieser verpflichtenden Aufforderung, wenn wir – aus unserer egozentrischen Perspektive heraus – darüber entscheiden wollen, welche „Traditionen“ und somit auch deren typischer Hundeschläge aus unserer modernen Welt verschwinden sollen?
Wo beginnt „natürliche Lebensgrundlage“ bei Tieren, die existieren, weil sie sich dem menschlichen Bedarfszweck über viele Jahrtausende angepasst haben, von ihm züchterisch beeinflusst, verändert
– und manchmal quälend entstellt wurden (was wiederum durch den Aspekt „verursachtes Leid“ von dem Erhaltungswert explizit ausgeklammert wird)?
Die Rahmenbedingungen für unser Moralempfinden gegenüber uns anvertrauten Tieren sind klar definiert: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“
Was sie definitiv nicht umfassen, sind eine persönliche Auslegung, Aversion oder Sympathie gegenüber anderen Lebensmodellen, solange einem Tier dadurch nicht ohne durch Vernunft erfassbare Motive besagtes „Leid“ zugefügt wird.
Das Barometer hierfür ist, weil es anders sinnentstellend werden würde, die Wahrnehmung des betroffenen Tieres. Aus-
Es sind die kurzen, „heißen“ Momente von schnellen Bewegungen, Adrenalin und fiebernder Ungewissheit über den Ausgang, die kompetitiven Sport so attraktiv machen. Damit diese Erlebnismomente einen Zugewinn für das Selbstbewusstsein und die Körperfunktionen bedeuten, braucht es einen ausgewogenen Rahmen zwischen Erregung, Regeneration und Selbstbeherrschung.
schließlich. Nicht das persönliche menschliche Befinden bei der Interpretation des Gesehenen. Zur Beurteilung bedarf es also Sachkunde, Objektivität und wesensgerechte Maßstäbe, um nicht in die Falle der emotionalen Projektion zu treten. Faktisch gesehen: Solange ein „Verwendungszweck“ also durch seine Art und konkrete Durchführung für das Tier keine von dem Tier selbst wahrge-

14
Foto: Constanze Rähse
Die individuelle Eignung ist heutzutage keine Rassefrage mehr. Viel mehr geht es um bestimmte Eigenschaften an mentaler und körperlicher Konstitution, die für den Sport Voraussetzung sind: deshalb finden sich immer mehr Exoten, deren wesensgerechte Ausbildung eine Herausforderung an Hundeführer, Helfer und Lehrwart stellt. Das bietet Potential zur Weiterentwicklung für jeden Beteiligten!
Erfolgreichstes Beispiel: Luna Tale Link, der erste Border Collie auf einer FCI IGP Weltmeisterschaft, 2017 vorgeführt vom Belgier Glenn de Bie auf der höchsten Stufe im Gebrauchshundesport.
greifenden Zeitraum übertragen, auch in schriftlicher Form (s. „Prüfungsordnung“).
Diese Sporttradition ist also mehr als dazu geeignet, phänotypische Veränderungen an dazu eingesetzten und zu diesem Zweck gezüchteten Hunden herbeizuführen, was eine Population von „für diesen Gebrauch geeigneter, weil angepasster“ Hunde entstehen lässt.
nommenen Schmerzen, Leiden oder bleibenden Schäden beinhaltet, ist eine pauschale Ablehnung (also ohne Prüfung des Individualfalls) einer Hundesportart mit Berufung auf das Tierschutzgesetz obsolet.
Um den Artikel 20a GG dreht es sich in etwas abstrakterer Form bei der Kontroverse „schützenswerte Tradition“ oder „nicht mehr zeitgemäße, tierleidverur-
sachende Bräuche“, wobei der Filter hiernach im Tierschutzgesetz zu finden ist, nämlich:
„... es ist verboten: (..)
§3.5 ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind.”
TRADITION & GESCHICHTE
Zunächst mal stellt diese Art von Betätigung eine „traditionelle“ Hundesportart dar, kein kurzfristiger Trend, der binnen weniger Jahrzehnte wieder von der Bildfläche verschwindet. Es werden also Handlungsmuster, bestimmte Vorstellungen und damit verbundene Sitten über einen längeren, in diesem Fall mehrere Generationen über-
„Schutzhundesport ist ein Sport für geeignete Hunde“, sagt Klaus Jadatz, Buchautor, Lehrhelfer und Obmann für Gebrauchshundesport im swhv –und trifft damit den Nagel auf den Kopf.
Die individuelle Eignung ist also eine wichtige Grundvoraussetzung, um in diesem Sportprogramm keine tierschutzwidrige Überforderung zu erleiden.

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 15
KYNOLOGIE
Der Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit 42 Zähnen
Foto:
Guss Kersemarkers
Deswegen kann auch nicht ein Hund als Leidempfindender Maßstab herangezogen werden, der aufgrund seiner phänotypischen und individuellen Wesenseigenschaften nicht für den Sportgebrauch „geeignet“ ist – ein großes Problem in der Verhaltensbiologie, denn auf deren Erkenntnisse aufgebaute Argumentationen berücksichtigen meist nicht diesen Mangel an Differenzierung.
Tradition ist ein geflügeltes Wort, sobald sich jemand auf die „Lieblingsbeschäftigung der Gebrauchshunde“ bezieht –schließlich liegt zwischen 1906 und dem Jahr 2019 einiges an verflossener Zeit, seitdem der erste offizielle Schutzhundewettbewerb stattfand.
Übrigens: Wer ebenso „traditionelle“ Stierkämpfe, kommerzielle Kämpfe gegen Hunde oder andere Tierarten, Tanzbären und dergleichen mit nach tierschutzrechtlichen Bestimmungen durchgeführter Sportschutzhun-
deausbildung vergleicht, nur weil deren Gemeinsamkeit in das Wort „traditionell“ mündet, sollte das Tierschutzgesetz aufmerksamer durchlesen: Diese Tätigkeiten sind ausdrücklich verboten (§3.6-8c TschG), lassen sich also nicht mit erlaubter und den Richtlinien entsprechender Ausbildung auf eine Stufe stellen. Das ist schlichtweg bar jedweder Sachkunde.
Die ursprüngliche Tradition des Schutzhundesports lässt sich indes deutlich weiter zurückerahnen als besagte Jahrhundertwende.
Der „gebeißige Hund“ findet schon in antikem Sprachgebrauch seine Nennung – als „Mordant“ leitet sich auch der romanische Sprachraum (hier: altfranzösisch) bezüglich besagter „Beißarbeit“ von der lateinischen Urform ab. Und wir können nur vermuten, dass es den ritualisierten Wettkampf mit im Dienste des Menschen beißenden Hunden schon län-
ger gibt, als das Zeitgeschehen in antikem Latein verewigt wurde.
verwendet) nicht mehr „Homme d’attaque“, sondern viel mehr „Homme d’assistant“.
Dabei sticht jedoch eine Besonderheit ins Auge: „canis mordax“ wird in Lexika explizit dem „Hirtenhund“ zugeordnet, nicht etwa einem Kriegs- oder Kampfhund. Und das bereits in Steinbachs „Germanico-Latinum“ von 1734, lange vor der offiziellen Entstehung des „Schäferhundes“ in seiner heutigen Form.
Zeitgenössischer Sprachgebrauch
bietet immer interessante Hinweise auf sich verändernde Wahrnehmung innerhalb gesellschaftlicher Prozesse, wenn es auch nicht gerade wissenschaftlicher Beweisführung dient:
In jüngerer Entwicklung wird das „Beißen“ zu „Beschützen“ („protection work“ (BE/AE.), „Schutzdienst“ (DE)) – und plötzlich heißt der offizielle Sparringpartner unserer „gebeißiger Hunde“ (im französischsprachigen Raum besonders im Ringsport
Wo der „Angreifer“ in der „Mannarbeit“ relativ selbsterklärend ist (im Deutschen der urtümliche Begriff „Scheintäter“ als aufzuhaltender Angreifer), bedarf es zum „Helfer“ eine weiterführende Definition:
Der „Mann“ hilft dem Hund und dem Wettkampfgeschehen, indem er sich an seine „Statistenrolle“ hält – auch „Figurant“ ist wenig schmeichelhaft eine von Statisten besetzte „Randfigur“ des Geschehens. Dass unsere Schutzdiensthelfer sich davon nicht wertgeschätzt fühlen, dürfte nachvollziehbar sein:
Der „Assistant“ muss letztendlich auch Trainer und Lehrender sein, denn er ist derjenige, der das vierbeinige Nachwuchstalent an die Feinheiten, Raffinessen und Spielregeln des Vollkontakt-Wettkampfes heranführt.
16
Von lapidarer Randfigur kann da also gar keine Rede sein!
Anzumerken wäre aber an dieser Stelle, dass im Ringsport der Zweibeiner an der Seite des „Gebeißigen“ seinen „Canis Mordax“ in den Wettkampf geleitet –nicht etwa „führt“. Hauptakteur ist also der Hund, nicht die beteiligten Menschen, auch wenn Kritiker gerne den Schutzhund als „Sportgerät“ abwerten.
Folgt man dieser Spur in den deutschen Sprachgebrauch, hat sich der „Schutzhundesport“ zu „Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde“ entwickelt. Man möchte also die Assoziation mit „Beißen“ und martialistischem „Schützen“ als potentielle Gewalttätigkeit verhindern und den Charakter eines „Sports“ herausstellen. Rechtmäßig bedarf es tatsächlich einer klaren Differenzierung des „Zwecks“ der Ausbildung – was in Folge schnell zu „typisch deutscher“ Kleinkariertheit ausufert.

Damit kommen wir zurück zur
Tradition:
Der Schutzhundesport ist unbestreitbar ein Kulturgut und erfüllt zudem alle notwendigen Qualifikationen zum „Sport“.
Es klingt grotesk. Prädikat: „schützenswert“ für etwas in seiner Natur „Schützendes“, das sich aber nicht so nennen darf, um keinen gesellschaftlichen Affront zu erzeugen?
IST DAS „ GEBEISSE“ DENN NOCH ZEITGEMÄSS?
Eine ganze Menge an Hundefreunden steht an dieser Stelle nun auf und schreit inbrünstig: NEIN! Das gehört abgeschafft! Das ist ein gewaltverherrlichender Rückschritt unserer gesellschaftlichen Ideale!
Führerverteidigung im Ringsport: heutzutage wird aus dieser ehemals dienstlichen Aufgabe (der Hund als Mittel zum Selbstschutz) ein hochstilisierter Wettstreit um Konzentration, Selbstbeherrschung und schauspielerischem Talent seitens des „Homme Assistant“ mit dem geprüften Hund.
An dieser Stelle ein Perspektivwechsel auf die „Makroebene“ unserer Gesellschaft.
Wir kennen dieses ambivalente Verhältnis auch aus anderen „Vollkontaktsportarten“ – populär ist beispielsweise der Boxsport. Das mag jetzt für leidenschaftliche Hundesportler ein merkwürdig anmutender Vergleich sein: Wir räumen dem „Hundeln“ sicherlich einen anderen Stellenwert ein. Schließlich handelt es sich nicht um zwei testosteronumnebelte Muskelpakete, die sich in einem Ring gegenseitig auf die Rübe hauen und dazu noch vom Publikum bejubelt werden. Wer tut sowas freiwillig? Und weiß nicht jedes kleine Kind, dass „Schläge an den Kopf“ dumm und viehisch machen?
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 17 Der
42
KYNOLOGIE
Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit
Zähnen
Foto: Constanze Rähse
Auf einem Hundeplatz stellt sich ein idealerweise bestens trainierter, athletischer „Figurant“ einem idealerweise ebenso trainierten „Vieh“ mit gebrauchshundetypischem Napoleonkomplex und streitet nach genauestens festgelegtem Regelwerk um ein Stück Plastikrohr mit einem ergonomischen Beißkeil und zahnfreundlichem Juteüberzug. Dabei legt das Regelwerk fest, dass der Zweibeiner eigentlich „immer“ verliert. Das „Verlieren“ ist wichtig, damit der Hund eine belohnungsorientierte Motivation für seine Teilnahme bekommt, da man ihm ja schwerlich Preisgeld auf ein Konto einzahlen kann.
ABER ein Punkterichter entscheidet, was für Haltungsnoten der eifrige Vierbeiner mitnimmt. Die Punkte sind dann für den Hundeführer, der im Grunde genommen am Rand steht und innerlich mit unbewegter Miene (Führerhilfen sind Regelverstöße!) die Daumen drückt, dass seine
Trainingsstrategien zum Punkteregen führen. Damit unterscheidet er sich allerhöchstens im finanziellen Ertrag vom BoxCoach.
über den Zeitraum mehrerer Jahrhunderte, ging mit dem Untergang eines Großreiches und damit in Verbindung stehendem Sittenverfalls einher.
Diktatur kam das „Boxen“ als Jahrmarktsattraktion ganz ohne Zutun wieder an die Oberfläche – nach über tausend Jahren.
Wäre das umkämpfte Teil rund und befänden sich mehr Kontrahenten auf dem Platz, hieße es vermutlich „Hundsball“ und der Hund im Tor wäre der glücklichste „Balljunkie“ der Welt.
Boxsport sei laut „Homer“ seit 688 vor Christus offizieller Bestandteil der Olympischen Spiele, also der kulturellen Sportdefinition schlechthin. Natürlich müssen auch da Grenzen gezogen werden, denn Gladiatoren in Arenen mit tödlichem Ausgang gegen „wilde Tiere“ antreten zu lassen und blutrünstige Faustkämpfe mit metallbeschlagenen „Schlaghandschuhen“ verfehlen irgendwann die sportliche Zielsetzung zugunsten der Volksbelustigung. Außerdem ist die gesundheitliche Halbwertszeit der Kämpfer dadurch eher begrenzt. Aber diese Fehlentwicklung vollführte sich
Und nicht der Boxsport wurde von Kaiser Theodosius schlussendlich verboten, sondern die „Olympischen Spiele“ als solches und damit auch jeglicher sportlicher Wettkampf, der überhaupt keine kämpferische Auseinandersetzung beinhaltet. Diente dieses Verbot dem Schutz der Gesellschaft vor der endgültigen Verrohung? Nein. Es hing mit der rasanten Ausbreitung des christlichen Glaubens zusammen. Vergnügen zum Selbstzweck und „heidnische“ Traditionen sollten tunlichst aussterben. Dass das „finstere Mittelalter“ auch gänzlich ohne Boxsport genügend Gewaltpotential und Verrohung zu bieten hatte, brauchen wir an dieser Stelle nicht im Detail zu erläutern. Erst Ende des 17. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung und Abkehr von religiöser
Der nach modernen Maßstäben reglementierte Boxsport ist etwa 20 Jahre älter als der „Deutsche Schäferhund“ und ziemlich genau 39 Jahre später fand der erste Schutzhundewettbewerb statt.
Wenn man also beiden „Vollkontaktsportarten“ einen archaischen Rückschritt in der gesellschaftlichen Moralentwicklung anlasten will, unterliegt man einem Irrtum. Auch und gerade der Schutzhundesport war maßgeblich daran beteiligt, aus dem „Nutzvieh“ Hund mit Wächtereigenschaften das Image eines mit bewundernswerten Talenten ausgestatteten Mitgeschöpfs zu kreieren. Er wurde von der antiken „Kampfbestie“ aus Gladiatorenzeiten zu einem vollwertigen Sportkameraden des Menschen, welcher fähig ist, sich durch sorgfältige Ausbildung an sportliche Regeln zu halten und
18
seine „animalischen Gelüste“ dafür zu beherrschen. Genau das wurde Tieren lange abgesprochen, da es als „Errungenschaft der menschlichen Entwicklung“ gilt. Und es braucht tatsächlich kombative Sportarten, um diesen Entwicklungsschritt und die kognitive Leistung dahinter zu verdeutlichen.
Damit landen wir wieder bei Klaus Jadatz, der sich für den Erhalt der Schutzdienstarbeit ausspricht:
„Triebanlagen werden gefördert, kontrolliert und abwechselnd hoch im Trieb und dann Ruhephase gestaltet. Insofern eine durchaus schützenswerte Sportart.“
Wir erinnern uns? Geeignete Hunde hatten viele Generationen Zeit, sich an die speziellen Belastungen anzupassen. Durch diese Anpassung findet man Charaktere, denen die Aufgaben nicht nur leicht fallen – sie haben auch alle Voraussetzungen, bei der Erfüllung Lust zu empfinden.
Das bedeutet, sie bedürfen keiner extrinsischen Motivation, um ihre Energie für die Aktivität zu verwenden.
Damit fällt ein eklatanter Kritikpunkt weg: kein zu seiner Leistung mit Gewalt gezwungener Hund schafft es in den heutigen Tagen noch, sich gegen seine „geeigneten“ Artgenossen durchzusetzen. Das hält auch den skrupellosesten „Hundeverschleißer“ davon ab, seine Zeit mit der Misshandlung eines solchen Kandidaten zu verbringen.
Letztendlich handelt es sich dabei um eine populistisch fest etablierte Worthülse, die ein an sekundäre Handlungsschemata geknüpfte Erregbarkeit und Fokussierung in einem Kontext zu bestimmten Auslösern beschreibt. Damit diese komplexen, neurobiologischen Vorgänge leichter verständlich werden, hat man sie in feste Begriffskörper gezwängt: das fachlich veraltete, aber populär im Gebrauch befindliche Triebmodell.
WAS GENAU TUT EIN HUND IM „ SCHUTZDIENST“ EIGENTLICH?
Selbstbeherrschung in höchsten Erregungslagen – das ist eine wertvolle Übung für hochreaktive Hunde. Um das zu absolvieren, müssen sie stets kognitiv Herr ihrer selbst bleiben.
Im Sport wird gerne der kynologisch als überholt geltende Begriff „Trieb“ verwendet.
„Schäferhunde“ gehören zu der FCI-Kategorie der Hüte- und Treibhunde. Damit zählen sie zu einem Schlag Hunde, der sich kooperationsbereit, wachsam, leicht erregbar, bewegungsfreudig und mit ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten ausgestattet zeigt – schließlich muss der „Hütehund“ nicht nur ein überragendes räumliches Verständ-

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 19
42
KYNOLOGIE
Der Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit
Zähnen
Foto: Jan Redder
nis besitzen, seine Erregungslagen blitzartig modulieren, die Reaktionen der Schafe auf seine Bewegungen kalkulieren, sich schnell und ausdauernd bewegen und dann auch noch auf die Signalgebungen des Hirten konzentrieren. Das muss auch ein Mensch kognitiv erstmal zustande bringen.
Weil der Hütehund dafür alle notwendigen Voraussetzungen mitbringt, kann er in der Bewältigung dieser Aufgaben Befriedigung verspüren. Dazu kommt der Faktor Mensch: die Zufriedenheit des Menschen über den gemeinsamen Erfolg überträgt sich auf den Hund und fördert die Festigung einer vertrauensvollen Beziehung.
Was nicht so eindeutig geklärt ist, wie wir uns das vorstellen –verspürt der Hütehund tatsächlich eine „Jagdmotivation“, oder handelt es sich nicht viel mehr um eine extrem erweiterte Form von Kontrollverhalten auf kooperativer Basis, welches
sich ebenso auf Objekte oder Raum ausdehnt? Bislang galt das „Hüten“ als isolierte Form von Jagdsequenz. Da jedoch die Arbeit auf dem Platz von vorne rein mit Begriffen wie „Beutearbeit“, „der Hund jagt gerade“ oder „wir fördern den Beutetrieb“ belegt wird, ist eine objektive Betrachtung schwierig. Es gibt Hinweise, dass diese Begriffe nicht im verhaltensbiologischen Sinne zutreffen.
Der Schutzhund auf dem Hundeplatz kanalisiert eher sein Interesse an einem Objekt auf den Kontext „Helferarbeit“. Objektspiel ist auch bei wildlebenden Caniden weit verbreitet, jedoch lässt sich nicht jeder Hund dafür begeistern.

Die sachkundig durchgeführte Ausbildung zum Schutzdienst ist sehr „technisch“ – der junge
Milimeterarbeit! Erst das Überschreiten einer vordefinierten räumlichen Grenze erlaubt dem Hund den Zubiss – egal, welche aufreizenden Bewegungen der Helfer vorher macht. In dieser Übung zeigt sich, welche komplexe Wahrnehmung und Verknüpfung ein Hütehund mit seiner Umgebung macht – was einst durch die „Herdeneignung“ in einem natürlichen Selektionsprozess gefestigt wurde.
Hund lernt Griff- und Einsprungtechniken, um den vorgeformten Beißwulst optimal greifen zu können. Wir bezeichnen es als „Beutearbeit“. Objektiv betrachtet ist es eine Form von „Objektspiel“ mit der Intention, Kontrolle darüber zu erlagen. In der Art, wie ein Hund sein mühsam errungenes „Zielobjekt“ herumträgt und vor Anwesenden präsentiert, lässt sich eine soziale Komponente
20
Foto: Constanze Rähse
Für sportliche Belastung benötigt der vierbeinige Athlet entsprechende Vorbereitung – hier beim Üben von Einsprungtechniken. Koordination und Schnellkraft werden abgefragt!
erahnen: je mehr ein Hund in der Tragephase gelobt und bewundert wird, desto höher seine Motivation, das Objekt bei der nächsten Runde zurückzuerlangen.
Das, was Klaus Jadatz im Sinne von „abwechselnde Trieblagen“ meinte, beschreibt die ursprünglichen Talente eine Hütehundes: die hervorragende Selbstregulation, mit der die Hunde blitzartig von primären „Erstreaktionen“ auf sekundäre, an funktionale Verhaltenstechniken gekoppelte Emotionen umspringen können.
Leslie Greenberg hat diesen Mechanismus an der York Universität in Kanada beim Menschen erforscht und herausgefunden,
dass wir damit Reize bis hin zu ausgewachsenen Lebenskrisen bewältigen – die Arbeit damit wird sogar in der klinischen Verhaltenstherapie angewandt.
Tatsächlich wurde bereits 2007 in einer Studie über Stressbelastung bei Diensthunden an der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr durch Silke Pauly nachgewiesen, dass der „Schutzdienst“ für die dort un-
tergebrachten Hunde durchweg positive, stabilisierende Eigenschaften bot.
Ein überraschendes Ergebnis, ging man bis dato davon aus, dass es sich durch „übersteuerte“ Sequenzen von Jagdverhalten oder gar wehrhafter Aggression im Sinne von Selbstschutz eher um Stressoren handle.
Empirisch betrachtet kennen wir viele Fälle, in denen Hunde mit starken Impuls- und Selbstre-
gulationsschwierigkeiten durch objektbezogene Arbeit mit einem Schutzdiensthelfer zu mehr Stabilisierung und selbstkontrollierterem Verhalten gefunden haben.
Das bestätigt auch Conny Munz vom „Club Canin Dog’s World“ in Ostbelgien, langjährige Diensthundeausbilderin für Militär und Polizei. Sie ist seit über vierzig Jahren im belgischen Ringsport unterwegs: „Wir haben unzählige Malinois, die von unbedarften Familien aufgenommen wurden, überhaupt keine wesensgerechte Behandlung erfuhren und dann bereits in jüngstem Alter mit Unruhe und Aggressionsproblematiken zu uns in den Verein kommen –mit der Bitte um Hilfe. Im Schutzdienst lernen diese Hunde ohne viel Gewalt oder komplizierte Therapie, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ihre wütenden, ängstlichen oder überschwänglichen Energien ohne unkontrollierte Ausbrüche auszuhalten und durch bewusste

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 21 Der
42
KYNOLOGIE
Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit
Zähnen
Foto: Sven Lober
Strategien mit ihrem Hundeführer zusammen an ihre Belohnung zu kommen. Das reicht in den allermeisten Fällen aus, um diese anfangs schwierigen „Wilden“ zu entspannten und zu gerne-mit-Menschen-arbeitenden Partnern zu machen.

Es gibt wenige Fälle, bei denen echte krankhafte Störungen zugrunde liegen – meist wird es einfach nicht gefördert und sich dann gewundert, dass sich der Schäferhund unerwünschte Methoden sucht, um mit sich selber klar zu kommen.“
Wer in diesem „heilsamen“ Prozess eine besondere Rolle spielt, ist der „homme d’assistant“, „figurant“ oder Schutzdiensthelfer.
Da haben wir die längst überfällige Würdigung!
Klaus Jadatz, der für den swhv Kurse und Weiterbildungen im Bereich Helferarbeit organisiert und auch durchführt, bringt eine „gute“ Helferarbeit mit Prädikaten wie:
Feingefühl
gute Analysefähigkeit
psychisch schnelles
Reaktionsvermögen
körperlich schnelles
Reaktionsvermögen in Verbindung. Im Grunde genommen sind diese der Spiegel zu den Fähigkeiten eines Schäferhundes.
Das ist auch nötig: Um sich anpassen zu können, benötigt der Organismus zunächst einen adäquaten Stressreiz. Dazu muss der Helfer nicht nur empathisch, sondern auch kognitiv in der Lage sein, seinem vierbeinigen Schützling genau die Anlässe zu bieten, die dieser für eine günstige Lernverknüpfung benötigt.
Wie viel Fingerspitzengefühl das bedarf, zeigt Ina ZieblerEichhorn auf: die Tierärztin
leitet das Hundezentrum Pfalz, bildet europaweit hochkarätige Mantrailer aus – und zieht in naher Zukunft die dritte Generation Wölfe im Kurpfalzpark groß.
Sie mahnt aus veterinärmedizinischer Sicht zur Vorsicht, wenn es sich um den Umgang mit Welpen dreht: in diesen sensib-
len Entwicklungsphasen kann der Serotoninhaushalt und die Produktion von Cortisol aus den Fugen geraten, wenn der Welpe längerfristig überreizt oder massiv überfordert wird. Das kann zu ernsthaften Fehlentwicklungen in den Gehirnbereichen führen, die für Verhaltenskontrolle zuständig sind
22
Foto:Jan Redder
Athleten im Wettstreit: Ein besonderes Merkmal von sportlichem Wettkampf ist die Verpflichtung zur gegenseitigen Fürsorge. Weder darf der Hund das „ungeplante“ Handicap des Helfers ausnutzen, noch darf der Schutzdiensthelfer durch seine Ausgleichsbewegungen den ihm vertrauenden Hund verletzen!
– oder spätere Beeinträchtigungen in der Stressregulation provozieren.
„Gut aufgebauter Schutzdienst ist kein Problem für einen gesunden Hund und hat durchaus positive Auswirkungen – die Schwierigkeit liegt an den praktizierenden Menschen und deren Unvermögen, sich auf die Entwicklungsphasen eines Welpen oder Junghundes einzustellen. Ein erwachsener Hund hat ganz andere Bewältigungsmechanismen als der Welpe. Auch ein Junghund sollte nicht in Erregungszustände gebracht werden, die er entwicklungsbedingt noch nicht verarbeiten kann. Dann beginnt Überforderung bei undurchdachtem Aufbau.
Wenn ich ein „Aus“ verlangen will, muss ich die kognitive Leistung dahinter erkennen und einen entsprechenden Übungsaufbau wählen. Und zwar bevor hohe Erregungslagen oder Ablenkung dazu kommen.
Der Junghund muss ja erst mal über ausreichend Selbstregulationsmechanismen verfügen. Und da sehe ich leider viel, was deutlicher Verbesserung bedarf. Das müsste sorgfältiger geschult werden. Vor allem was die Beobachtungsgabe der Verantwortlichen betrifft.“
Richtungsweisende Worte, was die Zukunft des Schutzhundesports anbelangt: es sind essentielle Grundlagen der Sportpädagogik, die sich mit der besonderen Verantwortung und deren gerecht werdenden Übungen für noch heranreifende Persönlichkeiten beschäftigt –und auf einen spielerischen, zur neugierigen Selbsterprobung einladenden Rahmen verweist.
Der Junghundeaufbau ist der sensibelste Teil der gesamten Helferarbeit.
„Diese Helfer müssen besonders gut geschult sein, neben Sensibilität auch viel praktische Erfahrung in der Hundeaus -
bildung und zudem einen gefestigten Charakter besitzen“, sinniert der erfahrene Lehrhelfer Klaus Jadatz: „Leider fehlen hier des Öfteren Verantwortliche, die solche Talente an einem Helfer erkennen und angemessen fördern. Teilweise mutieren ungeeignete Schutzdiensthelfer zu Selbstdarstellern und beschädigen somit die positiven Anlagen des Hundes und zusätzlich die gesamte Ausbildung der Hunde.“
Ein eindringlicher Aufruf, der eines zeigt: auch der Hundesport ist nicht von gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen gefeit.
Christina Trache, die nicht nur über 45 Jahre aktiv die Entwicklung im deutschen Schutzhundesport mitverfolgt hat, sondern nebenbei auch Arbeitshunde züchtet, ist von Beruf psychologische Beraterin. Bei dem Stichwort „mutierte Selbstdarsteller“ stellen sich ihr mit wiederkehrender Häufigkeit die Nacken-
haare auf: „Zu keiner anderen Zeit wurden wir so häufig mit Menschen konfrontiert, die ihre Bedürfnisse unmittelbar befriedigt sehen wollen, Geduld oder schlicht Rücksichtnahme als unzumutbar befinden und mit einer derart unrealistischen Selbsteinschätzung zur Tat schreiten, dass ein Scheitern geradezu vorprogrammiert ist“, berichtet sie aus ihrem beruflichen Alltag.
Und dann kommen die unweigerlich folgenden aggressiven Beschuldigungen oder intrigante Ablenkungsmanöver dazu, die gerade in einem Verein schnell zu Spannungen und zerstörtem Vertrauen führen. Das ist kein Phänomen des Hundesports, sondern ein gesellschaftlich immer größer werdendes Problem.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gebrauchshundearbeit für viele nicht mehr so attraktiv ist, weil es genau um diese Punkte geht: Geduld haben, sich konzentrieren, für ein Erfolgserlebnis
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 23
42
KYNOLOGIE
Der Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit
Zähnen
arbeiten und dafür Anstrengung oder Kritik in Kauf nehmen, zudem muss man mit Frustrationen und Konkurrenz umgehen lernen.
Letztendlich ist der Schutzhundesport eine Teamarbeit, in der es um Sozialkompetenz, Vertrauen und gegenseitigen Respekt geht. Da haben gewissenlose Selbstdarsteller keinen Platz.“
Tatsächlich richten besagte „Selbstdarsteller“ in den Reihen des Sports großen Schaden an. Nur – welcher ist das überhaupt?
Im Grunde genommen gehört die Selbstdarstellung zu einer notwendigen Selbstinszinierung, die unser „soziales Image“ bedingt –also die Art, wie wir von unseren Mitmenschen wahrgenommen und demzufolge auch behandelt werden. Da gibt es keine „Faustformel“, da die Schwelle zur Zufriedenheit bei jedem anders liegt.
Der Schutzhundesport ist allerdings ein sensibles Thema, da auf gesellschaftlicher Ebene viele Ängste oder auch unangenehme Erfahrungen projektiert werden. Dann bietet ein kompetitiver Sport mit „Vollkontakt“, aufregenden Sequenzen und emotionaler Beteiligung sehr viele Anlässe, um gezielt Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erhalten. Das ist die menschliche Natur, wir praktizieren diese Art der „Heldenverehrung“ schon immer – und manchmal ist es auch ein gesundes Ventil für soziale Missstände, die einzelnen Betroffenen helfen, sich davon zu befreien.
Manche Persönlichkeiten haben jedoch ein größeres Bedürfnis nach Anerkennung, als sie Kraft ihrer Leistung und ihrer Kompetenz erringen können. Und da „scheiden sich die Geister“. Die einen gehen den mühsamen Weg, über Selbstreflektion, überwundene Krisen und stete Verbesserung ihre Erfüllung zu finden. Andere suchen „schnel-
le“ Erfolge – und täuschen mehr Kompetenz vor, als sie sich erarbeitet haben. Das kann schnell krankhafte Formen annehmen: manche dieser „Selbstdarsteller“ investieren unglaublich viel Energie darin, sich durch theatralische Geschichten oder geschicktes Ausnutzen von fehlender Erfahrung in ihrem Umfeld in eine unangemessen erhöhte Position zu bringen.
Tatsächlich bietet sportliches Reglement eine Art Schutzfunktion, welche auch in der Hundezucht zum Tragen kommt: ausgelegt auf Kooperation, Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenzen macht eine Orientierung an „Regelwerken“ schnell sichtbar, welche Persönlichkeiten sich überhaupt daran anpassen können. Auch in diesem Feld besitzt der Schutzhundesport eine erstaunliche Ähnlichkeit zu traditionellen Kampfsportarten – die oft hart erscheinenden Verhaltensregeln haben unter anderem den Zweck, für die Gemeinschaft
„ungeeignete“ Charaktere herauszufiltern. Das mag abschreckend klingen, dass derart radikal über die Zukunft von Menschen entschieden wird.
Aber es handelt sich dabei um Ausbildungen, die man in verantwortungsbewussten Händen sehen möchte. Auch die Unfallverhütungsvorschriften der VBG
(DGUV Vorschrift 23 §12) weisen bezüglich Diensthunden darauf hin, dass Hunde nicht eingesetzt werden dürfen, die „zu Bösartigkeit neigen“ oder sich nicht „dem Hundeführer zweifelsfrei unterordnen“. Ebenso benötigt der Hundeführer Befähigungen, unter anderem auch psychische Eignung und persönliche Zuverlässigkeit.
Im Schutzhundesport wird die „Abteilung B“, also die „Unterordnung“, gerne als demütigende Dressur verurteilt. Vor dreißig, vierzig Jahren sah die grobe Herangehensweise und das unterdrückte Mitlaufen der Hunde tatsächlich nicht son-
24
derlich sympathisch aus. Auch nicht das häufige Anreizen in Selbstschutzbereichen.
„Aber wir hatten damals deutlich weniger Schwierigkeiten mit unkontrolliert aggressiven Hunden – und die Kandidaten, die sich in Aggressionsbereichen überhaupt nicht geregelt bekamen, landeten bei Polizei oder Bundeswehr bei erfahrenen Spezialisten und in Aufgabenbereichen, in denen sie ihre für das zivilisierte Zusammenleben ungeeigneten Tendenzen sinnvoll ausleben konnten“, berichtet Christina Trache von diesen längst vergangenen Tagen.
„Wenn man solche Herangehensweisen kritisiert, muss man auch die weiterführenden Konsequenzen betrachten. Bedürfnisorientiert und lustbetont ist immer schöner für alle Beteiligten – aber wo stoßen wir an die Grenzen davon? Was geschieht mit uns, wenn wir diese Schutzfunktion immer weiter aufgeben?
Schaden wir uns und den davon betroffenen Hunden langfristig nicht mehr, als wir ihnen Gutes tun?“
Ernüchternde Gedanken einer erfahrenen Hundeführerin, die sich tagtäglich mit psychologischen Mechanismen auseinandersetzt.
„Die Hundeausbildung in unserem Sport ist sehr modern geworden“, bestätigt Klaus Jadatz abschließend, „manche alten Zöpfe gehören einfach abgeschnitten und versteinerte Ausbildungsmethoden, die niemandem etwas bringen, radikal aus den Köpfen der Mitglieder gestrichen. Das ist uns größtenteils gelungen. Die Prüfungsordnung wurde diesen Umständen in den letzten Jahren leider nicht angepasst und auf kaum nachvollziehbare Art verändert.“ Es geht dabei um den VPG-Sport, die urdeutsche Variante aller Schutzhundesportarten, die auf internationaler Ebene heute „IGP“ heißt.
Der swhv Gebrauchshundesport-Obmann sinniert über die Zukunft:
„Über den Tellerrand gesehen, könnten Elemente aus Obedience und Mondioringsport den Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde bereichern und in der öffentlichen Akzeptanz verbessern. Die Zeiten und auch das gesellschaftliche Ansehen haben sich nun mal verändert. Wir können uns nicht auf der einen Seite davor fürchten, immer mehr ins Hintertreffen zu geraten, auf der anderen Seite aber keine Offenheit für Weiterentwicklung einbringen.“
Die Zukunft wird von Hundesportlern abhängen, die bereit sind, den Schutzhundesport weiterhin verantwortungsbewusst und auf hohem Niveau zu praktizieren. Mit sorgfältig gezüchteten und aufgezogenen Hunden, mit Fairness, Toleranz, Respekt – und dem notwendi-
gen Sinn für Gemeinschaft. Die Zukunft steht im Zeichen internationaler Netzwerke und gegenseitiger Inspiration. Das sollten wir zu nutzen lernen.

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 25
KYNOLOGIE
Der Hund beißt! Ein ethischer Balanceakt mit 42 Zähnen
DER HUND BEISST!
Foto:Jan Redder
ROLAND
EINE DAME MIT ERFAHRUNG
SCHIRLING GEWINNT MIT ISI ZUM ZWEITEN MAL DIE VDH FH DM!

Foto: Kurt Buffel 26
TEXT: INKA STONJEK
Mit ihren knapp elf Jahren hat die Malinois-Hündin Independent Spirit’s Isidora, genannt Isi, einen großen Vorteil ihren jüngeren vierbeinigen Mitstreitern gegenüber: sie hat schon Erfahrung mit Frost und Schnee gesammelt. Ein großer Vorteil bei der Deutschen Meisterschaft im Fährtensuchen vom 18. bis 20. November 2022 in Oberdorla. Am Ende des kalten Wochenendes gewinnt sie mit Roland Schirling und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft.

Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft! Isi und du, ihr beide habt den Wettkampf mit insgesamt 199 Punkten gewonnen. Wie hat Isi die Herausforderungen gemeistert?
Gründünger. Der Schwierigkeitsgrad der Fährten war für uns genau richtig: nicht zu schwer, nicht zu leicht. Isi ist in der ersten Fährte mit 100 Punkten bewertet worden und ich muss sagen: Ja, das hat sie sich verdient. Sie neigt manchmal zu kleinen Schönheitsfehlern, wenn sie zum Beispiel unnötig oft oder zu weiträumig neben der Fährte prüft. Aber von diesen kleinen Schönheitsfehlern war absolut nichts zu sehen. Bei der zweiten Fährte, die mit 99 Punkten bewertet wurde, hat sie einen Gegenstand etwas langsam verwiesen und an einem Winkel länger gebraucht. Dort verlief eine Traktorspur, sodass sie sich neu orientieren musste. Der Punktabzug war also völlig gerechtfertigt.
Wie lief denn die VDH Deutsche Meisterschaft 2022 der Fährtenspezialisten für euch ab?
Roland Schirling: Bei der VDH Deutschen Meisterschaft treten insgesamt 30 Teams an, deren Hunde jeweils zwei Fährten von unterschiedlichen Fährtenlegern und bei unterschiedlichen Richtern suchen müssen. Die meisten Fährten wurden in diesem Jahr auf Saat gelegt und einige auf
Roland Schirling: Ich kann es mir seit einigen Jahren einrichten, schon einige Tage vor solchen Veranstaltungen anzureisen. Das ermöglicht mir und meinem Hund, dort auch gedanklich anzukommen und uns schon mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Gerne nutzen wir beispielsweise die Möglichkeit eines Trainings, wenn es sich ergibt. Diesmal hatte die frühe Anreise allerdings einen Nachteil: Wir sind vorbereitet auf die Wettervorhersage „Regen am Wochenende“ am Dienstag vor der Deutschen Meisterschaft in Oberdorla angekommen, es wurde bis zum Wochenende aber täglich trockener und kälter. Letztlich sind wir am Samstag und Sonntag dann im Frost und auf Schnee gestartet. Da wären die zu Hause gelassenen gefütterten Schuhe, langen Unterhosen und Handschuhe passender gewesen als Gummistiefel und Regenbekleidung.
Oberdorla Ende November 2022: Roland Schirling gibt seine elfjährige Isi bei frostigen Temperaturen am Ansatz frei.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 27
HUNDESPORT
Interview mit Roland Schirling – VDH Deutscher Meister FH 2022
Foto: Corinne Jaquot-Glüh
Welche Bedeutung haben denn das Gelände und die Witterung für die Fährtenarbeit?
Roland Schirling: Jede Fährte entwickelt einen typischen Geruch – je nach Bewuchs. Dieser Prozess wird zudem durch die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst: Ist er fein oder grob, sandig oder lehmig, trocken oder feucht, weich oder hart bzw. hartgefroren? Entsprechend stärker oder schwächer ist die Bodenverletzung beim Treten der Fährte. Und schließlich wird die Geruchsentwicklung noch ganz maßgeblich durch die Witterung bestimmt: Je stärker sich die Bedingungen während der dreistündigen Liegezeit zwischen Treten und Suchen verändern, umso schwieriger wird es – sagt mir meine Erfahrung.
Im Frost gelegt, dann lieber auch im Frost gesucht – im Trockenen gelegt, dann bitte kein starker Regen oder Hagel – im Frühtau gelegt, dann darf die Sonne noch gern bis nach dem Absuchen warten. Weil man sich Prüfungsbedingungen aber nicht malen kann, sollte man mit dem Hund unterschiedlichste Bedingungen trainieren. Ich habe mit Isi zwar schon auf gefrorenem Boden und Schnee trainiert, aber das ist
einige Jahre her. In der Aachener Ecke, in der wir leben, ist es mittlerweile einfach zu mild. Die jungen Hunde von anderen Teilnehmern bei der VDH DM haben teilweise sogar noch nie Schnee und Frost erlebt –geschweige denn, darauf trainiert.
Was hat die Veranstaltung in Oberdorla ausgezeichnet?
Roland Schirling: Die gesamte Veranstaltung hätte vom Tourismusverband gesponsert sein können: Oberdorla hat eine herrliche Landschaft mit unendlichen, hügeligen Weiten – bei der Meisterschaft wie mit weißem Puderzucker überzogen und von strahlender Sonne erleuchtet. Es ist dünn besiedelt und hat riesige Ackerflächen. Die Veranstalter pflegen gute Kontakte zu den landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort und hatten deshalb Zugriff auf sehr viel Fläche. Zudem sind sie sehr erfahren in der Organisation solcher Großveranstaltungen und haben zusammen mit den Fährtenlegern für alle Teilnehmer nahezu gleiche Voraussetzungen geschaffen, die den Witterungsbedingungen gemäß gut leistbar waren.
Das Erfolgsduo Roland und Isi war auch dreimal auf der DVG Bundessiegerprüfung IGP dabei und einmal auf der VDH IGP DM!
Sie haben auch – wie wir zu sagen pflegen – keine Autobahnen getrampelt, sind aber auch nicht einfach über die Fährte geflogen. Alles, was planbar war – der sportliche Teil, der gesellige Teil, die Verpflegung – war optimal vorbereitet. Das ist nicht selbstverständlich.

28
Foto: Birgit Schirling
Auch seitens der Teilnehmer war zu spüren, dass es im Fährtenhundesport immer noch ein intensives Miteinander und eine hohe Kollegialität der Hundeführer untereinander gibt, die ja eigentlich im Wettbewerb zueinander stehen. Das kenne ich aus dem Schutzhundesport so zum Beispiel nicht. Im Fährtenhundesport fiebert man nicht nur bei der eigenen Mannschaft mit, sondern auch bei anderen Teilnehmern und ist betrübt, wenn mal etwas nicht planmäßig klappt. Ich hoffe und wünsche mir, dass das noch lange so erhalten bleibt.
Ihr seid für die FCI Weltmeisterschaft in Finnland qualifiziert. Gibt es darauf eine besondere Vorbereitung?



Roland Schirling: Aber sicher! Finnland wird nach 2019, 2021 und 2022 unsere vierte Weltmeisterschaft sein. Darauf arbeiten wir hin, was letztlich aber bedeutet: alles wie immer.
Ich halte viel davon, kontinuierlich zu trainieren. Seitdem Isi ein gereifter, erfahrener Hund ist, trainieren wir im Regelfall zwei- bis viermal pro Woche, sofern Trai-
(Hovawart)


4x VDH Deutsche Meisterschaft FH 2008 / 2009 / 2010 / 2011
2x dhv Deutsche Meisterschaft FH
2009 Sieger
5x RZV Deutsche Meisterschaft FH
Sieger 2008 & 2009 & 2010
2x DVG Bundessiegerprüfung FH
Sieger 2008 & 2009
ningsgelände zur Verfügung steht. Einige Hundeführer trainieren vielleicht seltener, damit ihr Hund nicht die Lust verliert. Das kann ich von Isi nicht sagen. Spätestens wenn wir am Ansatzstock stehen, ist ihre Lust voll da.
Du sprachst Isis Schwachstellen an. Arbeitet ihr noch daran oder geht es eigentlich darum, Isis Niveau zu halten?
BODO VON DER LAHRSTRASSE (Deutscher Schäferhund)
2x DVG Bundessiegerprüfung FH
INDEPENDENT SPIRIT’S ISIDORA (Malinois)
3x FCI Weltmeisterschaft FH

Vizesieger 2019
Sieger 2016
6x DVG Bundessiegerprüfung FH






Sieger 2017 + 2018 + 3x Vizesieger
5x VDH Deutsche Meisterschaft FH
Sieger 2019 & 2022
Roland Schirling: Ja, genau – letzteres. Es ist schwieriger, das Niveau eines Hundes über Jahre zu halten, als einen jungen Hund neu aufzubauen. Ich habe schon oft beobachtet, dass erfahrene Hunde irgendwann oberflächlicher, man könnte auch sagen: ein wenig arroganter werden. Sie gehen dann nicht mehr mit vollem Einsatz an die Fährte heran, zumindest dann nicht, wenn die Fährte leicht zu sein scheint. Das ist einerseits fehleranfällig, andererseits gibt es Punktabzug. Solch ein Verhalten verträgt sich nicht mit der Prüfungsordnung, nach der die Hunde jederzeit intensiv suchen sollen.
Rolands Erfolgsbilanz im Spezial-Fährtenbereich kann sich sehen lassen.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 29
HUNDESPORT
Interview mit Roland Schirling – VDH Deutscher Meister FH 2022
← ← ←
Wann beginnst du eigentlich die Ausbildung in der Fährtenarbeit?
Roland Schirling: Nachdem wir mit Isi als Welpen vom Züchter nach Hause gekommen sind, haben wir ihr als erstes eine erste kleine Fährte gelegt. Nichts großes, nur spielerisch wenige Schritte. Und von da an hat sie einen Großteil ihrer Futterration auf der Fährte bekommen – als Welpe mehrfach täglich. Bei meinem vorherigen Hund – meinem Hovawart „Willi“ – war es genauso: Meine Hunde bekommen ihr Futter nicht aus dem Napf, sondern sollen es sich beim Arbeiten verdienen. Das hat auch etwas mit der Wertschätzung dem Hund gegenüber zu tun. Er soll nicht ein Kindchen sein und bleiben, das von uns gefüttert wird. Er soll die Chance haben, zu arbeiten und zu einer erwachsenen Persönlichkeit heranzureifen.
10% auf alles in der Shop-Kategorie
Und wie baust du Fährtenarbeit auf?
Roland Schirling: Zu Beginn trete ich Flächen von 30 x 30 cm bis 50 x 50 cm aus und lege kleine – möglichst unsichtbare – Futterbrocken hinein. Wenn der Hund gelernt hat, dass es sich nur in der ausgetretenen Fläche zu suchen lohnt, folgt dieser Ansatzfläche eine kleine Fährte. Dabei lege ich anfangs auch in jeden Schritt einen kleinen Futterbrocken.


Beim Treten der Fährten achte ich darauf, dass ich die Schritte nicht zu klein mache und die Füße nicht nebeneinander setze, sondern der große Zeh des einen Fußes leicht versetzt an die Ferse des anderen anschließt, sodass ein Pendeln des Hundes von Schritt zu Schritt zustande kommt.
FÄNGT MIT GUTEM EQUIPMENT AN!
CODE: NASE10

www.sporthund.de














Hinweis: Einfach den Gutscheincode am Ende deiner Bestellung in das Gutscheinfeld eingeben und automatisch 10% Rabatt auf alles in der Shop-Kategorie Nasenarbeit erhalten. Nur ein Rabattcoupon pro Person einlösbar. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Der Coupon ist gültig bis 30.4.2023.


30
Foto: Kurt Buff el
„Nasenarbeit“
ERFOLG
Um zu verhindern, dass der Hund zu schnell wird, führt die Fährte nicht geradeaus, sondern besteht aus Schlangenlinien, Bögen und Winkeln und orientiert sich explizit nicht am Furchenverlauf oder dergleichen. Auch das Überqueren von schmalen Wegen oder Gehwegplatten gehört von Anfang an zum Repertoire. Schließlich sind ja noch Leckerchen in jedem Schritt.

Parallel dazu fange ich mit dem Verweisen an. Ich zeige dem Hund, wie ich etwas Futter in ein Filmdöschen lege und verschließe es. Dann bewegt sich das Döschen in meiner Hand schnell zum Boden. Der Hund ist interessiert und mit etwas Hilfe legt er sich davor. Und „Zack!“ geht das Ding auf. Es dauert nicht sehr lang, dann legen sich die Hunde voller Erwartung vor die Filmdöschen, wenn sie welche auf der Wiese im Garten entdecken. Die Fährte und das Verweisen der Gegenstände kombiniere ich so schnell wie möglich, damit die Hunde beides als etwas Zusammenhängendes begreifen – und nicht als Alternative.
Roland Schirling: Abgesehen davon, dass sie mit ihren knapp elf Jahren langsam eine graue Fellfarbe bekommt, zeigt sie keine Alterserscheinungen. Sie läuft genauso gerne wie früher, steht problemlos aus dem Liegen auf und kann sich weiterhin über lange Fährten gut konzentrieren. Es gibt derzeit also keinen Grund, mit der Fährtenarbeit aufzuhören. Wenn ich irgendwann merke, dass sich ihr körperlicher oder geistiger Zustand ändert, gehen wir sofort in Ruhestand. Ich möchte ihr nicht zumuten, dass sie merkt, dass sie schlechter wird. Dann gehen wir eben nur noch miteinander spazieren oder bewachen das Haus.
Wird es nach Isi noch einen Hund geben?
Roland Schirling: Parallel zu ihr nicht, weil sie keinen zweiten Hund neben sich dulden würde. Nach ihr aber schon. Da meine Frau und ich aber beide nicht jünger werden, wird es ein kleinerer und leichter handlebarer Hund sein. Von dem wir uns aber auch wünschen, dass er sich für die Fährtenarbeit begeistern kann. Von einem Sport auf Wettkampfniveau sind wir nämlich weiterhin nicht abgeneigt.
SPORTHUND wünscht für die WM viel Erfolg!
Was glaubst du, wie lange kannst du mit deiner Isi noch Fährtensport betreiben?
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 31
HUNDESPORT
Interview mit Roland Schirling – VDH Deutscher Meister FH 2022
Foto: Kurt Buffel
VDSV OFFENE DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2022



32
TEXT + FOTOS: CONSTANZE RÄHSE
Lautes Hundegebell schallte am ersten Dezember-Wochenende durch die Wälder von Schönwald. Bei Lauf an der Pegnitz fand in diesem Jahr die offene Deutsche Meisterschaft des VDSV statt, zu der 190 Teams aus ganz Deutschland und einige wenige aus der Schweiz und aus Österreich angereist waren.
4,4 Kilometer galt es für die Monoklassen und 4,6 Kilometer für die Gespannklassen, also alle mit mehr als einem Hund im Zug zu absolvieren. Das Ganze natürlich zweimal, denn i.d.R. werden immer zwei Heats gewertet. Der Wettkampf startete am Samstag, als pünktlich um 8:45 Uhr das erste 8er-Gespann die Starlinie passierte.
JulePrins
VDSV DM 2022:
Deutsche Meisterin
Scooter-1 Damen
Deutsche Meisterin Bike Damen
Zwei Dinge waren für mich schnell klar: Erstens: wenn man so ein Event noch nie besucht hat, ist es schon beeindruckend, an der Strecke zu stehen, wenn die Gespanne vorbeiziehen. Alle Hunde sind hochkonzentriert bei der Aufgabe, die darin besteht, Vollgas zu geben und auf den Musher zu hören. Der lenkt mit Kommandos das Gespann, sagt alle Tempo- und Richtungswechsel an. Die wichtigsten Kommandos sind „rechts“ und „links“, „halt“ natürlich und „warten“. Jeder Musher hat dafür seine eigenen Begriffe. Zweitens: es wird ein langer, kalter Tag im Wald.
Wertungsklassen – da muss man erstmal den Überblick behalten
Im Zughundesport werden alle Klassen mit Gerät, also die mit Scooter, Bike und Wagen, immer in zwei Kategorien gewertet. Die erste wäre die „Nordic breed“-Kategorie RNB, die für alle reinrassigen Schlittenhunderassen. Auch hier gibt es dann noch einmal eine Spezifikation, wobei meist nur, wie in Lauf auch, die Klasse 1 (RNB1): Huskys am Start ist.
VDSV DM 2022:



Deutscher Meister
Scooter-2
Deutscher Meister
Scooter-1 Männer
Interviewpartner
Jule und Marc Prins
Die 33-jährige Sportwissenschaftlerin und der 49-jährige Physiotherapeut kommen ursprünglich aus dem Humansport, waren erfolgreiche Mountainbiker, Läufer und Triathleten mit Höhepunkten wie Welt- und Europameisterschaften. Nach einem schweren Unfall war für Jule die sportliche Karriere beendet. Wie nutzt man die viele Freizeit, wenn die sonst immer mit Sport ausgefüllt war? Man schafft sich einen Hund an! 2015 sind sie dann auf den Zughundesport gestoßen, weil ihre sehr verrückte Cleo ausgelastet werden musste. Seitdem sind sie erfolgreich dabei. Sehr erfolgreich, denn über die Jahre haben sie viele Welt-, Europameister und Deutsche Titel gesammelt, gehören zu den Besten der Deutschen Zughundesportszene. Und wenn man über den Hund zum Sport zurückfindet, dann ist das ein großartiges Gefühl, beschreibt die geborene Bremerin. Marcs Lieblingsdisziplinen sind Canicross und Scooterjöring. Jule favorisiert eher das Bike.


In der Klasse 2 (RNB2) wären dann alle anderen Schlittenhunderassen wie beispielsweise Samojeden, Malamute etc., aber die sieht man in Dryland-Rennen eher selten.
Die zweite Kategorie ist die NPB „no nordic Breed“, in der also alle anderen Hunde gewertet werden, auch Mischlinge. In dieser dominieren die Hounds, aber theoretisch könnten auch 8er Gespanne nur mit Malinois laufen oder gemischte Rudel.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 33 VDSV Deutsche Meisterschaft Zughundesport HUNDESPORT Ma ins
Platz 3 Bike Männer
Und noch etwas wird auch dem laienhaften Zuschauer gleich klar: die richtigen Flitzer sind die NPBs, die den Reinrassigen in allen Klassen Zeit abnehmen. Naja, nun sind die reinrassigen Schlittenhunde, die der Laie sich vor dem Gespann vorstellt, auch eher die, die Distanzrennen bestreiten, also auf Ausdauer gezüchtet sind. Husky und Co. laufen eher bei Etappenrennen, an denen pro Tag auch mal bis zu 50 Kilometer (in Europa) zurückgelegt werden müssen.

Interessant ist auch, dass die RNB-Klassen generell nicht nach Mushergeschlecht getrennt gewertet werden, wie in den NPB-Klassen. In den Gespannklassen ist das ja generell nicht der Fall. Im CaniX-Run wiederum ist es egal, welcher Hund aus welcher Kategorie vorgespannt ist. Nicht so ganz leicht also mit dem Durchblick!
Die Deutsche Meisterschaft bot also in 16 verschiedenen Wertungen die Möglichkeit auf den Titelgewinn. Und das sind sie, die Deutschen Meister ihrer Klassen:
8er Gespann
RNB1: Jürgen Stolz
NPB: Jürgen Oberheim
6er Gespann
RNB1: Andrea Herdegen
NPB: Francis Latta
4er Gespann
RNB1: Götz Bramowski
NPB: Tamara Lambertz
2-Dog-Scooter
NPB: Marc Prins
RNB1: Jessica Paulsen
1-Dog-Scooter
NPB weiblich: Jule Prins
NPB männlich: Marc Prins
RNB1: Andreas Böhm
Bike
NPB weiblich: Jule Prins
NPB männlich: Felix Övermann
RNB1: Matthias Klatt
CaniX-Run
weiblich: Carolin Joeken
männlich: Florian Leithmann
Vorbereitung und Ablauf
Für die Veranstaltung stand großzügiges Gelände rund um den Sportverein Schönberg zur Verfügung. Es gab zwei Stakeouts, die die Gespannklassen und die Monoklassen „trennten“. Daniela Zellmer bewertete ihren Platz als „großzügig und nahe am Startbereich, was für große Gespanne nicht ganz unwichtig ist. Ich war da sehr zufrieden.“
Auch mit der Organisation war sie grundsätzlich zufrieden, beanstandet nur den Informationsfluss, zum Beispiel bezüglich der Startzeiten, die nur via Internet bereitstanden. „Das war etwas unglücklich, denn die Verbindung mit dem Handy war dort echt schlecht.“
34
8er NPB-Gespann von Daniela Zellmer im ersten Heat
Die Startabstände sind auf so einer Meisterschaft eng getaktet. Die 8er und 6er Gespanne fuhren im Abstand von zwei Minuten los, alle anderen Klassen wurden minütlich gestartet. Man versuchte, die schnellsten immer an den Anfang zu stellen, damit es möglichst wenige Überholvorgänge gibt. Denn die kosten nicht nur wertvolle Sekunden, sondern können auch stressig werden, wenn beispielsweise der Trail nur drei Meter breit ist und ein schnelleres Gespann vorbeiziehen will.
„Wie schwierig sich das Überholen gestaltet, ist auch von dem abhängig, der überholt wird ...“, sagt mir Daniela und resümiert das stellvertretend für alle Starter. „... ob er mitdenkt und abbremst, wenn man neben ihm ist und natürlich auch, ob die Hunde sauber sind. Grundsätzlich benötigt man mit Gespann deutlich mehr Platz, als mit einem Mono-Hund, zum Glück sind die Startzeiten aber meist so, dass es in den großen Gespannklassen so gut wie nie zu Überholmanövern kommt.“
Nun, ich habe eines live erlebt und muss sagen, dass der überholte Thomas Hartmann mit seinem NPB-6er-Gespann sehr fair Platz gemacht hat, um Musherin Barbara Winzig den Vortritt zu lassen. An dieser Stelle war auch die Strecke breit genug.

Tolle Streckenführung kritisch betrachtet
Interviewpartner
Daniela betreibt den Zughundesport seit 2008. Anfangs nur freizeitmäßig, bestritt sie erst Ende 2010 ihr erstes Rennen. Ihre Motivation war die Zielsetzung nach einer Krebsbehandlung mit OP, Chemotherapie und Bestrahlung ein Rennen überhaupt durchzustehen. Das verlangt Respekt, besonders wenn man weiß, dass sie zu der Zeit noch laufend oder bikend unterwegs war. Erst später kam sie über Scooterjöring zu den Gespannklassen. Seit 2018 fährt sie mit Hounds die 6er und 8er Gespanne, „weil es einfach Spaß macht! Es ist schön zu sehen, wie das Team zusammenarbeitet und harmoniert. Da geht mir das Herz auf.“ Schöner kann man die Passion Schlittenhundesport nicht beschreiben. Daniela hat 13 Hunde.

Überholvorgang mit 6er-Gespann. Da braucht es Fairness und gute Nerven.





Bezüglich der Strecken gab es einige Kritikpunkte, die auch für Laien wie mich nachvollziehbar sind. Sogar ich, die nur fotografieren wollte, bin die Strecke am Vortag abgelaufen, um einen ersten Eindruck zu gewinnen und mir „schöne Ecken“ zu suchen. Für die Musher, wie die Hundeführer im Zughundesport genannt werden, ist das Ablaufen aber immens wichtig, ja sogar „ein absolutes Muss“, sagt mir Rabea Wening die Drittplatzierte im Bikejöring der Damen, „weil wir im Rennen hohe Geschwindigkeiten fahren und die Hunde die Strecke besser schon kennen sollten.“ Und so sind auch Jule und Marc Prins am Vortag die Strecke mehrmals abgegangen.
Grundsätzlich haben die Strecken den gefragten Teilnehmern gefallen. „Sie waren sehr abwechslungsreich, mit kniffligen Passagen und einer Meisterschaft würdig“, urteilen Jule und Marc Prins.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 35 VDSV Deutsche Meisterschaft Zughundesport HUNDESPORT
VDSV DM 2022: Platz 2 8er NPB Gespann
Daniela Zellmer
DanielaZellmer
Interviewpartner

Rabea Wening
Rabea betreibt zusammen mit ihrem Mann seit ca. fünf Jahren Zughundesport. Angefixt durch Freunde aus diesem Sport, entwickelte sich bei den beiden Leistungssportlern schnell der Wunsch nach einem eigenen Schlittenhund. „Da der Aufwand für solche Rennen immens hoch ist und es sich kaum lohnt, nur für einen Start zu den Wettkämpfen zu fahren, kam schnell Hound Nr. 2 dazu“, sagt mir Rabea. Mittlerweile sind es fünf Hounds, die individuell nach ihren Stärken am Bike, am Scooter oder auf der Canicross-Strecke auf nationalen und internationalen Wettkämpfen eingesetzt werden. Aber für Rabea, die in der laufenden Saison bei allen nationalen Rennen immer das erreicht Podium hat, ist die Hauptmotivation für diesen Sport ganz einfach: „Das Schönste ist der Moment, in dem man gemeinsam mit seinem Hund Zeit verbringt, egal ob im Wettkampf, beim Training oder im Alltag. Die Hunde kennen keine Ranglisten oder können eine erbrachte Zeit im Wettkampf beurteilen. Für sie zählt nur, ihre absolute Leidenschaft fürs Laufen mit ihrem Teampartner zu teilen und genau das sollten sich die menschlichen Sportler immer vor Augen halten.“


Pia Schmalzbauer liebte ebenfalls den technischen Anspruch und Rabea Wening bewertete die Strecke als potentialreich und top, auch mit flachen und schnellen Abschnitten. „Allerdings hätte man sich das Schotterstück direkt am Anfang sparen können und auch auf dem letzten Stück bergab lag sehr viel grober Schotter. Da ist bei den hohen Geschwindigkeiten, gerade auf dem Bike, das Verletzungsrisiko sehr hoch.“ Jule Prins sieht das genauso und fügt hinzu, dass das alles andere als optimal war und sie diesen Untergrund auch im Training möglichst meiden.“




Auch die Sicherheit wurde insgesamt bemängelt. „Sicherheit ist super wichtig“, alle sind sich darüber einig. „Besonders das Bikejöring ist mittlerweile auf einem Niveau, wo die Topfahrer mit ihren Hun-
den Leistungen und Geschwindigkeiten abrufen, bei denen kleinste Fehler schwere Stürze verursachen können,“ sagt Rabea und macht damit deutlich, dass die Strecken deswegen auch gut gesichert und gekennzeichnet werden müssen. „Die Monostrecke war zum Teil sehr schlecht abgeflattert und zum Teil auch gefährlich abgeflattert.“ Auch Streckenposten waren viel zu wenige auf der Strecke. Nicht nur ich hatte während des Rennens ahnungslose Spaziergänger auf der Strecke, die mich im Rennen behindert haben. Das kann vielleicht auf einem Wald- und Wiesentunier passieren, aber nicht auf einer Deutschen Meisterschaft.“
Auch die Prinsen sehen das so: „Es hätte ruhig ein paar mehr Orientierungen geben können, mehr Flatterband, mehr Absperrungen an
36
VDSV DM 2022: Platz 3 Bike Damen
Rabea Wening
Rabea Wening mit Zorro im Bikejöring
Wegkreuzungen. Und es war wirklich viel zu viel los auf der Strecke. Da war doch einiges an Spaziergängern unterwegs. Wir sind ja schon mit hohen Geschwindigkeiten auf den Waldwegen unterwegs und es ist natürlich wünschenswert, wenn es mit gegenseitiger Rücksichtnahme klappt und es keine Unfälle gibt. Vielleicht könnte man im Vorfeld eines Rennens mehr Hinweisschilder aufhängen und am Renntag selbst, mehr Streckenposten, die darauf hinweisen. Die fand ich im Allgemeinen sehr rar, auch wenn ich weiß, wie schwer es ist, Helfer zu finden.“
Auch Pias Bikehund Ota ist am Samstag einmal falsch abgebogen. „Am 2. Tag waren die Strecken etwas besser abgeflattert, deutlich sichtbarer und dadurch sicherer, was den jungen Hunden sehr geholfen hat.“
Teamerfolg zählt bei der Aufstellung
8:31,8: das war die schnellste Zeit in der Klasse Scooter mit einem Hund und 7:54,9 die schnellste Zeit in der Klasse Bikejöring. Beide Zeiten haben gemeinsam, dass sie von derselben Musherin erreicht wurden. Jule Prins ist damit nicht nur in beiden Disziplinen die Deutsche Meisterin 2022, sie ist auch in beiden Klassen die Schnellste überhaupt, weil auch die Sieger der Männerwertungen einige Sekunden verloren haben. Also musste sich auch ihr Mann Marc seiner schnellen Frau geschlagen geben, krönte sich aber als Scooter-König der Männer und gewann beide Klassen, die mit einem Hund und die mit zweien. Beide Prinsen haben damit ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigt und fuhren aus Lauf mit vier neuen heim.
Die Prinsen setzen in ihrem Rudel auf Mädels. Ihre sportliche Basis aus der Vergangenheit ist hilfreich, aber die Leidenschaft am Tun
Pia Schmalzbauer
Interviewpartner



Pia Schmalzbauer

Die zweifache FMBB-Weltmeisterin im Bikejöring war in diesem Jahr das erste Mal auf einer VDSV Deutschen dabei. Die Fränkin ist allgemein hundesportbegeistert, macht parallel auch IGP und ist seit Jahren extrem erfolgreich im turnierhundesportlichen Vierkampf 3 unterwegs. Zu ihrem Rudel gehören neun Hunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Über die Jahre mit ihrem Malinois Mika an Siege gewöhnt, gehören jetzt auch drei junge Hounds zu ihrem Rudel, die man augenscheinlich einfach braucht, wenn man auch im VDSV ganz vorn mitfahren will. Die 32-Jährige macht Zughundesport seit 2014. Sie ist schon immer gern Rad gefahren und hat irgendwie auch ein bisschen Talent, sagt sie. Deswegen ist Bikejöring auch ihre Lieblingsdisziplin. „Im Laufen bin ich zu schlecht und Scooter ist jetzt nicht so meine Lieblingsdisziplin, weil es mega anstrengend ist.“
und ein gutes „Management der Hunde“ ist entscheidend. Vor jedem Rennen überlegen beide gemeinsam, wer mit welchem Hund auf die Strecke geht. Diese Entscheidung ist abhängig von der eigenen Konstitution, von der Strecke selbst und auch von den Startzeiten, die sehr temperaturbelastend sein können. „Wir möchten jedem Hund das perfekte Rennen bieten. Wenn ein Hund eigentlich für Scootern vorgesehen ist, diese Disziplin aber im Zeitplan erst am Nachmittag startet, dann kann es sein, dass die Temperaturen für diesen Hund schon zu hoch sind, weil dieser wärmeempfindlicher ist als ein anderer aus unserem Rudel.“ Wichtig ist den Prinsen, dass sie im Team erfolgreich sind.
Genauso sieht das auch Rabea Wening, für die es die erste richtige Bikesaison war und für die sie super hart mit ihrer Hündin Champ trainiert hat. Leider hat sich diese dann am Anreisetag verletzt.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 37 VDSV Deutsche Meisterschaft Zughundesport HUNDESPORT
Platz
Scooter-2 Platz 7 Bike Damen
VDSV DM 2022:
5
„Das hat mich emotional natürlich aus der Bahn geworfen“, sagt Rabea. „Mein Mann hat dann auf seinen Start verzichtet und mir „seinen“ fünfjährigen Bikehund Zorro gegeben.“ Und das hat sich am Ende auch bezahlt gemacht, den Rabea und Zorro haben mit Platz 3 hervorragend abgeschnitten.
Pia Schmalzbauer ist mit einem fünften und einem siebten Platz von ihrer ersten DM heimgefahren. Und das, obwohl ihr Scooter fahren eigentlich zu anstrengend ist. Die Frage, warum sie in der Klasse Scooter mit zwei Hunden unterwegs ist, ist damit eigentlich beantwortet. „Außerdem“, fügt sie trotzdem noch hinzu „ist Scootern mit zwei Hunden auch eine sehr gute Möglichkeit, die Hunde auszulasten. Und da ich nur so Schlumpfen-Hounds habe, die um die 26 kg wiegen, tun die sich zu zweit natürlich leichter.“
Ihre zwei noch jungen Hounds Lily und Féli haben ihre Sache also ganz gut gemacht und sich in der Laufzeit im zweiten Heat sogar nochmal gesteigert.
Ein falsches Abbiegen im Samstagsrennen auf dem Bike hat der Musherin ganz schön Zeit gekostet. Trotzdem schafften Pia und Ota im Bikejöring die Strecke in einer Gesamtzeit von 17:26,2 zu bewältigen, was die Hälfte der Teilnehmer aus der Männerkonkurrenz nicht geschafft hat. Trotzdem möchte sie ab dem nächsten Rennen dann in der Gespann-Klasse starten.
Für Daniela Zellmer ist ein „Management der Hunde“ eher die Frage des Einspannens. Sie hat „nur“ acht aktive Laufhunde und wenn alle fit sind, startet sie mit denen auch in der 8er Gespannklasse, so wie in Lauf. In jedem Gespann gibt es immer Leader, also Führungshunde, die besonders aufmerksam dem Musher „zuhören“ und folgen. Daniela hat den Luxus, mehrere zu haben, was ihren anfänglichen Starts im Bike- und Scooterjöring geschuldet ist.

Hauptsächlich sind ihre zwei Hounds Boreas und Chaos, beide 2016 geboren, die Leader und die führten die anderen zu Platz 2 in der Gesamtwertung. Aus ihrem Sommerwurf hat sie fünf Welpen behalten, mit denen sie in Zukunft auch weiterhin aktiv bleiben möchte.
Jeder hat also noch Ziele und ich hoffe, man sieht sich mal wieder! Mir jedenfalls hat es gefallen, bei diesen Sport mal live dabei zu sein und das Adrenalin der Musher zu spüren, wenn die Gespanne, Biker und Scooter mit hohem Tempo an der Linse vorbeiziehen. Ich hoffe, die Laufer Truppe organisiert mal wieder ein solches Event. Dann bin ich auch da!
38
Jule Prins mit Pringles im Bikejöring
▶ JULE, DU STARTEST MIT DEM SCOOTER UND DEM BIKE. WAS LIEBST DU MEHR?
Jule Prins: Definitiv ist Bikejöring meine Haupt- und Lieblingsdisziplin. Am Biken hängt mein Herz! Auf dem Scooter bin ich zusätzlich unterwegs, weil es mich reizt, auch in dieser Disziplin noch einen internationalen Titel zu holen. Und ich habe dafür gerade den perfekten Hund. Wilde, unser letzter gezogener Welpe zeigt sich in ihrer ersten Saison als geborener Scooterhund.
{ weiter nachgefragt }
▶ WAS IST ANSTRENGENDER?





















Jule Prins: Da ich nicht zum Training auf dem Scooter komme, ist diese Disziplin anstrengender für mich und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Mir fehlt da oft die Übung und im Rennen ist dann immer Vollgas angesagt. Das Biken kennt mein Körper, da ich es schon jahrelang betreibe und mich dazu richtig sicher auf dem Rad fühle. Aber beide Disziplinen haben ihren Reiz.
▶ DU WARST IN LAUF IN BEIDEN DISZIPLINEN SOGAR SCHNELLER ALS DIE MÄNNER. MACHT DAS DER HUND AUS, DIE EIGENE FITNESS ODER AUCH EINE HÖHERE RISIKOBEREITSCHAFT? INWIEWEIT IST DEINE MOUNTAINBIKE-KARRIERE DA HILFREICH?

Jule Prins: Es ist eine Kombination aus vielen Dingen, würde ich sagen. In Lauf hatte ich leichtes Spiel, da ich unseren Top-ScooterHund bekommen habe. Wenn Wilde vor den Scooter gespannt ist, muss man nicht besonders viel hinten arbeiten. Sie ist mit ihren 35 kg nicht nur extrem stark, sondern auch sehr schnell. Diese Kombination ist natürlich perfekt für die Disziplin Scooter mit einem Hund.
Beim Bike kommt es auch immer sehr darauf an, ob dem Fahrer und dem Hund die Strecke liegt. Wir versuchen auf kleine schnelle Hunde zu setzen, die mit jeder Strecke zurechtkommen. Meine Pringles
Prinsen-Interview HUNDESPORT sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 39
Marc Prins mit Coach & Nutzz im Scooter-2-Rennen
INTERVIEW + FOTOS: CONSTANZE RÄHSE
läuft auch ihre erste Bikesaison mit mir. Letztes Jahr wurde sie mit Marc Deutsche Meisterin am Scooter und der Sprung zum wesentlich schnelleren Bike war eine echte Herausforderung für sie. Sie ist sehr sensibel und gerade am Bike ist der Hauptfehler, den viele machen, ihre Hunde zu überfahren. Das geht nicht lange gut. Ich glaube, Männern fällt das oft noch schwerer, einen passenden Hund zu finden, der ihr Tempo gehen kann. Man findet sehr selten einen so schnellen Hund, der von Anfang bis Ende die Leine auszieht. Vor allem auch, wenn es gerade oder bergab geht. Ich achte sehr darauf, dass meine Hunde immer auf Spannung bleiben, was ihnen Sicherheit gibt. Auch wenn es mit dem ganzen Adrenalin oft schwerfällt, sich zurückzuhalten im Sinne des Hundes.
Grundsätzlich muss man aber feststellen, dass beim Scooterjöring ganz oft mal Mädels mit starken Hunden vor den Männern ankommen. Da spielt einfach das Eigengewicht und das Gewicht des Hundes eine riesige Rolle. Ich gehöre zwar nicht zu den schmalsten Fahrerinnen, aber der Unterschied meines Gewichtes zu dem meines Hundes ist schon ordentlich. Da haben viele Männer einen kleinen Nachteil.

▶ ZUGHUNDESPORT HAT SICH JA DIE LETZTEN JAHRE RASANT ENTWICKELT, IMMER MEHR ERLIEGEN DER BEGEISTERUNG. ABER NATÜRLICH ENTWICKELT SICH MIT STEIGENDER WETTKAMPFKONKURRENZ AUCH DAS NIVEAU RASANT.


























Jule Prins: Ja, die Ansprüche an die Rennstrecken steigen mit dem Niveau der Sportler und ihrer Hunde. Es wird immer schneller, knapper und man geht mehr Risiko ein. Da kann man sich keine Fehler erlauben. Umso wichtiger wird da eine sichere Strecke. Keiner will sich verletzten oder seinen Hund schädigen, in den er ja auch viel Training investiert. Die Startgebühren sind auch mittlerweile so extrem hoch, dass wir Sportler dann auch eine sichere und gut abgesperrte Strecke erwarten. Wenn wir im Ausland für ein paar Euros an den Start gehen, erwarte ich diese Professionalität nicht.
▶ MARC, MIT DEM SCOOTER SCHEINST DU UNSCHLAGBAR ZU SEIN, EGAL OB EIN HUND ODER ZWEI HUNDE VORGESPANNT SIND. IST SCOOTERJÖRING DEINE LIEBLINGSKLASSE?
Marc Prins: Ja, mittlerweile ist das meine absolute Lieblingsklasse. Vor drei Jahren stieg ich noch ein wenig skeptisch das erste Mal beim Rennen auf den Scooter und muss mittlerweile zugeben, dass ich Nichts mehr lieber mache als das! Und das meine ich nicht nur auf Rennen bezogen, sondern auch im Training!
40
Marc Prins mit Turbo im Bikejöring
IMMER
▶ BESCHREIBE DOCH MAL KURZ, WORAUF ES DA ANKOMMT, DAMIT MAN AM ENDE VORN LIEGT.
Marc Prins: Etwas Training und genetische Voraussetzungen müssen gegeben sein, wie in jedem Sport. Aber das meiste spielt sich im Kopf ab. Wer nicht kämpft, zu früh aufgibt oder nicht an sich glaubt, hat wenig Chancen beim Scootern vorne mitzufahren.
▶ IST DAS MIT EINEM HUND SCHWERER ODER MIT ZWEI?

Marc Prins: Es ist natürlich schneller mit zwei Hunden, daher braucht man auch etwas mehr Technik. Mit einem Hund ist es technisch nicht ganz so anspruchsvoll, aber physisch dafür viel härter.
▶ EIN TRAUM VON DIR WAR DER DEUTSCHE TITEL IN ALLEN MONO-DISZIPLINEN, GEFEHLT HAT NOCH DAS BIKE. BIST DU ENTTÄUSCHT, DASS ES NUR PLATZ 3 GEWORDEN IST?
Marc Prins: Der Traum besteht immer noch und Ziele müssen gelebt werden. Bikejöring war dieses Jahr nur eine „Notkategorie“, weil ich mich beim Laufen verletzt hatte. Denn um den Titel am Bike zu holen, muss ich mir einen anderen Hund aus unserem Rudel davor spannen und es wäre ein wenig Training plus ein Fahrrad nötig. Das ist dann in der Zukunft geplant, wenn es zeitmäßig und finanziell besser reinpasst. Aber dennoch war der dritte Platz dieses Jahr mit Turbo ein Riesenerfolg. Wir hätten damit nicht gerechnet und umso mehr haben wir uns alle als Familie darüber gefreut.



























▶ IHR HABT 13 HUNDE, WIE VIELE DAVON LAUFEN AKTIV? SIND DAS EHER RÜDEN ODER HÜNDINNEN?
Jule Prins: Ja, wir haben 13 Hunde, davon sieben aktive Rennhunde. Vier sind bald zwölf Jahre alt und die zwei achtjährigen Vizslas laufen nur zum Spaß Kurzdistanzrennen mit uns oder mit Freunden, die keinen irren Hound vor sich haben möchten.
Wir haben bei den aktiven nur einen Rüden, aber auch nur, weil es in unserem Wurf nicht mehr Hündinnen gab. Also behielten wir Pistole. Aber wir stehen im Allgemeinen auf Hündinnen im Leistungssport. Sie haben viele Vorteile. Das fängt schon in der Haltung an, wir finden sie im Rudel viel unkomplizierter. Sie zicken mal, wenn sie läufig werden, aber es gibt nie Beißereien, so wie ich das von Freunden mit Rüden kenne. Es gibt auch kein Gepöbel im Freilauf mit anderen Hunden. Zudem ist es in einem Haufen unkastrierter Mädels immer einfacher unter Mädels zu bleiben.
sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 41 Prinsen-Interview HUNDESPORT
Marc Prins mit Pistole im Scooter-1-Rennen
Und Hündinnen haben meist mehr Biss und den stärkeren Willen auf dem Trail. Bin mir ziemlich sicher, dass einige unserer Hündinnen so lange laufen würden, bis sie tot umkippen. Außerdem bringen sie durch ihr geringeres Gewicht mehr Vorteile mit, sind robuster, oft auch schneller, da kleiner. Man hat auch nicht das Problem, dass Hündinnen das Futter verweigern oder bei der Arbeit abgelenkt sind, weil irgendwo eine läufige Hündin rumläuft.
Marc Prins: Bisher haben es alle meine Mädels geschafft, national vor oder mit den Männern vorne mitzufahren und international sogar in der Weltspitze. Wir setzen seit Jahren auf kleine, schnelle, verrückte Mädels. Also wir sind ganz klar Team „Hündin“!
▶ KÖNNT IHR EIN PAAR ASPEKTE DER FRAGE „RÜDE ODER HÜNDIN“ IM ZUGHUNDESPORT MAL KURZ ERLÄUTERN?
Jule Prins: In der Klasse Scooter mit einem Hund fahren die meisten Rüden, auch beim Canicross. Die meisten Sportler denken, es braucht schwere Hunde. Klar ist beim Scootern und Laufen ein gewisses Gewicht sicher von Vorteil, aber gerade bei letzterem muss man sich auch fragen, ob man das Risiko, seinen Körper für den Erfolg kaputt zu machen eingehen möchte. Ich laufe am besten und am schnellsten mit meiner 25 kg Hündin und auf flacher Strecke mit meinem 28 kg Rüden. Am Scooter ist Wilde mit 35 kg fast unschlagbar und Pistole mit seinen 28 kg hat es schwer, mit den Zeiten mitzuhalten. Beim Bikejöring ist es wichtig, dass wenn man selbst stark ist, eine kleinere, schnelle und kopfstarke Hündin im Zug hat und wenn man mehr Zugunterstützung braucht, auch gern einen Rüden.

eingehen
Also, man kann es nicht pauschalisieren. Es kommt auf das eigene Leistungsniveau, das Ziel und die Kategorie an, ob man lieber einen












Rüden oder eine Hündin einspannt. Was auch eine Rolle spielt, ist die Zuchtlinie. Oftmals sind die Rüden der Mittel- und LangdistanzLinien so groß und schwer wie die Hündinnen der Sprintlinien. Ein Beispiel dafür sind Wilde, ein Sprinthund mit 35 kg und Pistole mit seinen 28 kg stammt aus einer MD-Linie.

▶ WIE ENTSCHEIDET IHR EIGENTLICH, WER MIT WEM IN EIN RENNEN STARTET?
Marc Prins: Eigentlich ist klar verteilt, wer welche Hunde läuft und fährt. Leider gibt es immer sehr spät Infos und Starterlisten von Seiten der Veranstalter. Für mich der größte Kritikpunkt überhaupt, weil man nie richtig planen kann. Und ein guter Plan ist nun mal der Grundstein.
42
Jule Prins mit Wilde unschlagbar beim Scootern
▶ KÖNNT IHR EIN BEISPIEL NENNEN, WARUM DAS WICHTIG IST?
Jule Prins: Ja. Ich möchte beispielsweise mit Wilde scootern und Pisti im laufen bei einem Rennen einsetzen. Wilde ist wärmeempfindlicher als Pisti und Canicross ist eigentlich fast immer die letzte Kategorie, die gestartet wird. Wir fahren aufs Rennen und plötzlich ist alles anders als normal. Und das ist oft so, es gibt keine klare Linie. Und so kann es passieren, dass dann auf einmal Scooterjöring erst gegen Mittag gestartet wird. Und wenn gegen Mittag keine optimalen Temperaturen mehr zu erwarten sind, heißt das für uns, die Pläne umzuschmeißen. Es kann also passieren, dass dann einige unserer Hunde gar nicht laufen, wir die Hunde tauschen oder gar nicht erst starten.
Für uns ist wichtig, dass alle bestmöglich und gesund über die Strecke kommen und wir im Team Erfolg haben.
▶ NUN SCHEINT EURE JÜNGSTE EIN SUPERTALENT ZU SEIN.

„STREITET“ IHR UM WILDE?

Jule Prins: Nein, um Wilde streiten wir uns nicht. Sie ist ganz klar mein Hund, aber sie ist so talentiert, dass, wenn ich Zweifel habe, eine Strecke nicht gut bewältigen zu können, immer Marc den Hund bekommt. Meistens hat also derjenige von uns Wilde, der zu den jeweils besseren Bedingungen startet. Wir wollen auf keinen Fall ein Risiko mit so einem jungen Hund eingehen, weder das Überholrisiko noch das aufgrund zu warmer Temperaturen.

▶ DANN WÜNSCHE ICH EUCH IMMER EIN GLÜCKLICHES HÄNDCHEN BEI ALLEN ENTSCHEIDUNGEN UND NOCH VIELE ERFOLGE IN DER ZUKUNFT. DANKE FÜR DAS GESPRÄCH!
EQUIPMENT FÜR PROFIS
CODE: NONSTOP10
www.sporthund.de









10% auf alles von Non-stop
Hinweis: Einfach den Gutscheincode am Ende deiner Bestellung in das Gutscheinfeld eingeben und automatisch 10% Rabatt auf alles der Marke Non-stop Dogwear erhalten. Nur ein Rabattcoupon pro Person einlösbar. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Der Coupon ist gültig bis 30.4.2023.

sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 43 Prinsen-Interview HUNDESPORT
AGILITY
18.-19.3.2023
1./2. Quali S/M
Mending (DE)
25.-26.3.2023
1./2. Quali I/L
Mending (DE)
11.-16.4.2023
FMBB
Oradea (RO)
15.-16.4.2023
3./4. Quali S/M



Wülfrath (DE)
22.-23.4.2023
3./4. Quali I/L
Wülfrath (DE)
12.-15.5.2023
Finale WM Qualifikation
n.n. (DE)
17.-18.6.2023
VDH Deutsche Meisterschaft
Bad Orb (DE)
8.7.2023
swhv Meisterschaft
n.n. (DE)
12.-16.7.2023
FCI JOAWC
Southam (UK)





20.-23.7.2023
FCI EO Horsholm (DK)
9.-10.9.2023
DVG BSP/BSPJ
Brietlingen(DE)
5.-8.10.2023
FCI Weltmeisterschaft
Liberec (CZ)
RH/MANTRAILING
13.-14.5.2023
DVG BSP
Rheine (DE)

20.-24.9.2023
IRO Weltmeisterschaft
Stubenberg (AT)
DOGDANCE
18.-21.5.2023
FCI Weltmeisterschaft
Herning (DK)
17.-20.11.2023
FCI EO
Stuttgart (DE)
OBEDIENCE
11.2.2023
VDH Qualifikation WM 2023


Hegau (DE)
11.-16.4.2023
FMBB
Oradea (RO)
22./23.4.2023
VDH DM + Quali-Finale
Haag (DE)
22.-25.6.2023
FCI Weltmeisterschaft
Spanien
1.-2.7.2023
DVG BSP
Hollnich
IGP
11.-16.4.2023
FMBB
Oradea (RO)
21.-23.4.2023
DVG BSP
Zehdenick (DE)
6.-10.9.2023
FCI Weltmeisterschaft
Nova Gorica (SLO)
15.-17.9.2023
SV BSP Meppen (DE)
4.-8.10.2023
WUSV Weltmeisterschaft
Felcsùt (HUN)
THS
25./26.2.2023
VDSV DM Sprint













Haidmühle (DE)
ab 10.3.2023
IFSS WM LD snow
Norwegen
1.-3.9.2023
dhv Deutsche Meisterschaft
Bamberg (DE)
6.-10.10.2023
DVG BSP
Nova Gorica (SLO)
CaniX
4.-5.3.2023
DVG BSP
Euskirchen (DE)
4.-5.3.2023
Schwabentrail
Renningen (DE)
17.-19.3.2023
Vulcanicross
Schotten (DE)
11.-16.4.2023
FMBB
Oradea (RO)
FÄHRTE
15.-20.5.2023
FCI Weltmeisterschaft
Helsinki (FIN)
28.-29.10.2023
DVG BSP
Güstrow (DE)
RALLY OBEDIENCE

7.-8.10.2023
DVG BSP
Flaesheim (DE)

MONDIORING
11.-16.4.2023
FMBB
Oradea (RO)
Patrick Schmalzbauer mit Legal Highs Axl
ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit
TOP HUNDESPORT TERMINE
44 Foto: Constanze Rähse
Finde die richtige Artikelbezeichnung der dargestellten Produkte und trage die entsprechenden Buchstaben in das Lösungswort ein.
Gewinne das MAELSON-DUO

Lounge Mat (Größe wählbar)
Biod Bowl (Größe wählbar)

PRODUKT-ASSOZIATIONS-Rätsel
SPORTHUNDGEWINNSPIEL
E Kuschelhoodie
N Zip-Jacke Teddy

J Winterhoodie
E Hydro Squeeze Ball


X Ultra Tug Ball
U Breathe Right Fetch Ball

E Bungeezergel
W FreshLine Zergel


S Top-Matic Zergel
Kostka Mushing Max Racer G6

E Kostka Mushing Max G6
Teilnahmebedingungen:
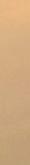
Sende das Lösungswort, deinen Namen und deine vollständige Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@sporthund.de





Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Maelson-Duo, bestehend aus einer Liegematte und einem Futternapf. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Es besteht auch kein Anspruch auf Auszahlung oder Ausgabe eines Ersatzgewinns. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die vom Teilnehmer angegebenen Daten werden nach Maßgabe der DSGVO behandelt.

Die Datenschutzerklärung findest du unter www.sporthund.de/ datenschutzerklaerung


A FIT Rolle

H Bongo Beißrolle
S Midas Rolle
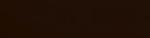
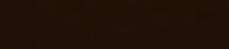
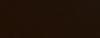



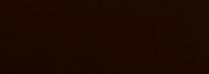



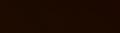



Lösungswort an gewinnspiel@sporthund.de und Chance auf das MAELSON-DUO im Wert von ca. 80 EUR sichern.
A Wasserdummy
W 3-Part-Dummy
R Snack Dummy
Einsendeschluss: 28. Februar 2023
Cityroller


C PUID N BIOD
BOID
B
L
Herausgeber:
LEROI GmbH
Geschäftsführer: Florian König, Olaf König






Am Schneckenhof 9


D-74626 Bretzfeld-Geddelsbach
Email: magazin@sporthund.de


Tel.: +49 (0) 79 45 / 9 41 01 01
Gesamtkonzept & Layout:
Constanze Rähse, Neuhaus an der Pegnitz






Lektorat:
Dipl.-Germanistin (Univ.) Cordula Scheffner, Viersen
Erscheinungsweise:
4x jährlich (1.2. / 1.5. / 1.8. / 1.11.)

Druck:
Saxoprint GmbH




Auflage:
5.000 Stück
Fotoquellen:
Jan Redder, Sven Lober, Guus Kersmarkers, Kurt Buffel, Birgit Schirling, Corinne Jaquot-Glüh, AdobeStock, Constanze Rähse
Hinweise:


Kein Teil dieses Magazins darf ohne Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Eine Haftung für Ratschläge unserer Experten kann nicht übernommen werden. Der Herausgeber behält sich das Recht vor, veröffentlichte Artikel, Beiträge und Fotos auch in seinen anderen Publikationen (In- und Ausland, im Web und elektronisch) ohne weitere Vergütung und Nachfrage zu veröffentlichen. Die Nutzungsrechte an eingesandten Leserfotos gehen mit Einsendung automatisch auf die Leroi GmbH über.
#SporthundPraxistreff
Unsere Partner in der Praxis:

46 RUBRIK Impressum & Vorschau
IMPRESSUM
Scan mich!
Yannick Kayser Jule Prins HSC Wuppertal Kira Uebbing Fabian Uebbing P i a Schmalzbauer
Marc Prins HannesMartinke Stefanie Simson TSG Schlegel ChristineHahn
P a trickSchmalzbauer
David Eule Diana Strätling Marvin Hahn
Regina Herrmann SGVVelden Isabell Eule
Sledwork Xback Active G2
besitzt die DNA der bewährten Xback-Geschirre!
sporthund.de





sporthund.de ∙[Heft 1/2023] 47
Foto: Constanze Rähse



sporthund.de
Foto: Constanze Rähse
ZUM SAMMELN SPIELT EUCH WARM!