
8 minute read
Kakao mit
Kakao mit QR-Code
TEXT
Advertisement
Désirée Klarer
BILDER
Adobe-Stock, zVg
Kakao, der Rohstoff für Schokolade, hat meist einen langen Weg hinter sich, bevor er in der Schweiz zum deliziösen Genussmittel weiterverarbeitet wird. Um mehr Transparenz in die Wertschöpfungsketten zu bringen, setzen Firmen auf verschiedene, digitale Lösungen.
Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis Kakaobohnen vollständig getrocknet sind.
Dass jene, welche die Rohstoffe für unsere Genussmittel herstellen, in Armut leben, ist ein offenes Geheimnis. Laut der deutschen Hilfsorganisation Inkota verdient eine Kakaobauernfamilie in Ghana mit sechs Mitgliedern und bis zu vier Hektaren Land im Durchschnitt umgerechnet 178 Schweizer Franken im Monat. Existenzsichernd wäre ein Einkommen von rund 368 Schweizer Franken, also etwas mehr als doppelt so viel.
Sieht man sich die Zahlen der Ernte im letzten Jahr an, müsste man meinen, dass die Bauern wenigstens 2021 mehr verdient hätten. Doch eine Studie der niederländischen landwirtschaftlichen Universität Wageningen (WUR) zeigt, dass dies leider nicht der Fall ist. Schätzungsweise zwei Millionen Kakaobauern in Ghana und der Elfenbeinküste, etwa 75 Prozent der Kakaobauern in diesen Ländern, leben in Armut. Diese beiden Länder produzieren rund 60 Prozent des Kakaos. Und dies, obschon beispielsweise Schokoladenhersteller Barry Callebaut ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete. Die Preise für den Rohstoff hingegen sind sogar gesunken.
Fairtrade: Ein Rappen Unterschied
Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Christopher Gilbert von der Johns Hopkins Universität in Baltimore, Maryland (USA) ging der Frage auf den Grund, wer am Schokoladenbusiness wie viel verdient. Von einer Tafel Schokolade gehen gut 44,2 Prozent des Verkaufspreises an den Einzelhandel, 35,2 Prozent an den Schokoladenhersteller und gerade mal 6,6 Prozent an die Kakaobauern. Die restlichen 14 Prozent des Geldes verteilen sich auf die verarbeitende Industrie, den Zwischenhandel und die Behörden.
«Kakaobauern verdienen pro Tafel Schokolade etwa zehn Rappen. Damit verdienen sie nicht genügend Geld, um Nahrungsmittel oder Medikamente zu kaufen oder ihre Kinder in die Schule zu schicken», sagt Florian Studer, Co-

Reife Kakaofrüchte schillern in den unterschiedlichsten Farben von grüngelb bis dunkelrot. Im Innern der Kakaofrucht eingebettet befinden sich laut Kakao-Experte Boris Haefele etwa 20 bis 60 Samen. Diese werden umgangssprachlich als Kakaobohnen bezeichnet.
75 Prozent der Kakaobauern aus Ghana und der Elfenbeinküste leben in bitterer Armut. Die beiden Länder produzieren rund 60 Prozent des Kakaos.
Geschäftsleiter der Firma Schöki. Der Schokoladenhersteller mit Sitz in Luzern hat es sich zur Mission gemacht, wirklich faire Schokolade herzustellen. Doch was heisst «wirklich fair»? Für die Firma Schöki bedeutet es, dass die Schokolade ohne Kinderarbeit und nicht auf Kosten der Bauern hergestellt wird.
Bei Fairtrade-Schokolade, von der man als Konsumentin oder Konsument annehmen dürfte, dass sie auch für die Bauern einen fairen Preis trage, treffe das leider nicht zu. Und dies, obschon die Bauern laut Studer einen garantierten Mindestpreis und einen Bonus erhalten. «Sie kriegen zwar einen besseren Preis, doch selbst damit verdienen die Bauern nicht genug, um der Armut zu entkommen. Pro Tafel Fairtrade-Schokolade erhalten sie nur einen Rappen mehr», sagt er.
Eine Software für die Branche
Bei Schöki hingegen verdienen die Bauern einen existenzsichernden Lohn. Das zumindest verspricht die Firma. Ob das Versprechen auch gehalten wird, können Konsumentinnen und Konsumenten voraussichtlich ab Mitte 2022 mit einem einfachen Scan überprüfen. Dann nämlich soll die erste Version der von Schöki initiierten Open-Source-Software namens Suschain fertiggestellt und in der Schöki-Lieferkette implementiert werden.
«Mit der Suschain werden alle Informationen entlang der Lieferkette vom Ursprung bis zum fertigen Produkt in Echtzeit erhoben, mit einer kryptografischen Signatur versehen und somit fälschungssicher gespeichert», erläutert Florian Studer. Die Informationen können Konsu-
Gut zu wissen:
Aus einer Fülle von gut über 500 Aromen, die in Kakao und Schokolade identifiziert worden sind, haben zwei Forscherinnen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften jene Aromastoffe identifiziert, die für den Duft und Geschmack von Kakao entscheidend sind. Daraus wiederum haben Irene Chetschik und Karin Chatelain ein Aromakit aus 25 Fläschchen hergestellt. Dieses Kit dient als Referenz und zur Qualitätssicherung etwa bei der Kakao- und Schokoladenproduktion. Die 25 Aromen können laut den Forscherinnen auch zur Schulung der Geschmackssinne genutzt werden.


Blockchain-Technologie sorgt für Transparenz Welche Möglichkeiten bieten sich durch den Einsatz der BlockchainTechnologie im Lebensmittelsektor? Tim Weingärtner: Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Pauschal kann man sagen: Immer dort, wo es um die fälschungsfreie, transparente Dokumentation geht, macht Blockchain Sinn. Im Lebensmittelsektor dürfte die Blockchain-Technologie wohl am meisten Verwendung in Hinblick auf die Herkunft der Rohstoffe sowie die
«Um Risiken gering Aufschlüss ten finden. elung der Lieferketzu halt möglic en, hilft e hst viele s, Was macht die Blockch Technologie so sicher? ain-
Player mit an Bord
zu holen.» Bei der Blockchain-Technolo gie handelt es sich um einzel ne Datenblöcke, die chronolo-
Tim Weingärtner, Departement Informatik, Hochschule Luzern (HSLU) gisch an werden, einander angehäng nachdem überprüf t t wurde, ob beispielsweise bei einer Zahlung alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen
Tim Weingärtner ist. Das Besondere an Bloc chain ist, dass alle Beteili kgist Studienleiter ten jederzeit ze zugreifen auf a , dies lle Datens e aber nic ätht an der HSLU. Als mehr verändern können. Alle solcher befasst Bet ren reib auf er d ihr er Block en Rech cha ner in fühn eine er sich unter vol his lstä tori ndige Kopie der Date e. So wird die Unverä nnanderem mit dem derbarkeit sichergestellt.
Potenzial, das Welche Vorteile birg der Einsatz dieser t die BlockchainTechnologie hat. Technologie für die Hersteller, Händler u Endkonsumenten? nd
Für alle drei Gruppen die Gewissheit darüber, wo ein Rohstoff tatsächlich herkommt. Für Händler dürfte der rasche Informationsfluss bei Rückrufaktionen wichtig sein. Für Hersteller und Endkonsumenten wiederum bietet sich durch die Blockchain-Technologie die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Jede neue Technologie birgt auch Risiken. Welche sind dies im Falle der Blockchain? Das ist zum einen der Aufwand der Implementierung, zum anderen müssen sich alle Beteiligten auf ein Ökosystem einigen und bereit sein, mitzumachen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist jener der personenbezogenen Daten. Bei aller Transparenz, welche die Blockchain-
Technologie bietet, dürfen diese Daten nicht in der Blockchain gespeichert werden, um nicht gegen Datenschutzvorschriften zu verstossen. Stehen wir bei der Blockchain-Technologie noch am Anfang oder schon mittendrin? Es werden noch viele neue Anwendungsfälle hinzukommen, vor allem ausserhalb der Kryptowährungen. Alles in allem würde ich sagen, dass wir in Hinblick auf die BlockchainTechnologie noch ganz am Anfang stehen. Die Nutzerzahlen kann man mit jenen des Internets im Jahr 1998 vergleichen. KONTAKT Hochschule Luzern Zentralstrasse 9 6002 Luzern Tel. 041 228 41 11 hslu.ch Wie bei einer Kette ist auch bei der Blockchain jedes Glied von Bedeutung.

DIE KURZE GESCHICHTE HINTER DEN «BLÖCKEN»
Die Technologie, auf der Blockchain-Datenspeicher und -Workflows basieren, gibt es laut Angaben der Technologiefirma Sas bereits seit den 1990er-Jahren. Die erste echte Blockchain-Implementierung war Bitcoin. Bitcoin – 2008 erstmals beschrieben und 2009 als Open-Source-Software veröffentlicht – ist ein Peer-to-Peer-System zur Verwaltung digitaler Assets und Zahlungen ohne Ausfallpunkt. Darunter versteht man einen Bestandteil eines technischen Systems, dessen Ausfall den Ausfall des gesamten Systems nach sich zieht. Frühere Versuche, eine digitale Währung zu schaffen, waren fehlgeschlagen, weil digitale Transaktionen kopiert werden konnten und es den Nutzern so möglich war, Geldbeträge mehrmals auszugeben. Bitcoin löste dieses Problem mit den universellen Buchhaltungs- und Bestätigungsprozessen von Blockchain. Mit der wachsenden Popularität von Bitcoin entstanden schnell weitere digitale Währungen mit jeweils eigenen Blockchain-Implementierungen. Mittlerweile wird solchen Lösungen branchen- und anwendungsübergreifend grosses Interesse entgegengebracht. Im Lebensmittelbereich setzen unter anderem auch die Konzerne Nestlé und Unilever Blockchain bei einigen wenigen Produkten ein. mentinnen und Konsumenten mit dem Scannen einer Produkt-ID auf der Verpackung des Endproduktes überprüfen. Mit der Open-Source-Software möchte das Suschain-Team auch andere Firmen in der Branche dazu motivieren, nachhaltiger und fairer zu agieren. Und: Sie möchte Transparenz reinbringen.
Start-up legt Karten auf den Tisch
Bereits einen Schritt weiter ist das schweizerisch-ghanaische Startup Koa. Das Startup, das dafür bekannt ist, das weisse Fruchtfleisch der Kakaobohnen zu verwerten und so das Einkommen von ghanaischen Kleinbauern zu erhöhen, setzt auf die Blockchain-Technologie. «Anstatt gute Geschäftspraktiken zu behaupten, legen wir die Karten auf den Tisch und lassen Konsumenten jede Bezahlung an Kakaobauern einsehen», sagt Anian Schreiber, Geschäftsführer von Koa. Mittels Scan eines QR-Codes, der auf der Verpackung des Produktes angebracht ist, können Konsumentinnen und Konsumenten bereits heute sehen, wie viel Geld die Bauern dank Koa mehr verdienen.
Bei der System-Entwicklung arbeitete Koa mit dem Berliner Software-Startup Seedtrace zusammen. «Wir verifizieren jede Transaktion und speichern sie dezentral auf einer emissionsarmen Blockchain ab. Gemeinsam mit Koa setzen wir damit neue Standards, die sicherstellen, dass die Informationen verifiziert sind, nicht manipuliert werden können und in Echtzeit für die Öffentlichkeit zugänglich sind», sagt Ana Selina Haberbosch von Seedtrace. Die beiden Firmen sind zwei der wenigen, die sich die Blockchain-Technologie im Lebensmittelsektor zunutze machen. Diese hat laut Tim Weingärtner von der Hochschule Luzern noch viel Potential (siehe Interview). •
Anzeige

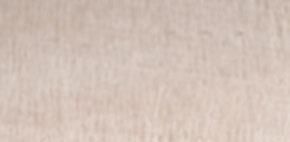









Vom Besten


VIDEO















