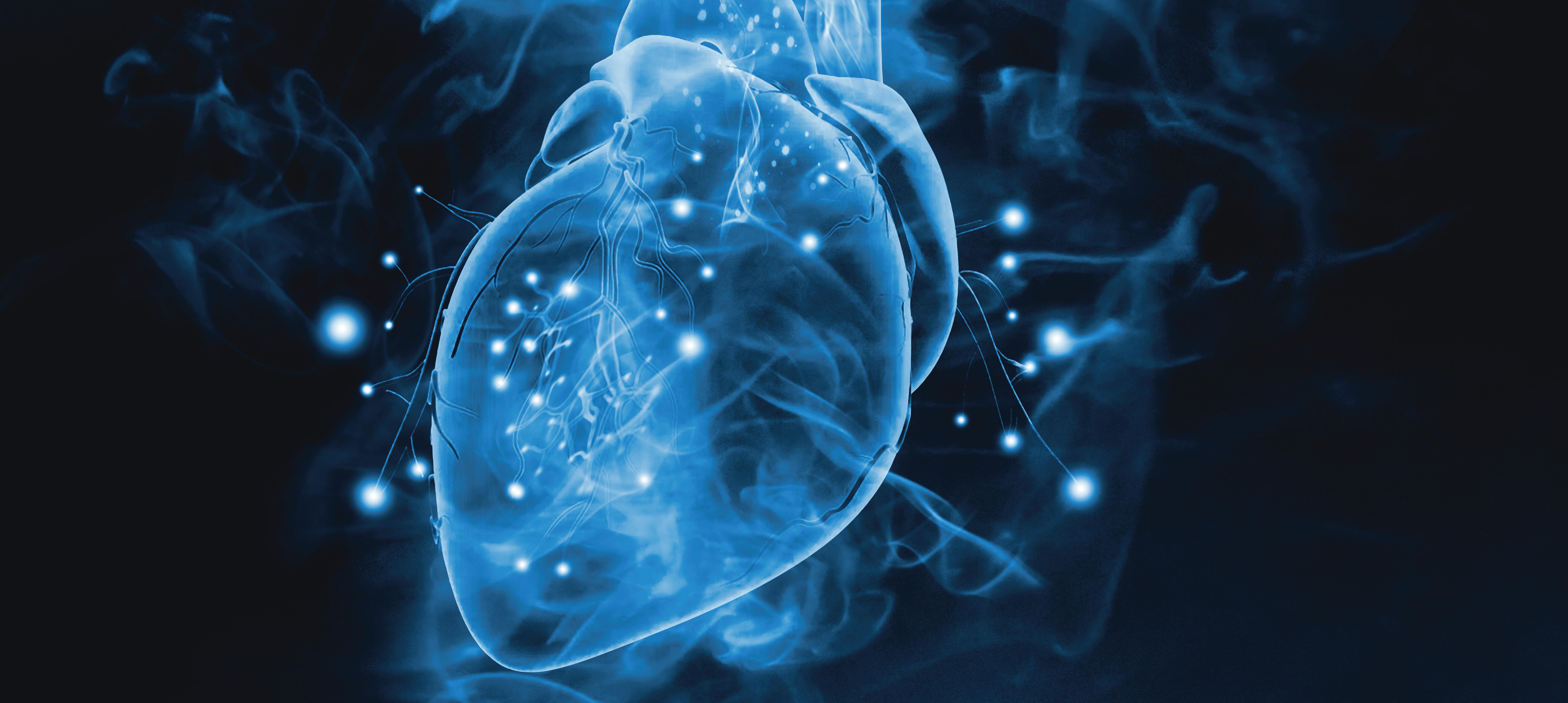
8 minute read
Management im Wandel
Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion diagnostizieren und gezielt behandeln
„Rund zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der westlichen Welt leiden an Herzinsuffizienz“ , so Prim.a Assoc. Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Diana Bonderman, 5. Medizinische Abteilung mit Kardiologie, Klinik Favoriten, Wien, zu Beginn ihres Vortrags im Rahmen eines Pressegesprächs.* Die Schätzung beruft sich auf unterschiedliche internationale Registerdaten.1 Die Dunkelziffer ist der Expertin zufolge wahrscheinlich sehr viel höher. „Herzinsuffizienz-Patientinnen und -Patienten mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) werden häufig nicht richtig erfasst. “ Mit der österreichischen Datenlage verhalte es sich ähnlich. Ein folgenschwerer „blinder Fleck“ , wenn man bedenkt, dass mehr als 50 % der Personen mit Herzinsuffizienz eine HFpEF haben und dieser Anteil zunimmt.2 Etwa 30 % der Betroffenen sterben nach einer Hospitalisierung noch innerhalb des ersten Jahres.3,4 Bislang fehlten für die HFpEF spezifische Behandlungsmöglichkeiten. Mit der Zulassung von Empagliflozin für die Therapie von symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II und größer), unabhängig von der linksventrikulären Ejektionsfraktion, hat sich dies jedoch geändert.
Der Weg zur Diagnose
Prof.in Bonderman erklärt, dass die Diagnosestellung einer HFpEF eine klinische Herausforderung sei, was allein aus ihrer Definition gemäß den aktuellen ESCGuidelines5 ersichtlich werde. Bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) und bei der Herzinsuffizienz mit mild reduzierter Ejektionsfraktion (HFmrEF) beschränkt sich die Definition auf klinische Symptome sowie eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) von ≤ 40 % bzw. 41–49 %. Bei der HFpEF ist die LVEF erhalten und beträgt ≥ 50 %. „Die Symptome sind oft nicht spezifisch. Daher braucht man zusätzliche Kriterien, um eine Herzinsuffizienz diagnostizieren zu können“ , schildert die Expertin. „Das sind einerseits erhöhte natriuretische Peptide, andererseits weitere Echo-Parameter, die strukturelle und/ oder funktionelle Veränderungen am linken Ventrikel, am linken Vorhof oder eine pulmonale Hypertension, also auch Veränderungen am rechten Ventrikel, zeigen. Da wird es schon kritisch und komplex“ , weiß Prof.in Bonderman und führt zwei Diagnosealgorithmen an, die man zur Hand nehmen könne: den vierstufigen HFA-PEFF-Algorithmus von Pieske et al.6 sowie einen vereinfachten Diagnosealgorithmus aus den ESC-Leitlinien. „Die Parameter spiegeln die Pathophysiologie der HFpEF wider.“
Richtungsweisender Phänotyp
Zudem hebt die Kardiologin einen amerikanischen Score (siehe Abbildung) hervor: „Der H2FPEF-Score beschreibt im Wesentlichen einen Patientenphänotyp, und das erleichtert die Diagnose. “ Der klassische Phänotyp sei weiblich, 72 Jahre alt, übergewichtig und habe in bis zur Hälfte der Fälle Vorhofflimmern, in der Hälfte der Fälle einen Diabetes. „Wenn ich eine solche Person mit Beschwerden wie Dyspnoe oder mit leichten Dekompensationszeichen sehe, denke ich zuerst an eine HFpEF. Natürlich brauchen wir ein Echo, um beispielsweise eine eingeschränkte Pumpfunktion oder ein Klappenvitium auszuschließen. Finden Sie jedoch nach dem Ausschluss anderer Ursachen noch ein Echo- oder NT-pro-BNT-Kriterium, welches einer HFpEF entspricht, dann haben Sie die Diagnose.“ Außerdem weist Prof.in Bonderman auf den Zusammenhang zwischen HFpEF und Lungenerkrankungen hin. Insbesondere bestehe eine Korrelation mit jenen, die mit Hypoxie einhergingen – etwa COPD oder Lungenfibrose. „Oft ist es ein kombiniertes Problem. Wenn sich jemand hypoxisch präsentiert, über starke Atemnot klagt, und man eine Lungenerkrankung diagnostiziert, dann heißt das nicht, dass keine Herzinsuffizienz vorliegt. Im Gegenteil: Das Risiko, zusätzlich eine HFpEF zu haben, ist sogar erhöht. “
Prognoseverbessernde Therapie
Auf die Diagnose folgt die Therapie – welche sich bei der HFpEF bis vor kurzem im Wesentlichen auf die Behandlung von Komorbiditäten, die Gabe von Diuretika und auf Rehabilitations- und Bewegungsmaßnahmen beschränkte, während für die Behandlung einer HFrEF in den ESC-Leitlinien eine prognoseverbessernde Vier-Säulen-Therapie, bestehend aus Angiotensin-Converting-EnzymeInhibitoren (ACEi) bzw. AngiotensinRezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNI), Betablockern (BB), Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten (MRA) und SGLT2-Inhibitoren, empfohlen wird. „Ich halte seit ungefähr zehn Jahren Vorträge über HFpEF und die Unmöglichkeit, sie adäquat zu therapieren. Seit den 1990er
Jahren gab es sehr viele Untersuchungen, die versuchten, dieses Problem in den Griff zu bekommen, und sie sind alle gescheitert. Deswegen ist es jetzt eine große Sensation, dass wir zum ersten Mal eine Studie mit positiven Ergebnissen haben.“ Prim. Prof. Dr. Georg Delle-Karth, Abteilung für Kardiologie, Klinik Floridsdorf, Wien, geht in seinem Vortag näher auf die neue Behandlungsmöglichkeit ein: „Die SGLT2-Hemmer wurden nicht für die Kardiologie entwickelt – Empagliflozin ist ein Antidiabetikum. Über die SGLT2-Hemmung wird die Glukose über den proximalen Tubulus in der Niere nicht rückresorbiert und es kommt zu einer Glukosurie. “ In der EMPA-REGOUTCOME-Studie7 zeigte sich, dass kardiologische Patienten nicht nur keinen Schaden durch Empagliflozin erleiden, sondern auch möglicherweise davon profitieren. Daher wurde die Substanz bei Patienten mit reduzierter Linksventrikelfunktion sowie bei Patienten mit erhaltener Linksventrikelfunktion getestet.
Studienergebnisse
Grundlage der Zulassung von Empagliflozin für die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz sind die EMPEROR-Studien (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) – zwei randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studien, in denen einmal täglich verabreichtes Empagliflozin 10 mg im Vergleich zu Placebo bei Erwachsenen mit chronischer HFrEF (EMPEROR-Reduced8) oder HFpEF (EMPEROR-Preserved9), mit oder ohne Diabetes, untersucht wurde. „Die EMPEROR-Studien kamen zu einem hochsignifikanten Ergebnis. Empagliflozin reduziert die kardiovaskuläre Sterblichkeit oder HI-Hospitalisation quer durch das gesamte Spektrum der Herzinsuffizienz“ , macht Prof. Delle-Karth aufmerksam. Die EMPEROR-Preserved-Studie untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit von Empagliflozin bei 5.988 Erwachsenen mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit einer LVEF von über 40 %. Sowohl Empagliflozin als auch Placebo wurde zusätzlich zum Behandlungsstandard verabreicht. In der Studie zeigte Empagliflozin eine relative Risikoreduktion von 21 % (3,3 % absolute Risikoreduktion, HR 0,79, >
Der H2FPEF-Score als diagnostische Hilfe
Klinische Variable Werte Punkte
H2
Heavy Body-Mass-Index > 30 kg/m2 2
Hypertensive 2 oder mehr antihypertensive Medikamente 1
FAtrial Fibrillation paroxysmal oder persistent 3
PPulmonary Hypertension Doppler-Echokardiographie: geschätzter systolischer Druck der Pulmonalarterie > 35 mmHg 1
EElder Alter > 60 Jahre 1
FFilling Pressure Doppler-Echokardiographie: E/e‘ > 9 1
H2FPEF-Score Summe (0–9)
Gesamtpunkte
Wahrscheinlichkeit einer HFpEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95
[KI 0,69–0,90]; p < 0,001) für den zusammengesetzten primären Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod oder Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz. Die NNT betrug 31 und der Nutzen war unabhängig von der Ejektionsfraktion oder dem Diabetesstatus vorhanden.9 Eine frühe und anhaltende Risikoreduktion durch Empagliflozin bei Patientinnen und Patienten mit HFpEF zeigte sich bereits nach 18 Tagen.10
Subgruppen und Nebenwirkungsprofil
Auf die Ergebnisse bei unterschiedlichen Subgruppen geht Prof. DelleKarth näher ein: Die Wirkung von Empagliflozin sei Placebo in allen wesentlichen Subgruppen überlegen und von folgenden Faktoren unabhängig (keine signifikante Interaktion): • Alter, • Geschlecht, • ethnischem Hintergrund, • rezenter Hospitalisierung aufgrund von HI, • BMI, • MRA in Verwendung, • Diabetes-Typ-2-Status, • LVEF (HFmrEF oder HFpEF), • chronischer Niereninsuffizienz.
Empagliflozin stabilisiert dem Experten zufolge die Nierenfunktion. Sei diese allerdings bereits zu stark reduziert (GFR < 20 ml/Min.), dürfe das Medikament nicht mehr verordnet werden (siehe Infobox), ebenso bestehe bei Typ-1-Diabetes eine Kontraindikation. Nebenwirkungen hat die Therapie mit Empagliflozin laut Prof. Delle-Karth kaum. „Die Rate schwerer Nebenwirkungen war auf Placeboniveau. “ Zu sehen gewesen sei ein kleiner Trend hin zu mehr Hypotension, da das Plasmavolumen abnehme. Dies könne ein gewünschter Effekt sein, allerdings sollte man gegebenenfalls die Diuretikadosis anpassen. Aufgrund der Glukosurie sei insbesondere bei Menschen mit Diabetes auch ein vermehrtes Auftreten von Infektionen des Harntrakts zu bedenken. Die Schlussfolgerung des Experten: „Natürlich bedarf es eines Monitorings, aber es steht hier eine sehr sichere Substanz mit einer einfachen Dosierung zur Verfügung.“
Lebensqualität im Blick
Für Betroffene ist nicht nur die Prognose wichtig, sondern auch die Lebensqualität. „Patienten mit HFpEF haben zwar eine bessere Prognose als Personen mit HFrEF, aber keine bessere Lebensqualität“ , betont Prof. Delle-Karth. In diesem Zusammenhang führt der Kardiologe Daten an, die beim ESC-Kongress 2022 am 27. August präsentiert wurden. Eine Metaanalyse der EMPEROR-Preserved- und der DELIVER-Studie11 zu Dapagliflozin konnte zeigen, dass sich die Lebensqualität unter der SGLT2-Hemmung signifikant verbesserte – gemessen mit dem Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). „Die Ergebnisse sind beeindruckend. Eine Verbesserung um fünf Punkte ist schon sehr gut, aber bei vielen Patienten kam es zu einer Verbesserung um 10, sogar um 15 Punkte. Auch zu einer Verschlechterung kam es signifikant seltener unter den SGLT2-Hemmern, verglichen mit Placebo. “ Prof.in Bonderman ergänzt: „Wir haben ein Medikament, dessen Vorteile die Patienten wirklich spüren, es hat eine positive klinische Auswirkung, kaum oder keine Nebenwirkungen, es wirkt rasch und eine Titration ist nicht nötig.“
Fazit: Awareness steigern
Gegen Ende des Pressegesprächs kommt Prof.in Bonderman nochmals auf die Diagnose zurück und unterstreicht, dass die Zeit gekommen sei, Patientinnen und Patienten mit HFpEF mehr zu berücksichtigen. Diesbezüglich zeigt sich die Expertin aber optimistisch: „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Meine Erfahrung ist: Sobald es eine Therapie gibt, steigt die Awareness. Man möchte etwas Gutes tun und es ist frustrierend zu sagen: ‚Ich kenne Ihre Diagnose, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen.‘“ Prof. Delle-Karths abschließende Message lautet: „Ich denke, dass der Cut-off von LVEF < 40 %, um mit einer sinnvollen Therapie zu beginnen, an Bedeutung verlieren wird. Es besteht die Diagnose Herzinsuffizienz, es gibt unterschiedliche Subtypen, und man kann jetzt Gott sei Dank im gesamten Spektrum etwas tun. Ich glaube, das ist der ‚Gamechanger‘, denn bis jetzt hatten wir nur bei der reduzierten Linksventrikelfunktion eine gezielte Therapie zur Hand – nun ist doch eine neue Zeit angebrochen.“
Anna Schuster, BSc
* Pressegespräch: „Herzinsuffizienztherapie –
Gamechanger Empagliflozin: Neue Erstattung RE2 (Hellgelbe Box) ab 1. September 2022“, 31. August 2022,
Skybar – Business Corner, Wien.
Referenzen: 1 Groenewegen A et al., Eur J Heart Fail. 2022, 22: 1342-1356. 2 Vasan R et al., JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11:1-11. 3 Owan TE et al., N Engl J Med. 2006;355:251-259. 4 MAGGIC Group, Eur Heart J 2012;33:1750-1757. 5 McDonagh TA et al., Eur Heart J 2021; 42: 3599-3726. 6 Pieske B et al., Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317. 7 Zinman B et al., N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 8 Packer M, et al., N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424. 9 Anker S et al., N Engl J Med 2021; 385:1451-1461. 10 Butler J et al., Eur J Heart Fail 2022;24(2):245-248. 11 Solomon SD et al., N Engl J Med 2022; 387:1089-1098.
AKTUELL
Erstattung Empagliflozin 10 mg – seit 1. September 2022
Hellgelber Bereich, RE2
Bei Patient:innen mit Diabetes Typ II: � Die Behandlung darf erst ab einem
HbA1c > 7 begonnen werden. � Die Behandlung hat nur als Second-
Line-Therapie zu erfolgen. � Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance < 30 ml/Min. oder eGFR < 30 ml/Min./1,73 m2 . � Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation. � Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen.
Bei erwachsenen Patient:innen mit chronischer Herzinsuffizienz als Zusatztherapie: � Wenn die Patient:innen trotz individuell optimierter Standardtherapie mit Medikamenten aus dem Grünen Bereich noch symptomatisch sind (NYHA ≥ Klasse II). � Therapieeinleitung nur bei etablierter
Diagnose der chronischen Herzinsuffizienz. � Erstverordnung und regelmäßige
Kontrollen durch Kardiolog:innen oder
Internist:innen mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz. � Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance < 20 ml/Min. oder eGFR < 20 ml/Min./1,73 m2 .
Referenz: Erstattungskodex, September 2022. Nähere Informationen unter: sozialversicherung.at/oeko/views/ index.xhtml







