
5 minute read
Das Virus und die Folgen
Nach COVID-19: Therapie und Follow-up*
SeriePULMO
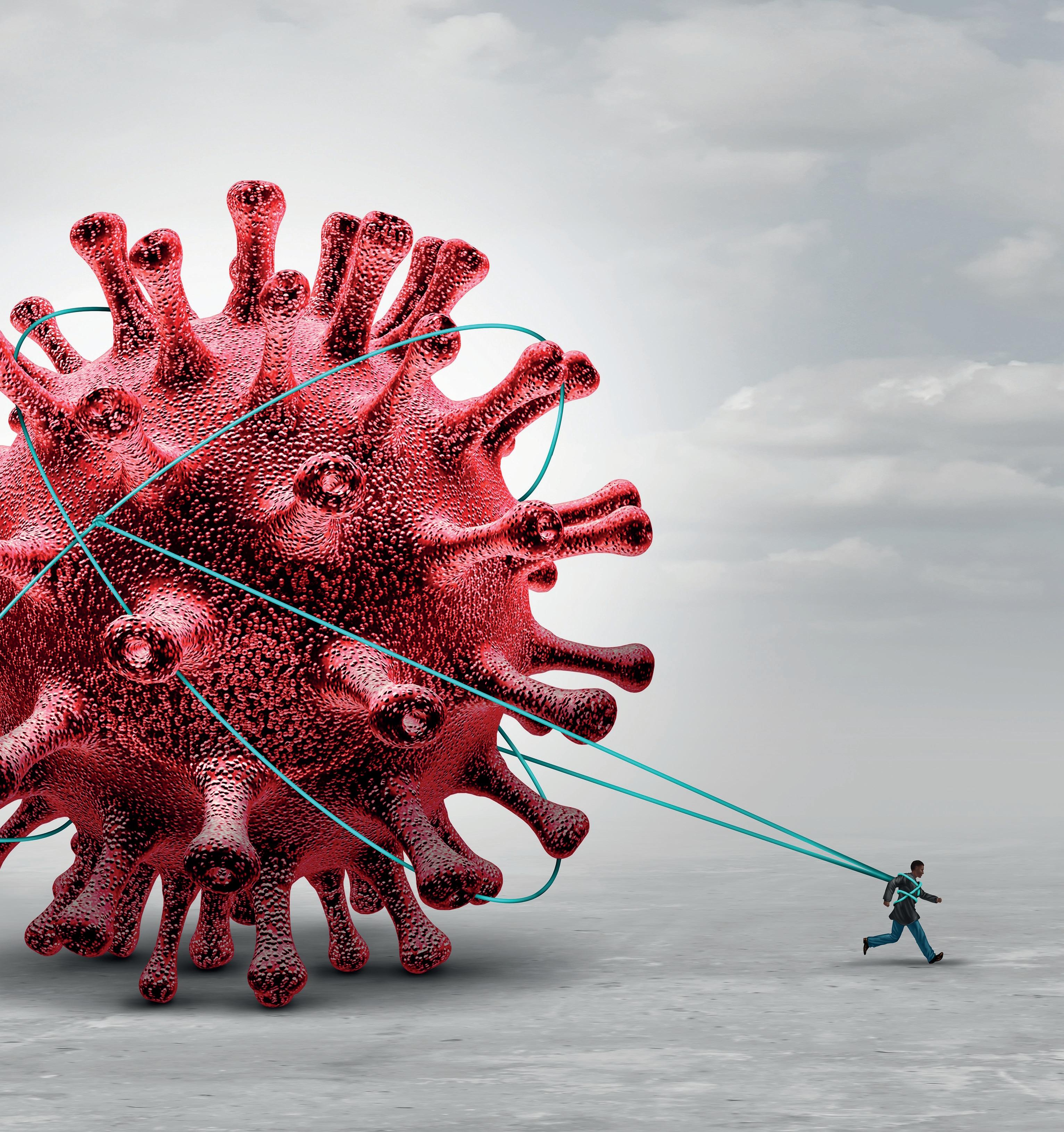
Die Prävalenz von Long/Post COVID wird aktuell mit etwa 10 % aller Erkrankten beziffert, wobei je nach Definition, Methodik und untersuchter Population die Häufigkeit zwischen 3 und 20 % schwankt. Für die ICD-Kodierung wird der Begriff des Post-COVIDZustandes genutzt (ICD U09.9), der sich vom Delphi Konsensus Statement der WHO ableitet.1 Hervorzuheben ist, dass in derzeit gültigen Richtlinien stets der zeitliche Zusammenhang zwischen der SARS-CoV-2-Primärinfektion und der Dauer der klinischen Beschwerden zur Begriffsdefinition herangezogen wird und keine COVID-19unabhängige Ursache als mögliche Erklärung für die klinischen Beschwerden vorliegen darf. Weiters ist anzumerken, dass die Begriffe Long COVID und Post-COVID-19-Syndrom nur verwendet werden sollten, falls schwere klinische Einschränkungen bestehen, welche die Lebensqualität beeinträchtigen und Alltagsfunktionen limitieren.2
GASTAUTOR: Priv.-Doz. Dr. Thomas Sonnweber, PhD
Pneumologie, Innere Medizin II, Universitätsklinik Innsbruck
Pathogenese und Risikofaktoren
In Bezug auf die Ursache der Persistenz klinischer Beschwerden nach CO-
VID-19 wurden zahlreiche Hypothesen postuliert. Diese umfassen eine chronische Inflammation durch Viruspersistenz bzw. eine anhaltende Immunreaktion auf persistierende virale Antigene, eine Dysbiose des Mikrobioms oder Viroms, zelluläre und metabolische Dysfunktionen, (Hyper-)Inflammation, autonome Dysregulation, Hyperkoagulabilität und Thrombosen, Autoimmunität, welche mit der Bildung von Anti-Idiotyp-Antikörpern einhergeht, einen anhaltenden postinfektiösen Gewebeschaden einschließlich prolongierter Endothelschäden und Störungen der Mikrovaskularisierung sowie eine prolongierte postinfektiöse Dysregulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS). Klare Risikofaktoren für Long/Post COVID sind nicht bekannt und auch milde COVID-19-Akutverläufe können zu persistierenden Beschwerden führen. Hervorzuheben ist, dass Alter, Geschlecht und Symptomlast während der Akuterkrankung mit dem Long-/Post-COVID-Risiko korrelieren, wobei Frauen bis zum 60. Lebensjahr doppelt so häufig Long/Post COVID entwickeln wie Männer.
Klinik von Long/Post COVID
Die klinische Symptomatik persistierender Beschwerden nach COVID-19 ist unspezifisch. Da COVID-19 eine Multisystemerkrankung darstellt, wurden mehr als 200 verschiedene COVID19-assoziierte Symptome beschrieben, wobei Fatigue, Belastungsdyspnoe, kognitive Einschränkungen, Angststörungen, Depression und Schlafstörungen zu den führenden Symptomen gezählt werden.1, 2 Weitere Symptome wie Anosmie, Ageusie, Brustschmerzen, Tachykardie, Muskelschwäche und Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, gastrointestinale Beschwerden, Hautmanifestationen, kognitive Einschränkungen („brain fog“) und psychische Einschränkungen werden regelhaft beschrieben. Post-COVID-19-Beschwerden können dabei Monate bis Jahre persistieren oder einen fluktuierenden/ relapsierenden Charakter haben.
COVID-19
Typische Symptome bei Nachweis einer Sars-CoV-2 Infektion
Diagnose 4 Wochen 12 Wochen
AKUT
Symptome bestehen für bis zu 4 Wochen
Fortwährend symptomatische COVID-19
Symptome bestehen für 4 bis 12 Wochen
Post-COVID-Syndrom
Symptome bestehen länger als 12 Wochen und sind nicht durch andere Diagnosen erklärbar
Long COVID
Symptome bestehen länger als 4 Wochen oder neue Symptome kommen hinzu
Abbildung: Begriffsdefinition persistierender Beschwerden nach COVID-19; adaptiert nach 2, 3 .
Diagnostik bei Long/Post COVID
Diagnostisch steht zunächst die Erfassung und Charakterisierung von vorliegenden Einschränkungen im Vordergrund. Hierfür stehen von verschiedenen Fachgesellschaften standardisierte Fragebögen zur Verfügung.4,5 Beispielsweise kann der funktionelle Status nach COVID-19 mittels der 5-stufigen Klok-Skala erhoben werden, die erlaubt, Patienten mit höhergradigen Einschränkungen (Klok ≥ 2) und weiterem Abklärungsbedarf von jenen mit geringen Einschränkungen (Klok ≤ 1) abzugrenzen, welche in der Regel >
keine weitere Abklärung und Kontrolle benötigen.5 Wichtig ist festzuhalten, dass Long/Post COVID nicht mittels funktioneller oder laborchemischer Untersuchungen ausgeschlossen werden kann.
Internationale Leitlinien zum Followup bei Long/Post COVID basieren aktuell nur auf schwacher Evidenz und orientieren sich einerseits an der aktuellen Symptomatik, andererseits an der Schwere der Akuterkrankung.2-4 Beispielsweise sollte bei sehr schwerem COVID-19-Akutverlauf und/oder hohem Risikoprofil (schwere Pneumonie, Komorbiditäten, kardiovaskuläre Komplikationen, hohes Alter etc.) eine Reevaluierung nach 4–6 Wochen erfolgen. Traten während der Akuterkrankung kardiovaskuläre Komplikationen (Myokarditis, Lungenembolie etc.) auf, wird eine kardiovaskuläre Evaluierung (inkl. EKG, Troponin und NtproBNPMessung, Echokardiographie) 6–12 Wochen nach akuter COVID-19-Erkrankung empfohlen. Unabhängig von der Schwere der akuten Erkrankung sollte bei persistierenden Beschwerden nach COVID-19 eine Reevaluierung nach zwölf Wochen stattfinden. Zeigen sich im Rahmen der Nachsorge höhergradige Einschränkungen oder Risikosymptome wie Atemnot und Synkopen, sollte eine weitere fachspezifische Abklärung angestrebt werden. Diese ist im Idealfall durch eine Anbindung an Long-/PostCOVID-Ambulanzen und multidisziplinäre Netzwerke möglich.2-4
Therapie bei persistierenden Beschwerden
Aufgrund der unvollständig verstandenen Pathomechanismen und des Fehlens größerer randomisierter klinischer Studien liegt aktuell keine ausreichende Evidenz für kausale Therapien zur Behandlung anhaltender Beschwerden nach COVID-19 vor. Demgemäß verweisen aktuelle Empfehlungen auf die individualisierte Therapie, welche darauf abzielt, Symptome zu lindern, eine Chronifizierung zu vermeiden und die allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern. Wegen der häufig multiplen Einschränkungen verschiedenster Organsysteme ist bei ausgeprägten Beschwerden in der Regel eine interdisziplinäre Betreuung sinnvoll. Hierbei spielt neben der hausärztlichen Betreuung insbesondere die Anbindung an pneumologische, infektiologische, kardiologische, neurologische, psychiatrische und psychologische Ambulanzen eine wesentliche Rolle, wobei stets eine symptomorientierte Zuweisung erfolgen sollte. Einen weiteren Behandlungsansatz stellen physiotherapeutische und rehabilitative Maßnahmen dar. Letztere schließen Trainingsprogramme zur Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit, aber auch psychologische/psychiatrische Therapien ein. Bei der rehabilitativen Behandlung von Long-/Post-COVID-Patienten ist ein dosiertes Training („pacing“) entscheidend, um eine Post-Exertional-Malaise (PEM) zu vermeiden.
Verlauf von Long/Post COVID
Bezüglich der Prognose von Long/Post COVID ist festzuhalten, dass ein Großteil der Patientinnen und Patienten eine spontane Heilung bzw. eine deutliche Abschwächung der Symptomatik im Verlauf zeigt. Ein kleiner Teil der Betroffenen (< 2 %) weist hingegen eine Persistenz der Beschwerden auf, die Monate bis Jahre umfasst.
Fazit
Die Genese und das Management von Long/Post COVID sind weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Derzeit stehen keine evidenzbasierten kausalen Behandlungsoptionen zur Verfügung. Dessen ungeachtet können durch eine interdisziplinäre Betreuung mit einer standardisierten Charakterisierung und symptomorientierten Behandlung Betroffener gute therapeutische Erfolge erzielt werden. <
* Der Experte war Vortragender bei der 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie von 29.9. bis 1.10.2022, Salzburg Congress.
Referenzen: 1 WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. [cited 30/08/22]; who. int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_CO-
VID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1 2 Koczulla AR et al., S1 Guideline Post-COVID/Long-
COVID. Pneumologie (Stuttgart) 2021: 75(11): 869-900. 3 Sivan M, Taylor S, NICE guideline on long covid. Bmj 2020: 371: m4938. 4 Rabady S et al., Guideline S1: Long COVID: Diagnostics and treatment strategies. Wiener klinische Wochenschrift 2021: 133(Suppl 7): 237-278. 5 Klok FA et al., The Post-COVID-19 Functional Status scale: a tool to measure functional status over time after
COVID-19. The European respiratory journal 2020: 56(1).
Weitere Literatur beim Autor.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
� Persistierende Beschwerden nach „coronavirus disease 2019“ (COVID-19) werden je nach angewandter Definition, Methodik und untersuchter Kohorte bei 3 bis 20 % aller Erkrankten beobachtet. - Die klinische Symptomatik nach COVID-19 ist unspezifisch, am häufigsten werden Symptome wie Fatigue, Dyspnoe, muskuläre Schwäche, kognitive Einschränkungen, Schlafstörungen,
Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Anosmie, Ageusie sowie eine ängstliche und/oder depressive Stimmung beschrieben. - Höhergradige persistierende COVID-19-Symptome, die keiner anderen Ursache zugeordnet werden können, werden je nach zeitlichem Abstand zur Primärinfektion als Long COVID (Beschwerden > 4 Wochen) bzw. als Post-COVID-19-Syndrom (Beschwerden > 12 Wochen) bezeichnet. - Ein spezifisches Risikoprofil für Long/Post COVID ist aktuell nicht bekannt und die interindividuellen Verläufe zeigen eine starke Varianz. - In der Betreuung von Patienten mit persistierenden Beschwerden nach COVID-19 sind
Erfassung, Charakterisierung und Graduierung der Symptomatik von großer Bedeutung, da angesichts des Fehlens kausaler Therapieansätze eine individualisierte symptomorientierte
Therapie angestrebt wird. - Während in einem kleinen Teil der Patienten Beschwerden über mehr als zwei Jahre beschrieben werden, so ist bei einem Großteil der von Long/Post COVID Betroffenen von einer
Spontanheilung und guten Prognosen auszugehen.








