
3 minute read
Neue Aufgaben für autonome Roboter
Neue Aufgaben für intelligente Helfer
Forschungsprojekte zu autonomen Robotern erfolgreich abgeschlossen
Roboter sind stärker als Menschen, ihre Bewegungen schneller und präziser. Aber bis sie ähnlich wie Menschen Aufgaben selbstständig übernehmen können, sind viele konzeptionelle und technische
Herausforderungen zu überwinden.
Mit drei Forschungsprojekten, die bei einer Konferenz viel Aufmerksamkeit erfuhren, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der H-BRS die Leistungsfähigkeit und Sicherheit autonomer Systeme ein Stück vorangetrieben.
Kollege KELO 500 Dow schiebt selbstständig Transportwagen oder Betten durch die Klinik und kommuniziert mit den anderen elektronischen Mitarbeitern
Wie können Roboter das Personal in Krankenhäusern entlasten?
Nicht nur in Zeiten der Pandemie kommt es darauf an, dass Pflegerinnen und Pfleger nicht mit logistischen Aufgaben wie dem Abtransport von Schmutzwäsche oder leeren Wasserflaschen beschäftigt sind. Dank des abgeschlossenen EU-Forschungsprojekts ROPOD gibt es demnächst einen marktreifen Roboter, der das übernimmt. Den hat die H-BRS gemeinsam mit der Katholischen Universität Leuven, der Technischen Universität Eindhoven und den Industriepartnern SMF Ketels und Locomotec entwickelt und in den AGAPLESION Frankfurter Diakonie Kliniken getestet. Der KELO 500 Dow kann selbstständig Transportwagen oder Krankenbetten durch das Haus befördern. Mit einem Plan des Gebäudes im Speicher bestimmt der Roboter selbst seine Route und kann mithilfe automatisierter Fahrstühle sogar auf mehreren Geschossen frei agieren. Aufgabe der Forscher aus Sankt Augustin war unter anderem die Fehleranalyse und das sogenannte Fleet Management: Sie programmierten Routinen, mit denen sich mehrere Roboter die Arbeit aufteilen oder im Störungsfall füreinander einspringen können. Die beiden Industriepartner gründeten im März 2020 das Joint Venture KELO Robotics, das die Ergebnisse des Projekts zur Serienreife bringen möchte. An dem Roboter KELO 500 Dow zeigt mittlerweile auch der Logistik-Riese DHL Interesse.
Können Roboter dabei helfen, pflegebedürftige Angehörige besser zu betreuen?
Im dünn besiedelten ländlichen Raum, wo die Entfernungen größer sind und das Pflegepersonal knapp, könnten Roboter eine soziale Stellvertreterposition übernehmen. Ob das funktioniert, hat das Forschungsprojekt RoboLand in zwei hessischen Landkreisen untersucht. In Zusammenarbeit mit Pflegewissenschaftlern von der Hochschule Fulda testeten die Forschenden der H-BRS in Haushalten von an Demenz erkrankten Menschen den Einsatz des Telepräsenzroboters „Double“. Er besteht aus einem fahrbaren Tablet an der Spitze einer Stange und kann von pflegenden Angehörigen ferngesteuert werden. Neben den rein technischen Problemen befassten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit Fragen der Akzeptanz. Wie gehen die Pflegebedürftigen und das Pflegepersonal aus der Ferne mit der Technologie um? Die Videobeobachtung brachte wichtige Erkenntnisse zu den Grenzen dieser Stellvertretersysteme. „Es ist schwierig mit Angehörigen zu kommunizieren, wenn man nur wie durch ein Schlüsselloch in einen Raum blickt“, sagt Erwin Prassler, Professor für Autonome Systeme an der H-BRS. Sein Folgeprojekt nimmt deshalb die sogenannte immersive Telepräsenz in den Blick: In diesem Fall trägt ein noch zu entwickelnder Roboter eine 360-Grad-Kamera und der Beobachter in der Ferne eine Datenbrille, die die volle Raumwahrnehmung ermöglicht.
Kann man vorhersagen, ob ein Roboter zuverlässig und sicher die Aufgabe erfüllt, für die er vorgesehen ist?
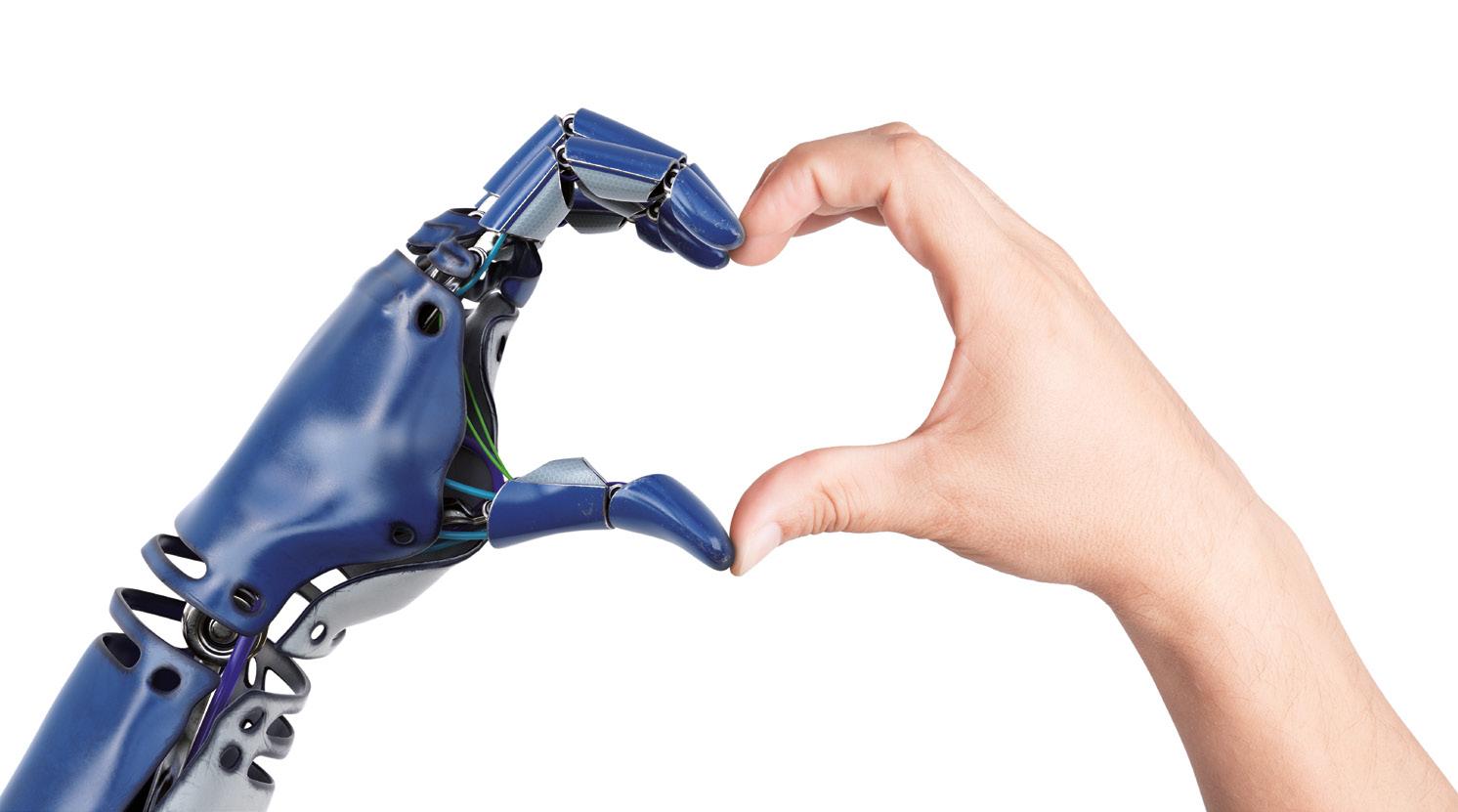
Eine Antwort auf diese Frage hat das Projekt VeriComp, das im November 2020 abgeschlossen wurde. Wenn zum Beispiel ein Roboter eine Schraube in eine Holzplatte drehen soll, ist dabei vieles zu beachten: Wie schwer ist die Platte, die der eine Arm hält? Wie viel Kraft braucht der andere Arm zum Drehen? Sind beide aufeinander abgestimmt und verfügen sie über die nötige Anzahl an Gelenken für die vorgesehene Bewegung? In der Computersimulation lässt sich der ganze Prozess modellieren und überprüfen. „So können wir zuverlässige Aussagen machen, sowohl in Bezug auf die erfolgreiche Ausführung der Aufgabe als auch zu Fragen der Sicherheit“, erklärt Nico Hochgeschwender, Professor für Robotik, Autonome Systeme und deren Sicherheit. Die an der Hochschule entwickelte Software lässt sich an verschiedenste Roboteraufgaben und -systeme anpassen. Damit ist sie interessant für Roboterentwickler und Lieferanten von Einzelkomponenten, die maßgeschneiderte Paketlösungen für Kunden anbieten möchten.
Wie lernen Roboter aus eigenen Fehlern?
Diese Frage beschäftigt Alex Mitrevski, Doktorand am Fachbereich Informatik, in Kooperation mit der Knowledge-Based Systems Group an der RWTH Aachen. Sein Ansatz besteht darin, dass ein KI-Algorithmus aus einer Masse von Daten sogenannte „constraints“, also notwendige Einschränkungen zur Lösung einer Aufgabe, herausfiltert. Zum Beispiel, dass es beim Transport von Wasser darauf ankommt, nichts zu verschütten, oder Nägel nach Möglichkeit gerade in eine Wand geschlagen werden. Einfache, aber für einen Roboter nicht selbstverständliche Erkenntnisse. Ähnlich wie ein lernendes Kind wird die Maschine durch menschliches Feedback unterstützt. Mitrevskis Überlegungen, vorgetragen bei der renommierten „International Conference on Intelligent Robots and Systems“ (IROS), wurden mit dem IROS Best Paper Award ausgezeichnet. „Das ist wirklich ein Ereignis“, meint Mitrevskis Betreuer Professor Paul G. Plöger. „Es gibt genug Forscher, die das in 30 Jahren akademischer Karriere nicht erreichen.“









