
9 minute read
Mit aktivem Gestalten die innere Sprachlosigkeit unterbrechen
Kreativität kann während und nach einer Krebserkrankung wichtig für die Verarbeitung der überwältigenden Erlebnisse sein.
Advertisement
Michi Peters (Alle Fotos: privat)
William Shakespeare hat einmal gesagt: „Der Kummer, der nicht spricht, na gt am Herzen, bis es bricht.“ Da steckt sehr viel Wahres drin, sagt Psychoonkologin Michi Peters. Hummer statt K rebs sprach mit der Psychoonkologin über die Bedeutung, in schwerer Erkrankung eine persönliche Ausdrucksform zu finden, und übe r die Frage, was heute im Angesicht der Erkrankung ein Tabu ist.
Frau Ort hat ein Buch geschrieben um ihre Krebserkrankung zu verarbeiten. Andere malen vielleicht, oder singen. Welche Wege kennen Sie noch und warum kann es wichtig sein, einen solchen Ausdruck zu finden?
Beate Ort hat mit ihrem Buch ihre Krebserkrankung verarbeitet und außerdem vielen Betroffenen damit ein großartiges Geschenk gemacht. Das ist eine sehr mutige Form des Ausdrucks. Bei meinen Patientinnen kann ich beobachten, dass sich unterschiedlichste Wege zeigen, um etwas zum Ausdruck zu bringen oder zu verarbeiten. Einige beginnen ein Tagebuch zu schreiben, andere nähen die tollsten PatchworkDecken oder häkeln wunderschöne Schals. Eine junge Patientin hat an einem Steinmetzkurs teilgenommen und „ihren Krebs“ in Sandstein gemeißelt nun im Garten stehen. Seit Jahren beobachtet sie, wie der Stein verwittert und sich langsam auflöst. Ich denke, für die ein oder andere kann es wichtig sein, einen solchen Ausdruck zu finden, weil oft die Worte fehlen und das aktive Gestalten die innere Sprachlosigkeit unterbricht. Außerdem bedeutet die fokussierte Aufmerksamkeit auf einen kreativen Prozess, ganz gleich welcher Art, immer auch, mit allen Sinnen im Moment zu sein, also einzigartige im Selbst entstandene Achtsamkeit.
Sie waren selbst vor vielen Jahren an Krebs erkrankt. Haben Sie damals auch einen „künstlerischen“ Ausdruck gefunden?
Ich selbst habe mich während meiner Krebserkrankung wieder an mein „altes“ Hobby, die Fotografie, erinnert. Der Blick durch die Kamera hat mich dazu gebracht die Dinge zu suchen, die mich berührten. Das Licht, die Sonnenstrahlen, außergewöhnliche Wolkenbilder haben mich besonders fasziniert. Über die Kamera konnte ich für meine wundervolle Umgebung mein Herz öffnen, ohne angesichts der überbordenden Schönheit der Natur sofort die Vergänglichkeit zu betrauern. Kurz gesagt: Der Blick durch die Kamera hat mir den selbstvergessenen Moment wiedergeschenkt. Dafür empfinde ich große Dankbarkeit. Ich fotografiere heute, nach fast 20 Jahren immer noch leidenschaftlich gerne.
Wie findet man diesen Ausdruck überhaupt? Manche sagt vielleicht, „das kann ich alles nicht“.
Ich bin davon überzeugt, dass es umgekehrt sein und man von einer Ausdrucksform auch gefunden werden kann. Patientinnen erzählen mir dann davon, dass sie aus heiterem Himmel Lust bekamen „etwas mit Farben zu machen“ oder die „alte Nähmaschine nochmal raus zu kramen“ oder, wie eine Kursteilnehmerin berichtete, ihr sei die Idee gekommen, kleine Herzkissen mit ➔
Klettverschluss zu nähen, die man am Sicherheitsgurt des Autos befestigen kann, damit der Gurt nicht drückt, wenn er über den implantierten Port verläuft. In diesem Fall hat sich die Kreativität in etwas ganz Praktischem ausgedrückt. In Workshops für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung habe ich Teilnehmerinnen erlebt, die sich vollkommen ahnungslos im künstlerischen Teil der Veranstaltung wiederfanden und erst einmal strikt von sich behaupteten, nicht malen zu können. Unter Anleitung einer Künstlerin und motiviert durch die Gruppe entstand dann doch zum großen


Erstaunen der Teilnehmerin ein Bild, das sie überglücklich und voller Stolz mit nach Hause nahm. Durch dieses Erlebnis begann das Vertrauen in ihre Fähigkeiten wieder zu wachsen, wie eine kleine Pflanze, die vorübergehend zu wenig Licht bekommen hatte. Manchmal ist ein kleiner Anstoß in einer Gruppe von Gleichbetroffenen eine große Hilfe, die „richtige“ Ausdrucksform zu finden. Patientinnen, mit denen ich in dem Workbook „Der größte Teil ist heil“ (Hummer statt Krebs 2019) arbeite, entdecken oft durch die inhaltliche Anleitung einen Weg, endlich etwas zum Ausdruck zu bringen, das längst „gesagt“ werden wollte. Sicherlich ist es auch hilfreich, wenn man offen für unterschiedliche Möglichkeiten ist und einfach mal etwas testet oder aufgreift, was man als Kind gerne gemacht hat.
Können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, dass es Betroffenen „leichter“ fällt mit ihrer Erkrankung umzugehen, wenn sie den Fokus auf etwas Kreatives wie Schreiben legen können?
Ich bemerke im Gespräch, dass es hilfreich sein kann, den Fokus auf etwas zu richten, das für den Zeitraum des Tuns die volle Aufmerksamkeit bekommt und mit Hingabe getan wird. Durch einen kreativen Prozess verschaffen sich Betroffene Auszeiten von der Erkrankung und Ich-Inseln, die sich wie ein sicherer Ort anfühlen. Ganz egal, wie der kreative Prozess auch aussehen mag, ob gemalt, getöpfert, geschrieben, genäht oder gekocht wird, es wird etwas sichtbar und begreifbar, das in seiner Form ausgedrückt werden wollte. Um sich auszudrücken bedarf es meines Erachtens jedoch nicht unbedingt der künstlerischen Aktivität. Ich erlebe Frauen, die sich regelmäßig in Gruppen treffen und gemeinsam etwas unternehmen oder Sport treiben und dadurch in einen regen Austausch im Gespräch kommen und beginnen, über sich und ihre Erkrankung zu sprechen. Auch das ist eine Form sich „Ausdruck“ zu verschaffen und wird als eine Art „Flow“ empfunden. Wenn man davon ausgeht, dass eine schwere Erkrankung oftmals zu einer Neuorientierung im Leben führt, spielen bei der Entstehung der individuellen kreativen Ausdrucksform sicher auch Inhalte und Herausforderungen aus dem Leben vor der Diagnose eine große Rolle. Auch bewusste Begegnungen mit der eigenen Stille können demnach eine wohltuende Ausdrucksform sein, wenn die Zeit vor der Erkrankung als laut und turbulent empfunden wurde.
Jüngere Erkrankte scheinen weniger Scheu zu haben, mit ihrer Geschichte
an die Öffentlichkeit zu gehen als ältere. Täuscht dieser Eindruck? Frau Ort mit ihren 50 plus berichtete, wie schwer ihr dieser Schritt fiel.
Ich denke, der Eindruck täuscht. Es gibt leider immer mehr junge Erwachsene, die eine Krebsdiagnose erhalten. Junge Erwachsene haben einen selbstverständlichen und direkten Umgang mit sozialen Medien, die mit dem Begriff „Öffentlichkeit“ gleichzusetzen sind. Sie sind es gewohnt Fotos ihrer wichtigen Lebensereignisse regelmäßig auf Internetseiten, die für ihren Freundeskreis zugänglich sind, zu posten und kommentieren zu lassen. Es gibt also eine Form der Öffentlichkeit, ohne persönlich und leibhaftig in Erscheinung zu treten oder in fühlbaren/erlebbaren Kontakt mit den Adressaten zu kommen. Das betrifft im weitesten Sinne die Generationen U-40. Deshalb sieht man auf unterschiedlichsten Internetplattformen auch mehr junge Gesichter als ältere. Ich begrüße das und hoffe, dass auf diesem Wege mehr und mehr über Therapieformen, Hilfsmittel, begleitende und unterstützende Maßnahmen öffentlich diskutiert und informiert wird. Ich würde mir wünschen, dass auch die steigende Zahl der Überlebensgeschichten und Geschichten derjenigen, die nach ihrer Krebserkrankung ihre persönliche Lebensplanung unter neu hinzugewonnenen Aspekten und mit neuem Mut wieder nachgegangen sind und gesund weiterleben, öffentlich erzählt werden.
Wie erleben Sie Ihre Patienten in der Praxis zum Thema Öffentlichkeit?
In meiner Praxis erlebe ich, dass der Umgang mit der eigenen Erkrankung in

puncto Öffentlichkeit sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ich sehe sowohl j unge als auch ältere Betroffene, die ganz offensiv mit ihrer Erkrankung umgehen, ihr Umfeld von Anfang an in die Therapieplanung mit einbeziehen und ohne erkennbare Scheu oder Scham auch nach Haarverlust „mittendrin“ bleiben. Aber ich sehe auch junge Frauen, die sich zurückziehen, die sich scheuen, bei ihrem Arbeitgeber mit „offenen Karten“ zu spielen und hoffen, dass die Perücke nicht als solche erkannt wird. Die Angst, nicht mehr den Werten, Normen und der zugeschriebenen Rolle durch das berufliche und familiäre Umfeld gerecht werden zu können und somit an Zugehörigkeit zu verlieren, kann eine Ursache für die Scheu vor Öffentlichkeit sein. Das kann für ältere Betroffene eine größere Rolle spielen, da die klassischen Rollenbilder hier
noch nicht so flexibel geworden sind, wie das bei jüngeren Menschen glücklicherweise der Fall ist.

Frau Ort meinte, dass Krebs immer noch ein Tabu sei. Wie sehen Sie das?
Ich persönlich glaube, dass man hier nicht mehr unbedingt von „Tabu“ sprechen sollte, wohl aber davon, dass sich der Umgang mit der Erkrankung in einem Wandel befindet und die Angst nach wie vor großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Kommunikation in diesem Themenbereich hat. Ich bekomme von meinen Patienten und Patientinnen die Rückmeldung, dass Krebs belegt ist mit Ängsten vor Ausgrenzung, Zurückweisung und sozialer und finanzieller Isolation. Die Befürchtung einen Karriereknick zu erleiden und die Angst vor dem Verlust von Zugehörigkeit verstärken oft die Sprachlosigkeit, die bereits die Diagnose ausgelöst hat. In einigen Bereichen bewahrheiten sich die Befürchtungen im Verlauf der oft Monate dauernden Therapie- und Genesungszeit. Arbeitgeber zweifeln an der Leistungsfähigkeit, Kollegen und Bekannte distanzieren sich mit der Zeit. Ich erlebe, dass PatientInnen nicht zum ReHa-Sport fahren können, weil das Geld für das Busticket nicht reicht, oder dass die Sorge besteht, den bewilligten, mehrwöchigen Aufenthalt in einer Reha-Klinik absagen zu müssen, weil das „Taschengeld“ für außerklinische Angebote nicht vorhanden ist. Das Tabuthema ist hier wohl eher Armut.
Welche Rolle spielt es hier als Außenstehender, den „richtigen Ton“ zu treffen?
Betroffene selbst können nach der Diagnose oft tagelang nicht das Wort „Krebs“ oder den Satz „Ich habe Krebs“ aussprechen. Meiner Meinung nach entscheidet auch die sprachliche Übermittlung einer Krebsdiagnose darüber, wie die Person, die die Diagnose erhält, mit den Inhalten umgehen kann und ob sie die eigene Erkrankung als stigmatisierend und als Tabu empfindet oder nicht. So bin ich überzeugt, dass eine gute, empathische und sprachlich mit Bedacht überbrachte Krebsdiagnose, die ein Arzt angstfrei ausspricht, ganz markant den Umgang mit der Erkrankung beeinflusst. Eine Diagnose kann sich als Traumatisierung auswirken und somit eine Tabuisierung im Patienten selbst auslösen. Ein Diagnoseschock bringt oft eine vollkommen veränderte Selbstwahrnehmung der Betroffenen mit sich. In meiner Arbeit als Psychoonkologin sind die Auflösung von Diagnosetraumen und die Integration der Erkrankung in den Lebensweg der Patienten und Patientinnen zentrale Themen. Ich finde, im Umgang mit Krebspatienten sollte Kommunikationskompetenz auf Seiten der Diagnoseübermittler eine besondere Beachtung finden. Ein gutes Arzt-Patienten-Gespräch, das von Wertschätzung, Echtheit und Sicherheit getragen wird, wird dazu beitragen, dass Betroffene mit ihrer Erkrankung aus der Tabuzone heraustreten. n
Info ZUR PERSON: MICHI PETERS
Michi Peters ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Psychoonkologin. In ihrer „Gesundheits-Werkstatt. Fa chpraxis für Gesundheitsprävention und Krisenbewältigung im Kreis Ahrwei ler“ in Oberdürenbach veranstaltet sie Ku rse, Workshops und Gesprächsangebote für Menschen mit und nach Krebs sowie Menschen in besonderen Lebensphasen. Vier Mal im Jahr veranstaltet sie in Schelborn die Gesprächsrunde „RedeZeit“, in der es um schwierige und tabubehaftete Themen geht.
Immer das Ziel im Auge!




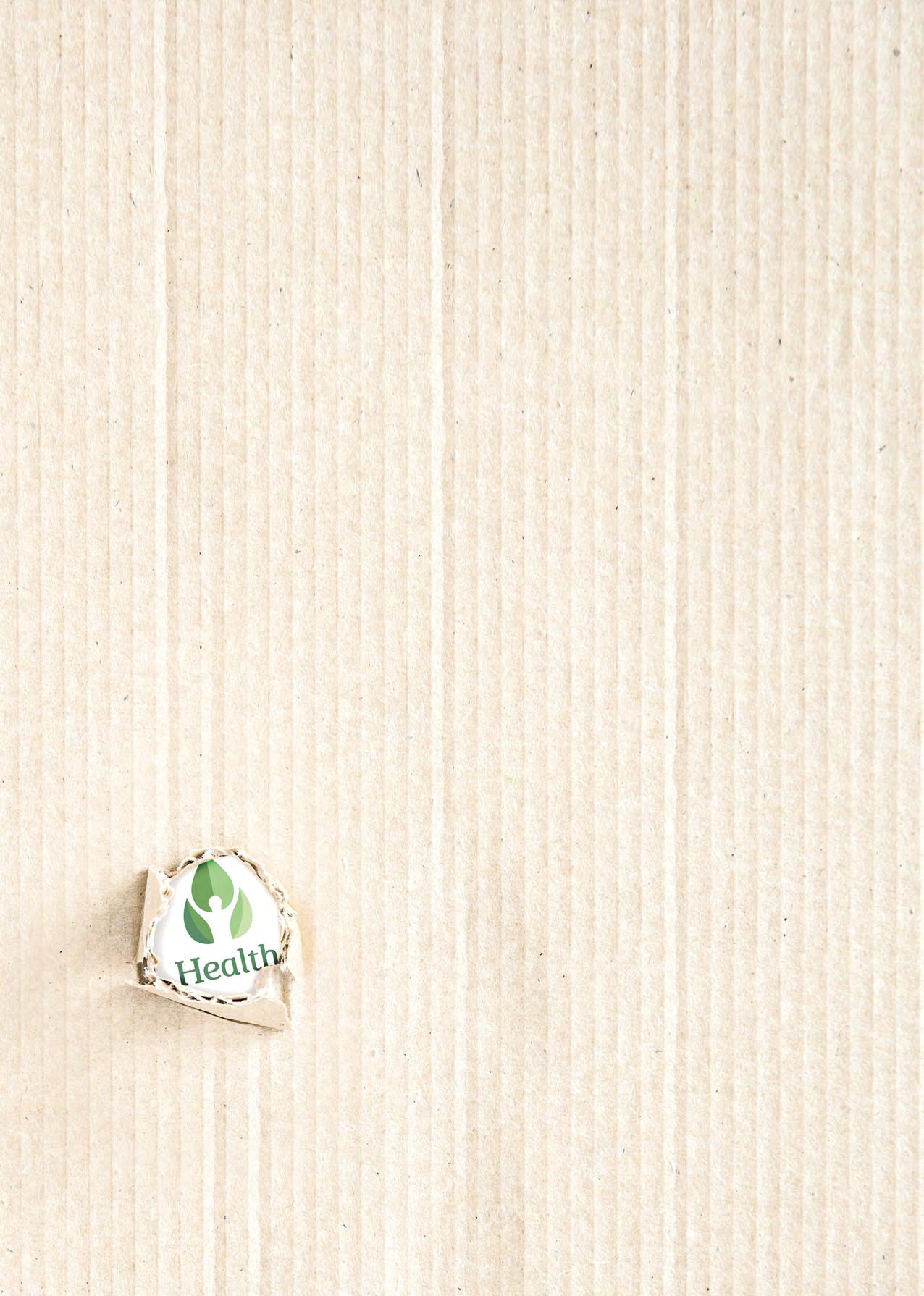

Als klassisches Dienstleistungs unternehmen im Bereich Werbe- und Mediengestaltung garantieren wir unseren Kunden einen optimalen Service.
Mit über 20 Jahren umfangreicher Erfahrung in allen Disziplinen der Print- und Digitalproduktion liefert unser Team bei den kniffeligsten Vorlagen brillante Resultate.


Wir sind offen für neue Technologien und Produktionsabläufe und lieben jede Herausforderung!









