Dieses Magazin haben wir für dich gemacht:
Themenheft: Wasser
Themenheft: Wasser

präsentiert von Deinen Dortmunder Unternehmen Dortmund


Entdecke die Geheimnisse Deiner Stadt



Dieses Magazin haben wir für dich gemacht:
Themenheft: Wasser

präsentiert von Deinen Dortmunder Unternehmen Dortmund


Entdecke die Geheimnisse Deiner Stadt


Seit bald 20 Jahren durchkreuzen die Kinder der „Yurumi-Gang“ in der Dortmunder Hörspielreihe die fiesen Pläne der Verbrecher Klunker und Mantel. Ob im Zoo, im ehemaligen Stahlwerk oder im Fußballmuseum – die drei Gang-Mitglieder Maradonna, Musti und Doktor erleben an vielen Orten unserer Stadt ihre Abenteuer.
Der Name der Hörspielreihe hat übrigens mit dem ersten Fall und mit echten Fakten zu tun. Yurumi ist nämlich der altindianische Name für den Großen Ameisenbären. Und der Zoo Dortmund ist wirklich das internationale Zuchtzentrum für diese bedrohten und einzigartigen Tiere. In der Geschichte wird ausgerechnet Ameisenbärin Sandra von Klunker und Mantel aus dem Zoo entführt. So kam der Stadtteil Persebeck groß raus –und die Yurumi-Gang feierte ihren ersten Erfolg.
Alle Hörspiel-Geschichten der Reihe gibt es auf Spotify, Deezer, Apple Music oder SoundCloud. Hör doch mal rein!
Diesmal dreht sich alles ums Wasser. Wir trinken es, wir nutzen es zur Kühlung, Spülung, Reinigung und in Form von Wasserstoff irgendwann als Antrieb für Autos, LKWs, Busse, Binnenschiffe.
Zukunftsmusik? Vielleicht, aber wer dieses Magazin in den Händen hält, ist Teil der Zukunft. Und für die Zukunft lernen wir aus der Vergangenheit. Deshalb sind wir stolz, einen der wichtigsten Mangaka im Magazin zu haben. „ASADORA!“ ist eine spannende Geschichte von Naoki Urasawa. Auch hier spielt Wasser eine wichtige Rolle, weil Asa als Rettungsschwimmerin lebt und mit Fluten und Tsunamis kämpft.
Wasser ist symbolisch für Veränderung und die Kraft der Natur. „ASADORA!“ erzählt deshalb auch, wie wichtig

Zusammenhalt und Mut sind, um Veränderungen anzunehmen.
KISSA21 – wir sind füreinander da –hier in Dortmund. Die Unternehmen mit der 21 nehmen dich ernst.
KISSA21 hat viele Seiten, ist gedrucktes Papier, ein echtes Pfund. Ganz bewusst. Mach Eselsohren hinein, kritzle drin herum, reiß Seiten raus. Eis- und Mayoflecken gehören dazu. Leg das Handy zur Seite, es ist dein Sommer.
Viel Spaß wünschen KIM, Pido und Dogibär Deine 21-Maskottchen

Welcher Wassertyp bist du? 6

Der Deutschland-Achter gibt alles! 48
Nass, temporeich oder eiskalt 54
Immer schön cool bleiben! 68
Sommer... Sonne... Freibad! 76
Schwimmen? Aber sicher! 110
Auf zur See-Fahrt 106
ENTDECKEN!
Arbeiten am Wasser? Na klar! 10
Dortmunds Wasserstraßen 28
Immer schön kühl bleiben 68
Klare Sache 82
Fürs Wasser gebaut 92
Renaturierung der Emscher 118
Klimawandel: Auf alles vorbereitet! 124
Stadtdächer: Grün statt Grau 134
Wärme aus der Ferne 140
Busfahren mit Wasser(stoff) 142
Regen für die Klospülung 154
Duschen, Bürsten, fertig! 158
Tierisch warm hier 164
Die Königin der Instrumente 182 Engagieren! Startzeit: Jetzt 190

Aufzug für große Pötte 36
Kanutour: Erfrischende Ruhr 44
Abenteuertag am Phoenix See 102
Komm, wir gehen ins Kino! 178

Comic: Das Geheimnis im Hafen 16
Leseprobe Manga: ASADORA! 1 219


Wie gut kennst du deine Stadt?
Fabelhafter Filter für Pfützenwasser
Deine Wasser-Rallye
Saatbomben: Da blüht dir was! 138
Rätsel: Der Name der kleinen Wassernixe 146

Deine Abenteuer in der Stadt 170
Experimente mit Wasser 198
Unterwasser-Spektakel, selbstgemacht! 206
Zeichenkurs: Mach dein Manga 210
Du hast noch keinen Plan für den Sommer, aber keine Lust auf Langeweile? Dann mach unseren Test. Finde heraus, was für ein Typ du bist und welche Aktivität rund ums Wasser zu dir passt.
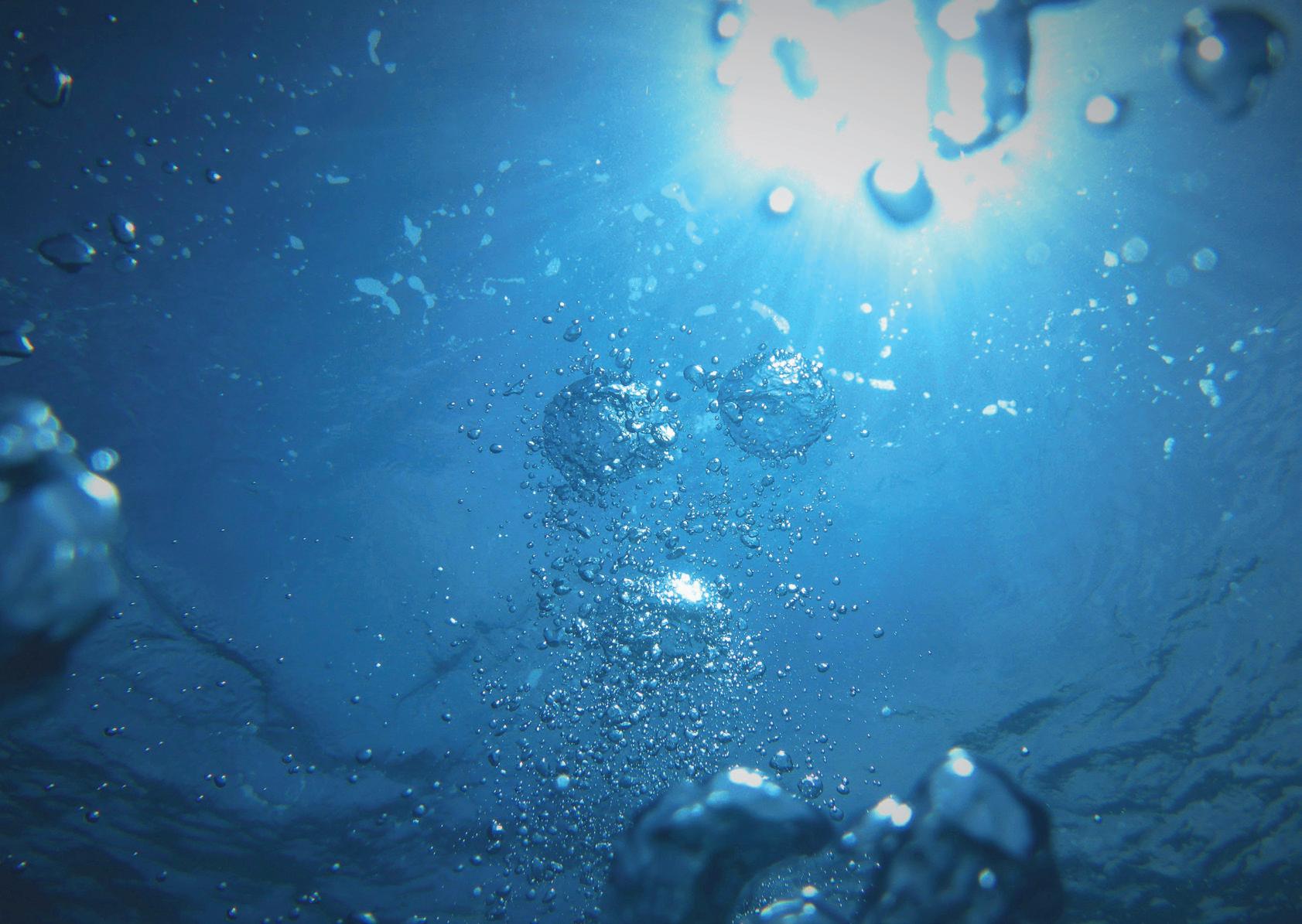
Kreuze bei allen Fragen auf dieser Seite die Antwort an, die am besten zu dir passt. Zähle danach zusammen, wie oft du mit welchem Buchstaben geantwortet hast. Auf der nächsten Seite findest du die Auflösung. Und gleich noch ein paar Tipps für heiße Tage.
FRAGE 1
Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Wasser denkst?
A Ein Regenschirm
B Ein Schwimmbecken
C Ein Trinkglas
FRAGE 2
So magst du Wasser am liebsten:
B in großen Mengen zum Abkühlen.
A möglichst weit weg von mir.
C mit Eiswürfeln in einem Glas.
FRAGE 3
Stell dir eine richtig große Wassermenge vor. Was möchtest du jetzt tun?
C Einen Becher oder Strohhalm holen
B In meine Badesachen schlüpfen und reinspringen
A Einen großen Bogen drum herum machen
FRAGE 4
Was ist dir im Urlaub am wichtigsten?
C Leckeres Essen und erfrischende Getränke
B Ein Meer, ein See oder ein Schwimmbad in der Nähe
A Gutes Wetter (kein Regen!) und am liebsten eine Stadt ohne Gewässer

FRAGE 5
Wie verbringst du einen Tag im Freibad?
C Mit einer gekühlten Trinkflasche in der Sonne
B Egal, solange ich trocken bleibe
A Im Schwimmbecken natürlich, ist doch klar
Zähle zusammen, wie oft du Antwort A, B oder C gewählt hast.
Welchen Buchstaben hast du am häufigsten gesammelt? Finde heraus, welcher Typ du bist, und schau dir gleich die Tipps an.

TYP A: Trockenpfötchen
Du machst es wie die Katzen und hältst dich möglichst fern von Gewässern aller Art. Dafür nimmst du sogar einen Umweg in Kauf. Selbst Regen beobachtest du lieber von drinnen, als durch die Tropfen zu laufen. Und bei Durst? Da greifst du lieber zur Limodose oder Saftflasche als zum Leitungswasser.
Tipp: Im Kino bleibst du garantiert trocken und deine Lieblings- getränke sind dort auch zu haben. Um tolle Filmtheater geht es auf Seite 178.
TYP B: Planschefin
Wie ein Delfin bist du im Wasser voll in deinem Element. Ob Schwimmbecken, See oder das Meer: Du möchtest sofort reinspringen. Während andere noch unentschlossen am Rand stehen, bist du schon längst im Wasser und vergnügst dich. Ein Sommer ohne Badespaß? Geht gar nicht!

TYP C: Schlürfofant
Elefanten lieben es, Wasser zu trinken. Genau wie du! Denn am liebsten hast du Wasser im Glas oder in der Flasche. Ob still, sprudelnd oder mit Geschmack, Hauptsache, du hast etwas zu trinken in der Hand. Ganz schön clever! Viel Wasser zu trinken ist nämlich wirklich wichtig und macht fit.

Tipp: Es muss nicht immer das Freibad um die Ecke sein. Wie wäre es mit einem Ausflug zum Badesee. Auf Seite 106 stellen wir dir welche vor.
Tipp: Frisches Trinkwasser ist erfrischend – nicht nur als Getränk. Erfahre auf Seite 82 wie aufwändig es für uns vorbereitet wird.
Wer gern am Wasser arbeitet, muss dafür zum Glück nicht an die Küste ziehen. In Dortmund und Umgebung gibt es genug Berufe, bei denen man fast den ganzen Tag am oder auf dem Wasser sein kann – oder zumindest mit Wasser zu tun hat.
Wasserbauer zum Beispiel arbeiten meist im Freien an und auf Binnenwasserstraßen wie dem Dortmund-Ems-Kanal. Sie pflegen, überprüfen und reparieren Uferbefesti-


Blick aus der Kanzel eines Portalkrans im Dortmunder Hafen
gungen und Schleusen, damit die Schiffe immer freie Fahrt haben. Wer keine Höhenangst und viel Fingerspitzengefühl hat, kann im Dortmunder Hafen als Portalkranführer arbeiten und ankom-
mende Container zwischen Schiff, LKW und Eisenbahn bewegen. Und es gibt noch viel mehr spannende Möglichkeiten, die Liebe zum Wasser mit seinem Job zu verbinden. Darüber haben wir mit
einem Wasserschutzpolizisten, einem Feuerwehrtaucher, einer BiologischTechnischen Assistentin im WasserPrüflabor und einem Binnenschifffahrtskapitän in Ausbildung gesprochen.
Carsten Kühne, Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizei-Wache Datteln

Aufgewachsen am Kanal, hat Carsten Kühne sich schon immer für Schifffahrt interessiert. Erst mal hat er aber seinen Kindheitstraum verwirklicht und ist „normaler“ Polizist geworden. Die Liebe zum Wasser hat ihn dabei nie losgelassen, sodass er eine vierjährige Zusatzausbildung zum Wasserschutzpolizisten gemacht hat. Seit 2010 arbeitet er in der Dattelner Dienststelle. An seinem Beruf liebt der 45-Jährige die Abwechslung, den Kontakt mit immer anderen Menschen und natürlich das Bootfahren. Dabei steuert er nicht nur das Polizeiboot, er wartet es auch, führt Ölwechsel durch und kleinere Reparaturen an Bord. Die Wasserschutzpolizei ist zuständig für die Sicherheit auf den Wasserstraßen rund um die Wache und im Dortmunder Hafen. „Wir gehen auf die Schiffe, überprüfen, ob das Fahrzeug noch Klasse hat. Das ist der TÜV für Schiffe“, erklärt Kühne. „Wir kontrollieren, ob die Ladung zugelassen zum Transport ist und ob die Schiffe nicht überladen sind. Der Kanal ist ja nur 3,5 bis 4 Meter tief. Und wir gucken, ob genug Besatzung an Bord ist und ob die ausreichend qualifiziert ist.“ Auch wenn er als Dienststellenleiter mittlerweile etwas weniger auf dem Wasser ist, hat Kühne seinen absoluten Traumberuf gefunden.

Marcel Kirchgäßer, Binnenschifffahrtskapitän in Ausbildung
Ein wochenlanges Leben an Bord, um Fracht auf Flüssen und Kanälen in ganz Europa zu transportieren? Monatelang unterwegs auf hoher See? Nichts für Marcel Kirchgäßer. Nach einer ersten Ausbildung zum Stahl- bauschlosser macht der 22-Jährige seine zweite Ausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän beim Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Rhein im Außenbezirk Sankt Goar, wo er auch wohnt. Kirchgäßer stammt aus einer alten Lotsenfamilie. Am besten an seinem Job gefällt ihm die technische Arbeit auf der Wasserstraße. Kirchgäßer und seine Kollegen, zu denen z. B. auch Wasserbauer gehören, „setzen dort die Schifffahrts- zeichen, halten die Uferanlagen in Schuss, errichten Wasserbauwerke wie Schiffsschleusen oder Wehranlagen oder untersuchen Havarien“. Zur Berufsschule geht Kirchgäßer in Duisburg. Während dieser Zeit lebt er mit den anderen Auszubildenden auf dem Schulschiff „Rhein“ – eine Art Internat auf dem Wasser. Nach seiner Abschlussprüfung darf er dann jegliche Schiffe egal welcher Länge und Größe auf allen Binnengewäs- sern Deutschlands fahren, außer auf besonders gefährlichen Strecken. Weil auch der Rhein bei Sankt Goar dazu gehört, macht Kirchgäßer zusätzlich ein extra Streckenpatent. Denn eins ist klar: Auch als fertiger Kapitän möchte er weiterhin in seiner Heimat arbeiten.
Andreas Ribbing, Feuerwehrtaucher bei der Wasserrettung in Dortmund

Hauptbrandmeister Andreas Ribbing ist einer von 38 Tauchern, die zur Spezialeinheit Wasserrettung innerhalb der Dortmunder Feuerwehr gehören. Als Lehrtaucher ist der 53-Jährige auch für die Aus- und Fortbildung zuständig. An seinem Beruf gefällt ihm besonders, „dass man eine sinnvolle Aufgabe hat, Menschen zu helfen und in einer Notsituation zu retten“. Der Umgang mit der Technik bereitet Ribbing viel Spaß, genauso wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Tauchtruppe: „Das machen wir ja immer im Team, wir sind mindestens vier Leute, die zusammen losgehen.“ Haupteinsatzgebiet sind der Dortmunder Hafen und der Dortmund-Ems-Kanal. Die Taucher retten Menschen – und manchmal Tiere – bei Bade- und Bootsunfällen und rücken aus, wenn jemand ins Eis eingebrochen ist. Auch die Suche nach Vermissten und die Bergung von Ertrunkenen gehören zu den Aufgaben. Neben im Schnitt ein bis zwei Taucheinsätzen im Monat, regelmäßigen Übungstauchgängen und der Wartung der Ausrüstung sind die Feuerwehrleute der Spezialeinheit Wasserrettung auch im Löschzug und im Rettungsdienst eingebunden. Sie bilden sich ständig weiter, aktuell zum Strömungsretter. Durch zunehmenden Starkregen geraten immer öfter Menschen in reißenden Gewässern und Überflutungsgebieten in Not.
Eigentlich wollte Veronika Vogel nach dem Abitur Biologie studieren. Doch dann hatte sie mehr Lust auf etwas Praktisches und ist auf den Beruf der Biologisch-Technischen Assistentin (BTA) gestoßen. Während der zweijähri- gen Ausbildung an einer Berufsfachschule hat ihr besonders der Bereich der Zoologie gefallen, unter anderem ging es dort um die Untersuchung von Gewässern. „Wir sind in einen Wald gefahren und haben Proben aus einem Bach genommen. Dann haben wir die Planktons gezählt, den ph-Wert gemessen, also die Gewässergüte bestimmt.“ Die Einsatzgebiete von BTAs sind vielfältig. Man kann etwa im Bereich Umweltschutz auf einem For- schungsschiff oder auch bei Aquarien arbeiten. Vogel hat sich für die Untersuchung von Trinkwasser im Labor entschieden. Im Auftrag großer Firmen untersucht sie Proben von den verschiedenen Stufen der Wasseraufbereitung auf für Menschen gefährliche Bakterien. Dazu gibt es verschiedene Verfahren. „Zum Beispiel füllen wir einen Tropfen Wasser in eine Petrischale, gießen eine Nährflüssigkeit drauf, verteilen das und erwärmen es für mehrere Tage.“ Nicht nur die Labortätigkeit an sich macht Vogel viel Spaß, auch wegen ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Mikrobiologie-Team freut sie sich jeden Morgen auf die Arbeit.
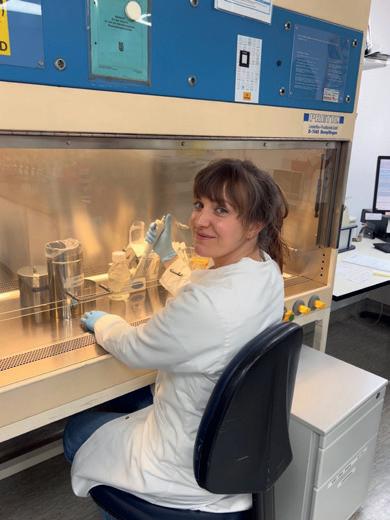

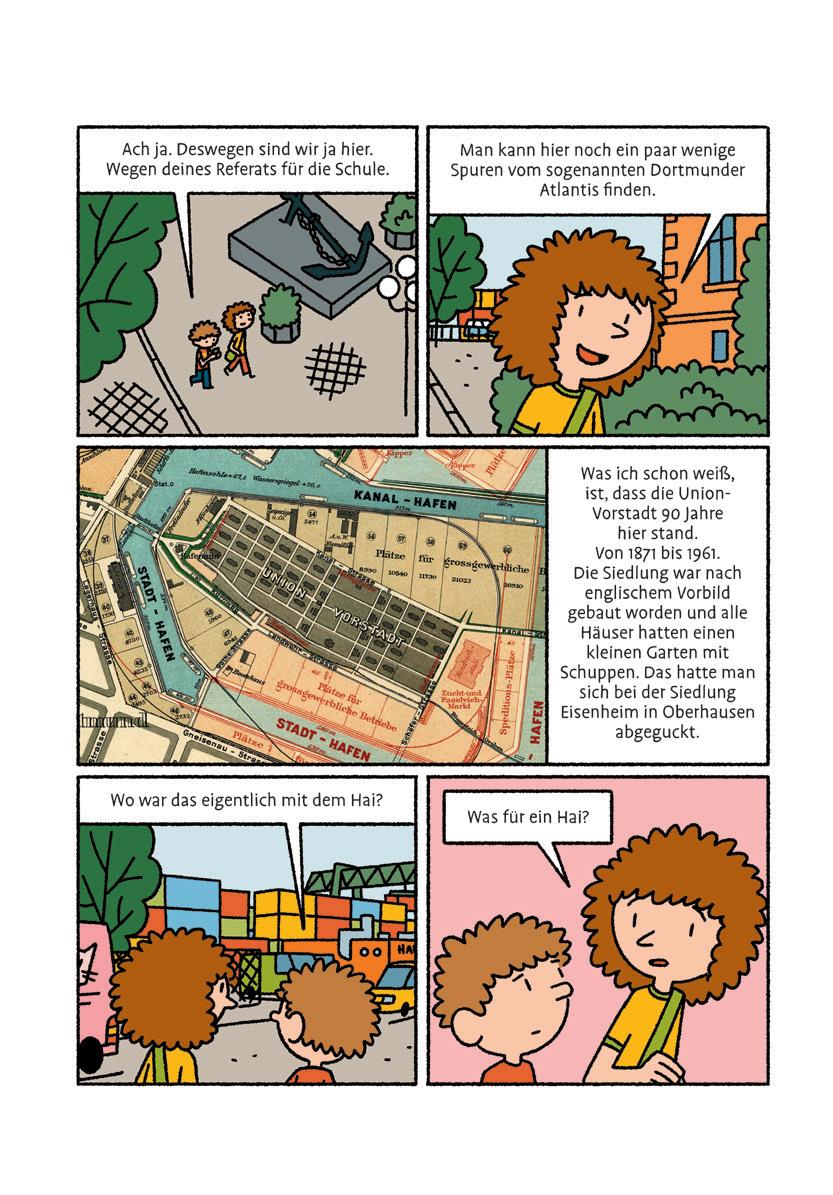
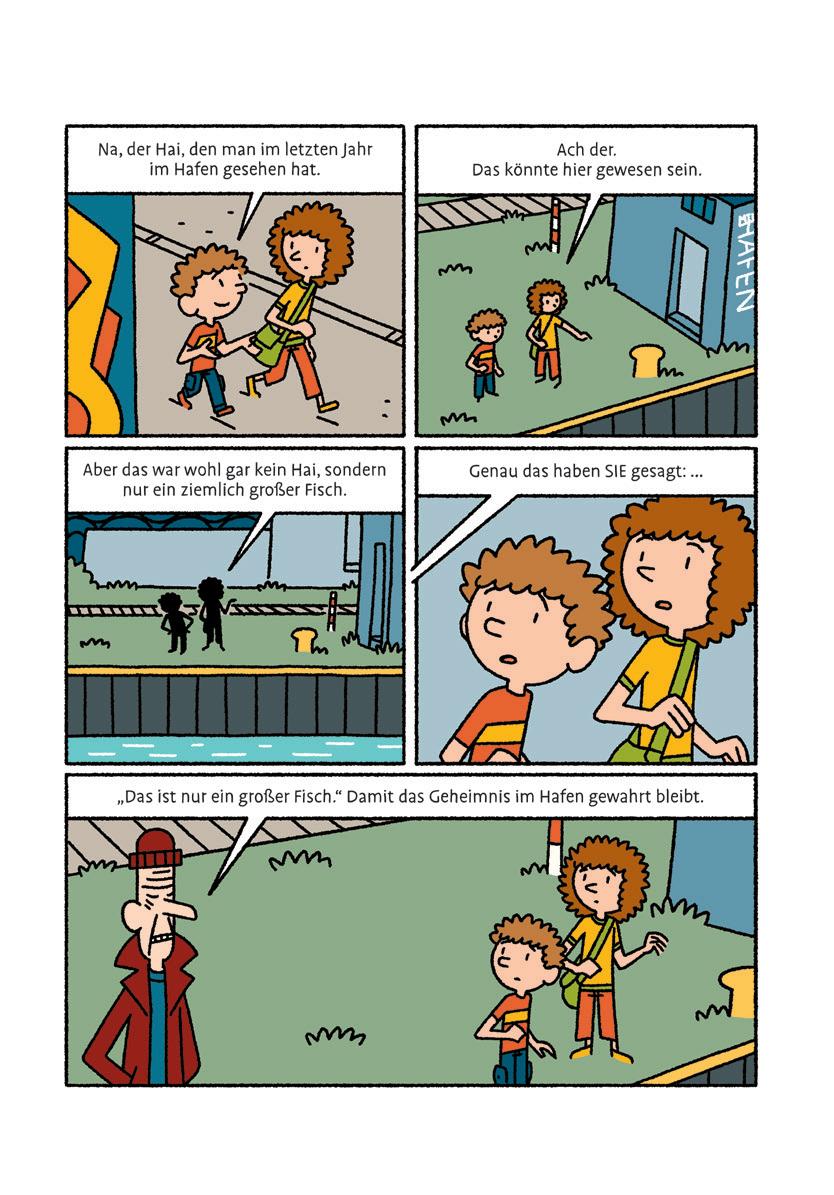
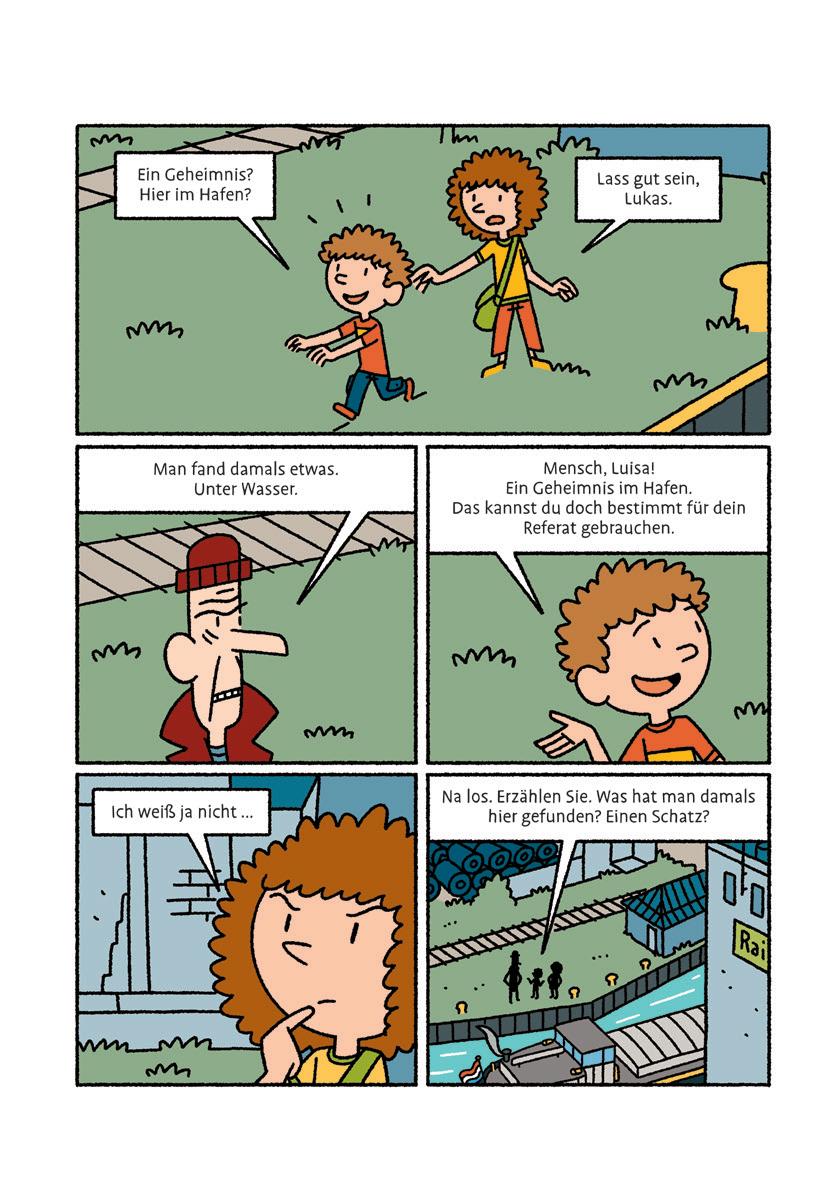
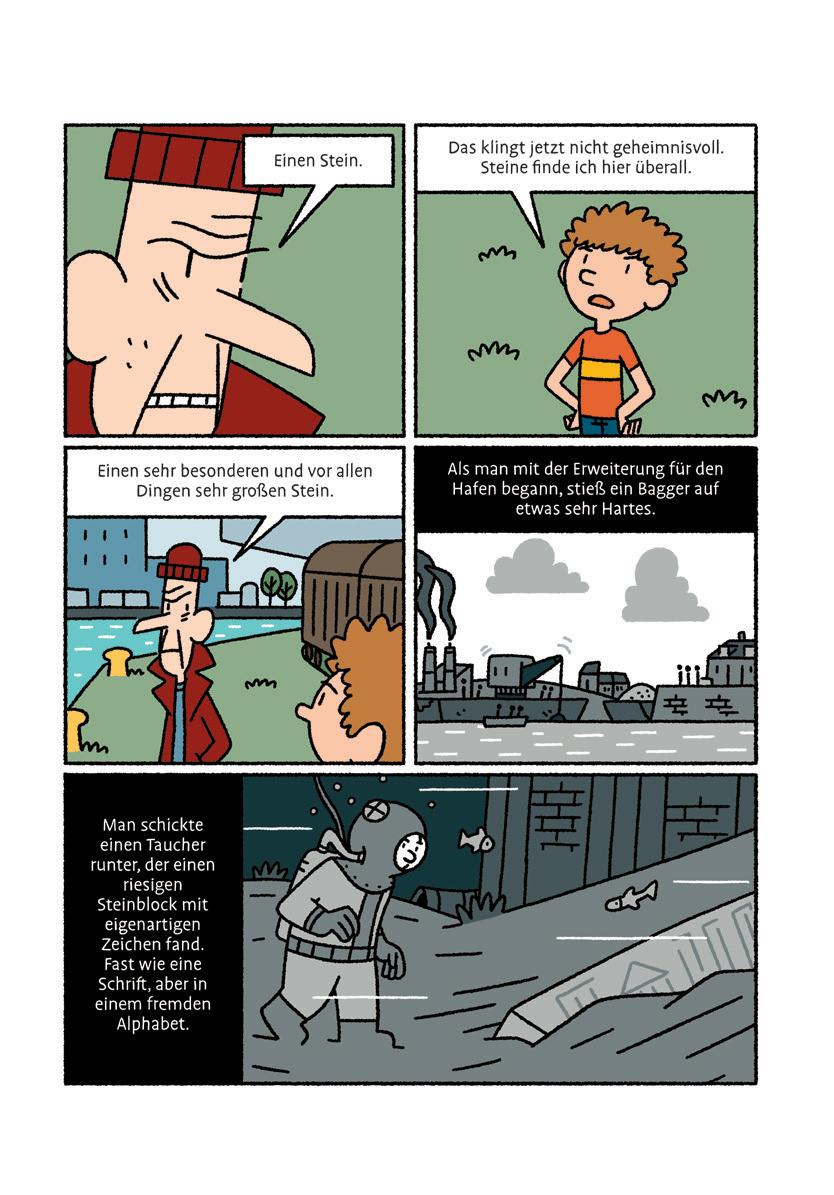
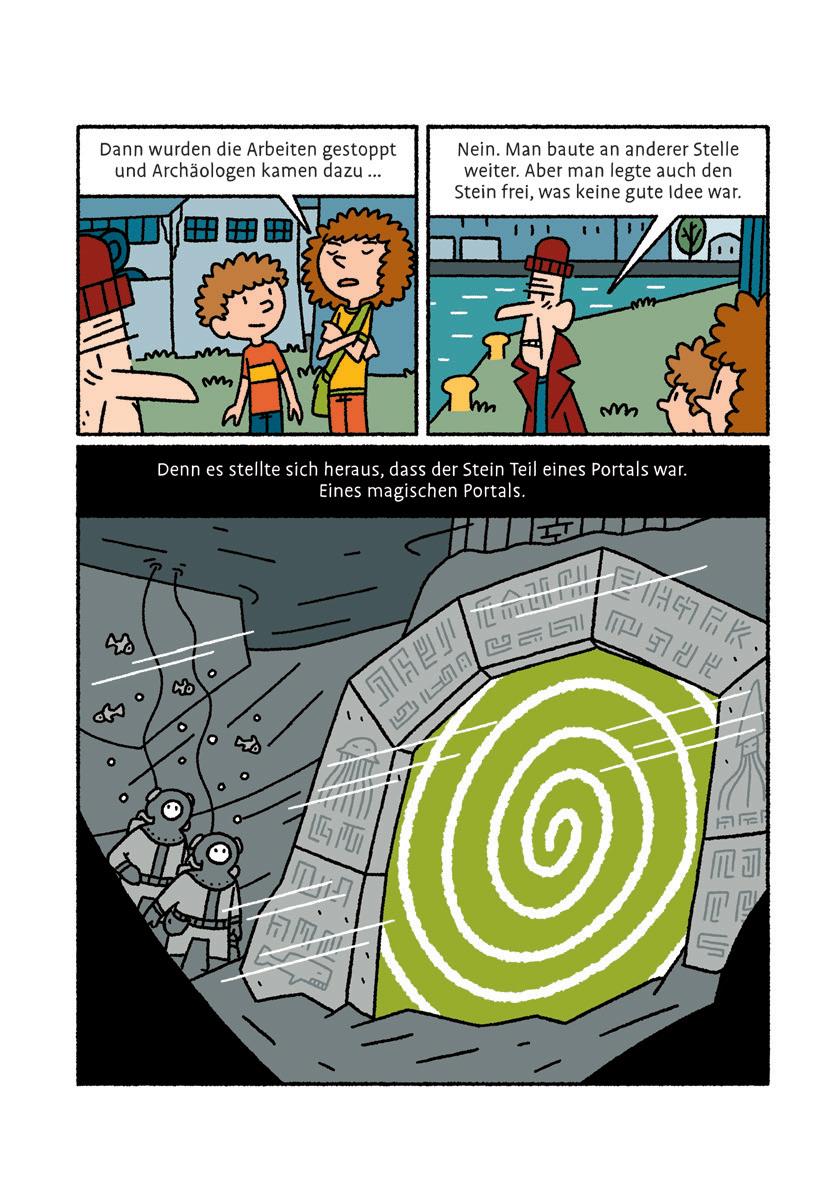
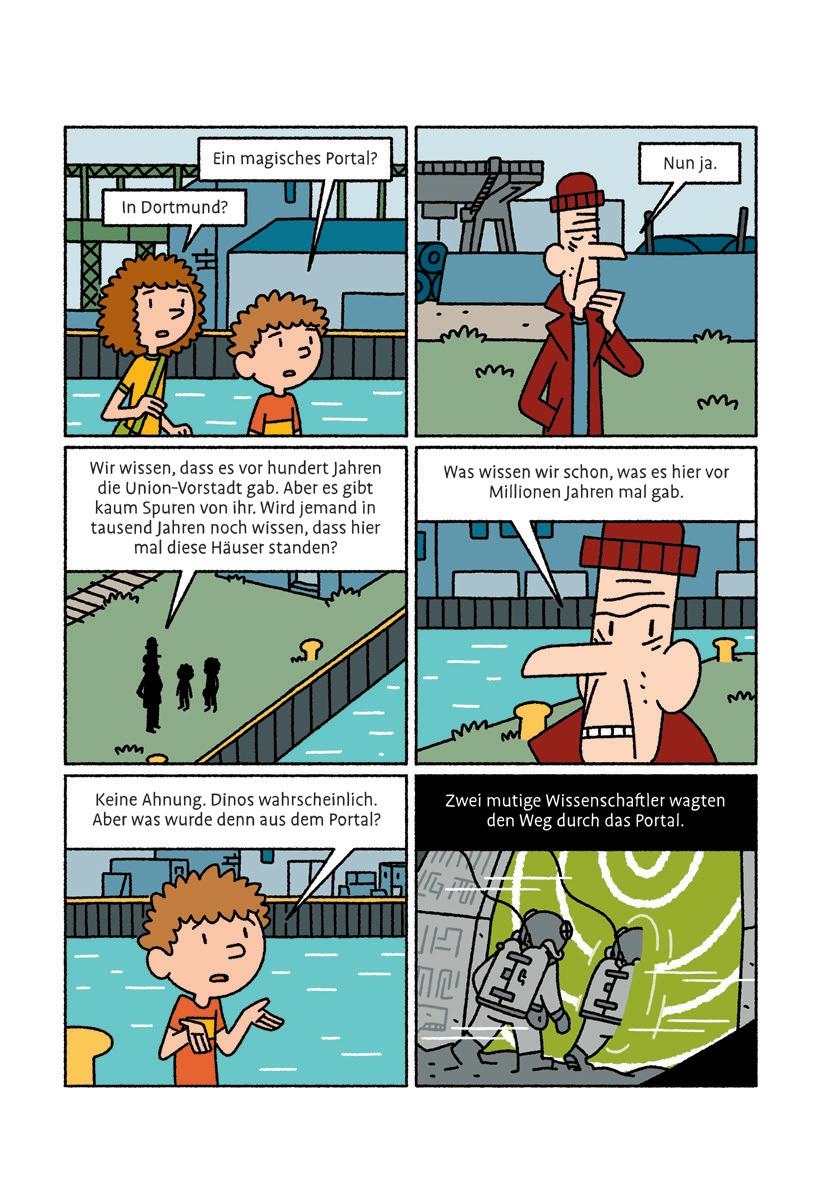
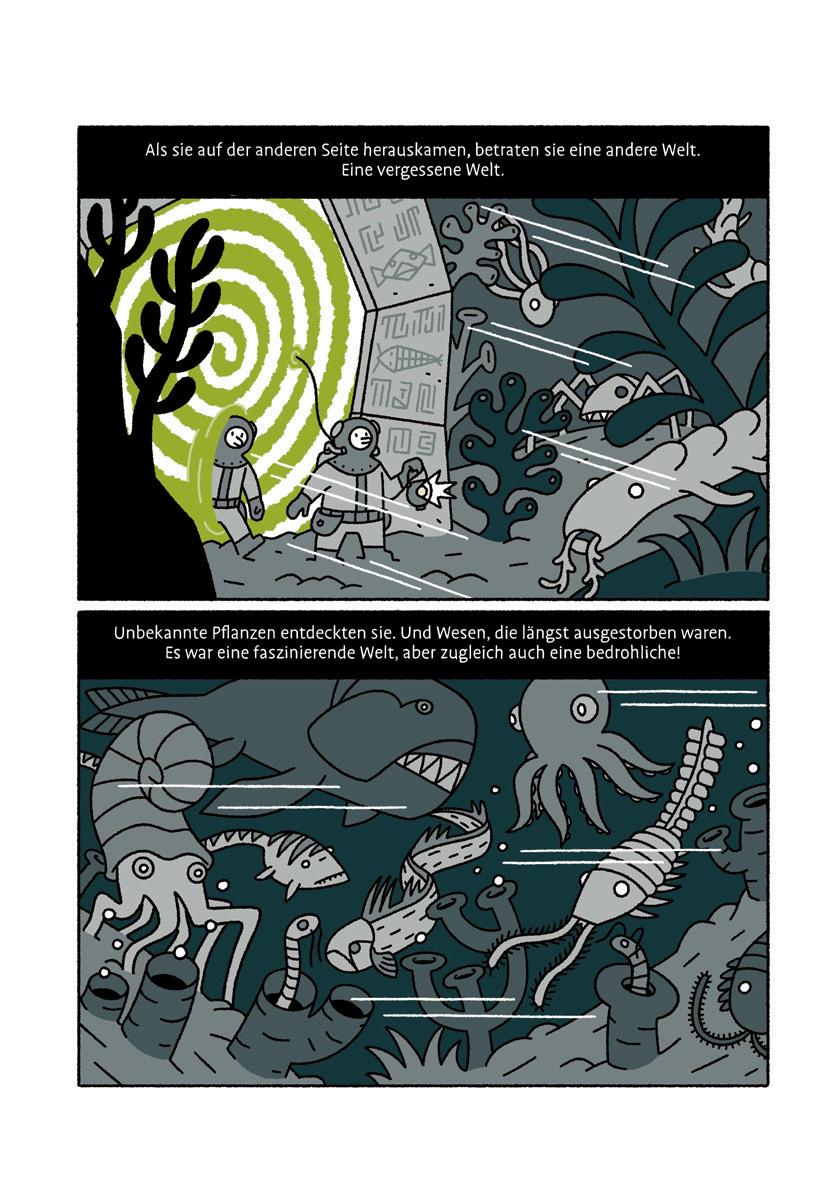
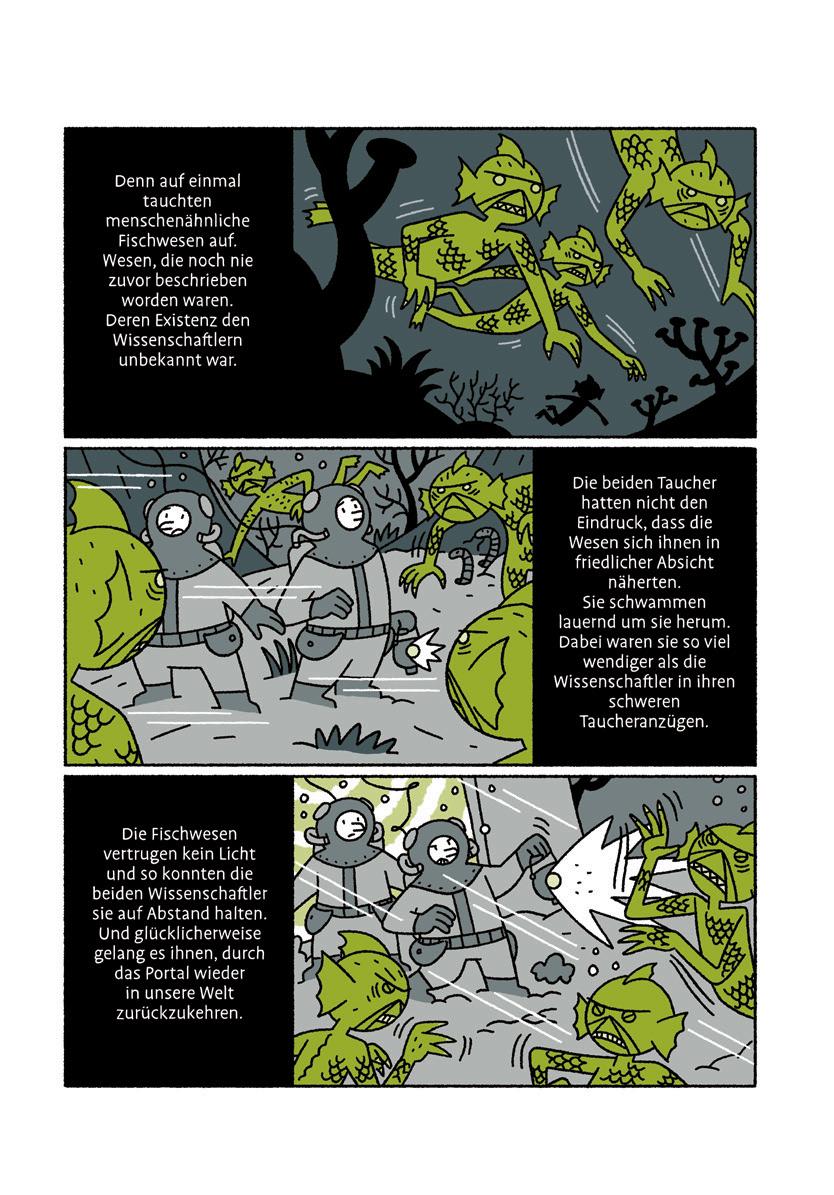
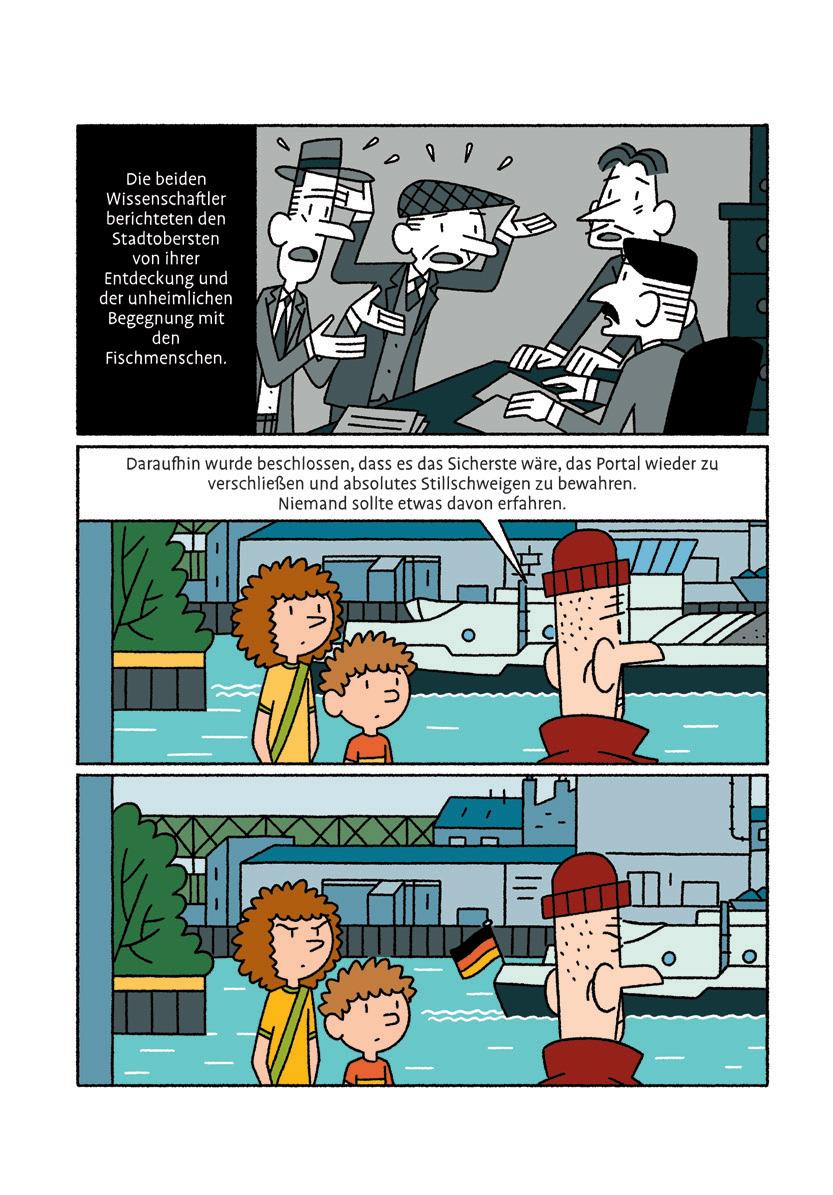


Wow, hättest du gedacht, dass Dortmund den größten Kanalhafen in Europa hat?
Das stimmt wirklich, denn kein anderer europäischer Hafen entlang der Kanäle hat mehr Hafenbecken als Dortmund. Insgesamt sind es zehn solcher Becken mit einer Uferlänge von 11 Kilometern. Wir haben also – tadaa! – den größten Kanalhafen in Europa. Von und nach Dortmund herrscht jede Menge Betrieb.
Viele Frachtschiffe, die in den Kanalhafen einfahren, sind mit Flüssigkeiten oder sogenanntem Schüttgut beladen, also zum Beispiel Kies und Zement. Und auch besonders sperrige Güter werden
transportiert. Das geht auf Wasserstraßen viel einfacher als zum Beispiel auf Autobahnen. Deshalb baut ein international tätiges Unternehmen im Dortmunder Hafen seinen Standort aus, um von hier Teile für Windkraftanlagen, Turbinen und Generatoren per Schiff zu transportieren.
Jedes Schiff, das im Dortmunder Hafen Güter ein- und auslädt, ersetzt rund 50 LKW.


Aufgestapelt wie Lego-Steine warten die Container in Dortmund auf ihre Weiterreise.
Überall am Hafen kann man superviele Container sehen: Aus aller Welt kommen Waren an und viele Läden in Dortmund und Umgebung werden über den Hafen beliefert. Ahnst du, wie all diese Container ins Hafengebiet gelangen? Die meisten Container rollen über die Straße mit Lastkraftwagen an oder über die Schiene mit der Bahn. Nur ein kleiner Teil der Container kommt per Schiff. Natürlich wäre es gut, wenn viel mehr von ihnen übers Wasser hier ankommen würden.
Denn der Transport von Gütern per Schiff kann dazu beitragen, viele LKW-Fahrten und damit CO2 einzusparen. Schiffe sind zudem leiser und verursachen weniger Unfälle. Aber wenn das so sinnvoll ist, warum kommen nicht viel mehr Waren mit Güterschiffen nach Dortmund? Der Grund liegt darin, dass ein Binnenschiff zwar mehr Fracht als ein LKW transportieren kann, dafür aber länger bis zum Ziel unterwegs ist. Sind Schleusen defekt, müssen große Umwege gefahren werden. Besonders wichtig für Dortmund ist die Schleuse in Henrichenburg.
Wenn sie nicht funktioniert, kommt kein einziges Schiff mehr in den Hafen hinein oder wieder heraus. Auch Brücken über den Kanal spielen für Schiffstransporte eine bedeutende Rolle. Sind sie zu niedrig, passen nur ein oder zwei Lagen gestapelter Container unter ihnen durch. Hebt man die Brücken an, macht man es den Binnenschiffern leichter.
Aber natürlich sind viele andere Wasserfahrzeuge auf den Wasserstraßen unterwegs. Wir erklären euch einige davon:
Das Inspektionsboot der Hafenmeister
Die Hafenmeister überwachen den Zustand der Hafenanlage. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Güterschiff versehentlich gegen die Wand eines Hafenbeckens stößt. Vom Inspektionsboot aus suchen die Hafenmeister also nach Beschädigungen an den Spundwänden der Hafenbecken. In akuten Gefahrensituationen stellen sie direkt eine Verbin-
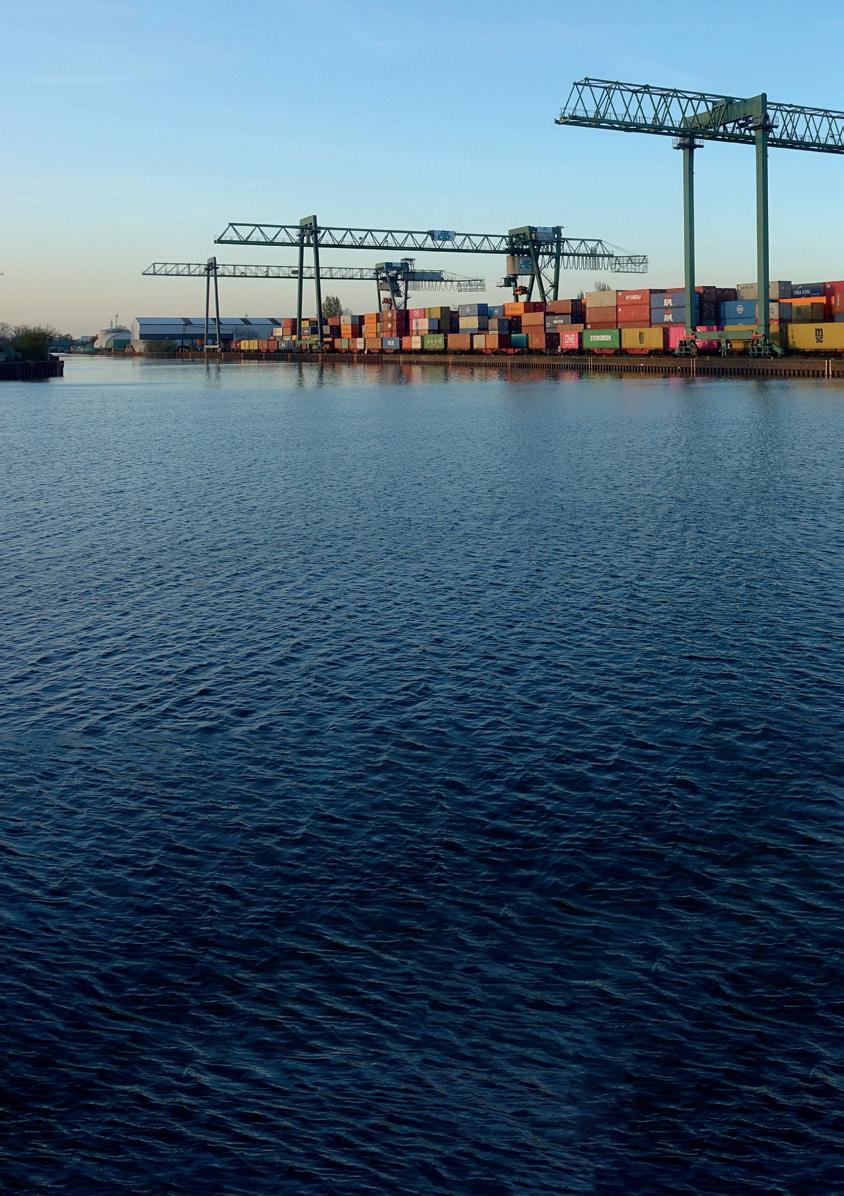
Wenn ihr euch darüber informieren möchtet, welches Schiff gerade nach Dortmund – oder irgendwo sonst auf der Welt – unterwegs ist, besucht doch mal die Internetseite www.marinetraffic.com

Zum Durchrutschen: An der Hafenpromenade kannst du die Container selbst erkunden. Ein guter Zeitpunkt dafür ist übrigens der 31. August ab 14 Uhr. Dann findet nämlich das große Stadtteilfest "Hafenspaziergang" mit vielen weiteren Attraktionen statt.

Für einen fantastischen Ausblick auf die Dortmunder Innenstadt und den Hafen solltet ihr den Deusenberg besuchen. Ein Spaziergang nach oben lohnt sich wirklich! Hier steht man übrigens deutlich höher als auf dem 38 Meter hohen Turm des Alten Hafenamts. Das prächtige Gebäude wurde im Jahr 1899 eingeweiht und steht unter Denkmalschutz.
dung zu Polizei und Feuerwehr her. Denn natürlich gibt es auch ein Polizeiboot, das bei Bedarf auf dem Dortmund-EmsKanal und im Hafen unterwegs ist. Die Wasserpolizei ist also bei Unfällen vor Ort, kontrolliert Sport- und Binnenschiffe und begleitet Sondertransporte.
Das Versuchsschiff Ella Du hast sicherlich schon vom „autonomen Fahren“ gehört. Im Straßenverkehr werden Autos erprobt, die selbstständig fahren, also ganz ohne Fahrer, nur mit Satellitensteuerung. Aber auch auf dem Wasser ist die Forschung weit fortgeschritten. Die Binnenschifffahrt wird digitalisiert und es wird an autonom fahrenden Schiffen geforscht. Ein Binnenschiff kann als Schubverband rund 180 Meter lang sein. Ein Schubverband besteht aus einem Schubschiff mit Motor und mehreren antriebslosen Schubkähnen. „Ella“ ist ein 15 Meter langes Versuchsschiff, mit dem das autonome Fahren mittels Künstlicher Intelligenz (KI) auch in Dortmund getestet wird. Mit etwas Glück kannst du „Ella“ zwischen der Schleuse Henrichenburg und dem Dortmunder

Hafen auf dem Kanal bei ihren Testfahrten beobachten. Der niedliche Name Ella steht übrigens für „Entwicklungsplattform im Modellmaßstab für Manöver-Automatisierung“. Puh.
Der Deutschland-Achter
Im Hafen selbst sind ausschließlich motorbetriebene Boote unterwegs. Am Kanal auf Höhe des Fredenbaumparks sieht man jedoch auch Boote, die mit reiner Muskelkraft betrieben werden. Hier auf dem Kanal trainieren die Männer der Deutschen Ruder-Nationalmannschaft

Die Ruderclubs Germania und Hansa bieten auch Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche an.
(siehe die Geschichte zum DeutschlandAchter in diesem Heft). Aber in den Hafen dürfen diese Ruderboote nicht einfahren – das Schwimmen ist hier ebenfalls strengstens verboten. Das wäre viel zu gefährlich!
Das Mähboot „Mähndy“ Ein weiteres außergewöhnliches Boot ist regelmäßig im Hafen unterwegs. Da das Wasser im Hafen sehr klar ist, bilden sich vor allem im Sommer wuchernde Wasserpflanzen, die sich in der Schiffsschraube verfangen können. Doch zum
Glück gibt es „Mähndy“, das Mähboot des Dortmunder Hafens. Die meiste Zeit ist es in den verschiedenen Hafenbecken unterwegs und befreit den Kanal von Algen und anderen Wasserpflanzen. Pro Jahr werden über 50 Tonnen Wasserpflanzen aus den Hafenbecken geholt.
Der Hafen als Industriegebiet
Der größte Teil des Hafens ist Industriegebiet, das heißt, dass hier an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Im Industriegebiet kann man nicht wohnen oder seine Freizeit verbringen. Hier gibt es Logistikunternehmen, Spezialfirmen für Verpackungen oder Ladungssicherung sowie
Recyclingunternehmen. Die Verkehrsanbindung des Dortmunder Hafens ist wirklich super: Schiene, Straße und Wasserstraße treffen hier aufeinander.
Viel tut sich gerade am Stadthafen und am Schmiedinghafen, den beiden östlichsten Hafenbecken. Entlang der Speicherstraße eröffnen Restaurants, Firmen und Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern. Ein Highlight ist das Eventschiff mit dem netten Namen „Herr Walter“. Früher wurde es als Schleppkahn eingesetzt, heute kann man hier feiern und Live-Musik genießen. Der Wandel entlang der Speicherstraße macht diesen Teil des Dortmunder Hafens zu einem lebendigen Quartier für alle.
Wenn du den Text gut gelesen hast, kannst du die folgenden HafenFragen spielend beantworten:
Welche Gesamtlänge haben die Wände aller Hafenbecken insgesamt?
A 11 Kilometer
B 8 Kilometer
C 10 Kilometer
2024 ist für den Dortmunder Hafen ein ganz besonderes Jahr. Was meinst du, welchen Geburtstag feiert der Hafen dieses Jahr?
A seinen 150.
B seinen 125.
C seinen 90.

Vor 125 Jahren eröffneten der Hafen und das Alte Hafenamt.

Wie heißt das Boot, das sich um die wuchernden Wasserpflanzen in den Hafenbecken kümmert?
A Mähndy
B Ella
C Nessi

Welche Nationalmannschaft trainiert auf dem DortmundEms-Kanal?
A Der Dortmund-Neuner
B Der Kanal-Kanu-Klub
C Der Deutschland-Achter
Wie viele Tonnen Wasserpflanzen holt Mähndy jedes Jahr aus den Hafenbecken?
A Ca. 25 Tonnen
B Mehr als 50 Tonnen
C Mehr als 150 Tonnen
Wie hoch ist der Turm des Alten Hafenamtes?
A 28 Meter
B 38 Meter
C 78 Meter
Schwimmen und Planschen sind im Hafen verboten. Aber wie sieht es mit dem Rudern aus? Darf die deutsche Rudernationalmannschaft hier trainieren?
A Rudern? Kein Problem, auf dem Kanal darf man es ja auch.
B Nein, Ruderboote sind ebenfalls verboten.
C Rudersport ist erlaubt, aber nur von Mai bis September.


Wenn ihr entlang des Emscher-Weges mit dem Fahrrad von Dortmund anrollt, entdeckt ihr schon von Weitem das imposante Schiffshebewerk Henrichenburg.
Dieses beeindruckende Bauwerk aus Stein und Stahl spielte früher eine entscheidende Rolle für die Schifffahrt. Dank des Schiffshebewerks konnte der Höhenunterschied von 14 Metern zwischen dem Dortmunder Hafen und dem RheinHerne-Kanal überwunden werden.
Heute ist das Hebewerk ein Industriemuseum. Schiffe nutzen schon lange die nahe gelegene Schleuse Henrichenburg. Im Museum könnt ihr herausfinden, wie so ein Aufzug für tonnenschwere Schiffe funktioniert.
Für Familien:
Welche ausgeklügelte Technik sorgt dafür, dass nur wenig Motorkraft nötig ist, um ein ganzes Schiff
anzuheben? Dieses Prinzip wird in der ehemaligen Maschinenhalle anschaulich erklärt. Hier könnt ihr mit einem Modell des Hebewerks experimentieren und die Technik durch viele weitere Mitmachstationen begreifen. Auf zwei großen Monitoren wird das Schaltwerk wie in einem Computerspiel zum Leben erweckt.

Teste selbst aus, wie alles funktioniert!

Auf dem Wasserspielplatz kannst du dich gut auspowern.
Öffnungszeiten:
Tipp:
Für Familien eignet sich perfekt ein Besuch des ehemaligen Motorgüterschiffs Franz-Christian. Im Unterdeck war einst die Ladung untergebracht. Heute kann man dort hautnah erleben, wie der harte Alltag einer Binnenschifferfamilie aussah. Die Menschen hatten an Bord nur wenig Platz und mussten mit winzigen Kajüten zum Schlafen, Kochen und Essen auskommen.
Für Freunde:
Auf dem Gelände des Schleusenparks, nur wenige Meter vom eigentlichen Hebewerk entfernt, findet ihr den Wasserspielplatz. Die Umkleidekabine ist aus ausrangierten Schiffscontainern gefertigt. In Badeklamotten rutscht ihr aus dem oberen Container nach unten, sehr praktisch. Mit dem Floß könnt ihr euch dann über das Becken ziehen oder
Wie es ist, auf einem Binnenschiff zu leben, kannst du hier hautnah erfahren.

Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 10–18 Uhr
Eintritt:
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre: frei Erwachsene: 5 Euro
So kommst du hin:
Jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag um 12 Uhr gibt es kostenlose Führungen. Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat gibt es zusätzlich Familienführungen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mit dem Fahrrad über den Emscher-Weg immer am Kanal entlang: ca. 15 km und 45 Minuten. Mit dem ÖVNP ist es komplizierter und dauert viel länger.
direkt mit einem Modell des Schiffshebewerks experimentieren. Eine Kletterwand und zwei Tarzanschwinger (also superhohe Schaukeln) sorgen für zusätzlichen Spaß. Das Gelände ist gleichermaßen spannend und entspannend, wunderschön inmitten von Grün gelegen.
Für Verliebte:
Begebt euch gemeinsam auf eine Reise durch Zeit und Raum. Über ein enges Treppenhaus mit 132 Stufen gelangt ihr ganz nach oben auf eine Brücke zwischen den beiden Türmen. Von hier habt ihr eine atemberaubende Aussicht auf das Hebewerk, den Kanal und die umge-
bende Natur. Industrieromantik pur – perfekt für einen unvergesslichen Spaziergang am Hafenbecken. Abschließen könnt ihr euren Besuch am OldtimerDoppeldeckerbus, der in eine Imbissstube umgewandelt wurde. Liebe geht durch den Magen! Pommes direkt am Kanal? Zu zweit doppelt lecker ;) Einmal so richtig abtauchen ... oder zumindest mal in so einen alten Taucheranzug steigen.

Bestimmt weißt du schon jede Menge über Dortmund. Dass die Stadt zum Ruhrgebiet gehört, zum Beispiel. Und dass hier das größte Fussballstadion Deutschlands steht. Aber jetzt geht es zur Sache! Kannst du auch diese kniffeligen Fragen beantworten?
FRAGE 1
Wie hieß Dortmund im Mittelalter?
A Throtgünni
B Throtsiggi
C Throtmanni
D Throthorsti
FRAGE 2
In welchem Dortmunder Vorort befindet sich der Mittelpunkt von Nordrhein-Westfalen? A
FRAGE 3
Welches dieser Wesen ist als lebensgroße Nachbildung in Dortmund zu bestaunen?
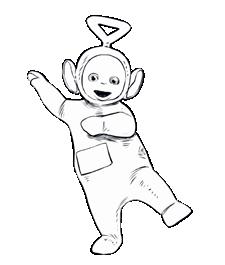

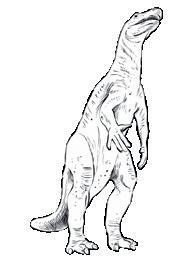
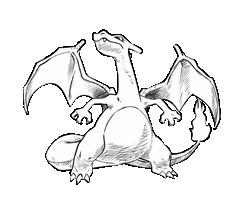
FRAGE 4
Wie viele Kinositzplätze gibt es in Dortmund?
A Weniger als 2 000
B Knapp 4 800
C Exakt 7
D
FRAGE 5
Wie heißt eine Straße in Dortmund? A Rügen B Helgoland C Sylt
Langeoog
FRAGE 7
Mit wie vielen in einer einzigen Halbzeit erzielten Toren hält der Ballspielverein Borussia den Bundesligarekord?
FRAGE 6
Welches ist die größte Grünanlage in Dortmund?
A Westfalenpark
B Westpark
C Fredenbaumpark
D Hauptfriedhof
? ?
FRAGE 8
FRAGE 9


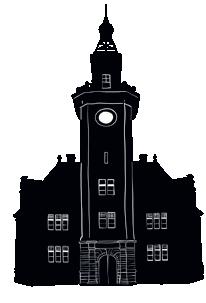
FRAGE 10 Was ist das Logo des Dortmunder Konzerthauses?
A Ein Elefant mit Kopfhörern
B Ein Nashorn mit Flügeln
C Ein Nilpferd mit Violine
D Ein Pinguin mit zwei Köpfen
Welches dieser Bauwerke ist nicht in der Nordstadt zu finden? A AUFLÖSUNG ? ?
Wie heißt eine Folge der Grusel-Heftroman-Reihe „Geisterjäger John Sinclair“?
A Voodoo in Dortmund
B Blutrausch am Borsigplatz
C Der Dämon von Dorstfeld
D Hexensabbat in der Nordstadt
10b) Das (geflügelte) Nashorn wurde als Logo des 2002 eröffneten Konzerthauses gewählt, da Nashörner für ihr ausgezeichnetes Hörvermögen bekannt sind.
9a) Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal steht in Dortmund-Hohensyburg, dem südlichsten Zipfel der Stadt.
8a) Band 693 der erfolgreichsten Horrorserie der Welt heißt "Voodoo in Dortmund". Autor Jason Dark, der in Dortmund aufgewachsen ist, baute als Gimmick viele „reale“ Freunde und Bekannte in die Geschichte ein.
7d) Am 6. November 1982 verlor Arminia Bielefeld beim BVB nach 1:0-Führung mit 1:11. Zehn seiner elf Tore schoss der BVB in Halbzeit zwei.

6d) Der Hauptfriedhof Dortmund ist mit 118 ha der drittgrößte Friedhof Deutschlands und damit fast doppelt so groß wie der Fredenbaumpark.
5b) Helgoland in Dortmund-Schönau
4b) Aktuell gibt es in Dortmund sechs Kinos mit insgesamt 4 826 Sitzplätzen
3c) Seit der Eröffnung 1980 begrüßt diese lebensgroße Nachbildung eines Iguanodons die Besucher in der großen Halle des Naturmuseums in der Münsterstraße.
2b) Der geografische Mittelpunkt NRWs liegt in Aplerbeck.
1c) Dortmund wurde 882 n.Chr. erstmals als Throtmanni erwähnt.
Ab aufs Wasser:
Im Viererboot geht ihr zusammen auf Tour.
Mit dem Kanu die sommerliche Natur erkunden!
Raus aus der Großstadt und ab in die Idylle! Die Ruhr bietet im Sommer eine Ferienkulisse wie im Abenteuerfilm. Der Fluss und sein grünes Ufer lassen sich am besten vom Boot aus entdecken. Eine Lenne-Ruhr-Kanu-Tour ab dem Kanucamp in Schwerte ist eine echte Naturexpedition — perfekt für Familien, für beste Freunde oder für Verliebte. Wer es sportlich mag, bezwingt die rund 35 Kilometer von Dortmund bis Schwerte
mit dem Rad. Und dann geht es ab auf’s Wasser. Bereit für ein besonderes Aben teuer?
Für Familien
Zieht euch sportlich-bequeme Kleidung an und begebt euch zu einem Erlebnis, bei dem alle mitmachen können. Bei den geführten und gut organisierten Touren kommen auch kleine Geschwister auf ihre Kosten. Macht euch gemeinsam einen tollen Familientag.


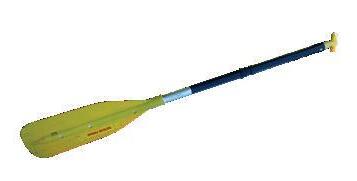


Bis zu vier Personen finden in jedem der Boote Platz. Auch für größere Gruppen stehen genug Kanus und Paddel bereit.


Unter fachkundiger Anleitung lernen auch Neulinge schnell das Paddeln.
Hey, Freunde
Seid ihr bereit für gemeinsame Action und Spaß? Die verschiedenen Touren bieten echte Herausforderungen und sorgen für bleibende Erinnerungen.
Sucht euch eine Tour aus und plant einen Tag voller Abenteuer und Lachen auf dem Wasser.
Und an alle Verliebten: Stellt euch vor, wie romantisch eine Kanutour sein könnte. Nur ihr zwei – inmitten der ruhigen Natur, dem sanften Rauschen des Wassers lauschend, vorbei an allerlei Tieren in den raschelnden Grasböschungen. Die Lenne-Ruhr-Kanu-Tour bietet euch die perfekte Kulisse für ein einmaliges Date, bei dem ihr gemeinsam neue Ufer erkundet.
Mehr Infos zu Touren gibt es auf der Website: https://ruhrkanu.de/
Checkliste Kanutour:
• bequeme, dem Wetter entsprechende, schnelltrocknende Kleidung, feste Schuhe (Trekkingsandalen oder alte Sportschuhe)
• Regenschutz & Fleecepulli
• Sonnenschutz
• eine komplette Garnitur Wechselklamotten
• gefüllte Trinkflasche
• einen kleinen Snack für zwischendurch
So kommst du hin: Zug: Schwerte Bhf (15 Gehminuten entfernt)
Was schwimmt denn da?
Damit Du am Bootsverleih mitreden kannst, hier ein kleines Paddel-1x1:
Kanu / Canadier. Mit dem Paddel „stichst“ du von oben ins Wasser und ziehst es nach hinten durch, daher nennt man es „Stechpaddel“. Boote gibt es meistens für zwei bis zehn Personen.
SUP.
Kajak. Mit dem Doppelpaddel wird's schnell nass im Boot, wenn du nicht aufpasst. Je länger das Kajak, desto sportlicher – aber auch kippeliger – ist es.
Ein „Stand Up Paddel Board“ fährst du meist im Stehen mit einem langen Paddel.
Ruderboot. Es ist das Rennrad auf dem Wasser und supersportlich. Jeder Ruderer bedient ein langes „Blatt“, das „Skull“ genannt wird. Die Königsklasse im Rudersport ist der Achter plus Steuermann oder -frau.
Bushaltestelle: Wilhelmsplatz oder Bahnhof
Drei öffentliche Parkplätze in je max. fünf Gehminuten Entfernung
Lenne-Ruhr-Kanu-Tour Ruhrstraße 18 58239 Schwerte Fon: 02304 · 616 99
E-Mail info@ruhrkanu.de www.ruhrkanu.de
Kanucamp Schwerte: Ruhrstraße 18 (Rohrmeisterei) 58239 Schwerte


DTeamwork – beim Boot-Tragen packen alle Ruderer selbstverständlich mit an.

Rollsitzcheck. Ruderexperten unter sich
er Regen prasselt auf das Wasser des Dortmund-Ems-Kanals. Es ist ungemütlich und grau an diesem Aprilmorgen. Gerade einmal zehn Grad. Acht große Männer in en anliegender Funktionskleidung und Adiletten tragen ein langes, schmales Boot vom Bootshaus zum Steg. Der Achter mit Steuermann ist im Rudersport die Bootsklasse mit acht Ruderplätzen und einem weiteren Platz für den Steuermann. Die Männer des legendären „Deutschland-Achters“ bilden die Auswahl der Spitzenruderer, die für Deutschland als Mannschaft bei Wettkämpfen (in dieser Bootsklasse) an den Start gehen. Das große Ziel für die acht Männer sind die Olympischen Spiele Ende Juli in Paris.
Noch knapp vier Monate Vorbereitung liegen vor den Ruderern. Inzwischen schüttet es wie aus Eimern. Der Wind bläst rein. Mit viel Power an Bord geht es los. Zwanzig Kilometer werden pro Trainingseinheit gerudert. Zehn Kilometer den Dortmund-Ems-Kanal rauf und zehn Kilometer wieder runter.
Während der Trainingsfahrt wird nicht gesprochen. „Dafür haben die Jungs keine Luft übrig“, sagt Bundestrainerin Sabine Tschäge, während das Boot Fahrt aufnimmt. Sie ist immer ganz nah an ihrem Team dran und folgt in geringem Abstand mit einem kleinen Motorboot.

Schwarz-Rot-Gold und die „Acht“ auf dem Trikot: Das Team Deutschland-Achter zieht durch.

Der richtige Rhythmus und gutes Teamwork sind das A und O Drei Wildenten fühlen sich gestört, heben ab und fliegen über das Boot hinweg. Aus der Vogelperspektive wirkt der Achter elegant, denn von hier oben betrachtet gleitet er im perfekten Takt anmutig durch das Wasser.

Aus der Sicht des Steuermanns im Boot sieht das aber ganz anders aus. Jonas Wiesen sitzt den Ruderern gegenüber. Er sieht, wie sie atmen, er sieht die Anstrengung, mit der das Boot bewegt wird. Steuermann Jonas ist der neunte Mann an Bord und hält das Boot auf Kurs. Der Einzige, der während der Trainingsfahrt spricht. Er motiviert das Team der acht Ruderer über eine Lautsprecheranlage. Mit Schlagmann Hannes Ocik gibt er den Takt vor.
Hannes sitzt direkt vor Jonas. Er ist, wie alle, nass bis auf die Haut. Hannes scheint durch Jonas hindurchzugucken. Mit jeder Ruderbewegung kommt der Ruderriese erneut auf Jonas zugerollt. Durch den Rollsitz können die Ruderer zusätzlich auch die Muskelkraft ihrer Beine einsetzen, so mehr Kraft in die Bewegung bringen und jeden Ruderschlag verlängern.
Der olympiaerfahrene Hannes weiß, was man für den Rudersport mitbringen muss: „Man sollte Spaß daran haben, sich in der freien Natur zu bewegen, auf dem Wasser zu sein. Um irgendwann mal erfolgreich zu sein, braucht man auch ein gewisses Durchhaltevermögen.
Dranbleiben und sich nicht von kleinen oder größeren Rückschritten aus der Spur bringen lassen. Am Ende des Tages den Spaß am Sport nicht verlieren!“
Es wirkt von außen so, als würde eine einzige Person das Boot rudern. Dabei treibt das perfekte Zusammenspiel der acht einzelnen Ruderer das Boot des Deutschland-Achters nach vorne.
Kilometer fressen auf dem Dortmund-Ems-Kanal An den Spundwänden des Kanals sind Markierungen mit den Kilometerständen angebracht. Laurits Follert aus dem Achter orientiert sich auch an den Brücken auf der Strecke: „Die kennt man alle“, erzählt er und lacht. „Auf der Runtertour zählt man schon manchmal die Brücken und weiß, dass ist jetzt die letzte Brücke und gleich haben wir es gepackt, dann sind wir wieder am Steg.“
Hier draußen auf dem Wasser kommt einiges zusammen, was das Rudern beeinflusst: die Mitruderer, das Wetter, der Wind und das Wasser, erzählt mir Trainerin Sabine: „Da kommen Schiffe entgegen, dann haben wir viele Wellen. Das schwappt dann im Kanal noch eine Zeit nach, ähnlich wie in der Badewanne.“
Schiffe haben dabei immer Vorfahrt. Die muss der Steuermann im Blick haben, sonst könnte es brenzlig werden.
Bundestrainerin Sabine beobachtet die Sportler genau: „Jeder im Boot weiß, was unser Ziel ist. Wir wollen im Sommer bei den Olympischen Spielen gut abschneiden und die Konkurrenz stört sich nicht daran, ob hier das Wetter jetzt schlecht oder gut ist. Die Motivation bei uns ist sehr hoch und unser Ziel ist, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen!“

Sabine Tschäge: Sie ist die erste Cheftrainerin beim Deutschland-Achter.

Über ein Megafon gibt Sabine kurze Anweisungen, die die Ruderer sofort umsetzen. Es geht um kleine Details, die den Ruderflow noch perfekter machen und den Rhythmus des Teams verbessern. Max John ist einer der Ruderer im Achter, der sich nach einer Verletzung zurückgekämpft hat. Mit einem Trick holt er sich die Extraportion Motivation im Training: „Ich stelle mir die Boote der Gegner neben mir vor. Unsere größten Konkurrenten, also das Boot der Briten oder Niederländer, die man halt schlagen möchte. Der Gegner ist neben uns, der gibt alles, jetzt müssen auch wir alles geben!“
Wer am Dortmund-Ems-Kanal vorbeiradelt, kann Glück haben und die Ruderer live sehen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Oder im Juli den Fernseher anschalten und die Daumen drücken für die olympische Goldmedaille.

Gute Stimmung bei den Teams: DeutschlandAchter, -Vierer und -Zweier ohne Steuermann auf einem Bild. Das 17,5 Meter lange Boot passte nicht mehr ganz aufs Bild.
Echt spritzig: Beim Wasserball erzielst du Tore im Schwimmbecken.

Bei diesen Wassersportarten geht es mit Schnorchel, Ball oder auf Kufen zur Sache.
Schwimmlehrer Carsten Dorn steht am
Wasserball, Tauchen, Kanufahren – es gibt so viele Möglichkeiten, im oder auf dem Wasser sportlich aktiv zu sein. Doch bei all diesen Sportarten ist eines wichtig: Du musst zuerst schwimmen lernen, damit du mitmachen kannst.
Beim Schwimmen übst du nicht nur Geschicklichkeit und Ausdauer. Es gibt dir Sicherheit, wenn du dich in tiefem Wasser ohne Angst bewegen kannst.
Beim SV Westfalen haben wir uns den Schwimmunterricht im Dortmunder Südbad angesehen.
Rand des 50 Meter langen Beckens und gibt Anweisungen: „Die Beine zusammen und kräftig durchziehen“, ruft er. Im Wasser wird das gleich mal umgesetzt. Die Kinder, die heute durch das Becken schwimmen, haben schon viel gelernt. Sie wissen, wie man atmet, gleitet und sich sicher im Wasser fortbewegt.
Heute geht es ums Kraulen und ums Brustschwimmen. Das nächsthöhere Abzeichen nach dem Seepferdchen ist das DLRG-Abzeichen in Bronze. Um das zu bekommen, musst du einen Kopfsprung vom Beckenrand machen und dann 15

Schwimmlehrer Carsten Dorn erklärt die Technik zum Kraul-Schwimmen: Was schwer aussieht, ist relativ leicht zu lernen.
Minuten lang schwimmen. Eine Strecke von 200 Metern soll dabei zurückgelegt werden, also vier Bahnen im großen Becken. Zur Schwimmprüfung gehört auch, zwei Meter tief zu tauchen und einen Ring aus dem Wasser zu holen. Zum Abschluss zeigst du noch einen Sprung vom Ein-Meter-Brett, dann ist das Bronze-Abzeichen geschafft.
Wer den Wassersport für sich entdeckt hat, kann beim SV Westfalen aus einer Vielzahl von Sportarten wählen. Es gibt so unterschiedliche Angebote wie Aquajogging, Wasserball oder Unterwasserrugby.
Unterwasser-Körbe als Ziel
Unterwasserrugby ist ein Mannschaftssport, bei dem es darum geht, den Spielball in den gegnerischen Korb zu befördern. Dieser Korb befindet sich aber unter Wasser! Deshalb besteht die Ausrüstung
aus Flossen, Taucherbrille und Schnorchel. Allerdings kann man sich den Ball unter Wasser nicht richtig zuwerfen, sondern man schiebt sich den Ball zu – etwa zwei bis drei Meter weit. Damit der Ball nicht zur Wasseroberfläche zieht, ist er ganz schön schwer. Rund 3,5 Kilo bringt er auf die Waage.
Jan Engel ist beim SV Westfalen einer der Betreuer beim Unterwasserrugby. Er erklärt, dass jeder Spieler ungefähr 15 bis 20 Sekunden unter Wasser bleiben kann: „Wir wechseln auch fliegend, also, wir haben immer sechs Spieler im Spielfeld, bei so einem normalen Ligaspiel. Es gibt den Auswechselbereich, da springt man aus dem Becken raus und ein neuer Spieler
springt dafür wieder in das Becken rein.“
Diese schnellen Wechsel machen die Sportart auch aus – jeder Spieler macht unter Wasser etwa zwei, drei Spielaktionen und dann wird wieder gewechselt.
Natürlich gibt es auch Raufereien um den Ball – daher kommt die Nähe zum Rugby. Und wenn plötzlich acht oder neun Leute um den Ball kämpfen, wirken die Teams ein bisschen wie ein riesiger Fischschwarm, der aus Menschen besteht.
Ein Unterwasserrugby-Spiel besteht aus zwei Halbzeiten mit einer Spielzeit von je 15 Minuten. Taktisches Gespür, Beweglichkeit und Schnelligkeit sind bei den Spielerinnen und Spielern erforderlich. Das Team, das am Ende die meisten Körbe geworfen hat, gewinnt. Jan Vogel: „Das Schöne am Unterwasserrugby ist, dass uns viele Spielerinnen und Spieler bis ins hohe Alter erhalten bleiben.“ Die Mannschaften sind bunt gemischt — und alle haben viel Spaß an ihrem Sport.
Schönhauser Str. 7 44135 Dortmund
Wenn du Interesse am Sport im Schwimmbecken hast, melde dich beim SV Westfalen: Instagram: svwestfalen 0151-231 83 516 post@svwestfalen.de
Schwimmendes Tor
Beim Wasserball kommst du ohne Taucherbrille und Schnorchel aus. Hier schauen nämlich alle mit den Köpfen aus dem Wasser heraus. Gespielt wird auf zwei Tore, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und genau in die soll der Ball geworfen werden. Deshalb hat jedes Team eine Torhüterin oder einen Torhüter. Weil im Wasser die Badesachen nicht zu sehen sind, tragen die Mannschaften Badekappen in verschiedenen Farben.

Badekappe, Taucherbrille und Schnorchel gehören zur Ausrüstung eines jeden Spielers beim Unterwasserrugby.
Beim Wasserball geht es ganz schön zur Sache. Schließlich kämpfen die Spielerinnen und Spieler um den Ball und müssen sich gleichzeitig über Wasser halten. Doch die Schiedsrichter sehen genau hin und erkennen auch ein Foul unter der Wasseroberfläche.
Eiskalter Teamsport
Für diesen Sport wird gefrorenes Wasser gebraucht: Beim Eishockey treten zwei Teams auf dem Eis gegeneinander an. Tore zu schießen ist auch hier das Ziel. Das Tempo auf dem Eis ist dabei deutlich höher als bei den Sportarten im Wasser.
Die Eisadler sind der Eishockeyverein in Dortmund. Stefan Witte ist Vorsitzender des Vereins und zeigt uns alles: das Stadion, die Tribünen, die Vereinsräume und auch die Umkleidekabinen. Mannschaften gibt es bei den Eisadlern ab einem Alter von sieben Jahren. „Wir wollen zeigen, dass Eishockey ein Sport ist, der viel
Spaß macht, und laden alle Interessierten gerne zu einer Schnupperstunde bei uns ein“, sagt Stefan Witte.
Auch in den Sommermonaten, wenn es kein Eis in der Halle gibt, gibt es Trainingsstunden – dann übt man die Schusstechnik und macht viele Konditionsübungen. Denn Eishockey ist ein Sport, der sehr viel Kraft und Ausdauer erfordert. Im Team gibt es eine klare Aufgabenverteilung für die verschiedenen Positionen. Der Sturm muss flink sein, die Verteidigung umsichtig und die Goalies, also die Torhüter, müssen reaktionsschnell sein.
Um Verletzungen vorzubeugen, ist beim Eishockey eine spezielle Schutzausrüstung vorgeschrieben. Ein starker Teamgeist ist aber noch wichtiger.

Viel Tempo auf Kufen
Die jungen Spieler tragen Schlittschuhe und viel gepolsterte Schutzkleidung, damit man sich auf dem Eis nicht verletzt. Klar, denn der Untergrund ist superhart. Eine Grundausrüstung kostet etwa 300 Euro – aber der Verein hilft dabei, alle auszurüsten. Es gibt sogar Tauschbörsen, damit man nicht ständig Sachen wie Schienbeinschoner, Brustschutz, Helm, Handschuh oder Stutzen neu kaufen muss. Weil es so aufwändig ist, die volle Montur anzuziehen, kommen die Eltern mit in die Kabine und helfen beim Anziehen.

Eishockey ist ein schnel- ler Mannschaftssport: Ein geschossener Puck kann eine Geschwindig- keit von über 170 km/h erreichen.
N
Während des Spiels dürfen pro Mannschaft maximal sechs Spieler gleichzeitig auf dem Eis sein. In der Regel sind dies fünf Feldspieler und der Goalie im Tor. Die Spielzeit bei Turnieren beträgt zweimal 20 Minuten. Da das Laufen auf dem Eis und die Jagd nach dem Puck für die Spieler sehr anstrengend sind, wird innerhalb der Teams häufig gewechselt.
Die Gemeinschaft bei den Eisadlern ist toll – von den Betreuern bis zum Eismeister, der das Eis wieder für die Schlittschuhe aufbereitet, herrscht bei allen eine tolle Stimmung.
Wer neugierig geworden ist und mal ein Probetraining besuchen möchte, kann das hier anfragen:
Instagram: eisadlerdortmund 0231 206 44 007
info@eisadler.com
EISADLER DORTMUND

Zocken boomt. Für die besten Gamer und Gamerinnen geht es an der Konsole mittlerweile sogar um richtig hohe Preisgelder. Alle großen Fußballvereine haben eSportsAbteilungen. Und seit Kurzem ist die Virtual Bundesliga ganz offiziell Teil der deutschen Fußballwelt. Für den BVB war beim Thema eFootball bislang allerdings der Unterhaltungswert wichtiger als Erfolge und Pokale. „Coolen Gaming-Content mit Bezug zum Fußball zu erstellen, das wird auch in Zukunft
unser Fokus sein“, sagt Julian Schade, der beim BVB am Thema eFootball arbeitet, „aber wir wollen schon auch in der Virtual Bundesliga angreifen.“
eSports ist beim BVB ausschließlich eFootball. Erné Embeli, dem Hunderttausende auf TikTok, YouTube und Instagram folgen, gilt als Aushängeschild des Projektes. Es gibt aber ein ganzes eFootball-Team, und zu dem gehört seit einigen Monaten auch die erst 14-jährige Eleonora „Eli“ Limkou. Das Besondere an der fußballverrückten Nachwuchs-Gamerin: Sie ist auch auf dem echten Rasen ein riesiges Talent und spielt gleichzeitig bei den U17-Juniorinnen des BVB. Wir haben Eli gefragt, wie das so ist – und wie sie im eFootball-Team gelandet ist …
Eli, was hat dich zuerst gepackt, das Fußballspielen auf der Konsole oder draußen?
Auf jeden Fall das Spielen draußen. Ich hab mit vier Jahren angefangen. Mein Vater hat Fußball gespielt, mein älterer Bruder auch. Über den bin ich dann irgendwann auch zur Konsole gekommen, aber erst deutlich später.
Zocken deine Freundinnen auch?
Zwei, drei gibt es, das sind Mitspielerinnen aus der U17, aber sonst spiele ich eher online gegen Jungs.


Stundenlang alleine im dunklen Zimmer zu zocken, ist eher nicht Elis Lieblingsszenario. Am liebsten spielt sie live mit anderen.

Die U17-Juniorinnen sind die erste weibliche Nachwuchsmannschaft überhaupt beim BVB. Eli zieht im Mittelfeld die Fäden.

Wie wurde das eFootball-Team vom BVB auf dich aufmerksam?
Der BVB macht ab und zu Online-Turniere, an denen jeder teilnehmen kann. Ich hab mich einfach mal bei einem angemeldet und direkt gewonnen. Das war wohl ganz gut.
Und was bedeutet es, jetzt offiziell eFootballerin zu sein?
Die eFootball-Abteilung des BVB organisiert regelmäßig ScoutingTurniere, außerdem Turniere und Events mit Sponsoren. Es gibt auch immer wieder Livestreams auf
Twitch und Co. Hier findest du die Accounts:
Instagram: @bvb09efootball
Twitch: @bvb_official
Tiktok: @bvb09efootball
Web: efootball.bvb.de
Wir haben ja extra Trainer beim BVB, die mir noch mal viel beibringen. Außerdem lerne ich viel von den anderen Teammitgliedern. Bislang spiele ich immer mal wieder Turniere und bin bei anderen Events dabei, aber das Ziel ist, mit 16 in der Virtual Bundesliga zu starten. Das ist das Mindestalter dafür. Mal gucken, ob das klappt.
Und im richtigen Fußball, welche Ziele hast du da? Ehrlich gesagt die gleichen. Ich werde hier krass gefördert und mein großer Traum ist die Bundesliga. Ob beides klappt, wie gesagt, das wird sich zeigen. Ich versuche, mir nicht zu viel Druck zu machen, und das ist auch meinen Trainern sehr wichtig, in der U17 und beim eFootball.
Hast du eine Lieblingsspielerin oder einen Lieblingsspieler?
Jamie Bynoe-Gittens. Der ist jung, schnell, technisch unglaublich gut und noch ganz am Anfang einer Profikarriere beim BVB. Der ist auch immer in meinem virtuellen Team dabei. Ich habe ihn sogar schon mal getroffen, als wir mit der U17 auf dem Profigelände im Footbonaut trainiert haben. Das ist eine Art kleines überdachtes Spielfeld, wo aus verschiedenen Richtungen Bälle kommen, auf die du reagieren und sie zurückspielen musst.
Bringt dir das Spielen an der Konsole eigentlich was für draußen?
Die Trainer beim eFootball legen viel Wert auf die Spielübersicht, also das Verlagern von der einen Seite auf die andere und so. Und das hilft auf jeden Fall auch draußen. Den einen oder anderen Trick habe ich auch erst auf der Konsole gelernt und dann auf dem echten Rasen probiert.
Dortmund
Kampstraße 1, 44137 Dortmund
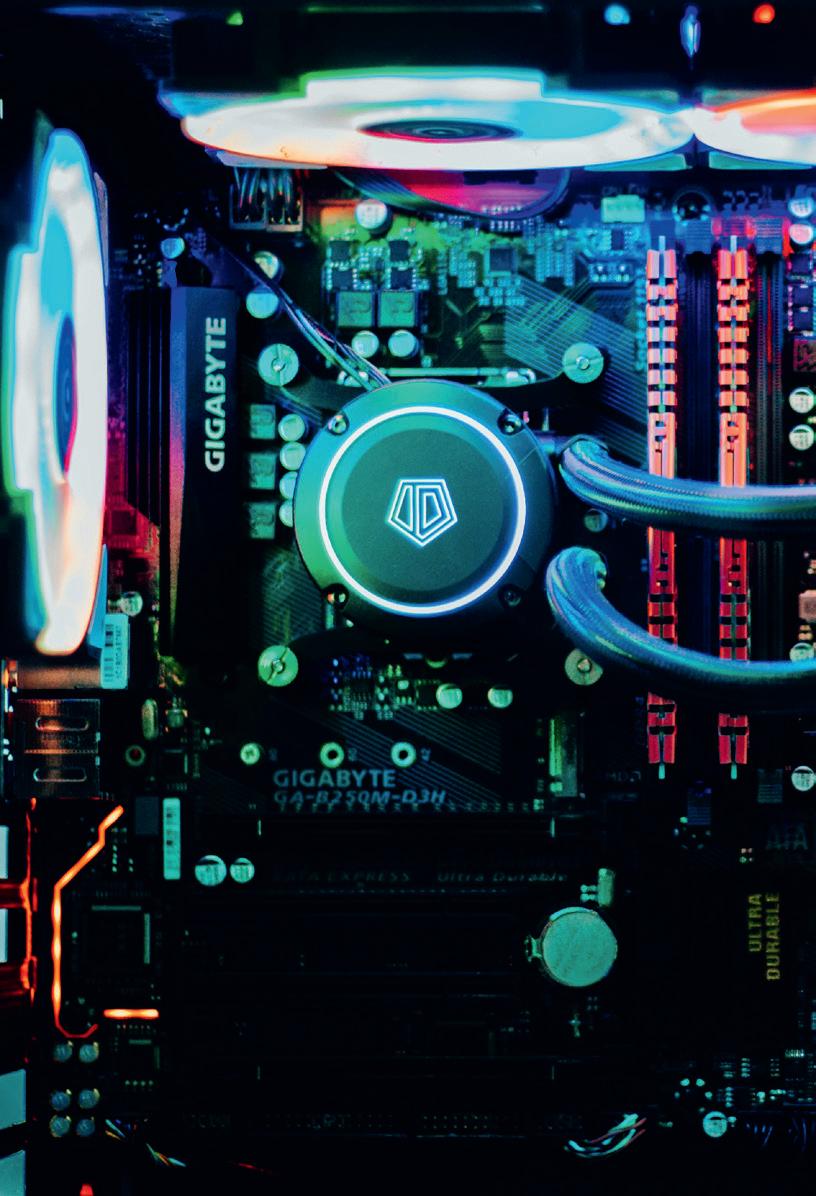
Die neue eSports-Arena in der Stadt
Mitten in der City kannst du seit Februar auf einer riesigen Fläche mit über 150 High-End-GamingPCs und Konsolen auf Profi-Level zocken. Das BaseStack bietet auch Trainings-Sessions, Turniere sowie andere Events und ist die offizielle Spielstätte der BVB-eFootball-Abteilung für die Virtuelle Bundesliga. Hin kommst du easy zu Fuß vom Hauptbahnhof, mehr Infos findest du unter www.basestack.gg.


Highlights � 3D-Kino � Schatzkammer � 360° Bundesliga Show

Reporterkabine
Ferienprogramm
Spielzone
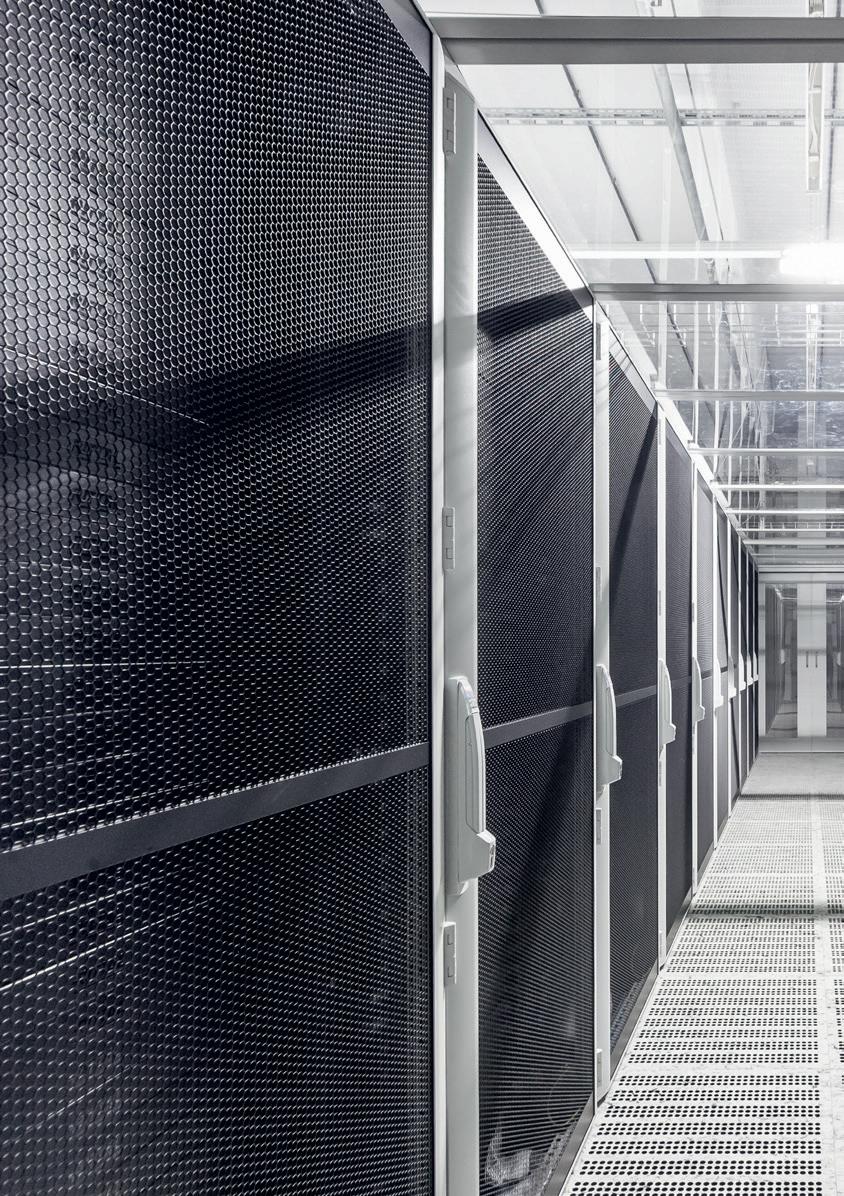

Nicht nur wir Menschen leiden unter Hitze, auch Computern kann sie schaden.
Aber wie hält man die Technik schön kühl? Wir haben für dich in den Rechenzentren von DOKOM21 hinter die Kulissen geblickt.
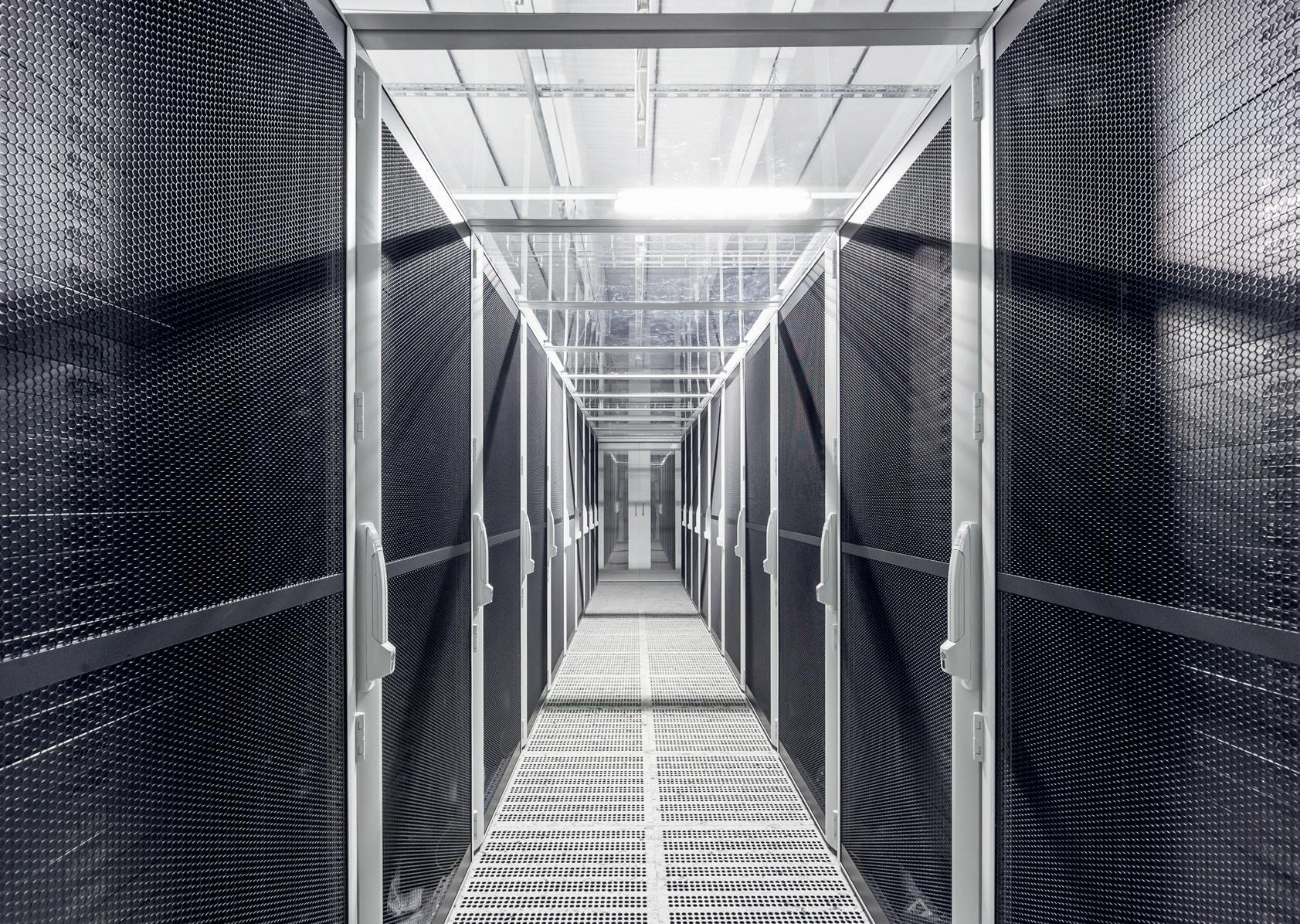
Hinter diesen Wänden verbergen sich unzählige Rechner und Festplatten. Die produzieren viel Hitze – und müssen kühl gehalten werden.

Kennst du dieses Gefühl? Es ist ein heißer Sommertag, du liegst im Garten und bist vor Hitze schon ganz rot im Gesicht. Doch dann macht jemand ein paar Meter neben dir den Rasensprenger an, die nassen Tröpfchen benetzen deine Haut und schon fühlst du dich viel frischer. So ähnlich funktioniert das auch mit Technik. Denn nicht nur Menschen kann es zu heiß werden, sondern auch Rechnern und Festplatten. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du auf deinem Handy oder Laptop zu lange YouTube-Videos geschaut hast. Geräte überhitzen mit der Zeit.
Das gilt vor allem, wenn sich viele Rechner in einem Raum befinden und riesige Datenmengen berechnen – sie laufen heiß. Dabei können Daten verloren gehen oder beschädigt werden.
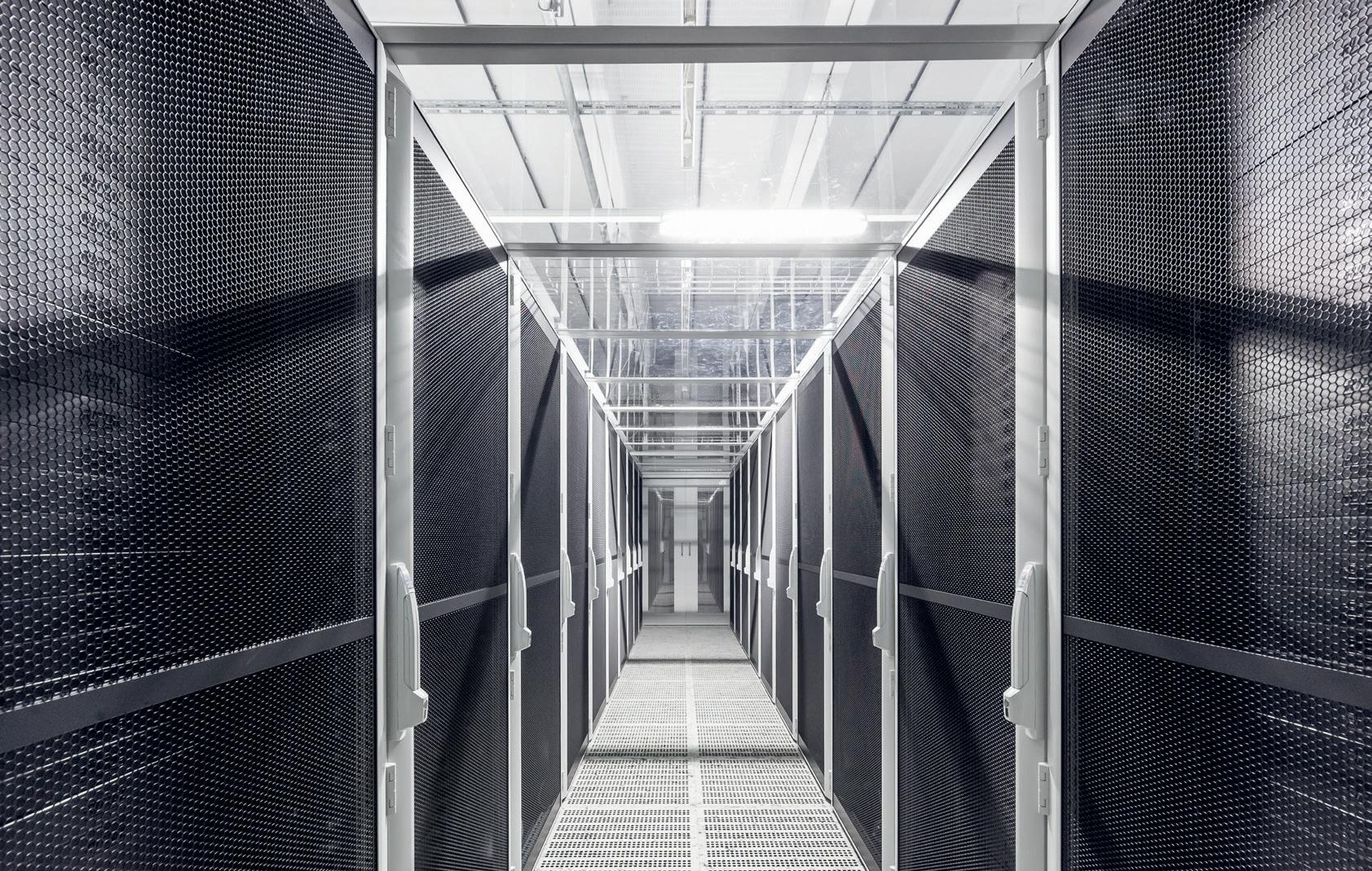
Riesiger Datenspeicher
Nun kann man Rechner natürlich nicht einfach nassspritzen, dann würden sie ja kaputtgehen. Wie man sie dennoch kühlt – auch mit Hilfe von Wasser –, weiß Mar-
kus Schimpf. Er arbeitet für den Telekommunikationsanbieter DOKOM21, der in Dortmund fünf Rechenzentren betreibt. Dort werden wichtige Daten gespeichert, etwa von Banken oder Onlineshops. Und jedes Foto, das du auf Social Media postest, jeder Song, den du streamst, und jede Chat-Nachricht, die du verschickst, wird auf einer Festplatte in einem Rechenzentrum gespeichert. Klar, dass man nicht möchte, dass diese Daten verloren gehen! Deshalb ist die Kühlung der Geräte auch das A und O.
Aufbau eines Datenzentrums
Um zu verstehen, wie das funktioniert, musst du erst einmal wissen, wie so ein Rechenzentrum überhaupt aufgebaut ist: Von außen sieht es wie eine Lagerhalle aus, innen befinden sich verschiedene Kammern mit Reihen voller Festplatten und Rechner, die durch unzählige Kabel miteinander verbunden sind. Du kannst dir das ein bisschen wie eine Bibliothek mit verschiedenen Regalen vorstellen, nur dass nicht Bücher, sondern Datenspeicher die Reihen füllen. Und im GeRechenzentren sehen von außen wie große Lagerhallen aus. Teil des Kühlkonzepts sind Außenkühler, große graue Kästen mit Ventilatoren (vorne links im Bild), die für Frischluftzufuhr sorgen.
Bei angenehmen 25 Grad funktionieren die Rechner einwandfrei. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass die Temperatur gehalten wird.
Durch Löcher im Boden gelangt die gekühlte Luft in die Kammern. Feine, computergesteuerte Sensoren messen rund um die Uhr die Temperatur. Ist es zu heiß, wird der Luftstrom angepasst. Kühle Luft marsch!
Die Rechner in den Kammern (links) berechnen riesige Datenmengen. Dabei erzeugen sie Hitze. Die warme Luft wird durch Schlitze rausgepustet und in die Gänge außerhalb der Kammern weitergegeben.

In den Gängen befinden sich Klimaschränke, also große Klimaanlagen, die die warme Luft aufnehmen und runterkühlen. Über Rohre sind sie auch mit den Außenkühlern draußen vor dem Gebäude verbunden.
Der Fußboden ist ein doppelter Boden, durch den die kalte Luft weiter in die Kammern geleitet wird.

gensatz zu Büchern brauchen sie Strom, der wiederum Hitze erzeugt. „Ohne Kühlung“, sagt Markus Schimpf, „würden in den Kammern schnell mal 50 Grad und mehr herrschen.“
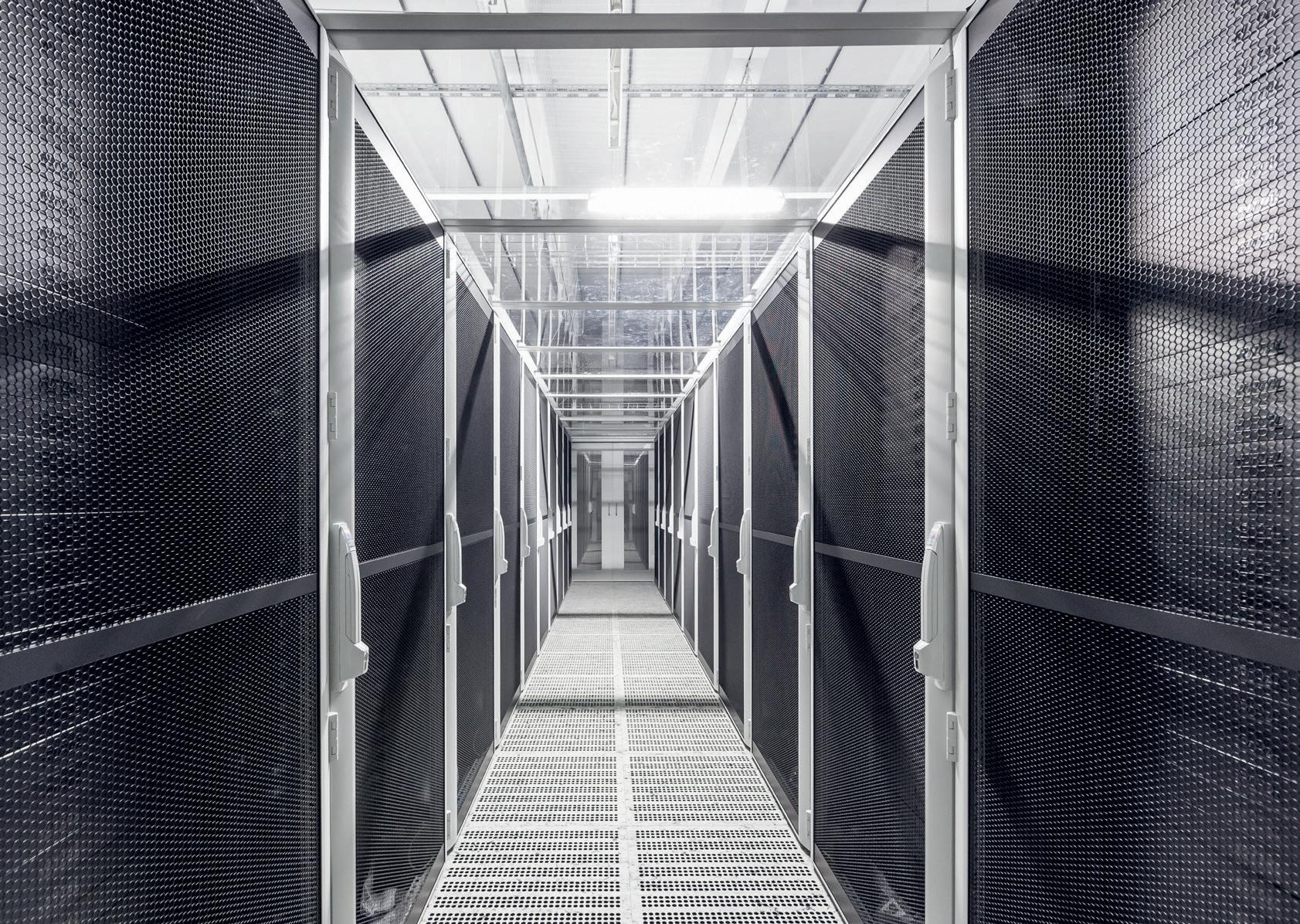
Kalte Luft rein, warme raus
Zwischen den Rechnerreihen – wenn man so will: in den Regalgängen – jeder Kammer zirkuliert deshalb kühle Luft.
Die kommt aus Löchern im Fußboden.
Cooler Trick: Es ist ein doppelter Boden,

Im Winter sorgt die kalte Außenluft, die über Ventilatoren ins Innere des Gebäudes gepustet wird, für Abkühlung. Im Sommer wird über Wasserrohre Sprühnebel in die Luft gepumpt, die dadurch abkühlt. Das spart Strom und ist umweltfreundlich.
Im Winter, wenn es draußen kalt ist, bedienen sie sich einfach an der kühlen Außenluft, die an die Klimaschränke und von dort aus an die Kammern weitergeleitet wird. Im Frühling und Sommer, wenn das Thermometer nach oben klettert, muss die Kühlflüssigkeit von den Klimaanlagen mithilfe der Kompressoren runtergekühlt werden. Das verbraucht aber Energie.
durch den die kalte Luft ganz gezielt in die Kammern geleitet wird. Feine, computergesteuerte Sensoren messen rund um die Uhr die Temperatur. Liegt sie bei angenehmen 25 Grad, ist alles in Ordnung, wird es wärmer, wird der Luftstrom entsprechend angepasst.
Die warme Luft wird wiederum durch Schlitze hinter den Rechnern rausgepustet und in die Gänge außerhalb der Kammer weitergegeben. Dort stehen Klimaschränke, also große Klimaanlagen, die die warme Luft aufnehmen, runterkühlen und wieder durch die Bodenrohre in die Kammer abgeben.
Umweltfreundliche Kühlung
„Aber das ist noch nicht alles“, sagt Markus Schimpf. Denn damit die Klimaschränke, die wie Kühlschränke mit Kühlflüssigkeit und einer Art elektrisch angetriebenen Pumpe – Kompressor genannt – konstruiert sind, möglichst energiesparend funktionieren, sind sie mit sogenannten Außenkühlern verbunden. Die stehen draußen vor der Halle, sind etwa so groß wie ein LKW und mit Rohren und Ventilatoren ausgestattet.
Wassernebel marsch!
Logisch, dass mit steigender Hitze immer mehr Energie, also Strom, nötig ist. Und genau deshalb kommt an heißen Sommertagen ein weiterer Kühltrick zum Einsatz, der Adiabatik heißt und ein wenig an den Rasensprenger erinnert: Durch die Rohre, die rings um die Außenkühler verlaufen, fließt kaltes Wasser. Wenn das Thermometer draußen auf mehr als 36 Grad steigt, sprühen die Rohre über Düsen feinen Wassernebel in die Luft. Das Wasser verdunstet in der heißen Luft und kühlt sie dadurch ab. Das spart Strom und ist umweltfreundlich. Nun kann die abgekühlte Luft ins Innere des Gebäudes geleitet werden. Und dafür sorgen, dass alle Rechner kühl durch den Sommer kommen.
Es ist ein richtig heißer Tag. Was gibt’s da Schöneres, als sich im Wasser abzukühlen? Dortmunds Schwimmbäder sind der perfekte Ort für erfrischenden Spaß.

Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche
Verpflegung
Preise

Hier wird das Wasser nicht mit Chlor, sondern mit Pflanzen gereinigt. Drei Becken – Schwimmer, Nichtschwimmer und Planschbereich – sorgen für Erfrischung, dazu gibt es den Spielplatz, Strand und Kiosk. Das besondere Highlight beim Freibadbesuch: Such Schnappi! Die Schildkröte lebt im Biotop, einem ruhigen Teich mit Liegeplätzen und Sonnendecks. Dort versteckt sie sich geschickt im Schatten. Findest du sie?

Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche
Verpflegung
Preise

Das Volksbad ist ein ganz besonderes Schwimmbad. Es liegt im Schatten des Signal Iduna Parks, des Stadions von Borussia Dortmund. Die Sprungtürme sind gigantisch und ragen wie Monumente in den Himmel. Für Familien und Kinder gibt es ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken mit einer Wassertemperatur von kuscheligen 30 Grad. Nach dem Schwimmen könnt ihr euch auf den großen Liegewiesen entspannen oder Beachvolleyball im Sand spielen.
Schwimmweg 2
Telefon:
Ihr wisst nicht, ob das Wetter mitspielt? Dann ab ins Sole- und Allwetterbad im Revierpark Wischlingen! Die Solehalle bietet entspannendes Salzwasser für Haut und Atemwege. Im Aktivarium gibt es Schwimmbecken, Kinderbecken mit Rutsche und Planschbecken. Draußen locken ein riesiges Wellenbecken, Sprungbecken und ein großes Solebecken. Wasserkanonen-Spaß sei euch garantiert! Ein perfekter Ort für einen Tag voller Abenteuer für Groß und Klein!
Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche
Verpflegung
Preise
www.wischlingen.de
Im idyllischen Freibad im Wellinghofener Wald gibt es für jedes Alter etwas: Planschen im Nichtschwimmerbecken oder Schwimmen im 50-Meter-Sportbecken mit Sprungbrett. Die hügelige Liegewiese unter hohen Bäumen bietet den perfekten Platz für die Sonnenanbeter unter euch. Neben Schwimmen und Sonnen gibt’s zudem Gelegenheit zu Beachvolleyball, Fußball und auch einen freundlichen Spielplatz. Ein toller Sommer-Ort voller sportlicher Vielfalt für alle!
Hopmanns
Wasserbecken

Sprungbrett
Liegefläche
Verpflegung
Preise

Deine Bewertung:
Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche
Verpflegung
Preise
Ziemlich cool ist im Sommer der Seepark Lünen und mittendrin der Horstmarer See. Der südliche Teil des Sees ist unzugänglich – ein Naturschutzgebiet für Tiere und Pflanzen. Doch am Nordufer erwartet euch der absolute Hotspot! Kostenloses Sonnenbaden auf feinstem Sand und weitläufigen Liegewiesen. In nur 45 Minuten mit dem Fahrrad von Dortmund aus erreichbar, bietet das Ufer ein reichhaltiges Café. Genießt die Aussicht vom Café oder plant euer eigenes Picknick direkt am Wasser!


Luft holen:
Ort finden:


www.sv-derne.de/freibad Im Sperrfeld 32 44329 Dortmund

So klappt die perfekte
„Arschbombe“
Achte darauf, dass das Wasser tief genug ist und dass der Bereich frei von anderen Schwimmern oder Hindernissen ist.
Nimm einen tiefen Atemzug, bevor du springst, und halte dann die Luft an. So kannst du dich besser unter Wasser orientieren und vermeiden, dass Wasser in deine Lunge gelangt.
Macht dich zum „Paket“: Dabei werden die Beine angehockt und mit den Armen umschlossen. Senke dein Kinn auf die Brust. Dies hilft, eine stabile Haltung zu bewahren, und sorgt für den ordentlichen Splash!
Kennt ihr das älteste Freibad Europas? In Dortmund Derne erwartet euch ein wahres Juwel – über 150 Jahre alt und familiär. Der Bademeister kennt fast jeden Gast persönlich. Mit geteiltem Becken, Rutschen ins kühle Nass und einer großartigen Liegewiese mit Kiosk für euer Lieblingseis. Sportbegeistert? Beachvolleyball, Tischtennis, Basketball – im Bad ist alles da! Ihr wollt mit dem Rad kommen? Kein Problem, es gibt genug Fahrradständer. Und als Geheimtipp gelten das Ferienkino unter Bäumen und ein geplanter Trödelmarkt. Termine? Schaut einfach online nach!
Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche Verpflegung
Preise
ACHTUNG ! Renovierungsarbeiten in 2024. Unser Tipp für 2025!
Auf einer Fläche von 4 000 Quadratmetern bietet das Freibad Badespaß für die ganze Familie. Für Herzklopfen und jede Menge Adrenalin sorgt die 65 Meter lange
Wasserbecken
Sprungbrett
Liegefläche Verpflegung
Preise
Doppelrutsche. Eine echte Abenteuerfahrt! Außerdem gibt es ein Planschbecken mit Wasserspielen zum Toben und einen Strömungskanal, in dem sich auch die Großen richtig auspowern können. Das Schwimmerbecken bietet ausreichend Platz zum Schwimmen oder einfach nur zum Relaxen am Beckenrand. Außerdem gibt es eine Badeinsel, auf der man sich in der Sonne aalen kann.
Badweg 30 44369 Dortmund
Telefon: 0231 - 31 01 80

Für den Extra-Splash: Strecke kurz vor dem Eintauchen eines deiner Beine aus.
Vom Sprungbrett: Falls du aus größerer Höhe springst, zieh deine Beine etwas stärker an. Das gibt Stabilität.
Sorge für Zuschauer: Lass Freunde oder deine Familie zugucken, wenn du springst. So bist du immer auf der sicheren Seite.
FREIBAD HARDENBERGWoher kommt eigentlich das Dortmunder Leitungswasser?
Was wird damit gemacht, damit wir es trinken können? Wir haben uns mal umgesehen
Um mehr darüber zu erfahren, haben wir Juri Siebel-Achenbach besucht. Der 35-jährige Techniker für Elektro- und Automatisierungstechnik arbeitet seit über zehn Jahren bei der Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW). Seit 2023 ist er stellvertretender Leiter des Wasserwerks in Westhofen.

In der Wasserschutzzone sind die Anlagen zur Gewinnung von Trinkwasser sicher vor Verunreinigungen.
Das Wasserwerk Westhofen liegt im Ruhrtal, genau wie die anderen fünf Werke von WWW. Juri erwartet uns vor einem Tor mit dem Schild „Wasserschutzzone. Zutritt nicht gestattet“. Für uns gilt das zum Glück nicht. Vorbei an einem denkmalgeschützten Wasserkraftwerk in dem Strom aus Ruhrwasser gewonnen wird, fahren wir in die Ruhrwiesen. Jenseits des Weges entdecken wir Nonnengänse, Fischreiher und Rehe. Was für eine Idylle!
„Das Oberflächenwasser der Ruhr, das wir zu Trinkwasser aufbereiten, wird an mehreren Stellen aus aus dem Fluss entnommen“, erzählt Juri.

Juri Siebel-Achenbach führt uns durchs Wasserwerk in Westhofen und zeigt uns die einzelnen Stationen Trinkwasseraufbereitung.der
STATION 1
Ruhrwasser wird entnommen
STATION 2
Kiesfilter
fängt Pflanzenteile
STATION 3
Filterkombination aus Sand und Kies
Die 219,3 km lange Ruhr entspringt im Sauerland nördlich von Winterberg und mündet in Duisburg in den Rhein.

Wassergewinnung im Ruhrtal
Zunächst fließt das aus der Ruhr entnommene Wasser über Kiesfilter, in denen es vorgereinigt wird. Alle gröberen Schwebstoffe wie z. B. Pflanzenreste bleiben im Kies hängen. „Das vorgefilterte Wasser fließt dann über Rohrleitungen hier in Westhofen in die Langsamsandfilter.“ So heißen die großen Versickerungsbecken, die Juri uns zeigt, in der Fachsprache. Insgesamt 12 solcher Becken mit einer Gesamtfläche von mehr als 8 Fußballfeldern gibt es in Westhofen. Darin wird das Wasser ein zweites Mal gefiltert: Erst sickert es durch die bis zu zwei Meter dicke Sandschicht der Becken, dann durch die natürliche, etwa sieben Meter dicke Schicht Ruhrkies. Auf dem darunterliegenden Fels mischt es sich mit dem Grundwasser.
Anschließend wird das versickerte Wasser in Rohwasserbrunnen aufgefangen und zum zweiten Standort des Westhofener Wasserwerks geleitet. Wir fahren mit Juri zu dem Gelände am Rand eines Wohngebiets.
Im Wasserkraftwerk in Westhofen wird seit 2012 Strom aus Wasser- kraft hergestellt. Dazu wurde das ehemalige Pumpwerk umgebaut. Das Gebäude von 1922 steht heute unter Denkmalschutz.

Trinkwasser wird nicht nur aus Flüssen wie der Ruhr gewonnen. Auch Quellen sowie das Grund- wasser können angezapft werden. In manchen Ländern wird auch das Meerwasser von Salz befreit und zu Trinkwasser gemacht. Das Wasser von Wasserwerke Westfalen ist ein Gemisch aus etwa 70 % Ruhrwasser und 30 % Grundwasser.

Von den 12 Langsamsandfiltern in Westhofen ist höchstens die Hälfte in Betrieb, also mit Wasser gefüllt. Die andere Hälfte wird derweil gereinigt.
STATION 4
Ozon tötet
Keime
STATION 5
Schnellfilter aus Steinkohle und Quarzsand
STATION 6
Aktivkohlefilter beseitigt allerkleinste Stoffe
STATION 7
Luft wird eingesprudelt
Schrittweise Aufbereitung
Die weitergehende Aufbereitungsanlage, kurz WAA, ist in einer großen Halle untergebracht.
Wasser ist hier nirgendwo zu sehen, dafür umso mehr zu hören: Es rauscht durch teils meterdicke Rohre und blubbert in verschiedenen riesigen Kammern und Becken. Alles ist blitzsauber, die gesamte Halle menschenleer. „Vieles läuft hier automatisch“, erzählt Juri.
„Die Wasseraufbereitung passiert quasi von selbst.“
Das Meiste wird über die Zentrale Leitstelle im Wasserwerk in Hengsen überwacht und gesteuert. Juri und seine sechs Mitarbeiter in Westhofen warten hauptsächlich die Anlage.
In der ersten Kammer der WAA findet die sogenannte Ozonung statt. Ozon ist ein Gas, wird es dem Wasser zugesetzt, sorgt es unter anderem dafür, dass Keime abgetötet werden.
Im nächsten Schritt wird das Wasser in die Schnellfilter geschickt. Diese bestehen aus zwei Schichten. Die obere Schicht enthält Steinkohle, sie fängt die gröberen Stoffe ab. Den Rest erledigt die zweite Schicht aus feinem Quarzsand.
Weiter geht es in die Adsorptionsfilter. Deren Becken sind mit Aktivkohle gefüllt. 1 g dieser Kohle hat eine Oberfläche von rund 1 000 m2, die superfeinen Poren der Körner saugen selbst allerkleinste Stoffe wie z. B. Medikamentenreste aus dem Wasser.

Ozon ist ein Gas, das im Wasser vorhandene Keime tötet. Im Anschluss an die Ozonung wird es wieder zu Sauerstoff umgewandelt.
Als Nächstes wird das Wasser entsäuert. Juri öffnet den Deckel eines Entsäuerungsbeckens. Das Wasser darin brodelt und schäumt wie in einem Whirlpool. „Durch das Einsprudeln von Luft wird Kohlenstoffdioxid aus dem Wasser getrieben und der pH-Wert steigt“, erklärt Juri. Anschließen wird das Wasser im Reinwasserbehälter gesammelt und gespeichert.
Als Juri den Deckel eines Entsäuerungsbeckens öffnet, rauscht und sprudelt das Wasser so laut wie an einem Wasserfall.

Wasserwerke Westfalen bereitet nicht nur Trinkwasser auf, sondern stellt auch Strom her. Neben insgesamt fünf Wasserkraftwerken gibt es zudem in jedem Werk eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der WAA. In allen Werken zusammen wurden im Jahr 2023 31,2 Millionen kWh Strom produziert.
Im Pumpwerk findet als letzter Schritt die UV-Desinfektion des Wassers statt.
STATION 8
Wasser wird im Reinwasserbehälter gesammelt
STATION 8
UV-Desinfektion zerstört
Mikroorganismen


Neben der Zentralen Leitstelle in Hengsen, die rund um die Uhr besetzt ist, gibt es in allen Werken eine eigene Leitstelle, um die Wasseraufbereitung zu überwachen – hier die im Wasserwerk Westhofen.
Wasserwerke Westfalen versorgt insge- samt 1,5 Millionen Menschen mit Trink- wasser, darunter auch alle rund 600 000 Dortmunder.
2023 wurden in allen Werken insgesamt 98,4 Mio. m³ Trinkwasser aufbereitet.
Allein 19,8 Mio. m³ davon in Westhofen.
Zum Vergleich: Damit könnte man mehr als 30-mal den Phönixsee komplett auffüllen.
Ab ins Pumpwerk
Ist es jetzt fertiges Trinkwasser? Juri schüttelt den Kopf. „In einem letzten Schritt geht es ins Pumpwerk zur UV-Desinfektion.“ Dabei wird das vorbeiströmende Wasser mit ultraviolettem Licht bestrahlt und mögliche noch übriggebliebene Mikroorganismen werden unschädlich gemacht. „Erst danach darf man aus Oberflächenwasser gewonnenes Trinkwasser auch offiziell Trinkwasser nennen und es aus dem Werk raus in die Hochbehälter pumpen.“
Alles unter Kontrolle
Während der gesamten Aufbereitung wird das Wasser übrigens ständig kontrolliert. Die Proben werden täglich von einem unabhängigen Labor untersucht –Trinkwasser ist das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland.
Weil so viel Reden über Wasser durstig macht, nimmt
Juri uns noch mit in sein Büro, vor dem ein Wassersprudler steht. „Ich selbst trinke nur Leitungswasser“, sagt er, während er jedem von uns ein Glas reicht.
„Man kann keine bessere Qualität und kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.“ Stimmt! Das Wasser löscht nicht nur den Durst, sondern schmeckt richtig gut.
ACHTUNG:
Das gefilterte Wasser sieht sauber aus, ist aber trotzdem nicht zum Trinken geeignet!
Probiere aus, wie ein Wasserwerk funktioniert, und bastele aus einer alten Plastikflasche und wenigen Zutaten einen eigenen Filter. Verwandle dreckiges Pfützenwasser in eine klare Flüssigkeit.
Du brauchst:
• eine Plastikflasche
• Messer oder Schere
• Watte
• Kies
• Aktivkohle (gibt es im Zooladen)
• Becher
So geht es:
1. Schneide die Flasche ungefähr auf halber Höhe vorsichtig in zwei Häften. Die obere Hälfte mit dem Flaschenhals verwendest du für den Filter. Die untere Hälfte wird dein Auffangbehälter für gefiltertes Wasser.
2. Stopfe Watte in den Flaschenhals und drücke sie gut zusammen. Sie muss richtig fest im Hals stecken. Stelle diesen Teil der Flasche dann mit dem Hals nach unten in den abgeschnittenen Teil.
3. Fülle nun nacheinander jeweils eine Schicht Aktivkohle, Sand und Kies in die Flasche. Jede Schicht sollte ein paar Zentimeter dick sein. Fülle die Flasche aber nicht zu voll. Es muss ja auch noch Wasser hineinpassen!
4. Für das Experiment kannst du Wasser aus einer Pfütze verwenden oder Wasser mit Blumenerde mischen. Die schmutzige Flüssigkeit kippst du nun in den Filter. Gieße immer nur so viel Wasser hinein, wie in den Filter und deinen Auffangbehälter passt.
5. Schon bald tropft Wasser aus der Watte im Flaschenhals. Wie sieht es aus?
Probiere auch andere Verschmutzungen aus! Wird das Wasser mit deinem Filter auch dann wieder klar, wenn du es zum Beispiel mit etwas Tinte mischst?
Bis unser Trinkwasser aus der Leitung kommt, nimmt es einen langen Weg. Einen wichtigen Zwischenstopp macht es hier: in den Hochbehältern der Dortmunder Netz GmbH.
Wasser brauchen wir jeden Tag. Beim Zähneputzen, unter der Dusche oder in der Küche. In Dortmund verbraucht jeder Mensch pro Tag etwa 130 Liter. Bis das Wasser aus unseren Leitungen sprudelt, hat es schon eine weite Strecke hinter sich. Kay Efselmann (auf unserem Foto ganz rechts zu sehen) arbeitet bei DONETZ, einer Firma, die zur Dortmunder Energie- und Wasserversorgung gehört. Er ist für den Betrieb der Rohrnetze verantwortlich, durch die das Wasser die vielen Kilometer Entfernung zurücklegt. „Natürlich gefiltert durch Sand und Kies, sickert das Wasser aus der Ruhr bis zu zehn Meter in die Erde und wird dann in unsere Wasseraufbereitungsanla-
Alle zwei Jahre werden die Hochbehälter – wie hier in Dortmund-Höchsten –gereinigt. Dann dürfen auch die Experten ins Innere.


gen befördert“, erklärt er. Dort wird das Wasser erneut gereinigt und hat bereits Trinkwasserqualität, ehe es eine wichtige Zwischenstation erreicht: die sogenannten Hochbehälter, riesige Speicher, die sich – wie es der Name schon verrät – an natürlich hochgelegenen Orten befinden.
In Dortmund befinden sich solche Behälter auf dem Haarstrang, einem Höhenzug im Süden der Stadt. Von außen sind die großen Bauwerke mitten im Wald fast nicht zu erkennen. Spektakulärer sieht es im Inneren aus. Die Säulen sorgen dafür, dass der Hochbehälter dem Druck des Wassers standhält. 22,5 Millionen Liter Wasser passen hier rein. Das sind mehr als 125 000 Badewannen. „Durch den natürlichen Druck kann das Wasser von oben in die Leitungen und bis in die 100 000 Hausanschlüsse gepumpt werden“, beschreibt Kay Efselmann die Idee der Behälter. Mit seinen Kolleg*innen von den Wasserwerken Westfalen sorgt er dafür, dass die acht Hochbehälter immer gut gefüllt sind. Vor allem morgens, wenn sich die meisten Menschen im Badezimmer oder in der Küche aufhalten. „Und bei Heimspielen vom BVB“, sagt Kay, „wenn in der Halbzeit alle aufs Klo gehen.“ Über Nacht werden die Wasserspeicher wieder aufgefüllt – damit auch am nächsten Morgen wieder sauberes Wasser aus den Hähnen kommt.
Der Hochbehälter auf unserem Foto ist acht Meter hoch, die Hälfte davon ist in der Erde vergraben. Er hat zwei Kammern, die größere von beiden hat einen Umfang von 117 Metern oder einen Durchmesser von 48 Meter.
Die Wasserleitungen Dortmunds sind zusammengenommen circa 2 100 Kilometer lang – das entspricht einer Strecke vom Westfalenstadion bis nach Madrid.
Das kleinste Rohr hat einen Durchmesser von 2,5 Zentimetern, das Größte von 1,5 Metern.
An Spitzentagen verteilen die acht Hochbehälter 185 000 Kubikmeter Wasser – pro Stunde.
Zum Vergleich: Ein Kubikmeter sind 1 000 Liter.
Das Wasser in den Hochbehältern wird jeden Tag auf seine Trinkwasserqualität geprüft.
Aus den acht Hochbehältern werden in Dortmund 365 000 Haushalte versorgt –zusammen haben die Behälter ein Fassungsvolumen von 67 Millionen Litern, das entspricht 372 000 vollen Badewannen.



DEW21 Servicecenter
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

④ Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund
Wenn du den Text gelesen und beim Film gut aufgepasst hast, sollte es ein Kinderspiel für dich sein, dieses Kreuzworträtsel zu lösen. Bringe die Buchstaben in den blauen Kästchen in die richtige Reihenfolge und du erhältst das Lösungswort.
SCAN MICH MIT DEM HANDY!
Kleiner Tipp: Es handelt sich um etwas, das viele Menschen gerade im Sommer sehr genießen.
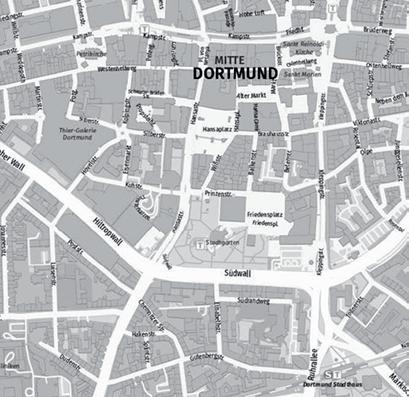

1 In Dortmund und einer anderen Stadt werden regelmäßig insgesamt mehr als 600 000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. Wie heißt die andere Stadt?
Rosenbrunnen Evang. St.Petri Westenhellweg 44137
Bei unser Rätseltour durch Dortmund dreht sich alles um das kühle Nass! Schnapp dir dein Handy, Stifte und ein paar Freundinnen oder Freunde und macht euch gemeinsam auf den Weg zum Startpunkt. An jeder der neun Stationen scannt ihr einfach den Code für die Details zu den Aufgaben. Auf geht's!
⑤ Gauklerbrunnen U-Bahn Stadtgarten Hansastraße 101 44137 Dortmund ⑥ Refillstation
Hansastraße 76 44137 Dortmund
2 Wie heißt die Dortmunder Netz GmbH abgekürzt?
3 Die Dortmunder Netz GmbH betreut ein Leitungsnetz, das 2 100 … lang ist. Erinnerst du dich an die richtige Längeneinheit? Schreibe diese bitte aus.
4 Welche Farbe haben Wasserleitungen?
5 Bevor das Wasser aus deinem Wasserhahn fließen kann, muss es zunächst eine lange Reise antreten. In welchem Fluss beginnt die Reise?
6 Wofür steht der Buchstabe E in DEW21?

44135 Dortmund
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
Wasserschild
Friedensplatz 3 44135 Dortmund
Servicecenter
⑦ Rosenbrunnen vor

② Südbad
DEW21 Servicecenter
Südbad
Kleppingstraße 28
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
Südbad
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
② Südbad
44135 Dortmund
② Südbad
Hydrant
Friedensplatz 3 44135 Dortmund
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
Schreibe den Text des DEW21-Plakates am Haupteingang des Südbads auf.
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
③ Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
Zeichne ein Hydrantenschild für eine Wasserleitung mit einem Durchmesser von 10 cm, bei dem der Hydrant 1,5 Meter rechts und 2,0 Meter vor dem Schild steht.
③ Hydrant
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
Friedensplatz 3 44135 Dortmund
⑦ Rosenbrunnen vor



Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund
④ Wasserschild
Friedensplatz 3
⑤ Gauklerbrunnen
⑤ Gauklerbrunnen
④ Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund
Evang. Stadtkirche
44135 Dortmund
U-Bahn
② Südbad
HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund

U-Bahn HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund
Evang. St.PetriStadtkirche Westenhellweg 44137 Dortmund
⑦ Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche
⑤ Gauklerbrunnen
Ruhrallee 30 44139 Dortmund
U-Bahn Stadtgarten
Hansastraße 101 44137 Dortmund
⑥ Refillstation
⑤ Gauklerbrunnen
U-Bahn Stadtgarten
Wie lang ist das Wasserleitungsnetz in Dortmund und welche Farbe haben Wasserrohre?
St.Petri Westenhellweg
⑧ Wasserspielplatz
St.Petri Westenhellweg 44137 Dortmund
⑧ Wasserspielplatz
km Farbe
44137 Dortmund
⑧ Wasserspielplatz
⑤ Gauklerbrunnen
U-Bahn
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund
Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund 5 FRAGE
③ Hydrant

Friedensplatz 3 44135 Dortmund
⑥ Refillstation
Hansastraße 76 44137 Dortmund
Hansastraße 76 44137 Dortmund
Hansastraße 101 44137 Dortmund
③ Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund
⑥ Refillstation
⑥ Refillstation
Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Hansastraße 76 44137 Dortmund
Refillstation
Hansastraße 76 44137 Dortmund
Hansastraße 76 44137 Dortmund
Male das Refill-Schild.
⑧ Wasserspielplatz
Gauklerbrunnen
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund
U-Bahn Stadtgarten
Hansastraße 101 44137 Dortmund
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund
HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter
Welches Firmenjubiläum feierte DSW21 im Jahr 1982?

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter
⑥ Refillstation
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
⑨ Hansekogge /
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
DEW21 Servicecenter
Hansastraße 76 44137 Dortmund
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
Hansastraße 101 44137 Dortmund

⑥ Refillstation
Hansastraße 76 44137 Dortmund 44137 Dortmund

Westenhellweg, 44137 Dortmund
⑦ Rosenbrunnen vor Evang. St.PetriStadtkirche
Wie viele Brunnen gibt es in Dortmund?
⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

Hansekogge/ DEW21
Servicecenter
Kleppingstraße 28, 44135 Dortmund
Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche
St.Petri
Westenhellweg
44137 Dortmund
Wasserspielplatz

Westenhellweg 44137 Dortmund
Und wie viele Liter sollte jeder Mensch am Tag trinken?
⑧ Wasserspielplatz
Schwarze-Brüder-Straße/Mönchenwordt 44137 Dortmund 8 FRAGE
Wasserspielplatz
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund
Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt
44137 Dortmund
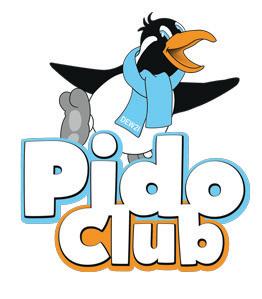
Hansekogge /

Schreibe die Wassergeräusche auf, die du erkannt hast.

Kleppingstraße 28
44135 Dortmund
⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter
WIE SCANNST DU EINEN QR-CODE?
In welchem Alter kannst du Mitglied im Pido-Club werden? Jahre
Kleppingstraße 28 44135 Dortmund
DEW21 Servicecenter
Kleppingstraße 28
44135 Dortmund

① DEW21 Servicecenter ② Südbad
Ruhrallee 30
44139 Dortmund

④ Wasserschild
Friedensplatz 3
Bei den meisten Smartphones reicht heute die Kamera-App, um die Codes zu scannen. Halte die Kamera über den Code, als wolltest du ihn fotografieren. Im Display erscheint ein Link, den du direkt antippen und öffnen kannst. Manche

44135 Dortmund ⑤ Gauklerbrunnen

St.Petri
Handys brauchen eine spezielle ScannerApp, die zuerst installiert werden muss.
U-Bahn Stadtgarten
Hansastraße 101

Westenhellweg 44137 Dortmund ⑧ Wasserspielplatz
③ Hydrant
Friedensplatz 3

44137 Dortmund ⑥ Refillstation
Hansastraße 76 ⑦ Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund ⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter




Auf dem ehemaligen Werksgelände kannst du entspannte Ferientage oder tolle Wochenenden verbringen.
Allein oder mit bis zu vier Personen an Bord könnt ihr den Phoenix See auch per Tretboot erkunden.

Kaum zu fassen, dass sich an diesem Ort noch zur Jahrtausendwende ein voll funktionierendes Stahlwerk von unglaublicher Größe befand. Der See und seine Umgebung erstrecken sich über mehr als 100 Hektar. Wow, das ist so viel wie fast 100 Fußballfelder!
Die 3,2 km lange Strecke rund um den Phoenix See wird total gern besucht. Hier ist ganz schön was los und trotzdem findet man immer ein Plätzchen für das, was gerade Spaß macht: vor allem Entspannen und Sport. Neben den typischen Aktivitäten wie Spazierengehen, Joggen, Radfahren oder Skaten hat das Quartier auch einige besondere Highlights zu bieten. Es gibt Spielplätze und jede Menge Liegewiesen, zudem Stege und Plattformen am Wasser. Oder habt ihr schon mal etwas von der Flüsterbrücke gehört? Das ist ein interaktives Kunstwerk, über das ihr wie bei einem
Dosentelefon miteinander flüstern könnt, ohne dass jemand anders es hört. Ihr merkt schon, am Phoenix See ist für alle etwas dabei. Spielt das Wetter mit, könnt ihr hier von morgens bis abends allerlei erleben!
Mit der ganzen Familie könntet ihr schon zur Frühstückszeit eintrudeln. Startet bei einem der ansässigen Bäcker oder der zahlreichen ufernahen Cafés mit einem kleinen Happen in den Abenteuertag. Oder wie wäre es direkt mit einem Picknick auf einer der Uferwiesen? Umrundet doch mit Mama & Papa, Oma & Opa den See und erklimmt den „Neuen Kaiserberg“, auch Phoenix See-Halde genannt. Das ist einer der Top-Aussichtspunkte in Dortmund. Von oben habt ihr einen fantastischen Ausblick über das gesamte Stadtgebiet. Wer entdeckt als Erster den Florian-Fernsehturm am Horizont?
Dann vielleicht etwas DJing und Bewegung. Unter der Brücke in Richtung Osten gibt es den YouPoint für Jugendliche. Das erste Outdoor-DJPult und eine chillige Area nur für Jugendliche wurde hier von der Stadt und dem Jugendamt erbaut – mit den Ideen von über 500 Befragten.

Einmal im Jahr wird es richtig laut: Mit lautem Getrommel startet dann das Drachenbootrennen auf dem See.
Für Freunde:
Habt ihr schon einen Plan für morgen?
Trefft euch doch mit der Clique am See. Spielt an Land eine Partie auf der Boulebahn. Ihr wollt lieber direkt aufs Wasser?
So kommst du hin:
https://www.lappset.de/ referenzen/ stadt-oeffentlichen-raum/ you-pointam-phoenix-see

Mit den zehn Tretbootautos könnt ihr ein Rennen starten –oder ganz entspannt über den See cruisen.
Der "Bootsverleih am Phoenix See“ versorgt euch mit Tret- und Ruderbooten für jede Gruppengröße. Wer wollte schon immer einmal das Segeln ausprobieren? Die zahlreichen Segelschulen am Phoenix See bieten Schnuppersegeln und Kurse auch für Unerfahrene an. Das Adriatic Sailing Team veranstaltet in den Sommerferien sogar eine Kinder-Segelfreizeit. Informiert euch im Internet!
Für Verliebte:
Jetzt wird’s besonders romantisch! Mitten im See schauen kleine Inseln aus dem Wasser. Eine davon ist nur mit Büschen bewachsen, das ist die „Landschaftsinsel“ mit eigener Anlegestelle sowie einer Ruhebank. Sie kann ausschließlich per Boot erreicht werden. So abgeschieden vom belebten Ufer sieht es niemand, wenn ihr heimlich Händchen haltet.

• Die nächstgelegene Haltestelle für die U-Bahn (U 41) und Busse ist Hörde Bahnhof oder Willem-vanVloten-Straße, die Buslinie 445 fährt den Phoenix See direkt an: Haltestelle Am Kai.
• Zu Fuß oder mit dem Rad kann man auf Höhe des Autohauses Peugeot von der Hermannstraße in die Hörder-Bach-Allee einbiegen, um zum Phoenix See zu gelangen.
Special-Tipp für Schulklassen:
Kurz nach den Sommerferien findet auf dem Phoenix See das berühmte Drachenbootrennen statt, ein Spaßrennen für jedermann. Da haben auch Anfängerteams Spaß! Die Termine stehen schon fest und anmelden könnt ihr euch ab sofort unter: www.drachenboot-dortmund. de. Besprecht das doch mal mit euren Lehrern! Termine: Samstag, 24. August 2024 & Sonntag, 25. August 2024
Bootsverleih:
www.bootsverleih-am-phoenixsee.de
Segelschule am Phoenix See: Adriatic Sailing Team
https://adriatic-sailingteam.de/ segelschule-am-phoenixsee/Adriatic
Sobald die Temperaturen wieder über 25 Grad klettern, sehnt sich so mancher nach einer kühlen Erfrischung. Denn es gibt nichts Schöneres, als an einem wunderschönen Sommertag einfach mal abzutauchen. Diese drei Ausflugziele im Umland sind echte Empfehlungen.



Etwa 60 Kilometer östlich von Dortmund liegt der Möhnesee. In der kalten Jahreszeit überwintern hier in aller Ruhe seltene Wasservögel, zum Beispiel
Gänsesäger, Schell- oder Tafelenten. Doch im Sommer ist am Möhnesee mit vielen Wassersport-Möglichkeiten wie Segeln, Surfen oder Stehpaddeln, richtig viel los. Ganze 1 700 Tonnen feiner weißer Sand bilden an der Event-Location „Uferlos“ einen Traumstrand. Hier könnt ihr schwimmen, die schöne Aussicht bestaunen oder entspannt auf einer Decke liegen. Der Eintritt kostet für Kinder bis 12 Jahre 3 Euro, für Erwachsene 5 Euro. Etwas Obst und eine Flasche Mineralwasser dürft ihr mitbringen. Ganze Getränkekisten, Grill-Equipment oder Campingausrüstung sind aber nicht erlaubt. Ansonsten kann man sich mit Eis, Getränken und kleinen Snacks bestens am „Uferlos“ versorgen.
Uferlos Möhnesee Bahnhofstraße 28 59519 Möhnesee www.uferlos-moehnesee.club

Die Glörtalsperre im Ennepe-RuhrKreis ist überregional bekannt als Freizeit- und Erholungsort. Dieses wunderschön gelegene Stück Natur liegt 45 Kilometer südlich von Dortmund. Am Ufer der Talsperre befindet die Jugendherberge Glörsee – für einen kleinen Preis kann man hier übernachten. Die überwachte Badestelle hat viele Vorzüge und bietet ein vielfältiges Erholungsangebot. Neben einer Abkühlung finden Kids und Eltern hier das Restaurant „Haus Glör“ und eine OpenAir-Bar, dazu eine großzügige Freizeitanlage mit Liegewiese. Doch es gibt auch ein paar Regeln zu beachten: Bei der Benutzung von aufblasbaren Schwimmhilfen (wie Schwimmringen, Luftmatratzen, Schlauchbooten oder Stand-Up-Paddle-Boards) müssen die Badegäste damit rechnen, dass die zuständigen DLRG-Rettungsschwimmer dies untersagen.
Gerade bei starkem Badebetrieb wird es im Wasser sonst schnell unübersichtlich.
Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr.
Haus Glörtal
Glörtalsperre 1 58339 Breckerfeld www.haus-gloertal.de

Auch am Biggesee, der 80 Kilome- ter südlich von Dortmund liegt, schwimmt ihr in freier Natur. Die gut ausgestatteten Strände und Badestellen bieten die perfekte Umgebung für einen entspannten Tag am Wasser – wer hier einmal zu Gast war, möchte direkt wieder- kommen. Der Biggesee befindet sich mitten im Sauerland und liegt direkt am Naturpark Ebbegebirge. Hier kann man sich sonnen, baden oder direkt am Wasser eine Runde Federball spielen. Wer nicht gern nass wird, kann eine Seerundfahrt mit der „Weißen Flotte“ buchen und so den See erkunden. Auch für Taucher, Surfer, Angler oder Spaziergänger gibt es Angebote rund um den See. Beim Schwimmen im Biggesee ist aber Vorsicht geboten: Besonders Nichtschwim- mer sollten selbst mit einer Schwimmhilfe immer in Ufernähe bleiben, denn der See ist über 50 Meter tief.

Kraulen, Tauchen, Schleppen –bei der DLRG Dortmund lernen die Kids, wie sie zum Rettungsschwimmer werden können.

Wer gern an Dortmunder Seen oder auch der Nord- und Ostsee baden geht, hat diese vier Buchstaben bestimmt schon gesehen: DLRG. Sie stehen für „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft“. Dahinter verbirgt sich die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.

In der großen Schwimmhalle ist es feuchtwarm, es plitscht und platscht, fröhliches Geschnatter erfüllt den ganzen Raum. Rund 25 Kinder tummeln sich im und am Becken. Sie schwimmen, unterhalten sich und haben ganz offensichtlich großen Spaß. Willkommen beim Schwimmtraining der zukünftigen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer! Fast geräuschlos taucht ein Mädchen mit dunklen Haaren aus dem Becken auf, streicht sich das Wasser kurz aus dem Gesicht. Es ist Laura. Sie ist 19 Jahre alt und hat schon mit fünf Jahren angefan-
Laura schwimmt schon seit sie fünf Jahre alt ist und ist heute regelmäßig als Rettungsschwimmerin im Einsatz.
gen, Schwimmunterricht bei der DLRG zu nehmen. Seitdem trainiert sie jede Woche und man sieht sofort, dass sie eine richtig gute Schwimmerin ist. „Ich habe mittlerweile das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen und arbeite gerade an Rettungs-Gold“, erzählt sie.
Laura ist schon seit ihrer Kindheit Teil der DLRG Dortmund Scharnhorst. Ihre Eltern, Christian und Astrid van Rissenbeck trainieren hier nämlich die Kinder und Jugendlichen einmal pro Woche. Das Trainerpaar ist schon sehr viele Jahre aktiv bei der Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft. „Wir haben uns hier sogar kennengelernt“, sagen sie lachend. Kein Wunder also, dass sie auch ihre beiden Töchter begeistern konnten.
Ferien als Retterin
Laura ist mittlerweile seit drei Jahren ausgebildete Rettungsschwimmerin. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel auf DLRG-Booten mitfährt oder im Sommer an den Stränden der Nord- oder Ostsee auf einem der vielen Aussichtstürme sitzt.
„In den Sommerferien können wir uns über eine Website für verschiedene Wachen anmelden“, erklärt Laura. „Letzten Sommer



war ich am Südstrand auf Fehmarn. Dort kommen Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland zusammen. Morgens um 8 Uhr besetzen wir an den Strandabschnitten die Türme und sind bis 18 oder 19 Uhr abends vor Ort.“
Gerät ein Mensch in Not, eilen Laura und das Rettungsteam zu Hilfe.
Ihren bisher gefährlichsten Einsatz hatte sie aber nicht bei einer Wache, sondern im Familienurlaub in Südfrankreich. Gemeinsam mit der ganzen Familie war Laura am Strand, als die kräftigen Wellen plötzlich ein kleines Kind umrissen.
„Meine Schwester und ich haben uns nur angeschaut und sind hingerannt. Andere Menschen versuchten zwar auch, das Kind zu retten, sie konnten es aber nicht
richtig greifen. Uns beiden ist es dann gelungen. In dem Moment habe ich gewusst, wofür ich die ganzen Jahre geübt hatte.“
Plötzlicher Ernstfall
Die Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen sind auf genau solche Situationen vorbereitet. Beim Training lernen sie spezielle Griffe, um Menschen auch bei starken Wellen aus dem Wasser zu ziehen. Sie lernen, wie man sich hinstellen muss, um nicht selbst umgerissen zu werden. Und auch, wie man jemanden greift, der zu ertrinken droht. Das ist nämlich nicht ungefährlich: Menschen, die panische Angst haben, klammern sich an alles, was sie zum Festhalten
Christian und Astrid van Rissenbeck haben sich vor vielen Jahren bei der DLRG in Dortmund Scharnhorst kennengelernt und trainieren heute die Kinder und Jugendlichen.
An den Stränden der Nord- und Ostsee ist die DLRG den gesamten Sommer über im Einsatz und sorgt für die Sicherheit der Badegäste. Jugendliche aus ganz Deutschland mit RettungsschwimmerAusbildung reisen für diese Einsätze extra an.
finden – und ziehen im schlimmsten Fall ihre Retter mit unter Wasser. Im Training lernen die Jugendlichen, wie sie so etwas verhindern und die Person trotzdem sicher ans Ufer bringen können.
Zusammen mit Laura trainiert Zoe, 14: „Ich war schon immer eine Wasserratte“, sagt sie. „Schwimmen ist mein Hobby und ich liebe es.“ Sie trägt das bronzene Rettungsschwimmer-Abzeichen, doch echte Einsätze wie Laura darf sie erst mit 16 Jahren machen. Seit sie als Zwölfjährige Teil der Jugendrettungsschwimmer wurde, hilft sie allerdings den jüngeren Kindern dabei, das Schwimmen zu lernen. Die DLRG bildet nämlich nicht nur für die Wasserrettung aus, sondern
bringt Kindern das Schwimmen schon ab dem Kleinkindalter bei.
Kinder, die alle Schwimmabzeichen erhalten haben, können den Juniorretter machen und dann weiter bis zum goldenen Rettungsschwimmer-Abzeichen trainieren. Zoe ist gerade auf dem besten Wege dahin.
Mehr als Schwimmunterricht
In diesem Jahr wird die DLRG Dortmund 100 Jahre alt und muss sich zum Glück um Nachwuchs nicht sorgen. Trainerin Astrid van Rissenbeck bereitet es ganz besondere Freunde, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu sicheren Schwimmern zu begleiten: „Der Verein ist wie eine große Familie. Die Kinder
bei uns aufwachsen zu sehen, vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmer, ist einfach toll.“
Auch Silas, 12, gehört dazu. Bei ihm ging es allerdings besonders schnell. Sein Seepferdchen hat er nämlich mit acht Jahren gemacht und sich dann im Eiltempo bis zum Rettungsschwimmer Bronze durchs Becken gekämpft. Er weiß natürlich auch, wofür er das tut: „Rein theoretisch kann ich damit sehr viele Menschen retten. Schwimmen zu können, ist wirklich wichtig. Jedes Jahr ertrinken Menschen, die noch leben könnten, wenn sie schwimmen gelernt hätten“, sagt er. Es gibt jedoch noch einen weiteren, sehr wichtigen Grund, warum er
Zoe hat mit ihren 14 Jahren bereits das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Bronze. Sie hilft dabei, jüngeren Kindern das Schwimmen beizubringen.



Das Schwimmtraining ist abwechslungsreich und vielfältig. Dazu gehören auch Spiele mit Bällen.

Silas zeigt stolz seinen Deutschen Rettungsschwimmerpass.
jede Woche wieder in die Schwimmhalle kommt: „Die Gemeinschaft und das Miteinander beim DLRG sind einfach toll.“
Möchtest du Schwimmen lernen? Oder auch Rettungsschwimmer werden? Das geht bei der DLRG. In Dortmund gibt es elf Ortsgruppen. Aktuell liegt die Wartezeit für einen Platz im Schwimmkurs bei 1,5 bis 2 Jahren nach Anmeldung. Das liegt vor allem daran, dass die DLRG mit dem ehrenamtlichen Team nur eine begrenzte Zahl von Kursen anbieten kann. Die Gruppen sind kleiner, dafür wird auf jedes Kind sehr individuell geschaut.. Astrid van Rissenbeck sagt: „Bei uns sollen die Kinder zu sicheren Schwimmern werden.“

Ortsgruppe Scharnhorst
DLRG-Kurse für Kinder
• Eltern/Kind-Schwimmen
• Anfängerkurs
• Bronze-Schwimmkurs
• Silber-Schwimmkurs
• Gold- Schwimmkurs
Jeder Kurs umfasst zehn Übungsstunden.
https://scharnhorst.dlrg.de
https://bez-dortmund.dlrg.de
N
Silas ist gerade dabei, sein bronzenes Rettungsschwimmerabzeichen zu machen, und liebt die Gemein- schaft bei der DLRG.


Durch Dortmund fließt ein kleiner Fluss, der eine ganz besondere Geschichte hat: die Emscher. Heute ist sie ein Fluss mit sauberem Wasser und Lebensraum für viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Das war aber nicht immer so

Zurück zur Natur! Die Emscher ist wieder auf Schlängelkurs.



Schnurgerade verlief die Emscher früher (roter Pfeil), bevor sie sich wieder einen natürlicheren Weg Richtung Rhein bahnen durfte (grüner Pfeil).
Der alte Verlauf der Emscher lässt sich rechts entlang der Baumreihe noch erkennen.
Bis es so weit war, musste die Emscher renaturiert werden. Der Begriff „Renaturierung“ bedeutet, dass etwas in seinen natürlichen Zustand zurückgebracht wird. Aber was war mit diesem Fluss passiert und warum musste gehandelt werden?
Die Emscher entspringt einige Kilometer östlich von Dortmund in Holzwickede und fließt nach rund 85 Kilometern in den Rhein. Über Jahrzehnte hinweg wurden die Abwässer von Millionen Menschen in den Fluss eingeleitet, außerdem Abwässer aus dem Bergbau, der Industrie und den Brauereien. Die Emscher war so dreckig, dass sie lange Zeit als „Köttelbecke“ bezeichnet wurde, das heißt so viel wie „Scheißbach“.
Der Fluss war so verschmutzt, dass keine Pflanzen, Fische oder andere Lebewesen darin existieren konnten. Nur für Bakterien war es ein Paradies. Die Emscher war einfach ein stinkender Abwasserkanal. Das hat vielen Anwohnern, die am Fluss gewohnt haben, buchstäblich total gestunken. Aus Angst davor, dass über das schmutzige Wasser Krankheiten verbreitet werden, sollte das Wasser schnell aus der Region befördert werden. Die
Emschergenossenschaft hat sich des Problems angenommen: Dafür wurde die Emscher an den Seiten beispielsweise durch Mauerungen befestigt, damit sie in einer möglichst geraden Linie fließt.
Jahrzehntelange Reinigung
Zum Glück hat die Emschergenossenschaft später entschieden, die Emscher wieder zu einem gesunden Fluss zu machen. Sie sollte vollständig vom Abwasser befreit und renaturiert werden. Das wird als „ökologischer Umbau“ bezeichnet. Die Befreiung vom Abwasser dauerte ganze 30 Jahre lang – von 1992 bis 2022. Das war jedoch keine einfache Aufgabe, denn wohin mit den ganzen Abwässern?
Erst einmal wurde unter der Emscher eine Kanalisation gebaut. Das Abwasser konnte jetzt durch unterirdische Rohre fließen. Dafür mussten drei riesige Pumpwerke gebaut werden. Drei große Kläranlagen reinigen das Abwasser. Der nächste Schritt des ökologischen Umbaus war die eigentliche Renaturierung der Emscher, an der auch heute noch gearbeitet wird. An vielen Stellen
Auf dem Emscher-Weg kannst du am Fluss mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour geht. Der 101 Kilometer lange Radweg führt von der Emscherquellhof in Holzwickede bis zur Mündung in den Rhein bei Dinslaken.
Startpunkt
Emscher-Weg:
wurden die Mauerungen bereits rausgerissen und der darunter liegende Boden ausgebaggert. Dort wurde der Fluss schon kurze Zeit später wieder zu einem natürlichen Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Schnell sind idyllische Flusslandschaften entstanden.
Die Renaturierung hat sich auch positiv auf die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten ausgewirkt, bereits jetzt sind mehr als 600 Arten in das Emscher-Gebiet zurückgekehrt, darunter Forellen, Eisvögel und Libellen.
Bei der Emscher hat sich ein ganz besonderer Wandel vollzogen: vom Fluss zum Abwasserkanal und zurück zu einem lebendigen Fluss. Das Flussbett, die Pflanzen, die Tiere und das Wasser – alles ist neu. Dieser ganze Prozess dauert immer noch an und ist sehr teuer, aber es hat sich gelohnt. Denn schon heute ist die Emscher wieder ein richtiger schöner Fluss und ein tolles Ausflugsziel.

Statt in den Fluss fließt fließt das Abwasser jetzt unterirdisch durch superdicke Rohre.
Startpunkt:
Emscherquellhof
Quellenstr. 2
So kommst du hin:
Bus 438 Haltestelle
Emscherquelle
RB 59 Haltestelle
Dortmund Sölde Bf
R52 Richtung Unna,
Haltestelle
Opherdicker Str.
Die Emscher kommt gut an! Zahlreiche Tierarten sind schon zurückgekehrt.

Auch in Dortmund spüren wir seine Auswirkungen, doch die Stadt tut etwas dagegen. Wir erzählen euch, wie sich das auf euch auswirkt und natürlich, wie ihr selbst aktiv werden könnt.

An heißen Tagen wird es für die Menschen oft unerträglich in den Innenstädten. Hier gibt es viel Beton und Glas, aber nur wenig Grün.

Klimawandel: Das Wort hast du bestimmt schon zigmal gehört. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Hier ein Erklärungsversuch:
Stell dir vor, dass die Erde von einer riesigen Decke umgeben ist, die uns alle warmhält. Diese Decke besteht aus verschiedenen Gasen, wie zum Beispiel dem Kohlendioxid, kurz CO2. Die nennt man auch Treibhausgase.
Durch vieles, was wir Menschen tun, gelangen mehr solcher Gase in die Luft: Unser Verkehr und die vielen Fabriken gehören dazu. Und sogar die Landwirtschaft sorgt für zusätzliche Treibhausgase, die in den Pupsen von Kühen enthalten sind. Sehr viele Kühe müssen sehr viel pupsen!
Dadurch wird die Decke dicker und es wird wärmer auf der Erde. Klingt kuschelig, ist tatsächlich aber ein Problem: Denn wenn es zu warm wird, schmilzt zum Beispiel immer mehr Eis am Nordpol und Südpol. Dann steigt der Meeresspiegel, weil die Ozeane das Schmelzwasser aufnehmen müssen. Dadurch könnten ganze Landabschnitte im Wasser versinken und Überschwemmungen drohen. Auch der Lebensraum vieler Tiere geht verloren.
Die Erdoberäche re ektiert einen Teil der Sonnenstrahlen in Richtung Weltraum
Die Hülle, die unsere Erde umgibt wie eine Decke, wird Atmosphäre genannt. Dort sammeln sich auch die Gase, die in Fabriken, durch den Verkehr oder in der Landwirtschaft entstehen. Die lassen die Decke dicker werden und sorgen für höhere Temperaturen auf der Erde. Das nennt man Treibhauseffekt. Die dickere Decke sorgt nämlich für mehr Wärme. Das funktioniert genauso wie in einem Treibhaus, also einem Glashaus, in dem Pflanzen wachsen. Deshalb heißen die Gase, die sich in der Atmosphäre sammmeln, auch Treibhausgase.
ab
Wir Menschen produzieren Treibhausgase durch Abgase in der Industrie und im Verkehr, durch Kohlekraftwerke, in der Landwirtschaft oder zum Beispiel beim Abholzen von Regenwäldern.
Ein Teil der Sonnenstrahlen prallt an der AtmosphäreKlimawandel: Auch in Dortmund
In Städten bemerken wir den Klimawandel und seine Folgen ebenfalls. Das konnte man in den letzten Sommern deutlich spüren: An heißeren Tagen speichern die Straßen und Mauern sehr viel Wärme.
Außerdem kann es durch den Klimawandel häufiger heftig regnen. In der Stadt ist das ein Problem. Denn auf den versiegelten Flächen wie Straßen, Parkplätzen oder Bürgersteigen kann das Wasser nicht versickern. Deshalb gibt es bei Starkregen öfter Überschwemmungen.
Der Klimawandel verändert auch die Natur. Manche Pflanzen und Tiere sind dadurch bedroht. Zum Beispiel, weil sie die höheren Temperaturen nicht vertragen oder weil sie nicht mehr genug Nahrung finden.
Zum Glück ist es aber möglich, etwas dagegen zu tun und dabei zu helfen, die wärmende Decke dünn zu halten. Was in Dortmund gegen den Klimawandel unternommen wird, haben wir vom Umweltamt der Stadt erfahren:
Folge des Klimawandels:
Bei Starkregen kommt es zu Überschwemmungen.


Auch der Flughafen Dortmund nutzt Sonnenergie.
Unsere Stadt hat einen Plan! Es gibt einige Maßnahmen, um das Klima schützen. Bei einer davon geht es um Gebäude. Die müssen auch in Zukunft geheizt und mit Strom versorgt werden. Dann aber, ohne dabei schädliche Gase zu produzieren, die die Decke dicker machen. Manche Häuser können mit umweltfreundlicher Fernwärme versorgt werden. Für einige Häuser eigenen sich zum Beispiel ganz besonders Solarzellen. Dabei wird Strom aus Sonnenlicht gewonnen.
Auch beim Bauen von neuen Häuser gibt es Möglichkeiten, das Klima besser zu schützen. Unsere Stadt unterstützt die Menschen dabei, ihre Häuser umweltfreundlicher zu machen. Sie bekommen dann Förderungen, also Geld für ihre Projekte.

Ausflug ohne Auto: Wie wäre es mit einer Radtour am Phoenix See in Hörde?
Umweltfreundlich unterwegs
Der Masterplan „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ hat einen klimaschonden Verkehr in unser Stadt zum Ziel: In Dortmund sollen bald mehr Menschen Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder Busse und Bahnen nehmen. Dafür werden die Straßen nach und nach umgestaltet und neue Fahrradwege gebaut.
Wie bist du unterwegs?
Kreuze an, wie du die unterschiedlichen Ziele erreichst:
Schule
Freunde
Freibad
Sport
Eisdiele
Lieblingsladen
Supermarkt
Welches klimafreundliche Verkehrsmittel sollte dringend mal erfunden werden?
Leckeres Essen wächst ganz in der Nähe.

Futtern für das Klima Sogar beim Essen können wir etwas für das Klima tun. In Schulen und Kitas soll es bald mehr gesundes und klimafreundliches Essen geben – mit Lebensmitteln von Biohöfen und vor allem aus unserer Region. Die werden nämlich nicht mit Flugzeugen oder riesigen Frachtschiffen aus anderen Ländern zu uns gebracht.
Auch beim Einkaufen können wir alle die Umwelt schützen. Wenn wir nämlich zu jeder Jahreszeit das Obst und Gemüse besorgen, das gerade Saison hat und in der Nähe wächst. Schaut mit euren Eltern beim Einkaufen doch mal nach, woher eure Lebensmittel kommen.
Und jetzt alle
Die Stadt Dortmund hat also viele Ideen, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Bei manchen dauert die Umsetzung allerdings etwas länger. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir alle dem Klima helfen können – unterwegs, beim Einkauf und Essen oder durchs Energiesparen.
Unterschiedliche Vereine und Organisationen unserer Stadt informieren und helfen euch dabei. Eine gute Übersicht findet ihr beim Klimabündnis Dortmund (www.klimabuendnis-dortmund.de).
Lasst uns gemeinsam unsere Erde schützen!
Dächer können viel mehr sein als ein Deckel fürs Haus. Mit spezieller Erde und Pflanzen verwandeln sie sich in echte Klimaanlagen.
Klar, in unseren Städten sieht man heutzutage fast mehr grauen Beton und Asphalt als Grünflächen, Parks oder Gärten. Auch in Dortmund. Und damit haben wir Menschen so einiges durcheinandergewirbelt: Regenwasser kann nicht so gut versickern wie auf dem Land, wo es einfach wieder in den natürlichen Kreislauf gelangt. Wenn es viel regnet, sind in den Städten die Abwasserkanäle überfüllt und die Straßen überflutet. Bei Starkregen sind sogar unsere Häuser betroffen – das Wasser steht dann in den Kellern, weil es nicht so schnell abfließen kann.
Kühl im Winter, heiß im Sommer Beton und Asphalt haben aber noch einen weiteren Nachteil: Sie sind im Winter kühl, erhitzen sich im Sommer schnell und bleiben lange warm. Dort, wo Wald, Wasser oder Grünflächen sind, ist es immer ein paar Grad kühler als in der Stadt. Unsere Städte wiederum werden von Jahr zu Jahr heißer, die Luft wird im Sommer immer stickiger.

Bepflanzte Dächer sehen nicht nur hübsch aus – sie bieten vor allem Vorteile für das Klima: Im Sommer kühlen sie die Umgebung und im Winter wirken sie wärmedämmend.

Im gesamten Stadtgebiet hat
DOGEWO21 um die 13 650 m2
Dach- und Garagenflächen bepflanzt. Ähnlich wie im Garten werden dazu spezielle Erde und Pflanzensamen verteilt.

Schöne Abkühlung
Viele Städte versuchen deshalb seit Jahren etwas zu tun, um das Stadtklima zu verbessern. Mit begrünten Dächern sorgt zum Beispiel DOGEWO21 für grüne Ausgleichsflächen in Dortmund. Auf einer riesigen Fläche von insgesamt 13 650 m2 hat das Unternehmen bisher schon etliche Dach- und Garagenflächen im gesamten Stadtgebiet bepflanzt. Das entspricht ungefähr zwei Fußballfeldern. Das Prinzip ist ganz einfach: Das Regenwasser sammelt sich auf den Grünflächen. Hier kann es besser versickern und zusätzlich wird die Umgebung gekühlt.
Hübsch & superpraktisch
Auf den Dächern wachsen nun also unterschiedliche hübsche Pflanzen. Das entlastet die Natur, sieht schöner aus als Beton und ist noch dazu superpraktisch, denn die Pflanzenschicht isoliert die Dächer: Im Winter bleibt die Wärme besser im Haus, im Sommer kommt die Hitze nicht so gut hinein. In Zukunft werden wir hoffentlich noch mehr von solchen Dachbegrünungsprojekten in unseren Städten sehen.
Grüne Dachflächen in der Stadt sind eine gute Idee: Die Pflanzen filtern
Schadstoffe und Feinstaub aus unserer Luft und sorgen so für ein besseres Klima.


So geht es:
1 Mische in einer Schüssel Blumenerde, Tonerde und die Blumensamen.

Mit selbstgemachten Saatbomben verwandelst du jeden Grünstreifen in eine Blumenwiese. Die bunten Blüten am Straßenrand sehen nicht nur schön aus, sie liefern auch jede Menge Bienenfutter. Leg gleich los!
2 Gib vorsichtig immer ein paar Spritzer Wasser zur Mischung, bis du eine feste Masse zusammenkneten kannst.
5 Nach dem Trocknen kannst du die Kugeln in Butterbrottüten verpackt verschenken. Oder du wirfst sie direkt auf blumenlose öffentliche Flächen.
Du brauchst:
• eine Tüte Blumensamen mit bienenfreundlichen Sorten
• 10 Esslöffel Blumenerde
• 10 Esslöffel Tonerde oder Bentonit
• eine Schüssel
• eine Sprühflasche mit Wasser
• einen Eierkarton
• Butterbrottüten
3 Nimm jeweils 1 – 2 Esslöffel der Samen-Erdmasse und forme sie mit den Händen zu kleinen Kugeln.

4 Lege die geformten Saatbomben in den Eierkarton und lasse sie einige Tage trocknen.

FROSTSCHUTZ Bei extrem kaltem Wetter stehen zusätzliche Wärmequellen bereit.
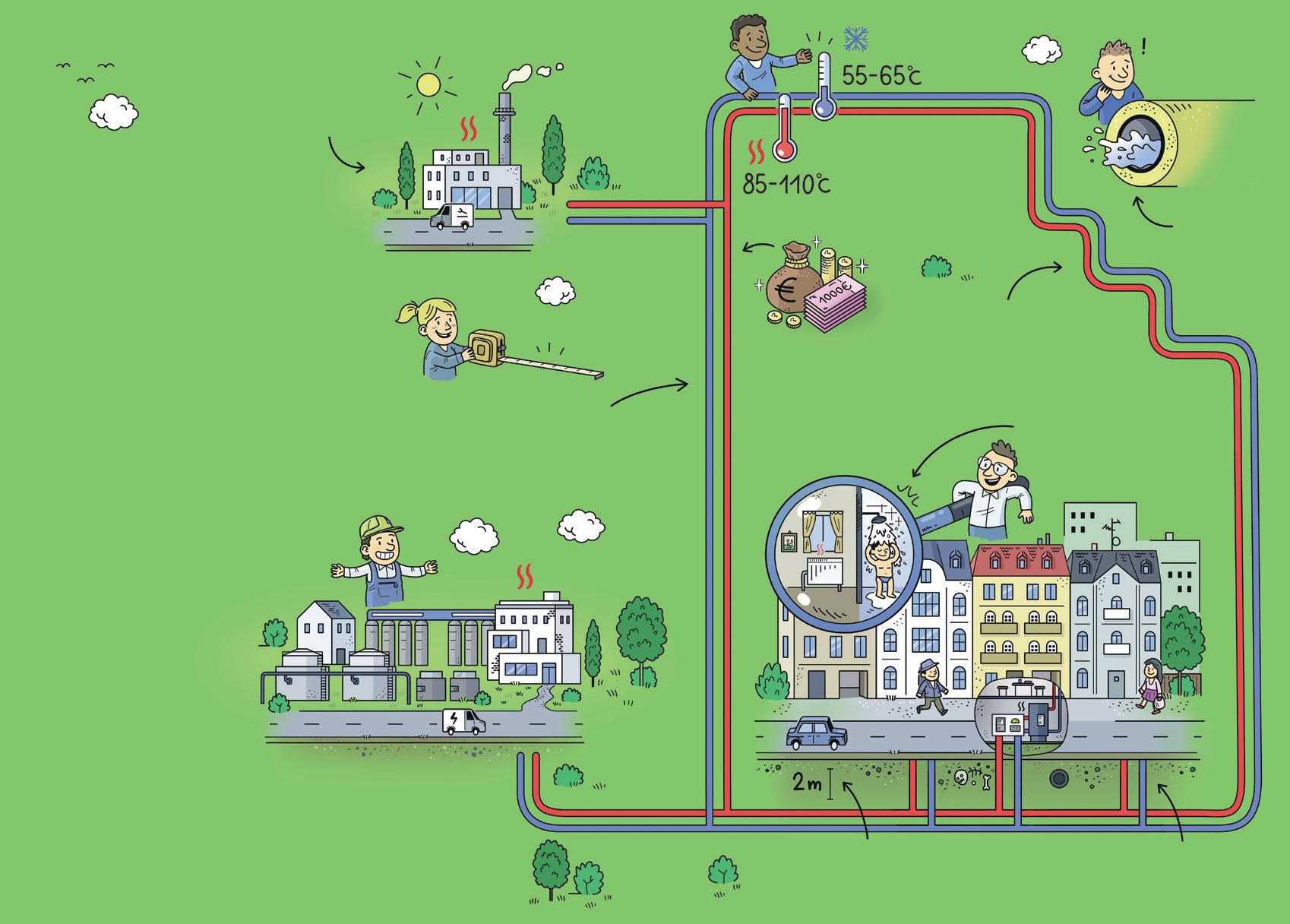
Ziemlich clever: Ein Kreislauf aus heißem Wasser sorgt für klimafreundliche Wärme in vielen Dortmunder Häusern.
Lange Leitungen schlängeln sich unter unserer Stadt hindurch. Sie sind gefüllt mit kochend heißem Wasser und transportieren damit Wärme zum Heizen und für warmes Wasser zu den Gebäuden. Für das Erhitzen der Fernwärmeleitung wird Abwärme aus der Industrie genutzt. Deshalb ist kein Kraftwerk nötig. Das spart tonnenweise klimaschädliche Treibhausgase.
70 KILOMETER lang ist das Dortmunder Fernwärmenetz.
Bei der Herstellung von Ruß entsteht ABWÄRME, die das Wasser in den Leitungen erhitzt.
ACHTUNG, HEISS! Selbst auf dem Rückweg hat das Wasser noch hohe Temperaturen.
TEURER AUSBAU.
Der Bau des Fernwärmenetzes kostet pro Meter bis zu 4500 Euro.
ZICK-ZACK-KURVEN machen das Leitungsnetz stabil.
HEIZUNG & WARMWASSER funktionieren mit Fernwärme.
DICKER
MANTEL:
Eine Isolierschicht hält das Wasser in der Leitung warm.
Fernwärmeleitungen liegen bis zu zwei Meter tief UNTER DER STRASSE.
Abzweigungen bringen die WÄRME in die HÄUSER.

Unglaublich, was dieser Wunderstoff Wasser alles kann – sogar Busse in Bewegung setzen. Genauer gesagt wird der Motor von einem Gas angetrieben, das im Wasser enthalten ist: dem Wasserstoff. Auch in Dortmund könnten in Zukunft Busse damit fahren.
Mit Wasserstoff sind Fahrzeuge klimafreundlich unterwegs und pusten nur Wasserdampf aus ihrem Auspuff. Deshalb wird Energie aus Wasserstoff immer häufiger eingesetzt. Doch das Gas allein kommt in der Natur nicht vor. Es muss extra aus dem Wasser herausgeholt werden. Und das ist ganz schön aufwendig. Wie das geht und was in Dortmund heute schon in Sachen Wasserstoff läuft, haben wir uns mal angeschaut.
Was ist denn so gut an den Wasserstoffbussen?
Sie sind gut fürs Klima, weil sie kein CO2 erzeugen. Außerdem stoßen sie keine Abgase aus wie Busse mit Dieselmotoren. Und mit einer Tankladung können sie 350 bis 400 km weit fahren, also von morgens halb 5 bis 22 Uhr abends ohne Pause Menschen durch die Stadt transportieren. Ein Elektrobus, der ähnlich klimafreundlich ist, schafft nur rund 200 Kilometer. Danach muss seine Batterie erst mal mindestens zwei Stunden aufgeladen werden. Wasserstoffantrieb ist neben dem Stromantrieb die Technologie der Zukunft. Wir probieren beides aus und schauen, was sich am Ende durchsetzt.
Video-Tipp: So funktioniert es!
ZDF logo! zeigt dir, wie Wasserstoff hergestellt wird und den Motor im Fahrzeug antreibt. Klick gleich mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=a7-Rp9BB3u4)
Woher kommt der Wasserstoff?
Aus einem Elektrolyseur in Hamm, der nicht nur Wasserstoff für die Busse, sondern etwa auch an Fabriken liefert.
DSW21 ist an der Anlage beteiligt, so können wir kontrollieren, dass grüner Wasserstoff produziert wird.
Wann sollen denn die ersten Busse fahren?
Frühestens in zwei Jahren, denn vorher muss erst mal eine Tankstelle gebaut werden. Wir testen dann erst mal mit fünf Bussen, wie der Einsatz funktioniert. So ein Bus kostet nämlich rund eine Million Euro, dreimal mehr als ein Dieselbus – das muss ja irgendwie bezahlt werden. Wenn alles gut läuft, stocken wir auf 20 Busse auf.

Wasser besteht aus winzigen Teilchen, den Molekülen.
Ein Wassermolekül setzt sich aus noch kleineren Teilchen zusammen, den Atomen: einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoff- atomen. Die lassen sich in einem besonderen Gerät voneinander trennen: im Elektrolyseur.
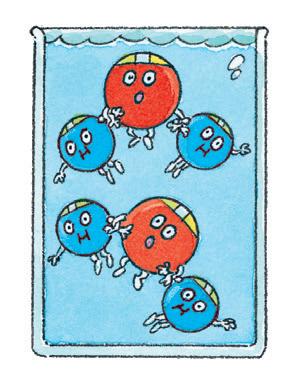
2 3
Klimafreundlich fährt der Wasserstoffbus nur dann, wenn der Wasserstoff im Tank mit Windenergie oder anderen erneuerbaren Energien hergestellt wurde. Solchen Wasserstoff nennt man auch grünen Wasserstoff. Wasserstoff, der mit Energie von Kohlekraftwerken (die riesige Mengen an CO₂ in die Luft pusten) produziert wird, ist nicht klimafreundlich und heißt grauer Wasserstoff. NUR GRÜN IST GUT FÜRS KLIMA

1
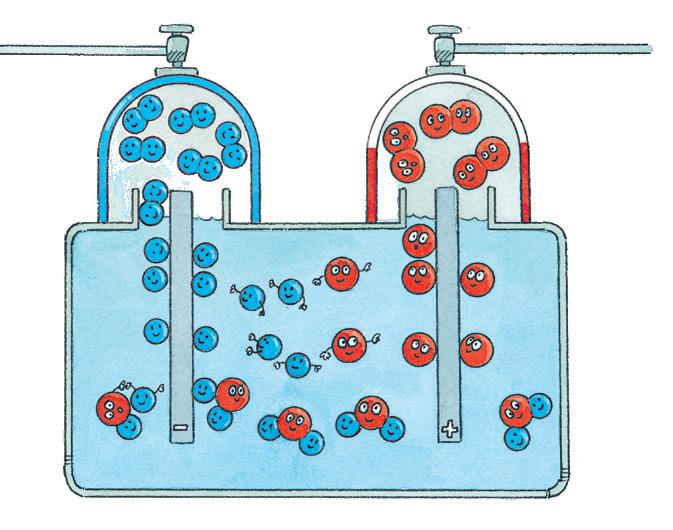
In den Tank 1 des wirdElektrolyseurs Wasser gefüllt. Wenn man Strom hindurchfließen lässt, trennen sich Wasserstoff 2 und Sauerstoff 3 . Weil die Gase leichter sind als Wasser, steigen sie nach oben und man kann sie auffangen: An der einen Seite steigt Wasserstoff hoch, an der anderen Sauerstoff.

IIn einer Höhle auf dem Grund der Ruhr lebt eine kleine Wassernixe. Ihr wunderschöner Name verleiht ihr magische Kräfte, mit denen sie das Trinkwasser der Stadt beschützt und dafür sorgt, dass die Bewohner von Dortmund niemals verdursten müssen.
Das missfällt jedoch der fiesen Hexe aus dem Ardeygebirge. „Warum besitze ich keine magischen Kräfte allein durch meinen Namen?“, meckert sie und wird ganz grün vor Neid. „Warum muss Hexerei für mich so ein mühsames und schweißtreibendes Handwerk sein?“
Wutentbrannt beschließt die fiese Hexe, den Namen der kleinen Wassernixe – und damit ihre Zauberkraft – zu stibitzen und gut zu verstecken. In der Nacht schleicht sie ins Tal und gießt ein paar Tropfen eines geheimnisvollen Zaubertranks in die Ruhr. Dann verschwindet sie kichernd in der Dunkelheit.
Als die kleine Wassernixe am nächsten Morgen erwacht, ist ihr wunderschöner Name fort. Und mit ihm ihre magischen Kräfte. Verzweifelt hockt sie in ihrer Höhle und weint bittere Tränen. So bitter, dass sie damit alles Wasser der Stadt zu vergiften droht.
Die Stadtoberen machen sich große Sorgen und bitten die fiese Hexe ins Rathaus, um ihr ins Gewissen zu reden. „Du kannst nicht wollen, dass unschuldige Menschen krank werden, weil sie vergiftetes Wasser trinken müssen. Die Wassernixe braucht ihre magischen Kräfte zurück. Bitte hilf uns, ihren Namen wiederzufinden!“
Die fiese Hexe bricht in lautes Gelächter aus. So laut, dass es über den Friedensplatz schallt und noch am Ostentor zu hören ist. Dann streicht sie sich mit ihren langen Fingern durch das filzige Haar und sagt mit gönnerhafter Miene: „Also gut, ich will euch helfen. Aber weil ich eine fiese Hexe bin, sollt ihr es nicht zu leicht haben.“
Sie reicht den Stadtoberen eine Karte.
„Innerhalb des Wallrings von Dortmund gibt es zahlreiche Brunnen. Fünf von ihnen habe ich auf dieser Karte mit einem roten Punkt markiert. Findet heraus, um welche Brunnen es sich handelt, und sucht sie auf.“


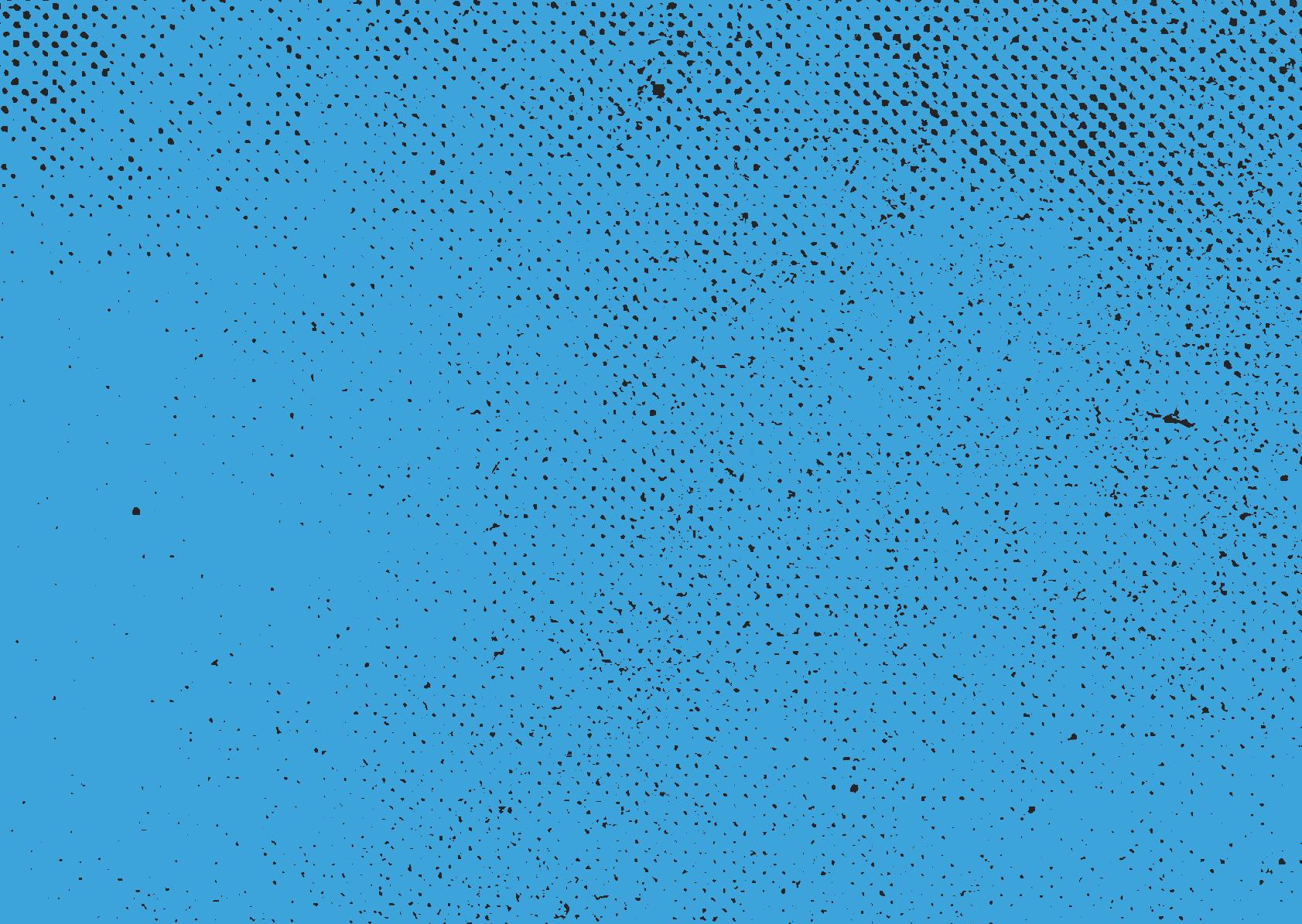
Die Stadtoberen studieren die Karte. „Scheint ein Klacks zu werden“, murmeln sie gemeinsam, „die Brunnen sind nicht allzu weit vom Rathaus entfernt.“
„Ich stelle euch nun sieben Aufgaben“, fährt die fiese Hexe fort. „Wenn ihr sie gelöst habt, habt ihr den Namen der kleinen Wassernixe wiedergefunden.“
Aus ihrem Hexenhut zaubert sie mehrere Skizzen und das Lösungsgitter hervor und breitet alles auf einem großen Tisch aus.
1
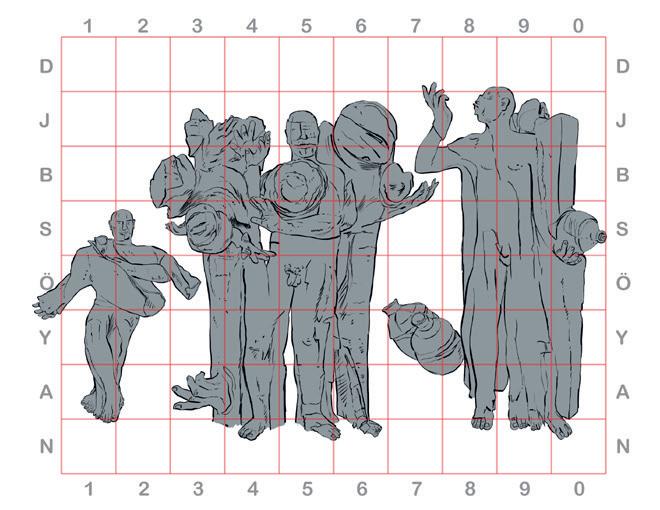
Einer der Brunnen ist mit lebensgroßen Gauklerfiguren verziert. Vergleicht meine Skizze mit den echten Figuren.
Ich habe ein Detail hinzugedichtet.
Schreibt die Koordinaten, in der ihr das hinzugedichtete Detail findet (z. B. J3 oder B7), in die 3. Zeile des Lösungsgitters.
2
In einer Straße, die zwar nicht aus Silber ist, aber so heißt, steht einer von zwei Trinkbrunnen. In Sichtweite dieses Trinkbrunnens findet ihr eine steinerne Gedenktafel. Wie hieß der Kunsthistoriker, der am 17. Januar 1826 im Lehrerhaus geboren wurde?
Schreibt seinen Vornamen in die 1. Zeile des Lösungsgitters.
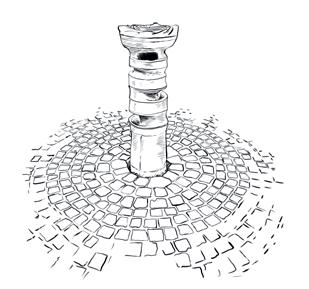
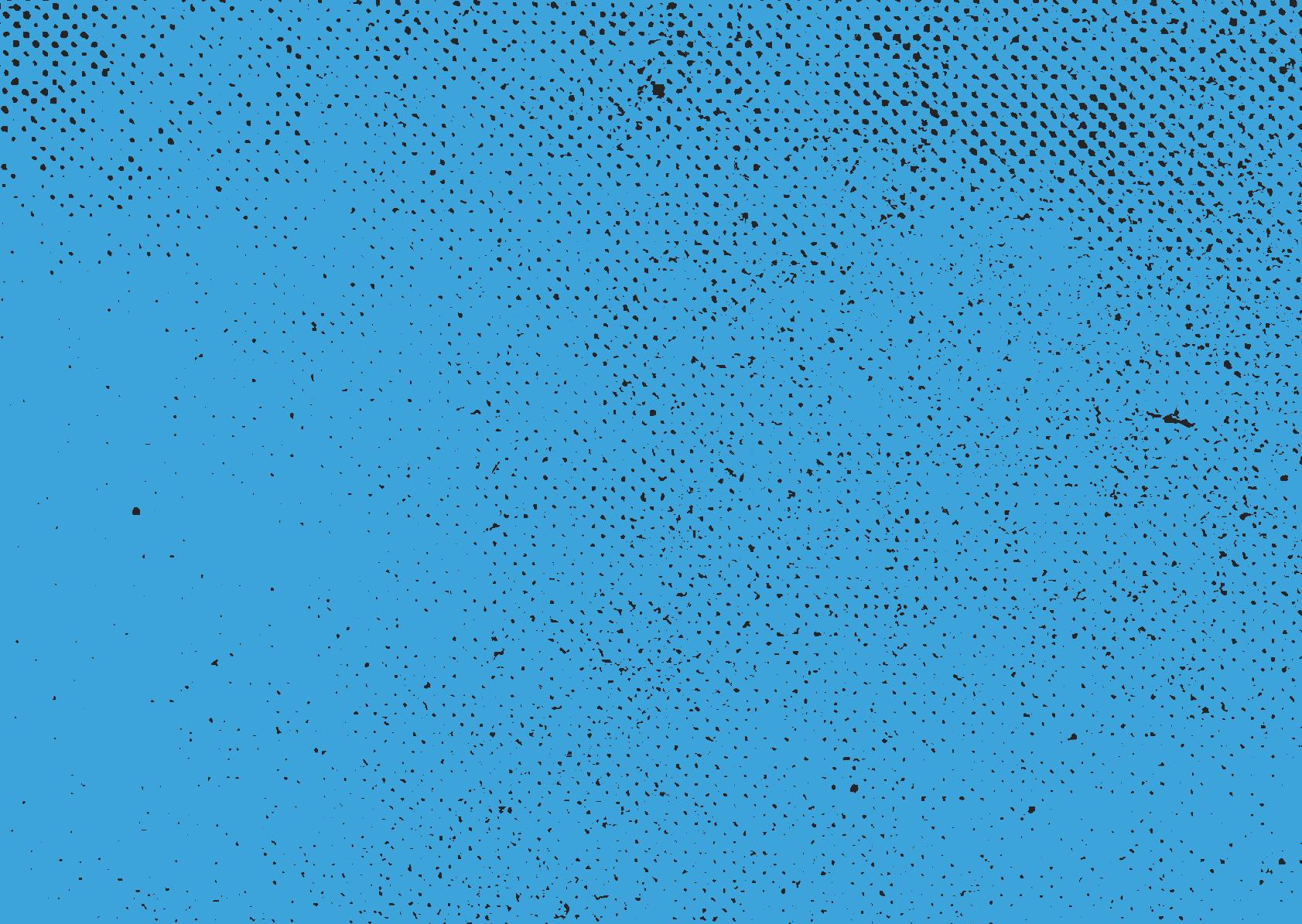
3
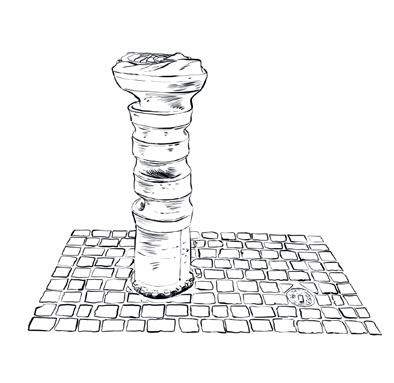
Der zweite Trinkbrunnen steht im Schatten eines großen mittelalterlichen Gebäudes. Ich habe einen Teil dieses Gebäudes skizziert, aber dabei gemogelt. Wie viele Fensterrechtecke fehlen im Vergleich zum Original?
Schreibt die Zahl als Wort in die 2. Zeile des Lösungsgitters.
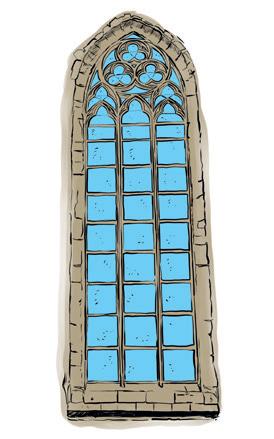
Aufgabe 4
Ein Brunnen ist mit vielen kunstvollen Elementen verziert.
Darunter befinden sich diese sich gegenüber sitzenden Gestalten.
Auf welches der aufgeführten Objekte starren sie?
Findet es heraus und tragt den darunterstehenden Namen in die 5. Zeile des Lösungsgitters ein.
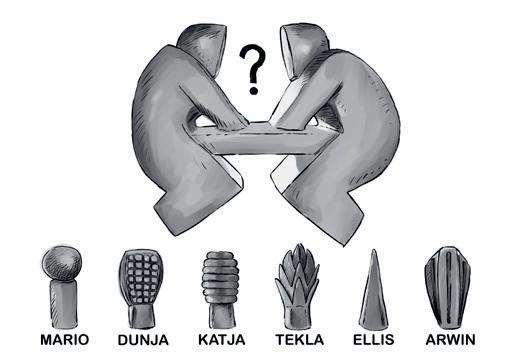
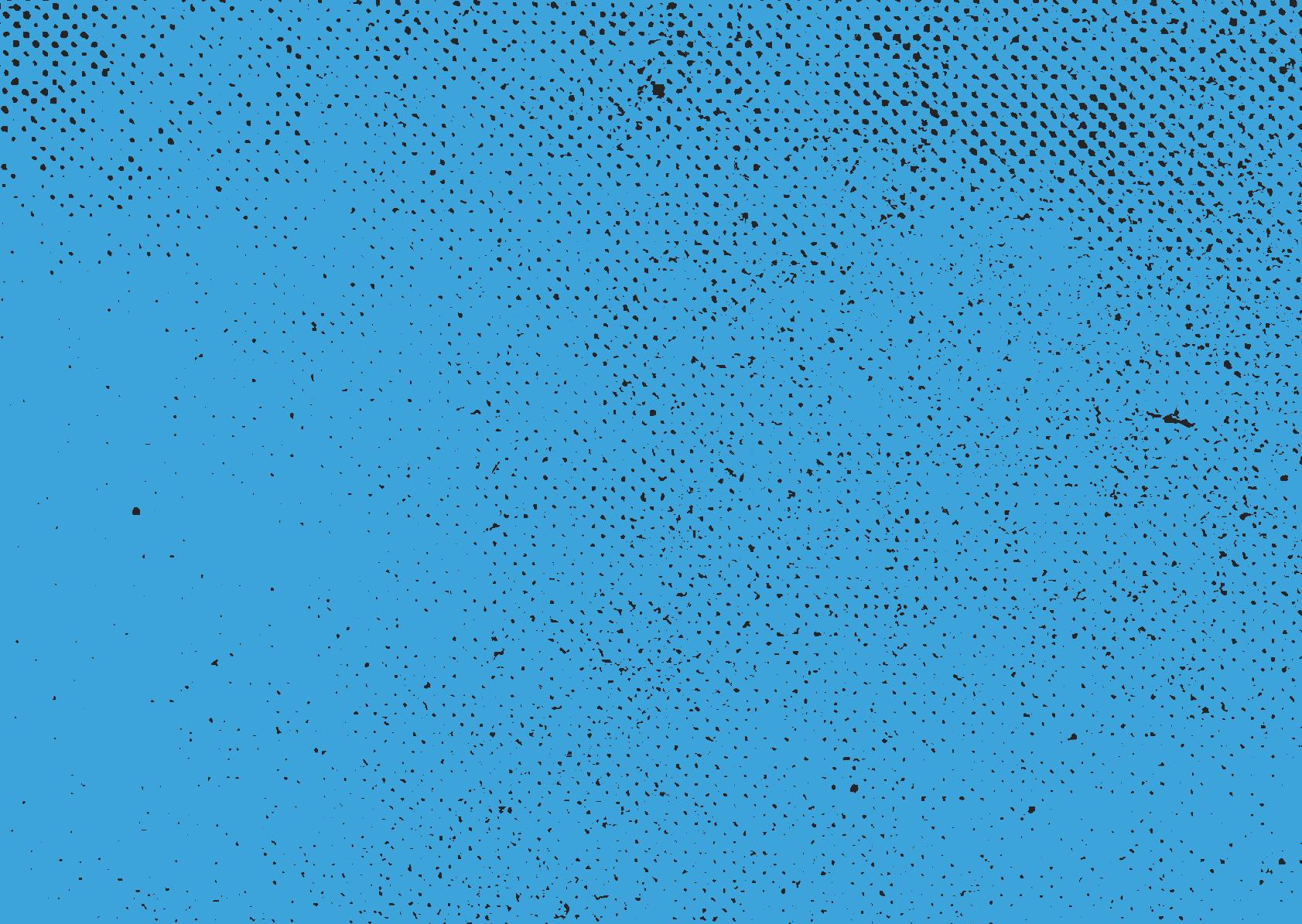
Aufgabe 5
Im näheren Umkreis eines Brunnens befindet sich ein Kunstwerk aus Metall. Ich habe sie skizziert. Die Zeichnung ist maßstabsgetreu, aber unvollständig. Auf was für einem Tier reitet die rechte Figur?
Tragt die Antwort in die 4. Zeile des Lösungsgitters ein.
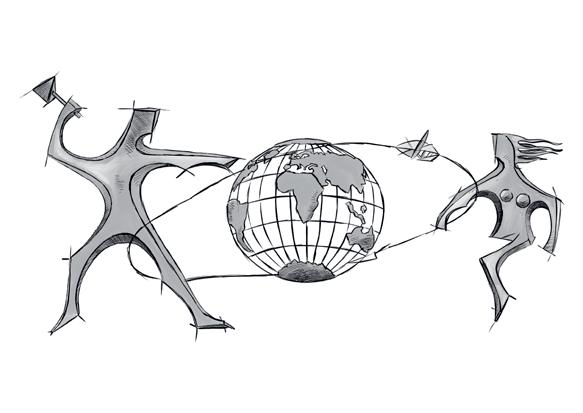
Aufgabe 6

Am Fuße eines der Brunnen befindet sich ein aufwändig verzierter Gullideckel. Ich hab ihn für euch skizziert. Sucht ihn und findet heraus, welches Wort ich auf meiner Skizze ausgespart habe.
Tragt es in die 6. Zeile des Lösungsgitters ein.
Die Stadtoberen holen tief Luft. In ihren Gesichtern steht ein wenig Ratlosigkeit geschrieben. Gut so, denkt die fiese Hexe. Dann setzt sie ihr fiesestes Lächeln auf und legt die letzte Aufgabe vor.
Für die letzte Aufgabe müsst ihr euch außerhalb des Wallrings begeben. Folgt dafür einem der bunten Pfeile, die auf der Karte eingezeichnet sind. Um zu wissen, welcher der Pfeile die richtige Richtung vorgibt, müsst ihr eine bestimmte Jahreszahl finden. Ich habe ein Relief abgezeichnet, das an der Fassade eines bekannten und traditionsreichen Dortmunder Hauses angebracht ist. In diesem Relief steht die gesuchte Jahreszahl. Leider ist mir etwas grüne Zauberbrühe über die Zeichnung gelaufen und die Zahl ist verwischt.
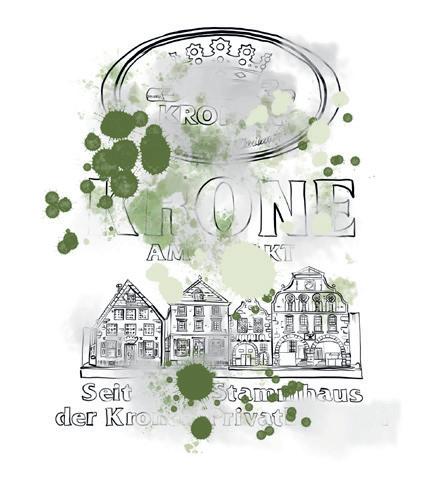
Deshalb findet das Haus mit dem Relief, es steht in unmittelbarer Nähe zu einem der Brunnen. Wenn ihr die Jahreszahl gefunden habt, schaut auf der linken Seite der Karte nach: Die Farbe der gesuchten Jahreszahl entspricht der Farbe des Pfeils, in dessen Richtung ihr laufen sollt. Überquert in Pfeilrichtung den Wall und folgt dem Straßenverlauf. Immer geradeaus, biegt nicht ab. Nach exakt 700 Metern könnt ihr einen Brunnen entdecken, den ich skizziert habe.
Was steht auf dem Schild, das in der Zeichnung blau gefärbt ist? Tragt die 2. Silbe des Wortes in die 7. Zeile des Lösungsgitters ein.

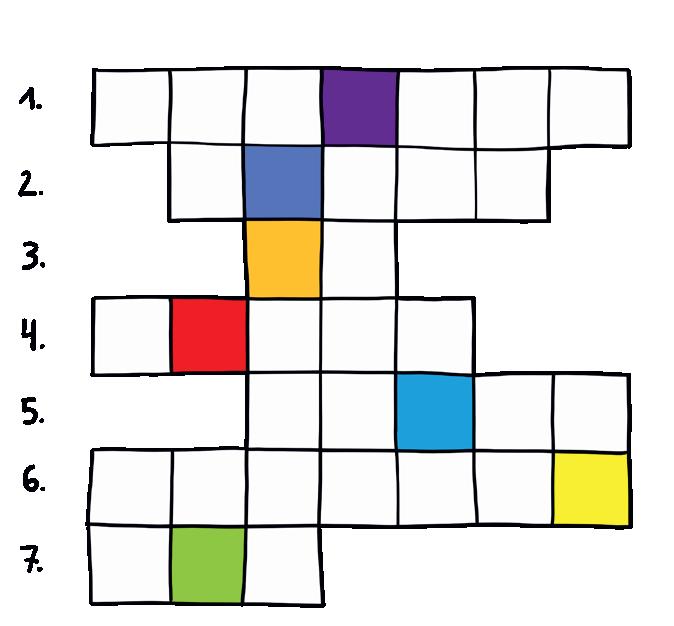
„Nun solltet ihr das Lösungsgitter komplett ausgefüllt haben. Wenn ihr die farbig unterlegten Buchstaben richtig zusammensetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der die Farben von außen nach innen in einem Regenbogen vorkommen, habt ihr den Namen der kleinen Wassernixe wiedergefunden.“
Die Stadtoberen versinken seufzend in ihren Sesseln. Einige von ihnen wischen sich mit einem Taschentuch etwas Schweiß von der Stirn. Nein, ohne Hilfe werden sie die Aufgaben nicht lösen können, da sind sie sich einig.
Könnt ihr den Stadtoberen helfen, den Namen der kleinen Wassernixe wiederzufinden?

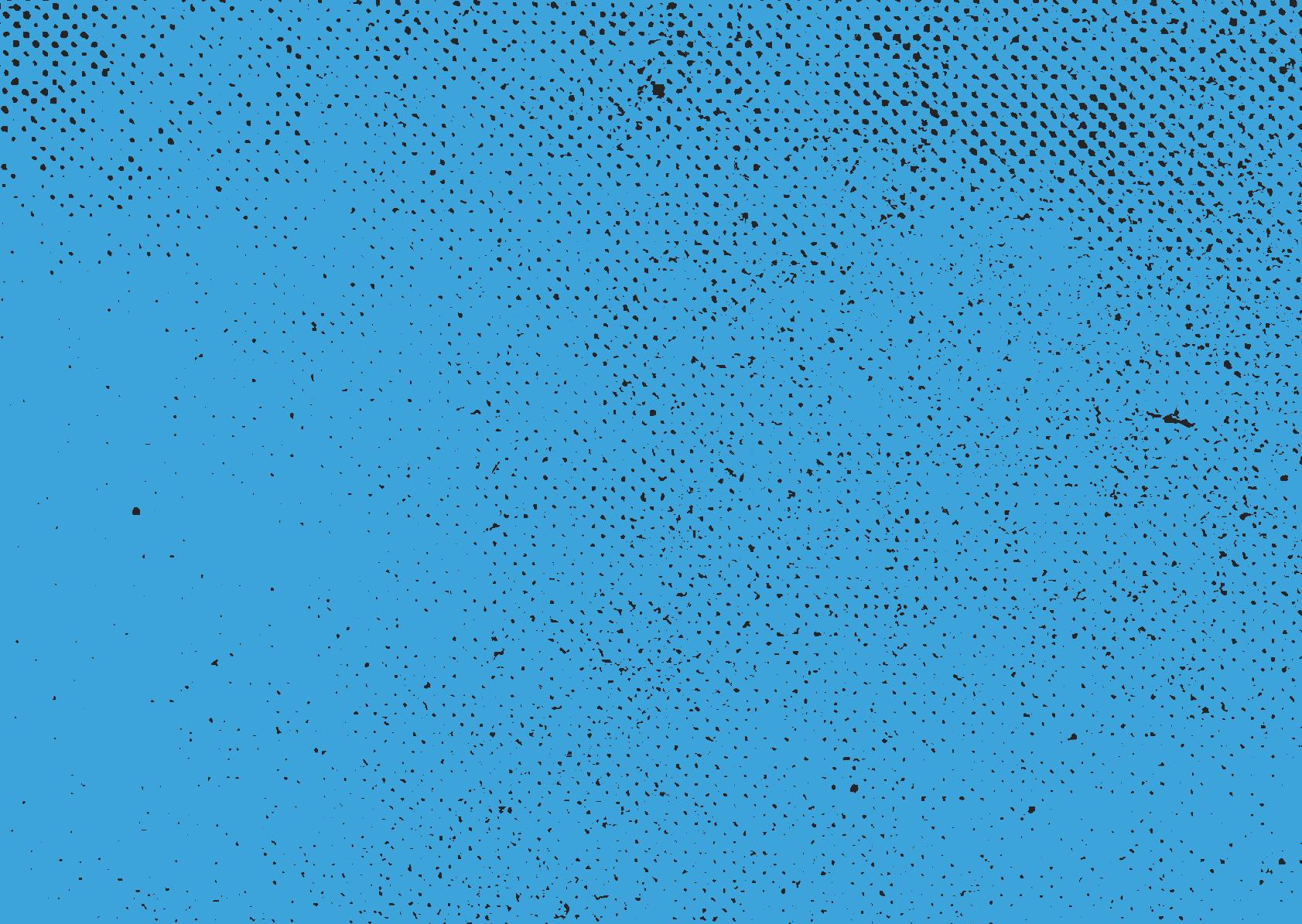
Jeden Tag spülen wir unfassbar viel kostbares Trinkwasser im Klo runter.
Am Dortmunder Flughafen läuft das etwas anders – hier gibt es nachhaltige Toilettenspülungen.
Klar: Regen nervt! Vor allem in den Ferien.
Aber auf dem Glasdach des Dortmunder Flughafens macht Regen einen Superjob: Er betreibt die Klo- und Urinalspülungen des kompletten Gebäudes – mithilfe einer Regenwasseranlage.
Und die funktioniert so: (bitte umblättern!)

FRAGE 1
Wie viel Liter Wasser verbraucht eine Klospülung?
A 9 Liter
B 2 Liter
C ein Trinkglas MINI-QUIZ FRAGE 2
Wie viel Trinkwasser verbraucht eine Person in Deutschland täglich?
A bis zu 50 Liter
B bis zu 250 Liter
C bis zu 128 Liter
Die meisten Toiletten der Stadt werden mit wertvollem Trinkwasser gespült. Am Flughafen gibt es eine bessere Lösung.


Über die große Dachfläche wird reichlich Regenwasser gesammelt.

FRAGE 3
Wie viel Regen fällt in Deutschland im Durchschnitt pro Quadratmeter?
Vom riesigen Glasdach des Flughafens fließt das Regenwasser über vier Leitungen in einen mächtigen Betontank. Der sieht ein bisschen aus wie ein Schwimmbecken. Hier sammelt sich das Wasser und fließt anschließend durch spezielle Filter, in denen es aufbereitet, also von Schlamm und Schmutzpartikeln befreit wird. Das aufbereitete Regenwasser gelangt von hier aus über eine Pumpe direkt in die Toilettenspülung.
A 450 Liter
B 670 Liter
C 1 200 Liter
wie viel es regnet. Wenn lange Zeit kein Regen fällt, sieht man das an den Füllstandsanzeigen und es wird automatisch Trinkwasser nachgefüllt.
Bei Bedarf wird das gesammelte Regenwasser auch für die Sprinkleranlage verwendet, die sich im Parkhaus unter dem Terminal befindet und bei Notfällen zum Einsatz kommt – zum Beispiel, wenn es brennt.
und damit auch teuer: Schmutz, Bakterien und Schadstoffe aus dem Grundwasser werden in speziellen Anlagen herausgefiltert, je nach Qualität wird das Wasser sogar mit Chlor versetzt. Die Anforderungen dafür sind hoch und müssen den Richtlinien unserer strengen Trinkwasserverordnung entsprechen. Schließlich muss dieses Wasser hygienisch sicher sein, wenn es aus der Leitung kommt.
Hygiene für das Klo?
Also ist es doch ziemlicher Blödsinn, wenn wir dieses qualitativ hochwertige Wasser einfach ins Klo kippen, schließlich trinken wir es nicht und berühren es noch nicht einmal. Regenwasser ist nachhaltig und viel günstiger als Frischwasser. Bleibt also zu hoffen, dass in Sinne der Nachhaltigkeit zukünftig noch viel mehr Regenwasseranlagen gebaut werden.
Tief unter dem Flughafen wird das Regenwasser für die aufbereitet.Weiterverwendung

Wenn jeder Haushalt ein bisschen dazu beiträgt, könnten wir eine Menge kostbares Wasser sparen. Wofür könnten wir (gefiltertes) Regenwasser noch verwenden?
✓ Pflanzen in Haus und im Garten gießen (das mögen die meisten Blumen sogar lieber)
Spülen mit Regenwasser
70 bis 90 Prozent der Klo- und Urinalspülungen des Gebäudes werden mit Regenwasser betrieben, je nachdem, wie viele Passagiere den Flughafen besuchen und
Regen- statt Frischwasser Eigentlich funktionieren unsere Toilettenspülungen in Deutschland mit Frischwasser. Aber streng genommen ist das die reine Verschwendung. Denn Frischwasser muss aufbereitet werden. Und das ist in Deutschland recht aufwendig
✓ Zum Putzen
✓ Für die Waschmaschine
QUIZ AUFLÖSUNG
3) B) Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Deutschland ungefähr 670
2)
1)

Zehn Minuten – das ist möglicherweise die Länge des neuesten Videos eures Lieblings-YouTubers. Ganz genauso lange dauert es, bis eine Straßenbahn wieder blitzblank ist.
Aber wie funktioniert das eigentlich?
Mithilfe einer „Tandem-NutzfahrzeugWaschanlage“. Ein schwieriges Wort –müsst ihr euch nicht merken. So eine Waschanlage gibt es auf dem Betriebshof der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) in Dortmund-Dorstfeld. Mithilfe einer fahrbaren Anlage können hier bis zu 38



Meter lange Stadtbahnen gereinigt werden. Und so kompliziert wie der Name der Waschanlage ist das eigentlich gar nicht.
Der Waschvorgang funktioniert nämlich ganz ähnlich, wie ihr es von herkömmlichen Autowaschanlagen kennt. Nur ist die Anlage für Straßenbahnen eben deutlich größer. Mehrere schwarz-gelbe, große und bewegliche Bürsten fahren automatisch an den Bahnen entlang. Sie säubern die Fahrzeuge und entfernen den Schmutz an allen Kanten und Seiten bis die Bahn wieder glänzt. Normalerweise werden die Fahrzeuge alle 15 Tage gesäubert. Das kommt jedoch auch immer auf das Wetter und darauf an, wie schmutzig die Bahnen wirklich sind. Auch am Betriebshof in Dortmund-Brünninghausen gibt es so eine Waschanlage, die jedoch speziell auf Busse ausgerichtet ist. Auf einer 27 Meter langen Laufschiene können hier bis zu 18 Meter

lange Fahrzeuge gewaschen werden. Und das in nur zwei Minuten. Diese Geschwindigkeit ist wichtig, um mit den vielen Bussen fertig zu werden, die eine Wäsche brauchen.
Wie viele Fahrzeuge kommen denn überhaupt pro Tag zum Waschen?
Pro Tag werden etwa 50 Busse und 10 Stadtbahnen gewaschen – und dabei wird ordentlich Wasser verbraucht. Um eine Straßenbahn zu reinigen, benötigt
DSW21 je nach Länge des Fahrzeugs zwischen 600 und 1 100 Liter. Für die Reinigung eines Busses hingegen braucht





man weniger Wasser: zwischen 400 und 600 Litern. Das klingt erst mal viel. Im Vergleich zu einer normalen Badewanne jedoch, die ungefähr 150 Liter Wasser fasst, relativiert sich die Zahl. Man könnte also auch sagen: Um einen Bus zu reinigen, werden ungefähr drei bis vier Badewannen Wasser benötigt.
Und was passiert mit dem schmutzigen Wasser nach dem Waschvorgang? Wasser ist ein kostbares Gut. Deshalb wird es wiederverwendet. Unterirdisch wird das benutzte Wasser in Sammelbecken aufgefangen. Dann reinigt eine Wasseraufbereitungsanlage das gesammelte Waschwasser. Das funktioniert wie mit einem Sieb: Der Schmutz wird aus dem Wasser herausgefiltert, getrocknet und entsorgt. Dadurch kann das Wasser für

weitere Waschvorgänge wiederverwendet werden. Und das nicht nur einmal. Gut für die Umwelt, denn pro Waschtag kann DSW21 allein bei der Reinigung von Bussen ca. 21 500 Liter Frischwasser sparen. Hinzu kommen 4 500 Liter bei den Stadtbahnen. Auf das ganze Jahr gerechnet, spart das Verkehrsunternehmen so an rund 260 „Waschtagen“ etwa 7,2 Millionen Liter Frischwasser. Wie viele Tausend Badewannen das sind, könnt ihr ja mal selbst ausrechnen. Eines ist jedenfalls klar: ziemlich viele.


Ganz schön warm unter so einer Löwenmähne. Ein Nickerchen im Schatten ist der beste Hitzeschutz für den König der Tiere.

Bei Sommerhitze kühlen wir uns im Freibad ab oder schlecken Eiscreme. Doch was machen eigentlich die Tiere, wenn es heiß wird? Viele von ihnen haben richtig coole Tricks gegen zu viel Hitze.
Wir Menschen geraten bei reichlich Wärme schnell ins Schwitzen. Und das ist gut so!
Denn der dünne Schweißfilm, der sich dabei auf der Haut bildet, ist ein guter Hitzeschutz. Die Flüssigkeit verdunstet nämlich und sorgt so für Abkühlung. Unser Körper hat also eine ziemlich ausgeklügelte Klimaanlage.
Nur wenige Tiere kühlen sich ebenfalls mit Schwitzen ab. Affen, Pferde und Kamele zum Beispiel. Wenn jemand aber sagt: „Ich schwitze wie ein Schwein“, dann kann das nicht stimmen. Denn Schweine haben nur an Nase und Rüssel

ein paar Schweißdrüsen, sie können nur ganz wenig schwitzen.
Deshalb nehmen Schweine bei Hitze gern ein Schlammbad und legen sich danach in den Schatten. Der Matsch auf der Haut sorgt beim Trocknen ebenfalls für Abkühlung. Genau wie der trocknende Schweiß bei uns. Außerdem ist die Schlammschicht eine gute Sonnencreme. Die empfindliche Schweinehaut bekommt schnell einen Sonnenbrand.
„Scheiß drauf!“ Das ist buchstäblich das Storchen-Motto, wenn es heiß wird. Weil auch Vögel nicht schwitzen, haben die
Ohren als Klimaanlage:
Die großen Lauscher der Löffelhunde strahlendie Körperwärme ab und sorgen für Kühlung.


Keinen Durst: Trampeltiere kommen lange ohne Wasser aus.
Vögel ein ungewöhnliches Kühlsystem entwickelt. Statt Schlamm als Sonnenschutz und zum Verdunsten zu verwenden, schmieren sie ihre Beine mit dem eigenen Kot ein.
In den heißen Regionen unserer Erde haben sich die Tiere an die Hitze angepasst. Jedes auf seine Art! Löffelhunde sind in der heißen Savanne in Afrika zu Hause. Hochsommer-Temperaturen machen ihnen nichts aus. Ihre Riesenohren sorgen nämlich dafür, dass ihre Körperhitze einfach abstrahlen kann. Sie benutzen ihre Lauscher als nicht nur zum Hören, sondern auch als Klimaanlage.
Auch Löwen sind Savannen-Tiere und warmes Wetter gewohnt. Ins Schwitzen geraten sie nicht. Sie besitzen nur ein paar wenige Schweißdrüsen an den Ohren und Pfoten. Ihr Hitzeschutz ist deshalb ein Nickerchen im Schatten.
Keine Sauerei: ein Matschbad für Abkühlung und Sonnenschutz

Kamele und Trampeltiere kommen auch bei größter Hitze ohne Wasser aus. Und zwar wochenlang. Dafür können sie bis zum 100 Liter Wasser auf einmal trinken. In ihren Höckern speichern sie aber kein Wasser, sondern Fett. Das ist ihr Energievorrat.
Den Trick mit der Matsch-Sonnencreme kennen auch die Elefanten. Sie nutzen eine trockene Schlammschicht auch, um sich vor lästigen Insekten zu schützen. Noch lieber kühlen sich die Dickhäuter aber mit einer kräftigen Dusche ab. Praktisch, wenn man dazu den eigenen Rüssel verwenden kann.
Doch auch unsere heimischen Tiere haben coole Tricks drauf, um mit der Sommerhitze klarzukommen. Libellen etwa richten ihren Körper mit dem schmalen Hinterteil zur Sonne aus. So bekommen sie nur wenige heiße Strahlen ab.

Eichhörnchen wird es im Sommer in ihrem Fellmantel zu warm. Deshalb verlieren sie dann die Haare an ihre Pfoten. Über die kahlen Stellen können sie die Wärme besser abgeben.
Achtung, Hitze!
Auch viele Haustiere mögen kein Sommerwetter. Für einige von ihnen können hohe Temperaturen sogar sehr gefährlich sein. Meerschweinchen oder Kaninchen zum Beispiel brauchen genug Schatten und ausreichend Trinkwasser für die heißen Tage.
Hunde hecheln, wenn es zu warm wird. Weil sie nicht schwitzen können, atmen sie ganz schnell mit heraushängender Zunge. Große Wärme macht Hunden ziemlich zu schaffen. Sie dürfen bei Sommerwetter auf keinen Fall im Auto gelassen werden. Im Inneren des abgestellten Fahrzeugs kommt es schnell zu extremer Hitze. Das kann für die Hunde lebensbedrohlich sein.
Wenn die Temperaturen in der Stadt steigen, wird es auch im Zoo Dortmund warm. Obwohl die vielen Bäume in der Anlage Schatten spenden, ist die Hitze auch dort zu spüren. Den meisten Tieren macht das wenig aus. Viele der Arten, die du im Dortmunder Zoo treffen kannst, stammen aus besonders warmen Erdteilen.
Es gibt dort etwa Erdmännchen aus der afrikanischen Savanne und SumatraOrang-Utans, deren natürliche Heimat Südostasien ist. Sie alle kennen sich mit sommerlichen Temperaturen aus. Wenn es ihnen zu heiß wird, suchen sie sich ein Plätzchen im Schatten oder trinken mehr als sonst. Bei den Orang-Utans im Zoo Dortmund wird dann getrickst: Weil sie nicht gern Wasser trinken, bekommen sie Tee und Wassereis. So sind sie gut mit Flüssigkeit versorgt. Viele der Zoo-Tiere haben einen eigenen Pool im Gehege. Kalifornische Seelöwen oder Humbolt-Pinguine können sich deshalb auch beim Baden abkühlen.

Auch die Tapire im Zoo Dormund freuen sich über fruchtiges Eis.
Mergelteichstraße 80, 44225 Dortmund

Öffnungszeiten:

teichstraße/Zoo, Bus 449: Haltestelle

täglich 9–18:30 Uhr
Wasser und Früchte werden zur eiskalten Erfrischung für die Orang-Utans. Kennen sich mit hohen Temperaturen aus: Erdmännchen sind in der warmen Savanne zu Hause.
Eintritt:
Eintritt: 5,50 Euro (Tageskarte ermäßigt)
So kommst du hin:
U49: Haltestelle Hacheney, Busse 438, 443 und 447: Haltestelle Hacheney, Busse 440, 450: Haltestelle Mergel-
Zoo, Vometalbahn
RB52: Haltestelle
Dortmund Tierpark
Tipp: Plane deinen Zoobesuch bei heißem Wetter am besten für den Vormittag.
Die Tiere sind dann aktiver. In der Mittagshitze verziehen sich viele von ihnen in den Schatten oder machen ein Nickerchen.


Okay, in Dortmund gibt’s keine malerischen Gebirgsbäche. Aber auch die Wasserläufe in den Grünanlagen der Stadt sind abenteuertauglich!

Für ein Abenteuer müssen wir nicht raus aus der Stadt. Neues entdecken, Dinge zum ersten Mal machen, und zwar ohne zu wissen, ob wir’s hinkriegen, der Natur „High Five“ geben –das geht auch mitten in Dortmund! Hier kommen vier Ideen für deine Abenteuer rund ums Wasser.
Stell dir vor, du strandest auf einer einsamen Insel.
Deine einzige Möglichkeit, von dort wegzukommen, ist ein Floß, das du dir selbst bauen musst.

Da wäre es doch nicht schlecht, das vorher schon mal gemacht zu haben. Diesen Sommer hast du die Chance dazu: mit einem Floß im Miniatur-Format! Such dir einige möglichst gerade und gleich dicke Stöcke oder Äste, säge sie auf die gleiche Länge und verbinde sie mit Schnüren. Zwei Lagen Stöcke sind meist stabiler. Du kannst auch einen Mast mit einem Miniatursegel draufsetzen. Die Challenge: Das Floß muss einen faustgroßen Stein tragen. Wie du diesen Stein fixierst, damit er nicht runterrutscht, überlegst du dir selbst. Am meisten Spaß macht es, das Floß auf einem Fluss fahren zu lassen und am Ufer mitzulaufen. Ein Segel ist auch toll. Aber je nachdem, woher der Wind kommt, kann es auch stören. Wenn das Ganze gut funktioniert, bist du bereit für die Flucht von der einsamen Insel.


Die Stöcke auf die gleiche Länge zu sägen, ist ziemlich easy, fürs Verschnüren brauchst du Fingerspitzengefühl – und vielleicht ein bisschen Geduld …

Mehr als drei Millionen Schiffswracks liegen irgendwo versunken auf den Gründen der Weltmeere.
Einige von ihnen haben sicher noch Schmuck und Gold von unschätzbarem Wert an Bord. Aber es ist unglaublich schwer, diese Schiffe zu finden und zu bergen. Du kommst einfacher an versunkene Schätze heran! Okay, wir meinen hier den Müll, der in den Gewässern der Stadt zu finden ist – aber wer weiß, vielleicht entdeckst du beim Rausfischen ja tatsächlich etwas richtig Wertvolles.
Außerdem kann selbst ein weggeworfener Gegenstand eine spannende Geschichte erzählen: Wo kommt er her? Wer hat ihn wohl ins Wasser geworfen? Wie lange liegt er dort schon? Und wie entsorgst DU ihn jetzt am besten? Es ist wirklich so: Wenn man das Müllsammeln als Trophäenjagd versteht und sich richtig reinhängt, kann man die abgefahrensten Funde machen. Für Gewässer hilft ein Kescher oder ein längerer Stock mit einer Art Haken am Ende (entweder ein krummgeschlagener Nagel oder eine Astabelung).
Handschuhe, die für Gartenarbeiten benutzt werden, sind ein guter Schutz. Denn natürlich könntest du auch etwas Scharfes oder Spitzes erwischen.



Tja, wie tief ist es denn nun, das Wasser? Und wie kommst du rüber? Auch das kannst du nach dem Vermessen der Pfütze natürlich ausprobieren.


Für dein Stadtabenteuer kannst du dir auch einen kleinen Rucksack packen –rein können Zollstock, Arbeitshandschuhe, ein Müllbeutel, Snacks und was zu trinken.
Pfützen sind eigentlich was richtig Gutes – kleine Gewässer, die Flohkrebsen oder Insektenlarven als Lebensraum dienen.
Aber in der Stadt stören sie die Menschen meist. Deshalb werden die Wege gepflastert oder asphaltiert, damit alles schön eben ist und das Wasser sich nirgendwo sammeln kann. Aber natürlich passiert das doch hier und da! Die Pfützensafari beginnt direkt beim nächsten Regen oder kurz danach. Die Challenge: Du musst die breiteste und die tiefste Pfütze des Tages finden! Dazu brauchst du einen Zollstock, einen Messstab (da kannst du einfach einen genau einen Meter langen Stock nehmen, in den du zusätzlich Kerben schnitzt) und hohe wasserdichte Schuhe (je tiefer du mit denen im Wasser stehst, desto tiefer die Pfütze, die Breite kannst du grob in Schritten messen). Auf einem Zettel oder in einem Büchlein notierst du die Maße und die Lage der Pfützen. Ihr könnt auch in Teams gegeneinander antreten. Übrigens: In Pfützen spiegelt sich oft sehr schön die Umgebung. Das sieht auch auf Fotos toll aus …




Wähle deine Lieblingsfarben aus. Am besten nimmst du die hellsten Farben zuerst.

Kreise oder Linien? In welche Richtung die Dose schwingt, bestimmst du. So entstehen immer neue Muster.

Es gibt Tage, da will einfach niemand vor die Tür. Wenn es draußen richtig grau und regnerisch aussieht, ist die beste Zeit für eine bunte Abwechslung.
Schnapp dir Schere und Schnur, Zeichenpapier, einen Haufen altes Zeitungspapier und flüssige Farbe. Zum Beispiel Acrylfarbe aus der Tube – die gibt es oft günstig in der Bastelabteilung. Baue dir dann deine Konstruktion für tolle Bilder: Bohre mit der Schere ein Loch in den Boden der Dose und zwei oben an der Seite. Befestige die Schnur am Dosenrand. Lege den Fußboden zuerst großflächig mit dem Altpapier aus und platziere dann dein Zeichenpapier in der Mitte. Der Eimer soll an der Schnur über dem Blatt kreisen können. Du kannst ihn irgendwo anbinden oder selbst die Schnur festhalten. Fülle nun die Farbe in den Eimer, gib etwas Anschwung und schon nimmt alles seinen Lauf. Schau zu wie die Farbe ein Muster auf das Papier zaubert und dein Kunstwerk entsteht. Kombiniere am besten deine Lieblingsfarben.

Filmstreifen zeigen die vielen Einzelbilder, aus denen ein Kinofilm besteht.

Früher einmal gehörte Dortmund mit fast 80 Filmtheatern zu den führenden deutschen Kinostädten. Heute gibt es noch wenige Kinos, die versuchen, ihr Publikum mit einem ausgewählten Filmprogramm zu unterhalten. Mit unseren jungen Kinoexperten Tylan und Mauro haben wir uns das mal näher angeschaut.
Für Familien:
Das Wetter ist schlecht?
Macht nichts, denn es gibt in Dortmund gleich fünf KinoSäle, die immer wieder besondere Filme vorführen. Also:
Wer hat Lust auf Popcorn und große Leinwand-Abenteuer?


Das sweetSixteen-Kino in der Dortmunder Nordstadt zeigt jeden Samstag und Sonntag ab 15:00 Uhr in der Reihe „Schokokuss & Brause“ ausgesuchte Kinderfilme. Dazu gibt es frisch gebackene Waffeln und die Betreiber haben einen großen Fundus an Stofftieren – die kann man knuddeln, wenn es auf der Leinwand


Im Roxy-Kino durften sich Tylan und Mauro die besten Plätze aussuchen.
zu spannend wird. Und hier lässt sich sogar Babysitting mit Kino verbinden: Einmal im Monat gibt es das KinderwagenKino (Kurzform: KiWaKi) – dann können deine Eltern die kleinen Geschwister-Babys (Empfehlung: bis 12 Monaten) mit ins Kino nehmen, um in gemütlicher und familiengerechter Atmosphäre einen aktuellen Film zu genießen. Dafür liegen dann Krabbeldecken auf dem Boden. Und der jeweilige KiWaKi-Film wird vom Publikum ausgewählt und in verminderter Lautstärke gezeigt.
Für Verliebte:
Was gibt es Schöneres, als mit seinem Lieblingsmenschen einen tollen Film in heimeliger Kino-Atmosphäre zu schauen? Die Schauburg auf der Brückstraße ist dafür ein perfekter Ort. Wer im Dortmunder Süden wohnt, sollte unbedingt mal die Postkutsche in Aplerbeck aufsuchen – hier stehen immer wieder Filme für einen romantischen Kino-Abend
auf dem Programm. Das Kino im U zeigt jeden ersten Freitag im Monat ab 20 Uhr bekannte Kinoklassiker. Ob „Bang Boom Bang“ oder „Dirty Dancing“ – hier kann man seiner Liebsten oder seinem Liebsten vorab eine Cola spendieren, um dann auf der großen Leinwand eine fantasievolle Reise für Augen und Ohren zu genießen.
Für Freundinnen und Freunde
Peter Fotheringham ist einer der Macher vom Roxy-Kino und er ist zudem für das sweetSixteen verantwortlich.
Aktuell gibt es für Kinder und Jugendliche immer wieder ausgesuchte Filme im Programm vom Roxy und Sweet Sixteen. Schaut einfach im Internet nach dem Programm und sucht euch aus, was euch zusammen Spaß macht. Übrigens: In den Schulferien öffnen die Kinos an manchen Tag schon um 13 Uhr für euch.

Peter Fotheringham ist die gute Seele vom Roxy und vom sweetSixteen.

Im Vorraum vom sweetSixteen steht noch ein uralter Filmprojektor.

Filmbühne „Zur Postkutsche“ Schüruferstraße 330 44287 Dortmund www.filmbuehne-dortmund.de
Roxy Lichtspielhaus
Münsterstr. 95 44145 Dortmund www.roxy-lichtspielhaus.de
Schauburg
Brückstrasse 66 44135 Dortmund www.schauburg-kino.com
sweetSixteen im Depot Kulturort
Immermannstraße 29 44147 Dortmund www.sweetsixteen-kino.de
Kino im U Leonie-Reygers-Terrasse 44137 Dortmund www.dortmunder-u.de/kino-im-u
CineStar Dortmund
Steinstraße 44 44147 Dortmund https://www.cinestar.de/ kino-dortmund/info

Ein Blick hinter die Kulissen der Orgel im Konzerthaus Dortmund – des größten (und: lautesten!) Instruments der Stadt.


So groß wie ein Haus: Die Orgel im Konzerthaus Dortmund
Der Konzertsaal: Eine Ostseemuschel unterm Sternenhimmel

Das ist hier ziemlich steil. Man muss schon schwindelfrei sein“, warnt uns Laura Allendörfer. Und dann führt sie uns in einen Zauberwald aus Pfeifen. Wir sind zu Besuch im Konzerthaus Dortmund. Mitten in der Innenstadt. Allein schon der Konzertsaal ist beeindruckend. Mehr als 1 500 Zuschauerinnen und Zuschauer passen hier rein und sitzen dann in einem cremeweißen Raum mit gewellten Wänden. So, als befände man sich in einer gigantischen Ostseemuschel. Die Decke des Saal ist pechschwarz mit hellen Lichtern – wie ein leuchtender Sternenhimmel. Und an der hinteren Wand des Saals thront über allem die Orgel des Konzerthauses. „Die Königin der Instrumente“ wird die Orgel genannt, weil sie das größte und lauteste Instrument ist, das ein Mensch alleine spielen kann.
Laura Allendörfer nimmt uns mit hinter die Kulissen der Orgel in Dortmund. Sie arbeitet im künstlerischen Bereich des Hauses. Das heißt: Sie plant (Orgel-)Konzerte und kümmert sich darum, dass bei der Durchführung von Konzerten auch alles reibungslos klappt. „Ich bin selbst nicht so oft im Orgelhaus“, sagt sie. „Auch für mich ist das spannend, hier zu sein.“ Mit ihr gehen wir hinein ins „Haus“ – denn die Orgel ist ein begehbares Inst-
rument mit drei Stockwerken. Eine steile Holzleiter führt von einer Etage der Orgel zur anderen. Und in ihr drin sieht es aus wie in einem Märchenwald aus Stäben. Aus Luftkanälen, Glanz und Pfeifen. Manche sehen aus wie riesige Holzkisten mit Klappe am Ende, andere wie lustige Spielzeughupen. Ein bisschen erinnert es auch an einen superkomplizierten Stecksystem-Baukasten.
Schwer wie zehn Autos
Viele Orgeln sind jahrhundertealt. Die Dortmunder Orgel ist hingegen fast fabrikneu. Denn für eine Orgel ist sie jung. Eingebaut wurde sie vor gut 20 Jahren, als das Konzerthaus Dortmund neu gebaut wurde. Entworfen hat sie der Bonner Orgelbauer Klais. Die Orgel im Kon-
Laura Allendörfer im Märchenwald aus Pfeifen

zerthaus Dortmund war ein ziemlich großes Projekt , denn sie ist gewaltig:
Insgesamt wiegt das Instrument 20 Tonnen, also etwa so viel wie zehn schwere Autos. Und es besteht aus insgesamt 3 565 Pfeifen, davon 306 aus Holz und 3 259 aus Zinn. Die kleinste Pfeife hat dabei gerade einmal die Größe eines Bleistiftspitzers. Sie pfeift so hohe Töne, dass man ziemlich gute Ohren haben muss, um sie überhaupt zu hören. Die größte Pfeife der Orgel hingegen ist acht Meter lang. So groß wie eine Giraffe. Für den Orgelbauer Klais ist das besonders gut, denn nach dem Einbau der Orgel –das ist eine jahrhundertelange Tradition bei den Orgelbauern – gab es neben dem Arbeitslohn obendrauf noch exakt so viel Wein, wie in die größte Pfeife passt: Für die Dortmunder Orgel 600 Liter.
Eine Blockflöte in extragroß
Durch die Pfeifen hindurch kann man runter in den Konzertsaal blicken. „Da unten ist gerade schon das Orchester für das nächste Konzert aufgebaut“, sagt Laura Allendörfer und zeigt auf die Bühne . „Das Tolle an einer Orgel ist: Sie kann fast alles spielen, was ein Orchester spielen kann.“ Dafür wählt man am Orgelspieltisch Klangfarben aus – Register heißen die. Manche Register klingen wie Flöten, manche wie eine Tuba. Eines der Register hat den Sound einer Posaune und ein anderes brummt wie ein Kontrabass. Und trotzdem ist das Prinzip einer Orgel eigentlich einfach. Sie funktioniert wie eine Blockflöte: Luft reinpusten – Ton kommt raus. Nur, dass die Luft nicht wie bei einer Flöte durch den Mund hinein-
3.565 Pfeifen– klein wie ein Bleistiftspitzer und groß wie eine Giraffe


gepustet wird. Eine Orgel hat ein ganzes Windwerk aus Bälgen und Gebläsen. Und eine elektronische Steuerung, die über eine komplizierte Steuerzentrale läuft.
Das ist der Spieltisch, der mitten auf der Bühne steht und durch dicke Kabel unter der Bühne mit der Orgel verbunden ist. Er ist das Cockpit der Orgel. Es gibt drei Tastaturen. Und Registertasten in Form von Kippschaltern, mit denen die unterschiedlichen Pfeifengruppen an- und ausgeschaltet werden können. Vor einem Konzert müssen diese Knöpfe immer sorgfältig programmiert werden, damit dann beim Spielen immer die richtigen Pfeifen loslegen .
Achtung Heuler!
So schön, wie sie aussieht, sind auch die Begriffe, mit denen die Funktionen einer Orgel beschrieben werden. Es gibt ein „Schwellwerk“ mit „Schwellern“ – das
Holzkisten, Pfeifen und Lufkanäle. Ein gigantisches Stecksystem

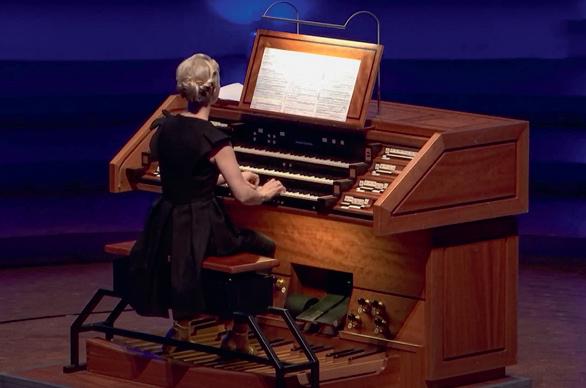
Der Spieltisch:
Das Cockpit der Orgel
sind Fußpedale, mit denen die Lautstärke gesteuert werden kann. Es gibt den Orgelwind, der durch die Windladen fließt. Das sind die Klappen, die sich öffnen, um den Pfeifen Wind zu geben, als würde man bei der Blockflöte einen Finger vom Loch nehmen. Und es gibt – das ist ein neues Lieblingswort! – „Heuler“. Denn bei einem solchen Instrument geht auch mal was schief. Und wenn dann ein Tonventil undicht ist oder die Mechanik klemmt, entwickelt sich ein nerviger Dauerton – ein „Heuler“ eben. „Da kann man dann bei einem Konzert auch nichts mehr machen“, sagt Laura Allendörfer. „Reparieren geht erst danach. Ein Heuler kommt aber glücklicherweise nicht so oft vor.“
Orgelstars in Dortmund
Bei all den Fachbegriffen ist es Laura Allendörfer aber wichtig, dass die Orgelkonzerte nicht nur etwas für Orgel-Nerds sind. „Ich mag es ja selbst am Allerliebsten, wenn mich die Orgel einfach mit
ihrer Vielfalt von Klängen überrascht“, sagt sie. Und deshalb sucht sie für die Konzerte nach aufregenden Künstlerinnen und Künstlern, die wirklich allen gefallen, besucht Orgelmusikwettbewerbe und recherchiert im Internet. So findet sie dann Künstlerinnen wie Anna Lapwood aus London. Die 29-Jährige ist ein echter Orgelstar und spielt unter anderem Filmmusikhits auf der Orgel.
Damit hat sie eine halbe Million Follower bei TikTok und erreicht mit ihren InstaReels Millionen Menschen. „Taylor Swift der klassischen Musik“ wird sie von der Presse genannt und Laura Allendörfer ist voller Vorfreude, sie nach Dortmund zu lotsen.
Nicht nur für Erwachsene „Manchmal hat ja so ein Konzerthaus den Ruf, nur etwas für ältere Menschen zu sein“, sagt sie. „Dabei gibt es doch unheimlich aufregende Musik zu entdecken, auch für Kinder und Jugendliche.“ Extra dafür hat das Konzerthaus
Dortmund deutschlandweit einmalige Angebote. Es gibt das Programm „Ohrenöffner“, bei dem Maus-Moderator Ralph Caspers zusammen mit WeltklasseKünstlerinnen und -Künstlern musikalische Themenfelder erkundet. Das wird dann live und kostenlos in die Klassenzimmer von bis zu 60 Schulklassen in ganz NRW gestreamt. Und es gibt im Juli ein Sommerferienprojekt für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Dabei könnt ihr Instrumente ausprobiren, tanzen oder sogar auf die Bühne.
Dortmund ist das erste deutsche Konzerthaus mit einer eigenen CommunityMusic-Abteilung. „Community Music“ heißt, dass einfach wirklich jeder und
Brückstraße 21, 44135 Dortmund
Online: https://www.youtube.com/ @KonzerthausDortmund
Eintritt:
Von 0,00 Euro bis ca. 169 Euro (abhängig von Veranstaltung und Preisklasse). Das Abo für die Orgelkonzerte kostet 94,50 € und die Hälfte für Kinder und junge Menschen bis 27 Jahre. Nutze das U27-Ticket von DSW21.
So kommst du hin:
Das Konzerthaus Dortmund liegt im Zentrum Dortmunds. Der Haupteingang befindet sich in einer Fußgängerzone. Die Anreise ist daher bequem mit
jede mitmachen darf – egal, ob man ein Instrument spielen und Noten lesen kann oder nicht. Die einzigen Voraussetzungen sind: Neugier und Freude daran, Musik mit anderen zu entdecken und zu erleben.
Die Freude kommt ganz von selbst. Spätestens, wenn man eines der von Laura Allendörfer organisierten Orgelkonzerte besucht. Ein einmaliges Erlebnis: wie vorne auf der Bühne ein einzelner Mensch ein paar Tasten drückt und dann das ganze dreistöckige Haus aus Pfeifen, Pumpen und Klappen anfängt zu sausen, zu dröhnen, zu wummsen. „Ja, diese Wucht des Klangs zu erleben, das beeindruckt mich jedes Mal“, sagt Laura Allendörfer.
öffentlichen Verkehrsmitteln
möglich:
Linien U42, U43, U44, U46 bis Haltestelle
Reinoldikirche/ Konzerthaus
Linien U41, U45, U47, U49 bis Haltestelle Kampstraße. Oder zehn Minuten zu Fuß vom Dortmunder Hauptbahnhof
Tipp:
Mit der Schulklasse bei einem „Ohrenöffner“-Konzert zuschauen oder beim Sommerferienprojekt anmelden und selbst Musik machen. Alle Informationen zum Community-Music-Angebot gibt es auf der Webseite.
Du suchst nach einem guten Zeitpunkt, um mit einem Ehrenamt zu starten?
Dann leg gleich los! Wer in Dortmund aktiv werden möchte, findet viele Möglichkeiten. Denn in unserer Stadt gibt es jede Menge Chancen, sich freiwillig zu engagieren und dabei richtig viel Spaß zu haben. Wir haben uns mal umgesehen.

„Miteinander stark” lautet das Motto des Jugendverbands der christlichen Hilfsorganisation Johanniter-UnfallHilfe. Kinder und Jugendliche lernen hier zum Beispiel Erste Hilfe, Teamwork und Engagement für andere Menschen. Die Johanniter-Jugend besteht aus zahlreichen Kinder- und Jugendgruppen und Schulsanitätsdiensten in ganz Deutschland. Sie alle bieten eigene Aktivitäten an, unter-
nehmen gemeinsam Ausflüge, sind draußen in der Natur aktiv und gestalten gemütliche Spielenachmittage. Bei der Johanniter-Jugend kannst du sogar Blaulichtfahrzeuge hautnah erleben und dich ab 16 Jahren im Bereich des Sanitätsdienstes und Katastrophenschutzes weiterbilden. Ab 18 Jahren darfst du dann auch zu den Einsätzen mitfahren.
Wer Lust hat, Teil der Johanniter-Jugend zu werden, kann sich die Dortmunder Gruppe in Aplerbeck ansehen. Melde dich dazu vorher bei der Regionaljugendleitung an: regionaljugendleitung. oestliches-ruhrgebiet@johanniter.de. Infos zu den Johannitern findest du unter: www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/ johanniter-jugend-miteinander-stark/

Wusstest du, dass es in den zwölf Dortmunder Stadtbezirken ganze 32 Jugendfreizeitstätten gibt? Hier können sich Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 24 Jahren treffen, aufhalten und ihre Nachmittage verbringen. Außerdem bieten die Einrichtungen viele Aktionen und Projekte, bei denen ihr euch aktiv beteiligen könnt.
Zum Beispiel in der Jugendfreizeitstätte Eving: „Bei uns fängt das mit einfachen Dingen an, so dass die Jugendlichen manchmal gar nicht merken, dass sie sich schon aktiv einbringen“, sagt Sandra Kampmann, Leiterin der Einrichtung lachend. „Sie helfen zum
Beispiel beim Kochen: Einmal in der Woche wird in unserer Küche nämlich für 70 bis 90 Kinder Essen zubereitet.“ Die Jugendlichen schlagen dafür selbst Gerichte vor, erstellen Einkaufslisten und kochen dann mit Beteiligung der Betreuer für alle, die an diesem Tag da sind. Und das sind oft ganz schön viele, berichtet Sandra Kampmann: „Viele Kinder kommen häufig hungrig zu uns. Deshalb ist es schön, wenn sie sich hier satt essen können.“ Die Beteiligung der Jugendlichen geht aber noch viel weiter. Sie haben zum Beispiel bei der Renovierung der Küche mitgemacht und helfen regelmäßig bei Festen in der Jugendfreizeitstätte.


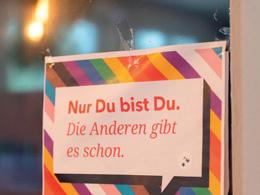


Außerdem bietet das Jugendforum der Einrichtung Jugendlichen vier Mal im Jahr die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen an die Bezirkspolitiker zu wenden. „Wir unterstützen sie dabei, ihre Wünsche und Ideen zu formulieren. Dann gehen sie selbst in die Bezirksverordnetenversammlung und tragen ihr Anliegen vor den Politikern vor“, erzählt Kampmann. „Das ist eine tolle Erfahrung, weil sie den Kindern zeigt, dass ihre Stimme gehört wird und sie etwas bewegen können.“ So wurden schon neue Fahrradständer für eine Schule bewilligt und barrierefreie Umbauten im angrenzenden Park angeregt.


Alle Infos zu den Freizeitstätten in euren Bezirken findet ihr unter www.dortmund.de. Übrigens: Die Stadt Dortmund hat auch in diesem Jahr wieder jede Menge Ferienangeboten in den Freizeitstätten. Die meisten davon sind sogar kostenlos. Alle Termine findet ihr auf der Internetseite der Stadt.

Etwa 300 Jugendliche in Dortmund sind bereits Mitglied in einer der 18 Gruppen der Dortmunder Jugendfeuerwehr. Sie sind zwischen 10 und 18 Jahre alt und werden von etwa 100 Betreuern begleitet. Wer bei der Jugendfeuerwehr eintritt, kann richtig viel lernen. Es gibt Übungen mit den Blaulichtfahrzeugen, Löschübungen und ein spezielles Training, um Menschen zu retten. Auch Erste Hilfe und natürlich die Gefahren von Feuer oder Feuerwerkskörpern bekommen alle beigebracht.
Vor allem aber wird bei der Jugendfeuerwehr der Teamgeist und das Miteinander gefördert. Denn bei der Feuerwehr ist es sehr wichtig, seinen Kameradinnen und Kameraden zu vertrauen und sich aufeinander verlassen zu können. Dank dieser Philosophie unterstützen sich die Jugendlichen gegenseitig, übernehmen Verantwortung und treffen Entscheidungen demokratisch.
Daneben hilft die Jugendfeuerwehr Dortmund auch in vielen alltäglichen Bereichen. So sammeln sie zum Beispiel ehrenamtlich Weihnachtsbäume ein und unterstützen ökologische Projekte der Stadt.
Alle Infos findet ihr unter: www.jugendfeuerwehr-dortmund.de

„Sozialgenial“ heißt das Programm der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Schülerinnen und Schüler entwickeln dazu im Unterricht eigene Ideen für Engagementprojekte. Mit Partnern der Schule können die Jugendlichen diese Projekte umsetzen. Und so lernen, wie sie ehrenamtlich tätig werden können. Die Stiftung unterstützt alle Schulen und Schulformen der Sekundarstufe 1.
So wie zum Beispiel die Hauptschule Scharnhorst. „Von Kids und Jugendlichen für Kids und Jugendliche“ heißt das Programm, das im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts erarbeitet wurde. 15 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 gestalten für je zwei Schulstunden pro Woche das Jugendzentrum Scharnhorst um. Sie

arbeiten sowohl in den Aufenthaltsräumen als auch im Gartenbereich. Themen wie Vielfalt und Toleranz, Respekt, Kooperation und Kollaboration, Umweltschutz, Partizipation und Selbstwirksamkeit werden in diesen Stunden mit eingebracht. Die Schülerinnen und Schülern gestalten etwa Graffitiwände, bauen Palettenmöbel und Pflanzenkästen. Wissen aus dem Schulalltag – aus den Fächern Kunst, Bio oder Werken – lässt sich dabei gut anwenden. Jeder kann dabei erleben, dass man etwas verändern kann und Engagement sich lohnt. Außerdem lernen alle Beteiligten einen Treffpunkt für die eigene Freizeit kennen. Der bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Praktika und ähnlichem.
„Sozialgenial“ ist nur ein Programm von vielen, die an Schulen angeboten werden. Fragt doch an eurer Schule einmal nach, ob es ähnliche Angebote gibt. Alle Infos zur Stiftung Aktive Bürgerschaft findet ihr unter: www.aktive-buergerschaft.de

Die Tafel ist eine deutschlandweite Hilfsorganisation, die Essen an Bedürftige verteilt. Auch in Dortmund gibt es eine Tafel. Wer nicht genug Geld hat, um im Supermarkt einzukaufen, kann hier versorgt werden. Zu ihr gehört das Panoramahaus in der Haydnstraße, in dem sich speziell um die Kinder der bedürftigen Familien gekümmert wird. Sie werden hier betreut, während die Eltern Lebensmittel bekommen, können spielen und andere Kinder treffen. Doch das Panoramahaus bietet noch mehr: zum Beispiel Kochkurse für Eltern und
Kinder, Vorlese-Programme für die Kleinen, Hausaufgabenhilfe für Schulkinder und Social-Media-Kurse für die etwas Älteren. Außerdem gibt es speziell für alle ab 14 montags einen Jugendtreff mit Angeboten, die auf sie abgestimmt sind.
„Jugendliche ab 14 Jahren können bei uns aber auch schon mithelfen“, sagt Regina Grabe, zweite Vorsitzende von der Dortmunder Tafel. „Sie können den Kleineren helfen, Ausflüge mit begleiten, aber natürlich auch beim Kochen unterstützten. Wir freuen uns darüber sehr.“




Alle Infos zur Dortmunder Tafel findet ihr unter: www.dortmundertafel.de
1
Wasser ist mal flüssig, mal zu Eis gefroren. Manchmal verdampft es beim Kochen auch einfach über dem Nudeltopf. Doch mit der glasklaren Flüssigkeit kannst du nicht nur baden, duschen oder Trinkgläser füllen. Sondern auch richtig gut forschen. Wenn du einen Wasserhahn in deiner Nähe hast, leg doch gleich los und finde heraus, wie du diese Fragen zum Wasser beantworten kannst! Überlege dir immer zuerst, welches Ergebnis du erwartest, und probiere es dann aus
Das Wasser fließt aus dem Hahn in einem kerzengeraden Strahl nach unten. Ist das immer so? Oder kannst du die Richtung verändern?

Du brauchst: einen Luftballon und einen Wasserhahn
So geht es:
1. Puste den Luftballon etwas auf und knote ihn zu.
2. Reibe ihn ganz schnell am Pulli oder an deinen Haaren.
3. Drehe den Wasserhahn so auf, dass der Wasserstrahl gerade nach unten verläuft.
4. Halte nun den Luftballon nah an den Wasserstrahl. Was passiert?
Achtung! Der Luftballon darf nicht nass werden.
Die Erklärung findest du auf der nächsten Seite.



Das passiert:
Wenn du den Luftballon ganz nah an den Wasserstrahl hältst, biegt sich der Wasserstrahl zum Luftballon.
Erklärung:
Wenn du den Luftballon reibst, wird er elektrisch aufgeladen. Deine Haare übrigens auch, deshalb stehen sie nach der Reibeaktion ab.
Im Luftballon sind jetzt ganz viele positive Ladungen.
Im Wasserstrahl gibt es positive und negative Ladungen. Diese Ladungen drehen sich jetzt so, dass alle negativen Ladungen auf der Seite mit dem Luftballon sind. Die positiven Ladungen im Luftballon und die negativen Ladungen im Wasser ziehen sich jetzt an. Deshalb verbiegt sich der Wasserstrahl.
So kannst du dir das vorstellen:



SCHWIMMT EINE 2 AUF DEM WASSER?
Eine Büroklammer ist aus Metall und schwerer als Wasser. Kannst du sie trotzdem auf dem Wasser schwimmen lassen? Oder geht sie direkt unter? Was glaubst du?
Du brauchst: eine Büroklammer eine kleine Schale mit Wasser
So geht es:
1. Fülle die Schale randvoll mit Wasser.
2. Lege jetzt die Büroklammer ganz vorsichtig auf die Wasseroberfläche.
3. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl kannst du sie bestimmt schwimmen lassen.
Das passiert:
Wenn du vorsichtig bist, schwimmt die Büroklammer auf dem Wasser.
Erklärung:
Wasser hat eine Oberflächenspannung. Das kann man sich etwa so vorstellen, als hätte Wasser eine Haut. Deshalb können auf dem Wasser auch Gegenstände schwimmen, die ein bisschen schwerer sind als Wasser.
Die Oberflächenspannung ist auch für einige Tiere sehr nützlich, zum Beispiel für den Wasserläufer. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass der Wasserläufer und auch die Büroklammer das Wasser eindrücken.
Deine Beobachtungen:

Mit Wasser und Zuckerwürfeln bunte Kunst zaubern? Wie soll denn das gehen? Probiere es doch einfach mal aus.
Du brauchst: einen Teller, Wasser, einige Zuckerwürfel, bunte Tinte
So geht es:
1. Gieße so lange Wasser in den Teller, bis er gut mit Wasser bedeckt ist.
2. Verteile nun auf jeden Zuckerwürfel vorsichtig einen Tropfen Tintenfarbe. Nimm für jeden Würfel eine eigene Farbe.
3. Lege nun die Zuckerwürfel mit der farbigen Seite nach unten in den Teller.
4. Beobachte, was passiert.


Das passiert:
Der Zucker und die Tinte lösen sich im Wasser auf. Die Farben verlaufen langsam. Es entsteht ein buntes Zucker-Wasser-Kunstwerk.
Erklärung:
Der Zucker löst sich im kalten Wasser schneller auf als die Tinte.
Der Zucker verteilt sich dabei unsichtbar im Wasser und zieht die Tinte einfach hinter sich her. So ähnlich, als würdest du jemanden huckepack nehmen. So entstehen die schönen bunten Bilder.



Zu diesen und anderen spannenden Fragen kannst du mit den Fachleuten von DEW21 direkt an deiner Schule experimentieren.
Zeig deiner Lehrkraft diese Seite und ladet DEW21 zu euch in den Unterricht ein.
Weitere Infos findet ihr unter https://www.dew21.de/ueber-dew21/ engagement/bildungsengagement



Aus einen Schuhkarton, Papier und Farbe zauberst du dir ganz einfach ein eigenes Aquarium. Wer da einziehen darf? Die Bewohner bastelst du gleich mit!

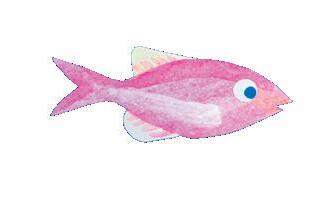
Du brauchst:
• Schuhkarton
• Bastelfarben
• Pinsel und Wasserglas
• festes Papier
• Bleistift
• Seidenpapier
• Schere
• Klebeband
• Garn
• Kleber
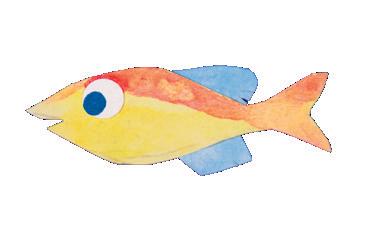

So geht es:
Male den Schuhkarton innen komplett mit blauen und grünen Farben aus und lasse ihn trocknen. Schneide das Seidenpapier in schmale Streifen. Daraus werden deine ersten Wasserpflanzen. Später kannst du sie an der Decke des Aquariums festkleben.

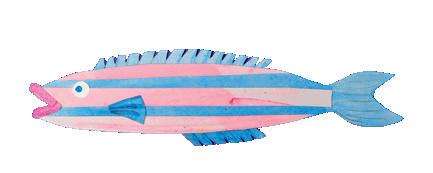

2 Zeichne auf das feste Papier Pflanzen, Korallen und Felsen. Bevor du sie anmalst und ausschneidest, denke daran, unten genügend Platz zu lassen. Dort knickst du später eine Lasche, mit der du sie am Aquarienboden festklebst..



3 Male verschiedene Tiere auf Papier, die später ins Aquarium einziehen sollen. Lass deiner Fantasie freien Lauf! Während sie trocknen, klebst du die Pflanzen und Steine im Aquarium fest. Schneide dann die Tiere aus. Einige kannst du an der Rückwand des Aquariums festkleben. Andere bemalst du von beiden Seiten und befestigst sie mit Garn und Klebeband an der Decke des Aquariums. Sie scheinen nun im Wasser zu schweben.


Aus einer alten Streudose und Konfetti aus dem Locher zauberst du ganz einfach Futter für deine Fische.
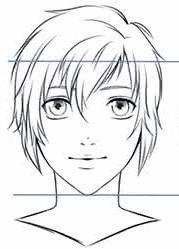
Deinen ersten Mangakopf zeichnest du in der Frontalansicht. Man sieht das Gesicht also direkt von vorne.

Beginne mit einem einfachen Kreis. Dabei ist es nicht wichtig, ob er perfekt ist. Du brauchst den Kreis also nicht mit einem Zirkel zu ziehen. Er muss auch nicht aus einer einzelnen Linie bestehen. Zieh einfach so lange Kreise auf deinem Blatt, bis du ein zufriedenstellendes Ergebnis hast (01). Achte dabei immer darauf, nicht zu fest aufzudrücken, da dieser Kreis nur eine Hilfslinie sein wird.


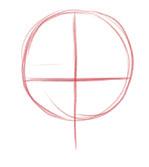
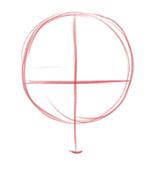
Als nächstes ziehst du in der Mitte einen senkrechten Strich, der unten ein wenig aus dem Kreis herausragt (02). Wie weit genau der Strich aus dem Kreis steht, ist erst einmal nicht wichtig.
Nun ziehst du eine waagerechte Linie genau auf der Mitte des Kopfes (03). Beachte hierbei, dass die Mitte deines gezeichneten Kopfes nicht auf der Mitte des Kreises liegt, sondern weiter unten, da das Kinn außerhalb des Kreises auf unserer senkrechten Linie liegt.
Dann setzt du unterhalb des Kreises einen Marker für das Kinn (04). Wie breit dieser Marker ist, hängt davon ab, wie breit du das Kinn deiner Figur zeichnen möchtest. Wo du den Marker hinzeichnest, entscheidest du. Je weiter unten er ist, desto länger, und je weiter oben, desto rundlicher oder breiter wird das Gesicht deiner Figur.
Im nächsten Schritt verbindest du das Kinn mit dem Kreis (05). Entscheide, wie geschwungen die beiden Linien sind, mit denen du das Kinn mit dem Kreis verbindest. Vermeide aber, sie ganz gerade oder gar nach innen gebogen zu zeichnen. Da der Kopf so aber noch ein wenig zu eiförmig ist, „schneidest“ Du nun an den Seiten ein bisschen vom Kreis weg (06). Wenn du nun die Form sauber nachziehst, hast Du einen korrekten und gleichmäßigen Kopf (07). Radiere aber an dieser Stelle nicht alle Hilfslinien aus. Einige wirst Du später noch brauchen.
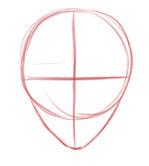
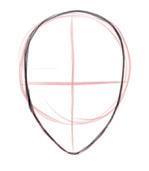
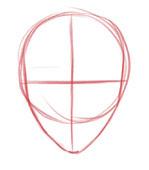
Probiere einen ersten Kopfumriss:

Wie auch schon beim Kopf fängst du beim Auge mit einem einfachen Kreis an. Ziehe einfach locker ein paar Kreise, bis er rund genug aussieht (08). So lockerst du auch gleich deine Hand. Stell dir diesen Hilfskreis als so etwas wie den Augapfel vor.

Wenn du große, runde Augen zeichnen möchtest, kannst du die Linie für das obere Lid einfach an dem Kreis entlang zeichnen. Ebenso kannst du nun das untere Lid am Kreis entlang zeichnen (10).


Nun zeichnest du über das obere Lid des Auges die Lidfalte (11). Sie ist nicht so breit wie das Oberlid, folgt aber der gleichen Form. Pass an dieser Stelle auf, dass du den Strich für die Lidfalte nicht zu hoch setzt, sonst sieht deine Figur schnell schläfrig aus.
Als Nächstes kommt der Augeninhalt dran. Der erste große Kreis nennt sich „Iris“ (nicht Pupille). Das ist der Teil, der später auch farbig wird (12).

Der zweite Kreis im Auge ist die „Pupille“ (13). Sie sollte die gleiche Form haben wie die Iris (es sei denn, du zeichnest deiner Figur Katzenaugen oder Ähnliches).

Hast du also eine leicht ovale Iris gezeichnet, sollte auch die Pupille ein wenig oval sein. Die Pupille muss in jedem Fall in der Mitte der Iris sitzen, wenn du das Auge von vorne siehst. Sie darf nicht nach links oder rechts wandern, nur weil die Figur nach links oder rechts guckt.
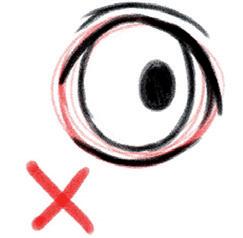
Am Ende fügst du noch die Augenbraue hinzu (15). Sie ist etwas breiter als das Auge. Lege fest, wie dick und geschwunden sie für deine Figur sein soll.


Probiere unterschiedliche Augen:

Auf der Basis eines Kreises kannst du auch ein schmales Auge zeichnen. Zeichne dann die Lider nicht direkt auf dem Kreis, sondern im Kreis (16). Nutze die waagerechte Hilfslinie deiner ersten Umrisszeichnung. Die Mitte des Auges muss genau auf der Mitte dieser Linie liegen. Wie beim runden Auge folgt der Strich für die Lidfalte wieder der Form des Auges und ist nicht zu weit über dem Auge (17).

Da dieses Auge nicht so groß und vor allem rund ist, kann die Iris hier als Kreis gezeichnet werden. Natürlich sieht man den Teil des Kreises nicht, der außerhalb des Auges beziehungsweise unterhalb des Augenlids ist.
Die Pupille muss wieder genau in der Mitte der Iris liegen. Um das zu verdeutlichen, siehst du hier den Teil der Iris, der außerhalb des Auges liegt.



Probiere auch schmale Augen:

Auch die Nase kann man von vorne ganz vereinfacht mit einem Kreis beginnen.
Da man von vorne gar nicht so viel von der Nase sieht, reicht es, einfach nur die Nasenlöcher zu zeichnen. Dazu ziehst du einfach zwei Häkchen auf gleicher Höhe am Kreis hoch und nach außen vom Kreis weg wieder hinunter (20).
Um zu veranschaulichen, wie das Ganze später aussehen soll und wo die Nase eigentlich ins Gesicht deiner Figur gehört, hier einmal direkt in den Kopf aus den vorigen Schritten gezeichnet (21). Die Augen sind auch schon dort, wo sie hingehören, nämlich mittig auf der Mittellinie des Kopfes. Die Nase setzt du in die Mitte oder ein bisschen unterhalb der Mitte zwischen Mittellinie und Kreis.
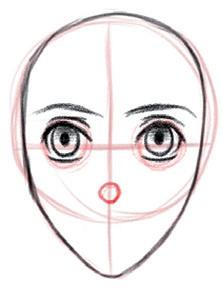
Übe das Einzeichnen der Nase:
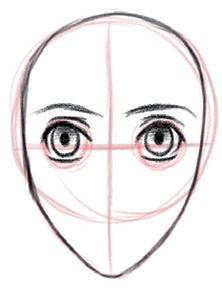
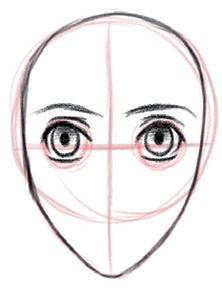

Die Position des Mundes auf deiner Skizze festzulegen ist sehr einfach, sofern du immer noch deine Kreis-Hilfslinie hast. Ein ganz normaler, geschlossener Mund liegt ziemlich genau auf der Linie unten am Kreis (22). Achte darauf, dass der Mund links und rechts von der Mittellinie gleich breit ist.
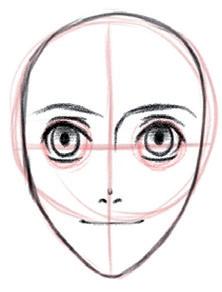
Wie breit der Mund deiner Figur ist, ist dir überlassen und hängt zudem vom Charakter der Figur ab. Weibliche Mangafiguren haben meist einen etwas schmaleren Mund als männliche. Eine Figur wirkt zudem wilder, je breiter der Mund gezeichnet wird. Wenn du magst, kannst du deiner Figur noch die Ober- und Unterlippe andeuten. Mache dir dann bewusst, wie die vollständige Form der Lippen eigentlich ist. Die Hilfslinien im Bild zeigen dir, welche Form du beim Andeuten der Lippen bedenken musst.
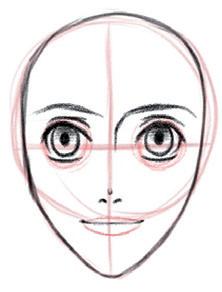
Oft wird im Manga nur die Unterlippe mit einem Strich oder einer Schattierung angedeutet. Manchmal auch die Oberlippe (24).
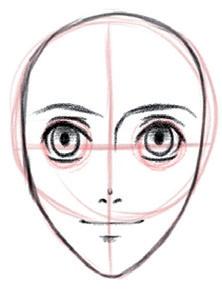
Entscheide, welche Form der Mund deiner Figur hat. Um einen betont geschwungenen Mund zu zeichnen, beginne einfach mit einem sehr flachen V an der Mittellinie. Von dort aus ziehst du zu beiden Seiten mit einem leichten Aufwärtsschwung den Mund bis zu den Mundwinkeln (25).
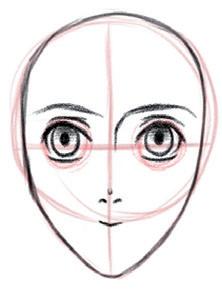
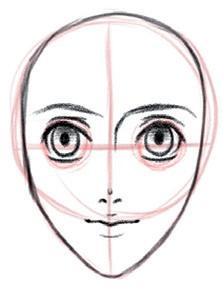
Realistischer wirkt ein Mund natürlich, wenn du auch bedenkst, was sich im Mund befindet und dies darstellst. Wenn du dich selbst im Spiegel betrachtest, wirst du feststellen, dass zuerst die obere Zahnreihe zu sehen ist, wenn du lächelst oder lachst. Vor allem wenn die Figur die Zähne nicht zusammenbeißt beim Lächeln oder Lachen, sieht man die untere Zahnreihe eigentlich nicht, wenn man frontal auf das Gesicht sieht (26).
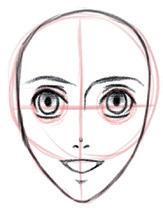

Teste unterschiedliche Mundformen:




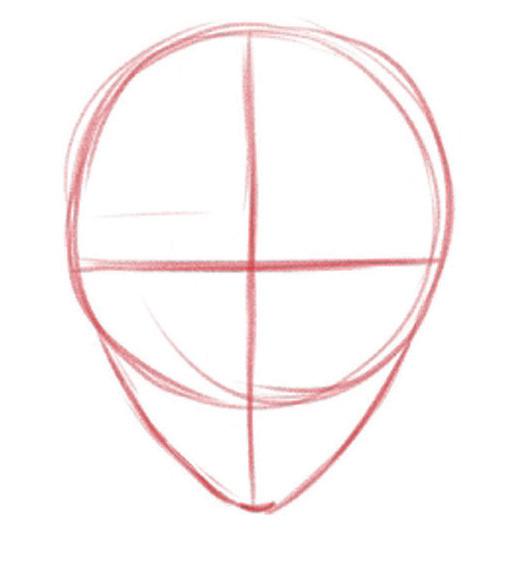
TIPP: Lust auf mehr? Im Dortmunder U gibt es jeden Mittwoch ab 16 Uhr den Zeichen-Workshop „Manga Total“.
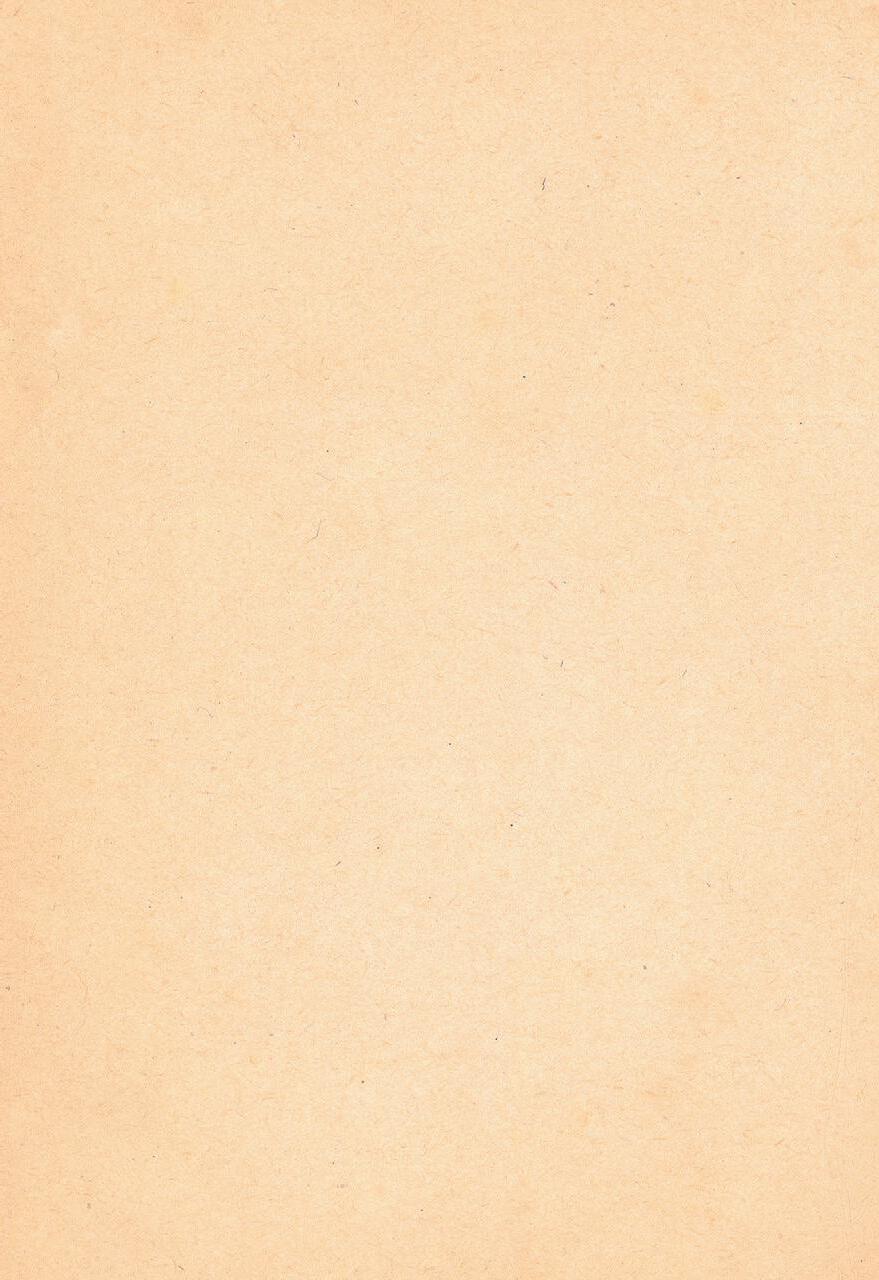

Naoki Urasawa Band
Dieser Comic beginnt nicht auf dieser Seite. ASADORA ist ein japanischer Comic. Da in Japan von „hinten“ nach „vorne“ gelesen wird und von rechts nach links, müsst ihr auch diesen Comic auf der letzten Seite aufschlagen und von „hinten“ nach „vorne“ blättern. Die Bilder und Sprechblasen werden von rechts oben nach links unten gelesen. Schwer?
Zuerst ungewohnt, doch dann bringt es richtig Spaß. Probiert es aus!
Viel Spaß mit ASADORA!

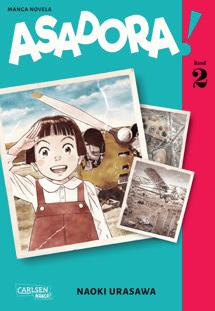
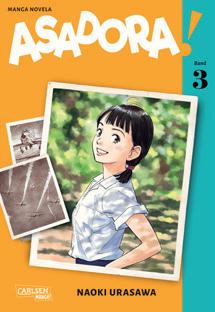
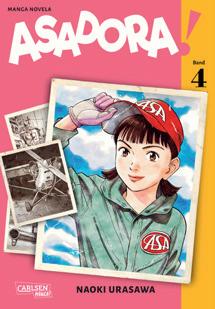
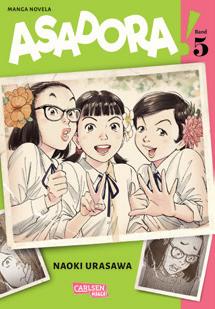
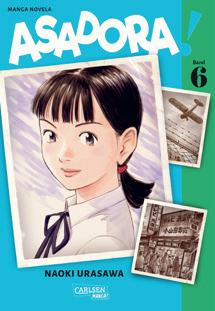
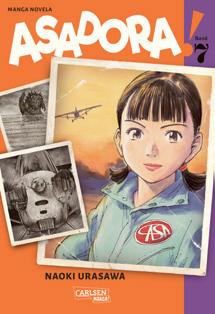

Das waren die ersten beiden Kapitel des ersten Bands der ASADORA!-Reihe. Wie es weiter geht und andere spannende Abenteuer liest Du in den Comics der CarlsenManga-Serie. Viel Spaß!
Erhältlich in guten Buchhandlungen, Comic-Shops oder unter www.carlsen.de/reihe/asadora
ooo… ein Held der Lüfte!
ich habe es so satt, ganz unten am Boden herumzukrauchen!
Wenn ich nur die Lizenz hätte… ich wäre... Gr o o o o o K l a p p e r K l a p p er
… wie den letzten idioten!
B am K uller K uller
Alle behandeln mich…
B am
Hff! Hff!
Hätte ich nur Geld… … bekäme ich die Lizenz… Hff! Hff! Lizenz?
Und wieso hast du was geklaut?
Weil du mich einen Dieb genannt hast.
Warum hast du mich überhaupt entführt?
Aber ich heisse nur Asa.
Und ich bin kein
Entführer…
ich bin kein Dieb…
Alle Welt…
jeder …
… mal lassen sie mich zurück…
Alle meine Geschwister haben schöne Namen.
Weil ich am Morgen geboren bin, heiSSe ich Asa.
Darum vergessen sie mich ganz oft. Mal fehlt mein Essen…
Na und?
Und niemand wird zur Polizei gehen.
Aber keiner merkt, dass ich nicht da bin.
…
ich hab mich dran gewöhnt. in so einer grossen Familie ist das so.
Aber ich bin sicher, dass ihnen jedes Kind etwas bedeutet.
Sie nennen uns einfach nur »alle«!
Hm, bei so vielen Kindern geht’s nicht anders.
»Alle schnell einschlafen!«
Nicht mal meine Eltern können uns auseinanderhalten.
»Alle zum Essen kommen!!«
Alle Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder.
»Haben alle alles eingepackt und nichts vergessen?«
… die groSSen Schwestern Yayoi, Satsuki, Mutsuki und die kleine Schwester Hazuki… Das sind alles hübsche Namen. Und du? Wie heiSSt du noch?
Meine groSSen Brüder jin’ichi und Yoshiji, die kleinen Brüder Reizo und Satoshi…
Ach ja, jetzt noch eins mehr… elf.
ich habe zehn Geschwister.
Darum haben sie sich auch nicht bei der Polizei gemeldet.
Das glaube ich nicht
Hast du etwa Kinder?
Hä?… wirst du niemandem etwas sagen, ja?
Und du hast mein Gesicht gesehen.
Das wird nicht passieren.
... bin ich fürs Gesetz jetzt ein Krimineller.
Wenn deine Eltern es schon gemeldet haben…
Plötzlich steht man vor dem Nichts!! Niemand wird freiwillig zum Dieb!!
Aber jetzt… … bin ich…
Dann wird überall mein Steckbrief ausgehängt und ich bin geliefert.
Du meinst, wenn ich dich gehenlasse…
Dann mach mich los…
… und lass mich gehen!
… meine ich nicht.
Nein… das…
ich wette, keiner hat gemerkt, dass ich nicht da bin.
Mich legst du nicht mit so ’ner simplen Lüge rein!!
Glaubst du etwa, ich falle darauf rein?
Willst du mich austricksen?
Du hast doch keine Ahnung, du Rotznase!!
… auch noch ein Entführer.
Schon bist du kein Entführer mehr.
… und da schreist du was von Dieb!
Deine Schuld.
… wird es noch nicht in den Nachrichten kommen.
Na ja… Selbst wenn deine Eltern der Polizei schon Bescheid gesagt haben…
Weil du ein Dieb bist!
ich hab das vorher noch nie gemacht! ist doch egal!! Ein Dieb ist ein Dieb!! …
ich war fast fertig mit der Arbeit…
Man weiSS ja nicht, was der Entführer dir dann antun würde.
Das war das erste Mal!!
Man soll den Täter ja nicht reizen. Der Täter bist doch du!
Argh…
Auch das noch!
jetzt eine Kerze… Sie muss beim Zeug für den Hausaltar sein…
Wo sind die Streichhölzer?!
Mist! Stromausfall!!
Wahrscheinlich dieser Hüftschwinger, Presley oder so!!
Pft! ist ja Englisch! ich versteh kein Wort!
ich bin verrückt danach!
Presley läuft die ganze Zeit, aber dieses Lied nur selten!! ich will wissen, wie es heisst und wer das singt!!
Der Luftdruck hat sich auf bis zu 900 Millibar erhöht, die Windgeschwindigkeit beträgt 60 Meter pro Sekunde…
Der Taifun Nummer 15 befindet sich circa 15 km südsüdwestlich von Shionomisaki und bewegt sich nach Nordost.
ist denn keiner da? Hilfe! Ein Dieeeb!!
D i e e e e b !!
KAPITEL 2 Zwei im Sturm
Aber du läufst ständig vorneweg!
Frauen – speziell kleine Mädchen — sollen hinter den Männern zurückbleiben!
Und dann mache ich bei Olympia…
N…Nein, du musst nicht extra zurückbleiben, ich gewinne anständig!
... den ersten Platz − für Japan!!
Da heult etwas… wie ein Tier…
Dummchen… ich bin der, der hier heult.
ihr habt überhaupt kein Geld?!
Und ihr habt kein Geld…
Schon wieder… Was denn?
Du bist keine Arzttochter…
Nnng! Nnng!
Nnng! Nnng!
Wir haben kein Telefon und auch gar kein Geld!!
Mein Vater ist kein Arzt!! ich war bloSS beim Arzt, um ihn zu holen!
Du bist nicht Doktor Tanakas Tochter?
Nein, ich bin Asa.
Dann kannst du etwas essen.
Nnng! Nnng!
ihr habt eine Menge Geld!!
Hä?! ihr habt kein Telefon?
…Verrätst du mir die Telefonnummer deiner Familie.
Das kann nicht sein! Dein Vater ist Arzt!
Aber zuerst
Hast du Hunger?
Hier sind Reisbällchen.
K n i r s ch FF ii i u h
Die Oma aus der Eckkneipe hat sie gemacht.
ich konnte nichts kochen, weil du mir ja ordentlich in die Hand gebissen hast.
F i U U U H
K n i r s ch
K n a r z
ich auch!
Nehmt euch selbst!
Mehr!!
ich muss jetzt los zu Frau Yoshioka, nachsehen wie es Mama geht. jawoooohl, Yayoi!
Es ist kein Reis mehr da!!
Und wenn ihr fertig seid, räumt ihr den Tisch ab!
Habt ihr gut zugehört?!!
Essen !!
Wenn du das Haus jetzt komplett zunagelst, kommst du nicht mehr rein!!
Papa!!
Was denn?
Ach ja…
Das stimmt
Du musst die letzten Bretter von innen anbringen!
Also, sind alle im Haus?
jaaaaa!
Komm schnell, Papa! Sonst kriegst du kein Essen mehr!
Natürlich! ihr seid alle da, was?
o o o o K a n g K a n g K a n gKang
Meine Brüder und mein Vater warten auf dem KomakiSportplatz auf mich. Also versuch nicht…
ja, aber nur weil du mitten im Lauf nach Hause gegangen bist, um daheim zu helfen. Wenn mein Vater und meine Brüder das erfahren, gibt’s für mich ein Donnerwetter…
Und dann mache ich bei Olympia…
N…Nein, du musst nicht extra langsamer werden, ich gewinne anständig!
Was denn?! Du warst doch der Sieger!
Aber du läufst ständig vorneweg!
Beim Langstreckenlauf letztes jahr hast du mich auch überholt!!
Frauen –speziell kleine Mädchen — sollen hinter den Männern zurückbleiben!
… den ersten Platz – für japan!!
Äh, n… nein, jetzt übertreibst du ein bisschen…
Stell dir vor, wie wir uns alle freuen, wenn du eine Goldmedaille gewinnst!
Das passiert nicht jedem…
ja, das ist riesig! Du bist unser aller Hoffnung!
Hm?
Du… Du gehst noch zur Grundschule…
Wie kannst du mich einfach so überholen?! ich bin Mittelschüler und trainiere jeden Tag!!
Hä?! Na klar!
Hoffnung?
Uff, wenigstens du kennst mich, Shota...
Hey, Asa!
Leute zu haben, die auf einen zählen, das ist doch was!
Ha! Nee, versetz dich mal in meine Lage!
Das ist ja toll, Shota!
A…A… Asa!!
Shota, du läufst sogar bei so einem Sturm?
Du machst uns alle glücklich, Shota! Wie schön!
Darum will mein Vater unbedingt, dass ich an der Olympiade teilnehme!! Du bist seine Hoffnung.
in fünf jahren sollen die Olympischen Spiele in Tokyo sein. Da muss ich unbedingt dabei sein!
jetzt stör mich nicht beim Training! Hff! Hff!
Aber wegen dem Krieg und so konnten sie sich ihren Olympiatraum nicht erfüllen.
Meine beiden groSSen Brüder sind Marathon gelaufen, wie unser Vater.
Hff!
Hff!
Man könnte denken, da hat jemand geheult…
o o o o G r o o o
ich muss schnell nach Hause! Wir bekommen ein Baby!
Hat der Blödmann wirklich den Sturm ausgelöst, oder was?!
Aber ich mag nur Yujiros* Lieder.
»ich warte für immer auf diiich…«
*
Psst!
WeiSSt du, wie es heisst und wer es singt?
Keine Ahnung!! ich habe gerade ’nen neuen Sender gesucht, weil ich die Taifun-Meldungen satthatte, und da lief dieses Lied.
war ein populärer Sänger in den 1950er- und 1960er-Jahren.
Sei still! Sonst kann ich das Lied nicht hören!! Sie hörten
»ich bin der, der den Sturm auslöst!!«
»ich bin ein Schlagzeuger, ein wilder Schlagzeuger...«
Tut mir leid… Hm? Was?
He, was machst du da mitten auf der Strasse?
Blödmann!!
Deine Schuld, dass ich nicht hören konnte, wer das singt!
Beim Putzen und Waschen singe ich es. Dann geht alles viel schneller!
Dieses Lied… ja, das ist es!!
ich habe es nur einmal im Radio gehört, aber seitdem immer im Kopf.
ich liebe dieses Lied!
Ei love yuhu ... Because I love you
Hä? Was ist damit?
Yujiro IshiharaNur ich heisse Asa…
ich habe ja viele Geschwister, aber das ist doch kein Grund…
Los, steig auf, Mutsuki!
Man könnte glauben, dass mich überhaupt keiner bemerkt…
Yayoi, Satsuki, Mutsuki… alle meine Schwestern haben hübsche Namen…
Meine Eltern wollten sich wohl nicht mehr weiter die Köpfe zerbrechen…
Asa = Morgen
Weil ich am Morgen geboren bin…
Fahren Sie besser allein! ich halte Sie nur auf.
Hah… endlich.
Äh…
Schon gut!
Hier, zieh die an. Du wirst ja pitschnass… Danke.
ich bin Asa!!
Asa…? ist Asa schon so gross?!
Gut, aber komm auch schnell nach Hause. Der Taifun… Und pass auf, es gab hier wieder eine Entführung… jaja, beeilen Sie sich!
... und Asa? Das sagt mir nichts…
Deine Mutter wird das schon schaffen, ist ja ein alter Hase...
Aber der Taifun...
Es gibt…
j… jawohl …!
… Yayoi, Satsuki, Mutsuki …
Nein! Sie müssen zu ihr!!
Doktooor!!
Geburtsklinik Tanaka
Was?! Sie liegt schon wieder in den Wehen?

im Moment habe ich andere Sorgen!
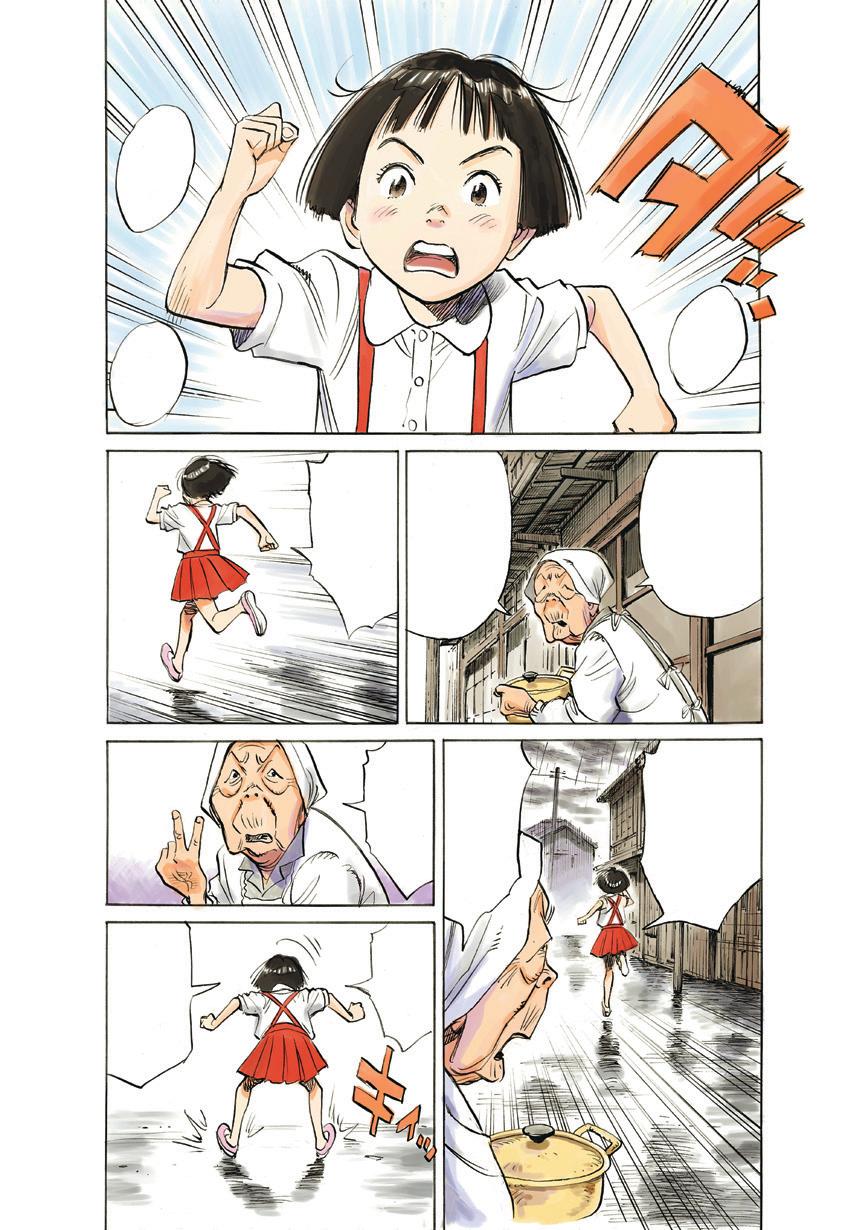
Lauf schnell nach Hause! Der Taifun kommt!
Satsuki, wo willst du hin?!
Hä?! Schon wieder?! Das wievielte ist es?!
Und mein Name ... … ist nicht Satsuki
Meine Mutter bekommt ein Baby!!
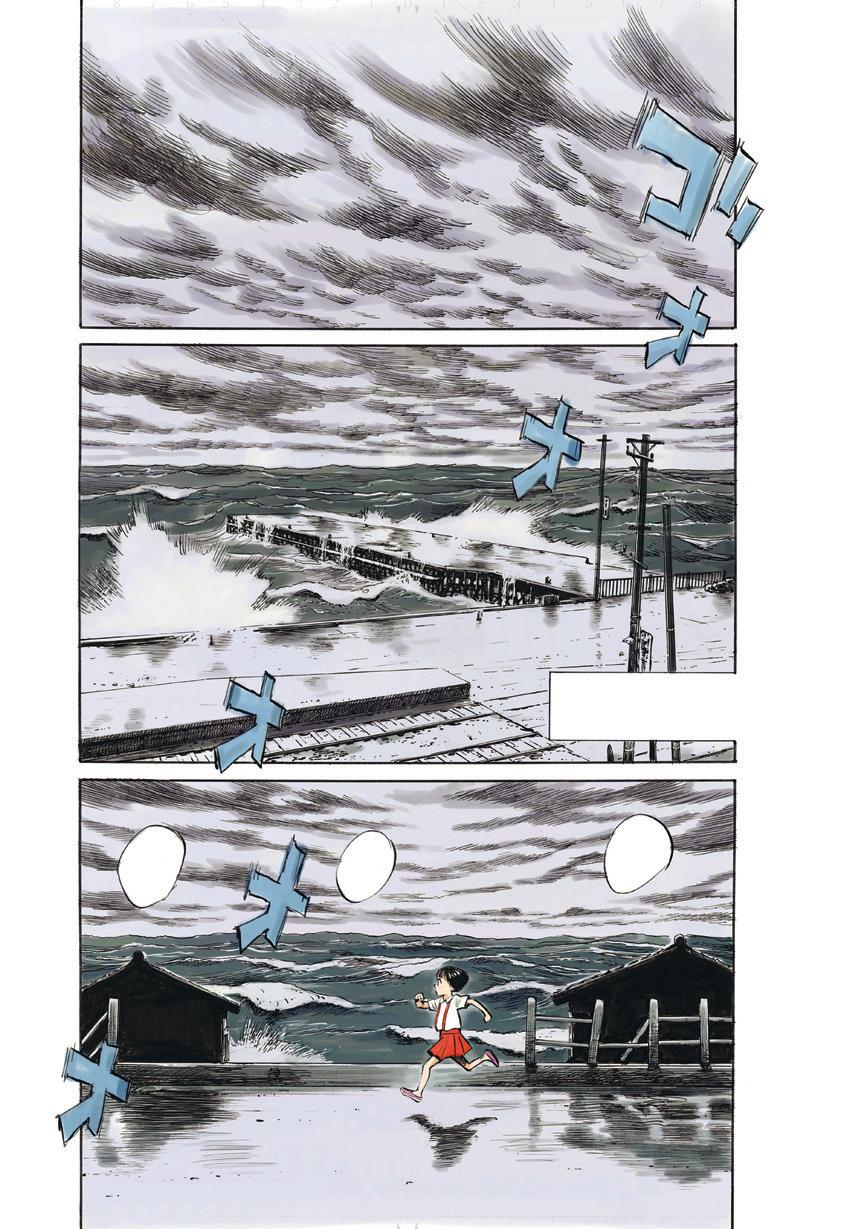 1959, AM HAFEN VON NAGOYA…
Hff!
Hff!
1959, AM HAFEN VON NAGOYA…
Hff!
Hff!
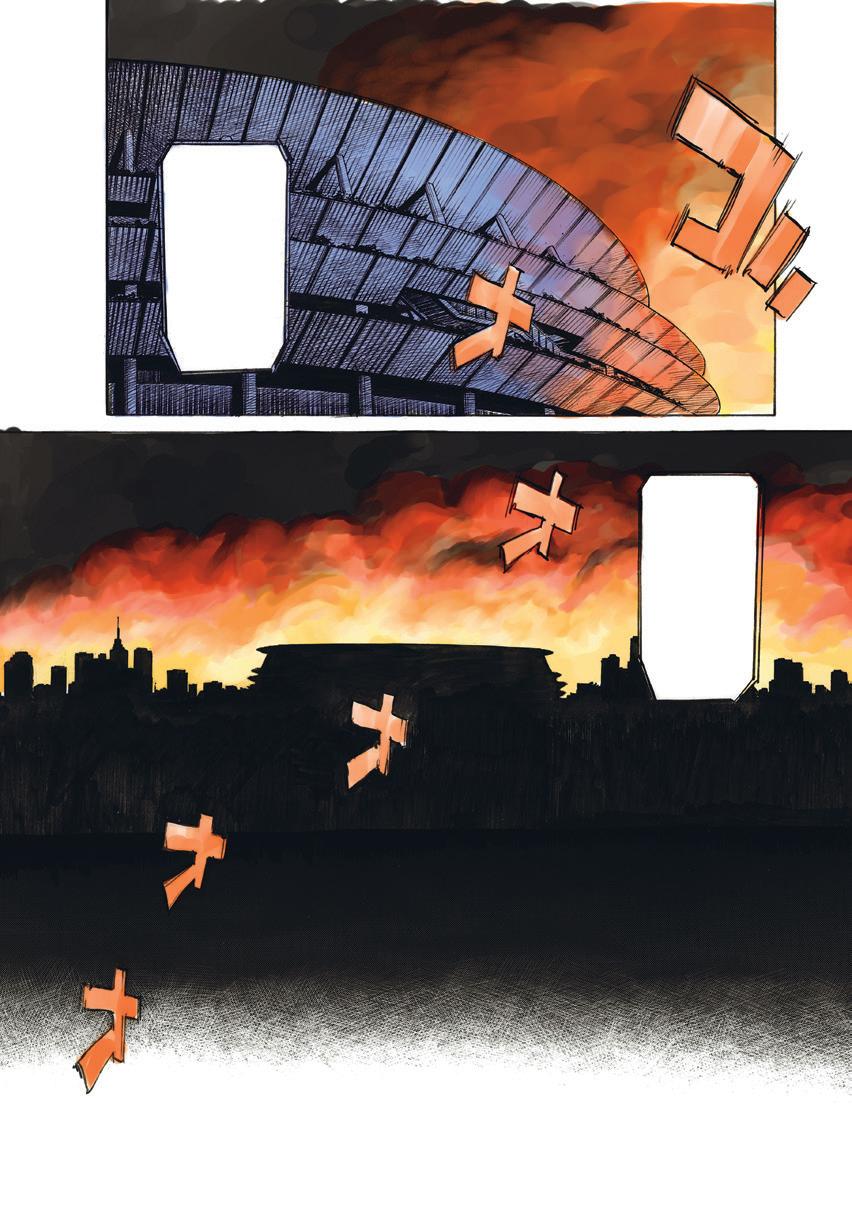
Wenn das Feuer sich nicht aufhalten lässt… … wird es selbst das neue Olympiastadion ...
O O O O m
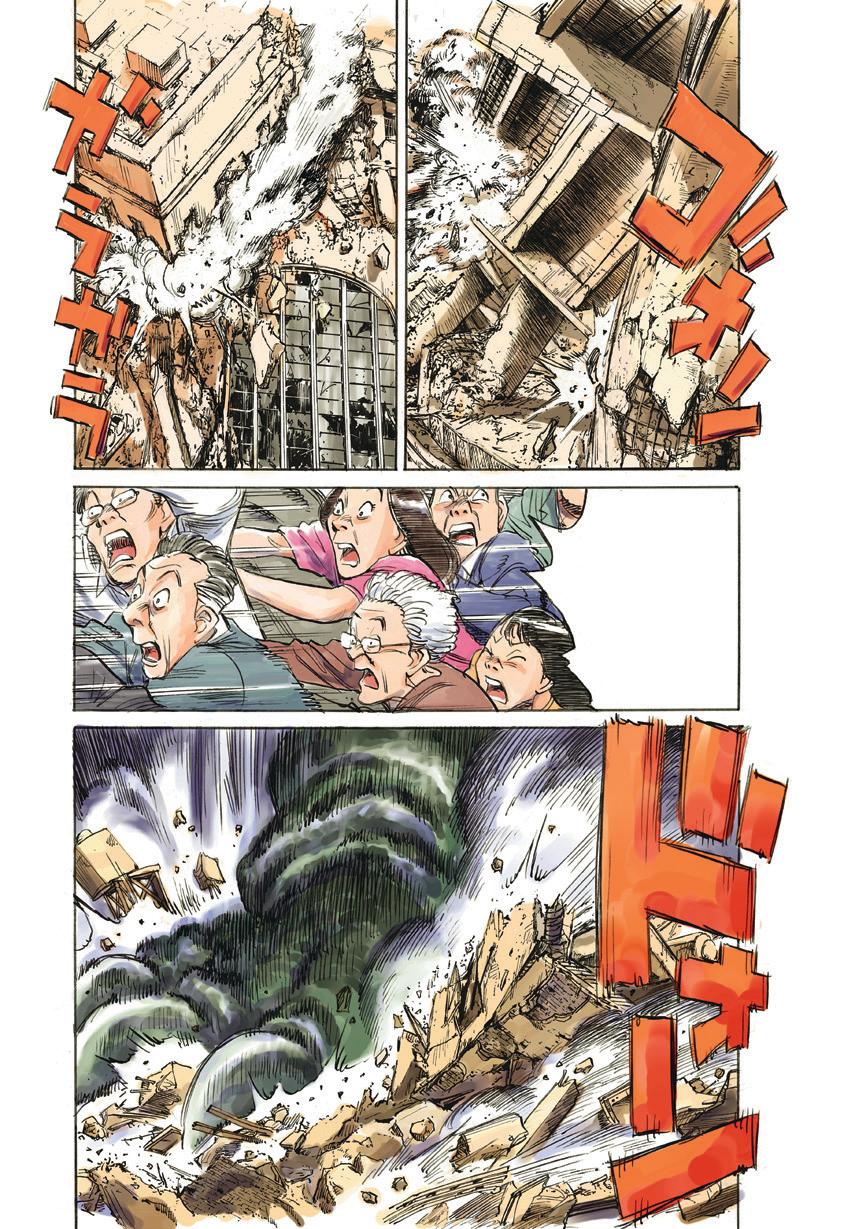
Die Geschichte einer Generation…
D O OM O A AA AH!! A W K RA W U M U MM
… vom Ende des Krieges bis zum heutigen Tag.
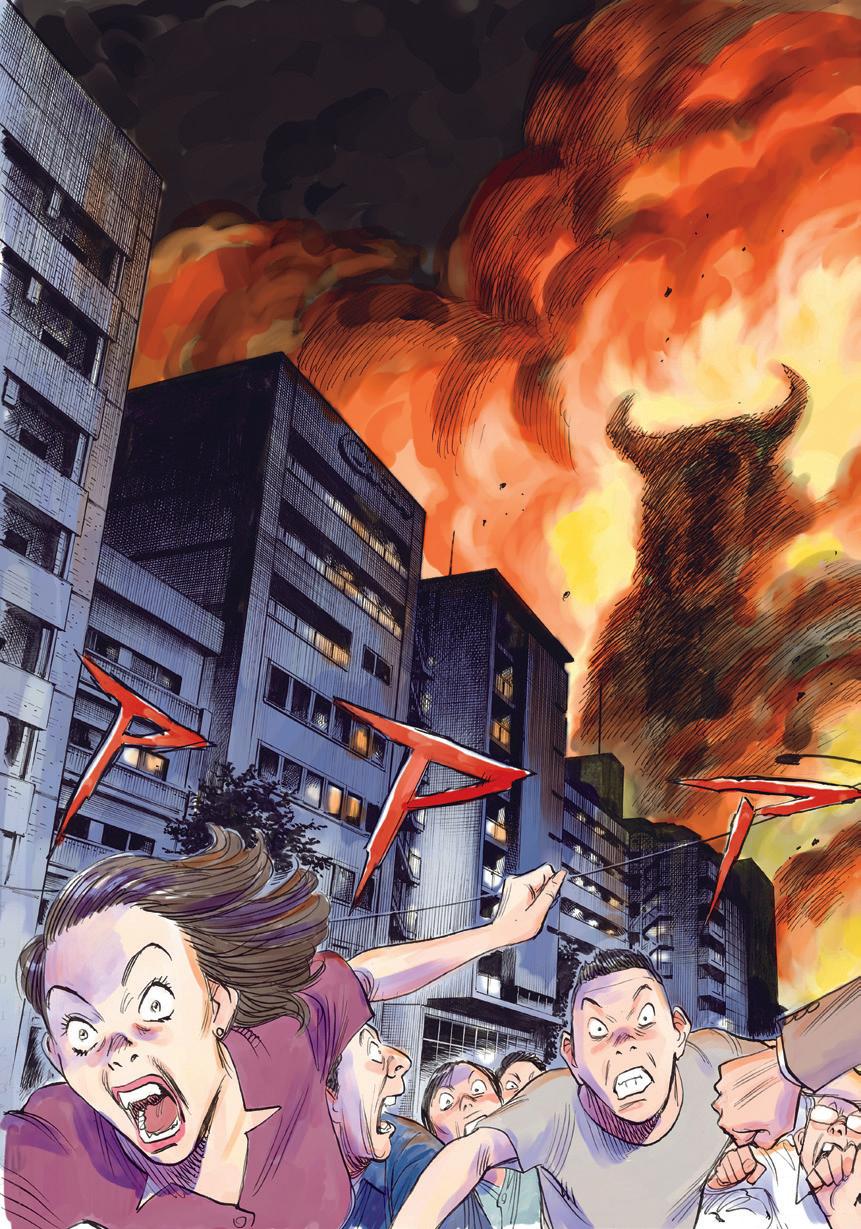
… eines mutigen Mädchens. A AUUUUUUR R G GH
Dies ist die Lebensgeschichte… A A AA A A H !! A H H AUUUR GH
H

Die Hauptstadt japans wird vom Feuer verschlungen!!

Tokyo steht in Flammen! ist die Stadt noch zu retten? Notevakuierung! Verlassen Sie sofort die Stadt! Ich wiederhole: Verlassen Sie…
OD E R A a h !!
OD E
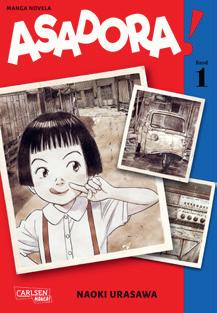
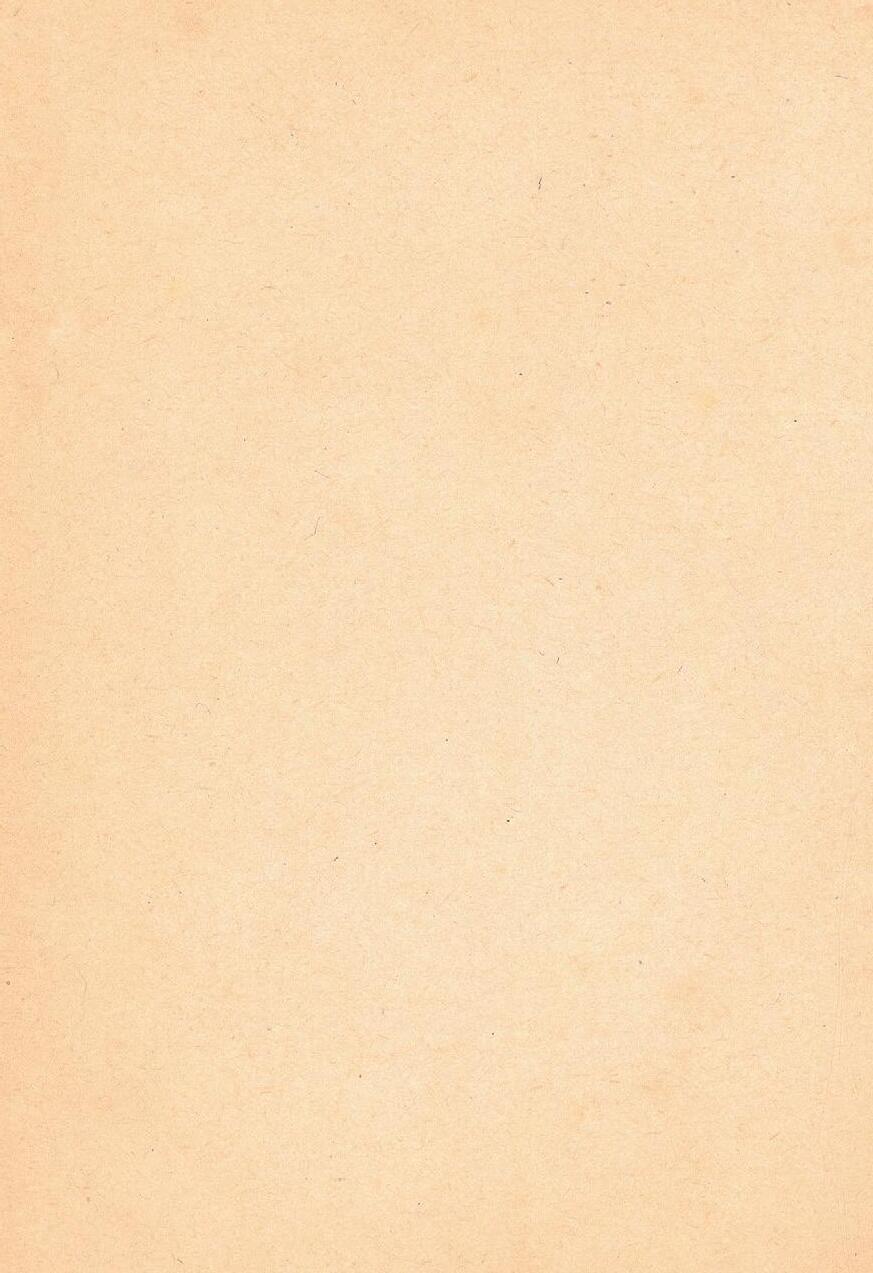

Eine Produktion von Carlsen K im Auftrag von 21/DSW21.
Herausgeber:
Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)
Unternehmenskommunikation
Deggingstraße 40 44141 Dortmund
Verantwortlich:
Frank Fligge (Leitung Unternehmenskommunikation DSW21)
Konzeption und Produktion:
Carlsen K – die Kindermedienagentur der Carlsen Verlag GmbH
Völckersstraße 14–20 22765 Hamburg
www.carlsen-k.de
Leitung Carlsen K: Guido Neuhaus, Chefredaktion: Sina Hahnemann, Redaktion: Meike Beurer, Textchefin: Anke Peterson (FR), Produktionsmanagement: Sabine Kramer
Schlussredaktion: Fabienne Pfeiffer (FR)
Art Direktion: Andreas Blum (FR, blumsbuero.de)
LÖSUNGEN:
S. 35: Hafen-Quiz: 1 A, 2 B, 3 A, 4 C, 5 B, 6 B, 7 B S. 153:
Der Name der Wassernixe ist: TARANEH
Autor*innen (freie Mitarbeit): Senta Best (134-137, 154-157), Stephanie Bley (44-47, 76-81, 102-105), Emma Dickhans (158-163), Alexandra Frank (68-75), Christo Förster (60-66, 170-175), Peter Hesse (54-59, 106-109, 178-181), Petra Klose (142-145), Anke Küpper (10-15, 82-89), Andrea Leim (110-117, 124-133, 190-197), Ole Löding (182189), Anke Peterson (6-9, 90-91, 138-139, 140-141, 164-169, 176-177), Alex Raack (92-95), Thorsten Schwermer (48-53), Sascha Wundes (28-35, 36-39, 118-123)
Fotos: Dominik Asbach (56-57, 196-197), Maks Bley (28-35, 44-47, 76-81, 102-105), Christian Bohnenkamp (102-103), Mareen Meier (3), Sabrina Richmann (82-89, 110-117, 178-181, 182-189, 192-193), Daniel Sadrowski (36-39, 58-59, 170-177), Luisa Schober (158-163), Marcel Stawinoga (164-169), Adobe Stock (4, 10-15, 37, 39, 40-41, 43, 54, 69, 76-77, 80-81, 96-101, 124-132, 142-145, 154-155, 190-197, 198-205), Picture Aliance (128), Unsplash.com (6-9, 60-66, 110-117, 114)
Illustration und Text Comic: Ulf K.
Illustration und Text Schnitzeljagd & Dortmund Quiz: Holga Rosen
Illustration Fernwärme & Wasserfilter: Jan Pieper
Illustrationen Wasserstoff: Sebastian Coenen
Text & Fotos Unterwasser-Spektakel: Franziska Fiolka
Druck:
Drukarnia Interak Sp. z o.o.
Polen