
www.domberg-akademie.de



www.domberg-akademie.de

Krisen meistern, solidarisch handeln
Kirche anders: hinüber Manufaktur
Ein neues Netzwerk für pastorale Ideen und Visionen entsteht
Faszinierendes Filmepos Dune
Was uns ein interreligiöser Blick an Erkenntnis bringt
Widerspruchslösung bei Organspende?
Fragen zu einer spannenden ethischpolitischen Debatte

QR-Code scannen und reinhören!

JETZT ABONNIEREN
www.forum-csr.net/abo Nur 30 € pro Jahr für Studierende nur 20 €
DieEnergiewendegehtvoran
©AdobeStock/rawpixel.com

ÄussereTransformation... …derSchlüsselliegtinder innerenEntwicklung GenussmitVerantwortung Nachhaltigkeitgehtdurch denMagen

› Klimarevolution › Mobilität in die Zukunft › Ressourcen › New Work › Supply Chain › Food for Future › Ethisch investieren › Digitalisierung › Gesellschaft im Aufbruch
Lesen Sie dies und mehr im Entscheidermagazin für nachhaltiges Wirtschaften und CSR
Jetzt für 7,50 € unter www.forum-csr.net/das_magazin auch als E-Magazin und PDF Tel. +49 (0)89 74 66 11 0 Mail abo@forum-csr.net

• Dr. Claudia Pfrang Direktorin der Domberg-Akademie cpfrang@ domberg-akademie.de
VVielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht: Um Sie herum sitzen alle mit Kopfhörern und kein Gespräch ist möglich? Und wenn man jemanden anspricht, dann ist die Person „not amused“. Diese Erfahrung mache ich zum Beispiel immer wieder bei meiner Nichte: Sie taucht in ihre Kopfhörer-Welt ab, nimmt nichts mehr um sich herum wahr und reagiert fast aggressiv, wenn man sie anspricht.
Dies kam mir in den Sinn beim Nachdenken über ein typisches Merkmal unserer derzeitigen Gesellschaft. Viele Menschen befinden sich in ihrer eigenen Bubble und kommen kaum noch mit anderen in Verbindung. Für viele scheint dies der einzige Weg zu sein, um mit eigenen Enttäuschungen, Wut und Überforderung in diesen krisenhaften Zeiten umzugehen. Das „Leben in Echokammern“ führt allerdings zunehmend dazu, dass das Bild vom anderen außerhalb des eigenen Bezugsrahmens schneller von Ressentiments geprägt ist, da eigene Sichtweisen verstärkt und andere „verschluckt“ werden. Wir haben verlernt, wirklich zuzuhören, wirklich zu verstehen.
Als wir unser Saisonthema „In Verbindung gehen. Krisen meistern. Solidarisch handeln“ gewählt haben, wussten wir noch nichts von den nun bald anstehenden Bundestagswahlen, die, wie die Kommunal- und Landtagswahlen in Ostdeutschland zeigen, nichts Gutes ahnen lassen. Was Studien schon vorweggenommen hatten, ist eingetreten: Immer mehr Menschen wählen eine Partei, die Vorurteile nutzt und Feindseligkeit schürt. Dass in Deutschland offene Ablehnung und Abwertung, v.a. gegen ausländische Mitbürger:innen, immer stärker werden, belegt die Autoritarismus-Studie der Universität Leipzig: Ausländerfeindlichkeit hat sich „zu einem bundesweit geteilten Ressentiment entwickelt“.
Umso wichtiger ist es, dass sich alle Parteien, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, gegen diese Tendenzen stellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Ressentiments und Polarisierung unsere demokratische Kultur untergraben. Die Autoritarismus-Studie warnt eindringlich: Die bloße Rede über Krisen führt oft eher zur Verdrängung als zur Lösung. Es braucht eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die es wagen, wirklich zuzuhören und mit Andersdenkenden in Verbindung zu gehen. Mit unserem Saisonthema möchten wir genau hinschauen: Was ist los in unserer Gesellschaft? Wie kommen wir in Verbindung? Wie schaffen wir Netzwerke über unsere eigene Bubble hinaus? Wie können wir gemeinsam Krisen meistern? (mehr dazu in unseren Coverstories)
Mut zu diesem Weg geben gute Nachrichten, so z.B. Ergebnisse der Shell Jugendstudie aus diesem Jahr: Die Jugend in Deutschland blickt überwiegend positiv und op-

timistisch in die Zukunft. Sie hat erfahren: Eine Krise wie Corona kann gemeistert werden. Doch dazu braucht es starken Zusammenhalt.
Mit unseren Angeboten laden wir Sie ein zum Zuhören und in Beziehung gehen, zum Austausch und Anstoß. Ausprobieren wollen wir auch ein neues Dialog-Format, das Meinungsvielfalt und Perspektivwechsel auf kreative Weise fördert. Blättern Sie in unserem Magazin.
Und auch wir als Team der Domberg-Akademie wollen wieder mit Ihnen in Verbindung gehen, von Ihnen lernen und hören, was Sie bewegt. Wenn Sie möchten, kommen wir gerne in den nächsten Monaten mit Ihnen ins Gespräch, so wie wir es schon während der Corona-Pandemie getan haben (mehr dazu siehe „Über uns“, S. 34). Wir sind überzeugt von der Kraft der Verbindung und des Austausches. Es wird uns näher zusammen- und weiterbringen.
Nehmen wir zuweilen unsere Kopfhörer ab, nehmen wir unsere Umwelt wieder bewusst wahr und kommen wir wieder ins Gespräch, über das, was wir denken, hören und fühlen. Klingt leicht, ist es aber nicht. Dennoch: In Verbindung zu gehen, ist unabdingbar.
Wir wünschen Ihnen immer wieder den Mut dazu! Mögen Sie das neue Jahr im tiefen Vertrauen und der Zuversicht angehen, dass es weitergeht, weil Gott mit uns unterwegs ist und das Unmögliche möglich machen kann.
Ihre



5 WIE WAR‘S?
Rückblick auf das Saisonthema " Heilsversprechen KI" 6
RAUS AUS DER BUBBLE, REIN IN DIE GEMEINSCHAFT
Wie wir den Krisenmodus auflösen 10
DREI FRAGEN ZU VERBUNDENHEIT & SOLIDARITÄT 12
DIE KRAFT DES MITEINANDER Bedeutung von Solidarisierung und Communities 14
UNSERE AKTION ZUR FASTENZEIT 14/15
DIE TOP-VERANSTALTUNGEN ZUM SAISONTHEMA 16
DEMOKRATIE & ETHIK
• Gegen Hysterie
• Widerspruchslösung bei Organspende 18
KOMPETENZZENTRUM
DEMOKRATIE UND MENSCHENWÜRDE
• Radikal-rechte Refugien • Antisemitismus hat viele Facetten 19
DIVERSITÄT
• Interkulturelle Kompetenz und Diversity 20
RELIGION & KIRCHE
• Rückblick Weltsynode • Frauen in der Kirchengeschichte 22
UMWELT & NACHHALTIGKEIT
• Die Zukunft der Care-Arbeit SAISONTHEMA
• Was uns stärkt Bildung in Krisenzeiten braucht Stärke
• Ellen Amman
Ein neues Tagungsprojekt nimmt Fahrt auf


• Klimaaktivismus braucht neue Wege
• Global Citizenship sensibilisiert 24
KULTUR & KREATIVITÄT
• Unser Serientipp • Auf den Spuren starker Frauen 26
PERSÖNLICHKEIT & PÄDAGOGIK
• Individualismus – gibt es das wirklich? • Intuition stärken 28
WERKSTATT ZUKUNFT
Über Mythen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz –Reflexionen zum Saisonthema // von thomas steinforth
Spätestens seit ChatGPT ist die „Künstliche Intelligenz“ in aller Munde. Der Diskurs dazu ist allerdings oft sehr aufgeladen, geprägt von Verheißungen und quasi-religiösen Heilserwartungen einerseits, von Dämonisierungen und Untergansszenarien andererseits. Grund genug für uns, in unserem Saisonthema „Heilsversprechen KI“ die Mythen rund um die KI kritisch zu hinterfragen. Nicht um die immense Bedeutung der KI zu relativieren, sondern um die konkreten Möglichkeiten – Chancen wie Risiken – der KI in den realistischen Blick zu nehmen.
In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschafts- und Technikgeschichte des Deutschen Museums haben wir daher bewusst ganz grundsätzlich gefragt: Was genau ist eigentlich intelligent an der Künstlichen Intelligenz? Was unterscheidet sie von der natürlichen Intelligenz der Menschen? Warum löst sie solche Erwartungen, aber auch solche Ängste aus? Was sagt das aus über die Gesellschaft, in der die KI solche Reaktionen auslöst? Und was sagt es über uns selbst aus?
Für den Soziologen Stefan Selke wird von der Technik und aktuell eben der KI nicht zuletzt deshalb „Trost“ erwartet, weil die Gesellschaft in vielfältiger Weise erschöpft sei. Das wecke z.B. den Wunsch nach einer Technik, die für allumfassende Effizienz sorgt. Die evangelische Theologin Birte Platow zeigte eindrücklich, wie sich in die Narrative zur KI religiöse Motive mischen und dass in unseren Einstellungen gegenüber der KI nicht selten Aspekte aus dem MenschGott-Verhältnis auftauchen. Wie diese Diskurse und Phantasien rund um KI nicht zuletzt von Erzählungen in Literatur und Film geprägt werden, erläuterte anschaulich Nadine Hammele.
Fazit: Die Kooperation zwischen DombergAkademie und dem Forschungsinstitut hat sich bewährt, unterschiedliche Kompetenzen und Perspektiven sind gerade bei einem komplexen Thema wie der KI sehr produktiv. An dieser Stelle eine unbedingte Leseempfehlung: Das kleine, aber gehaltvolle Büchlein unseres Kooperationspartners Rudolf Seising, einem Experten zur Geschichte der KI, trägt den programmatischen Titel „Es denkt nicht .“
In weiteren Online-Veranstaltungen ging es um ausgewählte, sehr unterschiedliche Anwendungsfelder der KI: Bildung, Demokratie, Inklusion oder auch das Handlungsfeld von Predigt und Verkündigung. Wir haben die Chancen und
Risiken erläutert, ethisch, politisch, philosophisch und theologisch reflektiert. Insgesamt zeigte sich auch hier: KI ist wie Technik überhaupt ein Mittel zum Zweck – oder sollte es sein. Wenn der Zweck nicht mehr klar ist oder gar die Technik zum Selbstzweck wird, kann es gefährlich werden. Daher sind ethische Reflexion und gesellschaftliche Verständigung (Was wollen wir mit der Technik? Wie kann sie dem Menschen, einem guten Zusammenleben und einer gerechten Gesellschaft dienlich sein?) bereits im Entwicklungsstadium unabdingbar. Ob das angesichts mächtiger Einzel- und Profitinteressen realistisch ist, wird uns auch weiter beschäftigen. Wie bei jedem Saisonthema haben wir auch diesmal ein biblisches Angebot gestaltet („Die KI bereut nicht – Gott schon“) und im Zuge unserer interreligiösen Angebote eine Veranstaltung zur KI in islamischer Philosophie angeboten. Wieder einmal hat sich bestätigt: Das Aufgreifen aktueller Entwicklungen (in diesem Fall der KI) hilft, religiöse Überzeugungen und Gottesbilder neu zu denken. Zugleich bieten die z.T. sehr alten „Schätze“ verschiedener religiöser Traditionen ein großes Potential, heutige Herausforderungen in einem ungewohnten Licht zu sehen und vielleicht besser zu verstehen. Auch bei den kommenden Saisonthemen werden wir daher biblische und interreligiöse Angebote gestalten.
Auch dieses Saisonthema soll „nur“ ein Auftakt sein. Unser Fokus wird dabei weniger auf der Vermittlung konkreter KI-Kompetenzen liegen – so wichtig und unerlässlich diese natürlich ist. Wir wollen nicht zuletzt die „großen Fragen“ stellen, die von praktischer Relevanz sind!
So mag es etwa aus prinzipiellen Gründen unrealistisch sein, „denkende Maschinen“ zu erschaffen. Und doch kann das Streben danach dazu führen, dass wir die Maschine unter der Hand zum Ideal des Mensch-Seins erheben – mit fatalen Konsequenzen!
Daher nehmen wir nicht zuletzt diese Frage mit: Wie verstehen wir unser Mensch-Sein (auch in der Perspektive des Glaubens)? Und was folgt daraus für die Gestaltung einer menschendienlichen Technik? •

SEPTEMBER 2024 BIS JANUAR 2025

Prof. Stefan Selke erläuterte den „Fetisch Effizienz“ anhand des Films „Modern Times“.

Die Veranstaltungen im Deutschen Museum wurden mit thematischen Führungen in der Robotik-Ausstellung kombiniert.
BUCHTIPP
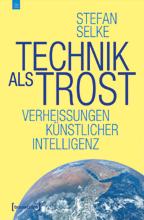
Stefan Selke Technik als Trost: Verheißungen Künstlicher Intelligenz transcript, 2023 EUR 69,97

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung


Krisenmodus – ein Wort, das die Gesellschaft für deutsche Sprache 2023 nicht umsonst zum Wort des Jahres gewählt hat. Man ist im „Krisenmodus“, so empfinden es jedenfalls viele
Menschen um mich herum und fühlen sich überfordert. // von claudia pfrang
Angesichts der aktuellen Krisen überrascht es und macht zugleich Mut, was die neueste Shell Jugendstudie zu Tage förderte: Die Jugendlichen blicken überwiegend optimistisch in die Zukunft. Das hatten auch die Herausgeber:innen der 19. Shell Jugendstudie nicht erwartet, die seit 1953 Einstellungen und Werte von Jugendlichen – diesmal waren es 2509 Personen im Alter von 14 bis 25 Jahren – in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. „86% vertrauen darauf, dass eine bessere Welt möglich ist“, so die Studienverantwortlichen, „und 70% sind sich sicher, dass die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse durch eigenes Engagement beeinflussbar sind“ (Shell Studie Zusammenfassung, 17). Die Corona-Krise erlebten die Jugendlichen trotz aller Einschränkungen, die sie hart trafen, als „eine beispielhafte Erfahrung, wie eine Gesellschaft plötzliche Krisensituationen bewältigen kann“ (ebd., 31). 75% sind mit der Demokratie zufrieden, auch das Vertrauen in die zentralen Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht und die Polizei ist genauso wie das politische Interesse angestiegen, 55% bezeichnen sich als politisch interessiert.
Optimistisch, pragmatisch, tolerant, nicht extremistisch und nicht misstrauisch – so die Charaktereigenschaften der Jugend des Jahres 2024. Forscher:innen haben keinen Trend zu einem Rechtsruck feststellen können. Und dennoch bleibt das Bild ambivalent – wie der Untertitel der Studie nahelegt: „Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt“.
Denn trotz dieser positiven Grundhaltung sind es die Angst vor einem Krieg in Europa, die Sorge um die wirtschaftliche Lage und eine eventuell steigende Armut, die die Jugendlichen umtreiben. Zusätzlich zum Thema Klima-


wandel besorgt sie mit 64% ebenso die wachsende Feindseligkeit der Menschen. Klimawandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt bleiben für alle Jugendlichen ein wichtiges Thema. Aber – und hier deutet sich ein gefährlich werdender Riss an – 55 Prozent sind der Meinung, dass die Maßnahmen des Staates nichts bringen. Außerdem: „Mehr als der Hälfte (56%) fehlt (…) das Vertrauen in die Einsicht ihrer Mitmenschen. Diese Jugendlichen nehmen es für sich so wahr, dass die als »richtig« und auch als »sozial wünschenswert« empfundenen eigenen Sichtweisen immer häufiger von anderen nicht geteilt werden“ (ebd., 17). So befürchtet ein Teil der jungen Menschen eine sich vertiefende Spaltung der Gesellschaft angesichts empfundener wachsender Armut und sinkender Lebensqualität (ebd., 31). Angst vor Krieg, Sorge vor zukünftig weniger Lebensqualität und bei vielen auch um den Arbeitsplatz angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage in Deutschland: Das ist die aktuelle Grundsorge vieler Menschen, mit der sich nicht nur Jugendliche überfordert fühlen. Und gleichzeitig geben die Antworten der jungen Menschen in der Studie eine Spur an, die uns weiterführen kann: Zuversicht, ihre Zukunft meistern zu können, geben vielen „die Ressourcen, die sie in sich selbst und in ihrem sozialen Nahbereich finden“ (ebd., 31f).
Für sich
In diesen krisenhaften Zeiten und angesichts des drohenden Verlusts von Sicherheit, Wohlstand und Ordnung, brechen nicht umsonst bei vielen Menschen tiefere Fragen auf: Was trägt und hält, wenn alles brüchig wird? Was zählt in meinem Leben? Wo finde ich Sinn und Orientierung?

Viktor Frankl, Psychiater und Begründer der Logotherapie, fand heraus, dass Menschen, die eine Sinn-Perspektive und tragende Hoffnung für sich haben, nicht nur seelisch, sondern auch körperlich widerstandsfähiger sind. Dies ist wissenschaftlich mittlerweile nicht nur für Extremsituationen bestätigt.
Menschen, die ihre Stärken kennen und sich immer wieder vergewissern, was ihnen Halt und Boden unter den Füßen gibt, hinterfragen sich. Sie sind – so eine Studie der University of Waterloo – empathischer und uneigennütziger. Sie sind weniger anfällig für Vorurteile und bereit, die von ihnen abweichenden Sichtweisen ernst zu nehmen. Sie können Spannungen zwischen der Vielfalt von Standpunkten und dem Eintreten für den eigenen Standpunkt, die eigene Überzeugung besser aushalten: Wesensmerkmale für das Leben in einer offenen, vielfältigen, demokratischen Gesellschaft, die besonders da gebraucht werden, wenn es darum geht, für eigene Überzeugungen einzustehen, in Auseinandersetzung zu treten und Konflikte auszutragen.
Konflikte, so kann man in dem Buch „Triggerpunkte“ der Autoren Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser lesen, gehören grundsätzlich zur Demokratie und zu Prozessen des sozialen Wandels. Sie werden aber immer dann gefährlich, wenn sie nicht behandelt und befriedet werden. Dann sind sie so etwas wie „soziale Entzündungsherde“. Dies unterstreichen auch die Forschenden der im November 2024 erschienenen Autoritarismus-Studie der Uni Leipzig, die davor warnt, dass das Reden über Krisen eher zu deren Leugnung als zu deren Anerkennung und Lösung führt.
Laut Mau et al. in „Triggerpunkte“ findet Konfliktbefriedung dann statt, wenn Kompromisse für alle Beteiligten annehmbar und auf Dauer angelegt sind. Eine breite Beteiligung, aber auch faire Aushandlungen müssten dem Prozess zugrunde liegen und ebenso Gerechtigkeitsfragen als grundlegendes Fundament adressiert werden. Doch wie kann das heute gelingen: Breite Beteiligung, faire Aushandlung, um anschlussfähig zu sein an den Alltagssinn für Gerechtigkeit und Angemessenheit?
Als erstes braucht es die Bereitschaft, ohne Vorbehalte mit anderen in Verbindung zu gehen. Durch die wachsende Spaltung ist dieser erste Schritt eine Herausforderung und zugleich eine Gratwanderung. Wo Ressentiments herrschen, wo soziale Verachtung und der Hass durch rechtsradikales Denken dominieren, steht die politische Kultur auf dem Spiel. Die Soziologin Eva Illouz spricht von „undemokratischen Gefühlen“ wie Angst, Abscheu, Ressentiment

In Zeiten von zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und Filterblasen ist der offene Dialog über kontroverse Themen wichtiger denn je. Genau das möchte das innovative Bildungsprojekt „Unbubble“ erreichen.
Die Idee ist denkbar einfach: An öffentlichen Orten wie Märkten oder Kinos kommen Menschen über politische Themen miteinander ins Gespräch. Ohne Vorbereitung, ohne negative Konsequenz und ohne Vorverurteilung. Die Themen und die Stühle (Pro/Kontra/Unentschlossen) werden vorgegeben. Die Moderation führt nur ins Gespräch ein und leitet heraus.
Die Gräben, die sich in unseren Diskursen –oder manchmal nur in unseren Köpfen –auftun, müssen gar nicht sein. Wir haben nur verlernt zu diskutieren und uns gegenseitig zuzuhören.
Mit Themen wie Migrationspolitik, Wirtschaftsformen oder Geschlechtergerechtigkeit spricht „Unbubble“ brandaktuelle gesellschaftliche Debatten an. Das Projekt soll dazu beitragen, den Umgang mit Meinungsvielfalt und Konflikten in der Demokratie zu stärken – durch ein Format, das Diskussion und Perspektivwechsel auf kreative Weise fördert.
und blindem Patriotismus. Dies führe zu einem Denken in Freund-Feind-Schemata und letztlich zu einer Entzivilisierung der Konfliktaustragung. Vieles, was noch vor kurzem als rassistisch und menschenverachtend galt, ist bis in die Mitte der Gesellschaft sagbar geworden.
Dass in Deutschland offene Ablehnung und Abwertung, v.a. gegen ausländische Mitbürger:innen, immer stärker werden, das belegt die Autoritarismus-Studie: Ausländerfeindlichkeit habe sich „zu einem bundesweit geteilten Ressentiment entwickelt“.
Ressentiments sind keine einheitlichen Gefühlslagen, sondern immer ein Gemisch aus unterschiedlichen Emotionen. Hier vermengen sich eigene Wut und Frustration, Angst vor Unbedeutendheit und ungenügende Anerkennung mit der Geringschätzung oder Abwertung anderer, mit Eifersucht und Neid gegenüber anderen. Um dieser oft damit einhergehenden Verbitterung zu entrinnen und mit diesen negativen Gefühlen weniger allein zu sein, scheint für viele der Weg in die Gruppe der Gleichgesinnten der einzige Ausweg zu sein. Nicht selten wird dabei dieses „Wir“ instrumentalisiert für politische Interessen, in denen nicht die Problemlösung oder das soziale Miteinander im Vordergrund steht, sondern die eigene politische Agenda und klare Eigeninteressen.
Ressentiments seien die gefährlichste Krankheit für die Demokratie, sagte einmal die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury. Wohin das letztlich führt, zeigt die verfahrene politische Situation in den USA aufs Deutlichste.
So hat der Chefredakteur der ZEIT, Giovanni Di Lorenzo, im Nachgang zu den US-Wahlen von den demokratischen Parteien gefordert, dass sie, um das Erstarken populistischer Parteien nicht weiter zu fördern, jene Stimmungen und Probleme wahrnehmen müssen, „die Menschen erst wütend machen und dann radikalisieren“ (Zeit 47/2024). Hier besteht angesichts des Erstarkens radikaler Parteien und der bevorstehenden Bundestagswahlen dringender Handlungsbedarf. Denn, so ist Di Lorenzo zuzustimmen, es gibt irgendwann „einen Kipppunkt, an dem diese politischen Kräfte nur noch schwer zu bekämpfen sind. Dann finden auch ihre sogenannten Informationskanäle immer mehr Gefolgschaft. Plötzlich gibt es omnipotente Unterstützer, die sich nicht mehr schämen, weil sie keinen Reputations- oder wirtschaftlichen Schaden mehr befürchten müssen, im Gegenteil. Das ist dann die Stunde der Opportunisten vom Schlage eines Elon Musk. Aus großer Spaltung wächst nur noch tiefere Spaltung“ (Zeit 47/2024). Ist dieser Kipppunkt nicht schon erreicht, ist kritisch anzufragen.
Raus aus der Blase, rein in den Austausch
Den von Di Lorenzo genannten Kipppunkt vor Augen sind dringend eine ganze Reihe an entschlossenen Menschen aus der gesamten Zivilgesellschaft vonnöten, die es wagen, wirklich zuzuhören und mit Andersdenkenden in Verbindung zu gehen. Um zu neuen Praktiken des Zusammenlebens und der Verbundenheit zu kommen, brauche es, laut „Triggerpunkte“, eine ganze Bandbreite an Akteuren, um Vorbehalte abzubauen und die kulturellen Repertoires zur




Aleida Assmann/Jan Assmann Gemeinsinn. Der sechste, soziale Sinn Verlag C.H. Beck 2024 EUR 69,97
Steffen Mau, Thomas Lux, Linus Westheuser Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft edition surkamp 2023 EUR 37,99
Christian Boeser Streit/Förderer. Warum wir sie brauchen. Wie Sie einer werden Verlag Klemm+Oelschläger 2023 EUR 22,00

Thematisierung sozialer Ungleichwertigkeit zu verändern. Es bedürfe sozialer Interaktionskontexte, über die sich kulturelle Veränderungen und das Miteinander des Unterschiedlichen allmählich etablieren, denn ohne diese „Scharniere des gruppenübergreifenden Austausches“, ohne das Wirken der Zivilgesellschaft sei Integration durch Konflikt kaum denkbar.
Wie kann das gehen, stehen doch viele Verantwortliche, gerade auch in der politischen Bildung ratlos vor der Spirale von Polarisierung und Spaltung, die kaum Verständigung möglich macht? Es wird nicht gehen, ohne Menschen, die auf Gemeinschaft vertrauen und den ersten Schritt auf andere zugehen, ohne offenes Interesse und kreative Ideen, die Menschen erst einmal wieder zusammenbringen – und ich spreche noch nicht davon, dass sie schon an einem Tisch sitzen.
Mittlerweile werden viele „Unbubble-Formate“ erprobt. Formate, die helfen sollen, die eigene „Blase“ zu verlassen, in einen Austausch mit Menschen anderer Meinungen, Haltungen und Werte zu kommen. In Hannover lädt beispielsweise das Autor:innenzentrum und das Kulturbüro Hannover zum literarischen Projekt „Out of the Bubble“ ein. Gespräche und Literatur sollen anregen, sich auf Forschungsreise zum je anderen Pol zu begeben, laden ein zu Begegnungen außerhalb der eigenen Komfortzone. Bei Bedarf werden diese Prozesse von Mentor:innen begleitet.
Auch die Domberg-Akademie möchte im nächsten Jahr mit einem Unbubble-Format zu kreativen Begegnungen und Austausch mit Personen mit anderen Meinungen anregen. (vgl. Kasten)
Wie das in einer ganz speziellen Weise sehr sinnenfällig unter besonderen Vorzeichen auch geschehen kann, zeigte der Theologe Massimo Faggioli: Er begann an der Universität Pennsylvania seine Vorlesung nach den US-Wahlen ganz ungewöhnlich, indem er seine Studierenden bat, Brote mitzubringen, sie zu teilen und gemeinsam zu essen. Damit wollte er verdeutlichen: Trotz aller Unterschiede ist es wichtig, aufeinander zuzugehen und das Leben miteinander zu teilen. Hier liegt der Auftrag gerade von uns Christ:innen: Nie die Hoffnung aufgeben, dass es möglich ist, Brücken zu bauen.
Zuhören 2.0
Wenn junge Menschen gefragt werden, was ihre wichtigsten Lebensziele sind, so haben laut Shell Jugendstudie stabile Beziehungen, Freundschaft und Familie mit deutlich über 90% den höchsten Stellenwert. Eine Glücksstudie der Harvard University unterstreicht zudem einmal mehr: Soziale Bindungen sind für Glück und Zufriedenheit wichtiger als Reichtum und Ruhm.
Dabei können wir viel von den Finnen lernen, die nach wie vor zu den glücklichsten Menschen gehören. Der kanadische Ökonom und Mitforschende am Weltglücksreport, John F. Helliwell, betont, dass ein wesentliches Element dafür sei, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die Zufriedenheit wesentlich mit der gleichzeitigen Zufriedenheit anderer zusammenhängt.
Finnisches Glück lässt sich so ins Wort bringen: Vertrauen in Mitmenschen und in den Staat, ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und Chancengleichheit insbesondere bei Bildung und Gesundheitsversorgung. „Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben“, so die finnische Einmütigkeit. Von einer solchen Stimmung sind wir in Deutschland weit entfernt. Grund dafür, so die Psychologin Judith Mangelsdorf, ist die gesunkene mentale Gesundheit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Dem gilt es vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen.
Aleida und Jan Assmann weisen in ihrem Buch „Gemeinsinn. Der sechste, soziale Sinn“ darauf hin, dass die Goldene Regel Quellen in allen Kulturen besitzt. Nennen wir es gesellschaftlicher Zusammenhalt, Gemeinsinn oder Solidarität als Begriffe mit unterschiedlichen Ausgangsund Endpunkten, die „resiliente Demokratie braucht kein Feindbild, aber einen klaren Sinn für das, was Menschen miteinander verbindet und zusammenhält. Sie hat Platz für Streit, Skepsis und Kritik“ (Assmann, 227). Eine starke Demokratie braucht Engagement und Gemeinsinn, die Bearbeitung realer sozio-ökonomischer Probleme, Menschen, die ermutigen und neue Initiativen wagen, Menschen, die ihre Komfortzone verlassen und in Verbindung gehen. Menschen, deren Kompass die unveräußerliche Menschenwürde ist. •
Ein wichtiger Baustein ist das Zuhören. Auch hier stehen wir wieder vor einem Dilemma: Wie geht zuhören und präsent sein beim anderen, wenn das, was man hört, so gar nicht mit der eigenen Sichtweise oder den eigenen Werten übereinstimmt? Wie geht es, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, ohne dass das Gespräch seine friedliche Atmosphäre verliert oder das gegenseitige Verstehen gefährdet wird? Wie damit umgehen, wenn die eigenen Worte auf taube Ohren stoßen? Der neuseeländische Psychologe David Grove hat in den 1980er Jahren eine Fragesprache entwickelt, die „Clean Language“-Methode, die neue Zugänge zum Zuhören eröffnet. Wichtig ist es, so sein Konzept, mit dem Hören und der Wahrnehmung zu beginnen und zwischen dem, was bei der hörenden Person ankommt, und dem, was diese erwidert, einen sogenannten „goldenen Raum“ entstehen zu lassen. In diesem Raum kann man mit hoher Sensibilität für die eigenen Gefühle unterscheiden zwischen dem, was das Wort bei einem selbst auslöst und den eigenen Annahmen, und dem, was das Gegenüber wirklich meint. Daher sind in Unbubble-Formaten immer wieder Moderator:innen wichtig, die unterscheiden können zwischen dem, was das Gesagte auslöst und den Inhalten des Gesagten.

dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie

„Was bedeutet es, in einem nervösen Land zu leben?“

Dr. Christian Boeser arbeitet am Lehrstuhl Pädagogik der Universität Augsburg. Er leitet das Netzwerk Politische Bildung Bayern, ist Initiator der Langen Nacht der Demokratie und Autor des Buches „Streitförderer“.
WWo erleben Sie Menschen überfordert und wie können Menschen heute gestärkt werden? Als der Philosoph Jürgen Wiebicke im Sommer 2015 durch Deutschland wandert und das Gespräch mit Menschen sucht, die ihm zufällig begegnen, beschreibt er unser Land als „nervöses Land“. Seitdem ist unser Land noch weitaus nervöser geworden. Als Beispiele lassen sich unter anderem nennen: die Corona-Pandemie, während der Freundschaften zu Bruch gingen; die Aktionen der Letzten Generation, als sich Klimaschutzaktivisten auf der Straße festklebten und von wütenden Autofahrern unter Beifall mit dem Inhalt einer Wasserflasche übergossen oder gar verprügelt wurden; der Krieg Russlands in der Ukraine und die Diskussion in Deutschland über Waffenlieferungen, bei der Andersdenkende als Kriegstreiber oder Putinversteher bezeichnet werden; der terroristische Angriff der Hamas auf Israel mit der darauf folgenden Eskalationsspirale und einer Zunahme antisemitischer Übergriffe in Deutschland sowie eine immer feindseliger geführte Diskussion über Einwanderung und Integration. Was bedeutet es, in einem nervösen Land zu leben? Nervosität meint eine innere Unruhe, eine Verringerung oder den Verlust von Gelassenheit. Nervosität ist ein Zustand gesteigerter Reizbarkeit, die zu schneller Erschöpfung führt. Hier müssen wir ansetzen.

Was bedeutet „Verbundenheit“ für Sie, und welche Herausforderungen stehen ihr in der heutigen, oft polarisierten Gesellschaft gegenüber? Die Ärztin und Journalistin Gilda Sahebi fordert im August 2024 „die Verbundenheit untereinander zu erkennen und sich nicht durch das blenden zu lassen, was Menschen vermeintlich trennt.“ Weiter schreibt Sahebi: „Hört man zu, welche Erzählungen den deutschen Wahlkampf dominieren, möchte man sich derweil die Ohren zuhalten. Bürgergeld: faul gegen fleißig. Migration: Deutsche gegen Ausländer. Krieg: Friedensliebende gegen Kriegstreiber. Gendern: Woke gegen Normale. Klima: Autofahrer gegen Autogegner. Keine einzige dieser spaltenden Erzählungen ist wahr.“ Tatsächlich gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor viel Wertschätzung für Demokratie im Allgemeinen und für unsere liberale Demokratie im Besonderen. Dessen sollten wir uns bewusst sein.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte, um eine Kultur der Solidarität und des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft zu fördern? Der schon zitierte Philosoph Jürgen Wiebicke schreibt in seinem Buch über seine Wanderung durch Deutschland: „Unserer Gesellschaft fehlt es an Orten der Begegnung für unterschiedliche Milieus und Schichten, es fehlt an Formaten des offenen Diskurses in einer Kultur des Zuhörens und Argumentierens, in der der Hass keine Chance hat.“ Nötig ist eine Balance zwischen Streit, im Sinne einer offenen Auseinandersetzung, und der Akzeptanz von Grenzen. Wenn diese Balance gelingt, kann Streit positive Wirkungen auf individueller, sozialer und gesellschaftlicher Ebene entfalten. Wir sollten Streit als Ausdruck von Wertschätzung verstehen und die positiven Wirkungen des Streitens betonen: Streiten ermöglicht Weiterentwicklung, fördert Kreativität stärkt Beziehungen und hält unsere Gesellschaft zusammen. In dem Projekt STREIT/ FÖRDERER setze ich mich hierfür ein.
„Empathie ist ein gutes Mittel gegen Schwarz-Weiß-Denken“

Marlene Groihofer ist österreichische Journalistin und (Buch-)Autorin. Zuletzt hat sie in Athen ihre Schauspielfähigkeiten trainiert und wieder einmal einen Radio Award in New York gewonnen. Sie ist ein Fan von Bodenständigkeit und Offenheit und kommt gern mit Menschen zusammen.
WWo erleben Sie Menschen überfordert und wie können Menschen heute gestärkt werden? Ich sehe die Menschen beruflich durch zu viele Aufgaben überfordert und privat durch gesellschaftlichen Druck. Ein Problem dabei ist die Digitalisierung. Ob Privatleben oder Arbeit, alles ist zu schnell und zu viel geworden und die mediale Über-Konsumation schadet. Der Mensch hat mit der Digitalisierung etwas Großartiges erfunden, mit dem er nicht umzugehen weiß: Wieso sonst starren wir den ganzen Tag in Screens? Stärken können wir uns nur gegenseitig. Der Mensch ist ein Rudeltier. Wir brauchen einander, und zwar analog. Wir brauchen einander in der körperlichen Berührung. Und wir brauchen die Natur. Der Mensch sitzt alleine in Wohnungen, verkrümmt sich den ganzen Tag vor dem Computer und hat den Bezug zum eigenen Körper, dem der anderen und zur Umgebung verloren. Wir sollten zusammen singen, tanzen und uns gemeinsam auf dem Boden wälzen, atmen, uns mehr umarmen, aufheben, im Kreis wirbeln oder übereinanderrollen. Nicht auf esoterisch-schwindlige Art, sondern ganz simpel und down to earth. Wir leben nur im Kopf. Aber an jedem von uns hängt ein Körper dran, der für ganztägige Bewegung gemacht ist, der über ganz klare Impulse
Was hindert uns so oft daran, „in Verbindung zu gehen“: mit uns selbst, mit anderen, mit der Natur? Wir fragen nach // von kathrin steger-bordon, magdalena falkenhahn und karin hutflötz
Entscheidungen treffen und Weisheiten in sich speichern kann. Wenn wir uns körperlich wahrnehmen und uns unsere Lebensumgebung physisch durch haptisches Erleben zurückerobern, dann kann das stärken.
Was bedeutet „Verbundenheit“ für Sie, und welche Herausforderungen stehen ihr in der heutigen, oft polarisierten Gesellschaft gegenüber? Verbundenheit bedeutet für mich, sich durch die Beziehung zu anderen Menschen, auch durch die Beziehung zu Orten und Dingen, im Leben und auf der Welt verankert zu fühlen. Im engen Kreis und im erweiterten Sinne. Ich kann mich auch dem Oktopus im Ozean verbunden fühlen oder der Fruchtfliege in der Küche. Feinde der Verbundenheit sind Ungerechtigkeiten wie Armut und Machtstrukturen. Polarisiert war die Gesellschaft ganz bestimmt immer schon. Hetzer und Spalter aber können sich heutzutage weltweit per Mausklick vernetzen. Dadurch lässt sich schneller und großflächiger mehr Schaden anrichten.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte, um eine Kultur der Solidarität und des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft zu fördern? Wir sind eine Gesellschaft, in der ständig alles und jeder bewertet wird. Und jeder hat zu allem sofort eine Meinung. Bewertung und Wettbewerb werden uns von klein auf antrainiert. Doch wofür? Weniger bewerten, mehr zuhören, mehr verstehen, das wären Schlüssel zu mehr Solidarität. Denn so funktioniert auch Empathie. Und Empathie ist ein gutes Mittel gegen Schwarz-WeißDenken. Außerdem muss Schluss sein mit der kapitalistischen Lüge, jeder sei für sein eigenes Glück selbst verantwortlich und an einem Scheitern selbst schuld. Es gibt unendlich vieles, das wir nicht selbst in der Hand haben. In 150 Jahren wird kein einziger Mensch, der jetzt gerade lebt, mehr existieren. Wir alle sind nur und jetzt gerade miteinander hier. Wir sind aufeinander angewiesen. Große Schritte für mehr Solidarität würden bedeuten, ein ganzes System umzukrempeln. Ein kleiner ist ein freundliches „Guten Morgen“ an der Supermarktkasse. •
„Es geht um den Weg der liebevollen Annahme“

Christa Middendorf ist Therapeutin für integrative humanistische Verfahren, ausgebildet u.a. in IFS (Systemische Therapie mit der Inneren Familie, R. Schwartz), tiefenpsychologisch fundierter Körperpsychotherapie (Hakomi), Traumatherapie (PITT nach Reddemann), Psychoonkologie (DKG) und Palliative Care für Psychosoziale Berufe, Mitglied im Lehrteam des IIFS-Instituts Heidelberg
Was bedeutet „Verbundenheit“ für Sie, und welche Herausforderungen stehen ihr in der heutigen, oft polarisierten Gesellschaft gegenüber? Verbundenheit erlebe ich, wenn ich aus einer offenen, wertfreien und akzeptierenden Haltung auf mich und andere Menschen schaue. Dann entsteht eine Verbundenheit im „Menschsein“. Polarisierungen entstehen, wenn wir (bzw. innere Persönlichkeitsanteile) in Kategorien, wie „richtig“ und „falsch“, denken, wenn wir urteilen bzw. verurteilen und nicht wirklich aneinander interessiert sind und zuhören. Dann verlieren wir die Verbindung zueinander.
WWo erleben Sie Menschen überfordert und wie können Menschen heute gestärkt werden? Ich arbeite schon viele Jahrzehnte u.a. im Bereich der Onkologie in verschiedenen Kontexten. Zurzeit arbeite ich, neben meiner Lehrtätigkeit und Praxis, auf einer Palliativstation. Dort erlebe ich immer wieder in allen Berufsgruppen eine Überforderung im Umgang mit dem Fortschreiten einer schweren Erkrankung.
Der Angst, Verzweiflung und Hilflosigkeit eines schwer erkrankten Menschen mit Präsenz und Wahrhaftigkeit zu begegnen, fällt vielen Menschen schwer. Es gibt Mechanismen in uns, die Leid, Krankheit und Not von uns fernhalten wollen, durch Verharmlosung, Ausgrenzung: „Mir kann das nicht passieren, ich mache ja alles richtig…“ oder Bewertung: „Selbst Schuld… sie hatte immer so viel Stress…“
Wir Menschen sind alle verwundet. Das Schlimme zu benennen, schafft Verbindung und macht es nicht schlimmer! Benennen befreit aus der Isolation. Sich im Menschsein zu begegnen, sich sehen, mit dem, was ist, ohne zu bewerten, schafft Verbundenheit.
Auch im therapeutischen Feld erlebe ich als Lehrtherapeutin immer wieder, dass der Wunsch sehr groß ist, eine Methode zu erlernen, die möglichst schnell von jeglicher Schwere und Last befreit und Wunden in uns heilt. Wenn wir uns achtsam und mitfühlend unseren Wunden zuwenden, fühlt sich das Verwundete in uns gesehen und angenommen. Und dieses Annehmen und Sehen begleitet uns ein Leben lang. Es geht also weniger um das Loswerden, sondern eher um den Weg der liebevollen Annahme.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte, um eine Kultur der Solidarität und des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft zu fördern? Ein erster wichtiger Schritt ist, zu bemerken, aus welcher inneren Haltung (z.B. kritisch, bewertend oder perfektionistisch) schaue ich auf mich und andere Menschen. Oft verbirgt sich hinter solchen Haltungen Angst, z.B. vor Entwertung, Ausgrenzung, Erniedrigung etc. Wenn ich dem „Ausgegrenzten“, dem „Verletzten“ in mir annehmend, interessiert und wohlwollend begegne, entsteht Vertrauen. So kann ich auch mit anderen Menschen anders in Beziehung sein. Mir scheint es wichtig, als Mensch verletzlich, unwissend, suchend sein zu dürfen und eine Kultur des Annehmens zu entwickeln. Sich auf Begegnung einlassen, bedeutet auch interessiert sein an dem „Anderssein“ und das eigene „Sosein“ nicht zu verleugnen. Annehmen anstatt bewerten! •


Passiert Ihnen das seit einiger Zeit auch immer öfter? Sie wollen ein Anliegen am Telefon klären, aber am anderen Ende der Leitung wartet eine automatische Stimme, eine Maschine, die ihr Ansuchen entgegennimmt.
Zum Abschied wünscht Ihnen die Stimme einen angenehmen Tag. Einen angenehmen Tag? // von magdalena falkenhahn
DDiese Vorstellung hinterlässt bei mir ein Gefühl zwischen Amüsement und Verzweiflung: Eine Maschine simuliert Empathie. Das ist im besten Falle nett gemeint, doch dieser künstliche Akt der Verbundenheit ersetzt kaum, was ein echter menschlicher Austausch erreichen kann. Ist das also die Welt, in der wir leben wollen? Wo ist unser Sinn für wahrhaftige Verbindung hingekommen?
Diese kurze Anekdote verdeutlicht ein urmenschliches Bedürfnis: In Verbindung zu sein. Gesehen zu werden. Welche Kraft das „Gesehen werden“ entwickeln kann, zeigt Marina Abramovićs berühmte Performance „The Artist Is Present“, die vom 14. März bis 31. Mai 2010 im New Yorker Museum of Modern Art stattfand. Bei dieser saß Abramović täglich acht Stunden lang regungslos auf einem Stuhl und blickte stetig wechselnden Besucher: innen in die Augen, die ihr gegenüber Platz nahmen. Durch diese stille, nicht-verbale Begegnung ermöglichte Abramović eine Form des intimen Kontakts, der ohne Worte auskam. Die schlichte Handlung des „Einfach-Daseins“ betonte die Bedeutung von Präsenz und Achtsamkeit im Moment. Durch den intensiven Blick der Künst-

lerin wurden die Teilnehmenden sich ihrer selbst und des anderen gewahr. Viele beschrieben das Erlebnis als tief emotional, einige waren sogar zu Tränen gerührt.
Nehmen wir uns in unserer digitalisierten und individualisierten Gesellschaft trotz aller AchtsamkeitsMantras zu wenig Zeit für echte Verl bindungen? Eine Frage, die sich sicherlich nicht pauschal beantworten lässt. Befragungen wie beispielsweise die des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) weisen – auch beeinflusst durch die Corona-Pandemie –einen erheblichen Anstieg von Einsamkeit auf. Demnach fühlt sich heute jede:r Dritte zwischen 18 und 53 Jahren zumindest teilweise einsam – Tendenz steigend.
Gleichzeitig leben wir in einer Welt multipler Krisen, die uns gesellschaftlich wie persönlich herausfordern. Gerade Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, haben statistisch gesehen ein höheres Risiko, sich politisch oder religiös zu radikalisieren. Zwischenmenschliche Beziehungen, der Zusammenschluss zu Netzwerken sowie Communityarbeit können Schlüssel sein, um persönliche wie gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern und diesen Tendenzen entgegenzuwirken.
Was bei der Kraft eines empathischen Blicks durch ein Gegenüber beginnt (siehe Abramović), potenziert sich in Freundschaftsnetzwerken, Communities und Kollektiven. Wenn Menschen sich zusammenschließen und füreinander da sind, entstehen nicht nur Beziehungen, die Stabilität und Trost spenden, sondern oftmals auch neue Perspektiven und Lösungen. Überfordernde Gefühle lassen sich leichter sortieren, wenn man sie mit jemandem teilt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass soziale Interaktionen Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Endorphine und Oxytocin freisetzen, die positiv auf die Stimmung wirken und Wohlbefinden fördern können.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete vor Kurzem von einer interessanten Studie der University of Virginia, welche die Kraft von Verbundenheit eindrücklich illustriert: Junge Teilnehmende standen mit einem schweren Rucksack vor einem steilen Hügel und sollten einschätzen, wie anstrengend der Aufstieg sein würde. Wenn jemand bei ihnen stand, bewerteten sie die Herausforderung als weniger groß – vor allem, wenn die Begleitung vertraut war. Übertragen auf schwierige Lebenssituationen oder gesellschaftliche Spannungen zeigt sich: Mit einem
nahestehenden Menschen an der Seite erscheint die Welt weniger bedrohlich.
Eine weitere Strategie gegen Ohnmachtsgefühle ist es, Engagement im direkten Umfeld zu finden. Auch wenn man im Großen den Lauf der Dinge nicht ändern kann, so lohnt es sich dennoch, sich dort zu engagieren, wo Veränderung im Kleinen möglich ist. Mit dem persönlichen Verhalten kann man sich für Zusammenhalt und Empathie in der Gesellschaft einsetzen: Angefangen bei einem Lächeln für eine fremde Person, über ein offenes Ohr für eine Person in der Nachbarschaft bis hin zum Engagement in örtlichen Vereinen oder Initiativen. Gerade durch den Zusammenschluss mit Gleichgesinnten kann der Glaube zurückkommen, dass man etwas bewegen kann. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit ist essenziell für das Individuum und stärkt das Prinzip Hoffnung.
Starke Netzwerke und solidarische Gemeinschaften bieten nicht nur Unterstützung in Krisensituationen, son-
Stadtteilzentren und Quartiersarbeit leisten beispielsweise einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und der Entwicklung kultureller Strukturen in Wohnvierteln: Sie bieten Menschen unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status eine Anlaufstelle sowie eine Möglichkeit der Begegnung. Durch niederschwellige Beratungsangebote können Menschen dort Hilfe erhalten z. B. bei der Bewältigung behördlicher Angelegenheiten. Bei kulturellen Veranstaltungen besteht für die Bewohner:innen des Viertels die Möglichkeit, miteinander in Austausch zu kommen und ggf. Ressentiments und Vorurteile abzubauen. Quartiersarbeit setzt zudem stark auf Partizipation und initiiert Prozesse zur gemeinschaftlichen Gestaltung des Viertels. Ob Urban Gardening-Projekte oder die Umgestaltung von Spielplätzen – durch die Beteiligung der Bewohner:innen werden das Verantwortungsgefühl für den Stadtteil und das Gefühl der Selbstwirksamkeit gestärkt. Beteiligung findet jedoch nicht nur in Großstädten mit Stadtteilzent-

dern stärken auch das Vertrauen (in sich und andere) und das Gefühl von Zugehörigkeit. Wenn Menschen füreinander einstehen, fühlen sie sich verantwortlich für die Bedürfnisse anderer und entwickeln eher ein Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und das Gemeinwohl. Dies stärkt den sozialen Zusammenhalt und macht es möglich, auch größeren gesellschaftlichen Herausforderungen mit kollektiver Kraft zu begegnen. Doch Solidarität entsteht nicht von selbst – sie muss bewusst gefördert und gestaltet werden, um Menschen die Kraft zu geben, gemeinsam schwierige Phasen zu bewältigen und aus Krisen heraus gestärkt hervorzugehen.
ren statt. Auch in kleineren Kommunen etablieren sich mehr und mehr Beiräte und Projektgruppen, die die Bürger:innen dazu einladen, die eigene Gemeinde aktiv mitzugestalten. Projekte und Bewegungen entstehen aber auch jenseits institutionalisierter Strukturen. Bei den sogenannten „Graswurzelbewegungen“ engagieren sich Menschen jenseits von Organisationen oder politischen Parteien für ein gesellschaftliches oder politisches Thema. Ausgehend von der Initiative einzelner oder weniger Menschen entstehen somit Netzwerke Gleichgesinnter, die das Ziel verfolgen, gesellschaftliche Veränderungen „von unten“ herbeizuführen. Ein Pa-
radebeispiel für eine der eindrucksvollsten Graswurzelbewegungen der letzten Jahre ist „Fridays for Future“: Der Protest einer einzelnen Schülerin in Schweden – Greta Thunberg – war der Anstoß für die Entwicklung der aktuell größten Klimabewegung der Welt. Dabei wesentlich: Graswurzelbewegungen leben vom Prinzip der Selbstorganisation, direkter Beteiligung und lokalen Netzwerken und stärken dadurch das Vertrauen in gemeinschaftliches Handeln.
Das Prinzip der Selbstorganisation ist auch Grundlage zahlreicher Selbsthilfegruppen. Bei diesen kommen Menschen mit ähnlichen Problemen und Erfahrungen zusammen und tauschen sich aus. Betroffene erleben in diesem Kreis meist ein hohes Maß an Verständnis für die eigene Situation und das Gefühl, mit den eigenen Problemen nicht allein zu sein. Sich als Teil einer Gruppe wahrzunehmen ist ein weiterer positiver Effekt, den Selbsthilfegruppen bewirken können. Sie wirken damit Isolation und Einsamkeit entgegen, welche nicht selten mit persönlichen Krisen einhergehen.
Ob Stadtteilzentren, Graswurzelbewegungen oder Selbsthilfegruppen – diese drei beschriebenen Formen von Community- und Netzwerkarbeit geben nur einen beispielhaften Eindruck davon, welche Kraft das „Miteinander“ entwickeln kann. Gerade angesichts zahlreicher spalterischer Tendenzen und überfordernder Krisen sollten wir uns auf diese Kraft besinnen. Es ist entscheidend, die Welt gemeinsam verstehen zu wollen und sich mit anderen zusammenzuschließen. Denn nur so können wir unsere kollektive Widerstandskraft stärken. Dabei spielt auch Empathie eine essenzielle Rolle. Sie ist eine wichtige Grundlage des Zusammenhalts. Aufgrund ideologisierter Debatten fällt es vielen zunehmend schwer, Empathie für das Gegenüber aufzubringxdennoch sollten wir uns darum bemühen, weil sie die Tür zum gegenseitigen Verstehen offenhält. Empathie ist eine menschliche Superkraft. Setzen wir sie ein! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung


Freundschaften, Gemeinschaften und gemeinsame Rituale geben Halt und Orientierung – nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch im Horizont gesellschaftlicher Herausforderungen. Immer mehr Menschen fühlen sich jedoch einsam und isoliert oder die vorhandenen Beziehungen tragen nicht mehr.
Welche Verbindungen brauche ich, um mich aufgehoben zu fühlen?
Wo erlebe ich Gemeinschaft, und was bedeutet sie für mich? In unserer Aktion möchten wir zum Nachdenken anregen und das Bewusstsein für unsere Beziehungen schärfen.
An sechs Montagen ab dem 10. März 2025 laden wir Sie ein, sich Zeit zu nehmen für Fragen an das Leben, Fragen an Ihr Leben, die wir Ihnen per E-Mail zusenden. Nehmen Sie diese Impulse mit in Ihren Alltag! Wagen Sie Selbstbesinnung!
Registrieren Sie sich dafür bei uns mit einer E-Mail an info@domberg-akademie.de | Stichwort „Fastenaktion“. Dann erhalten Sie die Fragen kostenfrei zugesandt.
Die wöchentlichen Impulse und Fragen während der Fastenzeit haben in den letzten Wochen dazu eingeladen, die Bedeutung der Verbindungen im eigenen Leben zu reflektieren. In unserem zweistündigen OnlineAustausch in der Karwoche stehen nun Gespräche und die gemeinsame Reflexion der Impulse im Zentrum: Welche Eindrücke und Erkenntnisse habe ich gewonnen? Was war hilfreich? Was hat mich überrascht oder irritiert? Was davon nehme ich mit in meinen Alltag?
Lassen Sie uns gemeinsam eine kleine Auszeit nehmen, um die Fastenzeit-Impulse nachwirken zu lassen, zusammen abzuschließen und dadurch gestärkt in den Alltag zurückzukehren.
Wir freuen uns auf einen bereichernden Austausch mit Ihnen!
Online-Austausch zum Abschluss der Fastenzeit-Impulse
Termin Mi, 09.04.2025
Beginn / Ende 19.00 / 21.00 Uhr
Mit Dr. Karin Hutflötz
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 09.04.2025


In Beziehung sein –Zweitägiges
Intensivseminar
Nichts wirkt sich so förderlich auf die mentale Gesundheit aus, wie ein gutes In-Beziehung-sein mit sich selbst und anderen. Wie das geht, zeigt dieser zweitägige Workshop in der Atmosphäre eines achtsamen Miteinanders.
Mit Elementen aus dem IFS (Internal Familiy System Therapy nach R. Schwartz) und aus der Achtsamkeitszentrierten Körperpsychotherapie (Hakomi nach Ron Kurtz)
Termin Sa, 08.02./So, 09.02.2025 Beginn / Ende 10.00 / 17.00 Uhr
Mit Christa Middendorff
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 190,00, Verpflegungspauschale (ohne Mittagessen) EUR 33,00 Ort Missio, Pettenkoferstr. 26-28, 80336 München
Anmeldeschluss Fr, 31.01.2025
Anbahnungen –Krisen – Lösungen: Beziehungsarbeit im Johannesevangelium
Ein biblischer Nachmittag zum Johannesevangelium mit Prof. Dr. Thomas Söding
Wir lesen und interpretieren gemeinsam Beispiel-Geschichten, in denen deutlich wird, wie weit die Radien, wie hart die Brüche und wie hoch die Spannungsbögen jener Glaubensbiographien sind, die der Evangelist imaginiert.
Termin Fr 21.02.2025
Beginn / Ende 17.00 / 20.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Thomas Söding
Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr EUR 15,00, Studierende EUR 9,00
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 19.02.2025

UNSERE ONLINE-REIHE ZUM SAISONTHEMA
Wer gehört dazu?
Aktuelle Situation in der pluralen Gesellschaft
In Kooperation mit Dachauer Forum e.V., der KEB München und Freising „Wer gehört dazu?“
Diese zentrale Frage der pluralen Gesellschaft stellt sich heute noch genauso wie vor 20 Jahren. Zugehörigkeit wird immer noch erkämpft, gewährt, verhindert. Inwieweit diese Bedingungen die Antwort auf die Frage „Wer gehört dazu?“ beeinflussen, wird in diesem Vortrag anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse erläutert und diskutiert.
Termin Mi, 12.02.2025
Beginn / Ende 19.30 / 21.15 Uhr
Mit Friederike Alexander Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 12.02.2025
Zivilcourage in schwierigen Zeiten
Erzähltheater mit Gespräch In Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde und Dekanat Freising
Anlässlich des 80. Todestages von Dietrich Bonhoeffer zeigt die Domberg-Akademie ein packendes biografisches Erzähltheater über diese herausragende Persönlichkeit. Lassen SIe sich mitreißen!
Termin Do, 27.03.2025
Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr
Mit Dr. habil. Rudolf Seising, Prof. Dr. Karoline Reinhardt
Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 15,00, ermäßigt EUR 10,00
Ort Evang.-Luth. Kirchengemeinde Freising, Martin-Luther-Str. 10, 85354 Freising
Anmeldeschluss Mi, 26.03.2025
Gesellschaftlicher Zusammenhalt unter Druck
Soziologische Analysen und Erfahrungen aus der Praxis Wie geht es den Menschen in Deutschland? Wie reagieren Menschen unterschiedlicher Milieus auf gesellschaftliche Transformationen? Welche unterschiedlichen Vorstellungen von Zusammenhalt haben diese und welche Konfliktlinien entstehen dadurch?
Dazu referieren zwei Expert:innen aus der Praxis und zeigen neue Blickwinkel auf.
Termin Do, 13.03.2025
Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr
Mit Dr. Nathalie Grimm, Prof. Dr. Matthias Klosinski, Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Do, 13.03.2025
Verbundenheit leben und erleben
Ein jüdisch-buddhistisches Gespräch
Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Welche Rolle spielen Beziehungen (zu anderen Menschen, zu anderen Geschöpfen, zu Gott und zu mir selbst) für das menschliche Leben? Welche Weise der Verbundenheit und der Gemeinschaft brauchen wir? Zu Fragen dieser Art haben alle Religionen etwas zu sagen.
An diesem Abend bringen wir Perspektiven aus Judentum und Buddhismus in ein interreligiöses Gespräch.
Termin Mo, 07.04.2025
Beginn / Ende 18.00 / 20.00 Uhr
Mit Tsunma Konchok Jinpa Chodrow, Miriam Vynograd
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr kostenfrei –
Spenden erbeten
Ort Careteria, Goethestr. 24, 80336 München
Anmeldeschluss Mi, 02.04.2025
Gemeinsam durch Krisen:
Wie soziale Netzwerke Solidarität stärken
Was sind soziale Netzwerke und wie funktionieren sie? In welcher Weise können sie hilfreich sein für die Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher Krisen?
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Potenzial sozialer Netzwerke interessieren: Fachkräfte aus Bildung und Sozialarbeit, Ehrenamtliche, sowie interessierte Einzelpersonen.
Termin Mo, 24.03.2025 Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Egon Endres, Uschi Weber Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 24.03.2025
Welche Gemeinschaft braucht der Glaube?
Eine inspirierende Suche nach neuen Formen der Verbundenheit
Wir erkunden neue Formen der Gemeinschaft in oder auch jenseits der klassischen Pfarrei und fragen, ob und wie sich diese mit traditionellen Formen produktiv verbinden lassen. Es werden neue Perspektiven eröffnet, in Workshops Erfahrungen ausgetauscht und neue Ansätze zum Handeln gesucht.
Termin Fr, 11.04.2025
Beginn / Ende 16.00 / 20.00 Uhr
Mit Andreas Feige, Johanna Gressung und andere Verantwortlich Viola Kohlberger, Dr. Stephan Mokry, Dr. Claudia Pfrang, Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 10,00, zzgl. Verpflegung EUR 5,00 Ort Kath. Hochschulgemeinde an der LMU, Leopoldstr. 11, 80802 München Anmeldeschluss Di, 08.04.2025
erfahren Sie mehr
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen des Saisonthemas auf unserer Website.

Bildung für alle möglich machen: mit unserem Solidarmodell
Im Solidarmodell kalkuliert die DombergAkademie eine empfohlene Teilnahmegebühr, z.B. EUR 9,00. Um allen Interessierten die Teilnahme an den Angeboten offen zu halten, ist es möglich, die Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.
Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Dies ist frei anwählbar bei der Buchung.

• Plädoyer gegen populistische Hysterie
• Widerspruchslösung: eine schwierige
Abwägung
kommentar
IIn Deutschland tut sich eine wachsende Kluft zwischen politischer Kommunikation und den tatsächlichen gesellschaftlichen Herausforderungen auf.
Insbesondere der Diskurs über Migration zeigt sich von der Realität entkoppelt. Populistische Rhetorik und vereinfachende Narrative dominieren, während faktenbasierte Analysen in den Hintergrund rücken. So wird Migration fast ausschließlich als Bedrohung wahrgenommen. Diese einseitige Perspektive verkennt nicht nur die Komplexität des Phänomens, sondern verhindert auch konkrete Lösungen und die Thematisierung anderer wichtiger Problemlagen.
Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Statt Migration als abstraktes Schreckgespenst zu instrumentalisieren, sollten wir uns den konkreten Aufgaben widmen: Welche Infrastruktur benötigen Kommunen? Wie kann die Arbeit von Ausländerbehörden so reformiert werden, dass Menschen dort mehr Unterstützung erfahren?
Gleichzeitig kommt es darauf an, die abstruse Dominanz des Themas Migration zu durchbrechen und stattdessen die wirklichen Herausforderungen wie Klimakollaps, ökonomische Ungleichheit und Demokratiezersetzung wieder politisch und diskursiv aufzugreifen und anzusprechen.
Damit die populistische Reaktionsweise der Verleugnung, Verdrängung und Projektion nicht weiter verfängt, sind wir alle gefordert, diese Themen zu adressieren und der Hysterie derjenigen, die uns die Migration als die große Bedrohung verkaufen wollen, zu widersprechen. •


kai kallbach ist Projektleiter des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde

eine schwierige abwägung
Rund 8.500 Menschen in Deutschland warten auf eine Organspende – viele vergeblich: Täglich sterben durchschnittlich drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig das benötigte Organ erhalten. Könnte die aktuell wieder kontrovers diskutierte „Widerspruchslösung“ helfen, die Zahl der Organspenden zu erhöhen? Und selbst wenn: Ist sie ethisch vertretbar? // fragt thomas steinforth
In Deutschland gilt aktuell die Entscheidungslösung: Organe dürfen nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, werden die Angehörigen nach einer Entscheidung gefragt. Obwohl die Mehrzahl der Menschen laut Umfragen der Organspende gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt ist, kommt es jedoch selten zur tatsächlichen Zustimmung: Viel zu wenige Menschen haben einen Spenderausweis oder dokumentieren ihre Zustimmung auf anderem Wege. Und die Angehörigen tendieren im Zweifelsfall eher zum Nein.
Die in vielen Ländern geltende Widerspruchslösung dagegen wertet bereits Schweigen als Zustimmung: Wer
einer Organentnahme nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widerspricht, habe sich de facto dazu bereit erklärt. Damit – so eine naheliegende Vermutung – könnte man die Zahl der Organspenden deutlich steigern, damit Leiden verringern und unnötiges Sterben verhindern. Dennoch ist ein ähnlicher Vorstoß zur Widerspruchslösung im Jahr 2020 gescheitert. Vor allem zwei Fragen werden kontrovers diskutiert:
. Ist die Widerspruchslösung zielführend – erhalten dann tatsächlich deutlich mehr Menschen ein Spenderorgan? Ländervergleiche zeigen, dass sie zwar einen wichtigen Beitrag leisten kann (wie etwa in Spanien mit einer viermal höheren Spenderquote), dass es aber keinen automatischen Zusam-
Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Demokratie & Ethik

menhang gibt. Andere Faktoren spielten ebenfalls eine wichtige Rolle, etwa eine alle Bevölkerungsgruppen sensibilisierende Information sowie organisatorische Regelungen und Anreizstrukturen im Gesundheitssystem. Auch die Medizinethikerin Christiane Woopen räumt ein: „Ganz genau kann man nicht wissen, inwieweit eine Widerspruchsregelung die Zahl der Organspenden erhöhen würde. Es besteht aber eine ernsthafte Chance für Hunderte von Menschen, die auf Organe warten. Diese Chance sollten wir nutzen.“
. Die zweite Frage ist ethischer Natur: Ist eine Widerspruchslösung ethisch vertretbar? Der Ethiker Peter Dabrock bestreitet das. Zwar werde auch dann niemand zur Organspende gezwun-
unsere highlights
gen, allerdings sei die informierte und ausdrückliche Einwilligung zu alle den eigenen Körper betreffenden Eingriffen „ethischer Goldstandard“. Es sei gefährlich, das Schweigen als Zustimmung zu werten. Ähnlich die Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl: Selbst Informationskampagnen vorausgesetzt, bleibe die Frage: „Wissen wirklich alle über das Thema Bescheid und wie sie widersprechen müssen?“ Auch könne die Widerspruchslösung moralischen Druck aufbauen. Dabei gelte doch: „Auch das Nein zur Organspende ist etwas, was auf jeden Fall akzeptiert werden sollte.“
Anders sieht es Armin Grau, Arzt und Bundestagsabgeordneter, der die Initiative zur Widerspruchslösung unterstützt: „Die Freiheit der Entscheidung wird in keiner Weise einge-
Zeitansagen –neue Denkansätze in krisenhaften Zeiten
In Kooperation mit dem Landesbildungswerk KLB in Bayern und dem KDFB Landesbildungswerk Bayern
Wir leben in einer Zeit vielfältiger Krisen, die sich überlagern und ineinander verwoben sind. Dies überfordert viele Menschen, macht Angst oder lähmt. Die Herausforderungen machen Bruchstellen sichtbar, sind aber auch, wenn wir es zulassen, eine Chance zum Aufbruch, zum Gestalten von Neuem. Denn eines zeigt sich schon heute: Mit den vorhandenen Lösungsansätzen werden sich viele Probleme in der Zukunft nicht mehr lösen lassen. Mit der Veranstaltungsreihe „Zeitansagen –neue Denkansätze in krisenhaften Zeiten“ möchten wir in diesen unübersichtlichen Zeiten Orientierung bieten und mehr noch –das Mindset, also festgefahrene Denkmuster und Überzeugungen, aufbrechen und zukunftsorientierte Denkweisen aufzeigen. Neben der Analyse ausgewählter Krisen, die dabei hilft, aktuelle Situationen einzuordnen, suchen wir mit Expert:innen nach Lösungsansätzen „out of the box“, die wieder Mut machen, Zukunft und Welt mitzugestalten.
KI-Revolution:
Chancen und Herausforderungen für Gesellschaft und Ethik
Termin Di, 18.02.2025
Mit Dr. Thomas Meier, Timo Greger
Silberne Gesellschaft:
Wie der demografische Wandel unser Leben neu definiert
Termin Di, 25.02.2025
Mit Frank Micheel, Dr. Karin Jurczyk
Globale Herausforderungen, neue Ansätze: Ein Paradigmenwechsel in der Außenpolitik?
Termin Do, 27.03.2025
Mit Dr. Benjamin Tallis, Dr. Maximilian Terhalle
Beginn / Ende jeweils 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Verantwortlich Kathrin StegerBordon, Martin Wagner, Anne Reimers Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss am Veranstaltungstag
schränkt!“ Und mit Blick auf das Leiden vieler Menschen sei die durch eine Widerspruchslösung verstärkte „Zumutung“, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, den Menschen zumutbar.
In der Absicht, die Zahl der Organspenden zu erhöhen, sind sich alle einig. Welcher Weg dorthin aber ist zielführend und ethisch vertretbar? Eine Frage, die wir am 26. Februar in unserer Reihe „ETHIK | einfach spannungsreich“ mit Kerstin Schlögl-Flierl und Armin Grau diskutieren. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung
Mit der Widerspruchslösung zu mehr Organspenden?
Hierzulande warten tausende Menschen oft vergeblich auf ein Spenderorgan. Aktuell wird diskutiert, die „Widerspruchslösung“ einzuführen: Wer der Organspende nicht ausdrücklich widerspricht, gilt dann als potentielle:r Organspender:in. Könnte dies helfen, die Zahl der Organspenden zu erhöhen oder sind andere Faktoren vielleicht viel bedeutender? Und selbst wenn: Ist sie ethisch vertretbar, auch mit Blick auf die wartenden Empfänger:innen?
Darüber diskutieren die Theologin
Prof. Dr. Kerstin SchlöglFlierl und der Mediziner und Politiker Prof. Dr. Armin Grau.
Termin Mi, 26.02.2025
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Kerstin SchlöglFlierl, Prof. Dr. Armin Grau
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 15,00, Studierende kostenfrei
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 26.02.2025

• Antisemitismus hat viele Facetten
• Online-Diskussionsreihe zu den
Radikal-rechten Refugien
In der Online-Diskussionsreihe Radikal-rechte Refugien werden unterschiedliche Subkulturen und Anknüpfungspunkte radikal-rechter Akteur:innen diskutiert. An jedem Abend wird eine Lebenswelt gesondert behandelt. Ziel ist es dabei, ein tiefgreifendes Verständnis der diversifizierten radikal-rechten Strukturen, Strategien und Ideologien zu entwickeln, um demokratie- und menschenfeindliche Akteur: innen sowie deren Ideologiefragmente erkennen und ihnen entgegentreten zu können.
Das Land wählt Rechts, die radikale Rechte zieht es aufs Land. Bis heute scheint diese Geographie vielen Betrachter:innen einleuchtend. Aus dem Blick gerät die Stadt. Stadt von Rechts.
Konturen radikal rechter Stadtpolitiken
Termin Mi, 05.03.2025
Mit Dr. Johann Braun
Anmeldeschluss Mi, 05.03.2025
Der türkische Rechtsextremismus stellt mit etwa 12.000 Anhängern die zweitgrößte extrem rechte Bewegung in Deutschland dar. Die Bewegung, auch bekannt als „Graue Wölfe“ oder Ülkücü-Bewegung, wird in diesem Vortrag beleuchtet.
Graue Wölfe: Der türkische Rechtsextremismus in Deutschland und in der Türkei
Termin Mi, 19.03.2025
Mit Dr. Ismail Küpeli
Anmeldeschluss Mi, 19.03.2025
Der Vortrag diskutiert die Bedeutung von Geschlecht in der Politik der radikalen und extremen Rechten. Die Inszenierung von Männlichkeit in zeitgenössischen Formaten der radikalen und extremen Rechten wird in Bezug gesetzt zu gesellschaftlichen Debatten um die Ordnung von Geschlecht im 21. Jahrhundert. Von wehrhafter Männlichkeit und dem Versprechen der Mannwerdung –Die Inszenierung von Geschlecht in der radikalen und extremen Rechten
Termin Mi, 02.04.2025
Mit Juliane Lang
Anmeldeschluss Mi, 02.04.2025
Für alle Veranstaltungen gilt:
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Verantwortlich
Kai Kallbach, Martin Stammler Teilnahmegebühr EUR 9,00 pro Veranstaltung empfohlen; Sie bezahlen einen freiwilligen Solidarbeitrag.* Ort Online via Zoom

antisemitismus beleuchten
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie unter Druck“ referierte Prof. Dr. Stephan Grigat am 23. Oktober 2024 über die Entstehung und heutigen Formen des Antisemitismus.
// ein rückblick von kai kallbach
UUnter dem Titel „Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart“ analysierte Grigat verschiedene antisemitische Traditionslinien und ihre moderne Ausprägung. Er betonte, dass Antisemitismus weit mehr als ein Vorurteil sei und beleuchtete seine ideologischen Funktionsweisen und die unterschiedlichen historischen Ursprünge in Christentum und Islam: Während im Christentum die Vorstellung der Juden als „Gottesmörder“ dominierte, existierte im Islam das „Dhimmi“-Konzept, das Juden als untergeordnete „Schutzbefohlene“ systematisch diskriminierte. Bis heute prägen diese historischen Grundlagen antisemitische Vorstellungen.
Den modernen Antisemitismus beschrieb Grigat als ideologische Reaktion auf die Komplexität kapitalistischer Gesellschaften. Die oft undurchschaubaren Macht- und Herrschaftsverhältnisse würden durch antisemitische Projektionen scheinbar verständlich gemacht. In diesem Sinne sprach er von einer „pathisch projektiven Reaktionsweise auf die moderne, widersprüchliche Gesellschaft“. Verschwörungstheorien, die jüdischen Menschen die Kontrolle über Wirtschaft oder Medien zuschreiben, dienten als Erklärungsmuster für Krisen –eine gefährliche Welterklärungsideologie, die im Holocaust gipfelte.
Besondere Aufmerksamkeit widmete Grigat dem Antizionismus. Dieser könne zwar verschiedene Gründe haben, schlage aber häufig in antisemitische Hetze um. Seit den 1930er Jahren verbinde der arabische Nationalismus Judenfeindschaft mit der
Ablehnung des Zionismus. Diese Perspektive finde im Iran und bei seinen Verbündeten gefährliche Verstärkung durch militärische und finanzielle Unterstützung von Gruppen wie der Hamas und der Hisbollah. Der Iran verfolge dabei das Ziel, Israel durch einen „Ring of Fire“ aus feindlichen Verbündeten zu destabilisieren.
Die iranische Bedrohung, die nicht nur anti-israelische, sondern offen antisemitische Positionen vertritt, sei laut Grigat eine der größten Gefahren für den Frieden im Nahen Osten und letztlich für jüdisches Leben weltweit. Das aktuelle iranische Nuklearwaffenprogramm bedrohe Israels Existenz fundamental. Grigat forderte daher eine gezielte Bekämpfung dieses „bewaffneten Antisemitismus“ als Voraussetzung für regionale Stabilität und Frieden.
Mit seiner Analyse forderte Grigat dazu auf, Antisemitismus in all seinen Facetten zu erkennen und entschlossen zu bekämpfen. Er plädierte dafür, in diesem Kampf auch eine Gewichtung mit Blick auf die realen Gefahrenpotentiale vorzunehmen und deshalb den bewaffneten Antisemitismus ins Zentrum der Kritik zu stellen. •
Prof. Dr. Stephan Grigat ist deutscher Politikwissenschaftler, Publizist, Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen und leitet das Centrum für Antisemitismus- und Rassismusstudien (CARS) in Aachen.

kai kallbach ist Projektleiter des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde
unsere angebote zum thema
Menschenwürde in Bildern: Sketchnotes-Workshop
Fortbildung für Sprachmittler:innen und Kulturdolmetschende
In Kooperation mit Caritas-Zentrum Freising Tauchen Sie mit uns in einen kreativen Workshop ein, der Raum für Reflexion, Austausch und Gestaltung bietet!
Gemeinsam erkunden wir die Idee der Menschenwürde, ihre Bedeutung für unser Leben und wie wir sie künstlerisch darstellen können. Im zweiten Teil des Workshops lernen Sie die Grundlagen der Sketchnotes kennen –eine einfache und intuitive Methode, Gedanken und Ideen visuell festzuhalten.
Schritt für Schritt üben wir, Symbole, Figuren und kleine Illustrationen zu zeichnen –Vorkenntnisse sind nicht nötig, Material wird gestellt. Am Ende halten Sie Ihre eigenen Sketchnotes in den Händen, die auf kreative Weise Aspekte der Menschenwürde zeigen und inspirieren.
Workshop-Inhalte:
Einführung: Was macht die Menschenwürde aus? Grundlagen von Sketchnotes –kleine Kunstwerke aus Zeichen und Worten Praktische Übungen: Menschenwürde kreativ visualisieren
Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil eines kreativen Austauschs rund um ein großes und wichtiges Thema!
Termin Fr, 21.02.2025
Begin / Ende 16.00 Uhr / 18.30 Uhr Mit / Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn, Dagmar Köhler
Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Caritas-Zentrum Freising, Bahnhofstr. 20, 85354 Freising
Anmeldeschluss Mi, 19.02.2025 beim Caritas-Zentrum Freising: ThiThanhHai.Ha@caritas.muenchen.org
Online-Reihe „Zukunft der Einwanderungsgesellschaft“: Deutschland in der Identitätsfindung
In Kooperation mit Dachauer Forum e.V. und der KEB München und Freising Über ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Politisch versteht sich Deutschland seit einigen Jahren als Einwanderungsgesellschaft. Dafür sind rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Migration und Integration wichtig. Aber reicht das für die Identifikation der Gesellschaft als Einwanderungsland?
In der dreiteiligen Online-Vortragsreihe nehmen wir in den Blick, inwiefern Deutschland tatsächlich ein modernes und offenes Einwanderungsland ist und auch als solches wahrgenommen wird. Wir richten den Blick darauf, wie stark sich die Gesellschaft damit identifiziert bzw. um ein „Wir“ ringt. Zudem befassen wir uns mit den damit zusammenhängenden Ängsten – auch von Seiten der Zuwandernden.
Termine der Online-Vortragsreihe:
Das Phantasma der bedrohlichen Anderen –Die Entwicklung von Migrationsdiskursen und Migrationspolitik in der Bundesrepublik
Termin Mo, 27.01.2025
Mit Prof. Dr. Simon Goebel
Wer gehört dazu? Aktuelle Situation in der pluralen Gesellschaft
Termin Mi, 12.02.2025
Mit Friederike Alexander
„Angst“ im Kontext von Migration –ein zweischneidiges Schwert
Termin Mi, 26.02.2025
Mit Barbara Abdallah-Steinkopff
Beginn / Ende jeweils 19.30 Uhr / 21.15 Uhr Teilnahmegebühr Einzelvortrag EUR 9,00, bei Buchung aller drei Vorträge EUR 24,00
• Interkulturelle
Kompetenz und Diversity
kommentar
Zum Verhältnis von
Spricht man über Vielfalt und Diversität, wird oft zuerst an ethnische Herkunft oder Nationalität gedacht – und damit an interkulturelle Kompetenz. Diese zielt darauf ab, kulturelle Unterschiede zu verstehen und Brücken zu bauen, etwa im Hinblick auf unterschiedliche gesellschaftliche Normen. Es geht darum, Empathie zu entwickeln, Stereotype zu hinterfragen und Missverständnissen entgegenzuwirken.
Das Diversity-Konzept hingegen geht über kulturelle Unterschiede hinaus. Es umfasst eine Vielzahl von Dimensionen – darunter Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, soziale Herkunft, Alter und körperliche Fähigkeiten. Hier steht im Vordergrund, individuelle Unterschiede und soziale Identitätsmerkmale zu erkennen und wertzuschätzen. Das bedeutet eine diskriminierungssensible Haltung zu entwickeln, die strukturelle Benachteiligungen und persönliche Vorurteile gleichermaßen ins Auge fasst.
Diversity-Kompetenz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um für gesellschaftliche Vielfalt zu sensibilisieren. Sie schafft Bewusstsein für die Überschneidung mehrerer Dimensionen von Benachteiligung (Stichwort Intersektionalität) und richtet den Blick auf ein gerechtes Miteinander. Indem wir uns auf Veränderungen einlassen, stärken wir auch unsere Demokratie, denn: Wir handeln gemeinsam aus, wie wir in Deutschland zusammenleben wollen. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

• Weltsynode nachgefasst
• Wo finden Frauen in der Kirchengeschichte statt?
kommentar
Rückblick auf die Weltsynode
Es war eine Überraschung. Papst Franziskus übernimmt die Beschlüsse der Synode sofort. Er geht nicht den bisherigen Weg, sie erst in einem nachsynodalen Schreiben in Kraft zu setzen. Er nimmt vorweg, was das Synodenpapier beschreibt: „Es ist nicht angebracht, die beratenden und entscheidenden Elemente, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, gegeneinander auszuspielen.“ (Schlussdokument Nr. 92). Dies ist eine Umkehr im bisherigen Vorgehen. Und schließlich gibt er dem Dokument sogar den Stellenwert eines nachsynodalen päpstlichen Schreibens.
Das Wort Umkehr prägt das Abschlussdokument: a) in den Beziehungen: verstärkte Beteiligung und Verantwortung von Lai:innen; b) in den Prozessen: Einbindung des Volkes Gottes in Entscheidungen, Transparenz und Rechenschaftspflicht; c) in den Bindungen: dezentral vor zentral. Ob dies gelingt, hängt ab von denen, die Macht wahrnehmen, und denen, die sie akzeptieren. Wie können transparente Entscheidungsstrukturen gewährleistet werden?
Einen Beigeschmack hinterlässt die Verschiebung der Frauenfrage. Es ist dem engagierten Auftreten von Frauen zu verdanken, dass das Thema bei der Synode auf der Agenda blieb. Dass die Weltkirche noch nicht so weit ist, mag für viele Bischöfe gelten, aber nicht für die Frauen weltweit. Überall tragen Frauen dazu bei, dass Kirche bei den Menschen und glaubwürdig bleibt. Die Öffnung des sakramentalen Diakonats für Frauen ist längst an der Zeit. •


dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie
frauen in der kirchengeschichte
Neue Forschungsansätze und intensives Quellenstudium fördern neue Blickwinkel // von stephan mokry
FFrauen in der Kirchengeschichte: Was fällt Ihnen dazu als erstes ein? Nicht verwunderlich, wenn Ihnen – angesichts der aktuellen Debatten um bessere Partizipation in der Kirche und die Rolle der Frauen – Persönlichkeiten in den Sinn kämen, die Bedeutendes leisteten (etwa viele Ordensgründerinnen), aber meist enormen Widerstand von Päpsten und Bischöfen erfuhren. So nannte auch Professorin Ines Weber (Salzburg) in ihrem einleitenden Vortrag bei unserer mit dem KBW Freising durchgeführten Veranstaltung „Nur in der zweiten Reihe? Frauen in der Kirchengeschichte“ solche Frauen. Doch sie machte deutlich, dass diese Ergebnisse auch von der lange dominierenden Forschungsperspektive abhängen: Kirchengeschichte war (und ist oft) Institutionen- und Hierarchiegeschichte. Doch in dem gleichen Maße, wie andere historische Disziplinen und Ansätze Einfluss erhielten (Methoden der Sozial- und Geschlechtergeschichte, oder theologische Perspektivwechsel, so das Verständnis von Kirche als Volk Gottes aller Getauften), wandelte sich das. So sucht man heute nach ganz anderen Quellen in den Archiven, um Antworten zur Rolle von Frauen in der Kirche zu erhalten oder gleich ganz andere Ausgangsfragen zu stellen. Das zeigte exemplarisch der stellvertretende Direktor des Diözesanarchivs von München und Freising, Dr. Roland Götz: Er führte spezielle kirchliche Quellenbestände vor (Matrikelbücher, mittelalterliche Ehegerichtsprotokolle etc.), aus denen man etwas
über Frauenschicksale erfahren kann, und durch die auch „normale“ Gläubige ins historische Rampenlicht mit ihren Geschichten gerückt werden, nicht selten Geschichten der sozialen Benachteiligung und Not, wenn z.B. im 19. Jh. Frauen ihre unehelichen Kinder aussetzten, da auch Männer damals gewisse rechtlich-materielle Voraussetzungen für die Eheschließung erfüllen mussten, aber nicht konnten. Dr. Anna-Laura de la Iglesia vom Freisinger Diözesanmuseum stellte zudem ein Führungskonzept vor, das sich Spuren von Frauen auf dem Domberg widmete und die Jubiläumsführungslinie „Männer.Macht.Geschichten“ unter einem kunsthistorischen Blickwinkel ergänzen sollte; jedoch –wie sie eingangs mit ironischem Unterton anmerkte – fand man nicht viel zum Anschauen vor Ort (am ehesten hier wohl die Grabplatte der Mutter von Bischof Leo Lösch aus dem 16. Jh.). Frauen stehen auch deswegen in der zweiten Reihe, so das Fazit des Abends, weil in der Geschichte der Kirche oft wenig Augenmerk auf ihrer Bedeutung lag. Schaut man aber genauer hin, dann waren und sind es Frauen, die das Glaubensleben wesentlich mitbestimmen. Der Frage nach Frauen in der Kirchengeschichte wollen wir in loser Folge in weiteren Veranstaltungen nachgehen. •

dr. stephan mokry ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Religion & Kirche
eine auswahl unserer angebote
Eine Veranstaltung zum 800. Geburtstag von Thomas von Aquin Anlässlich dieses Jubiläums fragen wir, ob uns Thomas auch etwas zum Ziel und zur Vorgehensweise des interreligiösen Dialogs sagen kann, insbesondere zum Gespräch mit dem Islam. Kann der Dialog helfen, den eigenen Glauben besser zu verstehen? Und ist die „Verteidigung“ des eigenen Glaubens mit dem Dialog verträglich?
Pater Felix Körner SJ (Islamwissenschaftler und Religionstheologe an der HumboldtUniversität zu Berlin) zeigt neue Wege des Religionsgeprächs auf.
Termin Do, 06.02.2025
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Mit Prof. DDr. Felix Körner SJ Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 9,00 Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Do, 06.02.2025
„Wo
Dokumentarfilm und Filmgespräch
In Kooperation mit dem Spirituellen Zentrum St. Martin Wir schauen uns den Film von Sandra Gold an und begleiten Brückenbauer:innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum. Im Mittelpunkt steht die Liebe. Dr. Florian Ihsen, Pfarrer und Leiter des Spirituellen Zentrums St. Martin der Evangelischen Kirche, und Dr. Thomas Steinforth führen durch den ökumenischen Vormittag.
Termin Sa, 29.03.2025
Beginn / Ende 10.00 / 13.30 Uhr
Mit Sandra Gold, Dr. Florian Ihsen Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 18,00
Ort Spirituelles Zentrum St. Martin, Arndtstr. 8 (Rgb.), 80469 München
Anmeldeschluss Fr, 28.03.2025
Aus der Reihe GOTT.neu.denken: Ein Dialog zwischen Hans-Joachim Höhn und Godehard Brüntrup SJ.
In Zeiten, in denen Menschen Gott nicht mehr brauchen und das Wort „Gott“ ihnen nichts mehr sagt, ist die Theologie mehr denn je herausgefordert. Wie kann die Rede von Gott in einen neuen Horizont gestellt werden? Wie können wir heute behutsam und angemessen von Gott sprechen, so dass Menschen dies mit ihrer Lebenswirklichkeit und ihrer Sprache, den Verstehenswelten von heute verknüpfen können?
Termin Sa, 08.02.2025
Beginn / Ende 09.30 Uhr / 15.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn, Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 35,00 Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Do, 06.02.2025
Spezialführung zur Fastenzeit in St. Martin Landshut und der Schatzkammer
In Kooperation mit dem CBW Landshut und der Hauptabteilung Kunst des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising Wir begegnen Christus in besonderen Kunstwerken (neue Altdorfer Kapelle und Chorbogen-Kreuz) und Raumkonstellationen (Kirche und Schatzkammer), dabei Licht und Dunkel, Tod und Auferstehung im Blick, verbunden mit kunsthistorischen und theologischen Impulsen.
Termin Fr, 04.04.2025
Beginn / Ende 15.00 Uhr / 17.00 Uhr
Mit Dr. Alexander Heisig, Dr. Gabriele Zieroff Verantwortlich Dr. Stephan Mokry Teilnahmegebühr EUR 7,00
Ort Stiftsbasilika St. Martin, Freyung 629, 84028 Landshut Anmeldeschluss Mo, 31.03.2025
Umkehr! Kirche sein angesichts des Missbrauchsskandals Geistlicher Missbrauch geschieht nicht selten im Kontext der Beichte. Der digitale Vortragsabend fragt nach den Gründen und Zusammenhängen für dieses Phänomen und diskutiert, welche Konsequenzen für die Beichtpraxis gezogen werden können, um dem entgegenzuwirken.
Hierzu werden Pastoraltheologie und Praxis zu Wort und miteinander ins Gespräch kommen.
Termin Di, 25.03.2025
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.15 Uhr Mit Prof. Dr. Katharina Karl, P. Harald Weber OFMCap Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Di, 25.03.2025
#weiter.glauben Braucht Gott Opfer?
Online-Vortrag mit Diskussion um den belasteten Opferbegriff
In Kooperation mit der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU „Opfer“ ist ein schwieriger Begriff in der Geschichte des Christentums. Welche Aussageabsicht steckt ursprünglich hinter diesem Motiv? Welche theologische Eigendynamik und Missverständnisse haben sich im Laufe der Zeit ergeben?
Termin Mi, 09.04.2025
Beginn/Ende 19.00 Uhr / 21.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Veronika Hoffmann, Prof. Dr. Markus Weißer
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang, Prof. Dr. Thomas Schärtl-Trendel
Teilnahmegebühr EUR 18,00, Studierende kostenfrei
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 09.04.2025

• Klimaaktivismus braucht neue Wege
• Global Citizenship sensibilisiert
kommentar
Die letzte gescheiterte Generation?
DDer klimapolitische Aktivismus ist in der Krise. Der Rückzug der „Letzten Generation“ in Österreich, sowie der Rücktritt des Bundesvorstands der Grünen Jugend sind nur zwei Belege einer tiefen Erschöpfung.
Diese Erschöpfung zeigt sich in den Abschiedsworten beider Gruppen. Während die Letzte Generation konstatiert: „die Gesellschaft hat versagt“, beklagt die Grüne Jugend die Unmöglichkeit, innerhalb des Systems grundlegende Veränderungen zu erreichen. Es sind Worte der Verzweiflung, die das wachsende Phänomen der Klimadepression widerspiegeln: Das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der sich verschärfenden Klimakrise bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Blockade.
Diese Entwicklung könnte das vorläufige Ende einer Phase des konfrontativen Klimaaktivismus markieren. Doch zugleich deutet sich an, dass die Klimabewegung nicht verschwindet, sondern sich transformiert. Die zentrale Frage wird sein, wie sie Klimaschutz vermitteln kann, ohne an der eigenen Ohnmacht zu zerbrechen.
Vielleicht liegt gerade in der aktuellen Krise eine Chance: Der Kampf gegen die Klimakrise braucht nicht nur technische Lösungen und politische Mehrheiten, sondern auch neue Wege, mit der emotionalen Belastung umzugehen, die dieser existenzielle Konflikt mit sich bringt. Damit wird die Auseinandersetzung mit der psychologischen Dimension des Klimawandels zunehmend wichtiger. Nicht nur für Aktivist:innen, sondern für alle, die das Thema ernst nehmen – und damit auch für die Bildungsarbeit. •


kathrin steger-bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit

global
citizenship sensibilisiert
Im Herbst 2024 war Sozial- und Umweltpsychologe
Prof. Gerhard Reese bei der Domberg-Akademie zu Gast. Er hat unter anderem einen Ansatz vorgestellt, der Menschen für die Klimakrise sensibilisieren kann. // von kathrin steger-bordon
DDas Konzept der „Global Citizen ship“ – das Gefühl einer Zugehörigkeit zur globalen Gemeinschaft – könnte ein Faktor sein im Kampf gegen den Klimawandel. Die sozialpsychologische Forschung zeigt: Menschen, die sich als Weltbürger:innen (Global Citizens) verstehen, zeigen nicht nur ein höheres Umweltbewusstsein, sondern auch eine größere Bereitschaft zum klimafreundlichen Handeln.
Studien belegen, dass Global Citizens einen erweiterten „Circle of Moral Concern“ (Kreis der moralischen Berücksichtigung) entwickeln – ihr moralischer Kompass umfasst nicht nur die unmittelbare Umgebung, sondern die gesamte Menschheit und das Ökosystem.
Besonders interessant sind die Erkenntnisse zur psychologischen Distanz: Während der Klimawandel für
viele Menschen ein abstraktes, zeitlich und räumlich entferntes Problem darstellt, reduziert die globale Identität diese mentale Distanz erheblich. Global Citizens nehmen Klimafolgen in fernen Regionen als persönlich relevant wahr, was laut Forschungen zu einer höheren Handlungsbereitschaft führt. Bildungsprogramme, die globale Staatsbürgerschaft fördern, zeigen entsprechend positive Effekte auf klimarelevante Einstellungen und Verhaltensweisen.
In der Sozial- und Umweltenzyklika Laudato Si, die in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert, stieß Papst Franziskus in ein sehr ähnliches Horn: „Wir brauchen eine neue universale Solidarität“ (Laudato Si, Abs. 14). Die Kirchen könnten ihre globale Identität nutzen und in diesem Sinne Ansätze des Global Citizenship stärken. •
Wie könnte eine Zukunft auf einem klimafreundlichen Planeten aussehen? Was nutzt der Klimaschutz? Und was kann ich ganz konkret dafür tun? Um die Erderwärmung zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, sind wir gefordert –jeder und jede Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Staat. Und das jetzt!
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Umwelt & Nachhaltigkeit spannende highlights zum thema
In Kooperation mit der vhs Freising, dem KBW Freising, engagierten Freisinger:innen, dem CineradoPlex Freising und dem Kreisjugendring Freising
Filmvorführung „Vergiss Meyn nicht” mit anschließendem Filmgespräch (FSK 12) Ein junger Dokumentarfilmer begleitet 2018 die Besetzung des Hambacher Forstes und er kommt ums Leben: Steffen Meyn stürzt unter ungeklärten Umständen bei den Dreharbeiten in den Tod. Wie weit kann und darf Aktivismus gehen?
Anhand seines Filmmaterials haben Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff eine teils ergreifende, aber immer interessante Dokumentation erstellt, die vom Kampf für die Realisierung von politischen Zielen handelt, aber auch von persönlichen Zweifeln.
Termin Mo, 17.03.2025
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 22.00 Uhr Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Teilnahmegebühr EUR 7,00 sind direkt an der Kinokasse zu entrichten Ort CineradoPlex, Münchner Str. 32, 85354 Freising Anmeldung Keine Anmeldung erforderlich
Entwickeln Sie ein eigenes Umwelt-Messgerät. Für Tüftler:innen & Anfänger:innen In Kooperation mit dem Science Center „Curiocity“. Gefördert durch das StMUK Bayern. Mithilfe des Calliope mini, einem Einplatinencomputer, werden die Teilnehmenden schrittweise in die Programmierung und Anwendung von Sensoren eingeführt. Gemeinsam entwickeln wir ein Umweltmessgerät, mit dem wir zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc. erfassen können. Neben dem technologischen Wissen erfahren die Teilnehmenden etwas über Nachhaltigkeit und die Berechnung des Klimawandels.
Termin So, 06.04.2025
Beginn / Ende 15.00 Uhr / 17.30 Uhr Mit Kim Ludwig-Petsch, Annika Strömmer Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Seminarraum Domberg-Akademie, Untere Domberggasse 2, 85354 Freising
Anmeldeschluss Mi, 02.04.2025
Konflikt zwischen Gewissen und Gesetz –Podiumsdiskussion mit spannenden Gästen Was bedeutet ziviler Ungehorsam für eine Demokratie? Ist er ein legitimes Mittel? Wo sind seine Grenzen?
Diese Fragen beleuchten wir in unserer Fishbowl-Diskussionsrunde gemeinsam mit Dr. Günther Beckstein, ehem. Bayerischer Ministerpräsident und Innenminister, Hartmut Binner, ehemaliger Polizist und engagiert bei „AufgeMUCt“, Luis Böhling, Aktivist der Letzten Generation, und Dr. Claudia Paganini, Medienethikerin der Hochschule für Philosophie in München.
Termin Mo, 24.03.2025
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.30 Uhr Mit Dr. Günther Beckstein, Hartmut Binner, Luis Böhling, Dr. Claudia Paganini
Moderation Clemens Ronnefeldt
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Teilnahmegebühr kostenfrei Ort wird noch bekannt gegeben Anmeldung Keine Anmeldung erforderlich
Das Escape Game Klimaprofis – saving tomorrow ist eine interaktive Methode, die im Unterricht und in der Bildungsarbeit eingesetzt wird. Sie vermittelt Inhalte des Klimawandels und zeigt Handlungsoptionen auf. Ziel ist es, das komplexe Thema der Klimakatastrophe niedrigschwellig und mit Nervenkitzel-Faktor zu vermitteln sowie Handlungsimpulse für den eigenen Alltag zu geben.
Nach einem größeren Relaunch im Sommer und Herbst 2024 ist das Spiel jetzt noch vielseitiger. Zusätzliche Elemente der „Augmented Reality“, also der Erweiterung der Realität, ziehen die Spieler:innen in das Erlebnis hinein. Außerdem gibt das Spiel jetzt auch Impulse, wie wir auf unser Umfeld und die Gesellschaft einwirken können, um nachhaltiges Handeln zu stärken. Das Motto: Reduziere deinen Fußabdruck auf der Erde UND hinterlasse deinen Handabdruck in der Welt.
Ebenfalls neu: Eine eigene Version für Jugendliche und für Erwachsene holt jede:n in der eigenen Lebensrealität ab.

In Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde
Der bekannte Klimaaktivist und Politikwissenschaftler Tadzio Müller liest aus seinem aktuellen Buch „Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps. Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben“ und diskutiert mit Teilnehmenden über Wege aus der kollektiven Klimadepression. An diesem Abend nimmt uns der Autor mit auf seine eigene Reise: von tiefer Verzweiflung über das Scheitern der Klimabewegung bis hin zu einer überraschenden Erkenntnis: Selbstwirksamkeit und Hoffnung hängen nicht vom Sieg ab, sondern vom Erlebnis des gemeinsamen Kampfes.
Termin Di, 01.04.2025
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr Mit Tadzio Müller
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Di, 01.04.2025

Zielgruppe Jugendliche ab 14 Jahren, Erwachsene
Kosten EUR 75,00 pro Woche, zuzüglich der Versandkosten
Teilnehmendenzahl max. 30 Personen
Benötigte Spielleiter:innen 2
Dauer 4 Stunden
(verkürzte Varianten möglich)
Benötigte Infrastruktur 2 Seminarräume/ Klassenzimmer
Umfang Das mobile Escape Game wird mit allen Spielmaterialien, Requisiten und technischem Equipment geliefert
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon

• Serientipp
• Wie mutige Frauen die Geschichte verändern
kommentar
Wahrhaftig und witzig
auf den spuren starker frauen
DOie Zweiflers ist das deutsche Serienhighlight des letzten Jahres: Eine pointierte Dramedy über das turbulente Leben der jüdischdeutschen Familie Zweifler in Frankfurt – warmherzig, skurril und durchweg unterhaltsam.
Als Familienoberhaupt Symcha Zweifler das Familiengeschäft verkaufen will, werden nicht nur alte Konflikte, sondern auch aktuelle Fragen über Identität, Werte und Tradition entfacht: Da ist z.B. der Enkel Samuel, der mit Saba – einer Schwarzen und zudem nicht-jüdischen Köchin – ein Kind erwartet. An der Frage, ob der Sohn beschnitten werden soll, entbrennt ein Kampf zwischen Unabhängigkeit und Familientraditionen.
Mit starken Figuren und beeindruckenden Schauspieler:innen gelingt es der Serie, aus der Perspektive mehrerer Generationen humorvoll von jüdischer Kultur und kultureller Vielfalt zu erzählen. Dabei spielt Die Zweiflers mit Klischees und bleibt dennoch authentisch.
Ein liebevoller, manchmal schonungslos ehrlicher Blick auf jüdisches Leben, aber auch Themen, die Familien im Allgemeinen bewegen: Konflikte zwischen Eltern und Kindern, Eheprobleme, Geburt und Tod. In einer Zeit, in der das Verständnis für unterschiedliche kulturelle und religiöse Perspektiven wichtiger denn je ist, setzt die Serie Maßstäbe und gibt Impulse, sich dem Thema Erinnerungskultur zeitgemäß zu widmen. Überzeugen Sie sich selbst: Die Serie, die 2024 den Deutschen Fernsehpreis erhielt, ist aktuell in der ARD-Mediathek zu finden. •


magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung
Die selbstbewusste Fürstin von Sachsen-Weimar setzte im 18. Jahrhundert Maßstäbe. Ihr Leben zeigt, wie eine mutige Frau die Geschichte verändern kann. // magdalena falkenhahn
Anna Amalia von Sachsen-Weimar setzte im 18. Jahrhundert Maßstäbe. In einer von strengen gesellschaftlichen Normen geprägten Zeit regierte sie mit Selbstbewusstsein und machte Weimar zu einem kulturellen Zentrum Europas.
Nach dem frühen Tod ihres Mannes übernahm Anna Amalia die Regentschaft für ihren Sohn Carl August und lenkte das Herzogtum Weimar-Eisenach. Ihre Regierungsführung war von Unabhängigkeit geprägt, und sie schuf ein Umfeld, das Raum für neue Ideen bot – eine fast revolutionäre Haltung für Frauen ihrer Zeit.
Sie erkannte zudem die Kraft der Kultur und formte Weimar zu einem Hotspot der Geisteswissenschaften. Unter ihrer Schirmherrschaft fanden Künstler wie Goethe, Schiller und Herder in der Stadt ein intellektuelles Zuhause. Ihre Vision machte Weimar zur Wiege der deutschen Klassik.
Bildung sollte für alle zugänglich sein, nicht nur für die Aristokratie – ein zentrales Anliegen der Herzogin. Sie gründete Schulen und schaffte mit der berühmten Herzoglichen Bibliothek, die heute als Anna-Amalia-Bibliothek bekannt ist, Zugang zu Wissen für die breite Gesellschaft.
Anna Amalias Leidenschaft für Musik ließ sie nicht nur komponieren und mehrere Instrumente lernen, sondern auch den Nachwuchs fördern. Ihre Kompositionen sind heute zwar weniger bekannt, doch ihr Engagement in der Musikwelt zeigt eine Frau,

Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach, wirkte als Regentin, Mäzenin und Komponistin.
die sich selbstbewusst in einer männlich dominierten Kunstform behauptete.
Anna Amalias Vermächtnis wirkt bis heute. Ihr Leben zeigt, wie eine mutige Frau die Geschichte verändern kann. Sie ist eine von mehreren beeindruckenden Frauen, denen sich das Seminar „Frauen-Stimmen. Mächtig. Revolutionär. Verdrängt.“ widmet. •
Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschlicher Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, die Kultur als Lebenswelt mit ihren vielfältigen Traditionen, Lebensformen und Wertesystemen. Wir möchten Sie inspirieren, sich mit den Künsten, Kultur(en) und damit auch mit der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen und sich zu engagieren.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Kultur & Kreativität

Veranstaltungsreihe zum Science-Fiction-Epos „Dune 2“
In Kooperation mit der Europäischen JanuszKorczak-Akademie, Münchner Forum für Islam, Münchner Bildungswerk, FB Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, College of Interreligious Studies München, Katholische Hochschulgemeinde an der LMU.
Wir zeigen den zweiten Teil des Filmepos „Dune“ mit anschließendem Filmgespräch
Die „Dune“-Filme spielen in einer weit entfernten Zukunft und erzählen eine epische Geschichte von Macht, kolonialer Ausbeutung, Familie, Spiritualität und der Sehnsucht nach Erlöserfiguren, angesiedelt auf dem lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arrakis.
Termin Mi, 29.01.2025
Beginn / Ende 17.00 Uhr / 20.00 Uhr
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn, Miriam Lücke , Dr. Thomas Steinforth Kinoticekt EUR 11,50, ermäßigt EUR 7,00 Ort Kino Neues Rottmann, Rottmannstr. 15, 80333 München Anmeldung bis Mi, 29.01.2025
Zu allen Zeiten haben Frauen den Gang der Geschichte, die Kunst und die Musik bestimmt oder beeinflusst. Und immer wieder suchten Frauen ein selbstbestimmtes Leben. Es gelang ihnen, durch ihre Dichtung oder durch ihre Kompositionen selbständig, ja aufmüpfig zu leben. Und ihre Biographien bergen so manche Überraschungen. Wer waren diese Frauen? Was hat sie bewegt? Was ist ihnen gelungen? Was nicht? Fragen über Fragen. Das Seminar versucht einige Antworten zu finden.
Termin Sa, 08.03. – So, 09.03.2025
Beginn / Ende Sa, 09.30 Uhr / 18.00 Uhr, So, 09.00 Uhr / 13.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Ute Büchter-Römer
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr EUR 109,00, ermäßigt EUR 93,00, Tagungspauschale (Speisen, Getränke, Raum): EUR 99,00; Übernachtung: EUR 79,00
Ort Ausbildungshotel St. Theresia, Hanebergstr. 8, 80637 München Anmeldung bis Do, 23.01.2025
Interreligiöse Einblicke in das Filmepos
„Dune“: Messias und das Volk der Fremen Wir tauchen ein in die faszinierende Welt von „Dune“ und erkunden die vielschichtige religiöse Symbolik, die in dieser epischen Erzählung verwoben ist. Im Fokus stehen die Messias-Figur des Paul Atreides und das Volk der Fremen. Anhand konkreter Filmszenen werden in drei Impulsvorträgen aus jüdischer, christlicher und muslimischer Perspektive die jeweiligen kulturellen und religiösen Motive herausgearbeitet. Danach kommen Gäste und Publikum miteinander ins Gespräch.
Termin Di, 04.02.2025
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Ali Ghandour, Eva Haller, Clara Schönfelder
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn, Miriam Lücke, Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 10,00
Ort Kino Neues Rottmann, Rottmannstr. 15, 80333 München Anmeldung bis Mo, 03.02.2025
Sie erleben Freude und Präsenz im Tanz, lernen Kreistänze, die zum Weitergeben geeignet sind und können sich inspirieren lassen von der Lebenskraft des beginnenden Frühlings.
Mit schwungvollen und ruhigen Kreistänzen und Gedichten feiern wir den Frühling und das Wachsen und Aufblühen um uns herum. Bei Sonnenschein tanzen wir auch draußen.
Termin Sa, 22.03. – So, 23.03.2025
Beginn / Ende Sa, 09.30 Uhr / 18.00 Uhr, So, 09.00 Uhr / 13.00 Uhr
Mit Michaela Schillinger Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr EUR 85,00, ermäßigt EUR 72,00, Tagungspauschale (Speisen, Getränke, Raum): EUR 66,00; Übernachtung mit Frühstück: EUR 65,00; Abendessen (wenn Sie nicht übernachten): EUR 14,00
Ort Schloss Fürstenried, Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München Anmeldung bis Do, 06.02.2025
Vom Memento Mori zu Death Positive: Wie das Wissen um den Tod das Leben beeinflusst
In diesem besonderen Format an der Schnittstelle kultureller und theologischer Bildung verbinden wir traditionelle „Vanitas“-Hinweise und „Memento-Mori“-Praktiken in Kunst und Religion mit dem aktuellen Trend der „death-positive-Bewegung“: Dieser geht es darum, den Tod nicht als etwas nur Bedrohliches zu verdrängen, sondern positiv zu sehen. Dazu werden etwa Apps entwickelt, die an das Ablaufen der Lebenszeit erinnern, Gesprächsformate „am Sarg“ angeboten und manches mehr. Ist das nur eine Fortführung der Tradition mit modernen Mitteln? Welchen Unterschied macht es z.B., wenn die „klassisch-christliche“ Erinnerung an die Sterblichkeit gepaart ist mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod oder wenn das Wissen um den Tod nicht mehr von einem „Danach“ ausgeht? Und wie könnte es heute aussehen: ein Verhältnis zum eigenen, irgendwann kommenden Tod, das dem Leben und der Freude an diesem nicht abträglich ist?
Das Format besteht aus zwei Einheiten:
1. Interaktiv-dialogische Auseinandersetzung mit Vanitas- und Memento-Motiven in der Alten Pinakothek
Im Bilder-Schatz der Pinakothek entdecken wir Hinweise auf Vergänglichkeit und Tod und kommen darüber ins Gespräch.
2. Impuls- und Reflexionseinheit, in der die Eindrücke aus der Kunstbegegnung reflektiert und in Verbindung gebracht werden mit anschaulichen Impulsen zur „death-positiveBewegung“ und christlich-liturgischen Traditionen wie dem Asche-Auflegen am Aschermittwoch.
Termin Fr, 07.03.2025
Beginn / Ende 16.00 Uhr / 20.00 Uhr
Mit / Verantwortlich Magdalena Falkenhahn, Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr EUR 25,00, inkl. Eintritt; Verpflegung: EUR 10,00
Treffpunkt Alte Pinakothek
Barer Str. 27, 80333 München
Anmeldung bis Mi, 05.03.2025

• Individualismus –real oder erfunden?
• Notwendige Intuition
kommentar
Die Mär vom Individualismus
nicht nur ein bauchgefühl
MMan spricht heute oft und gern von der immer „individualistischeren Gesellschaft“, wenn man soziale Kälte oder den Mangel an Gemeinsinn erklären will. Diese definiere sich dadurch, dass Werte wie Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung wichtiger seien als soziale Nähe und Bindungen. So wurde auch bei der Eröffnung des neuen Trauerpastoralen Zentrums Haus am Ostfriedhof beklagt, dass das Sterben immer individualistischer werde.
Aber stimmt diese gängige Diagnose der Zeit? Sicher, Sterben und Trauern sind im Wandel begriffen, wie viele andere Lebensbereiche auch. Es wird kaum mehr zuhause gestorben, aufgebahrt oder in gemeinsamen Ritualen getrauert. Stattdessen wird meist in Kliniken und Heimen gestorben, das Aufbahren der Leiche erfolgt standardisiert durch Dienstleister und die Hinterbliebenen trauern oft nur für sich allein. Sterben, Tod, Trauer geschehen heute also keineswegs individueller, sondern zunehmend einheitlicher, anonymer, isolierter.
Was zunimmt ist die Isolation. Und die Spielräume individueller Gestaltung und Stimmigkeit werden immer geringer. Was würde helfen? Genau genommen: Mehr Individualität! Echte Würdigung der Einzigartigkeit und Einmaligkeit jeder Person, ihres Lebenswegs und sozialen Umfelds. Es wäre an der Zeit, nicht nur in Sonntagsreden, sondern im Vollzug und im Miteinander zu würdigen, was ein Mensch in seiner je eigenen Vielfalt und Verbundenheit mit anderen ist und dazu braucht. •


dr. karin hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung

Intuition ist ein wichtiger Schlüssel zu persönlicher Ganzheit und Klarheit. Sie wird nur oft missverstanden als unbegründetes Wissen oder „Bauchgefühl“, als Gegenteil von strukturierter Überlegung und logischem Denken. Dabei ergänzt sie diese nur in notwendiger Weise. // von karin hutflötz
IIn Bildung die Rolle von Intuition zu stärken, kann heute fragwürdig erscheinen. Ist nicht schon genug Falsch- und Halbwissen unterwegs? Und werden nicht zunehmend FakeNews und Irrationalismen verbreitet, persönliche Ressentiments mit politischer Meinung verwechselt und subjektive Gedanken einfach mit objektiven Einsichten gleichgesetzt?
Solche Verwechslungen und fehlende Denkschärfe sind sicher ein Signum der Zeit. Mit Intuition hat das aber wenig zu tun, eher mit dem Mangel an intuitivem Wissen und differenzierender Urteilskraft. Denn nicht jede spontane Laune oder vorurteils-
diktierte Eingebung ist schon Intuition. Diese erwächst – wie aktuelle Forschung eindrücklich zeigt – aus vertiefter Wahrnehmung und meist langer, fundierter Erfahrung, greift auf alle Sinnesdaten und Körperwissen zurück.
Ein starker Zugang zur eigenen Intuition vertieft den Verstand, schärft die Urteilskraft und erlaubt erst Beweglichkeit innerhalb von Strukturen. Intuition zu stärken, bedeutet hörender und sehender zu werden für sich selbst und das, was geschieht. Sie lädt dazu ein, den Blick zu halten und zu schärfen für die reiche Innenwelt, die jede Person ist und in sich trägt,
Unsere Angebote zur Persönlichkeitsbildung zielen auf transformative Erwachsenenbildung. Mit innovativer Didaktik und fundiertem Wissen im Schnittfeld von Pädagogik, Psychologie und Philosophie: Wer bin ich, und wie lernen wir uns in Vielfalt anzunehmen? Wie können wir Begegnungen und Beziehungen besser gestalten? Wie gelingen persönliche Entfaltung und gemeinsames Wachstum?
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Persönlichkeit & Pädagogik

ebenso für eine vielschichtige Wirklichkeit, die sich mit allem, was begegnet, zeigt. Dank unseres Zugangs zu intuitivem Erkennen brauchen wir Komplexität nicht zu fürchten, sondern nur zum Anlass zu nehmen, genauer hinzusehen und den Blick zu weiten, Mustererkennung zu machen im vielfältig Bewegten und Überkomplexen der Realität.
Intuition hieß ursprünglich unmittelbare Eingebung, geistige Schau, das Erfassen des Wesens einer Wirklichkeit. Heute benennt Intuition die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in unmittelbarer Einsicht – beyond words – zu erfassen, noch vor aller diskursiven Verstandestätigkeit und logischem Schlussfolgern.
Neurowissenschaftlich inzwischen gut beforscht, zeigt sich, dass Intuition tatsächlich nicht nur subjektives Wissen, sondern im Resultat objektive Einsichten und sicheres Handeln erlaubt – wenn sie auf einer starken Neigung und sehr viel Erfahrung in einem Feld beruht. Wer zum Beispiel lange und mit Leidenschaft in der Bildungspraxis tätig ist, weiß dann irgendwann spontan und stimmig, was in einer bestimmten Lehr- und Lernsituation zu tun ist. So entwickelt sich Intuition als Sinn für Stimmigkeit, als ein „so müheloses wie deutlich bestimmtes Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes“, wie Descartes es schon beschrieb.
Intuition ermöglicht auch erst kreatives Denken und Tun. Die Sprache der Intuition sind oft innere Bilder, Zeichen und Symbole, die sich erst in Ruhe und Kontemplation zeigen. Die Fähigkeit, diese besser lesen zu können und ihnen zu trauen, erlaubt erst innere Führung.
Die wichtigsten Voraussetzungen für die Bildung und wirksame Stärkung eigener und kollektiver Intuition sind deshalb Innehalten und die Erfahrung der Stille, nicht zuletzt in Verbundenheit mit der Natur: der eigenen, wie der im Ganzen. •
highlights aus unserem angebot
Eine kreative Entdeckungsreise zur inneren Weisheit. Die Sprache der Intuition sind oft innere Bilder und Symbole. Die Fähigkeit, diese besser lesen zu können und ihnen zu trauen, erlaubt erst innere Führung. Im Seminar werden wir das mit vielfältigen, kreativen Methoden erfahren und üben, wie das zu mehr Stimmigkeit und Orientierung auf dem Lebensweg, aber auch zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude beitragen und entscheidende Impulse bei wichtigen Entscheidungen geben kann: Wahrnehmungsübungen, Reisen in die Innenwelt, spielerische Interventionen – zu zweit und in der Gruppe.
Termin Sa, 15.03.2025
Beginn / Ende 10.00 Uhr / 17.00 Uhr Mit Sabine Albrecht-Morgner Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 120,00, inkl. Material und Pausenverpflegung Ort Seminarraum Domberg-Akademie, Untere Domberggasse 2, 85354 Freising Anmeldeschluss Mo, 10.03.2025
Rückzug in die Familie –eine Absage an die Demokratie?
Das Verhältnis von Familie und Staat ist vielschichtig.
Vorgestellt als ‚natürliche‘ Form sozialen Zusammenlebens dient Familie als zentrale Legitimationsfigur für den (National-)Staat. Ist der Rückzug in die Familie also eine Absage an Demokratie und Gemeinwohl? Darüber sprechen wir mit dem Philosophen und Psychoanalytiker PD Dr. Lukas Kaelin von der Universität Wien. Mit Hegels Gesellschaftstheorie und Freuds Kulturtheorie wird ein Thema von großer politischer Relevanz beleuchtet.
Termin Di, 06.05.2025
Beginn/Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit PD Dr. Lukas Kaelin
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Di, 06.05.2025
Ein Tag Schreib-Zeit für sich selbst und intensiven Austausch mit anderen. Mit velfältigen Impulsen aus der Biografiearbeit und aus dem Creative Writing. Biografische Momente freudvoll und achtsam heben und Lebenslinien nachzeichnen. Sich selbst begegnen und lesen lernen. Das verändert den Blick auf das Erlebte. Es lässt uns das Erlebte würdigen und verbindet uns stärker mit uns selbst und mit anderen, wenn wir in der Gruppe schreiben und wir über uns und unsere Geschichte(n) ins Gespräch kommen.
Termin Sa, 05.04.2025
Beginn / Ende 10.00 Uhr / 17.00 Uhr Mit Sonja Kapaun
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 90,00, Verpflegung EUR 15,00
Ort Seminarraum Domberg-Akademie, Untere Domberggasse 2, 85354 Freising Anmeldeschluss Fr, 28.03.2025
Einführung in Zuhörstrategien nach der Methode der „Clean Language“. Clean Language ist eine ‚Fragesprache‘, die in den 80er Jahren entwickelt wurde. Sie erlaubt ein offenes Zuhören und das ‚In-der-SchwebeHalten‘ der eigenen Annahmen. Gleichzeitig ist sie erkenntnisfördernd, aktiviert kreatives und lösungsorientiertes Denken und ermöglicht Zugang zu innerem Wissen. Für alle in fragenden, lehrenden oder beratenden Berufen, die ihre Zuhör-Fähigkeiten beim Begleiten von Menschen erweitern möchten.
Termin Fr, 16.05.2025
Beginn/Ende 10.00 Uhr / 17.00 Uhr
Mit Doris Leibold und Camilla Högl
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 120,00, inkl. Material und Pausenverpflegung
Ort Seminarraum Domberg-Akademie, Untere Domberggasse 2, 85354 Freising Anmeldeschluss Mo, 12.05.2025

• Was ist uns die Care-Arbeit wert?
wir brauchen zukunftstfähige netzwerke
Die Care-Krise treibt viele Menschen in die Erschöpfung und gefährdet das Wohl sorgebedürftiger Menschen. // von thomas steinforth
WWer bessere Rahmenbedingungen für private und familiäre Care-Arbeit (Erziehung, Betreuung, Pflege…) fordert und ein zukunftsfähiges Gesundheits-, Pflege- und Erziehungssystem verlangt, hört oft die Mahnung: All das müsse von „der Wirtschaft“ erarbeitet werden. Deren Leistungsfähigkeit dürfe man keineswegs überfordern. Was gerne übersehen wird: Wesentliche Voraussetzungen dafür, dass „die Wirtschaft“ überhaupt irgendetwas erarbeiten kann, werden in der bezahlten wie unbezahlten Care-Arbeit erarbeitet – und diese wird tatsächlich überfordert. Die Care-Krise wird sich durch den demographischen Wandel und Fachkräftemangel weiter verschärfen, treibt viele Menschen in die Erschöpfung und gefährdet das Wohl sorgebedürftiger Menschen. Wie könnte sie aussehen – die Zukunft der Care-Arbeit?
Ein erster Schritt wäre es, den Wert der Care-Arbeit wirklich wahrzunehmen. Die unbezahlte Sorgearbeit in Deutschland hat einen Umfang von rund 117 Milliarden Stunden im Jahr. Das Volumen der Erwerbsarbeit dagegen beträgt gute 60 Milliarden Stunden. Immer noch aber wird das private und familiäre Sorgen und Kümmern wie ein Nebenschauplatz der „eigentlichen“ Wirtschaft betrachtet, der in den üblichen Wohlstandsmessungen nicht erfasst wird. Diese Ignoranz trägt dazu bei, dass dieses Zukunftsthema politisch sträflich vernachlässigt wird. Wir brauchen zukunftsfähige Netzwerke des Mit- und Füreinander, die zwischen der privat-familiären SorgeArbeit und den nachhaltig zu sichernden professionellen sozialen Diens-

ten angesiedelt sind. Traditionsreiche Netze wie Nachbarschaftshilfen müssen weiterentwickelt, mit neuen Formen kombiniert und ausgebaut werden. Und sie brauchen stützende Strukturen – sonst reißt das Netz. Dringend geboten ist ein Mehr an Geschlechtergerechtigkeit. Denn Frauen schultern mit 72 Milliarden Stunden den Großteil unbezahlter Sorgearbeit, insbesondere für die Erziehung von Kindern und die Pflege von Angehörigen. Sie sind es auch, die von der Krise im Erziehungs- und Pflegewesen besonders betroffen sind und immer öfter „einspringen“ müssen, wenn es zu Ausfällen kommt. Eine gerechtere Aufteilung muss zwar auch zwischen den konkreten Personen selbst ausgehandelt werden, braucht aber politische und ökonomische Rahmenbedingungen.
Vor allem braucht es Zeitgerechtigkeit für alle: „Viele Menschen wollen ihre Zeit grundlegend anders auf die Lebensbereiche verteilen. Das ist keine Luxusdebatte, sondern verweist auf Probleme, die gelöst werden müssen“, so die Feministin Teresa Bücker,
die eine Verkürzung und Umverteilung der Zeit für Erwerbsarbeit fordert, etwa durch eine 4-Tage-Woche. Um mehr Zeit für Sorge-Arbeit geht es auch im „Optionszeitenmodell“ von Karin Jurczyk: Danach würden alle Menschen ein Zeitbudget von etwa neun Jahren zur Verfügung haben, um ihre Erwerbsarbeit phasenweise zu unterbrechen und gleichzeitig abgesichert zu sein. Wir diskutieren dieses Modell in einer Veranstaltung am 25. Februar.
Eine gerechtere Zukunft der CareArbeit ist mit Kosten verbunden. Allerdings: Im Vergleich zu den oft ausgeblendeten, ungerecht verteilten und viele überfordernden Kosten und Lasten der gegenwärtigen Care-Krise sind sie mehr als vertretbar. Es sind dringend notwendige Investitionen in ein gutes Leben für alle. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung


traumasensible demokratiebildung
// von karin hutflötz
Diejenigen, die sich derzeit in Bildung für Demokratie, Vielfalt und Gerechtigkeit einsetzen, stehen vielfach unter Druck: Sie sind Anfeindungen und Diskriminierungen ausgesetzt, müssen innere und äußere Konflikte gut einschätzen können und mit emotional aufgeladenen Situationen und nicht selten mit traumatisierten Menschen Umgang finden. Demokratische Werte scheinen immer vehementer in Frage gestellt, zudem werden nicht nur die diskursiven, sondern auch die mentalen Herausforderungen, Verantwortungen und Bildungs-Bedarfe in dem Feld immer komplexer und schwieriger.
Was kann also helfen, um in diesen Krisen-Zeiten anders mit Zielgruppen umzugehen? Wie kann man Beteiligte mental stärken? Wo erfahren sie mehr darüber, wie persönliche Konflikte sich auf soziale Beziehungen und auf die politische Ebene auswirken?
Ellen Ammann
Ein Tagungsprojekt nimmt Fahrt auf. // stephan mokry
Eine katholische Schwedin, die ab spätestens 1900 bis zu ihrem Tod 1932 das kirchliche Leben in München und sogar ganz Bayern nachhaltig bis heute prägt: das war und ist Ellen Ammann. Die Katholische Stiftungshochschule (KSH) geht auf sie zurück, die Bahnhofsmission, der heutige IN VIA e.V., der Landesund der Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes, die bayerische Polizeiseelsorge und das Säkularinstitut der Ancillae Sanctae Ecclesiae. Dabei war Ammann keine weltabgewandte, lebensferne Asketin – sondern stand mitten im Leben als Ehefrau, Mutter, „Klinikmanagerin“ und eine der ersten weiblichen Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Sie hat wohl maßgeblich zur Verhinderung des Hitler-Putsches 1923 beigetragen. Am 18. Oktober 2024 trafen sich auf Initiative der Domberg-Akademie in der KSH Verantwortliche aus den mit Ammann historisch verbundenen Institutionen sowie Expert:innen aus der Wissenschaft (Profan- wie Kirchen-
VIA Bayern e.V. hat dazu erstmalig zusammen mit einem interdisziplinären Expert:innen-Team ein Onlinetool in Selbstlern-Modulen entwickelt, in dem Ansätze aus der Traumatherapie und Traumapädagogik für die Arbeit in der Demokratiebildung, politischen Bildung und interkulturellen Pädagogik angepasst wurden. Es bietet informative Erklärvideos, viel fachliches Wissen nebst wertvollen Anleitungen zur (Selbst-)Reflexion, didaktische Anregungen und konkrete Methoden für die Bildungspraxis. Mit dem Ziel, vor allem die Haltung und das Miteinander der Menschen und auch der politischen Bildner:innen zu stärken. •

dr. karin hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung

geschichte, Soziale Arbeit, Pädagogik) und dem Archivwesen, um sich intensiver miteinander zu vernetzen und sich über Themen und Inhalte rund um Ammann zu verständigen und diesen Kontur zu verleihen.
Über 30 Personen inklusive Studierender der KSH tauschten sich auf fachlicher wie persönlicher Ebene aus. In enger Kooperation mit Professorin Raika Lätzer (KHS) werden wir die Ergebnisse zu einer für Herbst 2025 geplanten Tagung über Ellen Ammann weiterentwickeln. •

dr. stephan mokry ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung
• Bildung in Krisenzeiten braucht Stärke
• Neues Tagungsprojekt zu Ellen Ammann

Traumasensible Demokratiebildung
In Kooperation mit dem VIA Bayern e.V. Menschen, die sich in Bildung für Demokratie, Vielfalt und Gerechtigkeit einsetzen, stehen unter Druck: Was kann uns helfen in diesen Zeiten, unsere Aufgaben kraftvoll und zuversichtlich zu meistern? Wie können wir anders mit unseren Zielgruppen umgehen?
Was kann uns alle stärken?
Die Veranstaltung richtet sich an alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen, nicht nur, aber vor allem in der politischen und sozialen Bildungs- und Beratungsarbeit –und an alle Interessierten.
Was stärkt uns? Traumasensible Demokratiebildung – ONLINE Online-Vorstellung des Online-Tools und seiner Anwendung. Eine Einführung zu Traumapädagogik in der Demokratiebildung mit Kathrin Kuhla und Nils Hackstein.
Termin Di, 21.01.2025
Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr
Mit Katrin Kuhla, Nils Hackstein
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mo, 20.01.2025
Traumasensible Demokratiebildung –wie geht das?
Eine Fortbildung zu ausgewählten Themen der Traumapädagogik und Demokratiebildung für Multiplikator:innen. Ein Vertiefungsseminar zum Online-Tool.
Termin Fr, 21.03.2025
Beginn / Ende 13.00 / 18.00 Uhr
Mit Katrin Kuhla,
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz
Teilnahmegebühr EUR 60,00, inkl. Pausenverpflegung
Ort Katholische Hochschulgemeinde an der LMU, Leopoldstr. 11, 80802 München Anmeldeschluss Mo, 10.03.2025

Was bedeutet es für die Praxis der Kirche, wenn die Kirchen immer leerer werden, vielen die Formen und die Sprache des Glaubens fremd geworden sind? Was ist zu tun - gerade im süddeutschen Raum und in den Alpenregionen, in denen Kirche bisher in den Traditionen verankert war? // fragt claudia pfrang
Auch wenn die Kirchen nach wie vor unübersehbar in der Mitte unserer Dörfer und Städte stehen, so fremdelt auch im süddeutschen Raum und in den Alpenregionen „das Volk“ mit der Kirche. Kirchenräume sind oft viel zu groß, die Formen und Worte fremd, die Regeln der Gemeinschaft wie aus der Zeit gefallen. Vieles passt auch hier nicht mehr zusammen. Heimatsound und der Anschluss an die Lebenswirklichkeiten gelingen scheinbar woanders besser. War also bisher dort noch die Kirche in den Traditionen vor Ort stark verankert, so wandelt sich das spätestens seit Corona rapide. Der Wegbruch an Kirchenmitgliedern mit den damit einhergehenden finanziellen Einbußen für die Kirchen werden dazu führen, dass Kirche ganz anders werden muss. Was das bedeuten könnte, zeigt sich wie in einem Brennglas an der Diskussion um leerstehende Kirchengebäude und kirchliche Immobilien. Oft wird diese mit viel Emotionen geführt. Finanzielle und pastorale Herausforderungen rühren an existentielle Erfahrungen und damit einhergehende tiefe Verbundenheitsgefühle. Und in all dem leuchtet die Frage auf:
Wie anders wird diese Kirche? Was lohnt sich „mit hinüber zu nehmen“? Und was ist nun wirklich mittlerweile „hinüber“?
In vielen nord- und ostdeutschen Regionen, in denen diese Prozesse schon weiter fortgeschritten sind, sind im Rahmen dieser Umbrüche oft ganz spontan informelle Netzwerke entstanden, bei denen sich Menschen über Konfessionsgrenzen hinaus verbinden, sich gegenseitig unterstützen und miteinander reflektieren, was da geschieht. Bekannter sein dürften die Stichworte wie „Fresh X“ und „Kirche hoch zwei“.
Aber wie steht es mit dem Süden Deutschlands oder noch spezifischer dem Alpenraum? Beides taucht bisher meist nur am Rande auf. Bei vielen Konferenzen stellen wir immer wieder fest, dass Teilnehmende an den Netzwerken v.a. aus dem nord- und ostdeutschen Raum kommen, was in gewisser Weise auch Einrichtungen widerspiegeln, die auf Ebene der Fachtheologie die Transformationsprozesse begleiten: das ZAP als Forschungscluster an der Universität in Bochum oder das KAMP als Arbeitsstelle der DBK in Erfurt. Dabei liegt in der spezi-

fischen Prägung der süddeutschen Region ein enormes Potential. An dieser Leerstelle setzt unser Projekt an. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, auch für diesen geographischen Raum sowie besonders die Alpenregionen ein Netzwerk derer, die Transformation gestalten und reflektieren, aufzubauen. Wir wollen Aktive vor Ort vernetzen, Kompetenzen bündeln, Ressourcen erschließen und diese Kraft der theologischen Reflexion für den Weg der Kirche in die Zukunft nutzen.
Denn wir sind überzeugt: Zu viele und zu große Gebäude sind mehr als nur eine Baulast. Wir ahnen, dass in den fremden Worten der Tradition noch viel Kraft und Weisheit steckt und eine Gemeinschaft, die sich vom Evangelium her prägen lässt, hoch aktuell sein könnte. Sie können auch Ansatzpunkt sein für eine neue Weise, das Evangelium zu leben: Kirche, aber anders.
Mit dem Projekt „hinüber“ möchten wir Kreative und Kluge im Süden Deutschlands und im Alpenraum zusammenbringen, Routinen durchbrechen, über den Tellerrand schauen und uns gegenseitig inspirieren und stärken.
Es freut uns sehr, dass wir den Pastoraltheologen Prof. Dr. Christian Bauer (Münster, davor Innsbruck) für die Projektgruppe gewinnen konnten, der sich für eine Theologie an sog. Andersorten stark macht und mit dem süddeutschen Raum und dem Alpenraum sehr verbunden ist. Mit Dr. Florian Schuppe denkt ein erfahrener Ökumeniker mit, der schon seit vielen Jahren die Themen rund um Transformation, Ab- und Aufbruch im Ressort Grundsatzfragen und Strategie des Münchner Ordinariats durch Netzwerke wie „Hoffnungsvol(l)k“ oder „Spurenleger“ mitgestaltet.



Gefördert durch die KEB Bayern
Einladung zur ersten hinüber Manufaktur Zum Auftakt des „hinüber“ laden wir haupt- und ehrenamtliche Multiplikator:innen lokaler Kirchentransformation zu einer hinüber Manufaktur am 15./16. Mai 2025 nach Kloster Beuerberg ein. Beuerberg als Ort der Transformation in der Erzdiözese München und Freising ist für uns der ideale Ort für die Erkundungen des Hinüber. Denn dort kommen alte Klostertraditionen und neue Handwerkskunst zusammen, dort wurde neu gebaut und wird versucht, Altes neu zu beleben. Dafür steht unter anderem der Begriff Manufaktur. Historisch steht eine Manufaktur zwischen traditioneller Handarbeit und moderner Fabrik, ist selbst ein „hinüber-Ort“. Zugleich zeichnet sie sich aus durch das Wirken von hochprofessionalisierten Spezialist:innen, die ein Produkt, ein gemeinsames Ziel in Teilschritten zusammen realisieren wollen.
Exploration – Inspiration –Konspiration ...
... sind die drei Schritte, die unsere erste hinüber Manufaktur prägen werden. In der Explorationsphase fragen wir: „Was ist hinüber? Von der Volkskirche und was danach ist“. Warum ist es wert, dass ich es hinübernehme?
Was ist schon drüben? Wir erkunden dazu den Ort und die eigenen Hintergründe, aus denen die Teilnehmenden kommen.
In Tellerrandgesprächen mit Personen möchten wir inspirieren, den Blick in die Weite und Tiefe des „hinüber“ zu werfen. Wie erleben Menschen jenseits von kirchlichen Kontexten den religiösen Abbruch und leere Kirchen? Was kann Kirche heute noch beitragen für die Gesellschaft vor Ort und wie können Umnutzungen kirchlicher Gebäude aussehen? Der Abend widmet sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff mit einem selbstironischen Augenzwinkern und hoffentlich mit viel Leichtigkeit.
Und danach geht es um das konspirative Zusammensetzen. Mit Ihnen wollen wir neue Geschichten erzählen, Geschichten des Hinübers und Geschichten von Drüben. Wir freuen uns hier auf das Denken gemeinsam mit Ihnen, mit Ihren Ideen und Ihren Transformationserfahrungen – damit Kirche anders wird.
Neben der Inspiration durch die Teilnahme an unserer hinüber Manufaktur werden verschiedene Tools für die lokale Kirchentransformation vorgestellt, die vor Ort eingesetzt werden können.
• hinüber. Damit Kirche anders wird
Das bekommen Sie in unserer hinüber Manufaktur
Mehr als religiöse Folklore: Katholischer Süden als Kontext einer liebenswerten Kirche von morgen
Mehr als Relikte der Volkskirche: Offene Heimat als Ort für die Sehnsucht nach dem guten Leben
Mehr als Organisationsberatung: Kreative Theologie als Ressource einer anderen Pastoral
Mehr als totes Kapital: Innovative Immobiliennutzung als Ansatzpunkt lokaler Kirchenentwicklung
Mehr als ein punktueller Beratungsimpuls: Begleitetes Netzwerk als Instrument pastoraler Nachhaltigkeit
Und danach? Diese hinüber Manufaktur ist gedacht als Auftakt für ein Kompetenznetzwerk, das Ressourcen sichtbar macht – im Blick auf inhaltliche Transformationskompetenzen wie auch Tools für den Einsatz in lokalen Transformationsprozessen. Bei Bedarf und Interesse ist geplant, weitere Manufakturen anzubieten. Wir sind gespannt, wo uns hinüber hinführen wird. •

dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie


Vorträge, Seminare, Workshops: Themenbezogene Highlights von Kreisbildungswerken in der Erzdiözese München und Freising zum Saisonthema „In Verbindung gehen“.
dachau
fürstenfeldbruck
münchen
miesbach
landshut
mühldorf
landshut
„Das wird man wohl noch sagen dürfen!“
Ein Vortrag über die Achtsamkeit in der Sprache

Eine gemeinsame Veranstaltung des Erzbischöflichen Dekanats Landshut und des CBW Landshut. Unsere Sprache entwickelt sich. Vieles, was wir in unserer Kindheit und Jugend gesagt haben, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Immer häufiger werden vertraute Wörter und Ausdrücke, bei denen wir nie etwas Böses gemeint haben, zum Tabu. Was soll denn an dem schönen Lied „Zigeunerjunge“ verkehrt sein? Dürfen Kinder heutzutage nicht mehr „Cowboy und Indianer“ spielen? Warum muss ich plötzlich „Schaumkuss“ sagen und was soll dieses Gendern?
Im Vortrag werden die Herkunft und Bedeutung von Ausdrucksweisen erläutert, um Klarheit in die verwirrenden Entwicklungen von „Political Correctness“ in unserem Alltag zu bringen. Dieser Vortrag richtet sich an alle, die sich für den Wandel unserer Sprache interessieren und besser verstehen möchten, was hinter den aktuellen Sprachdebatten steckt. Zudem richtet er sich an jene, die nach einem Kompass suchen, um sich heutzutage sensibel auszudrücken.
Der Referent Andy Kuhn (Jahrgang 1982) ist Autor und Musiker in mehreren Projekten. Er studierte Literatur und Sprachwissenschaft, Politikwissenschaft, Medien und Kommunikation in Regensburg.
Termin Mi, 26.03.2025
Beginn / Ende 19.00 / 21.00 Uhr
Mit Andy Kuhn
Teilnahmegebühr EUR 5,00
Ort Pfarrzentrum St. Martin, Landshut Martinsfriedhof 225, 84028 Landshut Info https://www.cbw-landshut.de/veranstaltungen/details/55076_das-wirdman-wohl-noch-sagen-duerfen Anmeldung ist nicht notwendig, aber erwünscht

münchner bildungswerk
Demenz Stunde – Online-Reihe
Demenz verstehen – Selbsterleben von Menschen mit Demenz
In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk e. V. Die digitale Veranstaltungsreihe „Demenz-Stunde“ will Wissen vermitteln und praktische Beratung geben, um verunsichernde Alltagssituationen besser zu bewältigen – mit dem Ziel, Sie zu entlasten und gleichzeitig die Lebenswelt dementiell erkrankter Personen besser zu verstehen. Es handelt sich um eine digitale Veranstaltung, bei der eine Referentin live spricht und Teilnehmende sich von zu Hause aus über ein digitales Endgerätzuschalten können. Sie erhalten einige Stunden vor Veranstaltungsbeginn einen Zugangslink zum Zoom-Meeting über Ihre E-Mail-Adresse.
Weitere einzeln buchbare Module aus dieser Reihe: Kommunikation mit Menschen mit Demenz 19.03.2025 | 16.00–17.15 Uhr
Infos und Anmeldung Münchner Bildungswerk: Veranstaltung
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 07.04.2025 | 16.00–17.15 Uhr
Infos und Anmeldung Münchner Bildungswerk: Veranstaltung
Termin Mo, 03.02.2025
Beginn / Ende 16.00 / 17.15 Uhr
Mit Iris Gorke, Dipl.-Sozialpäd. (FH), Alzheimer Gesellschaft e.V. Teilnahmegebühr Die Veranstaltung ist kostenfrei dank der Förderung durch die Willi-Gross-Stiftung.
Ort Online via Zoom
Infos und Anmeldung Münchner Bildungswerk: Veranstaltung Anmeldeschluss Mo, 03.02.2025

miesbach
Mit Herz und Klarheit –Wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht
Wir reden heute viel von den Bedürfnissen der Kinder, an denen wir uns orientieren wollen. Aber welche Bedürfnisse haben Kinder? Und wie kriegen wir diese mit den Bedürfnissen der Familie und den eigenen Bedürfnissen als Eltern unter einen Hut? Und überhaupt: Wie werden Kinder stark? Nur dadurch, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen?
Ein Online-Vortrag des Spiegel-Bestseller-Autors Dr. med. Herbert Renz-Polster rund um die Entwicklung der Kinder und was im Leben mit Kindern sonst noch zählt, aus der Reihe „KBW Digital“.
Termin Mi, 12.02.2025
Beginn / Ende 20.00 / 21.30 Uhr
Mit Dr. med. Herbert Renz-Polster Teilnahmegebühr EUR 9,00 bzw. EUR 12,00 für Paare Ort Online-Vortrag per Zoom
Info www.kbw-miesbach.de
Anmeldung KBW Miesbach, Tel. 08025/99 29-0, info@kbw-miesbach.de (sowie weitere Bildungswerke im Rahmen der „KBW Digital“-Initiative)
Anmeldeschluss Mi, 12.02.2025, 12 Uhr
keb münchen und freising
Gott spricht: „Doch ich lasse nicht alles durchgehen.“
Gegen Schwarz-Weiß-Denken – Für Menschlichkeit & Vielfalt
In unserer zunehmend komplexen Gesellschaft suchen viele Menschen nach einfachen Lösungen – auch in den Kirchen. Dies passt nicht zu einer soliden biblisch-fundierten Glaubensund Lebensweise. Vielfalt und Menschlichkeit sind ein hohes Gut, das durch aktuelle Entwicklungen bedroht ist. Wir wollen einander ermutigen, Unterschiede positiv wahrzunehmen und konstruktiv damit umzugehen. Dr. Philipp Hildmann, Geschäftsführer des Bayer. Bündnisses für Toleranz, beobachtet seit Jahren kritisch extremistische Tendenzen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Gemeinsam mit Dr. Christine Abart (Haus St. Rupert Traunstein), Max Aman (KEB München und Freising), Sr. Susanne Schneider (missio München) und Barbara J. Th. Schmidt (Bildungshaus LVHS Niederalteich) wirbt er dafür, als Christinnen und Christen für Demokratie und Menschenwürde einzutreten.
Die Veranstaltung findet kostenfrei online via Zoom statt. Den Zugangslink erhalten Sie nach Anmeldung. In Kooperation mit Missio München, Misereor in Bayern, Haus St. Rupert Traunstein, KLVHS Niederalteich.
Termin Mi, 19.02.2025
Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr
Mit Barbara J. Th. Schmidt, Dr. Christine Abart, Dr. Philipp Hildmann, Max Aman, Sr. Susanne Schneider Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online via Zoom
Info https://www.keb-muenchen.de/veranstaltungen/ details/13639_gott-spricht-doch-ich-lasse-nicht-alles-durchgehen-ex-34-7
Anmeldeschluss Di, 18.02.2025
dachauer forum
Von der Hoffnung erzählen, die uns erfüllt Gesprächsabend mit Herrn Weihbischof Wolfgang Bischof
„Die gute Nachricht zuerst!“ Da denken wir Christen an das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu. Aber was kann das in unserer Zeit bedeuten? Worum geht es bei dieser christlichen Hoffnung? Gibt es trotz aller Krisen innerhalb der Kirche unserer Erzdiözese solche Hoffnungszeichen und positiven Zukunftsperspektiven?
Termin Mi, 19.02.2025
Beginn / Ende 19.30 / 21.30 Uhr Mit Weihbischof Wolfgang Bischof, Weihbischof im Erzbistum München und Freising Verantwortlich Annerose Stanglmayr Teilnahmegebühr Gebührenfrei, Spenden erwünscht Ort Ludwig-Thoma-Haus Dachau, Erchana Saal, Augsburger Str. 23, 85221 Dachau Info https://www.dachauer-forum.de/veranstaltung/ von-der-hoffnung-erzaehlen-die-uns-erfuellt/ Anmeldeschluss Mo, 17.02.2025
mühldorf
Männer sind keine Altersvorsorge Kompaktkurs Vorsorge und Absicherung für Frauen
Ziel des Kurses ist es, Frauen auf dem Weg zu selbstbestimmten Finanzentscheidungen zu unterstützen.
Der Finanzberater Arthur Wilm – Coach, Finanzberater und Trainer Verbraucherbildung – wird über wichtige Aspekte informieren und Fragen dazu beantworten.
Termine Fr, 21.03.2025
Beginn / Ende 18.30 / 21.00 Uhr
Mit Arthur Wilm Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online Info https://www.kreisbildungswerk-mdf.de/ veranstaltung-41399
Anmeldeschluss Mo, 17.03.2025

brucker forum Letzte Hilfe –Begleitung und Umsorgen am Lebensende
Das Lebensende und Sterben macht Mitmenschen oft hilflos. Sterbebegleitung ist vielfach auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich. Wir vermitteln in diesem Kompaktkurs Grundwissen, zeigen einfache Handgriffe und möchten ermutigen, sich schwerkranken und sterbenden Menschen zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen. Begleiten und Umsorgen am Lebensende braucht ein bisschen Mut und Wissen, das wir hier vermitteln möchten.
In Kooperation mit dem Hospiz Germering
Termin Mi, 09.04.2025
Beginn / Ende 16.00 / 20.00 Uhr
Mit Jacqueline Stryczek, Palliativ Care Pflegekraft
Susanne Heußler, Krankenschwester, Caritas-Sozialstation Verantwortlich Annette Koller, koller@brucker-forum.de Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Hospiz Germering, 82110 Germering
Info https://www.brucker-forum.de/veranstaltungen/ details/42879_letzte-hilfe-begleitung-und-umsorgen-amlebensende
Anmeldung unter www.brucker-forum.de
Anmeldeschluss Mi, 09.04.2025

Fortsetzung unseres Listening-Projekts:
Ihre Anliegen und Erwartungen sind uns wichtig!
GGerade angesichts gegenwärtiger Krisen und Transformationsprozesse steht für uns fest: Wir möchten ganzheitliche Bildung für und mit den Menschen gestalten, von und miteinander lernen und einen Raum für Begegnung auf Augenhöhe schaffen. Dazu möchten wir – wie bereits in der Corona-Pandemie – INNEHALTEN und Ihnen ZUHÖREN:
Was bewegt Sie?
Welche Herausforderungen sehen Sie?
Was erwarten Sie konkret von der Domberg-Akademie?
Egal wie Sie mit uns in Kontakt treten: Wir sind DA und hören Ihnen zu!

Unser Online-Shop ist in Arbeit
Nutzen Sie demnächst die Möglichkeit, sich bequem und direkt über die Online-Shop-Funktion noch einfacher zu unseren Veranstaltungen anzumelden oder weitere Produkte und Angebote zu erwerben.

Teilen Sie uns Ihre Anregungen, Wünsche und Gedanken mit. Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:
Rufen sie über den QR-Code unseren „DA hören wir Ihnen zu“-Fragebogen auf und füllen ihn online aus oder schreiben Sie uns Ihre Gedanken ganz frei per E-Mail an: info@domberg-akademie.de, Stichwort: „DA hören wir Ihnen zu“
Kommen Sie mit uns ins Gespräch: Vereinbaren Sie per E-Mail einen individuellen Telefontermin mit unserer Direktorin Dr. Claudia Pfrang oder unseren Bildungsreferent:innen. Die Kontaktdaten der einzelnen Ansprechpartner:innen finden Sie auf unserer Homepage unter „Über uns“. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!


Hier gehts zum Online-Fragebogen „DA hören wir Ihnen zu“
Unser neues Teammitglied im Themenbereich Religion und Kirche stellt sich vor:
MMein Name ist Viola Kohlberger, ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit Mitte Oktober 2024 im Team der theologischen Erwachsenenbildung bei der Domberg-Akademie. Parallel schreibe ich an meiner Dissertation im Bereich der Neueren Kirchengeschichte über die katholische Jugendverbandsarbeit im Bistum Augsburg von 1945 bis 1963. Ich wohne schon viele Jahre in München, war bis Anfang November aber noch beim Bistum Augsburg als Diözesankuratin der Deutschen Pfadfinder*innenschaft St. Georg tätig. Ehrenamtlich habe ich mich zusätzlich von 2019 bis 2023 als Mitglied des Synodalen Weges engagiert und dort unter anderem den theologischen Grundlagentext mitgeschrieben. Ganz besonders schlägt mein Herz schlägt für Jugendverbandsarbeit, Bildungsarbeit, Geschlechtergerechtigkeit, Kirchengeschichte und Kirchenpolitik. Ich freue

mich sehr auf die vielfältigen Aufgaben, spannenden Themen und interessanten Menschen bei der DombergAkademie und auf viele bereichernde Veranstaltungen und Angebote, an denen ich nun aktiv mitwirken darf. Besonders gespannt bin ich auf die Begegnungen und Diskussionen, wenn ich mit Ihnen über Gott und die (Kirchen- und Glaubens-)Welt nachdenken darf. •
Um allen Interessierten die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten offen zu halten, machen wir es allen Interessierten möglich, ausgewählte Veranstaltungen kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.
In unserem Solidarmodell der Domberg-Akademie kalkulieren wir eine empfohlene Teilnahmegebühr, z.B. EUR 9,00. Ist Ihnen diese Teilnahmegebühr nicht möglich, können Sie beim Buchen der Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt auswählen und erhalten einen ermäßigten Zugang zur Veranstaltung.
Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Auch dies ist frei anwählbar bei der Buchung mit „*“ gekennzeichneter Veranstaltungen.
Weitere Informationen zum Solidarmodell und unserem vielfältigen Bildungsangebot, unseren Aktivitäten und Bildungsmaterial finden Sie auf unserer Website: www.domberg-akademie.de
Sie möchten kein Angebot der DombergAkademie mehr verpassen? Dann abonnieren Sie einen unserer Newsletter und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: www.domberg-akademie.de/newsletter
Instagram instagram.com/domberg_akademie/ Facebook facebook.com/dombergakademie YouTube youtube.com/c/DombergAkademie Twitter mobile.twitter.com/claudiapfrang
Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell in unserem Veranstaltungskalender auf der Website. Hier können Sie sich auch bequem online für alle Angebote anmelden! www.domberg-akademie.de/veranstaltungen
KONTAKT
Domberg-Akademie
Hildegard Mair (Kursmanagement)
Untere Domberggasse 2 85354 Freising
Tel.: 08161 181-2177 info@domberg-akademie.de
erfahren Sie mehr
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen des Saisonthemas auf unserer Website.


da ist das Magazin der Domberg-Akademie
Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising Untere Domberggasse 2 85354 Freising www.domberg-akademie.de
Verantwortlich für den Inhalt (V.i.S.d.P.): Dr. Claudia Pfrang, Direktorin
Redaktion DA: Dr. Stephan Mokry, Dr. Claudia Pfrang, Geraldine Raithel
Konzeption Magazin: André Lorenz Media & Merchandise GmbH, www.andrelorenz.de
Gestaltung dieser Ausgabe: Geraldine Raithel
Lektorat: Kathrin Hoffmann
Bildbearbeitung: Holger Reckziegel
Druck: Lerchl-Druck e. K., Liebigstraße 32, 85354 Freising www.lerchl-druck.de
Gedruckt mit mineralölfreien Ökofarben auf 100% Recyclingpapier.

Bildnachweise: Cover, S. 4, 6–7, 14/15, 35: iStock/ultramansk // S. 5: iStock/solarseven (oben), privat (unten) // S. 9: shutterstock/Branislav Nenin // S. 10: links/privat, rechts/Sophia Aigner // S. 11: privat // S. 12: iStock/DisobeyArt // S. 13: iStock/FangXiaNuo // S. 14: shutterstock/BongkarnGraphic // S. 16: shutterstock/Orawan Pattarawimonchai // S. 22: shutterstock/oneinchpunch // S. 23: Domberg-Akademie // S. 24: iStock/clu // S. 26: iStock/Eoneren // S. 28: shutterstock/pikselstock // S. 29 oben: iStock/Denis Novikov; unten: Domberg-Akademie // S. 30: iStock/Jiri Vlach // S. 31: Fotoagentur Kiderle // S. 32: Andy Kuhn // S. 33: shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A, AdobeStock/ C.Schüßler // S. 34: shutterstock/TanyaKim // alle Fotos der Mitarbeitenden der Domberg-Akademie: Fotoagentur Kiderle oder privat.
Wir bemühen uns sorgfältig um die Bildrechte der von uns verwendeten Bildmotive. Sollten wir eines versehentlich vergessen oder falsch bezeichnet haben, bitten wir um Nachricht.









www.caritas-nah-am-naechsten.de