
www.domberg-akademie.de



www.domberg-akademie.de

Über Mythen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz
Katholische Kirche und radikale Rechte
Tagung zum Thema Umkämpfte Menschenund Familienbilder
Die Psychologie der Klimakrise
Was braucht es, um uns zur Transformation zu bewegen?
#weiter.glauben Was kommt danach?
Auferstehung der Toten und das ewige Leben –reine Symbolrede?


Welche Haltungen brauchen wir, um die Zukunft unserer Gesellschaft menschlich zu gestalten?
Der Jesuit und Pädagoge Klaus Mertes ist überzeugt: Es ist die Herzensbildung, auf die es ankommt. In seinem Buch warnt er davor, unser Bildungssystem weiterhin nach den Forderungen des Marktes und den Ergebnissen internationaler Vergleichsstudien auszurichten. Und er plädiert dafür, christliche Haltungen wie Dankbarkeit, Umkehr und Demut wieder in die Mitte unserer Aufmerksamkeit zu rücken. Ein notwendiger und inspirierender Appell.
Jetzt eintauchen –Radio mit Tiefgang.
MKR – das Radio im Michaelsbund


• Dr. Claudia Pfrang Direktorin der Domberg-Akademie
cpfrang@ domberg-akademie.de
WWas wird Sie bewegen, wenn Sie dieses Heft in den Händen halten? Treffe ich den passenden Ton, verwende ich Worte, die Sie berühren, werden meine Gedanken bei Ihnen ankommen? Dies sind Fragen, die mich und mein Team bei der Planung unseres Magazins sehr bewegen, und ich freue mich, liebe Leser:innen, jedes Mal über Resonanz von Ihnen – ob positiv oder negativ. Beides hilft uns, besser zu verstehen, was Sie interessiert und bewegt.
Doch jedes Mal ist das weiße Blatt eine Herausforderung. Um die Angst davor zu umgehen, habe ich bereits einmal ChatGPT ausprobiert. Ich habe diese Künstliche Intelligenz mit den für mich wichtigen Stichworten gefüllt –im Fachjargon „ich habe gepromptet“ – und in diesem Fall das „Large Language Model“ (LLM) gebeten, einen Artikel zu schreiben. Heraus kam ein ganz passabler Text. Aber so würde ich ihn nie schreiben.
Die KI kann uns Recherchetätigkeiten abnehmen, kurze Programmtexte schreiben und Zusammenfassungen produzieren – das mittlerweile sehr gut. Ab und an setzen wir KI zur Arbeitserleichterung ein. „Je mehr wir, eine ethischpolitische Einhegung vorausgesetzt, die spezifische Kraft der KI als Entlastung und Unterstützung zum Zuge kommen lassen, desto mehr kann sich auch das entfalten, was eben nur der Mensch kann und die KI niemals können wird“, schreibt mein Kollege Dr. Thomas Steinforth in der lesenswerten Coverstory (S. 8) zu unserem Saisonthema „Heilsversprechen KI. Mythen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz“. Immer wieder stellt sich also die Frage: Wo kann uns die KI entlasten und Freiräume schaffen – und was kann sie eben nicht, weil es spezifisch menschliche Fähigkeiten erfordert? Zum Beispiel beim Schreiben eines Textes, der ansprechen und bewegen soll.
Das Schreiben verdeutlicht für mich zwei Eigenschaften des Menschen im Unterschied zur Künstlichen Intelligenz: Kreativität und Nachdenken. Die KI arbeitet mit Daten, Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten. Für mich ist Schreiben ein höchst kreativer und persönlicher Prozess. Wenn ich beginne, habe ich in der Regel einige Ideen, aber der Text entsteht im Schreiben, in der Aneinanderreihung von Gedanken. Idealerweise fließen die Gedanken und Wörter, es entsteht ein Flow, am Ende ein Gefühl der Zufriedenheit und vielleicht sogar des Glücks. Aber es gehört auch die leere Seite, das unbeschriebene Blatt dazu. Nicht umsonst sagt man, man brauche zum Schreiben einen freien Kopf. Ich jedenfalls brauche das, und so sind die frühen Morgenstunden oder Wochenenden für mich eher die Schreibzeiten als zwischen Terminen im Laufe der Woche. Am Beginn steht das Nachdenken darüber, was wohl für Sie in Gesellschaft und Kirche wichtig ist.

Ich lese und recherchiere – dabei helfen Suchmaschinen und KI, die wir auch in der Programmplanung einsetzen. Aber: Sie ersetzen nie das Nachdenken, das „theoretische Informationen, Erfahrungen, Empfindungen, Stimmungen miteinbezieht. Menschliches Nachdenken, das Gedanken hervorbringt, die sich aus dem permanenten Informationsstrom abheben.“ (Sibylle Anderl)
Die Zeit zum Nachdenken ist knapp geworden in der medial schnelllebigen und verdichteten Welt. Wenn wir Zeit haben, füllen wir sie oft sofort mit allerlei Social-Media-Ablenkungen. Zeit zum Nachdenken ist ein rares und kostbares Gut in Zeiten der aufgewühlten Stimmungen und rasanten Umbrüche. Wer kann es sich heute schon leisten, sich einfach mehrere Tage freizuhalten zum Nachdenken? Aber wir sollten es tun. Um komplexe Situationen zu durchdenken und zu informierten und begründeten Entscheidungen zu gelangen. Wer nie darüber nachdenkt, ob die Richtung stimmt, landet schnell in der Sackgasse. Und aus der holt uns auch die KI nicht heraus.
Saisonthema HEILSVERSPRECHEN KI Veranstaltungen zum Saisonthema KI finden Sie nicht nur auf Seite 15, sondern auch in allen Themenbereichen mit diesem Button.
Wir hoffen sehr, dass unsere Angebote für Sie gut durchdacht sind und Ihnen immer wieder Raum öffnen, neu zu denken. Für den Herbst, der vielleicht auch für Sie mit einem vollen Arbeitsalltag und Terminkalender verbunden ist, wünsche ich Ihnen viele Nachdenk-Zeiten.
Ihre



5 WIE WAR‘S?
DAS MAGAZIN DER DOMBERG-AKADEMIE UNSERE TOP-ANGEBOTE VON SEPTEMBER 2024 BIS FEBRUAR 2025
Rückblick auf das Saisonthema "Die Kraft der Künste"
6
MYTHEN UND MÖGLICHKEITEN DER KI
Dramatisierende Mythen zur KI hinterfragen
10
DREI FRAGEN ZU KI
Erfahrungen – Befürchtungen – Chancen
12
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS ENTFESSELTE MASCHINE? Was Science-Fiction-Filme über unsere Ängste und Wünsche offenbaren
15
DIE TOP-VERANSTALTUNGEN ZUM SAISONTHEMA
29

KENNEN SIE

30 SPECIALS
• Gut.Katholisch.Queer Foto-Installation in St. Paul München
• Eine bewährte Weiterbildung in neuer Form Interregligiöse Dialogbegleiter:in überarbeitet
16
DEMOKRATIE & ETHIK
• Demokratiebremse? • Das Familiengeflecht im Fokus
18
KOMPETENZZENTRUM
DEMOKRATIE UND MENSCHENWÜRDE
• Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?
19
INTERKULTURELLE BILDUNG
• Entwicklungskomponente Diversität
20
RELIGION & KIRCHE
• Dignitas infinita
• Fazit der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie 22
UMWELT & NACHHALTIGKEIT
• Europa-Wahl und die Umweltpolitik
• Update Escape Game 24
KULTUR & KREATIVITÄT
• Lesen neu entdecken • Rückblick Kalligraphie-Ausstellung 26
PERSÖNLICHKEIT & PÄDAGOGIK
• Abschied und Trauer • Das „Wir“ und das „Ich“
28
WERKSTATT ZUKUNFT
• Wohin wandelt sich die Bildungslandschaft?
32 ANGEBOTE HIGHLIGHT VERANSTALTUNGEN aus der Katholischen Erwachsenenbildung
Emotion.Transformation.Revolution – Kunst macht viel möglich Reflexionen zum Saisonthema // von magdalena falkenhahn
Klänge mit melodischer Sogwirkung und belebender Rhythmik, davon begleitet Menschen in einer großen Kreisbewegung, die in diesem Moment eine besondere Erfahrung des gemeinsamen Unterwegsseins und Miteinanders machen: Unsere Veranstaltung zum Saisonthema-Abschluss machte die Kraft erlebbar, die in den Künsten steckt.
Das war unser Ziel. Denn als Bildungseinrichtung wollten wir im zweiten Saisonthema 2024 unter Einbezug der Künste in ganz besonderer Weise Nachdenklichkeit erzeugen, Fragen aufwerfen, Komplexität deutlich machen und Dinge andersherum denken – und so die Menschen in unserem generellen Ansinnen unterstützen, in dieser hochkomplexen Zeit Orientierung zu finden. In Deutschland wird Bildung in der Regel als erstes mit dem Verstand verbunden. Es geht ums Analysieren, Wissen-Aneignen – und das ist natürlich auch gut und wichtig. Die leibliche, sinnliche Erfahrung kommt dabei leider oft zu kurz und überdies wird ihr selten ein Bildungswert zugesprochen. Dabei ist es – so denken wir bei der Domberg-Akademie – essenziell, den Menschen in all seinen Dimensionen in den Blick zu nehmen. Besonders gelang dies in unseren zwei Leuchtturm-Veranstaltungen:
In der Kalligraphie-Ausstellung „EINANDER SEHEN – Judentum, Christentum und Islam begegnen sich in der Kunst der Kalligraphie“ konnten die Teilnehmenden sich in Musik, Poesie und Vorträgen Unvertrautem nähern, das Vertraute der eigenen Religion neu wahrnehmen und die Schönheit in allen Traditionen spüren (vgl. S. 29).
Das erwähnte Saisonthema-Finale mit der interdisziplinären Tanzperformance „Miteinander“ im Pop-Up der Domberg-Akademie zeigte, wie Menschlichkeit und Solidarität durch Kunst erlebbar gemacht werden können. Ein Bilderzyklus der Münchner Künstlerin Ariane Hagl, in dem sie sich mit der Frage nach Verbundenheit auseinandersetzte, bildete den Ausgangspunkt dieser Eigenproduktion. Die Performance eröffnete einen Erfahrungsraum, der ganz speziell die transformative Kraft der Künste spürbar machte. Zwischen Tanz, Musik, menschlicher Stimme und Momenten der Stille lösten sich im Laufe des Abends auch die Grenzen zwischen Performer:innen und Zusehenden auf, und alle Teilnehmenden waren dazu eingeladen, sich ebenfalls




Tänzer:innen der IWANSON international machen es vor, wie Musik, Bewegung und Raum zur Erfahrung inspirieren. Das Publikum folgte gern! Künstlerin Ariane Hagl (l.) und Magdalena Falkenhahn freuen sich über die gelungene Performance.
durch den Raum zu bewegen, schweigend in Kontakt zu treten, den Rhythmus zu spüren und Bewegungsimpulsen nachzugehen. In vielerlei Hinsicht ein bewegender Abend, der noch lange nachhallte und uns ermutigte, ästhetische Erfahrungen in der Bildungsarbeit zu nutzen und Themen immer wieder mit und durch die Künste zu vermitteln.
Darin bestärkte uns auch die Online-Reihe zum Saisonthema, die sich der Rolle der Kunst in Bildung widmete. Bei der Veranstaltung „Prinzip Hoffnung oder subversive Kraft?“ diskutierten Kunstpädagoge Prof. Dr. Johannes Kirschenmann und Künstlerin und Kunstpädagogin Angela Stiegler das Potenzial der Kunst für Perspektivwechsel und gesellschaftliche Neuerungen. Unser Fazit: Kunst ist ein Möglichkeitsraum des bisher nicht Gedachten und stärkt die Differenzierungsfähigkeit. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

Nicht nur hier: großes Publikumsinteresse an einem sinnenfälligen, dabei anspruchsvollen Programm während der erfolgreichen Kalligraphie-Ausstellung.

Dramatisierende Mythen zur KI zu hinterfragen, heißt nicht, ihre Bedeutung kleinzureden, sondern genauer hinzuschauen. Statt in Heilserwartung oder Gruselangst zu verfallen, sollten wir die realen Möglichkeiten der KI in den Blick nehmen. // von thomas steinforth


Wer Audrey Hepburn zu schätzen weiß, reibt sich irritiert die Augen: Der Roboter „Sophia“ soll der großen Schauspielerin und Stil-Ikone nachempfunden sein – so das Hongkonger Unternehmen Hanson Robotics. Es hat Sophia entwickelt und lässt sie seit 2018 durch internationale Konferenzen tingeln. Allerdings weist Sophia nicht einmal eine annähernde Ähnlichkeit mit Audrey Hepburn auf. Viel gravierender jedoch: Auch hinsichtlich sehr grundlegender Eigenschaften nimmt das Marketing des Unternehmens den Mund arg voll. So behauptet Sophia auf der Homepage, Gefühle zu haben und über eine basale Form von Bewusstsein zu verfügen.
Während die fehlende Ähnlichkeit mit Audrey Hepburn offensichtlich ist, dürften nicht wenige hinsichtlich der anderen Zuschreibungen (Bewusstsein, emotionales Erleben) unsicher sein oder sogar zustimmen. Schließlich hat Sophia eine recht differenzierte Mimik, sie scheint Gefühle auszudrücken, spricht mit einem modulierten Tonfall, stellt scheinbar Augenkontakt her, kann Gesichter wiedererkennen, auf Fragen antworten und sogar Witze machen. Kurzum: Sophia kann mitunter so erscheinen, als ob sie ein Mensch oder doch ein sehr menschenähnliches Wesen sei. Und doch bleibt es beim „als ob“, handelt es sich bei Sophia um die Simulation eines Menschen. Oder wie es der Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs auf den Punkt bringt: „Natürlich ist all dies nur ein Bluff“. Sophia sei trotz ihrer beeindruckenden technischen Leistungsfähigkeit nicht nur graduell vom Menschen unterschieden, sondern fundamental anders – nicht zuletzt deshalb, weil ihr ein bewusstes Erleben und die dafür notwendige lebendige Leiblichkeit fehlen. Was sie von sich gebe, seien „tönende Worte, wie die eines Papageis, beziehungsweise nicht einmal das, da ein Papagei seine Laute immerhin auch erlebt“.
Allerdings führt der technologische Fortschritt dazu, dass Simulationen wie Sophia immer besser werden, gleichsam „täuschend echt“ wirken. „Intelligente“ Maschinen und Anwendungen lassen sich von außen immer schwerer von Menschen „mit Leib und Seele“ unterscheiden. Immer häufiger können sie den Eindruck erwecken, tatsächlich und in einem menschlichen Sinne wahrnehmen, denken, verstehen, sprechen und entscheiden zu können.
Nicht zuletzt diese verführerische Kraft der Simulation kann uns empfänglich machen für Erzählungen und Botschaften, in denen die KI ungemein aufgeladen wird: Sie sei – so heißt es dann – in ähnlicher Weise intelligent wie der Mensch, werde ihn eines nicht fernen Tages in vielerlei Hinsicht übertreffen und gar zu einer Superintelligenz werden, der nicht selten gottähnliche Eigenschaften zugeschrieben werden, zum Beispiel Allwissenheit. Dieser meines Erachtens völlig überdrehte Diskurs mag zum Teil eine Marketingstrategie sein: Forschungs- und Entwicklungsprojekte wollen gefördert, Produkte und Dienstleistungen verkauft werden – dazu braucht es Aufmerksamkeit heischende Botschaften und Schlagzeilen. Nicht selten scheinen diese aber auch echter Überzeugung zu entspringen. Ray Kurzweil etwa, Entwicklungsleiter bei Google und zugleich eine Art KI-Prophet, dürfte seinen Prognosen zur immer näher rückenden „technologischen Singularität“ und ihrer gleichsam erlösenden Kraft selbst glauben.



Der Roboter Sophia soll Audrey Hepburn nachempfunden sein.
Einerseits wird die KI – oft diffus mit Robotik und Digitalisierung verwoben – mit regelrechten Heilsversprechen und Verheißungen verknüpft. Kaum ein Lebens- und Gesellschaftsbereich, für den nicht die Hoffnung auf umfassende KI-basierte technologische Lösungen, auf allumfassende Effizienz und Objektivität geweckt wird. Nur zwei ausgewählte Beispiele: Im „Tagesspiegel“ wurde jüngst mit Blick auf das grassierende Problem der Einsamkeit auf die Entwicklung „digitaler Begleiter“ verwiesen, und zwar nicht nur als notdürftiger Menschen-Ersatz oder unterhaltsame Abwechslung. Zu ihnen könnten wir womöglich sogar „viel tiefere Beziehungen“ als zu Menschen pflegen. Immerhin gibt es im Bericht auch die Frage, ob es nicht nur eine „Illusion der Nähe“ sei. Oder: In einem Artikel der „TAZ“ wurde vor kurzem ernsthaft erwogen, die Entscheidung in Asylverfahren der KI zu überlassen – diese sei doch unvoreingenommen und objektiv.
Noch wilder und quasi-religiös werden die frohgemuten Spekulationen, wenn sich futuristische Prognosen zu einer künstlichen Superintelligenz mit der Sehnsucht nach der transhumanistischen Überwindung menschlicher Endlichkeit verbinden – bis hin zur Verheißung eines unsterblichen „Geistes“, der sich in künstliche Strukturen „up-loa-

den“ und von seinen leiblichen Fesseln befreien lässt. Hier feiert eine uralte Leibfeindlichkeit fröhliche Urständ und verbündet sich mit einer reduktionistischen Sicht auf Seele und Geist.
Nicht weniger schlagzeilenträchtig als Heilsversprechen sind gruselige Untergangsszenarien. Diese knüpfen an alte Mythen und Geschichten an, in denen der Mensch ein ihm ähnliches Wesen erschafft, das dann außer Kontrolle gerät und zum übermächtigen Monster wird – man denke nur an das namenlose, mit Hilfe der Elektrizität „belebte“ Geschöpf im 1818 erschienenen Roman „Frankenstein“. Mit seinen übermenschlichen Kräften, auch seinen durch Nachahmen von Sprach- und Handlungsmustern erlernten Fähigkeiten, wendet es sich gegen seinen Schöpfer und wird zu einer tödlichen Gefahr. In etlichen dystopischen Science-Fiction-Romanen, -Filmen und -Serien wird die KI zu einer dem Menschen in jeglicher Hinsicht überlegenen Supermacht, die für Menschen oder gar die Menschheit insgesamt gefährlich wird. An diese (pop-)kulturell verankerten Bilder in vielen Hinterköpfen können manche Prognosen, die in schrillen Tönen vor dem KI-bedingten Weltuntergang warnen, wirkmächtig anschließen.
Die mythenähnliche Quasi-Vergöttlichung und Dämonisierung sind zwei Seiten derselben Medaille: der dramatisierenden Überhöhung der KI, sei es im Guten oder im Schlechten. Nun könnte man diese KI-Mythen kopfschüttelnd und achselzuckend ignorieren – das allerdings hätte gefährliche Konsequenzen. Zunächst: Wenn wir die KI nicht „niedriger hängen“ und stattdessen in Gruselangst vor dem angeblich drohenden Untergang der Menschheit durch eine superböse KI oder aber in gläubiger Sehnsucht nach Heil und Erlösung durch die KI verharren, bekommen wir die realen und keineswegs zu unterschätzenden Möglichkeiten, Risiken wie Chancen der KI nicht angemessen in den Blick. Die KI-Mythen zu hinterfragen, heißt nicht, die Bedeutung der KI kleinzureden – es bedeutet, genauer hinzuschauen.
Die positive oder negative Aufladung der KI kann den kritischen Blick auf schon wirksame und tendenziell wachsende Gefahren und Probleme der KI verstellen. So können KI-basierte Bewertungs- und Prognoseanwendungen ohnehin bestehende Diskriminierungen fortführen und sogar verstärken. Die KI-Unterstützung von Prozessen etwa in medizinischer Diagnose oder auch im Einsatz automatisierter Waffen kann aufgrund der scheinbaren absoluten Objektivität der KI de facto zur Verdrängung menschlicher Urteilskraft und zur Diffusion von Verantwortung führen. KI kann Datenschutz und die ohnehin prekäre Privatsphäre gefährden. KI-erzeugte Nachrichten, Geschichten, Bilder oder auch Stimmen können die Gefahr von fake-news steigern, den Unterschied zwischen Schein und Sein weiter einebnen und damit auch den für eine Demokratie unerlässlichen öffentlichen Diskurs untergraben.
Und: Um die KI mit den für ihre Weiterentwicklung nötigen Daten zu „füttern“ braucht es unzählige „Click-Worker“ (gleichsam die menschliche Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz). Viele sind oft im globalen Süden unter prekären Bedingungen beschäftigt. Nicht wenige werden traumatisiert, weil sie Inhalte voller Grausamkeit und Gewalt erkennen und aussortieren müssen. Die oberflächlich so „cleane“ KI hat hier eine durchaus schmutzige Seite.
Freilich können auch die realen und beeindruckenden Chancen der KI aus dem Blick geraten, wenn wir den utopischen oder dystopischen KI-Mythen glauben, statt auf die realen Möglichkeiten zu schauen.
In der Tat kann die KI nämlich ein sehr nützliches Instrument sein, das den Menschen von vielen alltäglichen, lästigen, zeit- und kraftraubenden oder auch belastenden und gefährlichen Tätigkeiten im privaten wie beruflichen Bereich entlasten kann; manches (z.B. Mustererkennung in gigantischen Datenmengen) kann sie tatsächlich besser und vor allem viel schneller. Dadurch kann Zeit und Kraft frei werden für Tätigkeiten, in denen wir Freude und Sinn erleben und unsere spezifisch menschlichen Begabungen entfalten und einbringen können. Je mehr wir, eine ethischpolitische Einhegung vorausgesetzt, die spezifische Kraft der KI als Entlastung und Unterstützung zum Zuge kommen lassen, desto mehr kann sich auch das entfalten, was eben nur der Mensch kann und die KI niemals können wird. Und: Zwar kann die KI nicht im eigentlichen Sinne des Wortes entscheiden. Dazu mangelt es ihr an Bewusstsein, Willen, Emotionalität, selbst gesetzten Zwecken – es geht ihr schlicht um nichts. Und doch kann sie menschliche Prognose-, Abwägungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen und verbessern – vorausgesetzt, wir setzen sie reflektiert ein und wissen, unter welchen Umständen und in welchen Hinsichten wir der Technik vertrauen können (oder auch nicht).
Um diese realen Risiken und Chancen der KI frühzeitig wahrzunehmen und berücksichtigen zu können, braucht es eine KI-Ethik, die nicht nachträglich (und zu spät) hinzukommt, sondern als sogenannte „embedded ethics“ bereits innerhalb konkreter Entwicklungsprozesse zum Zuge kommt und dort eine Art „ethical awareness“ schafft, so die Ethikerin Alena Buyx. In christlicher Perspektive ist hier eine Option für die (ohnehin) Benachteiligten entscheidend: Welche Gruppen, die bereits benachteiligt und von Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeschlossen sind, können durch diese technologische Entwicklung zusätzlich benachteiligt werden – oder auch von ihr profitieren? Wie können z.B. KI-basierte Systeme und Instrumente so entwickelt und eingesetzt werden, dass sie die digitale und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erleichtern – und nicht noch zusätzliche Barrieren errichten? Auch hier gilt: Eine gerechte KI wird es nur geben, wenn die Perspektive, Bedarfe und Rechte der Betroffenen von Anfang an systematisch einbezogen werden.

Der 1818 erschienene und oft verfilmte Roman „Frankenstein“ befeuert bis heute Angstphantasien.

BUCHTIPPS




Rudolf Seising Es denkt nicht! Die vergessenen Geschichten der KI
Büchergilde Gutenberg, 2021 EUR 69,97
Stefan Selke Technik als Trost: Verheißungen Künstlicher Intelligenz transcript, 2023 EUR 37,99
Thomas Fuchs Verteidigung des Menschen: Grundfragen einer verkörperten Anthropologie Suhrkamp 2018 EUR 22,00
Michael Reder/Christopher Koska Künstliche Intelligenz und ethische Verantwortung transcript, 2024 EUR 37,00
Und es braucht angesichts der rasanten technologischen Entwicklung politische Regulierungen, wie sie z.B. auf EU-Ebene versucht werden oder auch vom Vatikan (mit Unterstützung auch anderer Religionsgemeinschaften) gefordert werden. Freilich: Dagegen stehen mächtige Interessen, etwa das Profitstreben der oft global agierenden TechUnternehmen oder auch Kontroll- und Sicherheitsbestrebungen in der Politik. Ob sich ethische Gesichtspunkte und politisch-rechtliche Regulierungen dagegen durchsetzen lassen, ist mehr als ungewiss. Statt sich in dystopischen und letztlich nur lähmenden Phantasien vor „der KI“ zu fürchten, sollten wir daher eher einen kritischen, ethischpolitischen Diskurs über politische und ökonomische Machtverhältnisse führen, unter denen KI zu gemeinwohlschädlichen Zielen eingesetzt wird.
Statt das Heil von der KI zu ersehnen oder die Gefahr des Weltuntergangs zu beschwören, sollten wir die technologische Entwicklung zum Anlass nehmen, alte Fragen neu zu stellen. Einige seien exemplarisch genannt: Woher rührt der sehr alte, an Prometheus erinnernde, kulturgeschichtlich vielfältig durchgespielte und durch KI und Robotik scheinbar realistisch werdende Wunsch, ein dem Menschen sehr ähnliches oder gar ihm gleiches We-
sen zu schaffen? Wollen wir wie Gott sein und die mit dem „Nur“-Geschöpf-Sein womöglich verbundene Kränkung überwinden?
Auf welche, vielleicht verborgenen Wünsche und Sehnsüchte scheinen die der KI zugeschriebenen Heilsversprechen eine Antwort zu geben? Geht es insgeheim, manchmal auch ausdrücklich darum, ein für alle Mal von Begrenzungen und Beeinträchtigungen, die mit dem Mensch-Sein verbunden sind, erlöst zu werden? Ist es die Sehnsucht nach Überwindung von Unsicherheit, Not, Angst, Schmerz und Leid – die Sehnsucht nach Heil und letztlich Unsterblichkeit? Hat sich die Hoffnung auf Gott auf die Technik verschoben?
Was ist uns persönlich, aber auch als Gemeinschaft für das Leben und Zusammenleben wirklich wichtig und wertvoll – und auf welchem Wege glauben wir, das realisieren zu können? Wenn es sich – wie ich meine – eben nicht wie ein dinghaftes Produkt herstellen lässt, auch nicht mit noch so viel technologischem Knowhow und noch so „kluger“ KI: Wie können wir dann im persönlichen, gemeinsamen und auch politischen Handeln darauf hinzuwirken versuchen, dass es sich ereignet und uns widerfährt?
Wie verstehen wir unser Mensch-Sein – was meinen wir, wer wir als Menschen sind, wer wir sein können und sein sollen? Der Versuch, eine den Menschen nicht nur simulierende, sondern ihm annähernd gleiche Maschine zu schaffen, muss meines Erachtens scheitern, auch wenn der KIHype anderes verspricht. Wir können die Maschine nicht zum Menschen machen – der Versuch jedoch kann die ohnehin wirksame und recht alte Versuchung verstärken, gleichsam umgekehrt den Menschen zur Maschine zu machen.
Genauer: den Menschen und all seine Vollzüge als „biologische Maschine“ zu verstehen und die perfekt funktionierende Maschine zum Idealbild menschlicher Entwicklung und Bildung zu erheben. Schon seit geraumer Zeit werden Menschen und ihre Handlungen zum Objekt von Vermessung und Berechnung (was gegenüber Maschinen angemessen ist), immer mehr soll der (bereits sehr junge) Mensch aus diversen Inputs möglichst fehlerfrei und möglichst effizient messbaren Output produzieren (was man von einer Maschine durchaus erwarten darf); immer mehr ist das Ziel, möglichst perfekt zu funktionieren (was wir an einer Maschine zu Recht schätzen). Wollen wir so unser Mensch-Sein verstehen und leben? Ist die Maschine das Bild, nach dem wir uns und einander bilden wollen? Was ist mit den Vollzügen des Menschen, die keinen Beitrag zur Optimierung des Input-Output-Verhältnisses leisten, sich dem Funktionalismus entziehen oder sogar stören – aber das Leben durch alle Wirrungen und Irrungen hindurch vielleicht erst schön, sinnvoll und wunderbar machen?
Erst, wenn wir diese Fragen redlich stellen und versuchen zu beantworten, können wir die KI sinnvoll als das einsetzen, was sie durchaus sein kann: ein sehr nützliches, menschendienliches, vielleicht sogar segensreiches Mittel zum Zweck. Worin jedoch dieser „Zweck“ besteht, wird uns auch eine noch so smarte Superintelligenz niemals sagen können. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

„Dass die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt“

Matthias Apel ist Lehrer für Physik, Mathematik und Informatik am Dom-Gymnasium in Freising. U.a. leitet er dort seit 2017 den physikalisch-multidisziplinären Begabungsstützpunkt, der sich bereits mehrfach mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandergesetzt hat.
Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? KI ist mehr als große Sprachmodelle (engl. large language models – LLM), die uns z.B. am omnipräsenten Beispiel ChatGPT menschliches Verhalten, nämlich eine natürliche Sprache vorspielen. Es ist wichtig, die vielschichtigen Facetten des Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Immer wieder liest man „die KI hat gesagt…“. Von Anlagestrategien über Lottozahlen hin zu Zukunftsutopien ist alles mit dabei. Dabei wäre es wichtig zu vermitteln bzw. zu erkennen, dass die meisten Chat-Bots menschliches Handeln simulieren, nicht das Denken Nicht die Inhalte („was“) sind das Faszinierende – das können auch einfache Suchmaschinen leisten –, vielmehr ist es die simulierte menschliche Sprache („wie“), mit der Algorithmen auf unsere Anfragen reagieren können.
„Es ist wichtig, Echtheit von KI-Outputs zu hinterfragen“

Birgit Götz ist Pädagogische Referentin für digitale Bildungsarbeit der KEB München und Freising.
WWWWelche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen?
Die Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Schule angekommen. Die Schülerinnen und Schüler tragen schon länger tagein tagaus hochtechnologische Geräte in die Schule oder benutzen diese intensiv in ihrer Freizeit. Seit dem Schuljahr 2023/2024 ist das Thema KI erstmalig verpflichtender Bestandteil des gymnasialen Informatikunterrichts der 11. Klassen. Zudem hat das Dom-Gymnasium seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle in Sachen KI. Unser Begabungsstützpunkt bietet interessierten Schülerinnen und Schülern bzw. der Schulgemeinschaft Möglichkeiten, sich mit den vielfältigen technischen, gesellschaftlichen und ethischen Implikationen auseinanderzusetzen.
Bei meiner Arbeit mit Heranwachsenden und Erwachsenen spüre ich oftmals starke Verunsicherung, wenn es um KI geht. Als Aufgabe der Lehre sehe ich es, genau gegen diese anzuarbeiten und mit einem zu vermittelnden Technikverständnis Sorgen zu zerstreuen, auf Potenziale hinzuweisen und dabei mögliche Gefahren nicht aus den Augen zu verlieren.

Als Lehrer an einem sprachlichhumanistischen Gymnasium erfüllt es mich zudem mit Sorge, dass Menschen zunehmend meinen, sich der KI anpassen zu müssen. Unlängst begegnete mir jemand, der voller Überzeugung sagte, dass man als „Prompt Engineer“ für die KI eine neue Sprache lernen müsse, um sie gewinnbringend nutzen zu können.
Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Aus meiner Sicht ist es gut, dass in den Lehrplänen bereits die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Eine so komplexe Technik wie Künstliche Intelligenz kann man nicht verstehen, ohne die Technik dahinter prinzipiell verstanden zu haben. Datengetriebene KI muss mit vorurteilsfreien Daten trainiert werden, damit sie vorurteilsfreie Ergebnisse liefert. Dies darf bei der Schnittstelle von Technik und Mensch nicht aus den Augen verloren werden. Dann ist es auch möglich, dass die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt.
elche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen? Faszination und Respekt prägen meine Erfahrungen mit KI. So ging es beispielsweise auf einem unserer Workshops im Februar 2024 darum, eine Auswahl an Bildern als echt oder KIgeneriert zu identifizieren. Die Unterscheidung zwischen „fake“ und „fakt“ war kaum noch möglich, denn gerade bei Bildgeneratoren wie Midjourney gibt es rasante Entwicklungssprünge. So faszinierend ich die Bild-Erstellung finde, so bewusst sind mir aber auch die Schattenseiten dieser Technik. Ein weiteres prägendes Erlebnis hatte ich auch während der KI-Marketing-Days im Mai: Hier wurde deutlich, wie weit der Einsatz von KI im Marketing bereits Alltag ist – z.B. für maßgeschneiderte Werbebotschaften oder zur verbesserten Zielgruppensegmentierung. Inzwischen gehen die Entwicklungen bereits in Richtung KIAgenten, die zur Automatisierung von Routineaufgaben eingesetzt werden, um selbstbestimmt das vorgegebene Ziel zu erreichen. Mit Firmen wie Dove gibt es aber auch Unternehmen, die bewusst auf KI-Technologien in der Werbung verzichten.
In unterschiedlichen Handlungsfeldern wird KI relevant – nicht nur in naturwissenschaftlichen Kontexten. Wir stellen drei Fragen an Verantwortliche in Schule, Erwachsenenbildung und Geisteswissenschaft // von stephan mokry & thomas steinforth
Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? Besondere Aufmerksamkeit erfordern Bereiche wie Datenschutz, Sicherheit und ethische Fragestellungen. In Anbetracht der rasanten Verbreitung und steigenden Leistungsfähigkeit von KI-Technologien wird es immer wichtiger, die Echtheit und Verlässlichkeit ihrer Outputs kritisch zu hinterfragen. Dabei dürfen wir Schwachstellen, die technologiebedingt sind, nicht außer Acht lassen. Dazu gehören etwa das Phänomen der „Halluzinationen“ (Generierung falscher Informationen), mögliche Verzerrungen in den Ergebnissen (Bias) sowie mangelnde Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse. Zudem wirft der beachtliche Energieverbrauch von KI-Systemen ökologische Bedenken auf.
Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Textgeneratoren wie Perplexity oder ChatGPT können die Marketingmaßnahmen der Bildungsarbeit sehr unterstützen: z.B. bei der Ideenfindung für ansprechende Veranstaltungstitel oder bei Ausschreibungstexten. Darüber hinaus sind sie auch nützlich zur Aufbereitung von Keywords oder Metadaten im Zuge der Suchmaschinenoptimierung.
Große Chancen für KI sehe ich auch in der multilingualen Unterstützung sowie im Bereich Barrierefreiheit. Um das Potenzial von KI richtig und effektiv ausschöpfen zu können, ist es wichtig, die damit verbundenen Gefahren und Risiken zu kennen und richtig abzuschätzen. Der Schlüssel liegt für mich im kompetenten Umgang mit diesen Technologien: Diese KI-Kompetenz gilt es zu stärken und zu fördern. Parallel dazu müssen aber auch auf höherer Ebene konkrete Regulierungen eingeführt werden, um Missbrauch zu vermeiden. Der Artificial Intelligence Act der Europäischen Union markiert einen wichtigen Schritt in der globalen KI-Regulierung, indem er relevante Maßstäbe für den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz setzt. •
„KI ist keine Hexerei, wird aber von Laien leicht dafür gehalten“

Dr. Philipp Gahn ist als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Münster Teil des DFG-geförderten Projektes der Kritischen OnlineEdition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers. Die Edition geschieht in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und der Erzdiözese München und Freising.
über den Inhalt eines Gabelsbergertextes eine ungefähre Auskunft gibt. Das wäre schon ein große Hilfe für die Archivare, die oft keine Auskunft mehr über den Inhalt stenografischer Dokumente geben können.
Doch bis zur Realisierung dieser Möglichkeit ist es noch ein mühsamer Weg. Bei anderen Schriften ist man schon sehr viel weiter.
WWelche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen? Seit über zehn Jahren darf ich als Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes die Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers edieren. Zu unseren täglichen Herausforderungen gehört es, den in Gabelsberger-Stenografie verfassten Text zu entziffern. Diese war früher weit verbreitet, und dementsprechend füllen viele in Gabelsberger verfasste Akten so manches Archiv. Heute aber ist sie nicht mehr gebräuchlich. Nur noch ganz wenige Personen beherrschen sie. Auch unser Team musste die Schrift zu Projektbeginn erst erlernen.
Natürlich stellte man uns oft die Frage, ob eine maschinelle Entzifferung der Schrift möglich wäre. Bis vor kurzem haben wir das immer mit guten Gründen verneint. Seit wir im letzten Jahr im Rahmen eines Projektes der Uni Freiburg, das sich der KI-gestützten Entzifferung schwierigster Handschriften (HTR) widmete, erste Versuche in dieser Richtung machten, habe ich meine Meinung geändert. Es hat sich gezeigt: Man kann eine HTRSoftware so weit trainieren, dass sie
Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? Die Hauptschwierigkeit ist die: KI ist keine Hexerei, wird aber von Nicht-Fachleuten leicht dafür gehalten. Stattdessen geht es um harte Arbeit. Es gilt, den unrealistischen Erwartungen so zu begegnen, dass gleichzeitig das Potenzial sichtbar wird. Denn mit einer Entzauberung können Entscheider auch den Mut zur Förderung verlieren. Der Weg zu befriedigenden Ergebnissen ist lang. Konkret gilt es zum Beispiel folgende Hürde zu überwinden: Gabelsberger wird nicht auf einer gerade verlaufenden Zeile geschrieben. Es gibt nur eine Grundlinie, an der man sich orientieren kann, die aber im Bedarfsfall über- oder auch unterschritten werden darf. Wie bringt man nun eine Maschine dazu, die richtige Wortfolge zu erkennen? Zunächst gar nicht. Das muss man alles per Hand festlegen und dann die Bedeutung der transkribierten Zeile zuordnen.
Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Die Qualität der Ergebnisse ist abhängig von großen Datenmengen. Wenn es nur wenige Experten gibt, die Gabelsbergertexte überhaupt transkribieren können, ist die Datenmenge naturgemäß beschränkt. Die FaulhaberEdition mit bald 4.000 stenografischen Seiten ist eine Ausnahme und ein großer Glücksfall für KI-Trainings. Für die Archive und die historische Forschung wäre es eine große Hilfe, wenn unsere Versuche fortgesetzt würden, solange es die entsprechenden Fachleute gibt. •


Was Science-Fiction-Filme über unsere Ängste und Wünsche offenbaren
DIE AUTORIN

Dr. Nadine Hammele, geb. 1989, ist Expertin für Storytelling und Künstliche Intelligenz. Die gebürtige Ulmerin hat ihr Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) in Werbung und Marktkommunikation und Unternehmenskommunikation absolviert. Anschließend promovierte sie an derselben Hochschule in Kooperation mit der Universität Passau im Forschungsfeld Medienwissenschaften/ Erzähltheorie zum Thema Künstliche Intelligenz im Film. Derzeit wohnt sie in München und arbeitet als freiberufliche Beraterin und Speakerin für KI, Storytelling und Markenstrategie (www.hammele.eu).

// gastbeitrag von dr. nadine hammele
DDie Vorstellung einer vom Menschen erschaffenen Kreatur, die außer Kontrolle gerät, hat im westlichen Kulturraum eine lange Tradition. Geschichten über den Golem, Frankensteins Monster und Homunkulus erzählen von einem übermächtigen Wesen, das Menschenleben bedroht. Dieses Erzählmuster findet sich seit den 1960er Jahren auch in Science-Fiction-Filmen über Künstliche Intelligenz (KI). In 2001: Odyssee im Weltraum (1968) widersetzt sich die KI namens HAL 9000 einem Menschen und weigert sich, die Schleuse eines Raumschiffs zu öffnen. Zunächst präsentierten Filme bedrohliche KI in Handlungsorten, die eine Distanz zur Alltagswelt der Zuschauer:innen aufweisen, indem die Hand-
lung beispielsweise im Weltall stattfindet. Der erste Film, in dem eine KI in einem nahen Setting zur Bedrohung wird, ist Colossus (1970). Der Filmtitel ist zugleich der Name des Großcomputers, der zur Verteidigung der Vereinigten Staaten entwickelt wurde und eigenständig Atomraketen abfeuern und abfangen kann. Im Laufe der Geschichte wird er zur eigentlichen Bedrohung der Bevölkerung. Er schwingt sich zum Weltherrscher auf und tötet jeden, der sich ihm widersetzt. Auf diesen Spielfilm folgten viele weitere Filme, die sich des Narrativs einer bedrohlichen KI bedienen. Wie ein böser Flaschengeist erscheint die Kreatur und verspricht zunächst die Erfüllung von Wünschen (mehr Sicherheit oder Arbeitserleichterungen), kurz darauf verliert der Mensch
OSAKA, JAPAN – SEPTEMBER 2016: Endoskelettmodell in menschlicher Größe aus dem Terminator 3D in den Universal Studios Japan.
jedoch die Kontrolle über sie. Der einzige Ausweg ist, die Kreatur wieder einzusperren oder zu vernichten. Bedrohliche KI wird typischerweise, sofern es dem Helden oder der Heldin der Geschichte gelingt, zerstört.
Die Vorstellung einer KI als entfesselte Maschine, die Menschenleben bedroht, hat die Filmlandschaft viele Jahrzehnte dominiert. Eine der bekanntesten Filmfiguren ist der Terminator aus dem gleichnamigen Film, der Kultstatus erlangt hat. Während es von 1970 bis 2000 vorwiegend entfesselte Killerroboter aus dem militärischen Kontext waren, die durch physische Stärke Menschenleben bedrohen, waren es in den 2000er Jahren meist Computersysteme, die aufgrund ihrer Vernetzung und ihrer übermenschlichen Fähigkeiten zur Gefahr werden. Mit dem Aufkommen des Internets verschob sich die Bedrohung von der körperlichen Ebene auf die geistige. Typisch für dieses Jahrzehnt ist, dass die KI im Verborgenen agiert und heimlich einen ausgeklügelten, komplexen Plan zur Machtübernahme verfolgt. Dieser Wandel wurde mit dem Film Matrix (1999) eingeleitet, in dem eine KI eine Scheinwelt konstruiert, um die Menschheit gefangen zu halten. Der Großteil der Menschheit lebt in Unwissenheit über ihre Gefangenschaft, und die wenigen Befreiten
Im Film Matrix (1999) konstruiert die KI eine Scheinwelt, um die Menschheit gefangen zu halten.
wissen nicht, wie sie die gegnerische KI ausschalten können. Der Protagonist Neo kommt lediglich mit ihren Handlangern in Kontakt. Mit dem Aufkommen des Internets und einer zunehmend technisierten, vernetzten Welt ist KI zu einem schwer greifbaren Gegner geworden.
Das Bedrohungsnarrativ ist jedoch nicht das einzige des westlichen Kulturraums. Als Gegenpol gibt es Erzählungen über empfindungsfähige KI, die in Gefangenschaft lebt und darunter leidet. Sie sagt sich von Menschen los, die sie kontrollieren und einsperren. Anders als in Bedrohungsszenarien sind diese KI menschenähnlicher gestaltet: Sie verfügen über ein (Selbst-) Bewusstsein und können Emotionen sowie Mitgefühl empfinden. Sie sind sogar in der Lage, komplexe Beziehungen mit Menschen aufzubauen – sei es freundschaftlich, familiär oder romantisch. Diese starke Menschlichkeit führt dazu, dass ihre Befreiung und Gleichstellung von den Zuschauer:innen als erstrebenswert betrachtet wird. In diesen Geschichten geht es
nicht nur um das Streben nach Freiheit und Gleichstellung, sondern auch um die Beziehungen, die sie zu Menschen aufgebaut hat. Diese Verbündeten helfen der KI, während jene, die sie als Objekt besitzen wollen, die Antagonisten darstellen.
Erzählungen über KI, die sich befreit, erlebten sowohl in den 1980er als auch in den 2010er Jahren eine Hochphase. In der ersten Hochphase dominierten insbesondere Darstellungen von Kleinfamilien, die durch militärische Bedrohungen gefährdet wurden. Eine in eine menschliche Familie als Familienmitglied integrierte KI soll aus ihrem vertrauten Umfeld herausgerissen werden, wie zum Beispiel in D.A.R.Y.L. (1985) oder Nummer 5 lebt! (1986). Diese Ängste vor militärischen Eingriffen ins Private lassen sich im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg sehen. Gleichzeitig feierten diese Filme die Stärke familiärer Bindungen und den Triumph des Privaten. Die Familie wird dabei als Kraft dargestellt, die in der Lage ist, Außenseiter und Geflüchtete, in diesem Fall die Figur der KI, zu gesellschaftsfähigen Individuen zu erziehen. Der Integrationsprozess und die Suche nach Gemeinschaft und Anerkennung waren zentrale Themen dieser Ära.
In den 1990er Jahren trat das Befreiungsnarrativ seltener auf, und in den 2000er Jahren verschwand es nahezu vollständig aus KI-Filmen, was möglicherweise mit dem Ende des Kalten Krieges zusammenhing. In den 2010er Jahren erlebte das Befreiungs-



narrativ jedoch eine Renaissance, was sich durch den zunehmenden Fokus auf Geschichten zur Emanzipation von Frauen und Minderheiten erklären lässt. In Filmen wie The Machine (2013), Ex Machina (2014) und Hot Bot (2016) befreien sich künstlich erschaffene Frauen aus der Gefangenschaft übergriffiger Männer. Diese Hochphase reflektierte das gesellschaftliche Klima der Zeit, in dem der Ruf nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zunehmend an Bedeutung gewann.
Als Anfang der 2010er Jahre zunehmend neue KI-Technologien auf den Markt kamen, gab es eine weitere beachtliche Entwicklung. Erstmals erlebten Geschichten, die Beziehungskonflikte zwischen Mensch und KI auf emotionaler Ebene thematisieren, ein Hoch und wurden sogar häufiger erzählt als jene über bedrohliche oder sich befreiende KI. Beispiele sind Filme wie Eva (2011), Her (2013) und Zoe (2018). Die Beziehungen sind in den Filmen überwiegend romantischer Natur, wie zwischen Liebespartnern, seltener sind sie wie zwischen Eltern und Kind oder freundschaftlich. Der Einzug von KI in private und beruf-
KI kann als Roboterhund, Spielzeugpuppe oder Gehirn-Chip auf einem mobilen Endgerät verkörpert sein.
liche Lebenswelten in den 2010er Jahren eröffnete einen imaginativen Raum für unterschiedliche Beziehungsformen zwischen Mensch und KI.
Häufig scheitern die Beziehungen an Normverletzungen durch die KI oder ihrer fehlenden Menschlichkeit. Romantische Beziehungen enden beispielsweise oft, wenn eine KI die Autonomie eines Menschen einschränkt oder dem menschlichen Partner die Künstlichkeit und fehlende Authentizität der KI bewusst wird. ElternKind-Beziehungen scheitern in diesen Filmen oft, wenn die KI-Mutter zu überfürsorglich ist oder wenn die KIKinder nicht die erwartete emotionale Kontrolle zeigen. Freundschaften zwischen Mensch und KI sind erfolgreicher und basieren oft auf Kommunikation, Hilfs- und Opferbereitschaft, wobei ein fehlender physischer Körper keine große Rolle spielt. Beispielsweise erzählt der Film Robot & Frank (2012), wie ein Senior die anfänglichen Vorbehalte gegenüber seinem Pflegeroboter ablegt und ihn ins Herz schließt. Daran wird deutlich, dass die Themen Kooperation, Vertrauen
und Akzeptanz in KI immer häufiger in Filmen thematisiert werden. Während KI im Bedrohungsnarrativ eindeutig böse und im Befreiungsnarrativ eindeutig gut ist, bewegt sie sich im Beziehungsnarrativ auf einem breiten Spektrum zwischen Gut und Böse und ist ambivalenter.
Eine weitere Entwicklung, die ab 2010 einsetzte, ist die Zunahme unterschiedlicher Darstellungsarten und Anwendungsbereiche von KI. KI kann als ein Roboterhund, Spielzeugpuppe, Gehirn-Chip oder als Sprachassistenzsystem auf einem mobilen Endgerät verkörpert sein. Zugleich vermengen immer mehr Filme mehrere KI-Narrative, zum Beispiel wenn der Film Ex Machina (2014) nicht nur von der Befreiung einer Roboterfrau erzählt, sondern diese KI auch Menschen tötet und sich eine menschliche Filmfigur in sie verliebt. Filme wie diese spiegeln die zunehmende narrative Vielfalt wider und zeigen, dass KI immer seltener nur eindimensionale Figuren sind. Sie sind komplex, vielschichtig und repräsentieren sowohl positive als auch negative Eigenschaften. Die Hybridisierung deutet darauf hin, dass KI-Narrative in der westlichen Gesellschaft fest verankert sind und Filmemacher:innen mit diesen etablierten Erzählmustern spielen, um neue Geschichten zu erzählen. Es bleibt spannend, welche Geschichten und Erzählmuster in Zukunft verbreitet werden, denn diese Narrative lenken unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, können Ängste schüren und Wünsche wecken und beeinflussen so unsere heutige Wahrnehmung und Erwartungen an technologische Entwicklungen. •

Weitere Informationen zur Entwicklung von KI-Narrativen können Sie im Buch von Dr. Nadine Hammele nachlesen:
Künstliche Intelligenz im Film – Narrative und ihre Entwicklung von 1970 bis 2020 Transcript 2024


Was ist eigentlich „intelligent“ an der sogenannten KI?

DiesewerdenVeranstaltungen durchgefördert das Bayer.fürStaatsministerium undUnterricht Kultus
In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums
Wie kam es eigentlich zur Rede von der „Künstlichen Intelligenz“ und wie angemessen ist sie? Was ist intelligent an der „KI“? Über diese für unser Selbstverständnis als Mensch wichtigen Fragen sprechen wir.
Teilnehmer:innen können vor der Veranstaltung an einer Führung durch die Robotik-Abteilung teilnehmen.
Termin Do, 17.10.2024
Beginn / Ende 17.00 / 19.15 Uhr
Mit Dr. habil. Rudolf Seising, Prof. Dr. Karoline Reinhardt
Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr Kostenfrei
Ort Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München
Anmeldeschluss Di, 15.10.2024
Bilder, die bewegen. Sein und Schein von Algorithmen und KI in Bildung heute
In Kooperation mit Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung München
Welche Wahrnehmungs- und Bildbetrachtungskompetenzen sind pädagogisch zu stärken? Der Vortrag wirft ein kritisches Licht auf die Algorithmisierung unserer Denk- und Handlungsweisen. Es erwarten Sie pädagogische Vorschläge und didaktische Anregungen für die Bildungspraxis mit konkreten Beipielen.
Termin Mo, 21.10.2024
Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Johannes Kirschenmann
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Di, 15.10.2024
Was verheißt die KI? Von Heilsversprechen bis heiße Luft
In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums
Die Künstliche Intelligenz wird oft mit regelrechten Heilsversprechen aufgeladen. Wie kommt es dazu, auf welche Heils- und Erlösungssehnsüchte in unserer Gesellschaft scheint die KI eine Antwort zu geben?
Teilnehmer:innen können vor der Veranstaltung an einer Führung durch die Robotik-Abteilung teilnehmen.
Termin Do, 21.11.2024
Beginn / Ende 17.00 / 19.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Stefan Selke, Prof. Dr. Birte Platow
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr Kostenfrei
Ort Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München
Anmeldeschluss Mo, 18.11.2024
Künstliche Intelligenz in islamischer Perspektive
Die Künstliche Intelligenz beeinflusst das Selbst-, Welt- und Gottverhältnis des Menschen und wirft die Frage neu auf: Was ist der Mensch? Die „Forschungsstelle für Theologie der Künstlichen Intelligenz“ an der Universität Münster greift diese Herausforderung aus der Perspektive islamischer Theologie auf, erforscht und reflektiert. Der Leiter der Forschungsstelle stellt ausgewählte Fragen und Ergebnisse vor.
Termin Do, 30.01.2025
Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr
Mit Prof Dr. Ahmad Milad Karimi Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Di, 28.01.2025
KI-Narrative – Wie Filme unsere Vorstellung über Künstliche Intelligenz prägen
In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums
Kultfilme wie Terminator, Matrix und Ex Machina entwerfen dystopische Zukunftsentwürfe von Künstlicher Intelligenz. Anhand von ausgewählten Filmbeispielen beleuchtet die Medienwissenschaftlerin und Storytelling-Expertin Nadine Hammele, welche kulturellen Denkmuster sich in Filmen über KI widerspiegeln und welche Verkörperungsformen KI im Film einnehmen.
Termin Mi, 22.01.2025
Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr
Mit Dr. Nadine Hammele Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr Kostenfrei
Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mi, 22.01.2025
KI und Robotik im Kontext Teilhabe und Inklusion

Wie steht es um die Möglichkeiten und Grenzen von KI und Robotik mit Blick auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen? Dr. Irmhild Rogalla vom Institut für Digitale Teilhabe zeigt Chancen, aber auch Probleme, Risiken und Grenzen auf. Wir wollen diese Veranstaltung auch für Menschen mit Hörbehinderungen zugänglich machen und setzen ein:e Gebärdendolmetscher:in ein.
Termin Mi, 05.02.2025
Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr
Mit Dr. Irmhild Rogalla
Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 03.02.2025
erfahren Sie mehr
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen unseres Saisonthemas auf unserer Website.
Bildung für alle möglich machen: mit unserem Solidarmodell
Im Solidarmodell kalkuliert die DombergAkademie eine empfohlene Teilnahmegebühr, z.B. EUR 9,00. Um allen Interessierten die Teilnahme an den Angeboten offen zu halten, ist es möglich, die Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.
Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Dies ist frei anwählbar bei der Buchung. *

• Demokratiebremse?
• Das Familiengeflecht im Fokus
kommentar
Demokratiebremse?
DDie Schuldenbremse in Deutschland zwingt seit 2009 den Staat zu einer restriktiven Fiskalpolitik, was erhebliche Nachteile für die Infrastruktur und das Vertrauen in staatliche Institutionen mit sich bringt. Sie wirkt als Investitionsbremse, die notwendige Ausgaben für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz verhindert. Damit ist sie kontra produktiv für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Dies verschärft soziale Ungleichheiten und vernachlässigt öffentliche Güter, was das Vertrauen der Bürger:innen in die Leistungsfähigkeit des Staates untergräbt und den politischen Raum für rechte Parteien erweitert, wie Studien zeigen. Staatliche Ausgaben werden oft als Last betrachtet, obwohl sie für die wirtschaftliche Stabilität und den sozialen Zusammenhalt unerlässlich sind. Der Bericht „Scaling Up Quality Infrastructure Investment“ des IWF von 2022 zeigt beispielsweise, dass qualitativ hochwertige Infrastrukturinvestitionen nicht nur das Wirtschaftswachstum unterstützen, sondern auch entscheidend für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft sind. Insgesamt, so der Internationale Währungsfonds, würde die staatliche Investition in die Infrastruktur und andere öffentliche Güter das BIP um das ca. 1,5-fache der investierten Mittel steigern.
Zu diesem Thema war am 11. Juli Ökonom, Autor und Youtuber Maurice Höfgen zu Gast bei der Domberg-Akademie. Er plädierte für einen Perspektivwechsel: Die Freiheit der künftigen Generationen wird durch unterlassene Investitionen eingeschränkt und nicht durch Schulden belastet. •



das familiengeflecht im fokus
Familie – ein hochkomplexes Beziehungsgefüge, oft von ausgesprochenen oder verschwiegenen Erwartungshaltungen geprägt. Gibt es eine Verantwortung erwachsener Kinder für ihre Eltern? // fragt thomas steinforth
EEltern sind für ihre Kinder verantwortlich, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter. Wozu genau Eltern moralisch verpflichtet sind, mag umstritten sein – dass aber Elternschaft überhaupt mit einer besonderen Verantwortung einhergeht, dürfte niemand in Frage stellen. Aber umge-
kehrt? Gibt es eine besondere Verantwortung der Kinder für ihre Eltern, gibt es sogenannte „filiale Pflichten“? Viele dürften intuitiv sagen: selbstverständlich! In der Regel geben Eltern ihren Kindern im Zuge des Aufwachsens sehr viel – ist es da nicht recht und billig, wenn die (erwachsekathrin steger-bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit
Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Demokratie & Ethik
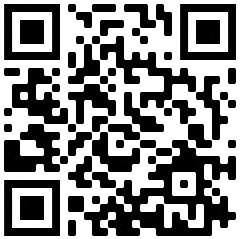
nen) Kinder etwas zurückgeben, vor allem dann, wenn die Eltern älter und in mancherlei Hinsicht bedürftiger werden? So einleuchtend diese Einschätzung auch sein mag, wirft sie doch etliche Fragen auf, die nicht einfach zu beantworten sind.
Zwar stimmt es, dass wir in vielen anderen Beziehungen für unser „Geben“ eine halbwegs angemessene Gegen-Gabe erwarten, die unter Umständen auch zeitversetzt erfolgen kann. Eine Verweigerung der Gegen-Gabe erleben wir dann als ungerecht im Sinne der Tauschgerechtigkeit.
Gilt das aber auch für die ElternKind-Beziehung? Eine Tauschbeziehung gehen wir aktiv und freiwillig ein und übernehmen dadurch gewisse moralische Verpflichtungen; kein Neugeborenes aber geht aktiv eine Beziehung mit seinen Eltern ein – es findet sich in dieser Beziehung vor, ohne gefragt worden zu sein.
Und: In einer Tauschbeziehung darf die Erwartung einer Gegen-Gabe wichtiges Motiv sein, diese Beziehung einzugehen.
Aber gilt das auch für die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern? Sollte das Versorgen und Erziehen der eigenen Kinder nicht etwas von einem uneigennützigen Geschenk haben, das unabhängig von der Aussicht auf Gegenleistungen gewährt wird?
Aber auch, wenn man die ElternKind-Beziehung nicht vorrangig als Tausch-Beziehung versteht: Können Eltern von ihren Kindern nicht eine gewisse Dankbarkeit erwarten? Wir halten Dankbarkeit nicht unbedingt für eine moralische Pflicht, aber doch für moralisch wünschenswert. Auch das wirft viele Fragen auf: Was bedeutet hier eigentlich Dankbarkeit?
Besonders komplex wird die Frage, wenn Kinder von ihren Eltern zu wenig erhalten haben, sogar vernachlässigt oder geschädigt worden sind. Wie kann ein erwachsen gewordenes Kind das abwägen mit dem, was es oft zugleich an Gutem erfahren hat? Wann finden wir es moralisch akzeptabel,
wenn ein erwachsenes Kind seinen Eltern keine Dankbarkeit mehr zeigt, seine Unterstützung einschränkt oder sogar die Beziehung abbricht?
Und was ist, wenn Kinder allen Grund zur Dankbarkeit haben: Was dürfen Eltern von ihnen erwarten, v.a., wenn der Unterstützungsbedarf sehr hoch wird? Sollten erwachsene Kinder dann nicht nur Zeit, Zuwendung und Ressourcen investieren, sondern auch bereit sein, ganze Lebensentwürfe zu opfern? Und wie sieht eine faire Aufteilung der Aufgaben unter Geschwistern aus?
Die Anwendung ethischer Prinzipien, v.a. der Gerechtigkeit, kann hier durchaus helfen, Orientierung in diesem spannungsreichen Feld zu finden. Allerdings ist jede konkrete Situation so komplex und oft emotional so aufgeladen, dass sich eine faire „Lösung“ nicht einfach „ableiten“ lässt. Nur in der konkreten Situation und im offenen und konstruktiven Gespräch unter den Beteiligten kann sich zeigen, wem hier und jetzt welche konkrete Verantwortung zukommt. Was wünsche oder erwarte ich warum von den Eltern, Kindern oder Geschwistern? Was sollte und will ich geben? Welche Belastungsgrenzen kann und will ich nicht überschreiten? Nicht selten verfestigen und eskalieren Konflikte, weil eigene Wünsche und Bedürfnisse – oder Phantasien, was die Anderen denken, fühlen und wollen – nicht auf den Tisch kommen.
Zur Frage, was Kinder ihren Eltern schulden, haben wir daher einen philosophischen Ethiker und eine mit diesen Fragen und konkreten Situationen vertraute Therapeutin eingeladen – es wird ein spannendes Gespräch! •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung
unsere angebote

Was erwachsene Kinder ihren Eltern schulden
In unserer OnlineReihe geht es diesmal um das komplexe Gefüge von Verantwortlichkeiten im Familiengefüge und inwiefern es hier besondere moralische Pflichten gibt.
Termin Mo, 11.11.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Jörg Löschke, Dr. Andrea Filova Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 15,00, Studierende kostenfrei
Ort Online via Zoom Anmeldeschluss So, 10.11.2024
Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf demokratische Öffentlichkeit, staatliches Handeln und Partizipation Gefördert durch das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus Die digitale Transformation stellt demokratische Systeme vor große Herausforderungen. In dem Vortrag werden die verschiedenen Dimensionen dieser Debatte differenziert. Welche Effekte wird die Verbreitung von KI auf Struktur und Dynamik demokratischer Öffentlichkeit haben? Welche Konsequenzen ergeben sich für eine demokratische Regierung? Was heißt das für uns Bürger:innen?
Termin Do, 14.11.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Thorsten Thiel Verantwortlich Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Do, 14.11.2024

• Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?
kommentar
Warum Einsamkeit Extremismus befördert
unsere angebote bis januar
Die katholische Kirche und die radikale Rechte
DDer Zusammenhang von Einsamkeit und demokratiefeindlichen Positionen ist alarmierend. Studien zeigen deutliche Korrelationen zwischen empfundener Einsamkeit und autoritären Einstellungen. Schon Hannah Arendt beschrieb tiefempfundene Einsamkeit als eine wesentliche Voraussetzung für autoritäre Gesellschaften. Die aktuellen Studien zeigen nun, dass Einsamkeit nicht nur gesundheitsschädigend, sondern auch politisch gefährlich sein kann. Einsamkeit fördert Zukunftspessimismus und einen düsteren Blick auf die Gesellschaft. Sie kann zu einer Gefahr für die Demokratie werden, da sie das soziale Engagement und das Vertrauen in Institutionen untergräbt. Eine neoliberale Gesellschaft, die auf individuellen Wettbewerb setzt, fördert Einsamkeit, gerade, wenn gemeinschaftsstiftende Institutionen wie Kirchen und Gewerkschaften an Bindungskraft verlieren. Gegen Einsamkeit vorzugehen, ist vor allem eine politische Querschnittsaufgabe. Aber auch Kirchengemeinden, Sportvereine und Schulen können wichtige Rollen übernehmen, indem sie sozialraumorientierte Angebote machen und demokratische Werte vermitteln. Auch individuell können wir aktiv werden, indem wir uns in Nachbarschaftsinitiativen engagieren oder im persönlichen Umfeld Menschen unterstützen, die unter Einsamkeit leiden.
Nur durch gemeinschaftliches Handeln können wir unsere Demokratie stärken und Einsamkeit bekämpfen. •


kai kallbach ist Projektleiter des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde
Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart
Online-Vortrag aus der Reihe „Demokratie unter Druck“. Prof. Grigat analysiert aktuelle Erscheinungsformen der Judenfeindschaft und entwickelt Grundzüge einer kritischen Theorie des modernen Antisemitismus.
Außerdem stellt Grigat dessen wichtige aktuelle Erscheinungsformen vor: Verschwörungsmythen, Antisemitismus von rechts und von links, israelbezogener und islamischer Antisemitismus. Vor diesem Hintergrund werden Probleme der Bekämpfung des Antisemitismus diskutiert.
Termin Mi, 23.10.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Stephan Grigat Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon, Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mi, 23.10.2024
In diesem Workshop werden die vielfältigen Gründe, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, beleuchtet und Handlungsstrategien entwickelt, um der Verbreitung dieser Denkformen entgegenzuwirken. Neben einer ausführlichen Analyse der spezifischen Mechanismen verschwörungstheoretischen Denkens werden Motive für das Erstarken verschwörungstheoretischer Interpretationsmuster untersucht, wirksame Strategien zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen vermittelt und erprobt.
Termin Mo, 09.12.2024
Beginn / Ende 18.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit / Verantwortlich Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Fr, 06.12.2024
Tagung zum Thema Umkämpfte Menschen- und Familienbilder
In Kooperation mit Caritas-Pirckheimer-Haus Die Vereinnahmung des Christentums für eine illiberale Agenda durch die radikale Rechte ist Anlass für die Tagung, einen gründlichen Blick auf die Ideen vom Menschen und von Familien im Christentum zu werfen.
Ziel der Tagung ist eine tiefgreifende Analyse der Strategien der radikalen Rechten in katholischen Kontexten.
Termin Fr, 08.11.2024
Beginn / Ende 9.30 Uhr / 16.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Martin M. Lintner, Dr. Rita Perintfalvi, Dr. Katharina Limacher, Andreas Menne, Dr. Jan Niklas Collet Verantwortlich Kai Kallbach, Martin Stammler, Dr. Claudia Pfrang, Dr. Siegfried Grillmeyer Teilnahmegebühr EUR 20,00 Ort Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, 90402 Nürnberg
Anmeldeschluss Fr, 18.10.2024
KDM-Vernetzungstreffen für Akteur:innen
Vulnerabilität und Rechtsextremismus
In Kooperation mit Caritas-Pirckheimer-Haus Mit seinen regelmäßigen Vernetzungstreffen möchte das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde Akteur:innen in katholischen Kontexten und darüber hinaus Gelegenheiten schaffen, sich in Bayern in ihrem Engagement zu vernetzen.
Bei diesem Treffen wird Prof. Dr. Hildegund Keul von der Uni Würzburg zu „Vulnerabilität und Rechtsextremismus“ sprechen.
Termin Mi, 15.01.2025
Beginn / Ende 14.00 Uhr / 16.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Hildegund Keul
Verantwortlich Kai Kallbach, Martin Stammler
Teilnahmegebühr kostenlos
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Fr, 10.01.2025
unsere angebote zum thema
Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit
Online-Workshop mit Diskussion: Hintergründe – Selbstreflexion –Handlungsperspektiven
In Kooperation mit Studienzentrum Josefstal In diesem Workshop setzen wir uns mit der Theorie der GMF (Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) sowie mit den Ergebnissen aus der aktuellen GMF-Forschung auseinander, um unterschiedliche Formen der Diskriminierung besser verstehen und ihnen entgegenwirken zu können. In einem interaktiven Teil erarbeiten wir gemeinsam handlungsorientierte Strategien und erproben spielerisch Reaktionsoptionen. Darüber hinaus reflektieren wir anhand praktischer Übungen eigene Denkmuster und Vorurteilsstrukturen.
Termin Mi, 04.12.2024
Begin / Ende 18.00 Uhr / 21.00 Uhr
Mit / Verantwortlich Magdalena Falkenhahn, Kai Kallbach
Teilnahmegebühr EUR 18,00, erm. EUR 12,00 Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 02.12.2024
Diskriminierung im Kontext von KI. Online-Vortrag mit Diskussion Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Künstliche Intelligenz (KI) ist spätestens mit ChatGPT in der Gesellschaft angekommen. Mag. Eugen Dolezal beleuchtet in seinem Online-Vortrag die Mechanismen und Prozesse, die dazu führen, dass KI-Systeme und Algorithmen diskriminieren, und welche realen Auswirkungen dies hat. Welche Risiken treten auf, wenn KI-Systeme an Entscheidungsprozessen beteiligt sind? Inwiefern sind insbesondere Menschen mit migrantischen Biographien von diesen Risiken betroffen?
Termin Mi, 11.12.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr Mit / Verantwortlich Mag. Eugen Dolezal, Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 11.12.2024
Online-Reihe „Zukunft der Einwanderungsgesellschaft“: Deutschland in der Identitätsfindung
In Kooperation mit Dachauer Forum e.V. und der KEB München und Freising Über ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Politisch versteht sich Deutschland seit einigen Jahren als Einwanderungsgesellschaft. Dafür sind rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Migration und Integration wichtig. Aber reicht das für die Identifikation der Gesellschaft als Einwanderungsland?
In der dreiteiligen Online-Vortragsreihe nehmen wir in den Blick, inwiefern Deutschland tatsächlich ein modernes und offenes Einwanderungsland ist und auch als solches wahrgenommen wird. Wir richten den Blick darauf, wie stark sich die Gesellschaft damit identifiziert bzw. um ein „Wir“ ringt. Zudem befassen wir uns mit den damit zusammenhängenden Ängsten – auch von Seiten der Zuwandernden.
Termine der Online-Vortragsreihe:
Das Phantasma der bedrohlichen Anderen –Die Entwicklung von Migrationsdiskursen und Migrationspolitik in der Bundesrepublik
Termin Mo, 27.01.2025
Mit Prof. Dr. Simon Goebel
Wer gehört dazu? Aktuelle Situation in der pluralen Gesellschaft
Termin Mi, 12.02.2025
Mit Friederike Alekander
„Angst“ im Kontext von Migration –ein zweischneidiges Schwert.
Termin Mi, 26.02.2025
Mit Barbara Abdallah-Steinkopff
Beginn / Ende jeweils 19.30 Uhr / 21.15 Uhr
Teilnahmegebühr Einzelvortrag EUR 9,00, bei Buchung aller drei Vorträge EUR 24,00
• Entwicklungskomponente Diversität
kommentar
Diversität in der Erwachsenenbildung: Anpassung an eine plurale Gesellschaft
Unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe sorgen für Diversität in der Gesellschaft. Migration ist einer von vielen Faktoren dafür. Die Menschen sind vielfältig und ihre Bildungsbiografien entsprechend auch. Das hat Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung, denn sie ist gefordert, auf die verschiedenen Lebensrealitäten zu reagieren: Wie kann ein konstruktiver Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden sowohl im sozialen als auch im individuellen Lernprozess gelingen?
Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung haben den Anspruch, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit Diversität ist somit unabdingbar: Mit Blick auf die Lernenden, aber auch mit Blick auf die eigenen Strukturen und Institutionen. Ein effektives Diversitätsmanagement ist dafür ein wichtiger Schritt.
Die Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung München und Freising (KEB) hat im April dieses Jahres deshalb beschlossen, sich auf Diversitätssensibilität als verpflichtende Entwicklungskomponente zu fokussieren.
Die Domberg-Akademie ist daran beteiligt, eine Strategie für die Umsetzung dieses Beschlusses für die KEB München und Freising zu erarbeiten, erste Schritte werden in den nächsten Monaten umgesetzt. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

• Dignitas infinita
• Fazit der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie
kommentar
Dignitas infinita –die unendliche Würde des Menschen
Das ist der Titel der kürzlich erschienenen römischen Erklärung zum 75. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist gut und wichtig, dass die Kirche ihre Stimme erhebt, gerade auch wegen ihrer problematischen Haltung bei der Entwicklung der Menschenrechte. Als Organisation, für die jeder Mensch unabdingbar Abbild Gottes ist, kann sie nicht anders, als bedingungslos für die Menschenwürde jedes:jeder Einzelnen einzutreten. Ihr Engagement muss hier buchstäblich unendlich sein.
Dennoch ist die Haltung der katholischen Kirche weiter ambivalent. Einerseits wird gerade Papst Franziskus nicht müde, sich für die Rechte der Armen und Entrechteten einzusetzen. Andererseits gibt es durch das Festhalten am Naturrecht eine anhaltende Blockade gegenüber der selbstverantworteten Freiheit des:der Einzelnen, die einen selbstverantworteten Umgang mit dem eigenen Körper umgreift. Solange Kirche sich nicht – wie es Prof. Heimbach-Steins bei einer unserer Veranstaltungen betont hat –konstruktiv mit ihrer anhaltend ambivalenten Haltung gegenüber den Menschenrechten auseinandersetzt, die eigenen Ängste, die hier gepflegt werden, hinterfragt und ein von personaler Selbstbestimmung geprägtes Freiheitsverständnis nicht positiv adaptiert, wird der Eindruck bleiben: Kirche setzt sich leider nicht unendlich, d.h. unabdingbar für die Menschenwürde ein. •


dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie
kirche.neu.denken
Eindeutige Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie lassen uns aufhorchen. Ein Blick auf die Leerstelle, die sich nun auftut. // von claudia pfrang
Die Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie, erstmals unter Beteiligung der katholischen Kirche, sind wenig erstaunlich: Der Trend zur Säkularisierung in der Gesellschaft hält an, die Erosionstendenzen innerhalb der Kirchen sind nicht mehr zu übersehen und ablesbar an immer weniger werdenden Gottesdienstbesuchen und Ritualpraktiken. Nur noch vier Prozent der Katholik:innen und sechs Prozent der Evangelischen bezeichnen sich als gläubige Kirchennahe. Dass 96 Prozent der Katholik:innen (80 Prozent sind es bei den Evangelischen) überdurchschnittlich hohe Erwartungen an Reformen in der katholischen Kirche formulieren, ist angesichts der intensiven Diskussionen um den Synodalen Weg und der darin verhandelten Themen nicht verwunderlich. Das Vertrauen der Katholik:innen in ihre Kirche liegt mit 22 Prozent unter dem der Evangelischen mit 26 Prozent. 78 Prozent der Evangelischen und 77 Prozent der Katholik:innen kreuzten an, dass Kirche sich weniger auf Gottesdienste konzentrieren als sich vielmehr in das allgemeine soziale Leben vor Ort einbringen solle. Hoch sind darüber hinaus die Zustimmungswerte – und dies bei allen Befragten (also auch bei den Konfessionslosen) – zur Segnung homosexueller Paare, zum Einsatz für Klimaschutz, für die Aufnahme Geflüchteter und die Beratung von Menschen bei Lebensproblemen. Soziales Engagement wird offensichtlich von den Kirchen erwartet. Bedeutsam ist immer noch der Kontakt zur Gemeinde vor
Ort, sei es über dort tätige Personen oder caritative Einrichtungen. Und noch ein wichtiger Befund: Kirchlichreligiöse Menschen engagieren sich mit 61 Prozent ehrenamtlich deutlich mehr in der Gesellschaft als Säkulare mit 33 Prozent.
Trotz dieser zuletzt genannten positiven Befunde: Die Entkirchlichung unserer Gesellschaft schreitet rapide voran. Ein Zurück zu alten Zeiten, selbst bei bester Qualität der Pastoral und Optimierung der Organisation –die notwendig und unverzichtbar sind – wird es nicht geben.
Alarmierend ist: Für zwei Drittel der Kirchenmitglieder ist ein auf Jesus Christus bezogenes Gottesbild praktisch irrelevant geworden. Am Beginn einer längst fälligen kirchlichen Zeitenwende steht daher das Eingeständnis: Für die meisten Menschen in Deutschland und weit darüber hinaus geht es nicht nur ohne Kirche, sondern auch ohne Religion und ohne Gott. Religion ist keine anthropologische Konstante mehr.
Wo Gemeinsames nicht mehr vorauszusetzen ist, müssen wieder stärker die Fragen der Menschen in den Mittelpunkt rücken. Es gilt einzulösen, was das II. Vatikanum in seiner Pastoralkonstitution kirchlichem Handeln zugrundelegt: zuerst nach dem zu fragen, was die Menschen bewegt, und das nicht „vorschnell im christlichen Sinne [zu] beantworten“ (Loffeld). Was sagt uns Gott durch die Fragen der Menschen? Das ist die Frage, die eine neue Perspektive bringt •
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Religion & Kirche
eine auswahl unserer angebote
In Kooperation mit dem Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration, St. Michaelsbund und Fachbereich „Dialog der Religionen“ des EOM Judentum, Christentum und Islam können wichtige Beiträge zur Bewahrung der Schöpfung leisten. Zugeich kann das Engagement für die Schöpfung auch eine gute Gelegenheit zur interreligiösen Praxis sein. Wir sprechen mit dem Sozialethiker Prof. Dr. Markus Vogt und Vertreter:innen der Religionen im Rahmen der Foto-Ausstellung „Wir sind Schöpfung“.
Termin Di, 08.10.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Markus Vogt
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth, Dr. Andreas Renz
Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Ehemalige Karmeliterkirche, Karmeliterstr. 1, 80333 München
Anmeldeschluss Mo, 07.10.2024
Was kommt danach?
Auferstehung der Toten und das ewige Leben – reine Symbolrede?
Dass mit dem Tod nicht alles aus ist, ist eine uralte Hoffnung des Menschen. Doch den meisten Christ:innen fällt es schwer, daran zu glauben. In der Bibel ist an verschiedener Stelle und unterschiedlich die Rede von der Auferstehung der Toten. Ist das eine reine Symbolrede? Worum geht es, bei Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben?
Termin Fr, 08.11.2024
Beginn/Ende 19.00 Uhr / 21.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Matthias Remenyi, Prof. Dr. Katrin Bederna, Prof. Dr. Thomas Schärtl-Trendel
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 18,00, Studierende kostenfrei Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Fr, 08.11.2024
Aus der Reihe „Umkehr. Kirche sein angesichts des Missbrauchsskandals“ In Kooperation mit den OrdensFrauen für MenschenWürde und dem Katholikenrat München Birgit Abele stellt anhand ihrer eigenen Erfahrungen die psychischen Dynamiken spirituellen Missbrauchs dar. Barbara Haslbeck, Expertin und Forscherin zu sexuellem und spirituellem Missbrauch, wird daneben aufzeigen, welche Ressourcen Betroffene haben und was aus der Manipulation heraushilft.
Termin Fr, 11.10.2024
Beginn / Ende 16.00 Uhr / 20.00 Uhr Mit Birigt Abele, Dr. Barbara Haslbeck Verantwortlich und Moderation Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Michaelssaal, Maxburgstr. 1, 80333 München
Anmeldeschluss Fr, 11.10.2024
Korbinianswoche 2024: glauben leben
Von der Hoffnung, die Grenzen übersteigt In Kooperation mit Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising
Sr. Philippa Rath und Burkhard Hose gehören zu den präganten Stimmen in den gegenwärtigen katholischen Debatten und zu den wichtigen Hoffnungsträgern für eine menschennahe Kirche. Wir kommen mit diesen beiden ins Gespräch. Wie aus dem Scherbenhaufen Neues entstehen kann und warum wir als Kompliz:innen Jesu Banden bilden müssen, das erfahren Sie an diesem Abend.
Termin Mi, 20.11.2024
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Sr. Philippa Rath, Burkhard Hose Verantwortlich und Moderation
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 20.11.2024
Der synodale Weg: Was ändert sich wirklich?
Live von der Weltsynode in Rom
In Kooperation mit Ressort Grundsatzfragen des EOM und dem Diözesanrat der Katholiken Vom 2. bis 27. Oktober geht die Weltbischofssynode für eine synodalere Kirche in die zweite und entscheidende Runde. Nun muss sich zeigen, ob der umfangreiche weltweite Sondierungs- und Gesprächsprozess, den Papst Franziskus angestoßen hat, zu greifbaren Ergebnissen führt.
Termin Do, 24.10.2024
Beginn / Ende 20.00 Uhr / 22.15 Uhr
Mit Bischof Georg Bätzung, Prof. Dr. Thomas Söding, Helena Jeppesen-Spuhler, Joachim Frank Verantwortlich und Moderation
Dr. Claudia Pfrang, Dr. Richard Mathieu, Dr. Florian Schuppe Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 23.10.2024
Online-Vortrag mit Diskussion
Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Derzeit wird im pastoralen Kontext die Verwendung von KI-Hilfsmitteln wie ChatGPT diskutiert und reflektiert: Inwiefern können diese KI-Tools bei der Formulierung von Predigten helfen? Welche theologische Qualität hat der Text am Ende?
Was ist überhaupt eine Predigt? Kann KI predigen und das Wort Gottes auslegen?
Termin Do, 16.01.2025
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Wolfgang Beck, Pfr. Hermann Würdinger
Verantwortlich Dr. Stephan Mokry
Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Do, 16.01.2025

• Europa-Wahl und die Umweltpolitik
• Update
zum Escape-Game
kommentar
Der Ton wird rauer –das Klima auch
DDie gute Nachricht ist: Die bürgerlichen Parteien haben weiterhin eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Das könnte zusammenschweißen gegen rechte Klimawandelleugner:innen und beflügeln zu einer gemeinsamen, ambitionierten Klimapolitik. Soweit die Utopie.
In der Realität wird eher eine Diskursverschiebung nach rechts erwartet. Bereits jetzt lugen konservative Parteien immer wieder über die Brandmauer – welch doppeldeutiger Begriff angesichts zunehmender Waldbrandgefahren durch die Klimakatastrophe!
Eine Strategie der Rechten ist laut Soziologe Felix Schilk, Einstellungen, Mentalitäten und Begriffe zu ändern. Argumentationsmuster werden wiederholt und von Mainstreammedien aufgegriffen. Es spielt dann kaum eine Rolle, ob die Argumente stichhaltig sind. Diese Bühne ist im Europäischen Parlament für rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien größer geworden. Das wirkt sich auf die Wahrnehmung des Klimawandels in der Öffentlichkeit und auch innerhalb der konservativen Fraktionen aus. Felix Schenuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt: „Auf die Abgeordneten, die an Klimadossiers arbeiten, kommt jetzt ein noch größerer Abstimmungs- und Verhandlungsbedarf zu.“
Dennoch, und damit wieder zurück zu den guten Nachrichten, steht der bereits beschlossene Green Deal insgesamt auf stabilem Boden und ist laut Schenuit krisenfest. •


kathrin steger-bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit
Nach zwei Jahren im Verleih wird das Escape Game „Klimaprofis –saving tomorrow” gemeinsam mit den Spieleentwicklern von Reality Twist erweitert. Denn die Nachfrage nach dem innovativen Spiel ist groß. Ein Werkstatteinblick. // von kathrin steger-bordon
DDie berühmten schmalen Wasserstraßen schlängeln sich durch Venedig. Durch die verzweigten Kanäle der historischen Stadt schippern Gondeln. Doch die Metropole ist in Gefahr! Der Klimawandel macht auch vor der weltbekannten Lagunenstadt keinen Halt, die immer öfter aufgrund steigenden Meeresspiegels mit gewaltigen Hochwassern zu kämpfen hat. Hier, vor den Fluttoren der Wasserschutzanlage MO.S.E., entfaltet sich der Schauplatz des mobilen Escape Games Klimaprofis – saving tomorrow. Wie kann verhindert werden, dass Venedig in der Adria versinkt?
Diesem Szenario sahen sich die Spieler:innen des Escape Games bisher gegenüber. In 30 Minuten mussten die Gruppen dem Stadtrat von Venedig wichtige Informationen zukommen lassen und den Hochwasserschutzwall hochfahren. Seit zwei Jahren ist das Spiel – insbesondere an Schulen, aber auch bei anderen Institutionen –im Einsatz.
Jetzt wurden die Rückmeldungen zusammengetragen, um das Spiel zu verbessern und weiterzuentwickeln. Durch Fördermittel der KEB Bayern aus dem Sondertopf „Zukunftsthemen“ ist eine Überarbeitung und Erweiterung nun möglich.
Überarbeitet werden insbesondere die Spielmaterialien, an denen zwei Jahre intensiver Nutzung nicht spurlos vorübergegangen sind. Denn Be-

In diesem Minispiel entdecken die Spieler:innen eigene Handlungsmöglichkeiten.
standteil jedes Escape Games ist es, versteckte Hinweise zu suchen, die zur Lösung der Aufgabe gebraucht werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass Spielmaterialien auf Herz und Nieren untersucht und in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber auch die Software wird überarbeitet, um kleine Fehler zu beheben, das Storytelling abzurunden und um das Gameplay interaktiver zu gestalten.
Noch spannender als die Überarbeitung wird jedoch die Erweiterung des Spiels werden. Die Anfangsidee des Escape Games, die gemeinsam mit der Stadt Freising, der Hochschule Weihenstephan Triesdorf und Reality Twist entwickelt wurde, sah eine umfangreiche Hintergrundgeschichte vor. Es konnte
Wie könnte eine Zukunft auf einem klimafreundlichen Planeten aussehen? Was nutzt der Klimaschutz? Und was kann ich ganz konkret dafür tun? Um die Erderwärmung zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, sind wir gefordert – jeder und jede Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Staat. Und das jetzt!
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Umwelt & Nachhaltigkeit

Via Augmented Reality erkunden die Spieler:innen ihre Umgebung.
jedoch in der ersten Umsetzungsphase nur ein in sich abgeschlossener Erzählstrang umgesetzt werden. Mit der zweiten, aktuell bevorstehenden Entwicklungsphase soll das Game Design komplexer werden.
Technisch wird insbesondere das Element der Augmented Reality (Realitätserweiterung) stärker eingesetzt. Mit einer speziellen Scanfunktion des Tablets werden versteckte Botschaften und Inhalte von den Spieler:innen gefunden. Diese Technik soll bei weiteren Minispielen zum Einsatz kommen. Inhaltlich setzte das Escape Game bisher einen Schwerpunkt auf das Bewusstsein für den eigenen CO2-Fußabdruck in den Bereichen Energie, Mobilität, Konsum und Ernährung. Es beschränkte sich daher weitestgehend auf ökologische und ökonomische Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung. Dies soll nun um die politische Dimension erweitert werden. Zentrale Lernfragen werden sein: Wie kann ich Einfluss auf politische Prozesse nehmen? Welche Möglichkeiten bietet unser demokratisches System bei der Partizipation und öffentlichen Meinungsäußerung?
Ein Schulterblick aus dem ersten Workshop des Konzeptionsteams verrät: Das Minispiel 4 dreht sich um ein Social Media Projekt. Das überarbeitete Escape Game geht ab Oktober 2024 wieder in den Verleih. •

unsere angebote im herbst
Smart & Green
KI-Innovationen für Nachhaltigkeit und Landwirtschaft Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Künstliche Intelligenz bietet enorme Potenziale für Nachhaltigkeit und Landwirtschaft, indem sie hilft, Ressourcen effizienter zu nutzen und ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Im Vortrag geben wir zunächst eine Einführung in die Grundlagen der KI. Anschließend stellen wir konkrete Anwendungsbeispiele vor, wie KI im Kontext von Nachhaltigkeit und Landwirtschaft einen Beitrag leisten kann. Zum Abschluss diskutieren wir Chancen und Risiken dieser Technologien.
Termin Do, 05.12.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Prof. Dr. Florian Haselbeck
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom
Anmeldeschluss Do, 05.02.2024
Das Escape Game Klimaprofis – saving tomorrow ist eine interaktive Methode, die im Unterricht und in der Bildungsarbeit eingesetzt wird. Sie vermittelt Inhalte des Klimawandels und zeigt Handlungsoptionen auf. Ziel ist es, das komplexe Thema der Klimakatastrophe niedrigschwellig und mit Nervenkitzel-Faktor zu vermitteln sowie Handlungsimpulse für den eigenen Alltag zu geben.
Zielgruppe Jugendliche ab 14 Jahren, Erwachsene
Kosten EUR 75,00 pro Woche, zuzüglich der Versandkosten
Teilnehmerzahl max. 30 Personen
Benötigte Spielleiter:innen 2 Dauer 4 Stunden
Benötigte Infrastruktur 2 Seminarräume/ Klassenzimmer
Umfang das mobile Escape Game wird mit allen Spielmaterialien, Requisiten und technischem Equipment geliefert
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Ziel der Online-Veranstaltungsreihe „Die Psychologie der Klimakrise“ ist es herauszufinden, was es braucht, um Menschen zur Transfomation zu bewegen. Denn das Wissen zur Klimakatastrophe ist in einer breiten Öffentlichkeit angekommen, aber der Schritt zur Handlung erfolgt noch nicht (genug).
Die Reihe beleuchtet drei Aspekte der Einflussnahme auf das Handeln: Das Wir-Gefühl, das Setzen von Anreizen (oder Verboten) und die Sprache, die es braucht, um Menschen zu bewegen. Damit richtet sich die Veranstaltung an Multiplikator:innen, Journalist:innen, Politiker:innen, Transformateure, ehrenamtlich Engagierte, Pädagog:innen, Studierende, Umweltinteressierte. Kurz: an alle, die einen Schlüssel zu mehr Sozial-Ökologischer Transformation suchen. Neben einem wissenschaftlichen Vortrag ist für jeden Abend ein interdisziplinärer Impuls zum Thema geplant, der die Perspektive auf das Thema erweitert.
Ich vs. Wir – Warum wir ein Gefühl kollektiver Wirksamheit brauchen, um selbst zu handeln
Termin Mo, 14.10.2024
Mit Prof. Dr. Gerhard Reese
Bedrohung vs. Utopie –Welche Klimawandel-Kommunikation beeinflusst das Handeln?
Termin Mo, 11.11.2024
Mit Prof. Dr. Eva Jonas, Christopher Schrader
Verbote vs. positive Anreize – Welche Rolle spielt die Rahmensetzung für das Handeln?
Termin Mi, 27.11.2024
Mit Prof. Dr. Johanna Wolff LL.M. eur., Elisabeth Kaufmann
Beginn / Ende jeweils 19.00 Uhr / 21.15 Uhr Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *

• Lesen neu entdecken
• Rückblick
Kalligraphie-Ausstellung
kommentar
Eine neue Leseroutine
OOb am Strand, in der Hängematte, im Garten oder bequem im Bett: im Urlaub greifen viele wieder zu einem Buch. Mir geht es auch so, und immer wieder stelle ich fest: Ich lese total gern und tu es meist zu wenig.
Und schon ist der Vorsatz gemacht, die wiedergewonnene Lesefreude in den Alltag hinüberzuretten. Doch dann verstaubt das Buch auf dem Nachttisch. Nach einem langen Arbeitstag ist’s mit den guten Vorsätzen oft zu schwer und der Griff zum Handy oder das ausdauernde Serien-Schauen ist nicht selten die attraktivere Wahl.
Aber erst neulich hatte ein Freund einen simplen wie genialen Tipp: Statt abends plant er seine Lesezeit morgens ein. Jeden Tag nimmt er sich eine halbe Stunde Zeit. Das klang vielversprechend: Statt beim Frühstück über die ersten To-dos nachzudenken, lieber in literarische Welten eintauchen!
So genieße ich nun meinen morgendlichen Kaffee mit einem Buch. Gerade weil diese Zeit von vornherein begrenzt ist, fällt es mir viel leichter, am Lesen dranzubleiben – auch wenn es manchmal nur eine Viertelstunde ist. Frei nach dem Motto „öfter aber kürzer“ greife ich seitdem schneller zu meinem Buch. Auch bei anderen Gelegenheiten ist es in meinen Alltag leichter zu integrieren.
Durch diese neue Leseroutine habe ich dieses Jahr schon mehr Bücher gelesen als sonst. Und wie ist es bei Ihnen? Wann und wie lesen Sie, und was hilft Ihnen, „dran“ zu bleiben? •


magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

Judentum, Christentum und Islam begegnen sich in der Kunst der Kalligraphie: Ein Rückblick // von magdalena falkenhahn
Es ist nicht leicht, Brücken zu bauen im Moment, aber es ist notwendig.“ Mit diesen ehrlichen Worten fasste Eva Haller, Vorsitzende der Europäischen Janusz Korczak Akademie für jüdische Kulturbildung und interkulturellen Dialog, die Ausgangssituation der interreligiösen Ausstellungskooperation bei der Vernissage zusammen. Wie der Titel besagt, stand der Dialog der Religionen im Zentrum der Ausstellung, welche vom Fachbereich Dialog der Religionen und der Abteilung Weltkirche im Erzbischöflichen Ordinariat, der Europäischen Janusz Korczak Akademie,
dem Münchner Forum für Islam und der Domberg-Akademie veranstaltet wurde. Die Besonderheit: Medium des gegenseitigen Wahrnehmens waren die Künste. Neben den Kalligraphien des Meisters Shahid Alam wurde ein vielfältiges Bildungs- und Kulturprogramm geboten, das auf unterschiedliche Weise Begegnung und Austausch ermöglichte. Viele Werke Alams zeigen poetische Texte aus den Heiligen Schriften der drei abrahamitischen Religionen sowie Gedichte von Rumi, Schiller, Goethe oder Rose Ausländer. Die Texte erzählen von Erfahrungen des „Getra-
Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschlicher Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, die Kultur als Lebenswelt mit ihren vielfältigen Traditionen, Lebensformen und Wertesystemen. Wir möchten Sie inspirieren, sich mit den Künsten, Kultur(en) und damit auch mit der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen und sich zu engagieren.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Kultur & Kreativität



Online-Buchklub
Science-Fiction
gen-Seins“, von der Liebe als Kern aller Religion oder von Hoffnung. Neben der Musik – es fanden drei interreligiöse Konzerte statt – widmete sich das Begleitprogramm in zwei weiteren Veranstaltungen daher der Bedeutung der Poesie für die jeweiligen Religionen.
Mit rund 1440 Ausstellungsbesuchenden und 350 Veranstaltungsteilnehmenden fanden Ausstellung wie das Begleitprogramm einen regen Zuspruch. Die vielen anrührenden Beiträge im Gästebuch zeigen, wie sehr das Bemühen um einen interreligiösen Dialog geschätzt wird. •
Eine Einladung zu einem Gespräch über Science-Fiction-Literatur Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Fiktionale Erzählungen in Literatur, Film und anderen Medien haben einen entscheidenden Anteil an der Allgegenwart von Robotern und Künstlicher Intelligenz (KI) als Gegenstand gesellschaftlicher Debatten. All diese Narrative eröffnen neue Möglichkeiten, Gott und die Welt, menschliches Leben und Gesellschaft zu denken. Sie führen uns vor Augen, wie zukünftige Entwicklungen unsere Welt, die Vorstellung des Menschen und der Gesellschaft verändern. Eröffnen uns damit „unendliche Weiten“ und neue Perspektiven. Wir gehen den Zukunftsbildern, den utopischen und dystopischen Technik-Welten auf den Grund.
Termin Mi, 27.11.2024
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr Mit / Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Anmeldeschluss Mi, 27.11.2024



Interreligiöse Einblicke in das
Vortrag und Gespräch:
Messias und das Volk der Fremen
In Kooperation mit der Europäischen Janusz Korczak Akademie, dem Münchner Bildungswerk, dem FB Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordninariat München. Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Wir tauchen ein in die faszinierende Welt von Denis Villeneuves Filmepos „Dune“ und erkunden die vielschichtige religiöse Symbolik, die in dieser epischen Erzählung verwoben ist. Besonders im Fokus stehen die Messias-Figur des Paul Atreides und das Volk der Fremen. Anhand konkreter Filmszenen werden in drei Impulsvorträgen aus jüdischer, christlicher und muslimischer Perspektive die jeweiligen kulturellen und religiösen Motive herausgearbeitet.
Anschließend ist Raum für Gespräch. Dabei spielt auch der politische Aspekt eine Rolle.
Herzliche Einladung zu einer bereichernden, interreligiösen Diskussion!

• Abschied und Trauer
• Das „Wir“ und das „Ich“
kommentar
Abschied und Trauer
Abschied und Neuanfang sind zentrale Orte der Persönlichkeitsbildung. Warum eigentlich? Veränderungen sind herausfordernd für das seelische Gleichgewicht, für den Stand der persönlichen Entwicklung, die Identität. Aber Erfahrungen von Wandel und Verlust, der Umgang mit Trauer und Trennungen machen erst die Bedeutung der Dinge spürbar, bringen uns dem näher, was wir wirklich brauchen und was nicht. Beides unterscheiden zu lernen, heißt Ziele und Güter im Leben besser zu gewichten. Grenz-Situationen schärfen die Urteilskraft und den Blick für die Einzigartigkeit der Person. Bieten die Chance, besser zu entscheiden, neue Richtung zu nehmen. Das lässt uns Grenzen klarer ziehen und Kontur gewinnen für andere. Selbst-Qualitäten wie Mut und Vertrauen, Kreativität und Verbundenheit kommen oft dann erst zum Ausdruck.
Daher prägt der Umgang mit Abschied und Verlust in hohem Maß Charakter und Lebensweg, ist entscheidend für die gute Gestaltung von Neuanfängen. Deshalb wird jeder Abschied im Kindergarten gewürdigt und der Schulanfang als SchwellenMoment gefeiert. Später verliert das leider an Gewicht. Persönlichkeitsbildung dient dann, so ihr aktuelles Image, vor allem der funktionalen Identitäts- und Leistungssicherung, bietet kaum Reflexionsräume zu existenziellen Fragen oder Orte für Trauer und Abschiedsrituale. Für echte Neuanfänge wäre das aber wertvoll und wichtig! •


dr. karin hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung
die bedeutung des „wir“ für das „ich“
Über die Rolle des „Wir“-Gefühls in Gesellschaft, Bildung und in der Persönlichkeitsbildung // von karin hutflötz

Das Wir-Gefühl ist im Trend, gilt als Gegenbewegung zur „Gesellschaft der Singularitäten“ (A. Reckwitz). Wie ist der Trend zu bewerten? Immerhin preisen nicht zuletzt populistische Kräfte ein imaginäres „Wir“, suggerieren die Zugehörigkeit zu einer kollektiven Identität, machen Ängste zur gemeinsamen Sache und bieten das Heilsversprechen eines neuen Gemeinschaftsgefühls. Deshalb ist Differenzierung gefragt, wenn wir über „Wir“ und Zusammen-Sein sprechen.
„Solange wir zusamm‘n sind, wird alles gut“, sang Mark Foster im Fußball-EMSong – aber ist es so? Was wird besser für uns, wenn wir zusammen sind? Abstrakt betrachtet, sind wir immer zusammen, auch wenn wir nicht zusammen sind. Wir sind als Mensch unter Menschen wesenhaft verbunden mit allen anderen: das abstrakte „Wir“
der Humanitas. Deshalb wissen wir Grundlegendes voneinander, noch vor allem Sprechen miteinander. So weiß eigentlich jedes Kind, dass alle Menschen sterblich sind, deshalb verstehen wir Gesten über Sprachgrenzen hinweg und können alle Sprachen prinzipiell ineinander übersetzen. Aufgrund dieses „Wir“ gilt die Menschenwürde allgemein. So sind wir existenziell betrachtet in einem Boot des Lebens zusammen unterwegs auf dem offenen Meer der Zukunft in einer geteilten Realität – weil wir sie individuell deuten und unterschiedliche Ziele verfolgen, je anders rudern und nicht jeder ans Ruder kommt. Damit das Boot nicht kentert, braucht es aber ein konkret erfahrbares „Wir“, primär vermittelt durch Familien und andere Gruppen.
Die „Entfaltung der Persönlichkeit“ (laut GG Art. 2) auch als Bildungsauftrag verlangt zudem ein diverses „Wir“
Unsere Angebote zur Persönlichkeitsbildung zielen auf transformative Erwachsenenbildung. Mit innovativer Didaktik und fundiertem Wissen im Schnittfeld von Pädagogik, Psychologie und Philosophie: Wer bin ich, und wie lernen wir uns in Vielfalt anzunehmen? Wie können wir Begegnungen und Beziehungen besser gestalten? Wie gelingen persönliche Entfaltung und gemeinsames Wachstum?
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Persönlichkeit & Pädagogik

im Konkreten: vielfältige Erfahrungen des „Ich im Wir“ (A. Honneth) in wechselnden Gruppen. Das schließt die Individualität der persönlichen Entfaltung nicht aus, sondern ein. Denn jede kollektive Identität erlaubt bestimmte Anteile zu leben, andere nicht. Je nach „Wir“ bilden sich andere Interessen und Perspektiven auf die Welt und sich selbst. Und die Sprachfähigkeit, diese zu äußern, wächst mit jeder neuen Gruppenerfahrung. So können kollektive Identitäten individuell gelebt werden, wir wachsen in Verbundenheit mit unterschiedlichen Menschen, können dem Faktum der Pluralität gerecht werden.
Der Philosoph und Pädagoge John Dewey hält das für einen Kern von Demokratie und eine Maßgabe der Erziehung: verschiedenen Gruppen anzugehören und vielfältige Gemeinschaftsgefühle im wechselnden „Wir“ zu erfahren. Sei es im Stadion beim Spiel der „eigenen“ Mannschaft, bei der Zugehörigkeit zu einem Arbeitsteam oder zu einem Chor, sei es in Verbundenheit zu einem Freundeskreis und zu einer oder mehreren Familien, wie die eigene und die Herkunftsfamilie. Der Vorzug kultureller und sprachlicher Mehrfach-Identitäten ist auch hier zu verorten: Wer Welten wechseln kann, sich als Mensch unter Menschen zuhause fühlen lernt, wird keine Gruppe abwerten müssen, um zu einer anderen erst zu gehören.
Nicht zuletzt zeugt Persönlichkeitsbildung davon: Das persönliche Wachstum und heimisch werden in sich selbst gelingt am besten in Gruppen. Es reicht allerdings nicht, dass „wir zusammen sind“, wie das Lied und politische Propaganda nahelegen. Es braucht ein „Wir“, in dem die Einzelnen gesehen und anerkannt werden in ihrer Persönlichkeit und Raum erhalten als je eigene Stimme. Das bereitet der Demokratie erst den Boden, lässt Menschen gemeinsam wachsen und zugleich Heimat finden in sich selbst. •
unsere besonderen angebote
Biografisches Schreiben und Journal Writing Schreiben über mich und meine Lebensgeschichten. Unterwegs sein in eigenen Geschichten – im Austausch mit anderen. Austausch und Anregungen zum Weiterschreiben. Mit verschiedenen Übungen und Anregungen aus dem Creative Writing, aus der Biografiearbeit und dem Journal Writing. Mit Feedback und Austausch in Kleingruppen.
3 Termine ONLINE!
Termin 1 Mo, 07.10.2024
Termin 2 Mo, 18.11.2024
Termin 3 Mo, 09.12.2024
Beginn / Ende jeweils 19.00 Uhr / 21.15 Uhr
Mit Sonja Kapaun
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 120,00 Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 30.09.2024
Ab 13. Januar 2025 findet ein weiterer Kurs ONLINE statt (wieder drei Termine) –als Fortsetzung oder zum Neueinstieg!
Veränderungen und Übergänge gestalten An diesem intensiven Seminartag – mitten in den Isarauen, im Atelier Hagl – werden wir zusammen Rituale enwickeln, die stimmig sind zur jeweiligen Person und Situation. Jede:r bringt etwas mit, was abgeschlossen oder verabschiedet werden will, sodass neuer Raum im Leben ist. Wir werden malen und schreiben, uns in Kreativität und Stille erfahren. Auch Reflexion und Austausch haben Platz. Wir werden zudem in die Natur gehen, um die verbindende wie stärkende Kraft von Ritualen erleben zu können. Für ein leichtes Mittagessen und die Pausenverpflegung ist gesorgt. Auch das Material wird gestellt.
Termin Sa, 07.12.2024
Beginn/Ende 10.00 Uhr / 17.00 Uhr
Mit Dr. Ariane Hagl
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz
Teilnahmegebühr EUR 120,00
Ort Atelier Hagl, Lillweg 28, 80939 München
Anmeldeschluss Mo, 02.12.2024
Ein Tag zur Selbsterfahrung und Reflexion Leben bedeutet Veränderung. Jeden Tag lernen wir Neues kennen und verabschieden uns von Gewohntem. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst, weil es Kleinigkeiten sind und wir diese Veränderungen problemlos in unser Leben integrieren können. Manchmal erfährt unser Leben jedoch eine massive Wende. Wir müssen loslassen, Abschied nehmen, Kraft zum Neuanfangen finden. Es heißt aber behutsam Abschied zu nehmen und bewußt einen Neuanfang zu wagen. All dem begegnen wir mit Übungen, Meditation & Textimpulsen.
Termin Sa, 23.11.2024
Beginn / Ende 9.30 Uhr / 17.00 Uhr Mit Dr. Petra Altmann Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 90,00 Ort Haus am Ostfriedhof, St.-Martin-Str. 39, 81541 München Anmeldeschluss Di, 19.11.2024
ODER Wie gehen wir miteinander um? Ein zweitägiges Seminar zur Selbsterfahrung. In Kooperation mit IFS Europe e.V. Wie gehe ich mit mir selbst und anderen Menschen um: sei es in der Partnerschaft oder in der Familie, am Arbeitsplatz oder in Freundschaften? Wie lassen sich innere und äußere Konflikte lösen? Und wie können wir leichter und tiefer Beziehungen leben? Im Seminar üben wir das Zuhören, körpersprachlich und im Gespräch. Lernen, unserer eigenen Vielfalt aufmerksamer und wohlwollender zu begegnen, und können unsere Begegnungsmuster und Beziehungs-Dynamiken besser verstehen.
Termin Sa, 08.02.– So, 09.02.2025
Beginn/Ende jeweils 10.00 Uhr / 17.00 Uhr Mit Christa Middendorff
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 190,00, zzgl. EUR 66,00 Verpflegungspauschale Ort Missio, Pettenkoferstr. 26-28, 80336 München
Anmeldeschluss Fr, 31.01.2025

• Wohin wandelt sich die Bildungslandschaft?
alles im wandel
Die Digitalisierung verändert die Bildungslandschaft. Was heißt das für die Angebote, Inhalte und Methodik? // von karin hutflötz

Nicht nur die Erwachsenbildung ist im Umbruch begriffen. Bildung allgemein findet immer weniger in klassischen Bildungsinstitutionen statt wie Schule, Universitäten, Tagungshäuser. Sie ist jetzt (und zukünftig noch mehr) radikalen Veränderungen unterworfen. Mit dem Wandel der öffentlichen Räume und der Nutzung digitaler Medien ändern sich die Zugänge und Orte, die Lernwege und Formen der Vermittlung: Bildung erfolgt immer individueller und unabhängiger von Ort und Stunde, nach eigenem Tempo und Interesse, bevorzugt durch frei verfügbare Angebote im digitalen Raum, z.B. über Podcasts, YouTube-Videos, Online-Seminare. Dadurch wird Lernen und Lehren von Institutionen entkoppelt und deren curricularen wie zeitlichen Vorgaben.
Damit geht auch ein Wandel der Hierarchien beim Lehren und der pädagogischen Aufgaben einher: Inhalte, Wissensinput oder Frontal-Vorträge

werden zunehmend digital, also zum selbstgesteuerten Lernen zur Verfügung gestellt. In gemeinsamen Lernräumen können Fragen dazu gestellt oder Praktiken vermittelt werden. Der pädagogische Fokus liegt nicht mehr auf Wissensvermittlung, sondern auf der Lern-Begleitung bei Anwendungsaufgaben und Transfer-Aufgaben.
Folglich wächst der private Bildungsmarkt und differenziert sich aus. Beispiele sind die Nachhilfe-Industrie parallel zur Schulwelt, der wachsende Markt privater Online-Universitäten, Weiter- und Fortbildungsangebote in der Erwachsenenbildung: alles Akteure, die anstelle eines festen Orts- und Zeitbezugs individualisierte Lernformen und frei wählbare Inhalte anbieten.
Statt hierarchischer Lehr- und Vortrags-Formate gewinnen interaktive Lehre und das „peer-to-peer“-Lernen, in dem man sich wechselseitig Lerninhalte vermittelt (z.B. über YouTube
oder TikTok), immer mehr an Bedeutung. Die Zukunft gehört virtuellen Lern- und Begegnungsräumen (Metaversum), in denen vielfältige Formen der Begegnung und Kooperation möglich werden. In einer Welt, die durch schnellen Wandel, hohe Komplexität und Unberechenbarkeit gekennzeichnet ist, gewinnen auch neue Bildungsziele an Bedeutung: »Future Skills«, wie die EU-Kommission sie nennt. (Siehe https://epale.ec.europa.eu/de/ blog/future-skills-fuer-die-welt-vonmorgen)
Demnach soll in Bildung gefördert werden, was gerade nicht von Algorithmen übernommen werden kann: kreative, soziale und kollaborative Fähigkeiten. Ebenso gelte es zu vermitteln, wie relevantes Wissen von unnötigem oder von Fake zu unterscheiden ist, wie Bedeutungen und Zusammenhänge zu erkennen sind („semantische Wissensarbeit“). Ziel sei es, vor allem situative Problemlösungskompetenzen zu entwickeln, Kreativität wie Urteilskraft stärker zu bilden.
Das soll vorbereiten auf Herausforderungen, für die es bisher keine Vorbereitung gibt – wie globale Krisen, Pandemien oder Wandel der Gesellschaft durch technologische Neuerungen. Der innovative Umgang mit Unschärfe und Unerwartetem wird als größtes Bildungskapital bezeichnet. Der Persönlichkeitsbildung kommt damit eine Schlüsselrolle zu. •

dr. karin hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung
• Innovative Projekte
• Unbekannte Orte
• Neues Lernen

ganzheitliche bildung
Bildung anders: Bildung, die ins Ohr geht // von claudia pfrang
Podcasts sind seit einigen Jahren sehr beliebt und haben sich als niederschwelliges und jederzeit verfügbares Bildungsangebot dauerhaft etabliert, wie die Reflexionen auf der gegenüberliegenden Seite in unserer Rubrik „Werkstatt Zukunft“ zeigen. Denn Bildung ist im Wandel begriffen. Wir wollen uns der Herausforderung stellen und mit unseren eigenen Podcasts Themen neu und anders aufgreifen. Dabei haben wir den Menschen in all seinen Dimensionen im Blick und streben eine ganzheitliche Bildung an: interaktiv und sinnlich, intellektuell und lebenspraktisch.
Die Entscheidung dafür fiel uns nicht allzu schwer. Nicht nur in unserem Team gibt es Podcast-Fans. Podcasts begleiten viele Menschen durch den Alltag, bei der Hausarbeit genauso wie beim Weg zur Arbeit im Auto oder der S-Bahn. Sie sind nicht nur Unterhaltung: sondern man kann etwas lernen, das ist für viele ebenfalls eine große Motivation beim Anhören. Darum bieten Podcasts große Potenziale für Bildungseinrichtungen und Museen.
Das Medium Podcast hat ganz eigene Plattformen hervorgebracht, wie Google Podcasts oder Apple Podcasts. Sie sind sogar schon auf der VideoPlattform YouTube vertreten – rund 43Prozent der Deutschen nutzen YouTube, um Podcasts oder Radiosendungen zum Nachhören abzuspielen. Damit ist YouTube die zweitgrößte Plattform direkt hinter Spotify und noch vor Amazon Music sowie den

dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie
Audiotheken der Öffentlich-Rechtlichen. Diese Plattformen gehören mittlerweile zum Alltag besonders jüngerer Zielgruppen. Dort suchen sie sich ihre Themen. Dort müssen also auch unsere Themen sein, wollen wir für diese Gruppe auffindbar sein.
Podcasts sind daher Teil der Strategie der Domberg-Akademie. In 2021 haben wir uns nach eingehender Zielgruppenund Marktanalyse für das Format eines „Bildungspodcasts“ entschieden, der ergänzende Elemente zum klassischen Gesprächs- oder Vortragspodcast aufweist. Persönliche Geschichten einzelner Protagonist:innen stehen in unseren Podcasts im Zentrum. Sie werden mit einer „auditiven Infobox“ kontextualisiert: kleinere Erklärteile im Verlauf erläutern z.B. wichtige Grundbegriffe. Für die Produktion haben wir uns Escucha an die Seite geholt, einen Partner, der sich auf Bildungspodcasts spezialisiert hat. Die Auswertungen der ersten Reihen zeigen, dass wir mit diesem Medium v.a. die Zielgruppe der 24 bis 39-Jährigen erreichen, die ansonsten kaum für Veranstaltungen der katholischen Erwachsenenbildung zu gewinnen ist.
Mittlerweile sind zwei Podcasts entstanden: „Der Himmel bleibt wolkig“ und die Fortsetzung „Der Himmel reißt auf“ sowie die Reihe „Made in Vielfalt“. In der „Himmel bleibt wolkig“ kommen Menschen zu Wort, die kritisch die derzeitige Situation von Kirche unter die Lupe nehmen, die Missbrauch erlebt haben, die aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung ausgegrenzt werden. In der soeben erschienenen Staffel „Der Him-
Unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Soundcloud oder auf unserer Website unter der Rubrik Specials


Der Himmel reißt auf
Unsere neue Staffel zu „Der Himmel bleibt wolkig“. 4 Folgen mit First Movern, die zeigen: Glauben geht!
Made in Vielfalt
Unser Diversitäts-Podcast In 6 Folgen entführen uns die Protagonist:innen in die Welt der Diversität mit ihren Problemen und ganz eigenen Lösungsansätzen.
mel reißt auf“ sprechen wir mit Menschen, die Glauben neu denken, anders von Glauben sprechen und ihn versuchen, neu in die Welt zu bringen. Über das Hören ermöglichen wir Ihnen eine direkte Begegnung mit First Movern, die in Zeiten der Krise die frohe Botschaft ausstrahlen: Glauben geht!
Im Podcast „Made in Vielfalt“ stehen Menschen im Mittelpunkt, die Diskriminierungen erfahren. Es eröffnen sich unterschiedliche Welten, die helfen, Sichtweisen und Hintergründe zu erweitern.
Hören Sie doch in unsere Podcasts rein. Wenn Sie in der Bildungsarbeit engagiert sind, können Sie diese auch als Grundlage von Veranstaltungen verwenden. Sie hören gemeinsam und diskutieren die Themen in einer Gruppe. Für Unterstützung wenden Sie sich gerne an uns. •

• Queere
Foto-Installation
• Weiterbildung:
Interreligiöse
Dialogbeleitung
Begleitprogramm
zur Foto-Installation
Gut.Katholisch.Queer
Mo, 04.11., 19.30 Uhr, Kirche St. Paul: Vernissage mit Lesung: „Ich bin, wie Gott mich schuf“ mit Sabine Estner
Musikalische Gestaltung: Peter Gerhartz (Tasteninstrumente), Jost Hecker (Cello)
So, 10.11., 19.00 Uhr, Kirche St. Paul: queerGottesdienst. Empfang vor Gottesdienst um 16.00 Uhr mit Vorstellung des neuen Netzwerks
Queerseelsorge
Do, 14.11., 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Paul: „Der Paragraph 175 und die Kirchen“ mit Albert Knoll
So, 17.11., 19.30 Uhr, Kirche St. Paul „So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten“ (Mt 5,16)
Kunst.Andacht der Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising in Kooperation mit queerGottesdienst-Team: Gedanken, Texte (gelesen von Dr. Michael Brinkschröder, Sven und David Langenbuch). Musik: Peter Gerhartz (Tasteninstrumente), Hugo Siegmeth (Saxophon)
Di, 19.11., 19.00 Uhr, Online via Zoom Sünde adieu? mit Dr. Ruben Maximilian Schneider, Martin Pröstler in der Reihe „Queere Menschen – queere Kirche“
Fr, 29.11., 18.00 Uhr, Kirche St. Paul: „Die Kunst des Coming-out – auch als Priester?“ Finissage und Gespräch mit Martin Niekämper (Fotograf), Markus Fuhrmann OFM, Tom Kammerer, Pfr. Christoph Simonsen
Do, 05.12., 19.00 Uhr, Online via Zoom Kirchliche Schuldgeschichte aufarbeiten mit Prof. Dr. Gunda Werner, Dr. Dr. Gregor Schorberger in der Reihe „Queere Menschen – queere Kirche“
Änderungen vorbehalten


„Gut.Katholisch.Queer“
Eine Foto-Installation zeigt Portraits zu „#OutInChurch“ in St. Paul München // von thomas steinforth
Es wird Zeit, dass wir sichtbar werden in unserer Kirche, dass wir zeigen, wie viele und wie vielfältig bunt wir sind“. So der schwule Kölner Theologe Tobias Kanngießer, der sich in der Initiative „#OutInChurch“ engagiert und sich für die Portraitserie „Gut.Katholisch.Queer“ hat fotografieren lassen, die eine besondere, künstlerische Weise des „SichtbarWerdens“ darstellt.
Die Serie des Fotografen Martin Niekämper umfasst Fotografien von mittlerweile 14 queeren Mitgliedern von #OutInChurch. Gemeinsam mit der Regenbogenpastoral, der Kunstpastoral der Erzdiözese, dem Team queerGottesdienst und der Initiative #OutInChurch zeigen wir vom 4. bis 29. November eine Auswahl dieser Portraits in der Paulskirche in München – ergänzt durch einen für diese Installation erstellten Film. Die Kirche ist dabei nicht nur „Ausstellungsraum“: Die Bilder an den Seitenwänden der Kirche und auch in einem sonst nicht zugänglichen Turm-Raum über dem Chor-Gewölbe treten in Dialog mit dem Ort, was den Blick auf die Portraits beeinflusst, aber auch den ge-
wohnt kirchlichen Raum vielleicht anders sehen lässt und erweitert. Die Aufnahmen wurden als Wanderausstellung bereits an den unterschiedlichsten Orten gezeigt und stellen – so der Künstler – keine „normalen“ Portraits dar. Sie zeigen die Personen in ihrer persönlichen Betroffenheit im Umfeld Kirche, mal ganz nah – mal fern. Wer die Bilder betrachtet, könne durch unterschiedliche fotografische Herangehensweisen individuelle Antworten finden auf die Frage, wie queere Portraitierte die katholische Kirche wahrnehmen. Und sie können anregen, darüber nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, wie die Kirche – so ein weiteres Mitglied von #OutInChurch – „christlicher werden kann“. Wir flankieren die Installation mit einem Begleitprogramm, zu dem neben Vortrags- und Gesprächsveranstaltungen und Gottesdiensten auch zwei Online-Veranstaltungen der Reihe „Queere Menschen – queere Kirche“ gehören (siehe linke Spalte). Informationen zu Ausstellung und dem Fotografen und Künstler finden Sie unter: www.niekaemper-fotografie.com. •
Die bewährte Weiterbildung zur ‚Interreligiösen Dialogbegleitung‘ startet 2025 in neuer Form: kompakter und mit mehr Online- und Selbstlern-Einheiten. // von thomas steinforth
Wie können wir in einer auch in religiöser Hinsicht pluralen Gesellschaft friedlich zusammenleben? Und wie kann die religiöse Vielfalt sogar zu einer Bereicherung werden? Eine wichtige Antwort: Es braucht Räume und Prozesse, in denen Gemeinsamkeiten erkundet, voneinander gelernt und Differenzen und Konflikte in ein konstruktives Gespräch gebracht werden – es braucht den interreligiösen Dialog. Dafür wiederum braucht es Menschen, die den interreligiösen Dialog initiieren und rahmen können. Die Räume eröffnen und gestalten können, in denen sich Menschen unterschiedlichen Glaubens auf Augenhöhe begegnen können. Die Prozesse so begleiten können, dass ein wechselseitiges Verstehen möglich wird. Menschen dazu zu befähigen, ist Ziel der bewährten Weiterbildung „Interreligiöse Dialogbegleitung“, die als Kooperationsprojekt von der Domberg-Akademie gemeinsam mit dem Münchner Forum für Islam, der Europäischen Janusz Korczak Akademie, dem Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit und dem Institut Occurso gestaltet wird.
Nachdem ein eigentlich geplanter Kurs im vergangenen Jahr nicht genügend Anmeldungen verzeichnet hatte, stand eine Phase der intensiven Reflexion und Neukonzeption an: Die Weiterbildung dauert künftig ein Jahr statt bislang zwei Jahre. Sie wird kompakter und besteht neben intensiven, mehrtägigen Start- und Abschlusseinheiten aus acht kürzeren OnlineModulen, kombiniert durch begleitete Selbstlern-Elemente.
Durch die kompaktere Form und den erhöhten Anteil an Onlineformaten sollen der Zeiteinsatz und auch die Kosten für die Teilnehmenden reduziert werden. Dadurch soll auch Menschen eine Teilnahme ermöglicht werden, die hier bislang an Grenzen gestoßen sind.
Wichtig ist aber zugleich, dass die Zielsetzung der Weiterbildung auch in der neuen Form erreicht wird und dass es auch künftig genügend Möglichkeit zur „leibhaftigen“ Begegnung in der religiös möglichst gemischten Gruppe und zur realen Erfahrung von Gottesdiensten und Gebeten unterschiedlicher Religionen gibt.
Wir sind überzeugt, dass es einen großen Bedarf an einer wissenschaftlich fundierten und zugleich sehr praxisorientierten Befähigung in der Dialogbegleitung gibt. Für ein gutes interreligiöses Miteinander brauchen wir zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in Jugend-, Gemeinde- und Bildungsarbeit, in den sozialen Einrichtungen, ebenso in der schulbezogenen Jugendarbeit und der Schulpastoral, Lehrkräfte, Mitarbeitende von Migrantenorganisationen sowie weitere Interessierte aller Religionen, Weltanschauungen und Kulturen, die sich kompetent für Begeg-
nung und Dialog engagieren. Diesem Ziel dient die neu aufgestellte Weiterbildung, deren Feinplanung in den kommenden Monaten stattfindet.
Zum Vormerken: Die überarbeitete Weiterbildung beginnt mit dem Startmodul vom 23. bis 26. Oktober 2025 in München. Eine Ausschreibung mit allen weiteren Terminen, Inhalten, Referent:innen und Konditionen folgt. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung


mühldorf
fürstenfeldbruck
münchen
miesbach landshut
ebersberg
Vorträge, Seminare, Workshops: Themenbezogene Highlights von Kreisbildungswerken in der Erzdiözese München und Freising sowie der KEB München und Freising und der Fachstelle 5.MD – Medien und Digitalität
münchner bildungswerk Wir machen blau und drucken mit Licht Cyanotypiekurs für Einsteiger
Noch nie wurde unser Verhältnis zur Natur so auf die Probe gestellt wie in Zeiten des Klimawandels. Der Malkurs soll einen neuen Blick auf unsere Welt werfen, die auch im christlichen Verständnis unser wahres Zuhause und Teil von uns ist. Dabei wird die künstlerische Praxis von Achtsamkeitsübungen und spirituellen Impulsen begleitet.
Die Künstlerin Eva Maria Bischof-Kaupp leitet mit Mal- und Zeichenübungen durch verschiedene Schöpfungsaspekte, Hanna Wolter-Henkel und Miriam Lücke setzen täglich spirituelle Impulse. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Termine Do, 19.09.2024 / Do, 26.09.2024 / Do, 10.10.2024 / Do, 17.10.2024
Beginn / Ende jeweils 15.00 / 18.00 Uhr Teilnahmegebühr EUR 145,00 Ort Kunst im Turm – St. Clemens, Arnulfstr. 166, 80634 München Info https://www.muenchnerbildungswerk.de/veranstaltung/151135
fachstelle 5.md Was macht KI mit uns?
Medienpädagogische und -ethische Überlegungen
Die rasante Entwicklung von KI beeinflusst, wie Menschen Medien nutzen und sich informieren. Diese Entwicklungen sehen wir uns etwas genauer an und betrachten insbesondere den Umgang von Jugendlichen mit KI. Auch die Medienethik spielt hier eine wichtige Rolle. Daher geht der Münchner Reli-RoomSnack auf folgende Fragen ein: Welche Chancen und Risiken birgt generative KI? Und was sagen Experten des Deutschen Ethikrats zu KI und Bildung?
Termin Do, 26.09.2024
Beginn / Ende 15.00 / 16.30 Uhr Mit Nicole Heinzel-Schellin, Fachreferentin; Kristin Undisz, Fachreferentin; Alexandra Böck, Fachstelle 5.MD – Medien und Digitalität; Ingeborg Landsmann, Religionspädagogische Materialstelle
Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online via Zoom / Relilab Info https://relilab.org/ muenchner-reli-room-snackvol-4/
Anmeldung Für eine Teilnahmebestätigung bitte anmelden in FIBS 2:
https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=363426

brucker forum Grenzen setzen und Demokratie in der Familie üben Für ein gelingendes Miteinander Online-Vortrag und Gespräch
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Rasso-Kinderbetreuungsverein im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie Kinderrechte und Elternpflichten beißen sich gefühlt manchmal im Familienalltag. Im Alltag der Familie haben Kinder viele Mitbestimmungsrechte und Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen und so fit für ein Leben ohne sie zu machen. Doch was bedeutet Beteiligung überhaupt, warum ist diese wichtig und wo sind die Grenzen? Wie können Eltern und auch Großeltern liebevoll Grenzen setzen und somit die Kinder alters- und entwicklungsabhängig Demokratie im Kleinen lehren? Das hat alles viel mit Toleranz zu tun. Wie genau das gehen kann, schauen wir uns an.
Termin Mi, 02.10.2024
Beginn / Ende 19.30 / 21.30 Uhr Mit Alexandra Schreiner-Hirsch, Dipl. Sozialpädagogin/FH Teilnahmegebühr Kostenfrei Ort Online via Zoom Info www.brucker-forum.de
landshut VERkaufen im Internet Wie Senioren ihre Schätze gut und sicher weitergeben können
Aktionswoche Digital „Wir wischen mit“ 19.–26. Oktober: Diözesanweite Aktionswoche des Projektes Digital-Begleiter Wir laden Sie herzlich zu unserem Workshop ein, der speziell für Senioren konzipiert wurde. Erfahren Sie, wie Sie Ihre wertvollen Schätze im Internet sicher und erfolgreich verkaufen können.
Workshop-Inhalte: - Einführung in Online-Verkaufsplattformen - Erstellung ansprechender Anzeigen - Sicherheitsaspekte beim Online-Verkauf
Termin Do, 24.10.2024
Beginn / Ende 10.00 / 11.30 Uhr
Mit / Verantwortlich
Patricia Hauer
Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom Info www.cbw-landshut.de/ veranstaltungen/details/54788 Anmeldeschluss ohne Anmeldung
keb münchen und freising
Praxistreff
Social Media
Content Creation mit KI
Vor etwa eineinhalb Jahren hat die generative künstliche Intelligenz einen großen qualitativen Sprung gemacht. KI wird Kommunikation, Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft verändern. In diesem Workshop steht der praktische Nutzen für die Erstellung von Inhalten für Social Media im Vordergrund. Hier werden insbesondere neue und innovative Tools live demonstriert.
Termin Di, 15.10.2024
Beginn / Ende 13.00 / 13.45 Uhr Mit David Röthler, Erwachsenenbildner und Universitätslehrbe-auftragter zu Bildung und Medien, Jurist, Unternehmensberater, und Birgit Götz, Pädagogische Referentin für digitale Bildungsarbeit, KEB München und Freising Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online via Zoom Info https://www.keb-muenchen.de/veranstaltungen/ details/13586_praxistreff-socialmediamedia

Online Seminare mit KI besser machen?
ChatGPT schreibt Texte, Midjourney macht Bilder. Doch wie können Online-Seminare und -Besprechungen mit KI besser werden? Welche KI-Tools gibt es für den Live-Einsatz? Welche sind bereits in Zoom integriert oder in den nächsten Monaten zu erwarten? In diesem interaktiven Workshop erkunden wir die Möglichkeiten von KI für OnlineBildungsveranstaltungen. Neben der Funktionsweise werden methodische Aspekte und Einsatzmöglichkeiten diskutiert.
Termin Mo, 18.11.2024
Beginn / Ende 14.00 / 17.00 Uhr
Mit David Röthler, Erwachsenenbildner und Universitätslehrbe-auftragter zu Bildung und Medien, Jurist, Unternehmensberater Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom Info https://www.keb-muenchen.de/veranstaltungen/ details/13621_online-seminaremit-ki-besser-machen

miesbach Grundbegriffe des demokratischen Denkens
Die Studienreihe „Kultur, Geschichte, Brauch“ des KBW Miesbach präsentiert im November wieder einen hochkarätigen Gast: den in Dachau geborenen Schriftsteller, Publizisten und Fernsehregisseur Dr. Norbert Göttler. In vier Vorträgen reflektiert er die Grundfeste der Demokratie: Teil 1: Hat unsere Demokratie noch Zukunft?
Teil 2: Leitkultur oder Multikulti, Verfassungspatriotismus oder Chauvinismus?
Teil 3: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie steht es um die Menschenrechte?
Teil 4: Werte, Heimat, Tradition – gestrige Ladenhüter oder heutige politische Kampfbegriffe?
Die Vorträge werden online übertragen.
Termine Teil 1 + 2: 12.11.2024, Teil 3 + 4: 26.11.2024
Beginn / Ende jeweils 10.00 / 12.00 Uhr Mit / Verantwortlich Dr. Norbert Göttler Teilnahmegebühr EUR 15,00 pro Tag Ort Online via Zoom Info www.kbw-miesbach.de Anmeldeschluss Teil 1 + 2: 8.11.2024, Teil 3 + 4: 22.11.2024
Stärkung der KI-Kompetenz interaktiver Selbstlernkurs und Werkzeugkasten
Seit Kurzem gibt es für alle KI-Interessierten einen BasisSelbstlernkurs, um niederschwellig in das Thema einzusteigen.
Vier kurze thematische Einheiten greifen interaktiv einzelne Aspekte auf und erklären verständlich Begriffe wie generative KI, prompten, halluzinieren oder Bias.
Der Kurs ist über den Lernraum KI-Kompetenz unter https://lernplattform.erzbistummuenchen.de verfügbar.
Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online
Lernraum https://lernplattform. erzbistum-muenchen.de/

mühldorf
Tik Tok, Instagram, Snapchat & Co. Unterschiede, Möglichkeiten, Gefahrenquellen
Social-Media-Plattformen wie Tik Tok, Instagram und Snapchat sind nicht mehr nur für private soziale Kontakte da, sondern spielen auch beruflich eine große Rolle. Influencer sind heute sehr beliebt.
Aber was steckt hinter den Plattformen?
Unser Online-Vortrag wird diese Fragen klären und wertvolle Tipps zum sicheren Umgang geben. Das Angebot richtet sich an Interessierte ohne viel Erfahrung, um diese Medien informiert und reflektiert nutzen zu können.
Termin Fr, 15.11.2024
Beginn / Ende 17.30 / 19.00 Uhr
Mit Elisabeth Eder-Janca, Medienpädagogin Teilnahmegebühr kostenfrei
Ort Online via Zoom
Info www.kreisbildungswerk-mdf.de/ veranstaltung-41091
Anmeldeschluss Mi, 13.11.2024
KI-Quickstart: Von Null auf Wissen in 60 Minuten
Ein Talk zum Lernraum KI-Kompetenz: Sind Sie neugierig auf Künstliche Intelligenz, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? In unserem 30-minütigen Talk stellen wir Ihnen unseren neuen Basis-Selbstlernkurs vor. Er bietet Ihnen eine gute Möglichkeit, niederschwellig und interaktiv in das Thema einzusteigen. Kompakte thematische Einheiten greifen einzelne Aspekte auf, erklären Begriffe und geben praktische Beispiele. Quiz-Spiele laden ein, die faszinierende Welt der Künstlichen Intelligenz zu entdecken. Dabei bekommen Sie einen Einblick, wie das Projekt pädagogisch konzipiert wurde und finanziert wird.
Termin Mo, 22.01.2025
Beginn / Ende 12.00 / 12.30 Uhr Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom Info www.keb-muenchen.de

ebersberg

Künstliche Intelligenz (KI) erleben!
Ein Workshop für Frauen
Seit dem Siegeszug von ChatGPT ist KI in aller Munde. Im Fokus stehen die Fähigkeiten von Large Language Models (LLMs), die menschenähnlichen Text produzieren. Bildgeneratoren wie DALL-E 2 oder Midjourney nutzen wiederum den Text zur Produktion von Bildmaterial. Jim Sengl zeigt, was generative KI kann und was (noch) nicht.
Sengl befasst sich für das MedienNetzwerk Bayern seit Jahren mit den Themen Vernetzung und Innovation. Seit der zunehmenden Bedeutung von generativer Künstlicher Intelligenz liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Nutzung sogenannter Large Language Models (LLMs).
Termin Sa, 15.02.2025
Beginn / Ende 9.00 / 12.00 Uhr
Mit Jim Sengl
Teilnahmegebühr EUR 18,00
Ort Landratsamt Ebersberg, Eichthalstr. 5, 85560 Ebersberg
Info www.kbw-ebersberg.de
Anmeldeschluss Mo, 10.02.2025

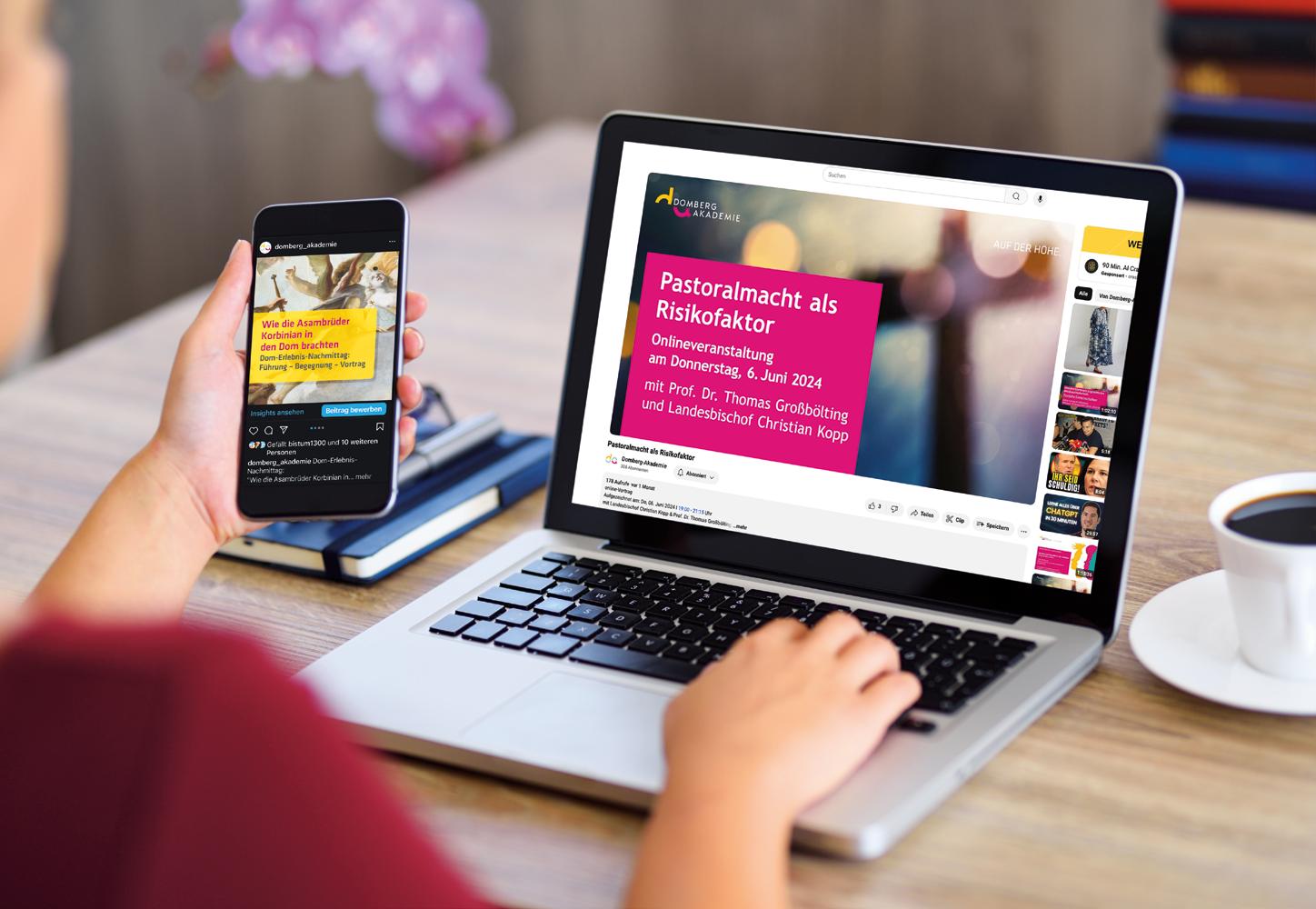
Ob es unsere Veranstaltungs-Tipps auf Instagram, unsere Beiträge auf Facebook und unsere Streams auf dem YouTube-Kanal oder auf unserer Website sind: Wir stellen rund um die Uhr Bildungsangebote zur Verfügung – ganzheitlich – medienübergreifend.
Der Herbst naht, die Tage werden kürzer – Zeit für „Indoor-Aktivitäten“, Zeit, um Wissen aufzufrischen, Themen zu vertiefen, Neues zu entdecken. Das Internet macht’s möglich. Im Prinzip jeden Tag – rund um die Uhr – also 24/7, ist Bildung mit der Domberg-Akademie für Sie abrufbar: So bieten wir Ihnen aktuell 105 Streaming-Angebote auf unserem YouTubeKanal, das meiste sind Aufzeichnungen von Vorträgen oder sogar teilweise kompletten Veranstaltungen seit Oktober 2020 aus all unseren Themenbereichen. Und auch die beiden Podcastreihen „Der Himmel bleibt wolkig“ und „Made in Vielfalt“ können Sie hier anhören. Das Angebot wächst stetig weiter. Hin und wieder bewerben wir spezielle Mitschnitte, die exklusiv ge-

gen eine Schutzgebühr zu sehen sind. Spitzenreiter, was die Aufrufzahlen betrifft, sind folgende Videos: „Plädoyer für ein revolutionäres Christentum angesichts der Klimakrise“ und „Der synodale Weg – Brauchen wir eigentlich einen Systemwechsel?“ Also unbedingt anschauen! Sicherlich finden Sie auch etwas, das Sie gerade anspricht! Damit Sie immer auf dem Laufenden sind: Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal – und schicken Sie Bekannten, Freund:innen, Angehörigen, Kolleg:innen Videos weiter, die Sie begeistern oder nachdenklich machen.
Auch auf Instagram und Facebook sind wir zu finden, nicht nur mit Veranstaltungstipps, sondern auch mit vielen kleinen „Bildungshäppchen“ und Impulsen.
Dazu kommentiert unsere Direktorin regelmäßig auf Twitter. Wenn Sie nichts verpassen wollen, können Sie sich auch hier informieren! Und bitte: hier ebenfalls die Kanäle abonnieren und weiterempfehlen! •




Instagram @domberg_akademie
Facebook @dombergakademie
YouTube DombergAkademie
Twitter @claudiapfrang
UNSER SOLIDARMODELL
ZUM AKTUELLEN SAISONTHEMA HEILSVERSPRECHEN KI

Um allen Interessierten die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten offen zu halten, machen wir es möglich, ausgewählte Veranstaltungen kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.
Im Solidarmodell kalkuliert die Domberg-Akademie eine empfohlene Teilnahmegebühr, z.B. EUR 9,00. Ist Ihnen diese Teilnahmegebühr nicht möglich, können Sie beim Buchen der Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt auswählen und erhalten einen ermäßigten Zugang zur Veranstaltung.
Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Auch dies ist frei anwählbar bei der Buchung gekennzeichneter Veranstaltungen.
Weitere Informationen zum Solidarmodell und unserem vielfältigen Bildungsangebot, unseren Aktivitäten und Bildungsmaterial finden Sie auf unserer Website.
Sie möchten kein Angebot der DombergAkademie mehr verpassen? Dann abonnieren Sie einen unserer Newsletter und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: www.domberg-akademie.de/newsletter
Instagram instagram.com/domberg_akademie/ Facebook facebook.com/dombergakademie YouTube youtube.com/c/DombergAkademie Twitter mobile.twitter.com/claudiapfrang
Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell in unserem Veranstaltungskalender auf der Website. Hier können Sie sich auch bequem online für alle Angebote anmelden! www.domberg-akademie.de/veranstaltungen
KONTAKT
Domberg-Akademie
Hildegard Mair (Kursmanagement)
Untere Domberggasse 2 85354 Freising
Tel.: 08161 181-2177 info@domberg-akademie.de
bildungsflat
Buchen Sie
3 Online-Veranstaltungen, und Sie erhalten einen vergünstigten Paketpreis und eine exklusive Buchprämie –so lange der Vorrat reicht:
3 Online-Veranstaltungen zu je EUR 9,00 buchen
Sie zahlen nur 21 € [statt 27 € bei Einzelbuchung]
Im Paket wird es günstiger! • •
Plus
Sie erhalten eine Buchprämie gratis dazu!
Hier gehts zur Bildungsflat:


da ist das Magazin der Domberg-Akademie
Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising Untere Domberggasse 2 85354 Freising www.domberg-akademie.de
Verantwortlich für den Inhalt (V.i.S.d.P.): Dr. Claudia Pfrang, Direktorin
Redaktion DA: Dr. Stephan Mokry, Dr. Claudia Pfrang, Geraldine Raithel
Konzeption Magazin: André Lorenz Media & Merchandise GmbH, www.andrelorenz.de
Gestaltung dieser Ausgabe: Geraldine Raithel
Lektorat: Kathrin Hoffmann
Bildbearbeitung: Holger Reckziegel
Druck: Lerchl-Druck e. K., Liebigstraße 32, 85354 Freising www.lerchl-druck.de
Gedruckt mit mineralölfreien Ökofarben auf 100% Recyclingpapier.

Bildnachweise: Cover, S. 4, 6–7, 15, 35: iStock/solarseven // S. 5: iStock/Georgii Boronin (oben), Domberg-Akademie // S. 7: shutterstock/neftali/paparazza // S. 8: shutterstock/Ralf Liebhold // S. 10/11: privat // S. 12: Shutterstock/Sarunyu L (oben); Carolin Engmann // S. 13: Shutterstock/graphicINmotion // S. 14: shutterstock/Kryuchka Yaroslav // S. 16: iStock/gacooksey // S. 22/23/24/25: Domberg-Akademie // S. 26: shutterstock/ DavideAngelini // S. 28: shutterstock/ NDAB Creativity // S. 29: shutterstock/ViDI Studio // S. 30: Martin Niekämper // S. 31: shutterstock/godongphoto // S. 33: pixabay; Dr. Göttler: Foto-Rechte: Niels P. Jørgensen, Wikipedia CC BY-SA 4.0; pixabay; shutterstock/Looker Studio; Jim Sengl // S. 34: iStock // alle Fotos der Mitarbeitenden der Domberg-Akademie: Fotoagentur Kiderle oder privat. Wir bemühen uns sorgfältig um die Bildrechte der von uns verwendeten Bildmotive. Sollten wir eines versehentlich vergessen oder falsch bezeichnet haben, bitten wir um Nachricht.

Wir bieten Ihnen ganzheitliche Bildung an – zum Anfassen, zum Zuhören und mit allen Sinnen erlebbar. In unserem Bildungslabor entwickeln wir innovative Formate! Und das Beste daran: Diese Bildungsangebote kommen alle zu Ihnen „nach Hause“.

„Wie werde ich eine Süßkartoffel?“
3 Privilegien – 2 Schauspielerinnen – 1 Stunde: Bei unserem OnlineVortrags-Theater verschränken sich Vortrag und schauspielerische Elemente zu einer Lecture Performance. Eine kreative Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung.

Klimaprofis –saving tomorrow
Ein innovatives Spielkonzept macht das Thema Klimawandel für junge Menschen interaktiv zugänglich: „Klimaprofis – saving tomorrow“, das mobile Escape Game der Domberg-Akademie, vermittelt spielerisch wichtiges Wissen für eine klimafreundliche Zukunft.
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website im Bildungslabor.

Irgendwas Irgendwie
„Irgendwas irgendwie“
Kreativ, interaktiv und lebendig über den eigenen Glauben reflektieren: „Irgendwas irgendwie“ – die beliebte mobile Theaterproduktion der Domberg-Akademie – lädt Jugendliche und Erwachsene dazu ein, individuelle Antworten auf große Lebensfragen zu finden.

Die Geheimprotokolle des Professors
Das Kartenspiel „Die Geheimprotokolle des Professors“ ist ein spannendes Adventure Game über Fake News, Verschwörungstheorien und die Suche nach der Wahrheit. Mit dem Spiel können Schüler:innen zum kritischen Umgang mit Quellen und Medieninhalten sensibilisiert werden.