Religion
Wie ist der Stand der Islamischen Theologie in Deutschland?

Welche Anreize gibt es für den Schutz des Klimas?
Was bedeutet eine zeitgemäße Persönlichkeitsbildung?




Wie ist der Stand der Islamischen Theologie in Deutschland?

Welche Anreize gibt es für den Schutz des Klimas?
Was bedeutet eine zeitgemäße Persönlichkeitsbildung?



Wendezeiten – Zeitenwende, so war mein erstes Editorial vor einem Jahr überschrieben, unser erstes Saisonthema lautete ZukunftsMUT. Und das über zwei Monate vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, seit dem wir uns fragen: „Sind unsere Ideale nach einem Frieden ohne Waffen, nach Feindesliebe überhaupt realistisch?“ Der Blick in die Zukunft ist nun noch mehr von Ungewissheit geprägt als zuvor. Nichts ist mehr so, wie es mal war – der Begriff „Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres 2022.
Diese äußeren Konflikte und der damit drohende Verlust von Sicherheit, Wohlstand und Ordnung lassen bei vielen Menschen tiefere Fragen im Inneren aufbrechen: Was zählt wirklich in meinem Leben? Was trägt und hält, wenn der Boden schwankt? Es sind die großen Fragen nach dem Sinn in unserem Leben, die hier aufbrechen. Sie stehen im Mittelpunkt dieses Heftes unter dem Titel Sinn suchen.
„Menschen brauchen Sinn wie die Luft zum Atmen“, schreibt meine Kollegin Karin Hutflötz in der Titelgeschichte dieser Ausgabe. Den Sinn zu finden, „erfordert immer mal innezuhalten und sich zu verorten auf dem eigenen Weg und im Leben. Ohne sich hin und wieder Zeit zu nehmen und die Geduld zu haben für einen solchen Blick, verliert man leicht den Sinn für Prioritäten und die Orientierung unterwegs.“ (Seite 7)

Der Untertitel unseres Saisonthemas bringt die Sinnsuche entsprechend in drei Begriffen auf den Punkt: Innehalten. Halt finden. Sich nicht aufhalten lassen. Menschen, die sich immer wieder vergewissern, was ihnen Boden unter den Füßen gibt, die Halt finden, können sich getrost auf eine Sinnsuche einlassen, die nach vorne hin offen ist. Sinn zu finden, ist eine Aufgabe, die sich ein ganzes Leben
•
Dr. Claudia PfrangDirektorin der Domberg-Akademie
cpfrang@ domberg-akademie.de
lang stellt, gerade an den biographischen Umbrüchen und Brüchen. Da merkt man, dass es oft keine einfache Antwort und schon gar keine Patentrezepte gibt. So mancher gut gemeinte Rat ist eher ein Schlag ins Gesicht – statt ein Mantel, der in kalter Zeit wärmt. Sinn kann man nicht eben „einfach mal machen“, er ist ein Weg und theologisch gesprochen oft „eine Gnade“. Etwas, das mir geschenkt wird. Mich dann, und das ist das Besondere, nicht mehr aufhält, mich für das einzusetzen, was mir wichtig ist, mich beflügelt, über mich hinauszuwachsen.
Sich diesen grundsätzlichen Fragen im inneren und äußeren Dialog ernsthaft zu stellen, ist Kern einer Persönlichkeitsbildung, die den sozialen und politischen Kontext der Person und ihrer Situation nicht ausklammert, sondern diese ausdrücklich und in offenen Fragen mit einbezieht. Das ist angesichts der multiplen Krisen wichtiger denn je und wird im Fokus der Neuaufstellung unseres Bereichs der Persönlichkeitsbildung stehen, wie ihn Karin Hutflötz auf Seite 26 skizziert.
Mit „ZukunftsMUT“ hielten Sie vor einem Jahr die erste Ausgabe unseres Magazins in den Händen. Und nach drei Ausgaben können wir sagen: Es macht Sinn. Es macht Sinn, die analoge und digitale Welt zu verbinden, unsere Arbeit transparent zu machen und Ihnen zu zeigen, was uns umtreibt.
Neuer Bildungspodcast
Nach dem Erfolg von „Der Himmel bleibt wolkig“, dem Bildungspodcast rund um Fragen der Kirchenkrise, widmen wir uns in unserem neuen Podcast nun den Themenschwerpunkten Diskriminierung und Vielfalt. Die ersten Folgen von Made in Vielfalt finden Sie auf unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt.
• Seite 19
Der Entstehungsprozess hilft uns immer wieder, in unserer Arbeit innezuhalten, uns zu vergewissern, warum wir tun, was wir tun – um dann Ideen zu entwickeln, mit welchen Formaten und spannenden Themen wir Sie begeistern können. Die vielen positiven Rückmeldungen und Bestellungen ermutigen uns. Nach den ersten drei Ausgaben möchten wir Ihre Meinung hören und starten daher im Januar eine Umfrage (Seite 34): Was ist für Sie das Besondere am Magazin, wie gefallen die Inhalte und das Layout, wo liegen Potenziale für die Zukunft? Nur so können wir Sie noch besser inspirieren, neu zu denken, neu zu glauben und neu zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die biblische Verheißung „Ich will dir eine Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11) für die Wege des neuen Jahres bestärken möge.
Ihre



Sind unsere Ideale noch realistisch? Reflexionen zum Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN // von kathrin steger-bordon

In einigen wenigen Wochen, am 24. Februar 2023, jährt sich der Ausbruch des Ukrainekrieges zum ersten Mal. Der Angriffskrieg Russlands ist ein Einschnitt in eine Weltordnung, auf die wir uns in den Jahrzehnten davor nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlassen haben. Wie geht es uns heute mit der veränderten Situation?
Neben den internationalen, den geopolitischen Folgen ist Putins Überfall auch auf persönlicher Ebene für viele eine Zäsur – beispielsweise bei der Einstellung zum Pazifismus. In einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung haben bereits im Juni 2022 42 Prozent der Befragten das Ende der deutschen pazifistischen Haltung konstatiert. Ausgehend von diesen verloren gegangenen Selbstverständlichkeiten stellte die Domberg-Akademie mit dem Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN die Frage: Wie sollen wir persönlich und politisch damit umgehen, wenn Ideale fraglich geworden sind und wir in einen Zwiespalt zwischen Idealen und (veränderten) Realitäten geraten?
Wir haben uns dieser Frage in einer mehrteiligen Online-Veranstaltungsreihe genähert. Am 14. November 2022 betrachteten wir das Ideal der transnationalen Solidarität. Professorin Dr. Julia Eckert von der Universität Bern vertrat dabei die These, dass nur das Festhalten am Ideal der transnationalen Solidarität eine Perspektive zur Bewältigung aktueller Problemlagen bereithalte. So arbeitete sie die Wichtigkeit solidarischen Denkens heraus, beispielsweise bei (kriegsbedingten) Migrationsströmen oder auch dem Klimawandel. Sie plädierte dafür, nicht in Nationen, sondern in Verflechtungseinheiten zu denken, zum Beispiel durch international agierende Institutionen. Neben diesen transnationalen Verflechtungseinheiten brauche es eine gut funktionierende lokale Nachbarschaft als politische Verwaltungseinheit. Beides könne in ihrem skizzierten Ideal die übergeordnete Stellung von Nationalstaaten abschwächen oder gar ersetzen.
Professor Dr. Giorgi Maisuradze von der staatlichen Ilia-Universität in Tiflis (Georgien) führte dagegen aus, dass gerade kleine Staaten historische Erfahrungen gemacht haben, in denen transnationale Verflechtungen zur Prekarisierung und Benachteiligung der lokalen Bevölkerung geführt hätten. Zu oft sei man von mächtigeren „Partnern“ überrollt worden.
Eine besondere Herausforderung stellen in Georgien nun die vielen russischen Geflüchteten dar, die mehrheitlich aus der Mittelschicht stammten. Sie sorgen durch ihre Finanzkraft für eine massive Preissteigerung von Wohnraum, die nun viele Georgier:innen trifft. Die Solidarität der einheimischen Bevölkerung, die sich 2008 selbst noch gegen einen russischen Überfall wehren musste, wird damit auf eine harte Probe gestellt.
Das Völkerrecht ist und bleibt eine wichtige Rechtsordnung – auch wenn es zweifellos Schwächen hat. Das ist das eindeutige Statement von Professor Dr. Stefan Kadelbach von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, der am 29. November 2022 zu Gast war. Er stellte sich der provokanten Frage, ob das Völkerrecht denn überhaupt noch einen Sinn habe, wenn es so einfach gebrochen werden kann. Kadelbachs Plädoyer: Man müsse das Völkerrecht in einem größeren Kontext sehen. Die Konsequenzen von Völkerrechtsbrüchen sind zwar nicht so unmittelbar sichtbar wie nach konventionellen Straftaten, aber sie sind dennoch sehr wohl spürbar – aktuell etwa in Form durch das Völkerrecht legitimierter Sanktionen, in der Zukunft voraussichtlich durch Reparationen und Prozesse am internationalen Strafgerichtshof. Sein Beispiel: Auch heute noch werden betagte Männer und Frauen für ihre Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg vor Gericht gestellt – das hätte sich 1945 noch niemand vorstellen können. Wie das Ideal des Völkerrechts eine bindendere Geltung bekommt, bleibt offen, doch die Konsequenzen von Rechtsbrüchen sind heute schon real.
Eine weitere Veranstaltung der Reihe widmete sich am 11. Januar 2023 dem christlichen Ideal der Feindesliebe. Tenor der Diskussion: Auch in einem brutalen Angriffskrieg hat sich dieses Ideal nicht einfach erledigt. Es verbietet uns nicht, uns gegen militärische Aggression zu wehren, fordert aber, auch im Angreifer nicht nur den Feind zu sehen, und Wege zum Frieden zu suchen. Mit Blick auf die Feindesliebe zeigt sich, was generell im Umgang mit herausfordernden Idealen gilt: Es gibt nicht immer moralisch perfekte und „ideale“ Lösungen – wir sind aber dennoch gefordert, die bestmögliche Option zu wählen. Auch ein Ideal, dem wir uns nur annähern können, kann in diesem Sinne Orientierung bieten. •

SAISONTHEMA
VON SEPTEMBER 2022 BIS JANUAR 2023
Wir setzen unser Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN mit zwei spannenden Veranstaltungen im Bildungsbereich Persönlichkeit & Pädagogik fort. An zwei Gesprächsabenden beschäftigen wir uns mit „Inneren und äußeren Konflikten“ und gehen der Frage nach: „Wann hören Kriege auf?“ • Seite 27
Haben Sie unsere OnlineReihe zu Solidarität, Völkerrecht und Feindesliebe verpasst, interessieren sich aber für die dort gehaltenen Impulse? Kein Problem.
Für eine Schutzgebühr von 9 Euro geben wir Ihnen einen exklusiven Zugang zu den Videos der Veranstaltungen. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Mail an info@domberg-akademie.de
Die Sinnfrage zu stellen, scheint so selbstverständlich wie absurd. Denn der Mensch hat die Gabe, scheinbar alles in Frage zu stellen, selbst den Sinn der Dinge und das Leben im Ganzen. Zugleich wissen wir auch – und leben meist gut damit –, dass es keine letzte Antwort auf die Frage gibt // von karin hutflötz

Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“, fragt der Philosoph Leibniz bereits 1714 in radikaler Verallgemeinerung der Frage nach dem Sinn. Und bis heute gilt die Philosophie als Zieldisziplin, wenn es um die Sinnfrage geht. Das ist sie aber nur bedingt, nämlich dann, wenn es um allgemeine Einsichten und theoretisches Nachdenken über den Sinn von Welt und Leben geht. Nicht jedoch, wenn sich die Sinnfrage in existenzieller Not oder abgründigen Momenten stellt, wenn Halt wegbricht und Orientierung im Leben verloren geht.
Dann ist die Sinnfrage unerlässlich, wie die Frage nach dem richtigen Weg und möglichen Ziel. Fertige Antworten, gar Sinndeutungen, Weisheitssprüche oder Ratschläge sind dann weder gut noch hilfreich. Davon erzählt eindrücklich das Buch Hiob: „Eure Merksätze sind Sprüche aus Staub“ (3,12). Statt „windiger Worte“ „leidiger Tröster“ (16,2–3) gilt es, erfahrenen Sinnverlust vor allem wahrzunehmen und zu bezeugen – damit den Blick auf das, was wirklich geschieht, mit dem Betroffenen zu teilen und es auszuhalten – ganz im Sinne Hiobs: „O Erde, deck mein Blut nicht zu / und ohne Ruhstatt sei mein Hilfeschrei!“
Krisen- oder Umbruchszeiten generieren Zukunftsangst oder zumindest das Gefühl von Aufbruch im doppelten Sinn des Wortes. Vermeintlich Selbstverständliches, verlässlicher Boden bricht auf, damit brechen Halt und Sicherheit weg. Doch Aufbruch kann auch Anfang einer neuen Reise sein und das Ende einer Starre, der erste Schritt zu einer persönlichen oder beruflichen Neu-Orientierung, der Beginn von sozialem und politischem Wandel. Wo Aufbruch und Umbruch, kann eine neue Seite aufgeschlagen werden im ungeschriebenen Buch der
Zukunft. Nur weiß man dann meist noch nicht, wie diese zu gestalten sei.
Man will es anders und besser machen, aber wie? Was wäre das Bessere, und wie können wir es gemeinsam und nach neuem Maß gestalten? So brechen ethische und existenzielle Fragen heute wieder verstärkt auf, gewinnen soziale und politische Relevanz angesichts der Dringlichkeit von Krisen- und Kriegsfolgen und gehen uns persönlich und im sozialen Miteinander an. Fordern aber auch grundsätzliche Weichenstellungen im Handeln: ˭
Wo wollen wir hin, wie wollen wir leben? ˭
Was zählt eigentlich, und was zählt mehr als anderes? ˭
Wie frei sind wir wirklich, wie können wir Freiräume schaffen und Selbstbestimmung leben?
Entscheidend ist nun, ob man mit diesen Fragen in Krise oder Sinnverlust konfrontiert wird, was kaum Spielraum zum neu Handeln und Reflektieren lässt. Oder ob man die Chance hat, sich solchen Fragen in freiwilliger Besinnung zu stellen, in einem gemeinsamen Innehalten und Austausch ohne Zeitdruck und Entscheidungsnot. Wo Selbstreflexion Raum bekommt und philosophische Reflexion auf die existenziellen wie ethischen Dimensionen der Fragen möglich ist, wie in unseren drei Workshops zur Persönlichkeitsbildung „QUO VADIS? Sinn suchen. Orientierung finden“ (siehe S. 15).
Mit der Sinnfrage, in der Weise ernsthaft gestellt, richten wir uns aus auf den Fluchtpunkt des Seins. Dieser ist und bleibt außerhalb des Bilds, das wir sehen können, bildhaft gesprochen. Der Fokus auf den Fluchtpunkt ist wie ein Gipfelblick. Nur wenn wir den haben, können wir uns auf den Weg machen. Aber der Gipfel hat genau genommen mit dem Weg nichts zu tun, muss auch nicht erreicht werden, nur hin und wieder im Blick sein, um Orientierung zu haben unterwegs. Daher lohnt es, mit der Frage „Worum geht es eigentlich?“ die FluchtpunktPerspektive einzunehmen, um Klarheit zu gewinnen über Mitte und Ziel – sei es im persönlichen Leben oder in gesellschaftlicher Gestaltung.
Das erfordert immer mal innezuhalten und sich zu verorten auf dem eigenen Weg und im Leben. Ohne sich hin und wieder Zeit zu nehmen und
die Geduld zu haben für einen solchen Blick, verliert man leicht den Sinn für Prioritäten und die Orientierung unterwegs. Arbeitet sich ab im Nebensächlichen, vernachlässigt seine Ressourcen und vergeudet Lebenszeit.
Dennoch geht es nicht um ein ständiges Kreisen um den Sinn! Die Sinnfrage wird vielfach thematisiert, doch auch auffallend polarisiert. Dabei geht es entweder um Sinnverlust im Abgrund der Depression, um Zustand und Symptom „des erschöpften Selbst“ (A. Ehrenberg). Oder um das wohlstandspropagierte Versprechen totaler Sinnerfüllung in einem durch Leistung und Achtsamkeit (selbst-) optimierten Leben. Was zwischen die Stühle dieser beiden scheinbar zur Normalität gewordenen Extreme fällt, ist der Sinn dafür, worum es im menschlichen Leben eigentlich geht –wo Sinnerfahrung individuell und gemeinsam zu finden ist, wie mit Sinnverlust umzugehen ist und inwieweit wir Sinnerfüllung brauchen.

Menschen brauchen Sinn wie die Luft zum Atmen. Dieser äußert sich vor allem als Sinn für Verbundenheit und in der Erfahrung von Beziehung und Bezug. Dabei geht es auch um einen Bezug zu sich selbst in innerer Vielfalt und äußerem Wandel, um Verbundenheit zu Welt und Natur, zum Schönen und Guten. Was wir aber jeweils als schön und gut erfahren, ob wir uns im Naturerleben oder in der politischen Gestaltung von Welt, in kreativer Auseinandersetzung mit materiellen oder immateriellen Dingen, in Musik, Meditation oder Bewegung als besonders sinnerfüllt erfahren, ist individuell ganz unterschiedlich. Ebenso das Maß, in dem uns etwas Sinn gibt. Doch Sinn ist ein gradueller Begriff: Manchmal reicht wenig, irgendeine Aufgabe und ein Wozu, um hinreichend Sinn zum Leben zu ‚haben‘.

Jenseits der Worte „Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach“, sagt Adorno, und verweist darauf, dass Sinnerfahrung im Positiven sich vor allem im fraglosen Tun und intrinsischer Motivation, am Maß von Freude und Hingabe zeigt. Solange wir irgendeinen Sinn sehen in dem, was wir tun – auch ohne ihn benennen zu können – finden wir Grund zum Sein,
Innehalten.Halt finden. Sich nicht aufhalten lassen
„Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“
und die Sinnfrage im existenziellen Sinn stellt sich nicht. Wenn sie aufbricht, dann nicht als philosophische Frage oder theoretisches Problem, sondern als Schmerz der Sinnlosigkeit und Verlust an spürbarem Bezug und Interesse, als Moment der Isolation und Leere.

Das verweist auf den Kern dessen, worum es bei der Suche nach dem Sinn eigentlich geht: darum, sich wieder auf den Weg zu machen, um Ausdruck zu finden und Verbundenheit zu erfahren. Um wieder gesehen und gehört zu werden, auch von sich selbst. Um sich wieder einschreiben zu können „ins Bezugsgewebe der Welt“, so Hannah Arendt. Analog zur Sprache, wo Sinn schlicht Kontextbezug bedeutet: Ein Satz zum Beispiel ergibt genau dann Sinn, wenn er im Kontext der Sprache und im Zusammenhang des Gesagten verstehbar ist. Menschlicher Ausdruck kennt viele Sprachen und äußert sich auf sinnlich vielfältigen Ebenen. In Gesten und Körpersprache verständigen wir uns primär, daher ist ein Lächeln zwischen Fremden schon eine starke Kraft, und eine Umarmung ist viel. Vor allem bedarf es aber des Zuhörens: Wem Sinn fragwürdig wird, der soll sprechen, die anderen zuhören. Statt meist umgekehrt: Wem der Sinn wegbricht, der zieht sich zurück, verschließt sich, schweigt. Während die anderen Ratschläge erteilen, Sinnsprüche an die Hand geben. Oder wie Hiob sagt: „Schweigt vor mir, damit ich reden kann!“ (13, 13)
Gerade Bilder und Farben sind wirkmächtige Mittel der Kommunikation und Sinn-Deutung: Sie verleihen Dingen Ausdruck, machen Barrieren sichtbar und Ziele klar, wo Worte noch nicht greifbar sind. Unser Seminar „BEYOND WORDS. Blockaden lösen. Farbe bekennen. Ausdruck finden“ Mitte Februar (siehe S. 27) befasst sich mit dieser Besinnung auf den eigenen Weg und Kompass jenseits der Worte. Das erlaubt, sich wieder auszurichten auf die Frage nach den eigenen Ressourcen als Quellen und Erfahrungsorte von Sinn und Freude. Und die Orte wieder aufzusuchen, wo die Fülle im Augenblick und die Verbundenheit mit Dingen und Menschen möglich scheinen, die einem wertvoll und wichtig sind. Genau dafür geht der Sinn leicht verloren im Trubel des Alltags und in der Taktung der Welt.
Das ständige Zuviel verstellt den Blick auf neue Perspektiven und „den utopischen Gehalt der Zukunft“, wie Ernst Bloch formuliert: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.“ Aber nicht im fatalistischen Sinn einer blinden Hoffnung auf Rettung oder Untergang (als müsse man keine Verantwortung für die Zukunft übernehmen, weil sie kommt, wie sie kommt) oder im technokratischen Sinn einer naiven Hoffnung auf die berechenbare Welt (als könne man die Zukunft nach Wunsch und Willkür bauen), sondern Hoffen zu lernen auf das im menschlichen Maß Mögliche – im Spielraum persönlicher Verantwortung und sozialer Teilhabe.
Doch woher nimmt man Maß für das eigene Leben und für eine unseren Sinnbedürfnissen gerechtere Welt, wenn sie noch nie war, wie sie sein soll? Besonders die sogenannte Generation Y fragt sich das verstärkt. Benannt nach dem englischen why, zu Deutsch „warum“, steht der Name sinnbildlich für den grundlegend Sinn hinterfragenden Charakter, der dieser Generation zugeschrieben wird. Diese jungen, oft hoch qualifizierten Menschen nehmen Erwerbsarbeit zum Beispiel weit weniger ernst als früher, selbst in karriereträchtigen Berufsfeldern. Sie investieren mehr in Beziehungen und Erfahrung, suchen Sinn und Lebensziele neu zu orten.

Davon zeugt auch das aktuelle Quit Job-Phänomen, wonach Menschen kündigen, auch ohne neue Sicherheiten zu haben. Offenbar sind sie nicht mehr bereit, sinnentleerte Jobs in Kauf zu nehmen „für ein bisschen Struktur“, wie es in einem Lied von Jennifer Rostock (Weltbilder, 2017) heißt: „Wir nehm’n uns die Zeit und schneiden sie klein / Bis nichts davon bleibt außer Daten und Deadlines / Stell’n unser Leben nach Kalender und Uhr für ein bisschen Struktur“. Und der Refrain lautet – ganz im Umbruchscharakter der Zeit: „Aber was, wenn das alles nicht reell ist? / Wenn unser Weltbild nur ein Bild und nicht die Welt ist? / Aber was, wenn in Wirklichkeit die Realität ganz anders geht?“ •
Dr. Karin Hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung
der Domberg-Akademie

bei
„Menschen brauchen Sinn wie die Luft zum Atmen. Dieser äußert sich vor allem als Sinn für Verbundenheit und in der Erfahrung von Beziehung und Bezug“
Drei Menschen, die in ihrem Beruf mit Sinn und Orientierung zu tun haben. Sie erzählen uns, wie sie sich
Hermann Reigber ist Geschäftsführender Leiter der Christophorus Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit am Klinikum Großhadern in München

Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen sich bei uns natürlich ganz besonders. Aber es ist schwer zu beurteilen, welche Rolle genau der Sinn im Leben der Menschen an der Schwelle zum Tod spielt, weil die Krankheitsverläufe so unterschiedlich sind: Manchmal geht es sehr schnell; es gibt aber auch Verläufe, die sich über mehrere Jahre hinziehen. Da bleibt dann natürlich schon die Zeit, sich dem Thema Sinn zu widmen. Und wir schauen ja nicht nur die Patienten an, sondern auch die Angehörigen, die mit dieser Frage vielleicht noch mehr beschäftigt sind.
Was gibt den Menschen, die ihr Lebensende im Blick haben, Sinn und Orientierung? Am wichtigsten ist aus meiner Sicht eine gute und gesicherte Versorgung in einer geeigneten Umgebung. Hier möchten wir Antworten geben auf die Fragen: Wo kann ich sein? Wo werde ich wahrgenommen? Wo ist auch für meine Wünsche und Bedürfnisse, für mein normales Leben Platz? Ein ganz normales Leben, bei dem man nicht eingebunden ist in eine belebte Umgebung – das geht auch in Pflegeeinrichtungen – auch das kann Sinn für ein nach außen begrenztes, vulnerables Leben geben.
Das Sinnkonzept für Kranke war in den zweieinhalb Jahren der Pandemie extrem gefährdet, weil die Normalität den CoronaRegeln und Isolationspflichten unterlegen ist. Wir haben hier in Großhadern eine Palliativstation mit zwölf Betten und einem ambulanten Dienst. Nach dem ersten strengen Lockdown konnten wir schon nach drei Monaten die Besuchsregeln wieder lockern und einen normalen Kontakt mit den Nächsten ermöglichen. Das ist ein basaler Sinn von höchster Bedeutung.
Viele sagen den Patienten: „Du musst keine Angst haben.“ Das ist Unsinn. Sich seiner Angst zu stellen oder ihr einen Ort zu geben, ist ein großer Schritt in das Land des Sinns. Die Angst soll einen Platz haben. Wir haben da vor allem auch die Nächte im Blick. Die Nacht ist der Ort der Angst.
Annemarie Eckardt engagiert sich hauptberuflich und ehrenamtlich ohne Pause: im FSJ, im BDKJ, in der Erwachsenenbildung … Macht mehr Arbeit auch mehr Sinn? Für sie schon

•
Neben der Angst und dem Umgang mit ihr beschäftigen unsere Patienten auch ihre Angehörigen. Kranke leiden oft darunter, dass es ihren Angehörigen so schlecht geht. Sie haben dann das Gefühl, dass sie zur Unzeit gehen und ihre Partner, ihre Familie, ihre Angehörigen alleine lassen würden. Das ist extrem sinngefährdend. An dieser Stelle versuchen wir, das soziale Umfeld durch Ehrenamtliche zu bereichern. Normalität herzustellen. Einfach da zu sein. Unterhaltung im Sinne einer leiblichen Kommunikation bereitzustellen.
Hermann Reigber ist auch Theologe. Glaubensangebote funktionieren nur noch niederschwellig: eine Kerze anzünden, gemeinsam beten …
Als hauptberufliche Bildungsreferentin im BDKJ für das Freiwillige Soziale Jahr begleite ich rund 100 Freiwillige durch ihr spannendes Jahr voller Entwicklungen und Veränderungen. In der pädagogischen Begleitung, die wir anbieten, geht’s ganz viel um Orientierung: Lebensorientierung, Berufsorientierung, Orientierung in der Arbeitswelt.
Ehrenamtlich habe ich im Dezember nach sechs Jahren als Stadt und Regionalvorstand beim BDKJ München aufgehört. Der Abschied fiel mir zwar schwer, war aber natürlich richtig: Ich bin jetzt 30 Jahre alt, der BDKJ ist ein Jugendverband …
Als Theologe stelle ich zunehmend fest, dass geschlossene Sinn und Glaubenskonzepte nicht immer gefragt sind. Dennoch bieten wir an, eine Kerze anzuzünden, ein Gebet für den Patienten zu sprechen, miteinander zu beten. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Eine Krankensalbung etwa wird nur noch selten gewünscht. Aber am wichtigsten: Ein Hospiz ist ein safe space. Hier ist der Tod, ein gesellschaftlich hoch explosives Thema, besprechbar. •
In meiner Arbeit und meinem ehrenamtlichen Engagement haben mich immer wieder Projekte begleitet, zum Beispiel in der Erwachsenenbildung des Erzbistums München und Freising oder im BDKJ wie München 2040, Mut zum Kreuz und etliche mehr.
Macht mehr Arbeit also auch mehr Sinn? Für mich schon. Für mich ist ein großer Antrieb, etwas mitgestalten zu können. Und wenn mir Dinge wichtig sind, dann setze ich mich auch gerne dafür ein. Da habe ich diese Spielfelder auch immer sehr gerne angenommen. In der Jugendverbandsarbeit war plötz
„Ein normales Leben – auch das kann der Sinn des Lebens sein“
„Glaube kann uns helfen, wo uns die Worte fehlen“
lich so viel möglich. Das hatte so viel Zugkraft, das hat mich sehr motiviert. Da steckt viel Herzblut drin, das gibt mir Sinn. Ich merke dann, das hat einen Bezugspunkt zu den Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und es geht da um die grundlegenden Werte, die mich antreiben.
Im BDKJ war ich vor sechs Jahren ein völlig anderer Mensch, da gehe ich jetzt ganz anders raus. Wie sehr mich diese Zeit verändert hat! Zum Beispiel konnte ich erleben, dass da draußen noch viel mehr ist, weswegen ich mich auch neu orientiert und mal eine neue Abzweigung genommen habe – das war in dem Moment oft anstrengend und kräftezehrend, aber im Nachhinein bin ich unfassbar dankbar!
Ich engagiere mich sehr, ich trage gerne Verantwortung und gebe Menschen Orientierung. Hier spielt mein Glaube eine sehr zentrale Rolle! Er ist auf jeden Fall eine Konstante, er verwurzelt mich und gibt mir immer wieder eine große Sicherheit: Ich kann gar nicht so falsch abbiegen … Da geht es um eine größere Orientierung, die mir auch das Gefühl gibt, dass ich nicht jede Entscheidung alleine treffen muss. Das kommt vor allem für die jungen Menschen zum Tragen in einer Lebensphase, in der sie in so großen Veränderungs und Entwicklungsprozessen sind. Da mit Ehrfurcht ranzugehen und förderliche Wachstumsbedingungen zu schaffen, danach richte ich meine Arbeit aus.
In meiner Arbeit mit den FSJlern merke ich bei ihnen ein großes spirituelles Bedürfnis. Sie sind auf der Suche nach etwas, das trägt, und haben gleichzeitig viele Widerstände, was Kirche angeht. Das Bedürfnis wäre da, allerdings fehlen die offenen Türen. Deshalb versuchen wir immer wieder, kleinere spirituelle Momente einzubauen. Denn Glaube kann uns helfen, wo uns die Worte fehlen. Er hilft uns beim Tragen. •
Stefan Bauberger

ist Jesuit, katholischer Priester, Zen-Meister, Philosoph und Physiker. Wenn sich einer auskennen müsste mit dem Sinn des Lebens – dann er
ist es nicht mehr das, worum es geht. Im Modus des „HabenWollens“ kann man das nicht haben. Der Sinn kann mir nur immer wieder neu geschenkt werden.
Worin der Sinn des Lebens für einen persönlich besteht, ist eine ganz schwierige Frage! Denn der Sinn des Lebens ist ja nichts, was zu einem Leben noch dazu kommt, sondern er ist im Leben schon immer drin gewesen.
• Stefan Bauberger kennt Phasen, in denen er ganz unruhig auf der Suche nach Sinn war – bis er gemerkt hat, dass das nichts bringt
Manchmal werde ich gefragt, warum ich so viele gegensätzliche Wege eingeschlagen habe. Ich antworte dann: Ich bin halt Mensch. Ich bin Jesuit geworden, weil ich eine Lebensgemeinschaft gesucht habe, die spirituell lebt, und in der ich etwas Sinnvolles für die Welt tun kann. Ich war schon immer auch naturwissenschaftlich interessiert, und deshalb habe ich nach dem Philosophiestudium noch Physik studiert bis zur Promotion. Seit ich 16 bin, meditiere ich. Das war für mich persönlich sehr wichtig. Mein ZenMeister, ein indischer Jesuit, wollte mich schließlich zum ZenLehrer ausbilden; so habe ich das auch noch gemacht.
Es gibt Zeiten, in denen die Wirklichkeit durchlässig wird für diesen Sinn – als Christ kann ich auch sagen „durchlässig für Gott“ –, dann finde ich diesen Sinn überall, in meinem Leben oder draußen in der Natur. Ich kenne aber auch Zeiten, die nicht durchlässig sind, in denen mich blöde Gedanken und Sorgen in Beschlag nehmen. Dann zeigt er sich nicht, der Sinn.
Ich will sinnvoll leben, heißt, dass ich ein Leben haben möchte, in dem ich gut leben kann. Aber die Welt steht auch in Brand. Ich kann mich da nicht raushalten, ich muss auch Stellung beziehen. In meinem Bereich Verantwortung wahrzunehmen, auch das heißt sinnvoll leben.
• Annemarie Eckardt ist eng mit BDKJ und FSJ verbunden – dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend und dem Freiwilligen Sozialen Jahr
Ich bin ein Grenzgänger zwischen Glaube und Naturwissenschaft, zwischen westlicher und östlicher Religiosität. Deshalb kann ich sagen, dass sich ein Sinn des Lebens objektiv nicht finden lässt. Ich selbst bin immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Lange Zeit war ich sogar auf einer verzweifelten Suche, aber jetzt bin ich eher ruhiger. Man kann den Sinn aber nicht finden. Sobald ich einen Sinn festzuhalten versuche,
Bei all dem war Glaube schon immer der Schlüssel in meinem Leben. Im Moment erodieren die christlichen Kirchen in Europa unfassbar schnell. Aber diffuse Formen der Spiritualität sind weit verbreitet. Dabei habe ich so meine Probleme mit dem Begriff der Spiritualität. Spiritualität wird konsumiert und gehört zu jedem gehobenen WellnessProgramm dazu. Das widerstrebt mir zutiefst. Für mich ist Spiritualität die Öffnung auf Gott, das Absolute, die große Wirklichkeit hin. Ich brauche mehrere Worte dafür, weil keines richtig trifft.
Also: Wenn die Welt in Brand steht, muss man auch was tun und sich engagieren! Aber um zur Ruhe zu kommen, ist es hilfreich, jeden Tag eine Übung zu machen für sich und die Seele. Sie muss nicht lang sein, dafür aber regelmäßig. •
„Ein Sinn des Lebens lässt sich objektiv nicht finden“
In Krisenzeiten bricht vieles auf, so manches Lebenskonstrukt steht zur Disposition, auch der Glaubens-Boden unter den Füßen wankt.
Es stellen sich verstärkt die großen Fragen des Lebens: Woher komme ich? Wozu bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn meines Lebens?
Tatjana Schnell, die an den Universitäten in Innsbruck und Oslo mit dem Schwerpunkt auf empirische Sinnforschung arbeitet, unterscheidet fünf Dimensionen von Lebenssinn:
vertikale und
horizontale Transzendenz
Selbstverwirklichung
Wir- und Wohlgefühl
Ordnung.
Für viele Menschen sind derzeit mehrere oder sogar alle dieser fünf Dimensionen eingeschränkt: Wie finden wir bei all diesen gewaltigen Herausforderungen Sinn, und was kann der christliche Glaube dazu beitragen?
Es ist eine der Aufgaben einer Religion, dass Menschen insbesondere an Brüchen des Lebens durch eine Rückbindung an ein größeres Ganzes Halt erfahren und Orientierung finden. Und Religionen erfüllen diese Aufgabe: Einer US-Studie aus dem Jahr 2021 zufolge finden religiöse Menschen deutlich mehr Sinn im eigenen Leben als nicht-religiöse.

Warum ist das so? Eine Antwort gibt in der Bibel der 1. Petrusbrief: „Gebt Zeugnis von eurer Hoffnung, die euch erfüllt.“ (1 Petr 3,15) Mehr denn je ist es gefragt, als Christ:innen Zeugnis zu geben von der heilbringenden Hoffnung. In Zeiten wie diesen von dem zu sprechen, was mir als religiösem Menschen Halt und Orientierung gibt. Auszusprechen und darüber zu reden, was mich erfüllt, antreibt und mir Kraft gibt, immer wieder neu an die Zukunft zu glauben.
So lässt sich Glauben verstehen nicht als Konglomerat von Glaubenssätzen, sondern in erster Linie als eine bestimmte Art der Lebensführung, wie es der Pastoraltheologe Matthias Sellmann in seinem Buch „Was fehlt, wenn die Christen fehlen? Eine Kurzformel ihres Glaubens“ (Würzburg 2021) neu erschlossen hat. „Christsein ist eine Ressource für positive, gelingende Existenz, (…) eine Hilfe zum Leben“, schreibt Sellmann (Seite 16). Gott will ein Leben in Fülle für uns alle. Und wer Christ:in ist, soll zeigen, wie Leben gelingen und nachhaltig gestaltet werden kann. Ein gelingendes und nachhaltiges Leben führen zu können, ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal des Christentums, aber Christ:innen können Vorbild sein und zeigen, welche Haltungen und Kompetenzen es dafür braucht.
Der Glaube zielt auf den Alltag, den wir täglich meistern müssen. Er muss sich im Alltag bewähren. Leben aus dem Geist des Evangeliums zeigt sich in der Haltung zum Leben, zu den Menschen und allem Lebendigen sowie darin, wie ich mein Leben führe. Das Spezifische des

Christliche Sinnfluencer:innen gesucht, findet claudia pfrang
INNEHALTEN.
„Jesus befähigte die Menschen immer wieder, Risiken einzugehen und an das Unmögliche im Möglichen zu glauben.“
Christlichen fasst Sellmann im Begriff der geistlichen Lebensklugheit zusammen. Diese Lebensklugheit lässt einen tiefer blicken. Dies führt zu einem tieferen Verständnis des „Geistlichen“, das oftmals nur als Flucht vor der Realität, als das Fromme, das Körperfeindliche, das Unpolitische, das Moralische, Brave, Kirchenangepasste verstanden wird. Das allerdings ist eine Verkürzung. Geistliches Leben hat vielmehr einen Blick für das, was möglich ist, was hinter dem Realen liegt oder liegen kann.


Christsein ist die Leidenschaft für das Mögliche
Christlich leben heißt somit, ein Möglichkeitsmensch zu sein – es ist das Gegenteil davon, sich der Realität zu verweigern, sondern es ermöglicht, sie vertieft wahrzunehmen und zu entdecken, was noch alles möglich wäre. Christ:innen sagen: Da geht noch mehr, auch wenn scheinbar nichts mehr geht! Geistliche Menschen sind Wandlungs-Expert:innen, sie sind, wie Sellmann es treffend auf den Punkt bringt, PotenzialCoaches, die an die Dreier-Logik glauben:
Es ist etwas da. Es ist etwas möglich. Es gibt eine Kraft, die uns ermöglicht, das Gegebene ins Mögliche zu verwandeln.
Jesus befähigte die Menschen immer wieder, Risiken einzugehen und an das Unmögliche im Möglichen zu glauben. In seiner Nachfolge unterwegs zu sein, bedeutet daher, immer auch etwas zu riskieren. Christlich sein ist die Leidenschaft für das Mögliche, das Wissen um die Verwandlungskraft! Das ist der Kern unseres Osterglaubens, das Alleinstellungsmerkmal des Christentums: Es ist möglich, dass aus zerstörtem Leben neues Leben entsteht – auch wenn wir es kaum für möglich halten.
Das lässt auch in diesen Zeiten, in denen wir den Planeten aufs Spiel setzen, immer wieder hoffen: Trotz aller Kipppunkte ist eine Zukunft für die Menschheit möglich. Das alte Leben mit dem Credo von schneller, höher, mehr, effektiver geht so nicht weiter, es braucht Neues, es braucht Wandlung. Was bedeutet das für uns Christ:innen? Müssten wir nicht mutig an der Spitze dieser Transformationsprozesse stehen?
Christliches Leben als Lebensklugheit meint also die Kompetenz, die uns befähigt, tiefer zu blicken, das Leben zu ergründen, weil wir wissen, dass Gott in allen Dingen zu finden ist. Und weil Gott überall ist, kann ich daraus die Kraft gewinnen, all das möglich zu machen, was unmöglich oder verrückt ist. Es geht also um eine zupackende und optimistische Lebensführung, und das nicht nur im religiösen Sinn. Es geht „nicht um eine irgendwie freischwebende ,Gesinnung‘, sondern um Lebenspraxis, Lebensbewährung, Alltagskraft“, macht Matthias Sellmann deutlich (Seite 63). Doch nach welchem Maß?
Es gibt für Christ:innen diesen einen Orientierungspunkt: Jesus Christus, sein Leben und seine Botschaft, die seine Jüngerinnen und Jünger von Anfang an fasziniert und die sie weitergetragen haben – das kann heute noch gelebt werden. Der
Christus-Hymnus im Philipperbrief (Phil 2,5–11) drückt das so aus:
„Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.“
Was können diese Gedanken für uns heute bedeuten? Welche Kompetenzen können wir für uns daraus ableiten? Sellmann nennt drei: ˭ Nicht länger wegrennen ˭ Aus sich herauskommen ˭ Kraft von außen aufnehmen.
Nicht länger wegrennen „Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ (Phil 2,7f.)
Die erste Kompetenz des Christseins: sich der Realität stellen; immer weniger wegrennen wollen, weil es um das ganze Leben geht. Das ist gerade in Situationen, die kaum lösbar erscheinen, manchmal schwer aushaltbar, aber auch unabdingbar. Die vielen derzeit kontrovers diskutierten Aktionen der Klimaaktivist:innen, die sich an Straßen festkleben, machen diesen Aspekt überdeutlich. Sie harren aus, zeigen, dass Politiker:innen nicht länger die Auseinandersetzung mit den Realitäten verdrängen oder auf die lange Bank schieben dürfen. Sie gehen persönliche Risiken ein. Sie rennen nicht weg.
Dabei ist es manchmal zum Davonrennen im Leben! Man muss auch nicht immer auf „Biegen und Brechen“ durchhalten. Nein, hier geht es darum, sich einerseits bewusst zu werden, dass das Leben kein Spaziergang auf dem Hochplateau ist, es Höhen kennt, aber auch Tiefen zu durchwandern gilt. Anderseits gilt es, sich ehrlich jeder Situation zu stellen, mit allem, was uns das gerade abverlangt. Glauben ist also nicht die Flucht aus der Welt, sondern gerade das Gegenteil: sich der Wirklichkeit zu stellen. Das führt hinein in die zweite Kompetenz des Christseins.
„Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ (Phil 2,6f.)
Gott taucht ganz in die Welt der Menschen ein – bis in die letzte Konsequenz. Er geht die Wege der Menschen mit, ist bedingungslos an ihrer Seite. Somit wird die Wirklichkeit zum Ort der Gotteserfahrung. Die Realität der Menschen – auch und gerade in sozialer Not und politi-
schen Konflikten – ist der Ort der Gottesbegegnung. Berühmt ist der Satz Jesu aus dem Matthäus-Evangelium: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Daraus ergibt sich der Auftrag, es Jesus gleich zu tun, sich an ihm zu orientieren und sich konsequent für Menschenwürde, Gleichheit, Gerechtigkeit, für eine solidarische und friedliche Welt einzusetzen.
„Aus sich herauskommen“ nennt Matthias Sellmann diese Kompetenz. „Es sind die, die nicht die Schnürsenkel ihrer Schuhe anmeditieren, sondern sich melden, wenn jemand gebraucht wird. Sie sind voller Fantasie, wo man noch etwas Zeit, etwas Geduld, etwas Geld für die erübrigen kann, die es nötiger brauchen.“ Bei solchen Menschen sei „unter der Oberfläche des harmlos Freundlichen eine hochgradig belastbare, geradezu trotzige widerstandsfähige Substanz eines tiefen Glaubens an menschliche Werte zu finden“ (Seite 91). Sie sind nicht einfach Ja-Sager:innen oder Gutmenschen, sondern die, die hartnäckig dranbleiben. Bei allen Herausforderungen und Widerständen, die der Einsatz für andere, für eine mögliche bessere Zukunft abverlangt, lassen sie sich das Vertrauen nicht nehmen, das uns Christ:innen zugesagt ist: „Ich will euch eine Hoffnung und Zukunft geben“ (Jer 29,11).
„Gott hat ihn erhöht.“ (Phil 2,9)
Die dritte Kompetenz ist der Glaube daran, dass uns immer wieder Kraft von außen zuwächst, um sich und anderes zu verändern. Das Leben Jesu erzählt viele Geschichten davon: Aus wenigen Fischen macht er ein Essen für viele, aus kleinmütigen Jünger:innen mutige Verkünder:innen. Jesus ist der wahre Transformationsexperte, würden wir heute sagen.
Trauen wir uns zu, dass auch wir verwandeln können? Wo haben wir vielleicht auch schon erfahren, dass uns eine Kraft im Leben zugewachsen ist? Wenn wir uns etwa für andere engagieren, ist immer wieder eine Kraft spürbar, die das, was wir geben, als Gabe aufhebt, weil wir selbst so viel empfangen.
Immer wieder habe ich sogenannte Sinnfluencer:innen kennenlernen dürfen. Das sind Menschen, die aus diesem Spirit leben: Menschen, die sich mutig der Realität stellen, die aus sich herausgehen und etwas wagen, denen eine Kraft zuwächst, die sie zu Taten beflügelt. Dies ist eine Einladung: Jede:r kann diesen Weg gehen. Christ:innen sollen es sogar jeden Tag neu versuchen. Und sie wissen, dass sie nicht alles aus eigener Kraft schaffen und tragen müssen. Sie können darauf vertrauen, dass im Scheitern ein Neuanfang möglich ist. Dieses Gefühl tiefen Vertrauens zeichnet Christ:innen aus. •
PfrangDie Frage, was zählt, worum es letztlich geht in Leben und Beruf, ist kaum zu beantworten, wenn man ausdrücklich gefragt wird. Im Handeln und Entscheiden aber beantworten wir sie immer mit. Daher lohnt der genaue Blick auf das, was für uns im Alltag zählt und Halt gibt, was unserem Tun Gewicht verleiht und wir im Miteinander als wertvoll und wichtig erfahren –auch scheinbar kleine Dinge zählen!
Wir möchten Sie gerne einladen, Ihre persönlichen Antworten auf folgende Fragen zu notieren: ˭
Was waren für Sie wichtige Momente und wertvolle Situationen im vergangenen Jahr – sei es im Privaten oder im Beruf?
Was schätzen Sie in Freundschaften oder in der Partnerschaft am meisten?
Was möchten Sie in Ihrer Arbeit und allem Tätigsein nicht missen?
Arbeit meint hier keineswegs nur Erwerbsarbeit, sondern auch Ehrenamt oder Care-Arbeit! Befragen Sie sich im Hinblick auf das, was für Sie selbst gerade Arbeit und Aufgabe ist – sei es im Dienst der Familie oder der Gesellschaft, eines Unternehmens oder einer Organisation.
Notieren Sie zu jeder Frage mehrere Antworten. Lassen Sie sich Zeit. Nehmen Sie die Fragen mit in ihren Alltag und an Rückzugsorte des Innehaltens. Und erinnern Sie sich so konkret wie möglich:
˭
Was genau war es, was mir mehr gibt als anderes? ˭
Was bleibt als „Stern“ am Himmel der Erinnerung auch im Rückblick noch bestehen? ˭
Was sind unumgängliche Marksteine, die anzeigen, dass ich auf einem für mich richtigen Weg bin?
Suchen Sie dann materielle Symbole oder würdige Platzhalter zu Ihren Gedanken!
Sammeln Sie beim nächsten Spaziergang zum Beispiel den einen oder anderen schönen Stein. Oder nehmen Sie Sterne aus Papier, die man beschriften kann. Schreiben oder zeichnen Sie darauf jeweils ein Wort oder Symbol – für das, was Sie als wertvoll und wichtig erfahren haben.
Finden Sie für diese „Marksteine“ nun einen würdigen Ort! Zum Beispiel in einer Schale zuhause. Oder als Papiersterne am Fenster oder als Mobile an der Decke. Oder ein schöner Ort im Garten, am Fluss oder unter einem Baum, an dem Sie gern vorbeikommen!
Solch Innehalten und Besinnen auf das für Sie persönlich Wichtige und Wertvolle im Leben UND der Mut, dem leibhaftig Ausdruck zu verleihen, eichen nachhaltig auf Sinn, geben Orientierung – und bestärken Andere darin, sich selbst zu fragen, was für sie wirklich zählt.
Karin Hutflötz
Auf
Innehalten.Halt finden. Sich nicht aufhalten lassen
DA erfahren Sie mehr! Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu allen aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen unseres Saisonthemas SINN SUCHEN. Hier bleiben Sie zum Beispiel auf dem Laufenden über die Termine unserer Reihe ZEITANSAGEN und können sich auch direkt für den Newsletter anmelden, damit Sie beim Start der Fastenzeitimpulse gleich mit dabei sind!

VADIS. Sinn suchen. Orientierung finden Workshops zur Selbsterfahrung und Besinnung auf den eigenen Weg und Kompass. Methodisch vielfältig und theoretisch fundiert. Im Schnittfeld von Philosophie, Psychologie und Pädagogik. In Kooperation mit dem Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung

Sinn und Orientierung finden in Leben und Beruf. Mit vielfältigen Übungen zur (Selbst-)Reflexion erforschen wir eigene Sinn- und Orientierungserfahrungen – und setzen diese in Bezug zu aktuellem Handeln und zukünftiger Orientierung.
Termin Fr, 03.02.2023
Beginn/Ende 10.00 / 18.00 Uhr Mit / Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Kath. Hochschulgemeinde an der LMU, Leopoldstraße 11, 80802 München
Teilnahmegebühr EUR 120,00; für alle 3 Termine EUR 330,00 Anmeldeschluss Restplätze auf Anfrage
Wie Leid und Verlust Orientierung geben können. Eine Fortbildung für pädagogische Fachkräfte und Interessierte. Film-Vortrag mit gemeinsamer Reflexion auf die Rolle von Vorbildern und Held:innenfiguren in der Persönlichkeitsbildung und im Film – dem prägenden Medium für Mythenbildungen und Zukunftsnarrative unserer Zeit.
Termin Do, 30.03.2023 Anmeldeschluss Mi, 29.03.2023
Eigene Werthaltungen verstehen – Innere Konflikte lösen. Wie man sich in Krise und Konflikt auf eigene Werthaltungen besinnt und sich mit Anderen darüber verständigt, was einem wichtig und wertvoll ist, wird in Theorie und Praxis vermittelt.
Termin Fr, 03.03.2023
Beginn/Ende 10.00 / 18.00 Uhr Mit / Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Kath. Hochschulgemeinde an der LMU, Leopoldstraße 11, 80802 München
Teilnahmegebühr EUR 120,00; für alle 3 Termine EUR 330,00 Anmeldeschluss Mo, 27.02.2023
Vom Wert der Utopien. Eine Fortbildung für pädagogische Fachkräfte und Interessierte. Das Kino findet oft neue Ausdrucksformen, um selbst das Unsägliche zu sagen, um den utopischen Gehalt auch im Alltäglichen oder Unscheinbaren zu zeigen, um den Blick auf die Wirklichkeit zu schärfen. Wie das Eingang finden kann in Bildung, zeigt dieses Film-Seminar.
Termin Do, 27.04.2023
Anmeldeschluss Mi, 26.04.2023
Beginn/Ende je 18.00 / 21.00 Uhr Mit Alexa Eberle
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Online über Zoom Teilnahmegebühr je EUR 30,00
Freiräume schaffen und Selbstbestimmung erfahren. Wie man den Sinn für individuellen Zeit-Bedarf im eigenen Leben wieder stärkt und sich wirklich als selbstbestimmt erfahren kann, zeigt dieser Workshop mit verschiedenen Methoden.
Termin Fr, 31.03.2023
Beginn/Ende 10.00 / 18.00 Uhr Mit / Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Kath. Hochschulgemeinde an der LMU, Leopoldstraße 11, 80802 München
Teilnahmegebühr EUR 120,00; für alle 3 Termine EUR 330,00 Anmeldeschluss Mo, 27.03.2023
Fastenzeitimpulse: Wo wir mit Kunstwerken in Beziehung treten, kann etwas in Bewegung geraten. Plötzlich stellen wir scheinbar selbstverständliche Welt- und Selbstbilder in Frage. Bei den diesjährigen Fastenzeitimpulsen sprechen wir mit Menschen, die uns von einer ganz persönlichen Begegnung mit Kunst erzählen. Die Video-Impulse laden dazu ein, darüber nachzudenken, welche Kunst-Momente für Sie selbst bedeutsam und prägend waren.
Melden Sie sich online für den Newsletter an, um den Start der Fastenzeitimpulse nicht zu verpassen!
Mit der Bildungsflat zu unserem aktuellen Saisonthema SINN SUCHEN haben Sie vergünstigten Zugang zu ausgewählten Veranstaltungen und haben die Chance auf eine attraktive Gratis-Buchprämie! Wie die Bildungsflat funktioniert und was sie kostet, erfahren Sie auf Seite 35.
Neue Denkansätze in krisenhaften Zeiten. Die Herausforderungen unserer Krisen machen Bruchstellen sichtbar, sind aber auch eine Chance zum Aufbruch.
Denn eines zeigt sich: Mit den vorhandenen Lösungsansätzen werden sich viele Probleme nicht mehr lösen lassen. Mit der Veranstaltungsreihe Zeitansagen
– Neue Denkansätze in krisenhaften Zeiten möchten wir in diesen unübersichtlichen Zeiten Orientierung bieten.
Und das sind ab Februar 2023 unsere Themen:
• Wandel durch Handel?
Wirtschaftliche Verflechtungen auf dem Prüfstand
• Zerreißen soziale Spaltungen unsere Demokratie?
• Die Welt auf der Kippe –braucht die Klimakrise neue Mindsets?
• Was trägt, wenn alles unsicher ist?
Wo und wie finden wir Orientierung für unser Leben? Die Online-Abendreihe fragt, welche „Leuchttürme“ uns helfen können, uns auf unserem Lebensweg zu orientieren. Die Themen: • Das Gewissen als Orientierungsrahmen? Begriffsklärung, Beispiele, Diskussion
• Begehren als ebenso gefährliche wie notwendige Lebens- und Orientierungskraft
• Sinn suchen, oder: Wie ein erfülltes Leben gelingen kann Termine 29.03.2023, 19.04.2023, 26.04.2023 (jeweils Mi)
Beginn/Ende jeweils 19.00 Uhr / 20.30 Uhr Mit Dr. Claudia Pfrang, Dr. Thomas Steinforth und Dr. Stephan Mokry
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr je EUR 9,00 Anmeldeschluss jeweils am Tag der Veranstaltung
• Sexuelle Selbstbestimmung
• PGR und Politik

Die Domberg-Akademie hat sich im November 2022 zusammen mit der Hochschule für Philosophie des Themas „Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung“ angenommen – ein sperriges Thema, nicht nur wegen des langen Titels, sondern auch wegen der vielen Barrieren im Kopf. Denn sowohl Sexualität als auch Behinderung sind immer noch schambehaftet. Hinter dem Thema stehen zwei Fragestellungen: eine konkrete und eine abstrakte.
Die konkrete Fragestellung betrifft die Menschen mit Behinderung selbst, ihre Betreuer:innen, Eltern und teilweise auch die Justiz: Wie kann den Betreuten Zärtlichkeit ermöglicht werden, ohne den Schutz vor Übergriffen aus dem Auge zu verlieren?
Die abstrakte Fragestellung betrifft uns alle: Wie gehen wir mit marginalisierten Gruppen um? Hier liegt der zivilisatorische Gradmesser unserer Gesellschaft. Wir müssen Menschen mit so genannter geistiger Behinderung die Macht zu sprechen geben UND lernen, ihnen zuzuhören.
Es zeigt sich eklatanter Aufholbedarf, in juristischen Verfahren etwa. Verfahren zu sexuellen Übergriffen werden regelmäßig eingestellt, weil die Aussagen von Opfern mit so genannter geistiger Behinderung nicht „aussagekräftig genug“ seien. Die Referentin Jochanah Mahnke sprach davon, dass wir im Zeitalter der Inklusion angekommen seien. Nur, wie ernst nehmen wir es damit? Denn Inklusion ist mehr als barrierefreie Toiletten. •
Kathrin

Eine zentrale Aufgabe des Pfarrgemeinderats ist es, gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen und Probleme zu beobachten, zu überdenken und sachgerechte Vorschläge einzubringen sowie entsprechende Maßnahmen zu beschließen (vgl. Satzung PGR § 2, 3c). Erst kürzlich hat Reinhard Kardinal Marx vor der Vollversammlung des Diözesanrates der Erzdiözese München und Freising wieder eine verstärkte Ausrichtung auf gesellschaftspolitische Themen gefordert.
Eine besondere Methode zur Aktivierung stellt die Methodik von Politiksimulationen dar, in der die Teilnehmenden Rollen von fiktiven Akteuren übernehmen, Themen diskutieren und mögliche Handlungsoptionen entwickeln.
Im Rahmen einer fiktiven offenen Sitzung des Pfarrgemeinderats in einer fiktiven Gemeinde sollen über Rollenprofile diverse Themen, die reale Pfarrgemeinderäte betreffen, transportiert und diskutiert werden. Damit soll zur politischen Sensibilisierung der Arbeit der Pfarrgemeinderäte und zur Aktivierung der politischen Arbeit beigetragen werden.
Vier Bausteine werden zur Auswahl stehen: ˭ Baustein A
Migration, Flucht und Asyl
˭ Baustein B Ökologie/Nachhaltigkeit ˭ Baustein C
Umgang mit Verschwörungstheorien ˭ Baustein D
Zukunft der Kirche (vor Ort)
Als erstes Thema steht Baustein A: Migration, Flucht und Asyl zur Verfügung. Zusätzlich wird es Vorlagen geben, um ein eigenes Thema des PGR zu bearbeiten.
Für die Durchführung der Politiksimulation sind mindestens 10, maximal 30 Teilnehmende notwendig. Die Politiksimulation kann zeitlich in drei Varianten durchgeführt werden: Kurzvariante (1,5 Stunden), mittlere Variante (3 Stunden) und Langvariante (5 Stunden). Die ersten beiden Varianten können in einer Pfarrgemeinderatssitzung durchgeführt werden, die Langvariante eignet sich eher für einen Klausurtag.
Der Baustein A: Migration, Flucht und Asyl kann ab Februar 2023 über die Domberg-Akademie gebucht werden, die weiteren Module sind ab März 2023 verfügbar. Die Kosten werden mit den interessierten Pfarrgemeinderäten individuell vereinbart. •
Mehr Informationen bekommen Sie per Mail unter info@domberg-akademie.de
Finanziert durch die KEB Bayern über Fördermittel für Zukunftsprojekte
ist
für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit
Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs- und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Demokratie & Ethik

Menschen fliehen aus zahlreichen Gründen: Sie fliehen vor politischer Verfolgung, Bürgerkriegen, Umweltkatastrophen, Armut und verschiedenen Formen von Gewalt. In ihrem Vortrag beleuchtet die Eichstätter Soziologin Prof. Dr. Karin Scherschel zentrale Etappen der Fluchtmigrationen in Deutschland sowie jüngerer Bewegungen.
Termin Di, 31.01.2023
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Karin Scherschel
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 9,00; Kursgebühr für alle 3 Teile EUR 23,00 Anmeldeschluss Di, 31.01.2023
Zum internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar beschäftigen wir uns in einer Online-Veranstaltung mit der jüdischukrainischen Perspektive auf das HolocaustGedenken.
˭ In Kooperation mit AWO l(i)ebt Demokratie Termin Do, 26.01.2023

Beginn / Ende 18.30 Uhr / 20.00 Uhr
Verantwortlich Kai Kallbach, Julia Gerecke
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Do, 26.01.2023
Dänemark, Norwegen und Schweden haben gänzlich unterschiedliche Ansätze in ihrer Migrations- und Flüchtlingspolitik gewählt. Der Vortrag beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Migrations-, Asyl- und Integrationspolitik der drei Länder und fragt, mit welchen Herausforderungen, aber auch Chancen sie konfrontiert sind.
Termin Di, 07.02.2023
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Dr. Tobias Etzold
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 9,00; Kursgebühr für alle 3 Teile EUR 23,00 Anmeldeschluss Di, 07.02.2023
Wie können wir in unserer Gesellschaft gut miteinander leben und unsere Strukturen so gestalten, dass Neuzugewanderte mit Flucht-/Migrationserfahrungen gut ankommen? Prof. Dr. Annette Korntheuer zeigt, mit welchen Teilhabebarrieren und Exklusionsmechanismen Geflüchtete konfrontiert sind.
Termin Mi, 15.02.2023
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Annette Korntheuer Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 9,00; Kursgebühr für alle 3 Teile EUR 23,00 Anmeldeschluss Mi, 15.02.2023
In diesem Workshop werden die vielfältigen Gründe, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, beleuchtet und Handlungsstrategien entwickelt, um der Verbreitung dieser Denkformen entgegenzuwirken. Neben einer ausführlichen Analyse der spezifischen Mechanismen und „Logiken“ verschwörungstheoretischen Denkens werden die gesellschaftlichen und individualpsychologischen Motive für das gegenwärtige Erstarken verschwörungstheoretischer Interpretationsmuster untersucht und wirksame Strategien zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen im privaten und beruflichen Kontext vermittelt und spielerisch erprobt.
Termin Mi, 01.02.2023
Beginn / Ende 18.00 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Kai Kallbach
Verantwortlich Kai Kallbach
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 12,00
Anmeldeschluss Di, 31.01.2023
Argumentationstraining gegen Verschwörungstheorien
• Das Christentum und die radikale Rechte
Der Bezug auf das Christentum spielt für die international vernetze radikale Rechte eine zentrale Rolle. Ihr geht es neben der direkten Unterstützung durch christliche Milieus auch darum, ihren Positionen a priori eine ethische Qualität zu verleihen, die gegen Kritik sowie Selbstzweifel immunisiert. Dabei sind die Parteien unterschiedlich erfolgreich im Werben um christliche Unterstützergruppen.
Christliche Fraktionen und Netzwerke bilden in einigen Ländern (zum Beispiel in Ungarn, Polen, Brasilien, USA) bereits eine wichtige Unterstützerbasis für Rechtsaußen-Parteien. In anderen Ländern, in denen Christ:innen nur eine geringe Rolle bei rechten Wahlerfolgen spielen, bemühen sich rechte Parteien sehr um christliche Milieus. Dies zeigt sich in der Formierung politischer Gruppen wie den „Christen in der AfD“, eindeutig codierten digitalen Resonanzräumen und publizistischen Beiträgen, die christliche Theologie für ein radikal und extrem rechtes Projekt aufzubereiten versuchen. Die kirchliche Erwachsenenbildung ist deshalb doppelt herausgefordert:
˭ Eine selbstkritische Perspektive auf eigene problematische Traditionslinien und historische Kontinuitäten, die den Brückenschlag nach rechtsaußen begünstigen, zu forcieren.
Das Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde diskutiert hochkarätig besetzt über die katholische Kirche und die radikale Rechte // von kai kallbach
Vom 13. bis 14. Oktober 2022 hat das Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche Bayern eine vielbeachtete Tagung zum Thema Die katholische Kirche und die radikale Rechte – eine notwendige Debatte veranstaltet. Die Juristin Liane Bednarz und die Theologin Sonja Strube beleuchteten in ihren Keynotes bei der Tagung in Nürnberg das Tagungsthema. Im Anschluss diskutierten sie mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, dem BDKJBundesvorsitzenden Gregor Podschun und den Teilnehmenden über Lücken im Forschungsfeld, Zusammenhänge zwischen kirchlichen Strukturen und dem Phänomenbereich „Katholische Kirche und die radikale Rechte“ sowie über Handlungsmöglichkeiten und notwendigkeiten.
Sehr hilfreich waren auch die „Außenperspektiven“ aus protestantischer und zivilgesellschaftlicher Sicht, die von Teilnehmenden am Ende der Tagung eingebracht wurden.
Die Tagung machte deutlich: Kirche wird in all ihren Bereichen mit reaktionären und menschenfeindlichen Positionen konfrontiert. Dieser Herausforderung muss sie sich stellen. Dafür braucht es Knowhow, Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und eine konstruktive Diskussionskultur über Gesellschaft, Glaube und Kirche sowie eine klare Abgrenzung zu radikalrechten Positionen. Dazu waren am Ende alle motiviert. Für das Frühjahr 2023 ist ein Sammelband mit den Ergebnissen der Tagung geplant, der im Echter Verlag erscheinen wird. •
In der Online-Reihe werden Subkulturen und Anknüpfungspunkte radikal-rechter Akteur:innen diskutiert. In jeder Sitzung wird eine radikal-rechte Lebenswelt behandelt.
Und aktuelle Wandlungen rechtsradikaler Bewegungen, ihrer Narrative und Strategien analytisch zu verfolgen und Widersprüche zur christlichen Ethik zu thematisieren. •
Systemrelevant? Systemsprengend? Am Abend ging Matthias Drobinski, Chefredakteur von publik forum, in seinem Vortrag der Frage nach, ob es Kirchen im 21. Jahrhundert in einer säkularen Gesellschaft überhaupt noch braucht und welche Rolle sie einnehmen könnten oder sollten.

˭
Nach einem anregenden Morgenimpuls von Claudio Ettl, dem stellvertretenden Akademiedirektor des CaritasPirckheimerHauses Nürnberg, vertieften sich die Tagungsteilnehmenden am Vormittag des zweiten Tages in Workshops zu Analysen und Handlungsoptionen im Bildungsbereich (Andreas Menne) und aus kirchlichjuristischer Perspektive (Michaela Hermes und Caroline Gmehling).
Die Radikale Rechte und die etablierte Konservative Do, 02.02.2023
Anti-Genderismus in Europa Do, 16.03.2023
Radikal-rechtes Denken in alternativen Milieus Do, 30.03.2023
Verantwortlich Kai Kallbach
DA erfahren Sie mehr! Über den QR-Code bekommen Sie mehr Informationen zu unserer Reihe „Radikal Rechte Refugien“

• Fachtag zu Diversität

• Neuer Bildungspodcast
Der neue Bildungspodcast zu Diskriminierung und Vielfalt // von magdalena falkenhahn
kann
Wie kann Diversität als wechselseitige Bereicherung erlebt und ohne Diskriminierung gestaltet werden? Das war Thema einer unserer Veranstaltungen mit pädagogischen Fachkräften verschiedener Disziplinen.
In der Diskussion wurde schnell klar: Ohne strukturelle und institutionelle Maßnahmen ist es schwer, den Ansprüchen an eine diversitätssensible Bildung gerecht zu werden. Darunter versteht Prof. Dr. Karim Fereidooni, einer der Vortragenden, unter anderem mehr personelle und finanzielle Ressourcen sowie die Schaffung von Beschwerdestellen. Auch verbindliche regelmäßige Fortbildungen sollten eingeführt werden.

Um eine echte Haltungsveränderung zu bewirken, hebt Dr. Karin Hutflötz, Referentin bei der DombergAkademie, gemeinsame Erfahrungen hervor, bei denen die Anerkennung
des anderen in wechselseitigem Sehen und Gesehenwerden erfolgt. Dies kann etwa über die Einübung spezifischer Gesprächspraktiken erreicht werden.
Wir stellen fest: Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf Diversitätssensibilität klaffen stark auseinander. Dennoch hat sich schon viel verändert. Und wir nehmen als Auftrag mit: Wie können die Menschen, die die Relevanz von Diversität anerkennen, (trotz diskriminierender Strukturen) befähigt werden, produktiv mit Diversität umzugehen? Diversitätssensibel zu bilden, ist eine komplexe Aufgabe und bedeutet noch einen langen Lernweg. •
Magdalena Falkenhahn ist stellvertretende Direktorin und Referentin für (Inter-) Kulturelle Bildung

Mit dem Saisonthema Was ist dein Privileg? Diverse Fragen an eine diskriminierende Gesellschaft haben wir im Sommer 2022 intensiv auf das Feld der Diversität geblickt. Ziel war es, für Privilegien der weißen, christlich sozialisierten Mehrheitsgesellschaft zu sensibilisieren sowie auf strukturelle, institutionelle und interpersonelle Benachteiligungen marginalisierter Gruppen in unserer Gesellschaft hinzuweisen. So ist die Idee für einen Bildungspodcast entstanden. Wir möchten Menschen kennenlernen, die von Diskriminierung betroffen sind. Die Protagonist:innen erzählen von ihrem Alltag, gemeinsam reflektieren wir die strukturellen Zusammenhänge. •
• Der Podcast wird gefördert aus Sondermitteln der KEB Bayern.
DA erfahren Sie mehr!
„Made in Vielfalt“ finden Sie über den QR-Code bei uns online und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Dass Kirche in ihrer bisherigen Form sich immer mehr auflöst, zeigen steigende Austrittszahlen, sinkender Gottesdienstbesuch, der Glaubensabbruch. Viele Menschen brauchen die Kirche nicht mehr. Wir stehen vor einem doppelten Dilemma: Kirche muss anders werden, damit sie wieder interessant wird, gleichzeitig interessiert immer weniger Menschen Glaube – und Kirche schon gar nicht.
Noch nie gab es so viel „rasenden Stillstand“: Initiativen um Initiativen werden gestartet, gleichzeitig bewegt sich gefühlt nichts. Stabilisieren die vielen Initiativen eher das System, statt es zu reformieren. Brauchen wir eine bewusste Unterbrechung? Das ehrliche Eingeständnis, dass wir den Karfreitag der Kirche erleben und den darauf folgenden Karsamstag aushalten müssen?
Was wir derzeit aushalten müssen, ist die Erkenntnis, dass es die eine weltweite Lösung nicht gibt. Dennoch brauchen wir dringend notwendige Reformen und müssen – wichtiger noch – mutig das Tagesgeschäft unterbrechen, damit Raum entsteht für Neues. Wie Kirche neu denken? Vielleicht durch einen Perspektivenwechsel: weg vom Kreisen um den Selbsterhalt hin zu einer Gemeinschaft, die erklären kann, wofür sie eigentlich da ist. Es geht um die Botschaft: Können wir den Kern so formulieren, dass die Menschen ihn verstehen? Ein erster Schritt dazu ist, sich gegenseitig zu erzählen, wo und wie wir Gott in unserem Leben erfahren. „Kirche neu denken“ beginnt mit „Glaube neu denken“. •
In einer neuen Reihe möchte die Domberg-Akademie den Stand der Islamischen Theologie in Deutschland untersuchen // von thomas steinforth

Die Islamische Theologie an deutschen Universitäten hat sich seit 2010 etabliert. Sieben Standorte mit heute über 2000 Studierenden (überwiegend Frauen) wurden oder werden staatlich gefördert: Frankfurt/ Gießen, Münster, Osnabrück, Tübingen, Erlangen-Nürnberg, Berlin und Paderborn. Bis heute sieht sich die Islamische Theologie unterschiedlichen Erwartungen und Zuschreibungen ausgesetzt:
Seitens der Politik besteht nicht selten die Erwartung, mit der Einbindung in staatliche Universitäten die Entwicklung eines mit Demokratie und Grundgesetz verträglichen Islam zu fördern.
Für viele Muslime bieten die Studiengänge eine große Chance, den eigenen Glauben durch kritische Reflexion zu vertiefen, sich mit Fragen auseinanderzusetzen und anerkannte Gesprächspartner:innen im interdisziplinären und gesellschaftlichen Diskurs zu werden. Zudem sollen die Absolvent:innen an unterschiedlichen Orten von der Schule bis zu den Moscheegemeinden das Glaubensleben bereichern. Die praktische Ausbildung (etwa der Imame) ist zwar nicht originäre Aufgabe der Universitäten, kann aber durch eine wissenschaftliche Qualifikation fundiert werden.

Zugleich gibt es innerhalb der muslimischen Verbände und Gemeinden auch Vorbehalte: Wieviel kritische Reflexion verträgt der Glaube? Leidet die Verbindlichkeit heiliger Schriften, der Tradition und religiöser Autoritäten, wenn Glaubensinhalte auf den Prüfstand wissenschaftlicher Vernunft
kommen? Wieviel Pluralität ist akzeptabel, und wie autonom darf eine wissenschaftliche Theologie sein? Fragen, die übrigens auch mit Blick auf christliche Theologie immer schon diskutiert worden sind.
Wir wollen in den Blick nehmen, wie sich die Islamische Theologie entwickelt hat, welche Themen in Forschung und Lehre besonders wichtig sind, welche (auch kontroversen) Debatten geführt werden und was davon für den interreligiösen Dialog, aber auch den gesellschaftlich-politischen Diskurs fruchtbar gemacht werden kann. Ebenso interessiert uns, wie ein Dialog christlicher und islamischer Theologie gestaltet werden kann und ob so etwas möglich ist wie „Intertheologie“ – so nennt es der Jesuit Tobias Specker, der laut Selbstbeschreibung zu einer „Theologie im Angesicht des Islam“ forscht und lehrt.
Für April 2023 planen wir in der Domberg-Akademie eine Veranstaltungsreihe zum aktuellen Stand der Islamischen Theologie in Deutschland – in interreligiöser Kooperation mit unseren Partnern, dem Muslimischen Bildungswerk Bayern, dem Münchner Forum für Islam sowie dem Fachbereich „Dialog der Religionen“ des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising. •
• Die Zukunft der Kirche • Islamische Theologie in Deutschland
Dr. Thomas Steinforth ist Referent für Theologische ErwachsenenbildungDr.
Claudia Pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.
Über den abgebildeten QRCode gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Religion & Kirche
Modul 1 – Die Frage nach Gott offenhalten in Kunst, Schule, Tod und Trauer
Termin Sa, 18.03.2023
Mit P. Klaus Mertes SJ, Msgr. Engelbert Dirnberger, Beatrice von Weizsäcker (angefragt) Wie können wir die Frage nach Gott offenhalten? Die ersten Impulse finden am Tagungsort statt, am Nachmittag erfolgt eine Exkursion in die Hl.KreuzKirche München.
Modul 3 – Philosophie Möglichkeiten und Grenzen der Künstlichen Intelligenz
Termin Sa, 21.10.2023
Mit Prof. Dr. Benjamin Rathgeber Künstliche Intelligenz (KI) stellt denkerisch eine Herausforderung dar: Was ist überhaupt KI? Was bedeutet sie für unser Verständnis von Mensch und Gott und unser Handeln?
Modul 2 – Soziologie Zukunftsmöglichkeiten des Christentums
Termin Sa, 13.05.2023
Mit Prof. Dr. Hans Joas
Braucht der Mensch Religion? Wie ist das Verhältnis zwischen Glaube und Selbstoptimierung zu denken? Ist Transzendenz überhaupt organisierbar?
Modul 4 – Theologie Über G*ttes Schöpfung und unser Geschöpf-Sein
Termin Sa, 02.12.2023
Mit Prof. Dr. Julia Enxing
Wir fragen nach, wie die Verhältnisse MenschTier, MenschUmwelt und MenschGott angesichts von Leid und Klimakatastrophe, aber auch eines vertiefteren Verständnisses des Tieres als Mitgeschöpf zu denken sind.
Beginn / Ende jeweils 9.00 Uhr / 17.00 Uhr Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang, Dr. Stephan Mokry, Dr. Thomas Steinforth Ort hybride Veranstaltung: missio, Pettenkoferstr. 26–28, 80336 München oder online Teilnahme Infos zu Preisen und Anmeldung unter www.domberg-akademie.de
Wie haben die Gespräche in Rom die Vorbereitung beeinflusst? Worauf kommt es jetzt an? Mit den Generalsekretären von DBK und ZdK blicken wir in den „Maschinenraum“ des Synodalen Wegs.
• Kooperation mit Ressort 1 des Erzbischöfl. Ordinariats und Diözesanrat der Katholiken
Termin Mo, 13.02.2023
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Mit Dr. Beate Gilles und Marc Frings Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Mo, 13.02.2023
Islamische Theologie – eine Zwischenbilanz
Termin Do, 27.04.2023
Mit Prof. Dr. Rauf Ceylan (angefragt) Ort München, Ort noch offen „Intertheologie“ – (wie) geht das?
Termin Di, 23.05.2023
Mit Prof. Dr. M. Sievers, Prof. Dr. T. Specker SJ
Ort Online über Zoom
Aktuelle Themen und Debatten der Islamischen Theologie
Termin Mi, 05.07.2023
Ort Online über Zoom
• Kooperation mit dem Muslimischen Bildungswerk Bayern, dem Münchner Forum für Islam und dem Fachbereich „Dialog der Religionen“ des Erzbischöflichen Ordinariats
Beginn / Ende jeweils 19.00 Uhr / 20.30 Uhr
Lange galt: „Spiritualität ist immer gut!“ Unter anderem ist sie wichtiger Sinngeber und Resilienzfaktor. Mit dem Bekanntwerden der dramatischen Folgen von spirituellem Missbrauch haben wir diese Naivität verloren. Woran erkennt man den Unterschied zwischen förderlicher/heilsamer und manipulativer/ missbräuchlicher Spiritualität? Die Referentin, Therapeutin und Autorin von Publikationen zu geistlichem Missbrauch, Dr. Hannah Schulz, erläutert Grundlagen geistlicher Freiheit und unterscheidet geistliche Macht von geistlicher Autorität mit ihren je spezifischen Missbrauchsformen.
• Kooperation mit OrdensFrauen für MenschenWürde und der Abteilung Spiritualität im Erzbischöflichen Ordinariat München Termin Mo, 27.03.2023
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr Mit Dr. Hannah Schulz
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Ort Online via Zoom Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Mo, 27.03.2023
Tagung in Vorbereitung auf das Korbiniansjubiläum 2024. Expert:innen stellen spannende Quellen aus 13 Jahrhunderten aus dem „Leben“ des Bistums Freising und des Nachfolge-Erzbistums München und Freising vor. Detailliertes Programm online verfügbar.
• Kooperation mit Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising, Verein für Diözesangeschichte von München und Freising
Termin Do, 11.05.2023 – Fr, 12.05.2023
Verantwortlich Dr. Stephan Mokry
Ort Ehemalige Karmeliterkirche, Karmeliterstr. 1, 80333 München
Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Fr, 05.05.2023
Was bedeutet konservativ?
Der Duden beschreibt „konservativ“ mit „am Althergebrachten festhaltend“. Das lateinische Wort „conservare“ wird übersetzt mit „bewahren“ und in einer weiteren Bedeutung sogar mit „[vor dem Untergang] retten“.
Wenn wir die Maßnahmen zum Schutz des Klimas nicht ausweiten, werden wir 2100 voraussichtlich bei etwa 2,7 Grad Erwärmung landen. Konkret bedeutet das für die Welt im Jahr 2070: 3,5 Milliarden Menschen werden in einem Gebiet leben, das praktisch zu heiß ist, um dort zu überleben. Daraus folgt, dass diese Menschen entweder sterben oder fliehen – und zwar zu uns. Darüber hinaus werden auch wir in Europa hungern und mit immer extremeren Naturkatastrophen leben müssen. Zudem sind Kipppunkte überschritten, das heißt es gibt kein Zurück.
Konservative sollten also vorneweg marschieren, wenn es um die Zerstörung ihrer „althergebrachten“ Lebensgrundlage geht. „Haltet“ an der Welt „fest“, so wie ihr sie heute kennt. „Bewahrt“ die Erde und eure Zukunft vor den invasiven Maßnahmen der Menschheit. Da kann auch eine Rückbesinnung motivieren: Wie viel Fleisch wurde vor 70 Jahren gegessen? Wie regional wurde eingekauft? Wie mobil und naturverbunden waren wir?
In dieser universalen Krise muss die Zeit der politischen Grabenkämpfe vorbei sein. Jeder kann aus der eigenen Prägung heraus handeln – solange wir uns auf den Minimalkonsens einigen: Die Welt muss gerettet werden. •
Kathrin Steger-Bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit

Die Europäische Kommission möchte Kerosin besteuern, um die CO2-Emissionen von Flügen zu reduzieren
klima-wandel dein tun
Intelligente Anreizsysteme sind ein gewichtiger Hebel für entscheidende Maßnahmen im Klimaschutz. Wir stellen zwei von ihnen vor // von kathrin steger-bordon
Wie kommen wir vom Wissen zum Tun? Das ist eine der Fragen, die häufig gestellt wird, wenn es um den Klimawandel geht. Das Wissen über den Klimawandel ist hoch, wie die Studie Planetary Health Action Survey der Universität Erfurt belegt: 40 Prozent der Befragten informieren sich sehr häufig oder häufig über den Klimawandel. Mehr noch: 60 bis 75 Prozent stimmen Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Ernährung, zu. Wie kommt es dann, dass immer noch viel zu wenig passiert, um dem Kimawandel entgegenzuwirken?
Es hängt von den Rahmenbedingungen ab, welche Entscheidungen im Alltag wie getroffen werden – bewusst oder unbewusst. „Aus diesem Grund kommt den sozioökonomischen, strukturellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen große Bedeutung bei der Bekämpfung des Klimawandels zu. Denn sie bestimmen über die verfügbaren Handlungsmöglichkeiten, zwischen denen die Menschen sich im Alltag entscheiden (können)“, fasst es die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen.
Zwei konkrete Beispiele: Greenpeace hat im Jahr 2020 zehn klimaschädliche Subventionen analysiert. Eine davon ist die Steuerfreiheit des Flugbenzins Kerosin. Durch die Besteuerung von Kerosin würde Fliegen teurer und damit gerade im Vergleich zu Bahnreisen unattraktiver werden. In der Folge könnten laut der Studie jährlich bis zu 26 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden, und zudem könnte der Fiskus acht Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen erzielen. Außerdem würde das

Wie könnte eine Zukunft auf einem klimafreundlichen Planeten aussehen? Was nutzt uns der Klimaschutz? Und was kann ich ganz konkret dafür tun?
Der Klimawandel ist die größte Gefahr für unseren Planeten. Um ihn zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, sind wir gefordert – jeder und jede Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Staat. Die Veränderung beginnt bei uns.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Umwelt & Nachhaltigkeit

nachhaltig durchs jahr 2023
schiefe Bild der Kosten von Flug- und Bahnverkehr geradegerückt. Die Europäische Kommission hat diesen Hebel wahrgenommen und versucht eine solche Steuer für innereuropäische Flüge einzuführen.
Kritisieren lässt sich die soziale Ungerechtigkeit, die mit höheren Flugpreisen einhergeht. Es gibt aber auch gute Beispiele, die sowohl einen Anreiz setzen, CO2 einzusparen, als auch für eine Umverteilung sorgen. Zum Beispiel das Klimageld, das im Koalitionsvertrag als Ziel steht. Das Prinzip ist einfach: CO2 wird bepreist, wodurch klimaunfreundliche Produkte automatisch teurer werden. Von den Klima-Erlösen wird jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Pauschale ausgezahlt. Unterwirft man diese Pauschale der Einkommenssteuer, findet ein sozialer Ausgleich statt.

Anreizsysteme, Subventionsabbau und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen sind gewichtige Hebel, um einen signifikanten Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels zu leisten. Daneben bleiben konkrete Handlungsimpulse für mehr Klimaschutz im Alltag im Fokus unserer Bildungsarbeit – ganz im Sinne unseres Saisonthemas vom Frühjahr 2022: KlimaWANDEL Dein Tun!
Das Spiel ist eine interaktive Methode, die im Unterricht und in der Bildungsarbeit eingesetzt werden kann. Sie vermittelt Inhalte des Klimawandels und zeigt Handlungsoptionen auf. Die Teilnehmenden erleben ein spannendes Abenteuer, in dem sie gemeinsam in kurzer Zeit Venedig vor der Flutkatastrophe schützen müssen, und vertiefen die Inhalte des Games in 4 Stationen zu Energie, Mobilität, Ernährung und Konsum. Ziel ist es, das komplexe Thema der Klimakatastrophe niedrigschwellig und trotzdem spannend zu vermitteln und dabei Handlungsimpulse für den eigenen Alltag zu geben. Zielgruppe Jugendliche ab 14 Jahren, Erwachsene Teilnehmendenzahl max. 30 Personen Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Kosten EUR 75,00 pro Woche bei Abholung (Versand möglich)
Fahren – Laden – Teilen: Wie steht es um die Mobilitätswende in Freising? Erkunden Sie mit uns die vielfältigen Möglichkeiten der Elektromobilität. Wir besuchen unter anderem eine E-Lastenrad-Station, zeigen ein Konzept der Teilhabe an einer privaten Ladeinfrastruktur und eine E-Carsharing-Station. Immer verbunden mit spannenden Impulsen und Diskussionen. ˭
In Kooperation mit der Agenda 21-Projektgruppe Energie und Klimaschutz ˭ Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Termin So, 23.04.2023
Beginn / Ende 14.00 Uhr / 16.00 Uhr
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Ort Treffpunkt wird noch bekannt gegeben Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Keine Anmeldung erforderlich
Schüler:innen ab 14 Jahren sind eingeladen, das Escape Game Klimaprofis – saving tomorrow zu spielen – ein spannendes Spiel rund um die Herausforderungen des Klimawandels. Unter Zeitdruck müssen Rätsel gelöst werden, um Venedig vor dem Untergang zu retten. Daneben lernen die Teilnehmenden Handlungsoptionen kennen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun.
˭ In Kooperation mit Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Termin Fr, 24.03.2023
Beginn / Ende 15.00 Uhr / 18.00 Uhr Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Ort Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Am Hofgarten 4, 85354 Freising Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Mi, 22.03.2023
Vernetzung, Input und Bestärkung sind die Ziele des Diözesanen Nachhaltigkeitstags. Auch in diesem Jahr erwarten Sie wieder spannende Referent:innen und intensiver Austausch.
˭ In Kooperation mit der Abteilung Umwelt im Erzbischöflichen Ordinariat, dem Diözesanrat der Katholiken, der KEB München und Freising e.V. und dem Erzbischöflichen Jugendamt München und Freising.
Termin Fr, 01.07.2023
Beginn / Ende 9.00 Uhr / 17.00 Uhr
Mit Dr. Sarah Köhler und Dr. Jörg Alt SJ Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon Ort Salesianum, St.-Wolfgangs-Platz 11, 81669 München
Teilnahmegebühr Kostenlos Anmeldeschluss Fr, 23.06.2023
• Die politische Bedeutung der kulturellen Bildung
• Privilegien auf der Bühne
Kulturelle Bildung findet nie im luftleeren Raum statt, sondern immer im Kontext einer Gesellschaft. Für viele macht das die kulturelle Bildung per se politisch. Blickt man auf die Prinzipien beider Disziplinen, lassen sich jedoch durchaus Unterschiede identifizieren: Während bei der politischen Bildung die Befähigung zur politischen Urteils und Handlungsfähigkeit mit Fokus auf das Gemeinwohl im Zentrum steht, geht es der kulturellen Bildung primär um die Stärkung des Individuums in der Auseinandersetzung mit den Künsten.
In der politischen Bildung findet zudem eine zielgerichtete Wertevermittlung statt. Im Medium der Künste entfallen hingegen Kategorien wie „richtig“ und „falsch“ und eröffnen einen Raum für individuelle Aushandlungsprozesse. Eine Verbindung der beiden Bildungsdisziplinen birgt außerdem eine erhöhte Gefahr für ideologische Manipulation. Das Dritte Reich ist hier ein mahnendes Beispiel.
Dennoch liegen in der Verbindung von politischer und kultureller Bildung große Potenziale für beide Seiten, insbesondere hinsichtlich Methoden und der Reflexion der damit einhergehenden Erfahrungen. Statt eine Trennung oder eine vollkommene Verschmelzung der beiden Bildungsfelder zu verfolgen, könnte gerade die Reibung interessante Fragen aufwerfen: Wann wird eine ästhetische Erfahrung oder künstlerische Auseinandersetzung für die politische Bildung fruchtbar? Wann wird die politische Dimension der kulturellen Bildung relevant? •
Magdalena Falkenhahn ist stellvertretende Direktorin und Referentin für (Inter-) Kulturelle Bildung

Mit dieser Frage werden die Teilnehmenden unseres OnlineVortrags-Theaters konfrontiert. Das Stück lädt zur Selbstreflexion und Diskussion ein // von magdalena falkenhahn
Statistiken zeigen, dass nichtweiße Menschen tendenziell eher als kriminell eingestuft werden, Nachteile auf dem Jobmarkt und bei der Wohnungssuche haben und ihnen das Deutschsein aberkannt wird, weil sie anders aussehen.
Diese Tatsachen prägen das Leben nicht nur der auf solche Weise diskriminierten, sondern aller Menschen in Deutschland. Denn dass die Farbe der eigenen Haut noch nie Grund für Beleidigungen oder Ausgrenzung war, ist ein Privileg. Dessen sind wir uns selten bewusst, stellt „Weißsein“ doch die Norm dar. Weiße Menschen profitieren tagtäglich von der systematischen Abwertung nicht-weißer Menschen. Sie befinden sich somit nicht außerhalb des Systems von Diskriminierung, sondern lediglich auf der anderen Seite.
Sich der Diskussion um Privilegien und Diskriminierung zu stellen und die eigene Position darin zu erkennen, ist oft eine hoch emotionale Angelegenheit. Unser Online-Vortrags-Theater Wie werde ich eine Süßkartoffel ist der Versuch, sich dem Diskurs mittels zweier fiktiver Charaktere zu nähern.
Die beiden Figuren des Stückes haben unterschiedliche Prägungen und Erfahrungen. Sie agieren subjektiv, emotional und aus bestimmten Erfahrungen heraus. Ihre Diskussion führen sie entlang dreier Privilegien, die in Deutschland bis heute sehr wirkmächtig sind: Weißsein, Männ-
lichsein, Christlichsein. In welchen alltäglichen Situationen sich diese Privilegien zeigen, wird unter anderem durch Checklisten verdeutlicht. Die beiden Protagonistinnen lesen Aussagen aus solchen Listen vor. Die Zusehenden werden eingeladen, selbst zu prüfen, wie privilegiert sie in Bezug auf die jeweilige Kategorie sind. Dafür machen sie für jede Aussage, die sie mit „Ja“ beantworten können, einen Strich auf ein Blatt Papier. Ein paar Beispiele:
• Ich kann unpünktlich sein, ohne dass es als Eigenschaft meiner ethnischen Herkunft angesehen wird.
• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich im öffentlichen Raum sexuelle Belästigung erfahre.
• Ich kann davon ausgehen, dass meine Sicherheit oder die Sicherheit meiner Familie nicht in Gefahr gebracht wird, wenn ich meine Religion anderen offenbare.
Am Ende werden die Striche zusammengezählt. Je höher das Ergebnis, desto privilegierter ist man. Nach jeder Vorstellung des Vortrags-Theaters gibt es in einem Nachgespräch Raum, persönliche Meinungen und Fragen auszutauschen und das Gehörte gemeinsam zu reflektieren. •
DA erfahren Sie mehr!
Mit diesem QR-Code gelangen Sie zu weiteren Informationen inklusive Trailer zum OnlineVortrags-Theater

Wie politisch ist die kulturelle Bildung?
Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschlicher Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, die Kultur als Lebenswelt mit ihren vielfältigen Traditionen, Lebensformen und Wertesystemen. Wir möchten Sie inspirieren, sich mit den Künsten, Kultur(en) und damit auch mit der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen und sich zu engagieren.
Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Kultur & Kreativität
3 Privilegien - 2 Schauspielerinnen - 1 Stunde: Bei unserem neuen Format verschränken sich Vortrag und schauspielerische Elemente zu einem innovativen Bildungserlebnis. Das Angebot ermöglicht eine außergewöhnliche Auseinandersetzung mit den Privilegien „Weißsein“, „Männlichsein“ und „Christlichsein“.
Zum Inhalt: „Wie geht Deutschland mit Diversität um?“ Diese Frage erforschen die jungen Studentinnen Sevil und Lotte im Rahmen eines Projekts an der Universität Schnell stellen sie fest: Welche Erfahrungen die Menschen in unserem Land machen, hängt wesentlich von Kategorien ab wie Geschlecht, Hautfarbe, sozialer Status oder Religion. Dass manche Menschen dabei von Geburt an bessere Chancen haben als andere, führt die beiden in eine intensive Diskussion über Privilegien und Benachteiligungen und lässt die deutsche „Kartoffel“ Lotte und das „Migrantenkind“ Sevil ihre eigenen Prägungen hinterfragen…
Die Inszenierung ist als Online-Angebot für Schulen, Jugendgruppen und Anbieter von Erwachsenenbildung sowie an ausgewählten Terminen für Einzelpersonen buchbar. Jeder Online-Aufführung schließt sich ein Nachgespräch an, um das Thema zu vertiefen und in den Dialog zu treten. • Die Projektentwicklung wurde gefördert aus Mitteln des Kulturfonds Bayern
Zielgruppe Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene Kosten EUR 450,00 Dauer 60 Minuten Vorstellung plus Nachbereitung (flexibel ca. 30 bis 120 Minuten) Buchungsanfragen und Infos Magdalena Falkenhahn (mfalkenhahn@domberg-akademie.de)
Frei buchbarer Termin Di, 28.03.2023 Kosten EUR 15,00 Ort Online über Zoom
Buchstaben, Bilder und Brushlettering: In diesem Kurs verbindet sich Schrift mit Farben und Formen. Aus der Kombination von Brushpens, Stiften und Pinseln mit Aquarellund Gouachefarben entstehen malerische Schrift-Bilder. Diese erhalten durch die Akzentuierung mit verschiedenen Techniken des Vergoldens einen magischen Glanz.
Termin 23.06.–25.06.2023 (Fr–So)
Beginn / Ende Fr, 16.00 Uhr / So, 13.00 Uhr
Mit Rainer Michel
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Kloster Scheyern
Teilnahmegebühr EUR 134,00
Ermäßigte Teilnahmegebühr EUR 121,00 Ganztagesversorgung EUR 101,00
Versorgung ohne Frühstück EUR 82,00 Übernachtung EUR 78,00
Anmeldeschluss Do, 11.05.2023
Schreiben Sie es so, wie Sie es meinen! Im Kurs werden wir uns auf das Entwickeln von Ausdruck bei der Breitfeder-Kalligraphie fokussieren, indem wir dynamische Pinselstriche durch Geschwindigkeit und Druck erzeugen und ergänzen. Der Kurs eignet sich für Kalligraph:innen mit etwas Erfahrung und soll helfen, den eigenen Schreibstil lebendiger werden zu lassen. (Kurssprache: Englisch)
Termin 27.10.–29.10.2023 (Fr–So)
Beginn / Ende Fr, 14.30 Uhr / So, 13.00 Uhr
Mit Denis Brown
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Pallottihaus, Freising
Teilnahmegebühr EUR 155,00
Ermäßigte Teilnahmegebühr EUR 132,00 Übernachtung mit Halbpension EUR 108,00 Tagungsverpflegung EUR 47,00
Anmeldeschluss Fr, 15.09.2023
Die mobile Theaterproduktion „Irgendwas irgendwie“ mit Nachgespräch gibt die Möglichkeit, kreativ und interaktiv über den eigenen Glauben zu reflektieren. Jugendliche und Erwachsene sind dazu eingeladen, individuelle Antworten auf große Lebensfragen zu finden.
Das Angebot ist wertvoller Impulsgeber, um persönlich über den Glauben zu sprechen –empathisch, offen und ehrlich.
• Die Projektentwicklung wurde gefördert vom Kulturfonds Bayern und den Innovativen Projekten der KEB München und Freising.
Zielgruppe Jugendliche ab der 8. Klasse, Erwachsene Termine individuell vereinbar Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Kosten EUR 300,00 zzgl. Fahrtkosten aus München (Präsenz); EUR 150,00 (Online)
Lernen Sie eine lebendige und moderne Fraktur. Diese modernisierte Bâtarde-Schrift, auch Gothicized Italic genannt, ist eine Mischung aus der energischen Kursivschrift von Denis Brown und gotischen Charakteristika. Fortgeschrittene Stiftmanipulationen und schnelle Gesten werden dazu beitragen‚ die Buchstaben zum Leben zu erwecken.
(Kurssprache: Englisch)
Termin 30.10.–03.11.2023 (Mo–Fr)
Beginn / Ende Mo, 14.30 Uhr / Fr, 13.00 Uhr
Mit Denis Brown
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Pallottihaus, Freising
Teilnahmegebühr EUR 280,00
Ermäßigte Teilnahmegebühr EUR 238,00 Übernachtung mit Halbpension EUR 220,00 Tagungsverpflegung EUR 117,00
Anmeldeschluss Fr, 15.09.2023
• Nachhaltige Pädagogik • Persönlichkeitsbildung heute
kommentar
Verstärkt durch die Pandemie, aber auch in Folge der Digitalisierung und einer Überbewertung von Theorie und Faktenwissen, ist kaum mehr Raum für sinnliche und leibliche Erfahrung in Bildung. Diese wird zunehmend beschränkt auf zweidimensionale Bilder und Texte in digitaler Vermittlung – im Dienst einer Pädagogik, die sinnliche Wahrnehmung und spielerische Kreativität als unnötig für Wissensgewinn und Bildungserfolg betrachtet, Körper und Gefühle abspaltet und eine vertiefte Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsbildung vermeidet.
Doch vielleicht „ist mehr Vernunft in deinem Leib als in deiner besten Weisheit. Und wer weiß denn, wozu dein Leib gerade deine beste Weisheit nötig hat?“, fragt Friedrich Nietzsche. Aktuelle Forschung verweist darauf, dass Bildungsprozesse nur dann nachhaltig Wissen generieren und persönlichkeitsbildend sein können, wenn sie mit Leib und Seele, „mit Geist und Verstand“ (Kor 1,14) geschehen, wenn die Vielfalt der Sinne miteinbezogen und gebildet wird: sei es durch kreative Methoden, durch körperliche Sensibilisierung und geistige Berührung, nicht zuletzt durch die Einbeziehung des Resonanzraums Natur.
Das schult die Wahrnehmung und erhöht die Aufmerksamkeit, schärft den Wirklichkeitsbezug und erlaubt, sich selbst und Andere in Vielfalt und Verbundenheit zu erfahren. Das wären primäre Bildungsziele – persönlich und politisch. •
Dr. Karin Hutflötz

ist Referentin für Persönlichkeitsbildung bei der Domberg-Akademie
Die Erfahrung gegenwärtiger Bildungspraxis weckt den Eindruck, als ginge es bei Bildung primär um Wissen und fachliche Kompetenzen, nach dem Motto: die aktuellen Krisen brauchen konkrete Lösungen. Dabei käme dem Bereich der Persönlichkeitsbildung eine starke Rolle zu – zumal im sozialen und politischen Kontext, wie Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darlegt. Denn das Recht auf Bildung bedeutet, „die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“, um „Verständnis, Geduld und Freundschaft“ und „die Aufrechterhaltung des Friedens“ zwischen Nationen, Rassen, Religionen zu fördern.
Eine Bildung, die dem faktisch genügen oder zumindest dafür den Boden bereiten will, muss innere und äußere Konflikte in ihrem wechselseitigen Bezug und Zusammenhang betrachten. Muss fragen, wie innere Leere und persönlicher Sinn-Verlust äußere Gewalt und destruktives Agieren im sozialen und politischen Raum bedingen. Und wie sich umgekehrt äußere Konflikte auf innere Entwurzelung und Orientierung auswirken.
Das formuliert einen Anspruch an Persönlichkeitsbildung, deren Gegenstand nicht mehr die Person als isolierter Akteur ist – imaginiert als Subjekt, das sich selbst zum Objekt seiner Selbstsorge und Selbstoptimierung macht –, sondern der Mensch in sozialen Bezügen, in diversen Milieus und vielfältigen Anerkennungsverhältnissen. Diese hinsichtlich ihrer sozialen (Macht-)
Strukturen und politischen Dynamiken besser zu verstehen und in gesellschaftlicher Breite und existenzieller Tiefe zu reflektieren, ist eine zentrale Aufgabe von Persönlichkeitsbildung.
Sich methodisch vielfältig solchen Fragen zu stellen, ist Kern einer Persönlichkeitsbildung, die von der sozialen Verwurzelung und zeitgeschichtlichen Verortung der Person ebenso wenig absieht wie von philosophischen Grundfragen und Zukunftsnarrativen der Zeit: Wie wollen wir leben? Wie können wir einander gerecht werden und wie ist eine gerechtere Welt möglich? Orientierung geben dabei nicht selten Ungerechtigkeitserfahrungen und Dystopien und Utopien: eigene, aber auch solche in Literatur und Film.
Gerade im Film werden gesellschaftliche Mythen und Vorbilder unserer Zeit generiert, die auch persönlichkeitsbildend wirksam sind und Sinn geben. Daher lohnt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Erzählungen von Utopien und Verheißungen, aber auch mit Figuren des Scheiterns, die richtungsweisend sind als (Anti-) Held:innen in Religion, Literatur und Kunst. Weil sie die Grenzen des Machbaren aufzeigen und zugleich bezeugen, was letztlich zählt. Wofür man bereit ist, auch zu verzichten oder etwas zu opfern – und wofür nicht. Für eine bestimmte Zeit und Gesellschaft, aber auch identitätsbildend für die jeweilige Person.
Ein solcher Blick auf prägende (Vor-)Bilder und Erzählungen der Vergangenheit dient zur Orientierung und Sinnfindung in Zukunft, bestellt den Boden der Zeit – gewissermaßen
„Es ist mehr Vernunft in deinem Leib“
Wir konzipieren Bildungsformate und Fortbildungen zur Persönlichkeitsbildung. Wir öffnen Reflexionsräume und machen Diskursangebote zu existenziellen Fragen und aktuellen Herausforderungen. Wir bieten transformative Erwachsenenbildung mit innovativer Didaktik und fundiertem Wissen im Schnittfeld von Pädagogik, Psychologie und Philosophie.
Über den abgebildeten QRCode gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Persönlichkeit & Pädagogik

in guten Zeiten! Lässt Richtung und Fahrt aufnehmen, erlaubt Innehalten in Selbstreflexion und ermöglicht gemeinsame Reflexion auf die Grundfragen des Lebens. Das bedeutet, sich einer Krise oder einem Konflikt nicht nur im „inneren Gespräch der Seele mit sich selbst“ (Platon) zu stellen oder an sich zu arbeiten (etwa zum Zweck erhöhter Achtsamkeit und Resilienz), sondern in echtes Gespräch und Austausch zu treten, das mit der Einsicht beginnt: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ (E. Bloch). Und wir ‚werden‘, indem wir uns in Vielfalt erfahren und in der Welt verwurzeln.
In ihrem Buch „Die Verwurzelung“ nennt die Philosophin Simone Weil dies das „vielleicht wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der menschlichen Seele“ – und zeigt umgekehrt, inwiefern „Entwurzelung“ die zentrale Ursache für Machtmissbrauch und Gewalt in der Welt sei, „die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft. Wer entwurzelt ist, entwurzelt. Wer verwurzelt ist, entwurzelt nicht.“
Ein solches „Verwurzeln“ ist aber nicht über feste Zuschreibungen oder Zugehörigkeiten zu haben – wie Herkunft oder Heimat, Familie oder Ehe, Beruf oder Kirche. All das kann ein Mensch haben und sich doch sinnentleert fühlen und unverbunden sein. Sich verwurzeln bedeutet, heimisch zu werden in sich selbst und Verbundenheit zu erfahren – im lebendigen Bezug, in erfahrenem Wohlwollen und echtem Interesse, in Teilhabe im Tun und Anerkennung als Mensch.
Persönlichkeitsbildung verlangt, sich mit Leib und Seele, Geist und Verstand, bewusst und wohlwollend mit sich selbst und seinen Anteilen auseinanderzusetzen, wie immer sie erlebt werden. Letztlich geht es darum, für alle Teile seiner selbst Stimme, Gehör und Ausdruck zu finden. Um heimisch zu werden in sich selbst und „wurzeln zu können selbst in der Ortlosigkeit“ (S. Weil). •
Wie entstehen und verlaufen innere und äußere Konflikte? Gehorchen beide einer gemeinsamen Logik – oder sind unterschiedliche Dynamiken am Werk? Wie wirken sich persönliche Konflikte auf zwischenmenschliche Beziehungen und die politische Ebene aus? Und: Wie beeinflussen Krisen und Kriege psychische Konflikte? Dazu befragen wir Birgit Rohm, Coach und Beraterin, und den Politikwissenschaftler Prof. Dr. Rico Behrens. ˭ In Kooperation mit dem Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung Termin Mo, 06.02.2023
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit Birgit Rohm, Prof. Dr. Rico Behrens Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Online über Zoom Teilnahmegebühr EUR 9,00 Anmeldeschluss Fr, 03.02.2023
Blockaden lösen. Farbe bekennen. Ausdruck finden. Der Workshop schafft mit kreativen Mitteln und interaktiven Methoden einen Experimentalraum, um wesentliche Fragen für sich selbst zu klären. Die Künstlerin, Psychologin und Pädagogin Dr. Ariane Hagl hat dazu einen einzigartigen Ansatz entwickelt, um Kreativität und Sinnlichkeit in die persönlichkeitsbildende Arbeit mit Einzelnen und Teams zu integrieren. So entsteht ein neuer Zugang zur eigenen Handlungs- und Urteilsfähigkeit.
Termin Sa, 18.02.2023
Beginn / Ende 10.00 Uhr / 18.00 Uhr
Mit Dr. Ariane Hagl
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz
Ort Atelier Hagl, Lillweg 28, 80939 München Teilnahmegebühr EUR 140,00 inkl. Material Anmeldeschluss So, 12.02.2023
Wenn Konflikte kommunikativ nicht mehr konstruktiv zu lösen sind, münden sie in Krieg und destruktiver (Selbst-)Aggression. Das gilt für innere wie äußere Konflikte. Doch wann lassen sich Konflikte beenden – zwischen Menschen und Staaten? Wie gelingt es, selbst verfahrene Konflikte zu lösen? Dazu befragen wir die Psychologin Christina Lohr und die Konfliktforscherin Prof. Dr. Sophia Hoffmann. ˭ In Kooperation mit dem Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung
Termin Mo, 13.03.2023
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit Dr. Christina Lohr und Prof. Dr. Sophia Hoffmann Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 9,00 Anmeldeschluss Fr, 10.03.2023
Das Selbstkonzept des IFS und seine Bedeutung für die Bildungspraxis. Prinzipien und Praktiken einer Persönlichkeitsbildung werden vermittelt, die zu vertiefter Wahrnehmung und Selbstführung verhilft. Die zeigt, wie wir resilienter werden und authentischer handeln können. Dazu werden die Grundlagen des IFSModells theoretisch fundiert und praxisnah dargelegt. • In Kooperation mit dem Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung, IFS Europe e.V.
Termin Mi, 08.03., 22.03. und 19.04.2023
Beginn / Ende jeweils 18.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit Dr. Lena Adams, Sebastian Herrlich, Dr. Karin Hutflötz
Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 120,00 (gesamt) Anmeldeschluss Mo, 06.03.2023

Neue Technologien sind unverzichtbares Ergebnis des menschlichen Schaffensdrangs und verbessern unser Leben. Doch für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung braucht es mehr als Technik // von thomas steinforth
Von den ersten Steinwerkzeugen bis zur Digitalisierung: Der menschliche Drang, immer neue technische Lösungen für vielfältige Probleme zu finden, ist unaufhaltsam. Gut so! Denn wenn wir mit Risiken neuer Technologien verantwortungsvoll umgehen und die Früchte technologischer Entwicklung gerecht verteilen (beides ist leider selten der Fall!), dann hilft die Technik, die Schöpfung mitzugestalten.
Allerdings: Wenn wir eine gute Zukunft erreichen, eine gerechte und nachhaltige Entwicklung gestalten wollen, dürfen wir nicht auf Technik allein setzen. Wenn wir „Innovation“ fast automatisch technologisch verstehen oder wenn wir Phänomene wie die so genannte Künstliche Intelligenz mit quasi-religiösen Verheißungen aufladen, dann läuft etwas schief. Ein paar Beispiele:
˭ Natürlich kann Digitalisierung helfen, Bildungschancen für alle zu verbessern. Aber nur dann, wenn wir uns verständigen, was Bildung eigentlich sein soll und nach welchem Bild des Menschen wir bilden wollen. Die um technische Mittel wissende Klugheit kann uns diese Fragen nicht beantworten, und sie erspart uns (zum Glück!) nicht, Bildung als Beziehungsgeschehen zu gestalten. Noch so viele Notebooks allein schaffen keine Bildungsgerechtigkeit.
˭ Selbstverständlich brauchen wir
technologische Innovationen, um die Klimaschädlichkeit unseres Wirtschaftens zu begrenzen. Aber keine Technologie erspart uns die Frage, wozu wir eigentlich wirtschaften und wie wir leben wollen. Technik allein wird den Planeten nicht retten. ˭ Auch für die drängende Frage, wie wir künftig gute Pflege und Care-Arbeit sicherstellen, können technische Mittel wie Robotik hilfreich sein. Aber nur dann, wenn wir wieder zu schätzen lernen – mit handfesten politischen Konsequenzen –, dass Pflege und Sorge wertvoll sind. Wir müssen wieder anerkennen, dass Menschen aufeinander angewiesen sind und das Füreinander-Sorgen keine lästige Pflicht, sondern Grundvollzug menschlichen Lebens ist.
Das, was im Leben wichtig und wertvoll ist, lässt sich nicht herstellen wie ein Produkt, auch nicht mit noch so viel technologischem Know-how. Wir müssen im persönlichen, gemeinsamen und auch politischen Handeln darauf hinzuwirken versuchen, dass es sich ereignet und uns widerfährt. Die Befähigung dazu sollte Auftrag aller Bildungsorte sein, die sich als „Werkstatt Zukunft“ verstehen. •
In diesem Seminar zu Erwachsenenbildung online erhalten Sie Anregungen zur Planung und Durchführung von Online-Seminaren über die Video-Plattform Zoom. Es gibt zudem Raum für Erfahrungsaustausch und Fragen.
Termin Mi, 22.03.2023
Beginn / Ende 18.00 Uhr / 19.30 Uhr
Mit Magdalena Falkenhahn
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Anmeldeschluss Mo, 20. März 2023
Hacking, Sabotage und Cyberoperationen lassen sich für Nicht-IT-Expert:innen nur schwer nachvollziehen. Dennoch tauchen diese Begriffe immer wieder auf und haben nun im Russland-Ukraine-Krieg eine neue Relevanz bekommen.
Gemeinsam mit einer Expertin klären wir die Fragen: ˭ Was ist Cyberwar? ˭ Welche Cyberoperationen finden international statt? ˭ Wie groß ist die Bedrohungslage in Europa und Deutschland? ˭ Wann sind Cyberangriffe wirksam und wann nicht?
˭ Und wie gut ist Deutschland geschützt?
Kerstin Zettl-Schabath arbeitet und forscht am Institut für Politische Wissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ihr Hauptforschungsfeld ist die Cyberkonfliktforschung im Rahmen der Internationalen Beziehungen und Außenpolitikanalyse.
Termin Do, 02.03.2023
Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr
Mit Kerstin Zettl-Schabath
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Ort Online über Zoom
Teilnahmegebühr Kostenlos
Anmeldeschluss Do, 02.03.2023
• Gefördert durch das Bayerische Staatministerium für Unterricht und Kultus
Dr. Thomas Steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung
Die Initiative SCHULTERSCHLUSS e. V. des Kabarettisten Christian Springer setzt sich mit vielfältigen kreativen Projekten für eine lebendige Gedenkkultur und eine vielfältige sowie demokratische Gegenwartskultur ein. Das Projekt Brutkasten des Rechtsextremismus, das vom Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde unterstützt wurde, beeindruckt auf beiden Ebenen.
Durch die Texte von Zeitzeug:innen des Aufstiegs der NSDAP in München lassen sich die dramatischen Entwicklungen nachvollziehen: Der rechtsextreme Terror der 1920er-Jahre zeigte schon früh an, worum es den Nazis ging. Es brauchte dann den Nährboden aus Justizversagen, Wirtschaftskrise, bürgerlicher Verrohung, großindustrieller Unterstützungsnetzwerke und ausuferndem Antisemitismus, damit die Propagandainstrumente der NSDAP ihre grausame Wirkung entfalten konnten. Wie sehr diese den heutigen Instrumenten rechtsextremer Agitation gleichen, führt das Projekt eindringlich vor.
Das Projekt Brutkasten des Rechtsextremismus fordert uns alle auf, jedem Ansatz dieser Ideologie konsequent entgegenzuwirken. Wer den Abend im Münchner Volkstheater (siehe Ausgabe 2 unseres Magazins vom April 2022) verpasst hat, kann diesen nun in einem Erinnerungsvideo, in dem eine Auswahl der Texte von den beteiligten Künstler:innen eingelesen und dokumentiert wurde, nachholen. Es wird auch in den sozialen Netzwerken verbreitet und soll kommenden Generationen als Warnung dienen.

Folgende Künstler:innen haben sich an dieser Initiative beteiligt: Alexander Liegl, Angela Ascher, Christoph Süß, Dietmar Holzapfel, Gerd Anthoff, Gitti Walbrun, Heinz Josef Braun, Lila Schulz, Michael Altinger, Michael Grimm, Nikola Norgauer, Udo Wachtveitl und Winfried Frey. •
DA erfahren Sie mehr!
Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt zum Erinnerungsvideo von Schulterschluss

Im ersten Quartal 2023 soll der neue Blog www.bildung-praktisch.de online gehen. Der Blog richtet sich an Multiplikator:innen und Dozierende in der Erwachsenenbildung. Er liefert Umsetzungsideen, übertragbare Bildungsangebote, unterstützende Infos und vieles mehr für den Praxisalltag als Bildungsakteur:in.
Aktuell enthält das Online-Angebot bildung-praktisch.de Beiträge aus den Bereichen Digitale Bildung, Glaube und Spiritualität sowie Kulturelle Bildung. Mittelfristig sind Inhalte zu weiteren Bildungsbereichen geplant. Ziel des Blogs ist es, Bildungswissen aus den Einrichtungen der Erwachsenenbildung nachhaltig sichtbar zu machen und zu teilen. Derzeit befindet sich der Blog in der Pilotphase. Ausgewählte Personen testen ihn gerade.
www.bildung-praktisch.de ist eine Kooperation der Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung München und Freising, der Hauptabteilung Außerschulische Bildung des Erzbischöflichen Ordinariats München und der Domberg-Akademie. •
Magdalena Falkenhahn ist stellvertretende Direktorin und Referentin für (Inter-) Kulturelle Bildung

•
•
•
Einblicke und Antworten aus dem Judentum, Christentum und Islam.
Das Erinnern spielt in allen drei abrahamischen Religionen eine entscheidende Rolle: ob in der Vergegenwärtigung von Gottes Heilshandeln oder auch im Erinnern und Trauern über erlittenes Unheil und im Gedenken an die Verstorbenen oder die Opfer von Gewalttaten. Aus drei Blickwinkeln soll das Thema „Erinnerung“ an diesem Abend interreligiös beleuchtet werden:
• die Bedeutung von Erinnerung in den Heiligen Schriften
• der Stellenwert des Erinnerns in religiöser Praxis (religiöse Feste, Jahreskreis, Gottesdienst, Gebet, Symbolhandlungen)
• die jeweilige religiöse Gedenkkultur und Erinnerungsarbeit heute.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit statt.
˭ In Kooperation mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit München-Regensburg, dem Fachbereich Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, der Katholischen Seelsorge KZGedenkstätte Dachau und der Evangelischen Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau
˭ Gefördert als Innovatives Projekt durch die KEB München und Freising Termin Mo, 06.03.2023
Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit Gönül Yerli, Dr. theol. Robert Mucha, Prof. Dr. Frederek Musall
Verantwortlich Judith Einsiedel, Dr. Stephan Mokry, Dr. Andreas Renz
Ort Pfarrsaal der Universitätskirche St. Ludwig, Ludwigstr. 22, 80539 München
Teilnahmegebühr EUR 7,00 (Abendkasse)
Neuer Bildungs-Blog
Schulterschluss
Erinnerung in den Religionen• München einmal anders wahrnehmen und die Ereignisse in den 1920er Jahren erleben
Dr. Claudia Pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie, Dr. Stephan Mokry und Dr. Thomas Steinforth sind Referenten für Theologische Erwachsenenbildung



DA erfahren Sie mehr! Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Seite „Glauben.neu.denken“ auf der Website der Domberg-Akademie, mit allen aktuellen Informationen.

Mit unserer Artikelreihe Glauben.Neu. Denken in Christ in der Gegenwart haben wir viel Interesse geweckt. Das zeigten zahlreiche Reaktionen im Verlauf der sechs Folgen, die seit Oktober 2022 erschienen sind. Auf die Suche zu gehen, was das Wesentliche des christlichen Glaubens sei, und von dort aus Glauben neu zu denken und die Erneuerung der Kirche anzustreben – diesen Ansatz unterstützen viele.
Zugleich haben wir Hinweise erhalten, was in den Artikeln vielleicht zu wenig bedacht worden ist – etwa die Notwendigkeit eines ökumenischen Blicks. „Ohne ökumenisches Denken kann man Glauben.Nicht.Neu denken“, so ein Leser in Anspielung auf den Projekttitel. Ein anderer Leser fragt sich, ob das „Neue“ nicht gerade das „Alte“ sei, wie es im Evangelium zu finden ist, dass es jedoch immer wieder „neu“ zu erleben und zu deuten sei.
Wir freuen uns, dass wir solche Fragen und Gedanken auslösen mit einem Anliegen, das die Domberg-Akademie und Christ in der Gegenwart verbindet: Wir wollen die Herausforderungen der Gegenwart annehmen und offen, frei und
konstruktiv-kritisch Impulse für das heutige Christsein geben. Eine dieser Herausforderungen ist die Kirchen- und Glaubenskrise: Wie kann aus dieser Krise Neues erwachsen, wie kann Glaube heute und in Zukunft gelebt werden und was folgt daraus für die (auch strukturelle) Reform der Kirche – immer unter Rückbesinnung auf den „Kern“ der Botschaft Jesu?
Dazu interviewten wir Theolog:innen, Bischöfe, Ordenschrist:innen und Menschen aus geistlichen Gemeinschaften. Wir erhielten persönliche, offene, differenzierte und abwägende Statements. Lernten unterschiedliche Sichtweisen kennen. Ließen uns überraschen. Gingen so gemeinsam mit den Leser:innen auf Entdeckungsreise. Suchten nach Antworten, die über Patentrezepte und die bloße Parole der „geistlichen Erneuerung“ hinausgehen.
Viele Gesprächspartner:innen wünschen eine stärkere Orientierung am Ursprünglichen der Botschaft Jesu, an seiner Verkündigung des liebenden Gottes, der uns zur Liebe ruft und ermutigt. Damit diese Botschaft auch heute wirkund heilsam sein kann, müsse sie glaubwürdig

Gemeinsam untersuchen die katholische Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“ und die Domberg-Akademie, wie Glaube im 21. Jahrhundert gehen kann // von claudia pfrang, stephan mokry und thomas steinforth
# 1 – CLAUDIA PFRANG UND
STEPHAN LANGER: DAS PROJEKT CIG 39 vom 25. September 2022
# 2 – STEPHAN MOKRY
ÜBER DIE TRADITION
CIG 41 vom 9. Oktober 2022
Mit Prof. Dr. Sabine Bieberstein (Neutestamentlerin, Eichstätt), Prof. Dr. Thomas Söding (Neutestamentler, Bochum) und Prof. Dr. Klaus Unterburger (Kirchenhistoriker, München)
# 3 – CLAUDIA PFRANG
ÜBER DIE THEOLOGIE CIG 43 vom 23. Oktober 2022
Mit Prof. Dr. Christian Bauer (Pastoraltheologe, Innsbruck), Prof. Dr. Martin Dürnberger (Fundamentaltheologe, Salzburg), Prof. Dr. Johanna Rahner (Dogmatikerin, Tübingen) und Prof. Dr. Jan-Heiner Tück (Dogmatiker, Wien)
# 4 – ANDRÉ LORENZ
ÜBER DIE ORDEN CIG 45 vom 6. November 2022
weitergegeben und erzählt werden. Menschen müssten bewegende Erfahrungen mit der Liebe Gottes machen können, diese in Gemeinschaft ausdrücken, deuten und teilen können, ihren Lebens- und Glaubensweg in Freiheit gehen können, sich spirituell verankern und sich an der Verheißung Jesu ausrichten können. Unerlässlich sei ein wertschätzender, geschwisterlicher, zugewandter, nicht ausgrenzender und Vielfalt zulassender Umgang miteinander. Dieses der Botschaft Jesu entsprechende Miteinander und ein konstruktiver, menschendienlicher Umgang mit Macht müssten auch strukturell Gestalt annehmen – Erneuerung des Glaubens und Strukturreform müssten Hand in Hand gehen!
Bei allem Konsens gibt es auch unterschiedliche Akzente, etwa zur Frage, welche Ausdeutungen der Botschaft Jesu in der kirchlichen Lehre oder welche Strukturelemente der Kirche zeitbedingt sind und geändert werden können –oder auch nicht. Allerdings: In den Gesprächen zeigt sich unserer Einschätzung nach, dass ein gemeinsames Suchen und das Bemühen um Verständigung möglich sind. Diesem Ziel dient auch die Fortsetzung unserer Kooperation. •
••• Ab Ende Januar 2023 stehen die Artikel in einem digitalen Lernraum zur Verfügung und können dort diskutiert werden.
••• Am 3. März 2023 vertiefen wir in einem Symposium von 15 bis 21 Uhr bei Missio in München mit Interviewpartner:innen und weiteren Gästen die Serie.
••• In einem BarCamp schauen wir im Frühsommer in die Zukunft: Wie geht „Glauben. neu.denken“ in der Praxis? Die Teilnehmenden können ihre Sichtweisen und Praxiserfahrungen aktiv einbringen.
••• Ein Podcast-Projekt stellt Menschen und Projekte vor, die bereits zeigen, wie Glaube neu gedacht und gelebt werden kann.
••• Schließlich planen wir ein Buch, um unser Projekt ins öffentliche Gespräch zu bringen.
Mit Sr. Paulina Kleinsteuber OSB (Missions-Benediktinerinnen Tutzing), Sr. Katharina Kluitmann OSF (Franziskanerinnen von Lüdinghausen), P. Christian Marte SJ (Rektor des Jesuitenkollegs Innsbruck) und P. Martin Werlen OSB (Prior der Benediktiner-Propstei St. Gerold)
# 5 – THOMAS STEINFORTH ÜBER
GEISTLICHE GEMEINSCHAFTEN CIG 47 vom 20. November 2022
Mit Karl Fischer (Charismatische Erneuerung), Daniela Frank (Gemeinschaft Geistlichen Lebens), Hiltrud Schönheit (Vorsitzende Katholikenrat Region München) und Bischof Heinrich Timmerevers (Dresden-Meißen/ Fokolar-Bewegung)
# 6 – STEPHAN LANGER ÜBER
DIE INSTITUTION
CIG 3 vom 15. Januar 2023
Mit den Bischöfen Stefan Oster (Passau) und Heiner Wilmer (Hildesheim)

mühldorf am inn Mut zur Entscheidung Vortrag mit Pater Anselm Grün

Man muss ständig Entscheidungen treffen, einfache und schwierige, manchmal sind es sogar Lebensentscheidungen. Pater Anselm Grün beleuchtet die Hintergründe, warum es uns oft schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Wissen können wir lernen, uns zu entscheiden. Denn keine Entscheidung zu treffen, lähmt uns und unser Miteinander.
Termin Do, 06.07.2023, 19.30–21.00 Uhr
Mit Pater Anselm Grün Verantwortlich Kreisbildungswerk Mühldorf Teilnahmegebühr
Eintritt EUR 17,00 zzgl. Vorverkaufsgebühr, Abendkasse EUR 22,00
Ort Haus der Kultur Waldkraiburg, großer Saal Info
www.kreisbildungswerkmdf.de/veranstaltung-39449
mühldorfVorträge, Seminare, Workshops: Themenbezogene Highlights von Kreisbildungswerken in der Erzdiözese München und Freising
bad tölz Meine Ängste, meine Sorgen, meine Kinder und ich Ein sehr aktuelles Thema in Familien unserer Zeit
Angst ist eine normale Reaktion auf bedrohliche Situationen, sie hilft uns, Gefahren zu erkennen und hält uns davon ab, Risiken einzugehen. Zu viel Angst stresst uns jedoch und engt uns in unserer Entwicklung ein. In unserem Workshop sensibilisieren wir uns für unsere Ängste und deren Auswirkungen auf die Familien, insbesondere unsere Kinder. Übernehmen Kinder die Empfindungen von uns Eltern? Wenn ja, wie können wir entgegenwirken? Welche Ängste haben wir ganz persönlich, und wie können wir diese positiv beeinflussen?
In einem weiteren Schritt erarbeiten wir Möglichkeiten, achtsam und reflektiert mit unseren Ängsten umzugehen und Gelassenheit zu erlangen. Unser Ziel ist es, uns unsere angstvollen Gedanken und das damit ausgelöste Verhalten bewusst zu machen und anzunehmen, aber auch zu erkennen, wo und wie wir etwas verändern können. Die Referentin, Karin Wanke, ist Erzieherin und Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie.
Termin Do, 02.03.2023, 19.30–21.30 Uhr
Mit Karin Wanke
Teilnahmegebühr EUR 10,00 Ort Pfarrheim, Kirchplatz 8, Ascholding Anmeldung Kreisbildungswerk Tel.: 08179 4239890
E-Mail: info@kbw-toelz-wor.de Anmeldeschluss Mo, 27.02.2023
Geschichtliche,
Die Darstellung des Kreuzes hat sich im Lauf der Jahrhunderte stark verändert. Theologie und Zeitgeist spielten dabei eine Rolle. Wir betrachten unterschiedliche Darstellungen aus der Geschichte des Kreuzes und warum sie so gestaltet wurden. Dabei reflektieren wir unsere eigenen Zugänge zum wichtigsten Symbol der Christenheit. Im zweiten Teil gestalten wir selbst unser ganz eigenes Kreuz in Glasfusingtechnik zusammen mit der Dachauer Glaskünstlerin Gabriele Metzger (www.lichtwerk-glas.de). Wir erfahren in ihrer Werkstatt außerdem etwas über das besondere Material Glas und stimmen uns nochmals kurz auf „unser“ Kreuz ein.
Termine
Teil 1: Mo, 13.03.2023, 19.30–21.00 Uhr
Teil 2: Sa, 18.03.2023, 14.30–16.30 Uhr
Mit Susanne Deininger (Pastoralreferentin), Gabriele Metzger (Glaskünstlerin)
Verantwortlich Susanne Deininger Teilnahmegebühr

Teil 1: EUR 5,00 /
Teil 2: EUR 20,00 inkl. Material
Ort Pfarrheim St. Ursula, Dorfstraße 7, 85221 Dachau-Pellheim
Info www.dachauer-forum.de Anmeldeschluss Mi, 08.03.2023
münchen Postpatenprojekt in München Ältere Menschen beim Schriftverkehr unterstützen
Ehrenamtlich engagierte Postpat:innen helfen älteren Menschen, ihre Post zu ordnen und zu bearbeiten. Im fünfteiligen Einführungskurs lernen Sie alles Nötige, um diese Menschen beim Umgang mit ihrer Post vorübergehend oder dauerhaft zu unterstützen. In Kooperation mit dem Sozialreferat der Stadt München, Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige.
Termine
Di, 14.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023, 18.04.2023, 25.04.2023, jeweils 17.30–20.00 Uhr; Infoveranstaltung zur Tätigkeit am Di, 31.01.2023
Mit Fachkräften der Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige; Maria Faber, Pflegelehrerin, Case-Managerin; Sybille Lohrer, Sozialmanagerin (M.A.)
Verantwortlich Maria Gulden Teilnahmegebühr kostenlos
Ort Münchner Bildungswerk e.V., Dachauer Str. 5, 80335 München Info www.muenchner-bildungswerk.de/ veranstaltungen Anmeldeschluss Di, 07.03.2023
berchtesgadener land Die Bibel falsch verstanden Adam, Eva und die Schlange –Sündenfall und Geschlechterbeziehung
Das „Buch der Bücher“ gehört wohl zu den am häufigsten zitierten Werken der Weltliteratur. Gleichzeitig werden biblische Texte oft entgegen ihrer ursprünglichen Aussageabsicht verwendet. Solche Missverständnisse werden in den Blick genommen. Diese Veranstaltung widmet sich dem Schöpfungsbericht und der darin befindlichen Versuchung von Adam und Eva im Paradies. In diesem Zusammenhang wird auch thematisiert, was dies für unsere Geschlechterbeziehung bedeutet.
Termin Do, 02.03.2023, 20.00–21.30 Uhr Mit Max Aman, Pädagogischer Referent für Theologische Erwachsenenbildung Verantwortlich Katholisches Bildungswerk Berchtesgadener Land e.V. Teilnahmegebühr kostenlos
Ort Pfarrheim Teisendorf Info www.bildungswerk-bgl.de Anmeldeschluss Keine Anmeldung erforderlich
Denken hilft!
Philosophische Anstöße in Zeiten der Veränderung Onlinevortrag und Gespräch mit der Theologin und Philosophin Prof. Dr. Katharina Ceming
Wozu Denken helfen kann, soll ein Streifzug durch die Geschichte der Philosophie klären. Denken ist ein wichtiges Instrument, um zu einem guten und verantwortlichen Leben zu gelangen. Denn wer nachdenkt, klärt nicht nur seine eigenen Gedanken, sondern legt auch Rechenschaft über sein Tun und Handeln ab. In Kooperation mit KBWdigital.
Termin Di, 21.03.2023, 19.00–20.30 Uhr Mit Prof. Dr. Katharina Ceming Teilnahmegebühr EUR 8,00

Ort Online
Info www.kbw-miesbach.de
Anmeldeschluss Mo, 20.03.2023
DA erfahren Sie mehr!
Scannen Sie den QR-Code für einen Überblick über die Veranstaltungen der Kreisbildungswerke und Detailinformationen zu den hier vorgestellten Angeboten.
erding
Selbst bestimmt. Lesung und Gespräch Wie wir mit Erwartungen umgehen und ein authentisches Leben führen.
Viele führen ein Leben, von dem sie glauben, es so leben zu müssen, obwohl es ihnen nicht gut tut. In ihrem Buch „Selbst bestimmt“ und mit dem Vortrag zeigt die Referentin Dr. Tatjana Reichhart wissenschaftlich fundiert und leicht nachvollziehbar, wie man sich mit kleinen Schritten aus diesen (gefühlten) Ketten befreit und ein authentisches Leben führt, ohne dabei egoistisch zu werden. Dr. Tatjana Reichhart ist Autorin, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Eigentümerin des Coaching- und Seminarcafés „Kitchen2Soul“ in München.
Termin Mi, 29.03.2023, 19.00–20.30 Uhr Mit Dr. Tatjana Reichhart Verantwortlich Carina Dollberger, KBW Erding e.V. Teilnahmegebühr EUR 10,00
Ort VHS Erding, Lethner Str. 13, 85435 Erding direkt am Bahnhof Erding Info www.kbw-erding.de/veranstaltung-23487 Anmeldeschluss Di, 28.03.2023
Erzbischof Reinhard Kardinal Marx hat am 14. September 2022 im Erzbischöflichen Palais den Mitgliedern der 13. Diözesanen Ökumenekommission ihre Berufungsurkunden überreicht. Mit dabei: unser Referent für Theologische Erwachsenenbildung Dr. Stephan Mokry (im Foto 3. von rechts).
Ökumenische Themen interessierten ihn schon in seinem Theologiestudium an der LMU München, er besuchte Lehrveranstaltungen am Zentrum für Ökumenische Forschung bei Birgitta Kleinschwärzer-Meister, Peter Neuner und Bertram Stubenrauch.

2015/16 leitete er das zweijährige Projekt 2017: Neu hinsehen! Ein katholischer Blick auf Luther der Akademie des Bistums Magdeburg und der KEB Sachsen-Anhalt in Halle/Saale, das auch in der bundesdeutschen Ökumene viel Resonanz erhielt. Mokry freut sich nun auf die nächsten vier Jahre in der Kommission, denn: „Die Domberg-Akademie behandelt zentrale Fragen, wie Christsein heute und in Zukunft funktioniert – und diese Fragen sind immer mehr ökumenisch relevant und erfordern gemeinsame Antworten.“ •
Die Domberg-Akademie war mit dem Escape Game Klimaprofis –saving tomorrow beim Katholischen Medienkongress in Bonn
Unter dem Motto Let’s face it – Authentizität und Kommunikation hat vom 2. bis 4. November 2022 der 3. Katholische Medienkongress in Bonn stattgefunden. Das Ziel war, Glaubenskommunikation gemeinsam umfassend zu denken und Impulse zur Weiterentwicklung kirchlicher Medienaktivitäten zu setzen. Wir waren eingeladen, das Escape Game Klimaprofis – saving tomorrow vorzustellen, das durch die Förderung des Medienfonds der Deutschen Bischofskonferenz maßgeblich ermöglicht wurde.
Unser Fazit zu innovativer katholischer Bildungsarbeit: Die Domberg-Akademie kann sich mit ihren zeitgemäßen Formaten in der katholischen Medienlandschaft sehen
lassen: Vom Podcast über das Escape Game bis hin zum multimedialen Bildungsformat der Lecture Performance bietet kaum eine Akademie ein so breites Spektrum der Kommunikation.
Aus den Panels, Vorträgen und Diskussionen nehme ich mit, dass gute Kommunikation von zwei Aspekten abhängt: Ehrlichkeit und Transparenz. Indem wir immer wieder schwierige und strittige Themen aufgreifen, wie Sterbehilfe, sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche oder Fragen der Diversität, versuchen wir in der Domberg-Akademie, diese Transparenz und Ehrlichkeit herzustellen, ohne dabei innere Widerstände oder Konflikte zu verschleiern.
•
Kathrin Steger-BordonVor genau einem Jahr ist die erste Ausgabe unseres DA-Magazins erschienen. In der Zeitschrift geben wir einen Einblick in die aktuelle Arbeit unseres Bildungsteams und informieren über ausgewählte Veranstaltungen und besondere Projekte.
Nach drei Ausgaben ist es Zeit für ein erstes Fazit. Dafür möchten wir von Ihnen gerne wissen: ˭ Wie gefällt Ihnen das Magazin? ˭ Welche Inhalte interessieren Sie besonders? ˭ Wo liegt für Sie der Mehrwert? Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen: www.domberg-akademie.de/umfrage
Damit können wir die richtigen Akzente setzen und unsere Bildungsangebote weiter an Ihren Bedürfnissen ausrichten. Vielen Dank! •
Entscheiden Sie sich jetzt für die Bildungsflat der Domberg-Akademie zum aktuellen Saisonthema. Zum vergünstigten Paketpreis erhalten Sie Zugang zu ausgewählten OnlineVeranstaltungen und eine exklusive Prämie, wenn Sie sofort buchen
Alle Termine der Online-Veranstaltungsreihe LEUCHTTÜRME Wo und wie finden wir Orientierung für unser Leben?
[statt 27 € bei Buchung der Einzelveranstaltungen]

Plus: Wählen Sie eine der beiden attraktiven Buchprämien gratis dazu! (So lange der Vorrat reicht)
Anselm Grün Abschiede Aufbruch in neue Welten Verlag Herder, 240 S.
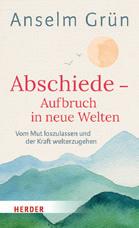

Hermann Glettler Dein Herz ist gefragt Verlag Herder, 224 S.
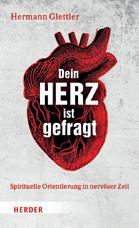
Sie möchten kein Angebot der DombergAkademie mehr verpassen? Dann abonnieren Sie einen unserer thematischen Newsletter und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: www.domberg-akademie/newsletter
Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook [facebook.com/dombergakademie] YouTube [youtube.com/c/DombergAkademie] Twitter [mobile.twitter.com/claudiapfrang]
Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell in unserem Veranstaltungskalender auf der Website. Hier können Sie sich auch bequem online für alle Angebote anmelden! www.domberg-akademie.de/veranstaltungen

Domberg-Akademie Hildegard Mair (Kursorganisation) Untere Domberggasse 2 85354 Freising Tel.: 08161 181-2177 info@domberg-akademie.de
Alle Termine der Online-Veranstaltungsreihe ZEITANSAGEN Neue Denkansätze in krisenhaften Zeiten
[statt 45 € bei Buchung der Einzelveranstaltungen]
Plus: Wählen Sie eine der beiden attraktiven Buchprämien gratis dazu! (So lange der Vorrat reicht)
DAerfahren Sie mehr
Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu den Angeboten der Bildungsflat.
Jürgen Manemann Revolutionäres Christentum transcript Verlag, 160 S.
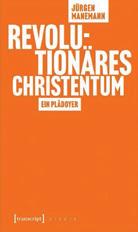
Harald Lesch und Thomas Schwartz Die Zukunftsformel Verlag Herder, 176 S.
da ist das Magazin der Domberg-Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising Untere Domberggasse 2 85354 Freising www.domberg-akademie.de
Verantwortlich für den Inhalt (V.i.S.d.P.): Dr. Claudia Pfrang, Direktorin Redaktion: Dr. Stephan Mokry, Janine Schneider, Melanie Waldinger Konzeption, redaktionelle und grafische Produktion: André Lorenz Media & Merchandise GmbH, Sauerlach, www.andrelorenz.de
Druck: Lerchl-Druck e. K., Liebigstraße 32, 85354 Freising, Tel. 08161-53030, info@lerchl-druck.de
Gedruckt mit mineralölfreien Ökofarben auf 100% Recyclingpapier.
Bildnachweise: Alle Fotos der Mitarbeitenden der Domberg-Akademie: Fotoagentur Kiderle oder privat. Titel: Bim / iStock; S. 6–9: aniaostudio / iStock; S. 10: Privat (3); S. 12: istockphotos; S. 19: istockphotos; Nils vom Lande, Shutterstock / zendograph, Tobias Trauth; S. 22: Pixabay; S. 29: SCHULTERSCHLUSS e.V. ; S. 30: Shutterstock; S. 32: Julia Martin_ Abtei Münsterschwarzach; S. 33: Sabine Jakobs, andreamuehleck; S. 34: Fotoagentur Kiderle
Wir helfen. Weil uns Menschen wichtig sind.







