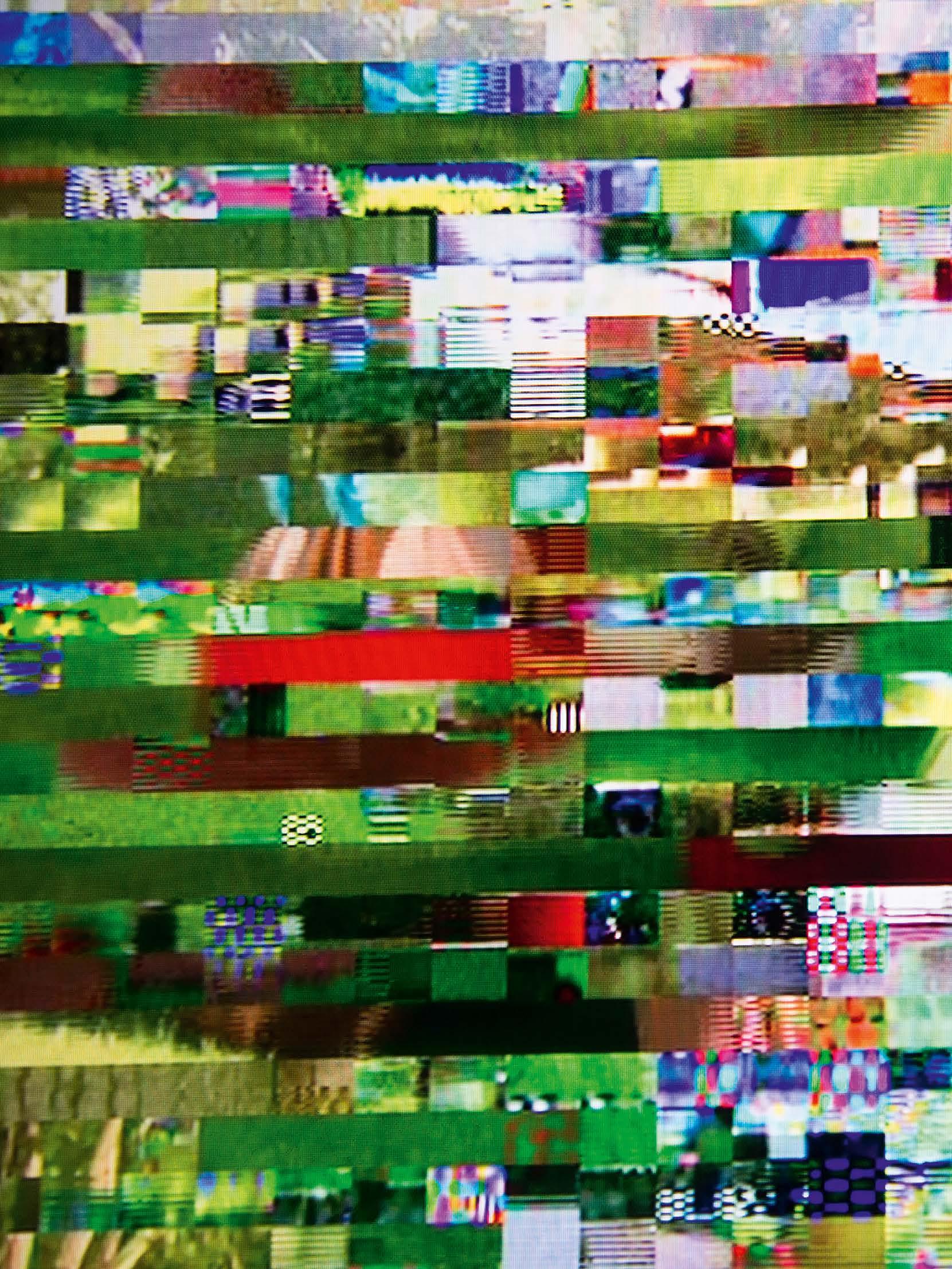
20 minute read
Mehr Indizes leichtere Orientierung?
Thema
Ein Markt, ein Index, eine Benchmark: In dieser Gleichung haben Investoren über ein Jahrhundert lang eine einfache, klare Orientierung gefunden. Doch die Welt wird komplexer, die Zahl der Indizes explodiert und ihre Rolle ändert sich. Helfen Sie Ihren Kunden durchzublicken.
Der Dow Jones Industrial Average-Index wurde 1884
erschaffen Kaum vorstellbar: Den DAX – gerade einer Frischzellenkur unterzogen und auf 40 Mitglieder erweitert – gibt es erst seit 1988. Gut 100 Jahre hat es also gedauert, bis die Idee von Charles Dow und seinem Partner Edward Jones endlich auch hierzulande Schule machte. Die beiden haben nämlich bereits 1884 den Dow Jones Industrial Average-Index geschaffen. Sein Ziel: Er sollte die Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes messen. Der aus 30 Titeln bestehende Index ist – neben dem weniger bekannten Dow Jones Transportation-Index – einer der beiden ältesten noch heute berechneten Aktienindizes.
Er ist damit auch Urvater der Idee, die Indizes lange Zeit verfolgten. Sie sollten die Entwicklung einzelner Anlagemärkte messbar machen: Länder-Aktienmärkte, regionale Aktienmärkte, Welt-Aktienmärkte. Die systematische Einteilung der Aktienindizes beim heute nach Umsatz größten Indexanbieter MSCI1 zeugt noch immer von dieser Grundidee (siehe Seite 8, Abbildung oben).
Im Sinne der Messung von Marktentwicklung wurden sukzessive auch Indizes für unterschiedliche Anleihenmärkte, für Rohstoff- und Immobilienmärkte entwickelt.
Manche traditionellen Indizes, auch der Dow Jones-Index, haben inzwischen bei professionellen Anlegern an Bedeutung verloren. Zwar wird er noch berechnet, doch wird heute von Investmentprofis der S&P 500, der mit 500 Titeln die Breite und Vielfalt des US-Aktienmarktes besser abbildet, als relevanter angesehen. Unter den Indizes, die die Aktienmarktentwicklung weltweit beschreiben, nimmt heute der MSCI World (oder MSCI All Country World) eine herausragende Stellung ein. Für Europa ist es der EURO STOXX 50.
Indizes: Die „Türsteher des Kapitals“
Die wesentliche Funktion, die Indizes über mehr als 100 Jahre erlangt haben, ist, als Benchmark für Anlegerportfolios zu dienen. Häufig wird eine Kombination – etwa aus Aktien- und Anleihenindizes – als Orientierung für den Aufbau von Portfolios privater und institutioneller Portfolios gewählt. Investmentfonds orientieren sich traditionell Unter den Indizes, die die Aktienmarktentwicklung weltweit beschreiben, nimmt heute der MSCI World (oder MSCI All Country World) eine herausragende Stellung ein.
Klassifikation von MSCI-Indizes
MSCI All Country World Index (ACWI)
MSCI World
Amerika Europa & Mittlerer Osten Pazifik MSCI Emerging Markets
Amerika Europa, Mittlerer Osten & Afrika Asien
Kanada USA Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Großbritannien Irland Israel Italien Norwegen Österreich Portugal Spanien Schweden Schweiz Australien Hongkong Japan Neuseeland Singapur Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Mexiko Peru Ägypten Griechenland Katar Kuwait Polen Russland Saudi-Arabien Südafrika Tschechien Türkei Ungarn VAE China Indien Indonesien Malaysia Pakistan Philippinen Südkorea Taiwan Thailand
Quelle: MSCI, Stand 07. 09. 2021
an einer solchen Benchmark. ETFs sollen häufig deren Wertentwicklung möglichst genau abbilden. Durch diese Orientierungsfunktion lenken Indizes die Kapitalströme weltweit. Das Kapital von Investoren fließt vermehrt in Titel, die in wesentlichen Indizes prominent enthalten sind.
MSCI, S&P und FTSE Russell ist damit in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Marktmacht zugewachsen, die WirtschaftsWoche nennt sie „Türsteher des Kapitals“: „Die US-Marktführer in Sachen Aktien-Indizes, MSCI und S&P, entscheiden maßgeblich mit, welche Papiere Anleger im Depot haben – und welche nicht.“2 Und das ist alles andere als trivial, denn so harmlos ist die Aufgabe der Messung einer Marktentwicklung nicht.
Anlagemärkte: Messen heißt gestalten
Die Entwicklung einzelner Anlagemärkte zu messen klingt zunächst wie eine neutrale, objektive Tätigkeit. Doch das täuscht. Indexanbieter müssen abwägen, welche der an den jeweiligen Börsen notierten Titel sie in ihre Indexberechnung aufnehmen und welches Gewicht sie dem jeweiligen Wertpapier im Index geben. Am häufigsten treffen Anleger heute auf marktkapitalisierungsgewichtete Aktien- und Anleihenindizes (mehr zur Systematik und zum Aufbau von Indizes unter „Indizes: 4 Kernfakten für Anleger“). Diese Gewichtung allein hat schon wesentlichen Einfluss auf die Lenkungsfunktion der Kapitalströme. Doch gerade, wenn es Aktieninvestoren darum geht, Wachstums- und Gewinnpotenziale von Unternehmen aus aller Welt in ihr Portfolio zu holen, treffen Anleger mit Indizes mitunter einschneidende Vorentscheidungen.
So könnte man zunächst einmal davon ausgehen, dass die Verteilung einer Kapitalanlage über die Weltregionen vom Anteil dieser Region am globalen Bruttoinlandsprodukt abhängen sollte. Schließlich sollen Aktien von den Gewinnen und der Wirtschaftsleistung von Unternehmen getragen sein. Wo diese am größten ist, müsste man demnach am meisten investieren. Danach im abnehmenden Umfang – je nach Anteil von Land oder Region am globalen BIP.
Ein Blick auf die Verteilung von Marktkapitalisierung weltweit lässt aber schon ahnen: Wenn Indizes marktkapitalisierungsgewichtet sind, werden ihre Schwerpunktsetzungen von der BIP-Verteilung abweichen. Hier spielen die historisch gewachsene Aktienkultur und damit die traditionellen Wege der Beschaffung von Investitionskapital eine entscheidende Rolle. Wenn die nicht über Aktien funktioniert, wird die Marktkapitalisierung von börsen-
notierten Aktien im Streubesitz aus diesen Ländern hinter anderen zurückbleiben. Die Grafik „Gewichtungskunststück: MSCI All Country World“ zeigt das im Vergleich. Während die USA im Jahr 2020 rund 25% des globalen BIP erwirtschafteten, lag ihr Anteil an der globalen Marktkapitalisierung gemessen an verfügbaren Daten mit gut 40% deutlich höher. Im Falle Japans halten sich BIPAnteil und Marktkapitalisierung mit rund 6% und etwa 7% fast die Waage. Deutschland und China sind dagegen gemessen am BIP an den Aktienmärkten deutlich unterrepräsentiert.
Doch selbst darüber geht die Ländergewichtung, die MSCI faktisch vornimmt, hinaus. So waren US-Aktien 2020 im MSCI All Country World Index mit 58% vertreten. Also weit jenseits des Anteils von rund 40%, den die US-Unternehmen an der Marktkapitalisierung weltweit haben. Chinesische Aktien kommen in diesem Index nur auf einen Anteil von 5%, also weit unter dem Anteil Chinas am globalen BIP (rund 18%) und auch unter dem Anteil der Marktkapitalisierung aller Aktien aus diesem Ländermarkt chinesischer Aktien (gut 10%). Rechnet man die chinesischen Unternehmen hinzu, die an US-Börsen gelistet sind, ändert sich das Bild kaum. Denn deren Anteil am US-Aktienmarkt bewegt sich im Promillebereich. Der Grund für die großen Abweichungen liegt darin, dass der Index auf die 3.000 größten Titel nach Marktkapitalisierung weltweit beschränkt ist. Ländermärkte mit vielen, aber kleinen Aktien sind dann im Index unterrepräsentiert. Umgekehrt können Märkte, die zuletzt großen Kapitalzufluss in ihre Top-Aktien verzeichneten, einen übergroßen Anteil erhalten. Heute sind das die USA, Anfang der 1980er-Jahre war das Japan. Obwohl dieser verbreitete Index also „Welt“ im Namen trägt, müssen Investoren genau hinsehen und gegebenenfalls abweichende Vorstellungen von einem globalen Investment durch zusätzliche Schwerpunktsetzungen bzw. Anteile länderspezifischer Indizes „ihrer“ eigenen Benchmark für ihr globales Investment realisieren.
Momentum und andere Verzerrungen
Selbst wenn man die Länderallokation einmal außen vor lässt und allein auf die Titelgewichtung blickt, führt die scheinbar so einfache wie objektive Schwerpunktsetzung nach Marktkapitalisierung zu Verzerrungen, deren sich Anleger zumindest bewusst sein sollten. Denn die Effekte dieser Verzerrungen können sich nachteilig auswirken.
Marktkapitalisierungsgewichtete Aktienindizes haben nämlich immer eine immanente Momentum-Neigung: D.h. der wertmäßige Anteil der Titel, die zuletzt an den Börsen gut gelaufen sind, wächst – schließlich sind ihre Preise gestiegen. Bei klarem Aufwärtstrend führt das zwar zur Selbstverstärkung von Strategien, die sich eng am Index orientieren oder diesem – wie die meisten ETFs – konsequent folgen. Doch diese Momentum-Neigung kann in Zeiten von Umbrüchen an den Märkten und einer möglichen Trendumkehr problematisch sein. Dann haben Titel mit hohen Preisen und tendenziell hoher Bewertung einen vergleichsweise hohen Anteil am Index. Von möglichen Kursabschlägen ist er daher stärker betroffen. Das ist auch der
Gewichtungskunststück: MSCI All Country World
Anteile im Vergleich (in %): BIP, Marktkapitalisierung und Indexgewichtung.
USA China Japan Deutschland
Anteil am globalen BIP (USD)
Anteil an globaler Marktkapitalisierung (USD)
Anteil am MSCI All Country World
0 10 20 30 40 50 60
Quellen: Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar im Jahr 2020 (Internationaler Währungsfonds, April 2021); Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen in US-Dollar im Jahr 2019 – neueste verfügbare Daten (WEF/Weltbank, April/Juli 2021); Anteile am MSCI All Country World, 2020 (msci.com, 15. 05. 2020)
Indizes: 4 Kernfakten für Anleger
Was hinter einem Index steckt, lässt sich an vier Merkmalen festmachen. Wer sie kennt, kann besser einschätzen, um welchen Index es sich handelt und wofür der Index nützlich sein kann.
1. Wer ist Indexanbieter?
Die Anforderungen für eine Indexaufnahme legen letztlich die Indexanbieter fest, also MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell & Co. Meist folgt die Auswahl nach Anlageklasse, Marktkapitalisierung, Branche, Region oder auch nach einer Kombination dieser Kriterien. Die großen Indexanbieter sind in den USA beheimatet. Ihre Weltindizes bringen daher oft eine starke Betonung des US-Marktes mit.

2. Handelt es sich um einen Kurs- oder Performanceindex?
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Kurs- versus Performanceindex: In einem Kursindex werden nur Kursveränderungen berücksichtigt, Ausschüttungen wie Dividenden oder Zinszahlungen schlagen sich nicht nieder. In einen Performanceindex fließen hingegen sämtliche Erträge der im Index enthaltenen Unternehmen ein, also Dividenden-, Bonus- oder Zinszahlungen. Kursindizes sind der Normalfall (S&P 500, Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100, CAC 40). Der DAX ist als Performanceindex eher die Ausnahme.
3. Welcher Markt soll abgebildet werden, wie erfolgen Titelauswahl und -gewichtung?
Wichtig ist natürlich auch das Titeluniversum, aus dem ausgewählt wird: Handelt es sich um den Aktien- oder Anleihenmarkt, um bestimmte Branchen oder Regionen? Dazu kommt die Gewichtung im Index:
– Marktkapitalisierungsgewichtung:
Die Gewichtung erfolgt entsprechend der
Marktkapitalisierung eines Unternehmens (Anzahl der ausgegebenen Titel multipliziert mit dem Börsenkurs). Beispiele: DAX, MSCI
World und S&P 500. – Preisgewichtung: Die Kurse aller im Index enthaltenen Werte werden addiert und anschließend durch die Anzahl der Titel im Index geteilt. Beispiele: Dow Jones und Nikkei 225. – Gleichgewichtung: In gleichgewichteten
Indizes („equal weight“) erhalten alle Titel das gleiche Gewicht. Der Vorteil ist, dass „teure“ Titel nicht zu hoch gewichtet werden.
Wirklich durchsetzen konnte sich dieses
Indexkonzept aber nicht.
4. Wie wird der Index regelmäßig überprüft?
Hier geht es um die Überprüfung der Indexzusammensetzung und deren Umsetzung. Verändert sich der Markt, können Titel aus einem Index herausfallen oder andere neu hinzukommen. Dafür wird die Zusammensetzung monatlich, vierteljährlich oder jährlich überprüft.
Kernpunkte für die Indexunterscheidung
Titeluniversum
Grundgesamtheit an Wertpapieren
Titelauswahl
Auswahlkriterien für Wertpapiere
Titelgewichtung
Gewichtung der Wertpapiere
Überprüfung
Regelmäßige Überprüfung der Zusammensetzung
z. B. alle Unternehmen eines Landes oder einer Region z. B. Marktkapitalisierung (Größe eines Unternehmens) z. B. nach Preis oder Marktkapitalisierung z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich
Kundeninfo zum Download unter
Grund, warum sich aktive Fondsstrategien in Abwärts- und Umbruchphasen im Durchschnitt leichter tun, passive, also rein indexorientierte Strategien zu übertreffen. Aktuelles Beispiel: Während der Aufwärtsphase im ersten Halbjahr 2021 gelang dies nach Untersuchungen von Scope nur knapp 38% der Fondsangebote. Beim von starken Einschnitten geprägten Vorjahr 2020 konnten dagegen noch 46% ihren Vergleichsindex übertreffen.3
Bei Anleihenindizes kann die Marktkapitalisierungsgewichtung dazu führen, dass die einflussreichsten Indexbestandteile auch eine hohe Schuldenlast tragen. Das kann auch ein Anzeichen für eine verschlechterte Finanzlage dieser Unternehmen sein. Auch hier kann es sich also lohnen, Experten die einzelnen Titel genauer analysieren zu lassen. Auch im Anleihenmarkt gilt das besonders in Stressphasen, wenn sich beispielsweise durch einen Zinsanstieg die Refinanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen und Staaten verschlechtern.
Kapital oder Kaufkraft?
Das ist doch die K-Frage!
Wenn man heute 5.000 EUR auf das Sparbuch oder Festgeldkonto einzahlt, dann steht dieser Betrag in der Regel auch nach 5, 10 oder 20 Jahren noch zur Verfügung. Das Kapital bleibt auf den ersten Blick erhalten. Aber der zweite Blick lohnt sich: Denn was passiert mit der Kaufkraft? Was kann man sich damit noch leisten? Bei Nullzinsen und nach Abzug der Inflation?
Sprechen Sie Ihre Kunden zur K-Frage an. Zeigen Sie ihnen mögliche Alternativen zum Kaufkrafterhalt, wie z.B. Fonds der DWS. Alle Infos zur K-Frage bei der Geldanlage finden Sie hier: go.dws.de/k-frage
Investitionen unterliegen Risiken.
Wichtige Hinweise: DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die vollständigen Angaben zu den Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Fonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzungen des Verwaltungsreglements und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei ihrem Berater, bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, D 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhalten sowie elektronisch unter www.dws.de herunterladen. DWS International GmbH, Stand: 20.08.2021. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
Beispiele für MSCI ESG-Indexgruppen
MSCI ESG Equity MSCI ESG Fixed Income & Bloomberg Barclays MSCI
Integration – ESG Leaders – ESG Focus – ESG Universal – Low Carbon – Climate Change
MSCI
– ESG Universal – ESG Leaders – Climate
Bloomberg Barclays MSCI
– ESG Universal – ESG Leaders
Value & Screens – SRI – KLD 400 Social – ESG Screened – Ex Controversial
Weapons – Ex Tobacco Involvement – Ex Fossil Fuel – Faith Based
Bloomberg Barclays MSCI
– Socially Responsible (SRI) – Faith Based
Impact – Sustainable Impact – Global Environment – Women’s Leadership
Quelle: msci.com, abgerufen am 31.08.2021
Bloomberg Barclays MSCI
– Green Bonds
Es gibt mehr als 3.000.000
Indizes weltweit
Exponentielle Vermehrung: Mehr als 3 Millionen Indizes
Weltweit gibt es weniger als 45.000 an Börsen notierte Aktienunternehmen.4 Welche Zahl an Indizes würden Anleger erwarten – Anleihen-, Rohstoff- und Immobilienmarktindizes hinzugerechnet? Bestimmt nicht die Zahl, die der Realität entspricht: 3.000.000!
Haupttreiber dieser Entwicklung ist die wachsende Bedeutung von ETFs und hier insbesondere der passiven, indexgebundenen Produkte. Seit der Jahrtausendwende haben sie mit einem zunächst einfachen Versprechen an Anleger viel Kapital eingeworben: Erhalten Sie zuverlässig die Wertentwicklung des Index – vermindert um ganz geringe Gebühren. Am Anfang stand die Nachbildung traditioneller Marktindizes der Liga MSCI World, S&P 500 oder auch des DAX. Mit dem zunehmenden Erfolg der ETFs wurde die Nachfrage nach immer feiner segmentierbarer passiver Anlage größer. Entsprechend wuchs die Zahl von Indizes, die Investitionen zum Beispiel in sektorale Ländermärkte oder ganz spezifische Investment Grade- oder High Yield-Anleihesegmente ermöglichten. Da Indexanbieter für jeden „Spezial“-Index Lizenzgebühren verlangen, ist die Ausweitung des Indexuniversums ein lukratives Geschäft und verleiht somit der Indexentwicklung eine große Dynamik.
Heute hat sich die Berechnung von Kapitalmarktbarometern zu einem riesigen Geschäft entwickelt. 2020 erreichte der Umsatz der Indexanbieter den Rekordwert von 4,1 Milliarden US-Dollar – gegenüber dem Vorjahr war das ein Plus von 10%, wie eine Auswertung der Unternehmensberatung Burton-Taylor zeigt. Dominiert wird der Markt von den drei Akteuren MSCI (25% der Umsätze), gefolgt von S&P Dow Jones (24%) und FTSE Russell (19%), einer Tochter der Londoner Börse.1 Das verbleibende Drittel teilen sich Indexanbieter wie Nasdaq, STOXX – der Gruppe Deutsche Börse zugehörig –, Bloomberg sowie kleinere Neulinge wie Solactive.
Die Treiber: Von Faktor- und Themen- bis hin zu Kryptoindizes
Ein weiterer Grund für die explodierende Anzahl an Indizes liegt darin, dass ETF- und Indexanbieter seit einigen Jahren an die Weiterentwicklung über die immer feinere Unterteilung bekannter Anlagemärkte hinausgangen sind. Indizes und auf ihnen beruhende ETFs sollen auch aktive Elemente des Investierens einfangen. Sie sollen Anlegern helfen, z.B. sektorale Schwerpunkte in Boombranchen zu setzen oder mithilfe von Anlagestilfaktoren zu investieren.
Faktor-Indizes lassen die Grenze von passivem und aktivem Investment verschwimmen (entsprechende ETFs rufen in der Regel auch höhere Gebühren auf als ihre einfach marktabbildenden Ahnen). Faktor-Indizes zeichnen sich dadurch aus, dass die Titel anhand bestimmter Merkmale („Faktoren“) alternativ gewichtet werden. Ziel ist es, eine Mehrrendite gegenüber dem breiten Markt zu erzielen.
Die wichtigsten Faktoren sind Size (Titel mit niedrigerer Marktkapitalisierung), Value
(günstig bewertete Titel), Momentum (Titel mit zuletzt positiver Kursentwicklung), Qualität (Titel mit soliden Unternehmenserträgen) und Minimum Volatility (Titel mit niedriger Volatilität). Themenindizes, ebenfalls im Kommen, bilden – anders als Branchenindizes – ein Thema ab, das viele Branchen betrifft bzw. betreffen kann, etwa die demografische Entwicklung, die Digitalisierung oder Wasser. Jüngstes Baby der Branche sind Kryptowährungsindizes, Indizes also, die die Entwicklung mehrerer Kryptowährungen wiedergeben. Die großen Indexanbieter bieten solche Indizes bereits an (S&P) oder arbeiten daran (MSCI).
ESG-Indizes: Der große neue Entwicklungstrend
Der große Trend ist derzeit aber sicherlich die Entwicklung immer neuer Nachhaltigkeitsindizes. Nur ein Beispiel: Allein MSCI hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile über 1.500 Aktien- und Anleihenindizes im Angebot, die Anlegern helfen sollen, die Entwicklung von ESG-Anlagen (Environmental, Social, Governance) zu messen und zu vergleichen. Oft handelt es sich dabei um Nachhaltigkeitsversionen klassischer Indizes (etwa den S&P 500 ESG-Index), zum Teil aber auch um eigens konzipierte Indizes zur Abbildung nachhaltiger Titel. Der Markt hat sich schon stark ausdifferenziert (siehe Grafik links oben). SRI-Indizes (Socially Responsible Investment) basieren im Übrigen auf strengeren Nachhaltigkeitskriterien als ESG-Indizes.
„Kohlenstoffarme“ Benchmarks der EU –gegen Greenwashing
Das Vorgehen der Indexanbieter, zu traditionellen Indizes nachhaltige Pendants zu schaffen, birgt natürlich immer die Gefahr des Greenwashings oder zumindest das Risiko, dass Anleger unter der Nachhaltigkeit eines Index mehr verstehen und erwarten als der Indexanbieter selbst. Um dem vorzubeugen, entwickelt die EU eigene Nachhaltigkeitsbenchmarks. Diese sollen Kriterien für nachhaltige Indizes definieren, auf die sich Anleger verlassen können, wenn sie diese als Benchmarks ihren Portfolios zugrunde legen. Bislang sind im Rahmen des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums zwei neue Benchmarks entstanden und in Kraft getreten. Beide im Bereich Klimaschutz, der von der EU unter den verschiedenen Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als besonders dringlich gesehen wird: die
EU Climate Transition Benchmark (CTB)
und die – noch strengere – EU Paris-aligned Benchmark (PAB). Die Anforderungen: Die im Klimaindex EU PAB enthaltenen Unternehmen müssen mindestens 50% weniger CO2-Intensität im Vergleich zum investier-
EU-CO2 -Benchmarks im Vergleich
Reduzierung der CO2Intensität (versus investierbares Universum)
Übergangsphase für Scope 3-Emissionen*
EU Climate Transition Benchmark (CTB) EU Paris-aligned Benchmark (PAB)
–30 % –50 %
bis zu 4 Jahre bis zu 4 Jahre
Mindestausschlüsse – kontroverse Waffen – Verstöße gegen gesellschaftliche Normen – Tabak
Weitere Ausschlussgrößen/ Anforderungen – Sustainable Impact – Global Environment – Women’s Leadership – Erlöse aus Kohle > 1 % – Erlöse aus Ölförderung oder – Ölverarbeitung > 10 % – Erlöse aus Erdgasgewinnung oder -verarbeitung > 50 % – Erlöse aus Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität der Lebenszyklus-
Emissionen von mehr als 100 g CO2e/kWh** > 50 %
Quelle: EU-Kommission, Darstellung FFB *Scope 3 umfasst alle anderen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.
Also z. B. gekaufte Waren und Dienstleistungen, Geschäftsreisen, Pendler, Abfallentsorgung, Verwendung verkaufter
Produkte, Transport und Lieferung (Up- und Downstream), Investitionen, Leasingobjekte und Franchisenehmer. Aktuell besteht noch keine Pflicht, diese Emissionen zu reporten. Zudem sind sie auch zum Teil nur schwer messbar und müssen daher geschätzt werden. **CO2e/kWh = CO2 -Äquivalente je Kilowattstunde.
EU-Benchmarkverordnung
Als Konsequenz aus der Manipulation von Referenzsätzen wie LIBOR hat der EU-Gesetzgeber die Benchmarkverordnung geschaffen, die seit Anfang 2018 gilt. Sie bezieht sich auf Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden. Zum Beispiel müssen nun alle „Kontributoren“, also alle, die zu einem Referenzwert beitragen, stets ihre „Genauigkeit, Integrität, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit” für die Berechnung dieser Referenzwerte garantieren. Unternehmen, die einen Referenzsatz berechnen, müssen auch „Chinese Walls” – also organisatorische Trennungen – zwischen der Indexadministration und anderen Bereichen, mit denen es zu Interessenkonflikten kommen könnte, einrichten. Die Verordnung besagt auch, dass nicht jeder einen Index erstellen kann: Um als Administrator für einen Index oder Referenzwert tätig werden zu dürfen, ist die Zulassung bei der jeweiligen Finanzaufsichtsbehörde nötig. Das erhöht die Verlässlichkeit der Indizes für Anleger.
1 Burton-Taylor, Financial Times, 27. 05. 2021. 2 WirtschaftsWoche, 25. 06. 2018. 3 investrends.ch, 27. 08. 2021. 4 WFE/Weltbank (für 2019), Juli 2021. 5 msci.com, 30. 07. 2021. baren Universum aufweisen. Bei der EU CTB sind es 30% weniger. Beide schließen kontroverse Waffen, Verstöße gegen gesellschaftliche Normen und Tabak aus, die EU PAB zusätzlich Unternehmen, die in den Bereichen Kohle und – oberhalb gewisser Schwellenwerte – Erdöl, Erdgas sowie kohlenstoffintensiver Stromerzeugung tätig sind.
Viele Indexanbieter haben reagiert und auf der Grundlage dieser neuen Benchmarks bereits zahlreiche Indizes erstellt, MSCI etwa den MSCI World Climate Paris-aligned Benchmark Select Index.
Die CO2-Benchmarkverordnung regelt zudem Offenlegungspflichten für CO2-Benchmarks – ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Anleger.
Fazit: Was Indizes heute für die Kapitalanlage leisten
Für Anleger und Berater heißt das alles: Indizes sind nach wie vor gute Hilfsmittel, um Entwicklung von Märkten, Teilmärkten und Segmenten zu beobachten und zu vergleichen – und auch den eigenen Anlageerfolg zu messen. Aber es gilt, sorgfältig zu analysieren, was ein Index leistet und wo mögliche Schwachstellen sind, die beim Aufbau eines Portfolios oder bei der Auswahl von Fonds, die sich eine Indexbenchmark setzen, zu beachten sind.
Das sind die Bereiche, die besonderes Augenmerk erfordern:
Es macht einen großen Unterschied, ob es sich bei einem Index um einen Kurs- oder Performanceindex handelt und wie die Anteile im Index gewichtet sind. Vorsicht ist geboten, wenn (wie bei Fonds nicht selten) die Entwicklung mit einem Kursindex verglichen wird. Wer Ländermärkte wie den deutschen mit dem US-amerikanischen Markt vergleichen möchte, muss gleichartige Indizes wie den Kurs-DAX und den S&P 500 heranziehen.
Auch Ihre Kunden sollten die wichtigsten Indizes kennen! So ist der MSCI World etwa
kein Weltindex, sondern ein Industrieländerindex, der zudem noch sehr USA-lastig
ist (68%). Industrie- und Schwellenländermärkte bildet der MSCI AC World ab. Im MSCI Emerging Markets hat China einen großen Anteil (35%).5
Behalten Sie als Berater Gewichtungen der Titel im Index im Auge! So machen etwa die US-Technologiewerte Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla und Alphabet durch den starken Kursanstieg in den vergangenen Jahren im S&P 500 mittlerweile 23% aus.
Achten Sie auf neue Indexzusammensetzungen! Neben dem DAX mit seiner Erweiterung auf 40 Mitglieder im September 2021 ist auch der MSCI Emerging Markets ein Beispiel für große Veränderungen: Denn 2018 begann MSCI, chinesische Festlandaktien („A-Shares“) in den Index aufzunehmen. Die gelten als deutlich volatiler als in Hongkong („H-Shares“) oder im Ausland gelistete Aktien.


TBF SMART POWER



Investieren Sie nachhaltig und global in Aktien der Energieinfrastruktur.

Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im
Au au der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and
Distribution“) sowie in den Bereichen
„Power Management / LNG Infra-
structure“ und „Energy E ciency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte
Wertschöpfungskette der Energie-
infrastruktur bzw. - Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG-Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt.
ISIN
TBF SMART POWER EUR R DE000A0RHHC8 TBF SMART POWER EUR I DE000A2AQZX9
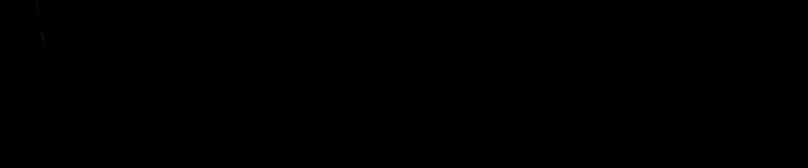
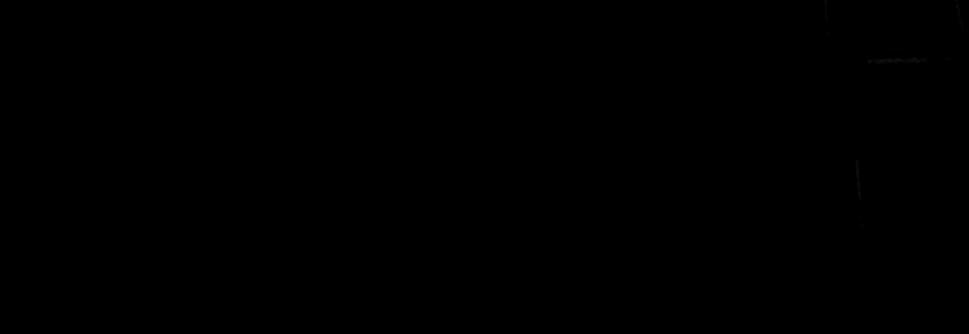


Der TBF SMART POWER wurde im November 2020 mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet. POWER FÜRS DEPOT!
ESG
investment process
Erfahren Sie mehr. +49 40 308 533 500
www.tbfsam.com

Disclaimer
© 2021 TBF Global Asset Management GmbH (für vorstehende Texte und Bilder). Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers [TBF Global Asset Management GmbH].












