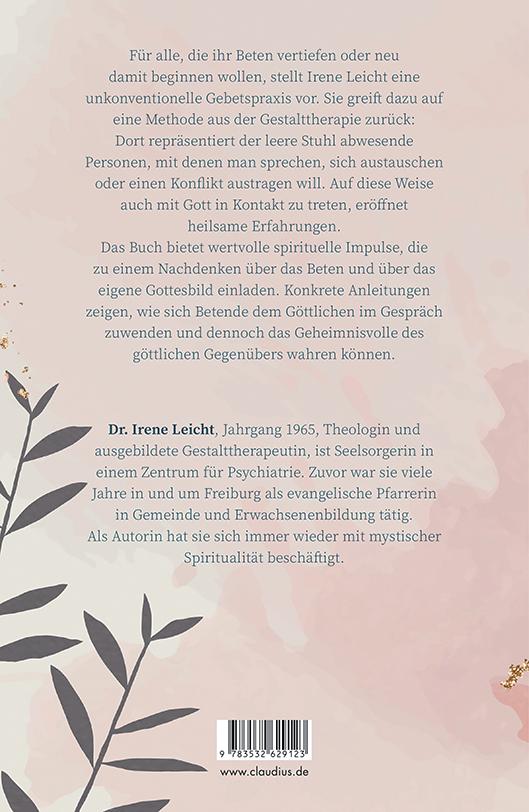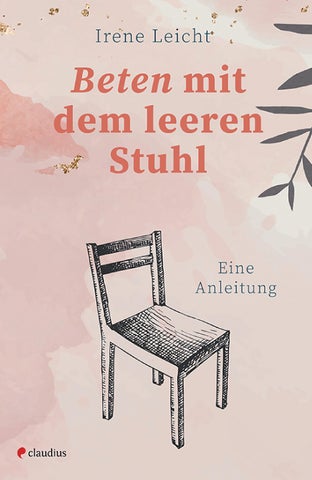Irene Leicht
Beten mit dem leeren Stuhl
Eine Anleitung
Zum Schutz der Umwelt verzichten wir bei diesem Buch auf das Einschweißen mit Folie.
© Claudius Verlag München 2025
Claudius Verlag im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. Birkerstraße 22, 80636 München www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an claudius@epv.de
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München unter Verwendung von Stuhl: © shilovegor/freepik.com; Hintergrund: © rawpixel.com7freepik.com
Lektorat: Stenger & Rode GbR, München
Gesetzt aus der Tinos
Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-532-62912-3
Mehr Bäume. Weniger CO2 www.cpibooks.de/klimaneutral
Einladung –mit Teresa von Ávila
Sie haben gerade ein Buch in die Hand genommen, dessen Titel Sie vielleicht neugierig gemacht hat. Mit einem leeren Stuhl beten? Das klingt vielleicht ein bisschen bizarr. Doch wenn Sie
● am Beten interessiert sind,
● Beten praktizieren oder vertiefen wollen,
● sich über einen neuen Impuls freuen,
● zu Experimenten bereit und
● für das Beten „im stillen Kämmerlein“ (vgl. Mt 6,6) offen sind –
dann könnte Ihnen dieses Buch vielleicht hilfreich werden. In diesen wenigen Zeilen habe ich schon dreimal das Wort „vielleicht“ benutzt. Und ich hätte es noch öfter verwenden können – eigentlich nach jedem Spiegelstrich. Das bringt mich auf die Idee, zunächst von mir zu erzählen. Denn dieses Buch enthält auch viel (Irene) Leicht. Sie können es vielleicht besser einordnen und die Inhalte nachvollziehen, wenn Sie ein wenig von mir erfahren, indem ich zusammentrage, was mich zu dieser Gebets-Idee geführt hat.
Katholisch getauft habe ich 1974 die sogenannte erste Heilige Kommunion empfangen. Daran habe ich Erinnerungen. Es hat mir viel bedeutet, auch der vorausgehende Unterricht. Ich hatte ein lebhaftes Interesse an biblischen Geschichten, insbesondere rund um Jesus, habe mich gerne an Kindergottesdiensten beteiligt und weiß auch noch, dass ich die mit der Erstkommunion verbundene Beichte als unangenehm empfand. Hier klingen schon einige Themen an, die mich
bis heute beschäftigen und die auch in diesem Buch vorkommen. Da wäre zum einen das Stichwort Kommunion als Ausdruck einer innigen Beziehung und Verbundenheit zwischen „Gott“1 und Mensch und in einer Gemeinschaft zu nennen. Zum anderen geht es um die Inhalte der christlichen Religion. Wer ist Jesus? Welche Bedeutung hat Christus für uns heute? Und dann das Thema Beichte: Angst, das Einreden von Schuldgefühlen, geistlich-kirchliche Macht, verbunden mit ihren Schatten – und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit, Entlastung und Erleichterung, nach dem Gefühl und der Gewissheit, angenommen zu sein und Vergebung zu erfahren.
Im Blick auf meine Kindheit sei an dieser Stelle noch die Freude am Singen erwähnt. In einer lebendigen evangelischen Singschule in meiner Geburtsstadt konnte sie sich entfalten. So war schon in Kindertagen der Boden bereitet für eine kleine Ökumene in mir. Diese ist inzwischen noch größer geworden. Das heißt, für die Gebetspraxis, die ich hier vorstelle, spielen die Zugehörigkeit zu einer Kirche, Konfession oder Religion keine oder kaum eine Rolle. Zudem steht das Singen für einen körperlichen oder ganzheitlichen Vollzug des Betens. Auch das ist wichtig für das vorliegende Gebetsverständnis.
Apropos Musik: Fragen der Religion haben mich schon sehr früh in existenzieller Weise umgetrieben und ich war ansprechbar. Mit anderen Worten: Vielleicht bin ich so etwas wie „religiös musikalisch“.2
Eine Schulfreundin hat mir neulich eine freche Spruchkarte zukommen lassen: „Im Leben ist es, wie damals in der Schule. Wenn’s nicht so gut läuft, versuchen alle mit Sport und Religion noch was zu retten!“ Bei mir war das so – notenmäßig war, neben Sport, Musik und Kunst definitiv Religion eine zumindest kleine Rettung in der Schule – und in einem übertragenen Sinn gilt es noch heute …
Zehn Jahre nach der Erstkommunion, also 1984, habe ich direkt nach dem Abitur begonnen, katholische Theologie und Latein zu studieren. Ich wollte Lehrerin werden. Inzwischen hatte ich bereits einen großen inneren Abstand zur römisch-katholischen Kirche. Sehr vieles hat mich an ihr gestört. Aber auch mein Glaube hatte sich verflüchtigt.
Das war in meiner Erinnerung eine unglückliche Zeit, vor allem innerlich. Irgendwie war mir die Freude am Leben und an den Mitmenschen abhandengekommen. Auch ins Theologiestudium habe ich nicht hineingefunden. Umso größer war die Erschütterung, als ich mich im Herbst 1986 „heilvoll“ verliebt habe. Eine solche Liebesbeziehung hatte ich nicht gesucht, jedenfalls nicht bewusst, und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass sich so etwas ereignen könnte. Dazu war vermutlich mein Misstrauen zu groß gewesen. Diese Erfahrung hat mir gleichsam den Stecker gezogen (obwohl ich keine Maschine bin, passt das Bild irgendwie). Noch heute würde ich sagen, dass dieser „Zu-Fall“ das größte Geschenk meines Lebens war. Verbunden war mit dieser Beziehung ein neuer Zugang zum Leben und zum Glauben, zum Theologiestudium und auch zur katholischen Kirche.
Mit der Spiritualität der Orden war ich bis dahin kaum in Berührung gekommen. Danach hatte ich zum Beispiel zwanzig Jahre lang eine enge Verbindung zu einem Karmel-Kloster, das von einer kontemplativ ausgerichteten Lebensform geprägt war. Auch damit verbundene Erfahrungen manifestieren sich in diesem Buch. Die Beziehung zu „Gott“ und den Menschen hängt aufs Innigste zusammen. Biblisch gesprochen geht es um die Einheit von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe (vgl. Lk 10,25–37). Jede menschliche Liebesbeziehung ist so etwas wie ein Unterpfand der Gottesliebe. Doch wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wie kompliziert sich Beziehungen gestalten können und wie unfertig wir in dieser Hinsicht sind. Meiner Erfahrung nach gibt es vielleicht so etwas wie ein sehr langsames Wachstum in der Liebe. Doch fast noch stärker ist mein Eindruck, dass wir täglich neu anzufangen haben. Aufgrund meiner Erfahrungen gehe ich davon aus, dass wir als Menschen beschenkt sind – mit dem Leben selbst. Dieses Geschenk anzunehmen, es zu öffnen, also es auszupacken und sich zu eigen zu machen: Dafür braucht es und dafür gibt es Hilfestellungen und Unterstützung. Durch andere Menschen, aber auch durch Bücher zum Beispiel. Für mich jedenfalls waren das die wichtigsten Begleiter*innen, neben der Musik. Das vorliegende Buch kann in diesem
Sinn vielleicht etwas beisteuern zu dieser großen Fülle, die es an Hilfsund Lebensmitteln gibt.
Dass mich mein Weg trotz der auch positiven Erfahrungen aus der römisch-katholischen Kirche hinausgeführt hat, war bitter und mit einer neuerlichen „Überraschung“ verbunden. Die fehlende Gendergerechtigkeit, die Abschottung gegenüber dem Pluralismus der (Post-)Moderne, die steilen Hierarchien und das priesterliche Amtsverständnis waren die hauptsächlichen Knackpunkte, die den Bruch vorbereiteten. Der kam dann plötzlich und wurde konkret ausgelöst durch die Lektüre von Dietrich Bonhoeffers Doktorarbeit „Communio sanctorum“. Schon wieder also Kommunion und Beziehung … 2004 wurde ich zur Pfarrerin in der Evangelischen Landeskirche in Baden ordiniert.
Viele Möglichkeiten und Freiheiten hat mir dieser Beruf geschenkt. In allen Feldern, in denen ich bislang tätig war, galt mein Interesse insbesondere auch der spirituellen Grundierung, das heißt, ich wollte Räume eröffnen für das Wirken der Heiligen Geistkraft und für ein geistliches Leben. Aus persönlichem Interesse, aber auch, um als Pfarrerin angemessener für andere Menschen da zu sein, habe ich nebenher therapeutische Qualifikationen erworben (vor allem in Gestalttherapie und Imaginationsbegleitung), die natürlich auch mit viel Selbsterfahrung verbunden waren.
Im Sommersemester 2024 konnte ich eine kleine Auszeit in Heidelberg nehmen. Diese nutzte ich, um mich auf die Aufgabe als Seelsorgerin in einem Zentrum für Psychiatrie vorzubereiten. Auch das Schreiben des Buches fiel hauptsächlich in diese Zeit. Inzwischen arbeite ich auf der neuen Stelle. Und bin dankbar dafür, dass die Klinik der Seelsorge Gastfreundschaft gewährt und die Kirche in diese Seelsorgearbeit investiert. Von allen Stellen, die ich als Pfarrerin innehatte, fühlt sich die aktuelle am stimmigsten an. Zu meiner persönlichen „Kirchen-Geschichte“ passt es, mit meinen Interessen an mystischer Spiritualität, seelsorglich-therapeutischen Themen und feministischer Theologie hier gelandet zu sein.
Von der Karmelitin Teresa von Ávila gibt es ein Gedicht, das mich schon lange begleitet. Es ist ein bisschen „ver-rückt“, denn es ist aus der göttlichen Perspektive verfasst. Wenn Sie es lesen, müssen Sie sich also vorstellen, „Gott“ selbst spricht zu Ihnen. Und zwar so:
Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet treu und klar; kein Maler lässt so wunderbar o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier: Bist du verirrt, bist du verloren, o Seele, suche dich in Mir.
In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt; sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier: Gedenk, was dich am tiefsten bindet, und, Seele, suche Mich in dir.
Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für; ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann ruf mich, und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen: Und, Seele, suche Mich in dir.3
Das Leitmotiv des Gedichtes „O Seele, suche dich in Mir, / und, Seele, suche Mich in dir“ bringt meine Überzeugung im Blick auf alle Menschen zum Ausdruck: Wir sind oder leben in „Gott“, und: „Gott“ ist oder lebt in uns. Und es wohnt ein Sehnen tief in uns, das uns immer wieder danach suchen lässt, diese Verbindung und wechselseitige „Einwohnung“ zu erfahren.
Von diesem Gedicht ausgehend ein paar Hinweise zu dem, was Sie in diesem Buch erwartet:
● Das erste Kapitel widmet sich grundlegenden Fragen: Wie können wir uns eine solche Beziehung zwischen Gott und Mensch vorstellen? Inwieweit haben im Blick auf diese Beziehung Psychotherapie und mystische Spiritualität miteinander zu tun? Und was ist unter „Seele“ zu verstehen?
● Teresa war eine Lehrerin des Betens. Unermüdlich hat sie zu vermitteln versucht, wie wir innerlich beten können. Einmal äußert sie: „Denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.“4 Wer ist dieser Freund, von dem Teresa spricht? Ihr Gesamtwerk macht deutlich, dass es „Gott“ ist, wie er sich in Jesus, dem Christus, mitgeteilt hat. Wie lässt sich heute von diesem Freund sprechen? Diese Fragen stehen im Zentrum des zweiten
Kapitels.
● Und dann: Was ist Beten? Was ist inneres Beten in Anknüpfung an Teresa? Vom Beten als Ausdruck einer zweiten Naivität handelt das dritte Kapitel.
● In dem Karmel-Kloster, in dem ich über einen so langen Zeitraum hinweg regelmäßige Retreats verbracht hatte, habe ich die erste Gebetserfahrung mit dem leeren Stuhl gemacht. Ich stand kurz vor dem Beginn der gestalttherapeutischen Ausbildung und hatte eine rudimentäre Kenntnis vom leeren Stuhl als spezifisch gestalttherapeutischer Technik. Während einer Meditationszeit bin ich dem spontanen Impuls gefolgt, mein Meditationsbänkchen zu verlassen
und in einem gewissen Abstand davon auf einem Meditationskissen Platz zu nehmen, um aus dieser Perspektive auf das leer gewordene Bänkchen „zu schauen“. Die Erfahrungen, die ich dabei machte, waren sehr eindrücklich. Sie wurden zur Initialzündung für das, was ich im vierten Kapitel reflektiere.
● Im fünften Kapitel schließlich stelle ich Ihnen diese Gebetsmöglichkeit konkret vor. Öfters schon habe ich dazu in Meditationsgruppen angeleitet. Vielleicht lassen Sie sich ansprechen und probieren diese Praxis dann selbst aus.
Schon wieder „vielleicht“. Ein wenig haben Sie jetzt von meinen persönlichen Prägungen erfahren, die zu diesem Buch geführt haben. Ich bin in meinem Leben schon öfters geschockt oder überrascht worden und habe das als bereichernd erlebt. Das will ich mit Ihnen teilen.
Das Wörtchen „vielleicht“ mit meinem Nachnamen in Verbindung zu bringen ist Spielerei. Wichtig ist es mir aus einem anderen Grund. „Vielleicht ist irgendwo Tag …“: So lautet der Titel des Tagebuchs von Friedolin Stier, einem (theologisch) hochgebildeten und sehr angefochtenen Menschen. Hier kommt Hoffnung zum Ausdruck in den Nächten des Lebens, doch alles bleibt in der Schwebe. Welche Kraft in dem Wörtchen „vielleicht“ steckt, illustriert zudem eine chassidische Geschichte, die Martin Buber erzählt.
Ein gelehrter aufgeklärter Mann möchte einen Rabbi der Rückständigkeit seines Glaubens überführen. Der Rabbi äußert ziemlich erregt – sein Ringen ist an seiner Mimik und Gestik abzulesen: „Vielleicht ist es aber wahr.“ Martin Buber fährt fort: „Der Aufklärer bot seine innerste Kraft zur Entgegnung auf; aber dieses furchtbare ‚Vielleicht‘, das ihm da Mal ums Mal entgegenklang, brach seinen Widerstand.“5
Das Fragliche, das Unsichere, der Realismus, die Leidenschaft, die Hoffnung, die in „vielleicht“ mitschwingen: Das gefällt mir. Eigentlich
könnte ich ständig „vielleicht“ sagen und schreiben, weil ich keine Versprechungen machen kann und weil ich so gut wie nichts sicher weiß. Und doch: Viel Leichtes zusammen ergibt hoffentlich auch etwas von Gewicht. Das soll „erwogen“ werden. Zu diesem gemeinsamen Erund Abwägen von „viel Leichtem“ und dann vor allem auch zum Beten mit dem leeren Stuhl möchte ich Sie verlocken. Vielleicht nehmen Sie die Einladung an. Vielleicht werden Sie inspiriert. Das wäre schön!
1 Eine kleine Psychologie und Mystiklehre
Obwohl ich weder Philosophin noch Psychologin bin und obwohl auch das Theologiestudium schon Jahrzehnte zurückliegt, wage ich in diesem ersten Kapitel sehr grundsätzliche Fragen zu stellen. Das fällt mir nicht leicht. Besuche der Uni-Bibliothek in Heidelberg erlebe ich als beinahe schwindelerregend. Sie führen mir „buchstäblich“ vor Augen, was ich alles nicht gelesen habe und was ich alles nicht weiß. Es wirkt bisweilen zufällig, was ich entdecke, aufschnappe, ausleihe, mir lesend aneigne. Entsprechend zufällig ist, was ich in diesem Buch zitiere und was eben nicht vorkommt, obwohl es höchstwahrscheinlich auch eine Erwägung, Erwähnung und Würdigung wert wäre.
In gewisser Weise illustrieren diese Sätze bereits, worum es zunächst geht. Vielleicht denkt die eine oder der andere: Die Autorin will sich absichern. Oder sie kokettiert. Beides kann und will ich nicht ausschließen. Doch in den Sätzen kommen auch mein Perfektionismus, die Angst, nicht zu genügen, die Überzeugung, nicht gescheit genug zu sein, zum Ausdruck. Sie stehen für meine eigene Therapiebedürftigkeit. Und ich habe den Eindruck: Diese wird mir bis ans Lebensende erhalten bleiben. Mit zunehmendem Alter nehme ich sie sogar schärfer wahr. Ich versuche damit leben zu lernen und möglichst kreativ damit umzugehen.
Dass ich mich traue zu schreiben und mich auf diese Weise mitzuteilen, kann auch als ein entsprechender Versuch gelesen werden. Diesen unternehme ich, weil ich „irgendwie“ vernommen habe, dass es stimmig und gerade meine Aufgabe ist. Und weil mich andere
Menschen dazu ermutigt haben. Selbst wenn ich scheitere, selbst wenn es nicht gelingt: Ich kann dieses Risiko eingehen, weil die Würde und der Wert meines Lebens nicht davon abhängen. Wie sich riskieren mit der Angst im Nacken? Um Vertrauen in meine unveräußerliche Würde und „Berufung“ unabhängig von den Bewertungen anderer ringe ich.
Dieses Ringen: Es findet in dem Ausdruck, was ich mystische Spiritualität nenne.
Im Folgenden will ich die Gedanken zum In-, Mit- und Nebeneinander von Therapiebedürftigkeit und mystischer Spiritualität weiterführen. Ich gehe davon aus, dass ich mit meinen Erfahrungen, den Selbstzweifeln, dem Leistungsdruck, den Minderwertigkeitskomplexen, dem Größenwahn, den erlebten und verinnerlichten Abwertungen und Kränkungen nicht allein bin. Daran schließen grundsätzliche Fragen an: Wer sind wir als Menschen? Wie kommen wir in Kontakt? Was stört einen guten Kontakt? Und was hat das mit Spiritualität zu tun? Es geht um unsere Würde und die Frage, wie wir sie leben und entfalten können.
Von Heiligung und Heilung
„Die Erzählungen der Chassidim“ enthalten eine Geschichte, die den Zusammenhang von Heilung und Heiligung veranschaulicht. Ich gebe sie hier in zwei Teilen wieder und kommentiere sie jeweils im Anschluss:
Einer fragte einst den Rabbi Schmelke: „Es steht geschrieben: ‚Werdet heilig, denn heilig bin ich, der Herr, Euer Gott. Jedermann soll seine Mutter und seinen Vater fürchten.‘
Wie kann das Lehmgebild, in dem die bösen Lüste wohnen, eine Eigenschaft Gottes zu erwerben streben? Und wie schließt sich das Gebot, Vater und Mutter zu fürchten, das dem Menschen Menschliches befiehlt, an den Ruf zum Überirdischen?“
Die zwei Fragen an den Rabbi basieren auf zwei „Ermutigungen“ der hebräischen Bibel, die im Buch Levitikus (Kap. 19, Verse 2 und 3) merkwürdigerweise direkt hintereinanderstehen: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Ewige, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater.“
Der Rede vom Menschen als „Lehmgebild, in dem die bösen Lüste wohnen“ könnte eine Kombination aus zwei Bibelstellen zugrunde liegen: Der Mensch ist „aus Erde vom Acker“ genommen (vgl. Gen 2,7), also ein Gebilde aus Lehm, sowie: „das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf“ (Gen 8,21). Diese drastische Auffassung vom Menschen mag zunächst irritieren, zumal uns die Sprache fremd ist. Wir finden eine solche Sicht auf den Menschen nicht nur in der Bibel, sondern zum Beispiel auch bei Sigmund Freud, der den Menschen als triebgesteuertes, zerrissenes Wesen betrachtet. Und schon zuvor konstatierte Immanuel Kant im Menschen einen „Hang zum Bösen“. Der damit verbundene Realismus scheint
mir wichtig und hilfreich – solange nicht davon ausgegangen wird, dass der Mensch in seinem Wesen böse ist. Eine solche Auffassung wäre ein krasser Widerspruch zum „es war sehr gut“ (Gen 1,31) des Schöpfungsgedichts. Und damit wäre auch kaum die – wie es eine Psychiatriepatientin einmal ausgedrückt hat – „unfassbare“ Würde des Menschen zu vermitteln. Der Mensch ist vielmehr zur Heiligkeit berufen. Dies ergibt sich aus der Fortführung der Schöpfungserzählung, wo dem Gebilde aus Ackerboden, dem Lehmgebild, der „Odem des Lebens in seine Nase“ geblasen und es so zu einem lebendigen Wesen wurde (vgl. Gen 2,7), das durch den Lebensatem am Göttlichen selbst Anteil hat.
Zurück zu den Fragen der chassidischen Erzählung: Warum stehen die beiden „Ermutigungen“ hintereinander und wie lassen sich die inhaltlichen Spannungen oder gar Widersprüche auflösen? Hier die Antwort – bzw. der zweite Teil der Geschichte:
Der Rabbi sprach: „Dreie schaffen, dem Wort unserer Weisen nach, an jedem Menschenkind: Gott, Vater und Mutter. Gottes Teil ist ganz heilig; die anderen können geheiligt und ihm angeglichen werden. Das meint das Gebot: Ihr seid heilig und sollt doch erst heilig werden; so müsst ihr das Vater- und Muttererbe in euch scheuen, das der Heiligung widerstrebt, und ihm nicht verfallen, sondern sein Herr und Bildner werden.“6
Diese Antwort des Rabbi liefert eine Steilvorlage, um das Verhältnis von Psychotherapie und mystischer Spiritualität zu beschreiben. „Vater und Mutter“ stehen in meinen Augen für das biologische und genetische, das familiäre und psycho-soziale Erbe, das alle Menschen mitbekommen haben. Dieses Erbe gilt es zu adaptieren, es dem Heiligen, dem Göttlichen anzugleichen. Dieses Erbe kann gut sein und das Heilig-Werden fördern. Es kann der Heiligung aber auch widerstreben. Dann sollte es „gescheut“ werden. Dann sollten wir ihm nicht „verfallen“.
Das meint in meinen Augen: Kein Mensch auf dieser Erde wurde von „Vater und Mutter“ vollständig und bedingungslos geliebt. Wir alle sind hineingeboren in eine Welt, die uns nicht nur bejahend und freundlich entgegenkommt. Wir alle haben Schäden davongetragen, durch zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit zum Beispiel. Und wir alle wissen um den oft mit Angst verbundenen Schrecken des Todes. Insofern uns das an unserer Würde zweifeln und uns destruktiv werden lässt, insofern es verhindert, dass wir „heilig“ und „ganz“ werden,7 gilt es, Abstand zu diesem Erbe zu gewinnen.
Eine Psychotherapie kann helfen, dieses (verinnerlichte) Erbe zu entdecken und damit umgehen zu lernen. Im besten Fall kann es „geheilt“ oder, vielleicht besser, integriert werden. Ärzt*innen und Therapeut*innen unterstützen dabei. Die Ziele einer Psychotherapie können unterschiedlich beschrieben werden. Wieder mit Freud gesprochen ist es zum Beispiel der innerlich souveräne Mensch, der als „Herr im eigenen Haus“ zu lieben und zu arbeiten vermag. Freuds patriarchal geprägte Sprach- und Bilderwelt sowie diejenige der chassidischen Geschichte und mancher Bibelpassagen und -übersetzungen gehören meiner Meinung nach im Übrigen auch zu dem Erbe, das es zu scheuen gilt, weil es der „Heiligkeit“ widerspricht und der Heiligung im Weg stehen kann. Mit der Geschichte gehe ich also davon aus, dass wir Menschen in einem existenziellen Sinn therapiebedürftig sind und es bis ans Lebensende bleiben. Nicht zufällig handeln auch viele Geschichten rund um Jesus von Heilung.
An dieser Stelle zwei subjektive „Eindrücke“: Zum einen erlebe ich in den Kirchen und in der Gesellschaft bisweilen immer noch eine Tabuisierung psychischer Erkrankungen. Manche empfinden es als persönliches Versagen, erkrankt zu sein. Meines Erachtens könnte es zur Humanisierung beitragen, wenn wir einen ehrlicheren Zugang zu unseren Ängsten, Verletzungen und Beeinträchtigungen finden und unsere diesbezügliche Heilungsbedürftigkeit eingestehen würden (ohne dabei an unpassenden Stellen „Seelenstriptease“ zu betreiben).
Zum anderen begegnet mir in den Kirchen und Religionen sowie in Teilen der Gesellschaft öfters eine meiner Meinung nach fatale Familienideologie, die den „Abschied von den Eltern“ (Peter Weiss) eher erschwert. Dabei finden sich in der Bibel viele familienkritische Passagen, die darauf hindeuten, dass ein Erwachsenenleben diese Loslösung voraussetzt.8 Je mächtiger das familiäre Erbe erlebt und je mehr es idealisiert wird, desto weniger kann es im Sinne der chassidischen Geschichte „gescheut“ werden, selbst wenn es die Heiligung behindert.
Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun macht sich für eine „kleine Psychologie“ stark und meint damit, dass Grundkenntnisse im Blick auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen, zwischenmenschliche Mechanismen wie Projektion und Übertragung sowie ein Wissen um die eigene innere Pluralität und Widersprüchlichkeit möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden sollten.9 Eine solche „kleine Psychologie“ wird sich auch in diesem Buch finden. Denn zum einen ist es so, dass das Beten mit dem leeren Stuhl vielleicht umso eher heilsame Erfahrungen zeitigen kann, je weiter die Auseinandersetzung und Versöhnung mit dem „Mutter- und Vatererbe“ fortgeschritten ist. Und zum anderen scheint es mir notwendig, sich der eigenen Therapiebedürftigkeit bewusst zu bleiben und damit leben zu lernen – um nicht abzuheben, um nicht einem Perfektionsdruck zu erliegen, um mitmenschlich, mitfühlend und realistisch zu sein.
Das hauptsächliche Interesse des Buches gilt der Vermittlung einer mystischen Spiritualität. Ich bin davon überzeugt, dass in uns allen eine „mystische Empfindlichkeit“ steckt, wie Dorothee Sölle es ausdrückt.10 Wir sind „Gottes“ bedürftig und „Gottes“ fähig – beides gehört zusammen.11 Die chassidische Geschichte sagt: „Ihr seid heilig und sollt doch erst heilig werden.“ Am Anfang steht also eine Zusage. Darauf folgt eine Ermächtigung. Es kann schon hier und jetzt die Erfahrung geben, dass das Heilige, mit den Worten der Geschichte, an uns schafft oder in und an uns wirkt, dass wir also spürbar Anteil haben am Prozess der Heiligung, an der Fülle, der Heiligkeit oder dem
Licht, die aus der Ewigkeit in unser Leben hineinspielen. Mystische Spiritualität bezieht sich darauf. Das Beten mit dem leeren Stuhl kann helfen, sich dieser Wirklichkeit auszusetzen und mit ihr in Kontakt zu kommen.
Im Duktus der chassidischen Erzählung gilt es also gleichsam zwei Welten zu verbinden: Heilung und Heiligung, Göttliches und Menschliches, Himmlisches und Irdisches, auch Psychotherapie und Seelsorge. Sensibel sein für die eigene existenzielle Therapiebedürftigkeit und gleichzeitig aus der Verbindung mit dem Göttlichen leben: Darum geht es. Die Selbstmitteilung des Göttlichen in dem Menschen Jesus von Nazareth steht im Zentrum der christlichen Religion. Insofern darf ihr nichts Menschliches fremd sein.12 Und um das Menschliche geht es in der sogenannten humanistischen Psychologie. Die Gestalttherapie ist ein Teil von ihr. Meine „kleine Psychologie“ wird sich vor allem auf sie beziehen. Sie bereichert, differenziert und erdet mystische Spiritualität. Im Grunde ist es einfach und in der Praxis manchmal doch so schwer und herausfordernd: Wir leben in dieser Welt – mit allem, was an Schönem, Mittelmäßigem und Schrecklichen dazugehört – und ahnen zugleich, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass wir noch woanders hingehören. Das Leben, das daraus erwächst, ist komplex, spannungsreich und dynamisch. Es bleibt beweglich. Beweglichkeit braucht es, um auf dem Weg zu bleiben, dem eigenen Weg, der gebahnt, begleitet und inspiriert werden kann von einer Energie, die von Jesus, dem Christus, kommt bzw. von welcher dieser selbst auch bewegt war – er, von dem es heißt, er sei „der Weg“ (vgl. Joh 14,6).