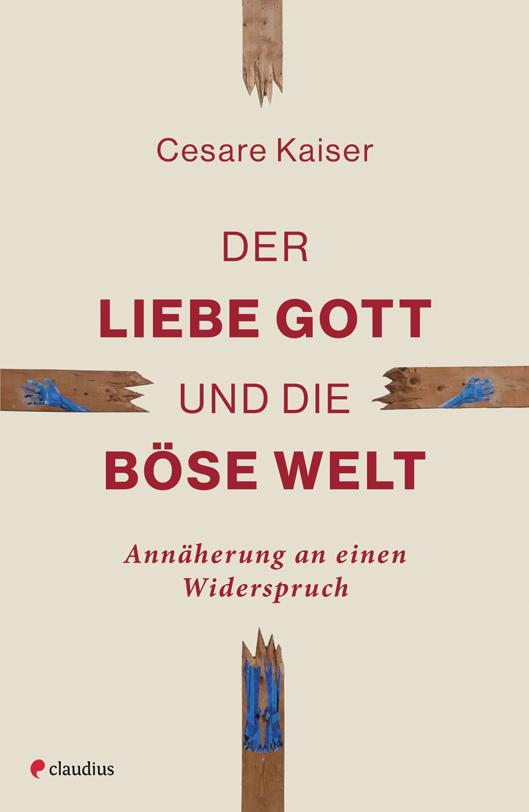
Der liebe Gott und die böse Welt
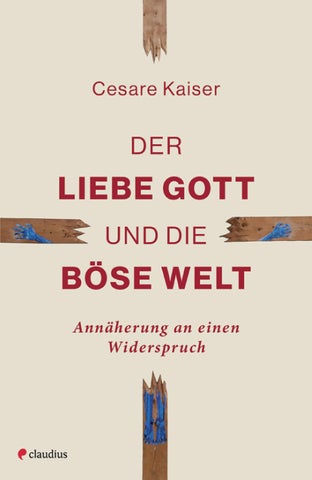
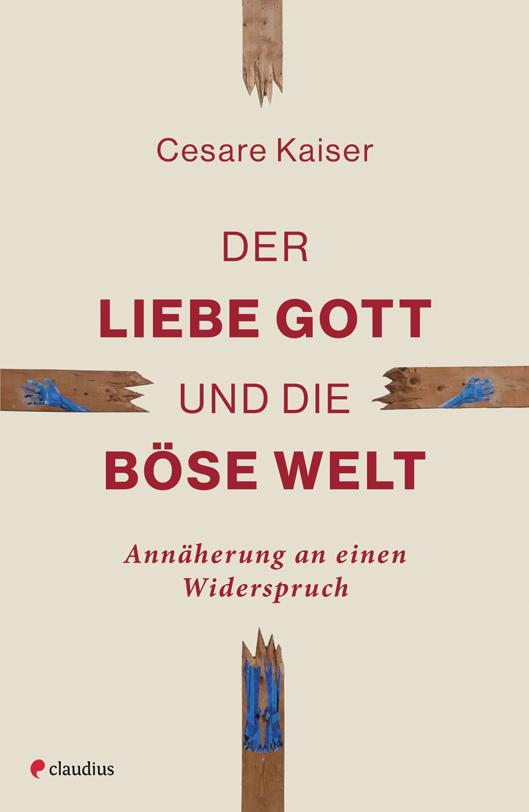
Der liebe Gott und die böse Welt
Annäherung an einen Widerspruch
www.cpibooks.de/klimaneutral
© Claudius Verlag München 2025
Claudius Verlag im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V.
Birkerstraße 22, 80636 München
Tel. 089/12172-119 www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an claudius@epv.de
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München unter Verwendung von Motiven aus dem Bild „Verlust der Mitte“ von Cesare Kaiser
Seite 128: Cesare Kaiser, Verlust der Mitte / Kreuz in der Christuskirche Bayreuth / Foto: Christian Böhm, Bayreuth
Lektorat: Stenger & Rode GbR, München
Gesetzt aus der Quinn Text und Neue Haas Grotesk Display Pro Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-532-62909-3
Einleitung: Eine große Frage
Über die Frage, wie der gute Gott und die böse Welt zusammengehören, haben sich schon viele Menschen Gedanken gemacht. Es gibt für dieses Problem sogar ein eigenes Fremdwort: „Theodizee“. Das ist Griechisch und bedeutet „die Gerechtigkeit Gottes“. Auch wenn die Frage nach dem gerechten Gott schon intensiv gestellt wurde, ist bis jetzt keine eindeutige Antwort gefunden worden.
Das wird auch mit folgendem Buch so bleiben müssen, da ich mir nicht anmaße, Gott vollständig begreifen zu können.
Dennoch versuche ich, der Frage möglichst nahe zu kommen, indem ich vorhandene Antworten miteinander vergleiche und auswerte. Dabei bin ich weiter gekommen, als erwartet. Den (Ent-)Schluss am Ende muss aber jeder für sich selbst ziehen. Auf jeden Fall kann es dann gelingen:
Dem Theodizeeproblem endgültig gelöst entgegenzusehen!
Wenn ich oft von „Gott“ rede, meine ich kein männliches Wesen, im Gegensatz zur weiblichen „Göttin“. Mir ist bewusst, dass das Fehlen einer geschlechtsneutralen Bezeichnung wirklich ein Verlust ist, da ich damit männliche Assoziationen wecke. Das ist ausdrücklich nicht gewünscht, zumal der mir bekannte Gott eine Beziehung wie „Vater“ und „Mutter“ anstrebt. Die Formulierung „Das Göttliche“ ist mir aber zu unpersönlich und daher keine Alternative – in dieser Beziehung bleibt Gott hier „Gott“, ohne männlich zu sein!
Wie viel Gott darf es denn sein?
Ohne Gott gibt es keine Fragen
Im Folgenden möchte ich verschiedene Gottesvorstellungen besprechen. Ob kein Gott, vielleicht irgendetwas Göttliches, viele Götter oder ein einziger Gott für uns wichtig sein kann, wird hier – auch im Zusammenhang mit der Frage nach Gerechtigkeit – diskutiert werden.
Die Frage nach einer höheren Gerechtigkeit können am einfachsten die Menschen beantworten, die für sich zu dem Schluss gekommen sind, dass es so etwas wie Gott nicht gibt. Das muss aber auch wirklich ein „Schluss“ sein. Wer die Frage offenhalten will, wird auch die Gerechtigkeitsfrage behalten müssen!
Ohne ein wie auch immer geartetes Gegenüber ist die Frage beendet, weil es nichts und niemanden gibt, dem man diese Frage stellen könnte. Fraglos können wir dann unsere Lebensenergie auf uns selbst konzentrieren. Es kann sein, dass wir dann etwas einsamer durch die Welt ziehen, aber eben auch befreit vom Ballast der anderen.
Für alle, die die Sache mit Gott endgültig erledigt haben, bietet dieses Buch nun nur noch theoretische Gedankenspiele ohne direkten praktischen Nutzen an. Dennoch sind auch diese Leser*innen herzlich eingeladen dabeizubleiben. Vielleicht taucht ja doch noch „etwas“ Interessantes auf.
Genaues weiß man nicht
Die meisten Menschen haben sich aber nicht zu dem Entschluss einer angenommenen „Gottlosigkeit“ durchgerungen. Sondern sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es über Gott und göttliche Dinge nichts zu sagen gibt. Diese sogenannten Agnostiker sind der Meinung, da man über Gott nichts Sicheres wissen könne, solle man über ihn lieber schweigen.
Vielleicht wird der Gang durchs Leben dann freier, vielleicht auch nur einsamer. Es kann natürlich jederzeit passieren, dass man den Eindruck bekommt, „da oben“ doch etwas erkennen oder auch nur erahnen zu können.
Schuld auf vielen Schultern
Ebenfalls etwas leichter hat es eine Vorstellung, die etwas aus der Mode gekommen ist: Denn wer sagt, dass es nur einen Gott geben muss?
Die zahlreichen Mitglieder der griechischen und römischen Götterfamilien unter ihren Chefs Zeus und Jupiter sind heute wieder vielen vertraut. Die Fantasy-Welle in Büchern und Filmen hat sie wieder neu ins Bewusstsein gebracht. Es ist einfach spannender, wenn mehrere Helden miteinander agieren, als wenn ein Oberchef alleine handelt. Das ist im Buch und Film genau das Gleiche wie auch im richtigen Leben.
Es gibt aber noch viele andere Religionen, in denen sich ganze Scharen von Gottheiten tummeln. Anhänger von mehreren Gottheiten haben bei der Frage nach der Gerechtigkeit keine größeren Probleme: Wenn ein erwünschter Erfolg bei einer göttlichen Intervention nicht eingetroffen ist, hat man sich eben an die falsche Gottheit gewandt. Entweder war eine
andere Gottheit zuständig oder es gab mächtigere Gegenspieler. Vielleicht hat sogar ein innergöttlicher Machtkampf dazu geführt, dass die menschlichen Wünsche unberücksichtigt blieben. Auf jeden Fall sind dann „die da oben“ schuld und wir sind aus der Verantwortung.
Aber wir müssen dabei nicht unbedingt, zur Untätigkeit verurteilt, den Göttern nur noch zuschauen! Es kann sogar sein, dass bei mehreren Göttern unsere Einflussmöglichkeiten zunehmen. Denn wir rücken zwar angesichts einer Götterhierarchie noch weiter nach hinten in der Liste der Einflussreichen. Aber die oft verwirrenden Einfluss- und Machtkonstellationen machen es auch einfacher, hier einzelne Götter gegeneinander auszuspielen.
Wir haben schon festgestellt, dass wir uns in der Regel besser fühlen, wenn wir einen Schuldigen, eine Schuldige gefunden haben. Es ist aber fast noch angenehmer, wenn wir eine ganze Anzahl von Schuldigen finden können. Ein Reich der Götter muss darum den Bereich der Menschen nicht verkleinern.
Vom Gerechtigkeitsgedanken her ist die Rückkehr zur Göttervielfalt, zum so genannten Polytheismus, gar nicht so abwegig. Wenn das Problem der Gerechtigkeit auf mehrere Schultern verteilt wird, ist es auf jeden Fall oft leichter zu ertragen!
Göttliche Wasserschlachten bis zur Erschöpfung
Das Judentum und damit auch das daraus hervorgehende Christentum hat es sich bei der Gerechtigkeitsfrage zunehmend schwerer gemacht: Es ist allmählich zu der Erkenntnis gekommen, dass es nur einen Gott gibt.
In der Anfangszeit berichtet das Alte Testament durchaus noch von göttlichen Wettbewerben, durch die herausgefunden
werden sollte, welcher Gott der Stärkste ist. Im ersten Buch der Könige in der Bibel zeigt sich sehr schön, wie zur Zeit des Alten Testaments mit der Frage nach Gott und den Göttern umgegangen wurde. Die Frage nach der Macht des eigenen Gottes stand im Vordergrund. Da es (noch) Mitkonkurrenten gab, stellte sich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes (noch) nicht. Diesen Zwischenschritt von vielen Göttern zu einem Gott möchte ich nicht vorenthalten. Er ist ein zugleich plastisches wie drastisches Zeitdokument.
Im achtzehnten Kapitel des ersten biblischen Buches der Könige (Verse 22 bis 39) fordert Elia, der Prophet Israels, die gegnerischen Priester zu einem Wettopfer auf. Es soll jeweils ein Stier über Holz gegrillt werden, allerdings ohne Zündfunken!
Der Gegner darf anfangen. Er ruft seine Götter an, das Opfer anzunehmen und mit Feuer zu verschlingen. Dem Gegner gelingt es aber nicht, das Feuer in Schwung zu bringen. Selbst großer körperlicher Einsatz bis hin zur Selbstverletzung führt nicht zum Ziel.
Nach dem Ablauf der Zeitvorgabe baut nun Elia seinen Grillplatz auf. Und obwohl er noch zwölf Eimer Wasser über alles kippt, kommt ein himmlisches Feuer. Elias Holz fängt an zu brennen und sein Stier an zu brutzeln.
Damals war es anscheinend noch einfach, festzustellen, welcher Gott hier mehr Feuer hat! Wer mag, kann in der Bibel auch nachlesen, wie nach damaligen Vorstellungen anschließend mörderische Gerechtigkeit hergestellt wurde. Obwohl die größere Zahl der Götter bessere Voraussetzungen für eine zufriedenstellende Antwort gab, ging die Entwicklung aber in die
andere Richtung: Im Laufe der Zeit kam Israel zu der Erkenntnis, dass man nicht nur den stärksten, sondern auch den einzigen Gott an seiner Seite hat. Dementsprechend ging man dann auch davon aus, dass sich im Laufe der Jahre die ganze Welt ihrem Gott anschließen werde.
Die Schöpfungsgeschichte steht zwar am Anfang der Bibel, zeigt aber eine relativ späte Erkenntnis, dass nämlich der eigene Gott der Einzige ist und damit auch die Entstehung der Welt verantwortet habe. Eine Besonderheit dieser biblischen Schöpfungsgeschichte ist, dass die Einzigartigkeit des eigenen Gottes schon beim Weltbau deutlich wird. Es gibt in der Weltgeschichte andere Anfangserzählungen, bei denen die Götter oder Gott aus vorhandenem Material unsere Welt basteln. Selbst besiegte Kollegengötter konnten hier zu Baumaterial werden. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Alleinstellungsmerkmal, dass laut Altem Testament unsere Erde ohne Bastelmaterial gebaut wurde. Dieser Gott hat die Welt aus dem Nichts fabriziert. Bei einem Gott, der der Einzige ist, reicht ein Wort, damit etwas entstehen kann (1. Mose, 1). Göttliche Wortgewalt schlägt alles andere!
