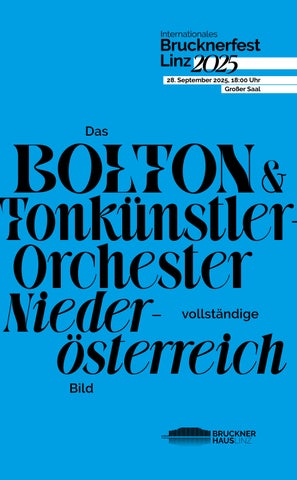28. September 2025, 18:00 Uhr Großer Saal
BOLTON & TonkünstlerO rchester Niederösterreich
vollständige
Klänge sehen – Bilder hören
Do, 2. Okt 2025, 19:30
I Salonisti – Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Das Schweizer Klavierquintett I Salonisti begleitet ein Pionierstück der Filmgeschichte: Lotte Reinigers Die Abenteuer des Prinzen Achmed feierte 1926 als einer der ersten abendfüllenden Trickfilm Premiere.
Mo, 6. Okt 2025, 19:30
Matan Porat Buster Keatons The General
Der Pianist und Komponist Matan Porat improvisiert die Begleitmusik zu Buster Keatons legendärer Stummfilmkomödie The General
Di, 7. Okt 2025, 19:30
Grams, Murray, KannehMasons & Chineke! Orchestra
Das einzigartige Chineke! Orchestra bringt William Levi Dawsons Negro Folk Symphony und Ludwig van Beethovens ›Tripelkonzert‹ mit drei fulminanten Solist:innen auf die Bühne.
Sa, 11. Okt 2025, 19:30 Stiftsbasilika St. Florian
Weikert & Bruckner Orchester Linz
Beim festlichen Abschlusskonzert stehen neben Leopold Stokowskis Bach-Transkriptionen für Orchester das Adagio aus Anton Bruckners 7. Symphonie und Paul Hindemiths Mathis der Maler auf dem Programm.
brucknerfest.at
Das Programm auf einen Blick
Für die Fertigstellung seiner 9. Symphonie d-Moll schloss Anton Bruckner Zeitgenoss:innen zufolge mit niemand Geringerem als »dem lieben Gott« einen Vertrag. Als »Preislied Gottes« widmete er ihm die Komposition in der Hoffnung, er würde ihm die Kraft bis zur Vollendung schenken. Doch es kam anders: Bruckner starb 1896, seine letzte Symphonie blieb ein dreisätziges Fragment. Trotz allem sind vom ausstehenden Finale umfangreiche Partiturentwürfe und Skizzen erhalten. Komplizierter wurde es, da Bruckners Sterbezimmer nicht rechtzeitig versiegelt worden war und Andenkenjäger:innen sich gierig auf seine Manuskripte stürzten. Seitdem inspiriert das Bedürfnis nach dem ›vollständigen Bild‹ einer vollendeten 9. Symphonie zahlreiche Versuche der Komplettierung.
Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich stellen sich der Herausforderung, Bruckners ›Bild‹ mithilfe der von Nicola Samale, Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips und BenjaminGunnar Cohrs in jahrzehntelanger Arbeit vollendeten Rekonstruktion in voller Farbenpracht zum Klingen zu bringen.
PROGRAMMBesetzung &
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Ivor Bolton Dirigent
Anton Bruckner 1824–1896
Symphonie Nr. 9 d-Moll WAB 109 // 1887–94
I Feierlich, misterioso
II Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell
III Adagio. Langsam, feierlich
IV Finale. Misterioso, nicht schnell
Viersätzige Fassung mit der Vervollständigung des Finales von Nicola Samale, Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips und Benjamin-Gunnar Cohrs (Fassung 2012, 2021–22 revidiert von John A. Phillips)
Konzertende: ca. 19:30 Uhr
Das vollständige Bild
Anton Bruckner // Symphonie Nr. 9 d-Moll
Mittwoch, 7. Oktober 1896: Der 72-jährige Anton Bruckner bringt in seiner Wohnung im Kustodentrakt des Oberen Belvedere in Wien, wo er dank der Zuwendung von Kaiser Franz Joseph I. seit gut einem Jahr ohne Kosten wohnen darf, mit zittriger Hand einige Zeilen an seinen
Bruder Ignaz zu Papier:

»Liebster Bruder [...]!
Ich bitte Dich Nichts mehr an mich zu senden. Ignaz wolle wolle an mich jetzt nichts senden, da ich ihm ebenfalls nichts retour fu niren kann. (mündl einst we mehr.
Dein
Bruder Anton Wien, 1896 Okt.
Leb wohl wohl wolf Belveverd.
AB.
7. Okt. 1896.
Sr Wohlg H I Bruck im löblStifte zu St Flor bei Linz Dein Bruder Anton 1896. Dein Bruckner.
T T ABmp
Ignaz, leb lebe wohl!
Leb’ webel woll wohl. hohllebwolf!«
Bruckners letzter Brief an seinen Bruder Ignaz vom 7. Oktober 1896
Anton Bruckner, Fotografie des Ateliers Josef
Löwy,
1894
Die Buchstaben werden immer unleserlicher, die Worte immer unklarer –nur vier Tage später stirbt Bruckner und hinterlässt der Nachwelt ein gewaltiges symphonisches Fragment, das fortan vom Nimbus des mystischen ›Opus ultimum‹ umweht werden wird: seine 9. Symphonie d-Moll.

Seit Ludwig van Beethovens – nicht zufällig ebenfalls in d-Moll stehender – 9. Symphonie schwebt die Zahl ›Neun‹ wie ein Damoklesschwert über den grübelnden Köpfen jener Komponist:innen, die sich auf das hart umkämpfte Terrain der Symphonik wagen. Noch Gustav Mahler hat, wie Alma Mahler-Werfel berichtet, »eine solche Angst vor dem Begriff Neunte Symphonie, da weder Beethoven noch Bruckner die Zehnte erreicht hatten. So schrieb er ›Das Lied von der Erde‹ erst als Neunte, strich dann die Zahl durch und sagte mir bei der später folgenden Neunten Symphonie: ›Eigentlich ist es ja die Zehnte […].‹ Als er dann an der ›Zehnten‹ schrieb, meinte er: ›Jetzt ist für mich die Gefahr vorbei!‹ Da Beethoven nach der Neunten starb und Bruckner seine Neunte gar nicht mehr vollenden konnte, so war es eine Art Aberglauben geworden, daß kein großer
Anton Bruckner // Symphonie Nr. 9 d-Moll
Symphoniker über die Neunte hinauskomme.« Auch Bruckner ist vom scheinbar unpassierbaren Grenzstein der Nummer ›Neun‹ eingeschüchtert, als er am 21. September 1887, gut einen Monat nach Abschluss der intensiven Arbeit an seiner 8. Symphonie c-Moll mit ersten Skizzen beginnt. »I’ mag dö Neunte gar nöt anfangen, i’ trau mi’ nöt«, gesteht er seinem ehemaligen Schüler Josef Gruber. Kaum begonnen, legt er den Kopfsatz schon wieder beiseite, um sich drei Jahre lang in die Revisionsarbeiten an seiner ersten, dritten, vierten und achten Symphonie zu flüchten. Erst im Februar 1891 wagt er sich wieder an die Neunte; diesmal mit Erfolg: Im Oktober 1892 beendet er den Kopfsatz, im Februar 1893 das Scherzo und schließlich, Ende November 1894, das Adagio. Das am 24. Mai 1895 begonnene Finale jedoch muss er am 11. Oktober 1896 unvollendet zurücklassen, der das Ende seines Lebens und zugleich den Beginn einer Legende markiert. Schnell ranken sich Mythen und Theorien um das Finale der 9. Symphonie, hinter denen die wahre Gestalt des Werkes nach und nach zu verschwinden droht.
I Feierlich, misterioso
Die durch die Wahl der Tonart d-Moll bewusste Anknüpfung an Beethovens 9. Symphonie zeigt sich gleich zu Beginn des mit »Feierlich, misterioso« überschriebenen Kopfsatzes: Über einem orgelpunktartigen Tremolo der Streicher – gleichsam Beethovens Eröffnung nachempfunden – flackern motivische Keimzellen der Hörner auf, die im Wechselspiel mit Pauken und Trompetensignalen über ein großes Crescendo in ein gewaltiges Unisono-Thema münden, dessen archaischer Gestus geradezu etwas »Vorweltliches, Zyklopenhaftes« (Franz Schalk) ausstrahlt. Demgegenüber steht das zweite Thema, die von Bruckner so bezeichnete Gesangsperiode, mit seiner zarten, von ineinander verwobenen Begleitstimmen getragenen Melodie der Violinen. Nachdem sich in der Durchführung erneut die gewaltige Kulmination des Hauptthemas Bahn bricht, verzerrt sich die Musik unversehens zu einem grotesken Marsch, der das »unter dem Alpdruck einer Untergangs- und Vernichtungsphantasie« (Wolfgang Stähr) stehende musikalische Gefüge beinahe unter sich zu begraben droht, ehe Bruckner ›zögernd‹ den Weg in die Reprise antreten lässt.
Orgelpunkt lang ausgehaltener oder in bestimmtem Rhythmus wiederholter Ton, meist in tiefer Lage
Anton Bruckner // Symphonie Nr. 9 d-Moll
II Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell
Am Beginn des anschließenden Scherzos steht ... nichts. Der Satz beginnt mit einer Generalpause, einem leeren Takt, dem erst im Folgenden ein auftaktiger, harmonisch mehrdeutiger Klang der Klarinetten und Oboen folgt. Diese, dem Beharren Bruckners auf einem strikten, geradzahligen Taktschema geschuldete Besonderheit, veranschaulicht, wie detailbeflissen der Komponist die formale Architektur seiner Symphonien konstruierte. Der spukhafte, von wirbelnden Streicherpizzicati durchzogene Satz –den Mahler’schen ›Nachtmusiken‹ nahe stehend – explodiert schließlich förmlich mit dem erstmaligen Auftreten des Scherzo-Themas: Über einem brachialen Unisono in Streichern und Hörnern türmt sich die Musik zu einem motorisch-stampfenden Tanz auf. Der Mittelteil hingegen überführt die harmonische Vielfalt in leichtfüßigere, träumerische Gefilde, in denen das untergründig Spukhafte allerdings noch immer präsent bleibt. »Keiner, der dieses allem Zopf zum Trotz, allem Fortschritt zu Nutz ersonnene, genialste ›Scherzo‹ Bruckners genießt […], käme auf den Gedanken, daß es in seiner Vollendung der Feder eines unter körperlichen und geistigen Qualen dem Tode Zuschreitenden entflossen!« (August Göllerich/Max Auer).
III Adagio. Langsam, feierlich
Dresdner Amen liturgische Formel, die ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts innerhalb der Messliturgie der Katholischen Hofkirche in Dresden gesungen wurde
In den hymnenhaften Melodien des zuletzt vollendeten Adagios verbirgt sich nach einem Bericht des mit Bruckner befreundeten Musikschriftstellers Theodor Helm ein »Abschied vom Leben«. Hochexpressiv hebt das einleitende Thema an, dessen Melodie alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter in sich vereint; eine kühne, die Grenzen der spätromantischen Tonalität auslotende Geste, die das Tor zu einer neuen Welt aufzustoßen scheint. Der Gestus des Religiösen, Gebetsartigen wird durch die Schlusswendung dieses ersten Themas noch verstärkt, in der das sogenannte ›Dresdner Amen‹ anklingt, das schon Felix Mendelssohn Bartholdy in seiner ›Reformations-Symphonie‹ und Richard Wagner im ›Gralsthema‹ seines Parsifal verwendet haben. In der anschließenden Gesangsperiode zitiert Bruckner das »Miserere« aus seiner Messe (Nr. 1) d-Moll, woraus sich eine gewaltige, selbst innerhalb des Bruckner’schen Œuvres beispiellose Stei-
gerung entwickelt, auf deren Höhepunkt sich das Hauptthema im Fortissimo der Posaunen und Kontrabässe mit hektisch-irrlichternden Figuren der Violinen zu einem brüllend-dissonanten Tredezimenakkord, einem aus sechs übereinandergeschichteten Terzen bestehenden Siebenklang, vereint, der im dreifachen Forte und ohne harmonische Auflösung abrupt abbricht. Es scheint tatsächlich, als habe auch Bruckner hier mit aller Macht die harmonischen und ästhetischen Grenzen seiner Zeit zu sprengen versucht.
Dennoch und entgegen der bis heute oft unkritisch wiederholten Deutung, handelt es sich bei diesem Adagio nicht um Bruckners bewusst gesetzte letzte symphonische Worte. Mindestens ein Jahr lang arbeitete er nach Abschluss des Adagios bei einigermaßen stabiler Gesundheit am Finale und hatte nach Ausarbeitung eines Particells bereits mit der Niederschrift der Partitur begonnen. Dabei folgte Bruckner genau jenem Arbeitsablauf, den wir auch von seinen vorhergegangenen Symphonien kennen: Bezifferung der Takte und Abschnitte, Notation der Streicherstimmen, Markierung und teilweise Ausarbeitung der Bläsereinsätze, meist mit Bleistift, um die definitive Version später mit Tinte auszuführen. Erst an diesem Punkt begann er mit der eigentlichen Instrumentation, ergänzte zunächst Holz-, dann Blechbläser, beginnend mit den führenden hin zu den ›begleitenden‹ oder ›füllenden‹ Stimmen. Letztlich hat Bruckner bis zu seinem Tod auf diese Weise knapp 40 Bögen mit mehr als 600 Takten Musik für das Finale beschrieben, wobei die Exposition und Teile des zweiten Hauptteils praktisch vollständig ausgearbeitet sind. Da von diesem letzten Arbeitsstudium allerdings einzelne Partiturbögen verlorengegangen sind, stützt sich die Rekonstruktion von Nicola Samale, Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips und Benjamin-Gunnar Cohrs für diese Passagen auf frühere Skizzen und Entwürfe, anhand derer sich ein fast lückenloser Verlauf des Finalsatzes konstruieren lässt. Es handelt sich also um weit mehr als einen unvollendeten Torso, den Bruckner der Nachwelt hinterlassen hat, wie etwa John A. Phillips mit Verweis auf Wolfgang Amadé Mozarts Requiem, einem weiteren unvollendeten, jedoch heutzutage selbstverständlich in nachträglich ergänzter Fassung gespielten Werk, betont: »Von den 653 Takten der N[eu][A]usgabe sind 557 Takte von Bruckner erhalten (440 Takte aus Partiturbögen, 117 aus Entwürfen). Weniger als zwei Drittel mußten nachträglich
Particell eine mit Anmerkungen zur Orchestrierung versehene Klavierpartitur
Anton Bruckner // Symphonie Nr. 9 d-Moll
zuende instrumentiert werden (in der Regel nur Bläserstimmen). Von den ergänzten 96 Takten konnten 83 Takte aus Reihung, Sequenzierung oder Transposition von Originalmaterial [...] gewonnen werden; nurmehr noch die letzten 13 Takte wurde ohne jede direkte Vorlage synthetisiert.
Dies entspricht gerade einmal etwas 4 Minuten Musik, weit weniger als bei [Franz Xaver] Süßmayrs Arbeit an Mozarts Requiem KV 626: Von Mozart liegen lediglich 83 Takte instrumentiert sowie 594 Takte in Vokalsatz und Generalbass vor. 189 der 866 Takte (= ca. 22 % oder 11 Minuten Musik) wurden von Süßmayr komponiert, 783 Takte von ihm orchestriert. Ungeachtet des hohen Fremdanteils ist Mozarts/Süßmayrs Requiem ausgesprochen populär; mithin wird im Vergleich zu Bruckner offenkundig mit zweierlei Maß gemessen.«
IV Finale. Misterioso, nicht schnell
Gesangsperiode von Bruckner etablierter Begriff, der die lyrischen zweiten Themen seiner Symphoniesätze bezeichnete
Mit archaischer Wucht türmt sich zu Beginn des Finales ein gewaltiges Hauptthema in d-Moll auf: Schroffe Doppelpunktierungen und unerbittlich absteigende Quartmotive malen das Bild des Trotzens, des Sich-Aufbäumens, ehe ein choralhafter Blechbläserabschnitt zur mysteriös zerklüfteten Fis-Dur-Gesangsperiode überleitet, in der sich die punktierten Rhythmen des Hauptthemas zu Begleitfiguren wandeln. Ein unheilvolles Halbtonpendel kündigt die Rückkehr des Eingangsmotivs an, das sich abermals steigert, rhythmisch verdichtet, lauter wird und in ein triumphales E-Dur-Choralthema mündet, an dessen Ende Bruckner in der Flöte das markante Begleitmotiv seines Te Deum WAB 45 zitiert. Dieses Motiv spielt auch in der folgenden Durchführung eine zentrale Rolle, wo es in variativer Form mit einer chromatisch absteigenden Basslinie und dem fragmentierten Eingangsthema verbunden wird. Mit der Rückkehr des Hauptthemas entfesselt Bruckner eine Fuge voll kontrapunktischer Virtuositäten, auf die eine majestätische Hornfanfare folgt. Noch einmal kehrt die elegische Stimmung der Gesangsperiode wieder, die Musik bäumt sich zu einem kurzen d-Moll-Gipfel auf und erneut taucht das Choralthema auf, diesmal begleitet vom Te Deum-Motiv in den Streichern und schließlich in das Hauptthema des ersten Satzes übergehend. In der Coda, eine der wenigen Passagen, zu denen uns Bruckners Partiturseiten und Skizzen fehlen, steigert sich die Rekonstruktion ganz

Beginn des Choralthemas des Finales in Bruckners Handschrift, 1895/96
im Geiste des typisch Bruckner’schen Finales zu einem grandiosen Höhepunkt, an dem sich zentrale Elemente wie die Te DeumBegleitfiguren und das Hauptthema, begleitet von Bläserfanfaren und raumgreifenden Akkordbrechungen, zu fulminanter Apotheose vereinen.
Andreas Meier
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Das Tonkünstler-Orchester mit seinen fünf Residenzen im Musikverein Wien und in Niederösterreich zählt zu den größten und wichtigsten musikalischen Botschaftern Österreichs. Eine mehr als 75-jährige Tradition verbindet das Orchester mit den Sonntagnachmittags-Konzerten im Wiener Musikverein. In Grafenegg und im Festspielhaus St. Pölten treten die Tonkünstler als Residenzorchester auf, ebenso im Stadttheater Wiener Neustadt, das sie nach mehrjährigem Umbau im November 2024 wiedereröffneten. Die Konzertsaison 2025/26 bringt sie ins Stadttheater Baden zurück, wo sie Anfang 1946 erstmals als Landessymphonieorchester Niederösterreich konzertierten. Den Kernbereich der künstlerischen Arbeit bildet das Orchesterrepertoire von der Klassik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts. Alternative Programmwege der Tonkünstler werden

von Musizierenden und Publikum geschätzt. Musikerpersönlichkeiten wie Walter Weller, Heinz Wallberg, Miltiades Caridis, Fabio Luisi, Kristjan Järvi und Andrés Orozco-Estrada waren Chefdirigenten des TonkünstlerOrchesters. Seit der Saison 2025/26 wird es von Fabien Gabel geleitet. Sein Vorgänger Yutaka Sado wurde nach zehnjähriger Tätigkeit als Chefdirigent zum Ersten Ehrendirigenten der Tonkünstler ernannt.
Tourneen führten das Tonkünstler-Orchester zuletzt nach Großbritannien, Deutschland, Japan und Tschechien. Zahlreiche CD-Aufnahmen spiegeln sein vielseitiges künstlerisches Profil wider: Im orchestereigenen Label erscheinen bis zu vier Einspielungen pro Jahr, zumeist als Live-Mitschnitte aus dem Musikverein Wien.

Ivor Bolton
Dirigent
Ivor Bolton ist einer der angesehensten Dirigenten im Bereich des barocken und klassischen Repertoires. Seine musikalischen Aktivitäten sind jedoch ungleich vielseitiger: So spielte er mit dem Mozarteumorchester Salzburg, das er von 2004 bis 2016 leitete, eine vielbeachtete Serie von Bruckner-Symphonien ein. Er arbeitet seit Langem kontinuierlich mit den Salzburger Festspielen und der Mozartwoche zusammen. Als Chefdirigent des Sinfonieorchester Basel (bis 2025) entstanden Alben mit Werken von Fauré, Berlioz, Saint-Saëns, Berio, Brahms, Britten und zuletzt Chausson. Als Musikdirektor am Teatro Real in Madrid leitete er eine Vielzahl an herausragenden Produktionen. Seit seiner Zeit als musikalischer Leiter der English Touring Opera und der Glyndebourne Touring Opera ist Ivor Bolton an den renommiertesten Opernhäusern zu Gast, unter anderem beim Maggio Musicale Fiorentino, der Opéra National de Paris, dem Royal Opera House Covent Garden sowie in den Opernhäusern von Bologna, Brüssel, Amsterdam, Lissabon, Sydney, Berlin, Hamburg, Venedig, Wien und Genua. Zur Bayerischen Staatsoper, wo er seit 1994 insgesamt 25 Neuproduktionen geleitet hat, pflegt er eine enge Beziehung: Für seine herausragende Arbeit dort wurde ihm der renommierte Bayerische Theaterpreis verliehen. Im Konzertbereich ist er unter anderem bei den BBC Proms und im Lincoln Center in New York, sowie beim Concertgebouworkest Amsterdam, Orchestre de Paris, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, sowie den Wiener Symphonikern gern gesehener Gast. 2024 wurde ihm für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Musik vom britischen Königshaus der Titel Commander of the Order of the British Empire verliehen. Zu seinen Projekten in der Saison 2025/26 gehören die Rückkehr an die Wiener Staatsoper (Die Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte), das Teatro la Fenice (Opern- und Konzertprojekte), die Bayerische Staatsoper München (Die Entführung aus dem Serail) und das Teatro Real Madrid (Ein Sommernachtstraum). Konzerte führen ihn unter anderem zum Shanghai Philharmonic Orchestra und zum Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Japan.

Highlights in der Saison 25–26
So, 2. Nov 2025, 11:00
Großer Saal
Gottfried, Lindsey, Nigl & Concentus Musicus Wien
Mozarts Nächte
Gemeinsam mit Kate Lindsey und Georg Nigl macht der Concentus Musicus Wien mit Serenaden sowie Opernduetten und Arien von Wolfgang Amadé Mozart den Tag zur Nacht.
Mo, 24. Nov 2025, 19:30
Großer Saal
Saraste, Kuusisto & Helsinki
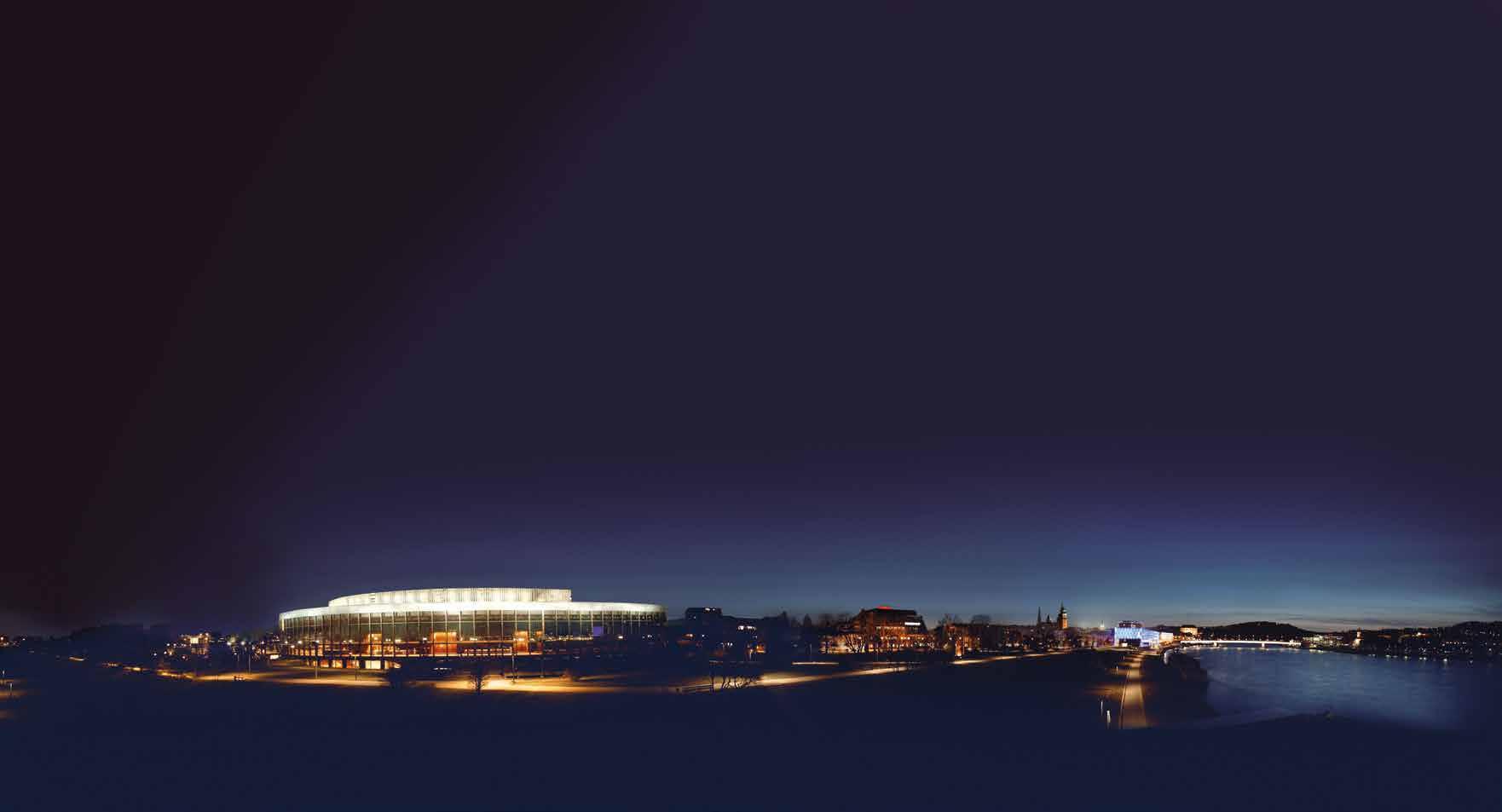
Philharmonic Orchestra
Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.
Mi, 10. Dez 2025, 19:30
Großer Saal
Hrůša & Wiener Philharmoniker
Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.
Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at




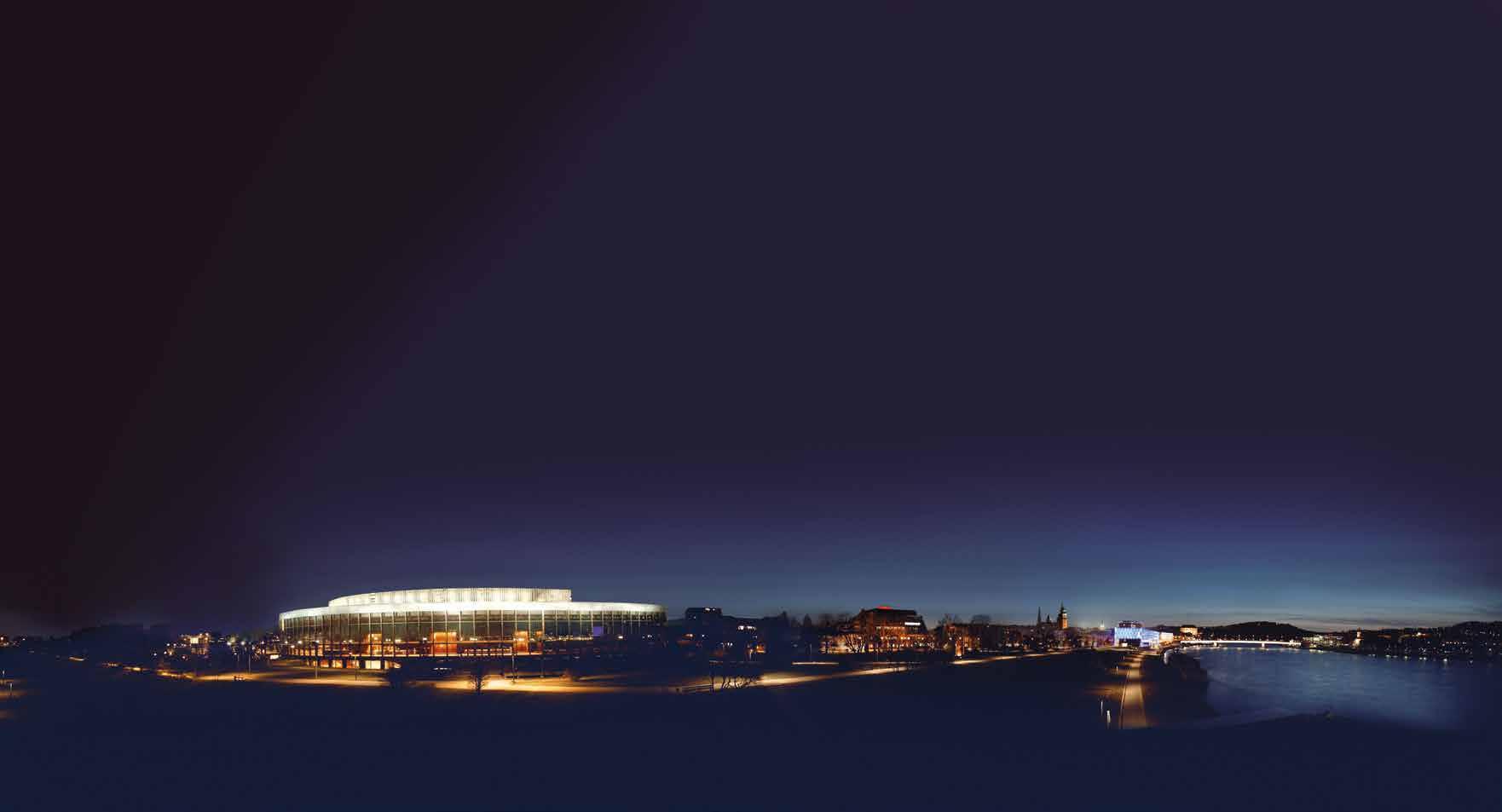

Impressum
Herausgeberin
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz
Redaktion
Andreas Meier
Biografien
Philipp Kehrer, Romana Gillesberger
Lektorat
Celia Ritzberger
Gestaltung
Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer
Abbildungen
privat (S. 5), Österreichische Nationalbibliothek, Wien (S. 6–7 & 11), N. Horowitz (S. 12–13), B. Wright (S. 15)
Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten
LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz
Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de
TAG FÜR TAG Ein Leben lang.

vossentowels vossen_towels vossentowels