Concertomacabre
25. September 2025, 19:30 Uhr Großer Saal
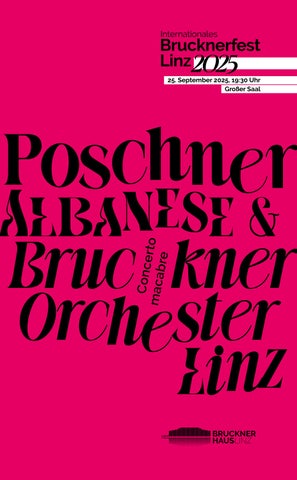
Concertomacabre
25. September 2025, 19:30 Uhr Großer Saal
Klänge sehen – Bilder hören
So, 28. Sep 2025, 18:00
Bolton & TonkünstlerOrchester
Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen Bruckners 9. Symphonie in einer in Linz noch nie gehörten viersätzigen Fassung zum Klingen.
Di, 7. Okt 2025, 19:30
Das einzigartige Chineke! Orchestra bringt William Levi Dawsons Negro Folk Symphony und Ludwig van Beethovens ›Tripelkonzert‹ mit drei fulminanten Solist:innen auf die Bühne.
Fr, 10. Okt 2025, 19:30
Juergen Maurer & Solistenensemble D’Accord
Das Solistenensemble D’Accord und Juergen Maurer präsentieren Richard Wagners romantische Oper Lohengrin in einer Paraphrase für Streichsextett und Sprecher.
Sa, 11. Okt 2025, 19:30 Stiftsbasilika St. Florian
Weikert & Bruckner Orchester Linz
Beim festlichen Abschlusskonzert stehen neben Leopold Stokowskis Bach-Transkriptionen für Orchester das Adagio aus Anton Bruckners 7. Symphonie und Paul Hindemiths Mathis der Maler auf dem Programm.
Das Programm auf einen Blick
Die Grenzen zwischen Kino und Konzert sind fließend. Zumindest in den Werken des Programms, für das der italienische Pianist Giuseppe Albanese ans Brucknerhaus Linz zurückkehrt, um gemeinsam mit Markus Poschner und dem Bruckner Orchester Linz zwei einsätzige Klavierkonzerte zu einem Ganzen zu verschmelzen. Miklós Rózsa verwendete für das Spellbound Concerto seine oscarprämierte Musik zum gleichnamigen Film von Alfred Hitchcock, der hierfür zunächst Bernard Herrmann angefragt hatte. Dieser arbeitete jedoch bereits an seinem Concerto macabre, dessen Aufführung die dramatische Schlussszene des ebenfalls 1945 erschienenen Films Hangover Square bildet.
Demgegenüber steht Erich Wolfgang Korngolds Symphonie in Fis, mit der sich der nach seiner Emigration in die USA zum HollywoodStar avancierte Komponist wieder im Konzertsaal beweisen wollte. Wie Korngold selbst pendelt das Stück zwischen Los Angeles und Wien, effektvoller Filmmusik und komplexer Symphonik und bildet damit in den Worten des Dirigenten Dmitri Mitropoulos »das perfekte Werk der Moderne«.
Giuseppe Albanese Klavier
Bruckner Orchester Linz
Markus Poschner Dirigent
Bernard Herrmann 1911–1975
Suite aus dem Film Vertigo // 1958
I Prelude II The Nightmare III Scéne d’amour
Miklós Rózsa 1907–1995
Spellbound Concerto für Klavier und Orchester // 1945
Bernard Herrmann
Concerto macabre für Klavier und Orchester // 1944, 1973
// Pause //
Erich Wolfgang Korngold 1897–1957
Symphonie in Fis op. 40 // 1949–52
I Moderato ma energico
II Scherzo
III Adagio
IV Finale
Konzertende: ca. 21:30 Uhr
Ein Mitschnitt des Konzerts ist am 11. Oktober 2025 um 15:05 Uhr auf Ö1 in der Sendereihe Apropos Klassik zu hören.
Bernard Herrmann // Suite aus dem Film Vertigo
1911 als Sohn russisch-jüdischer Emigranten in New York City geboren, suchte Bernard Herrmann als Musiker schon früh die Nähe zu neuen Medien wie Film und Rundfunk. Nach Kompositions- und Dirigierstudien an der New York University sowie der Juilliard School of Music arbeitete er ab 1933 für das CBS Symphony Orchestra, das er ab 1940 bis zu dessen Auflösung 1951 als Chefdirigent leitete. Im Zuge seiner Arbeit für Hörspiele und Musiksendungen des CBS Radio komponierte er hierbei erste Orchesterwerke zur Untermalung von Lesungen, die er ›Melodrams‹ nannte. Indessen entstand in seiner knapp bemessenen freien Zeit zwischen 1935 und 1940 eine erstaunliche Zahl symphonischer Werke: 1935 die Ballettsuite The Skating Rink sowie eine Sinfonietta für Streichorchester; 1938 die dramatische Kantate Moby Dick, im Jahr darauf uraufgeführt durch die New York Philharmonic unter der Leitung von John Barbirolli, der das Werk als »die bedeutendste Sache, die ich je von einem jungen amerikanischen Komponisten gesehen habe« bezeichnete; 1941 schließlich Herrmanns erste und einzige Symphonie, während deren Entstehung ihn erstmals der Ruf nach Hollywood ereilte: Orson Welles, der mit Herrmann 1938 durch das Radiohörspiel The War of the Worlds (Der Krieg der Welten) landesweit für Furore gesorgt hatte, engagierte ihn 1941 als Komponisten für sein Kindodebüt Citizen Kane. Hierfür bereits für einen Oscar nominiert, gewann Herrmann die begehrte Auszeichnung schon im Jahr darauf für seine Musik zu The Devil and Daniel Webster Mitte der 1950erJahre traf Herrmann schließlich mit Alfred Hitchcock zusammen, der zur prägenden Gestalt seines filmmusikalischen Schaffens werden sollte. Nach der gemeinsamen Arbeit an The Trouble with Harry (1955), The Wrong Man und The Man Who Knew Too Much (beide 1956), in dem Herrmann sogar einen Auftritt als Dirigent hat, folgte im Jahr 1958 jener Film, der heute als Hitchocks Opus magnum und für viele als einer der besten Filme überhaupt gilt: Vertigo

Das Drehbuch schildert die Geschichte des Polizisten John ›Scottie‹ Ferguson (gespielt von James Stewart), der bei einer Verfolgungsjagd über den Dächern San Franciscos beinahe zu Tode stürzt und seither, von Höhenangst und Schuldgefühlen aufgrund des Todes eines Kollegen geplagt, vom Dienst freigestellt ist. Einige Zeit später bittet ihn ein ehemaliger Schulfreund, Gavin Elster, seine Frau Madeleine (Kim Novak) zu beschatten, die Elster für selbstmordgefährdet hält. Scottie entdeckt, dass Madeleine vom Geist ihrer jung verstorbenen Urgroßmutter Carlotta besessen zu sein scheint: Sie frisiert ihr Haar wie Carlotta, trägt dieselbe Kette und hat jenes Hotelzimmer gemietet, in dem Carlotta vor ihrem Tod wohnte. Scottie rettet sie, als sie sich eines Tages in der Bucht von San Francisco ertränken will und sie verlieben sich ineinander. Bei einem Ausflug zu ihrem Elternhaus läuft Madeleine plötzlich in die angrenzende Kirche und dort treppauf zum Glockenturm. Scottie folgt ihr, ist aufgrund seiner Höhenangst allerdings nicht schnell genug und muss mitansehen, wie Madeleine von der Spitze des Turmes in den Tod stürzt. Er selbst fällt daraufhin in tiefe Depression und wird in eine Nervenklinik eingewiesen. Nach seiner Entlassung begegnet er der jungen Judy Barton, die ihn an Madeleine erinnert. Nach und nach bedrängt er sie, Kleidung, Haarfarbe, Frisur und Charakterzüge von Madeleine anzunehmen. Als sie jedoch eine Halskette anlegt, die Scottie als Madeleines erkennt und die auch auf einem Gemälde von Carlotta zu sehen ist, erschließt sich ihm das doppelbödige Spiel: Gavin Elster hat seine Frau Madeleine ermordet und Judy als diese ausgegeben, um Scottie zum Zeugen und Mitverantwortlichen für ihren fingierten Selbstmord zu machen. Scottie fährt mit Judy zur Kirche und zwingt sie, die Szene auf dem Turm nachzustellen. Judy beteuert ihre Liebe, sie küssen sich, als plötzlich eine dunkle Gestalt –eine Nonne, wie sich später herausstellt – am Turmaufgang erscheint. Judy erschrickt, stolpert rückwärts und stürzt in die Tiefe. Scottie hat seine Höhenangst überwunden und seine Geliebte zum zweiten Mal verloren.
Herrmanns Musik greift die zentralen dramaturgischen Fäden des Films in Form musikalischer Leitmotive auf. »[Madeleine] wird ständig mit dem Tod in Verbindung gebracht und die Faszination, die sie ausübt, ist die Faszination des Todes, ein Verlangen nach Vergessen und endgültiger
Bernard Herrmann // Suite aus dem Film Vertigo
Befreiung; die Sehnsucht nach dem Traum, nach dem Ideal, nach dem Unendlichen wird zwingenderweise zur Sehnsucht nach dem Tod: Scotties und unser Schwindelgefühl« (Robin Wood).
Dieses Schwindelgefühl erzeugt Herrmann durch ein ›Urmotiv‹ in Form gegenläufiger Dreiklangsbrechungen in Holzbläsern, Harfe, Celesta und im Tremolo der Violinen, neben denen sich bedrohliche Blechbläserakkorde nach und nach zum ›VertigoAkkord‹ –eine Übereinanderschichtung von es-Moll und DDur – formen. Ebenfalls aus dem ›Urmotiv‹ entwickelt er auch das ›Sehnsuchtsmotiv‹, eine als Dreiklang auf- und absteigende Violinmelodie über einem Harmoniewechsel von AsDur nach aMoll. Im Prelude der Suite spiegelt Herrmann die zweigeteilte Form der Erzählung (I = Madeleine, II = Judy) formal wider, indem er das ›Urmotiv‹ zweimal an den sich immer höher auftürmenden Blechbläserakkorden zerschellen lässt und damit die gegenläufigen Vexierspiele beider Filmhälften inszeniert. Im Nightmare wird das ›Urmotiv‹ zu aufsteigenden Triolen in verminderten Akkorden transformiert, die in einen martialischen Habanera-Rhythmus münden: Es ist das Motiv der verstorbenen Urgroßmutter Carlotta, von harmonisch ›suchenden‹ Akkorden begleitet und zuletzt in den von Harfenglissandi umrauschten Taumel des ›Vertigo-Akkords‹ mündend. Das ›Sehnsuchts-Motiv‹ leitet schließlich auch die Scene d’amour ein, während der sich Judy im Film in Madeleine verwandelt. Und tatsächlich erscheint über flirrenden Tremoli ein Madeleine zugeordnetes ViertonMotiv, steigert sich und kulminiert in einer gewaltigen Eruption des ›Sehnsuchtsmotivs‹: Die Ver wandlung ist abgeschlossen, Judy und Scottie liegen sich in den Armen.
»Wenn Judy auftaucht und wir in die Liebesszene übergehen, blenden wir alle Umgebungsgeräusche aus, denn Mr. Herrmann dürfte hier etwas zu sagen haben.«
Alfred Hitchcock
Andreas Meier
Miklós Rózsa // Spellbound Concerto für Klavier und Orchester
Für die Musik seines 1945 erschienenen Films Spellbound (dt. Ich kämpfe um dich) hatte Alfred Hitchcock ursprünglich Bernard Herrmann im Sinn, der aufgrund seiner Arbeit für John Brahms Hangover Square sowie seiner Verpflichtungen für das CBS allerdings nicht verfügbar war. Die, wie sich im Nachhinein feststellte, mehr als glückliche zweite Wahl fiel auf Miklós Rózsa. 1907 in Budapest geboren, war Rózsa nach seinem Kompositions- und Musikwissenschaftsstudium am Konservatorium in Leipzig, unter anderem bei Max Regers Nachfolger Hermann Grabner, 1931 nach Paris gezogen, wo er zunächst mit Werken wie seiner Serenade op. 10 oder dem Orchesterwerk Thema, Variationen und Finale op. 13 auf sich aufmerksam machte – letzteres wurde von Dirigenten wie Karl Böhm, Georg Solti, Bruno Walter und Leonard Bernstein aufgeführt. Sein Kollege Arthur Honegger machte ihn schließlich auf die Möglichkeiten der Filmmusik aufmerksam. Ab 1937 zunächst in London tätig, kam Rózsa infolge des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs während der Arbeit an seiner Musik zu The Thief of Bagdad 1940 nach Hollywood. Dort blieb er und komponierte bis zu einem schweren Schlaganfall im Jahr 1982 mehr als 200 Filmmusiken, wobei ihm das Kunststück gelang, sich mit Werken wie dem 1952 für Jascha Heifetz komponierten Violinkonzert oder seiner Sinfonia Concertante des Jahres 1966 auch im Konzertsaal zu behaupten.
Francis Beeding gemeinsames Pseudonym des Autorenduos John Palmer und Hilary Saunders
Die Geschichte des Films Spellbound – basierend auf dem Roman The House of Dr. Edwardes von Francis Beeding –beginnt in Green Manors, einem Institut für Nervenkranke im US-Bundestaat Vermont. Dr. Murchison, der kurz vor dem Ruhestand stehende Institutsleiter, und die Psychologin Dr. Constance Petersen (Ingrid Bergman) begrüßen den
Miklós Rózsa // Spellbound Concerto für Klavier und Orchester
designierten neuen Chefarzt Dr. Anthony Edwardes (Gregory Peck), hinter dessen Fassade sich ein Geheimnis zu verbergen scheint: Edwardes verhält sich sonderbar und gerät in Panik, wenn er das Muster paralleler Linien auf weißem Untergrund sieht. Petersen gesteht er, er glaube, den echten Dr. Edwardes umgebracht und dessen Identität angenommen zu haben. Dabei kann er sich weder an die Tat noch an seine wahre Identität erinnern; einzig die Initialen ›J. B.‹ auf einer Zigarettenbox geben einen Hinweis auf seinen tatsächlichen Namen. Als sein Geheimnis auch von anderen entdeckt wird, flieht er unter dem Pseudonym John Brown nach New York, wohin ihm Petersen folgt. Sie überredet Edwardes, sich von ihrem ehemaligen Lehrer, dem Psychiater Dr. Brulov untersuchen zu lassen. Brulov analysiert Browns Träume – im Film begleitet von Szenenbildern Salvador Dalís – und erfährt, dass Brown mit dem ›echten‹ Dr. Edwardes Skifahren und nicht schuld an dessen Absturz war. Gemeinsam mit Petersen fährt Brown in das Skigebiet, wo er sich bei der Nachstellung der Abfahrt an den Sturz Edwardes’ und zugleich an den Grund seines damit verbundenen Schuldkomplexes erinnert: Bei einem von ihm verursachten Unfall in seiner Kindheit war sein Bruder ums Leben gekommen – ein Trauma, dass nach Edwardes’ Unfall zu John Ballantynes, so der echte Name von John Brown, Amnesie geführt hat. Wider Erwarten ergibt eine Untersuchung jedoch, dass Edwardes vor seinem Sturz erschossen wurde. Ballantyne wird verhaftet, Petersen jedoch ahnt, dass Murchison der Täter war. Dieser gesteht, er habe Edwardes aus Angst um seine Stellung als Chefarzt getötet. Als Petersen den Raum verlässt, begeht Murchison Selbstmord.
Die im Herbst 1944 komponierte und 1946 mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnete Partitur von Rózsa taucht das spannungsvoll zwischen bildgewaltigem Liebesdrama und experimenteller kinematographischer Psychoanalyse stehende Werk Hitchcocks in gleichermaßen romantische wie moderne Klänge. So hebt das vom Komponisten für den Konzertsaal adaptierte Spellbound Concerto für Klavier und Orchester mit dem berühmten Hauptthema des Filmbeginns an, an das sich wenig später in den Violoncelli das im Film erstmals bei der Begegnung von Petersen und Ballantyne zu hörende ›Liebesthema‹ anschließt – Jahre später von John Williams im ›Liebesthema‹ von Prinzessin Leia und Han

Miklós Rózsa // Spellbound Concerto für Klavier und Orchester
Solo in Stars Wars zitiert. Die träumerische Stimmung kippt, als jenes Instrument einsetzt, das Rózsa nach seiner Verwendung selbstironisch zum »offiziellen Sprachrohr Hollywoods für psychische Störungen« erklärte: das Theremin. »Hitchcock erklärte mir seine genauen Anforderungen: ein großes, weitschweifendes Liebesthema für Ingrid Bergman und Gregory Peck und ein ›neuer Klang‹ für die Paranoia, die das Hauptthema des Filmes war. Hitchcock und [der Produzent David O.] Selznick wussten nicht, was ein Theremin war und ob man es vielleicht essen oder bei Kopfschmerzen einnehmen könne, aber sie willigten ein, es auszuprobieren […]«. Das vom Theremin vorgestellte ›Paranoia-Thema‹ steigert sich und mündet schließlich in eine martialische Solokadenz des Klaviers. Nach einer kurzen, scheinbar unbeschwerten Allegretto-Passage, im Film zur Untermalung eines Tischgesprächs im Hintergrund zu hören, kehrt das Hauptthema in dramatischblechgepanzertem Moll zurück und bahnt sich seinen Weg über eine grandiose Steigerungssequenz zur strahlenden Wiederkehr im anfänglichen Es-Dur.
»Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von einer seiner [i. e. Produzent David O. Selznick] Sekretärinnen, die mich fragte, wie viele Violinen ich für die Titelmusik eingesetzt hatte. Ich sagte es ihr, sie rief kurz darauf zurück und teilte mir mit, dass Selznick das mit Franz Waxmans Musik für [Alfred Hitchcocks] Rebecca verglichen und festgestellt habe, dass dieser mehr Violinen verwendet hat und dass ich die Titelmusik mit ebenso vielen Violinen noch einmal aufnehmen solle.
Das tat ich gerne, aber ob ein halbes Dutzend mehr Violinen wirklich einen Unterschied machte, das merkte nur Selznick.«
Miklós Rózsa in seiner Autobiografie Double Life, 1982
Andreas Meier
Bernard Herrmann // Concerto macabre
für
Klavier und Orchester
John Brahm geb. Hans Brahm; deutscher Regisseur, der 1937 in die USA emigrierte
»Ich sehe noch immer niemanden, der mit Herrmann vergleichbar wäre«, räumte Produzent David O. Selznick gegenüber seinem Produktionsleiter Richard Johnston auf der Suche nach einem Komponisten für Alfred Hitchcocks Spellbound ein. Die letztlich ›zweite Wahl‹ Miklós Rózsa stellte sich dennoch als Glücksgriff heraus, die dem Film sogar einen Oscar für die beste Musik einbrachte. Bernard Herrmann hatte das lukrative Angebot für Spellbound im September 1944 ausschlagen müssen, da er neben seiner Arbeit für die CBS an einem anderen Filmprojekt arbeitete: John Brahms Hangover Square – ein Film, der für den beständig zwischen Film und Konzertsaal pendelnden Herrmann einen besonderen Reiz ausübte, handelt es sich beim Protagonisten George Harvey Bone, gespielt von Laird Cregar, doch um einen Komponisten, dessen Arbeit an einem Klavierkonzert im Mittelpunkt der Handlung steht.
Zu Beginn der 1903 in London angesiedelten Erzählung taumelt Bone nach dem Mord an einen Ladenbesitzer auf die Straße, nachdem er dessen Zimmer in Brand gesetzt hat. In seiner Wohnung angekommen, gesteht er seiner Freundin Barbara Chapman (Faye Marlowe), dass er keine Erinnerung an die letzten Stunden hat. Nachdem er aus der Zeitung vom Mord erfährt, legt er gegenüber dem Polizisten Allan Middleton (George Sanders) offen, er leide unter Anfällen von Amnesie, stets begleitet von dissonanten Klängen. Tage später trifft er in einem Pub die Sängerin Netta Longdon (Linda Darnell). Er verliebt sich, sie hingegen interessiert sich kaum für ihn, versucht jedoch Profit aus seinen Fähigkeiten als Songwriter zu schlagen. In der Guy Fawkes Night, während eines erneuten Anfalls, erwürgt Bone sie und verbrennt ihren Körper auf einem der in der Stadt aufgebauten Leuchtfeuer. Als Middleton Verdacht

schöpft und ihn am Tag der Aufführung seines neuen Werks für Klavier und Orchester damit konfrontiert, sperrt Bone ihn in seiner Wohnung ein und eilt zum Konzert. Inmitten der Aufführung, in der Bone selbst als Solist auftritt, kann sich Middleton befreien und betritt gemeinsam
Bernard Herrmann // Concerto macabre für Klavier und Orchester
mit Polizeikollegen den Konzertsaal. Die Musik und das Erscheinen der Polizisten bringt Bones Erinnerung an beide Morde zurück, er verlässt den Saal – Barbara Chapman übernimmt an seiner Statt den Solopart – und wird hinter der Bühne von der Polizei verhört. Mit seinen Taten konfrontiert, wirft er eine Gaslampe und setzt damit das Gebäude in Brand. Während das Publikum in Panik aus dem Saal flieht, setzt sich Bone noch einmal ans Instrument und spielt die letzten solistischen Takte seines Klavierkonzerts, ehe das in Flammen aufgehende Gebäude über ihm zusammenbricht.
Herrmanns Musik für das fulminante Finale des Films, die er 1976 in revidierter Form als Concerto macabre veröffentlichte, verbindet nahtlos diegetische, also zur filmischen Realität gehörende, und nichtdiegetische Musik, also solche, die nicht Teil der Filmhandlung ist, sondern nur vom Publikum wahrgenommen wird. Einerseits funktioniert das Concerto macabre damit als Konzertwerk, das von den Charakteren des Films auch als solches zur Aufführung gebracht und wahrgenommen wird, andererseits untermalt Herrmann damit die sich während des Konzerts entwickelnde Handlung. So begleiten etwa nach einer gravitätischen Einleitungspassage, in der unter anderem das Liebesthema zwischen Bone und Chapman erklingt, dissonante Blechbläserakkorde – Bones Amnesie symbolisierend – das Eintreten der Polizisten in den Konzertsaal. Der anschließende AllegroTeil im 6/8Takt exponiert eine atemlos voraneilende Melodie, die zu Beginn des Filmes von einem Drehorgelspieler vor dem Haus des ermordeten Ladenbesitzers gespielt wurde. Es wird klar, dass Bone unterbewusst Klänge und Melodien in sein – also Herrmanns – Werk eingeflochten hat, die unmittelbar mit seinen Amnesieanfällen in Verbindung stehen. Kongenial verschmelzen auch in den letzten Takten musikalische Form und dramaturgische Konzeption ineinander, wenn das von allen Orchesterstimmen verlassene Klavier den Bogen zum solistischen Beginn des Werkes schlägt und zugleich den einsamen Tod Bones symbolisiert.
Andreas Meier
Erich Wolfgang Korngold // Symphonie in Fis
Erich Wolfgang Korngold war ein musikalisches Wunderkind, das schon bald die Bewunderung von Richard Strauss, Gustav Mahler und Giacomo Puccini auf sich zog. Als Schüler Alexander Zemlinskys machte er rasche kompositorische Fortschritte, und sein Ballett Der Schneemann, das er elfjährig schrieb und das 1910 an der Wiener Hofoper uraufgeführt wurde, erregte weithin Aufmerksamkeit. Die erstaunlich reifen Jugendwerke wurden von so berühmten Musikern wie Bruno Walter, Artur Schnabel, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Felix Weingartner oder Richard Strauss aufgeführt. 1934 folgte Korngold der Einladung Max Reinhardts, der bereits auf der Flucht vor den Nationalsozialisten war, nach Hollywood, um Mendelssohns Schauspielmusik zu Shakespeares A Midsummer Night’s Dream für den Film zu arrangieren. Der ›Anschluss‹ Österreichs verbot Korngold die Rückkehr in seine Heimat. Er beantragte Asyl, ließ sich 1938 in Hollywood nieder und erhielt 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft. In den USA begann Korngolds zweite Karriere: als Filmkomponist der Warner Brothers. Sein Versuch, nach dem Krieg zur klassischen Musik zurückzufinden (unter anderem mit dem Violinkonzert, dem Cellokonzert und der Symphonie in Fis), schlug fehl, und Korngold sah sich in seiner Wahlheimat wie in Europa gleichermaßen vergessen.
Es brauchte Mut und tiefste Überzeugung, zum Anfang der 50erJahre des 20. Jahrhunderts eine Symphonie zu schreiben, als die Avantgarde von Darmstadt und Donaueschingen die musikalischen Spielregeln der Nachkriegszeit zu bestimmen begann und die Gattung der Symphonie (neben manch anderem) für tot erklärte. Wenn trotzdem ein Komponist auf der symphonischen Form beharrte, noch dazu in ihrer traditionellen Viersätzigkeit, und wenn er dann noch seinem Stück den bekenntnishaften Titel Symphonie in Fis gab, war der Konflikt mit dem Zeitgeist unvermeidlich. Vor die Wahl gestellt, sich an Dodekaphonie und Aleatorik
anzupassen oder (wie Berthold Goldschmidt für die nächsten drei Jahrzehnte) das Komponieren ganz aufzugeben, entschied sich Erich Wolfgang Korngold für die Flucht nach vorn. Korngolds Statement in einem Brief aus dem Jahr 1952 ist künstlerisches Credo und Protestruf in einem: »Ich glaube, meine neue Symphonie wird der Welt zeigen, dass Atonalität und hässlicher Missklang unter Preisgabe von Inspiration, Form, Ausdruck, Melodie und Schönheit letztlich im Untergang der Tonkunst enden werden.« Zugleich mit dieser selbstbewussten Positionsbestimmung benannte Korngold hier noch einmal deutlich die Grundpfeiler, auf denen seine Tonsprache unverrückbar ruhte – seit dem ersten gedruckten Werk des Zwölfjährigen.
An seinen künstlerischen Glaubenssätzen hat Korngold bis zuletzt festgehalten, denn sie waren ihm zweite Natur, ohne sich jedoch dabei »den harmonischen Bereicherungen zu verschließen, die wir etwa Schönberg verdanken« und »unbeschadet moderner Diktion, in der ich höre und fühle«. Beeindruckt vom Prestigeerfolg des MaxReinhardtFilms A Midsummer Night’s Dream mit Korngolds Bearbeitung von Mendelssohns Musik, setzten die Warner Brothers alles daran, den Komponisten für Original-Filmkompositionen zu gewinnen. Er, zunächst widerstrebend, willigte schließlich unter dem Druck der europäischen Ereignisse ein. Hollywood bot Korngold Asyl, verbunden mit einem Filmmusikauftrag für den Robin HoodFilm. Aus Wien und Europa gewaltsam entwurzelt, stellte sich Korngold die bittere Frage: »Wozu noch Opern schreiben, wozu noch komponieren, in solcher Zeit?« Seine Antwort war, dem ›eigenen‹ Schaffen für die Dauer des Krieges zu entsagen und sich fast ausschließlich der Filmkomposition zu widmen, als deren Pionier er höchste Maßstäbe setzte. Es entstanden 18 Filmpartituren, »Opern ohne Gesang«, wie Korngold sie nannte. 1946 beendete er seine Filmarbeit und resümierte: »Mein Ziel war stets, für den Film eine Musik zu schreiben, die seiner Handlung und Psychologie gerecht wird und sich trotzdem – losgelöst vom Bild –im Konzertsaal behaupten kann.« Für ihn bedeutete der Film letztlich im doppelten Sinn Lebensrettung und künstlerisches Überleben im Exil. In der Rückschau erscheint die Filmmusik – bei aller Eigenwertigkeit –gleichsam wie eine auf Vorrat angelegte Materialsammlung für das Schaffen nach dem Exil. Im Selbstverständnis des Komponisten war es nur

Erich Wolfgang Korngold mit seiner Familie bei der Ankunft in New York, 1935
konsequent, dass er in fast allen seinen in rascher Folge entstandenen Nachkriegswerken Themen und Motive seiner Filmmusiken verarbeitete, die er mit einer Fülle neuer Gedanken verknüpfte. Film- und Originalmaterial fügten sich nahtlos und ohne Stilbruch zu einem organischen Ganzen. 1949 kam Korngold, von neuem Schaffensdrang beflügelt, nach
Wien, in der Hoffnung, an die Glanzzeiten vor dem Nationalsozialismus anknüpfen zu können – im Gepäck die neu geschaffenen Kompositionen, darunter die Symphonische Serenade für Streichorchester op. 39, die Wilhelm Furtwängler und die Wiener Philharmoniker 1950 vorstellten. Schon 1947 hatten die Wiener Symphoniker unter Otto Klemperer mit dem Solisten Bronisław Gimpel das für Huberman und Heifetz geschriebene Violinkonzert in D op. 35 zur europäischen Erstaufführung gebracht. Nachdem Korngold bereits 1951 mit einem Konzert in Wien geehrt worden war (bei dem auch sein 1941 im Exil entstandener PessachPsalm op. 30 zur Aufführung kam), sollte sich nur wenige Jahre später bei einer weiteren EuropaReise 1954 der ersehnte musikalische Neuanfang in der Alten Welt als tiefe Enttäuschung erweisen. Zweck dieser Reise war vor allem die Aufführung der Symphonie in Fis, die jedoch nur unter widrigen Bedingungen zustande kam.
1949 in Wien begonnen und 1952 in Hollywood abgeschlossen, steht Korngolds Symphonie in Fis zwischen zwei Welten, im Spannungsfeld von Tradition und Moderne, zwischen düsterem Pessimismus und kämpferischem Widerspruchsgeist – eine Parallele zu Arthur Honegger und seiner Symphonie liturgique. Ihre Widmung »Dem Andenken Franklin D. Roosevelts« ist Dank und Ehrenbezeigung für Korngolds Asylland und dessen 1945 verstorbenen Präsidenten. Der schwelgerische, gelegentlich ornamentale Schönklang der Frühwerke ist in der Symphonie einer schnörkellosen, abgeklärten Herbheit gewichen, die Harmonik wirkt vereinfacht und zugleich vertieft. Korngolds fast demonstrativer Rekurs auf die entlegene FisDurTonalität mit ihrem erdentrückten, zu Überhöhung und Exaltation neigenden Charakter war kein Zufall; FisDur hat in Korngolds Musik oft eine zentrale Rolle gespielt, nicht zuletzt in der visionären Auferstehungsmystik der Toten Stadt und im Wunder der Heliane. Es war auch die Tonart von Mahlers Adagio der fragmentarischen 10. Symphonie. Korngolds ambitionierter großsymphonischer Entwurf, seine erste und einzige Symphonie, sucht neue, zeitgenössische Töne – Krieg und Exil haben darin ihren Niederschlag gefunden.
Ostinat geschlagene schwere Synkopen des mit Marimba, Xylofon und Klavier fast perkussiv behandelten Orchesters eröffnen den Kopfsatz und leiten über zum langausgesponnenen tonartfremden Hauptthema in der Soloklarinette. Es wird durchgeführt in dissonanzgeladenen Bläsersätzen von schmerzlicher Expressivität. Erst später findet der Satz Beruhigung (und am Ende die Haupttonart) in einer Trost und Frieden verheißenden Flötenepisode über gehaltenen Streicherakkorden.
Der zweite Satz ist eine ruhelos dahinjagende, rondoartige Tarantella im 12/8Takt, die ihre treibenden Impulse aus einem aufsteigenden Tritonus bezieht mit Tonrepetitionen von rastloser Bewegung. Ein nach E-Dur gewendetes Seitenthema im heroischen UnisonoKlang der Hörner führt zum Trio, dessen beschwörender, durch die Tonarten kreisender Klagegestus bereits den nächsten Satz vorausahnen lässt.
»Mein ganzes
An dritter Stelle lotet d-Moll in Bruckner’sche Tiefen, die Korngold hier früherem Filmmaterial abgewinnt. Es beginnt im Schritt eines Trauerkondukts. Sein Hauptthema stammt aus dem 1939 entstandenen Film The Private Lives of Elizabeth and Essex, handelnd von der verzweifelten Hassliebe zwischen Königin Elisabeth I. und Robert Devereux, dem Earl of Essex, einer klassischen ›Amour fou‹, die für den Earl auf dem Richtblock des Henkers endet. Der skalenartig aufsteigende Überleitungsgedanke benutzt ein Motiv aus Captain Blood, Korngolds erster OriginalFilmmusik von 1935. Das in unirdischsphärenhaften Klangfarben von Flöte, Celesta und Harfe chromatisch herabschwebende Seitenthema entstammt Korngolds Filmmusik zu Anthony Adverse (1936). Nach mächtigen Steigerungen leidenschaftlicher Klage mündet der Satz wieder in den Trauermarsch und gipfelt, alle filmischen Stimmungskontexte transzendierend, im ekstatischen dMollAbgesang – ein symphonisches Monument von erschütterndem Pathos und universaler Tragik.
Leben habe ich nach dem perfekten Werk der Moderne gesucht. Mit dieser Symphonie habe ich es gefunden.«
Dimitri Mitropoulos, 1959


Erich Wolfgang Korngold // Symphonie in Fis
Im AllegroFinale greift Korngold in für ihn typischer Weise auf Material der früheren Sätze zurück. Das Hauptthema, ein rhythmisch profilierter Geschwindmarsch in Piccolo, Flöte und Celesta, ist die Umdeutung der ruhigen Flötenepisode des ersten Satzes. Der nostalgische, wienerischkantable Seitengedanke in den Streichern bedient sich noch einmal –harmonisch verfremdet – eines Filmthemas: Kings Row (1941), ein Seelendrama aus dem amerikanischen Kleinstadtmilieu mit Exkurs in das Wien Sigmund Freuds und der vielleicht besten Schauspielleistung des späteren Präsidenten Ronald Reagan. Ungetrübte Serenität will sich auch hier nicht einstellen. Wieder tauchen mahnend Bruchstücke der Vorgänger-Sätze auf. Aber die unablässig sich aufschwingenden Quartenmotive des Hauptthemas drängen über ein knappes Fugato schließlich doch zur befreienden, fulminanten Fis-Dur-Apotheose. Korngold also ein ›DurKomponist‹?
»Vom Künstlerischen her gesehen machte er keinen Unterschied zwischen Oper, Konzert, Kammermusik und Film. Er komponierte alles mit der gleichen Hingabe, mit demselben Ernst, kompromisslos sich selbst gegenüber. [Er] legte sich sogar das Filmmanuskript zurecht wie ein Libretto –vielleicht […] eine absichtliche Selbsttäuschung?«
Korngolds Sohn George
So jedenfalls sah ihn 1922 sein früher Biograf Rudolf Stefan Hoffmann. Und tatsächlich stehen auf den ersten Blick fast sämtliche seiner Werke aller Gattungen am Ende in einer Durtonart. Doch hat Korngold, der kein Vielschreiber war, seine Dur-Finali nie leichtfertig hingeworfen. Sie sind erkämpft und erlitten, sublimiert durch tiefempfundene, oft zwielichtgebrochene langsame Sätze, die nicht selten das Herzstück des Ganzen bilden, wie im 3. Streichquartett (1945) und der Symphonischen Streicherserenade. Das im Schaffen Korngolds allgegenwär tige Leitmotiv aufsteigender Quarten, von ihm selbst »Motiv des fröhlichen Herzens« genannt und von zentraler Bedeutung in der frühen Sinfonietta, die Symbolik des ›Sursum Corda‹ (›Empor die Herzen‹) in Korngolds gleichnamiger symphonischer Ouvertüre, dies sind keine naiven Leerfloskeln, kein blinder Happy-End-Optimismus, sondern notwendiges Korrelat zu den Nachtseiten seiner Musik. Vom tragischen c-Moll-Largo der 2. Klaviersonate in
EDur des 13Jährigen führt ein direkter Weg zum Adagio der Symphonie in Fis. Dazwischen liegen zwei Weltkriege, Austreibung und Exil. Sie haben im Werk Korngolds unüberhörbare Spuren eingegraben. Den affirmativen, lebensbejahenden Grundton seiner Musik konnten sie wohl verändern, aber nicht brechen. Wie ein ungeschriebenes Programm scheint über Korngolds Gesamtwerk als Motto zu stehen, was einst der Arbeitstitel seiner Oper Die tote Stadt war: der Triumph des Lebens.
Korngolds Hoffnung auf ein Nachkriegs-Comeback blieb unerfüllt. Sein Versuch, in Wien mit der Symphonie in Fis »in die Situation meines gegenwärtig so verkannten und vernachlässigten Schaffens eine Bresche zu schlagen«, war damals gescheitert. 1955 kehrte der Komponist deprimiert aus Wien endgültig nach Amerika zurück. Erich Wolfgang Korngold teilte das bittere Los der ins Exil Getriebenen, das Carl Zuckmayer bereits 1939 in seiner Elegie von Abschied und Wiederkehr prophezeit hatte: »Ich weiß, ich werde alles wieder sehen / Und nichts mehr finden, was ich einst verlassen.« Korngold starb, erst 60jährig, am 29. November 1957 in North Hollywood. In seinem Nachlass fanden sich erste Skizzen zu einer geplanten 2. Symphonie.
Di, 18. Nov 2025, 19:30
Mittlerer Saal
Herta Müller & Duo Brüggen-Plank
Der Beamte sagte Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist für eine Lesung ihrer Erzählung
Der Beamte sagte im Brucknerhaus zu Gast, musikalisch unterstützt vom Duo Brüggen-Plank.
Mo, 24. Nov 2025, 19:30
Großer Saal
Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra
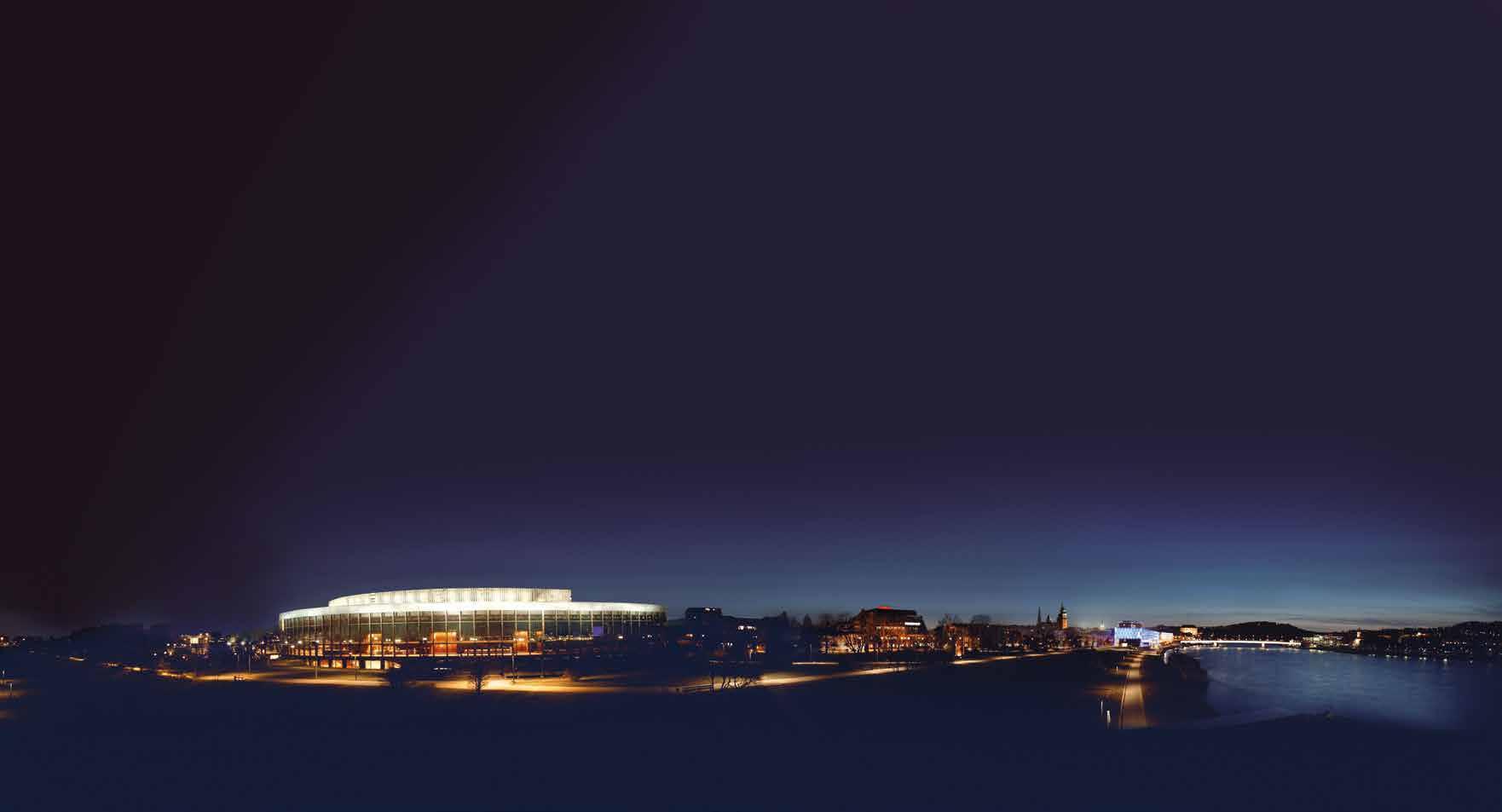
Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.
Mi, 10. Dez 2025, 19:30
Großer Saal
Hrůša & Wiener Philharmoniker
Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.



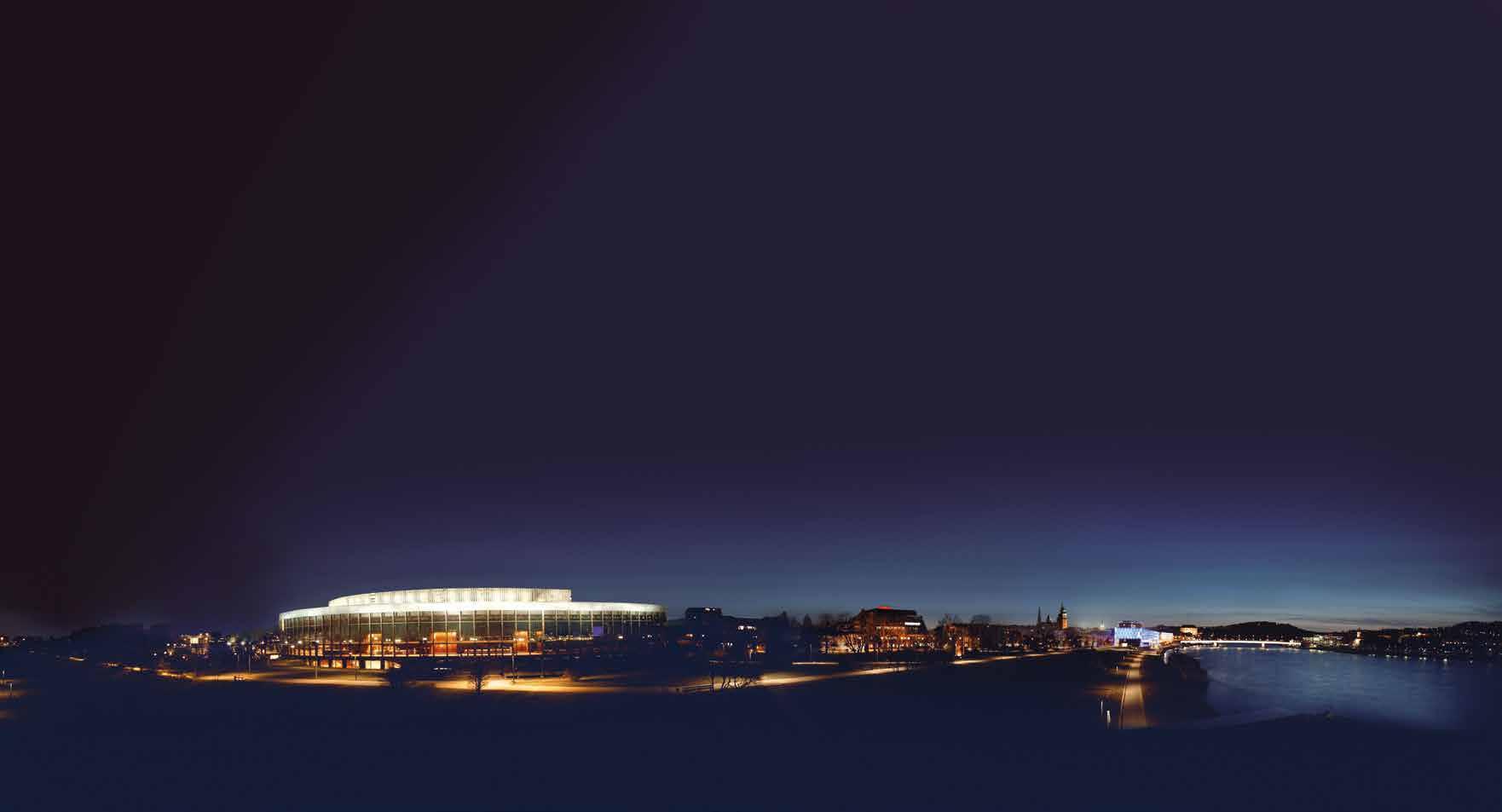

Klavier
Giuseppe Albanese debütierte 2014 beim Label Deutsche Grammophon mit dem Konzeptalbum Fantasia, gefolgt von seinem zweiten DG-Album Après une lecture de Liszt im Jahr 2015. 2016 veröffentlichte Decca Classics seine WeltpremiereAufnahme des Stücks Vàltozatok – Variationen von Béla Bartók. 2018 erschienen die beiden Klavierkonzerte und Malédiction von Franz Liszt bei Universal Music und 2020 sein drittes DGAlbum Invitation to the Dance. Albanese wird von renommierten internationalen Häusern wie dem Metropolitan Museum of Art, der Rockefeller University und der Steinway Hall in New York, dem Konzerthaus Berlin, der Laeiszhalle Hamburg, der Philharmonie Essen, dem Brucknerhaus Linz, dem Mozarteum Salzburg, St. Martin-in-the-Fields in London, der Salle Cortot in Paris, dem Museu Calouste Gulbenkian in Lissabon und dem Teatro Colón in Buenos Aires eingeladen. Er ist Gast bei internationalen Festivals wie dem Winter Festival Arts Square von Yuri Temirkanov in Sankt Petersburg, dem Castleton Festival von Lorin Maazel (USA), dem Internationalen Klavierfestival von Brescia und Bergamo, dem Festival MITO SettembreMusica in Mailand und Turin, der Biennale Musica in Venedig, dem Festival International de Colmar, En Blanco y Negro in Mexico City, dem Tongyeong International Music Festival in Südkorea und dem Internationalen Brucknerfest Linz. In Italien spielte er in allen wichtigen Konzertsälen wie der Sala Santa Cecilia und dem Auditorium Rai in Turin.
Giuseppe Albanese wurde 2003 mit dem ersten Preis beim Vendôme Prize in New York ausgezeichnet (in der Jury waren Elisabeth Leonskaja, Christa Ludwig und Sir Jeffrey Tate). Außerdem gewann er 1997 den Premio Venezia und den Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks beim Concorso Busoni in Bozen. Er promovierte mit summa cum laude zum Doktor der Philosophie und war mit nur 25 Jahren Dozent an der Universität von Messina. Er hat eine Professur für Klavier am Konservatorium Maderna-Lettimi in Cesena-Rimini inne.

Das Bruckner Orchester Linz (BOL) zählt zu den führenden Klangkörpern Mitteleuropas, blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück und trägt seit 1967 den Namen des Genius loci. Seit dem Amtsantritt von Markus Poschner als Chefdirigent vollzieht das BOL einen weithin beachteten Öffnungsprozess, der neue Formate generiert, unerwartete Orte aufsucht, in der Vermittlung überraschende Wege findet und vor allem für künstlerische Ereignisse in einer unnachahmlichen Dramaturgie sorgt, die ob ihrer Dringlichkeit und Intensität bei Publikum und Presse unerhörte Resonanz hervorrufen. Markus Poschner und das BOL sind einer ureigenen Spielart der Musik Anton Bruckners auf der Spur und lassen diese in einem unverwechselbaren oberösterreichischen Klangdialekt hören. Das BOL ist nicht nur das Symphonieorchester des Landes Oberösterreich, sondern spielt die musikalischen Produktionen des Linzer Landestheaters im Musiktheater – einer der modernsten Theaterbauten

Europas und Heimstätte des Orchesters. Konzerte beim Internationalen Brucknerfest Linz, Konzertzyklen im Brucknerhaus und spektakuläre Programme im Rahmen des Ars Electronica Festivals gehören genauso zum Spielplan des Orchesters wie Auftritte als Botschafter Oberösterreichs und seines Namensgebers auf nationalen und internationalen Konzertpodien. Seit 2012 hat das Bruckner Orchester Linz einen eigenen Konzertzyklus im Wiener Musikverein und seit 2020 auch einen im Brucknerhaus Linz. Die Zusammenarbeit mit großen Solist:innen und Dirigent:innen unserer Zeit unterstreicht die Bedeutung des oberösterreichischen Klangkörpers. Das Bruckner Orchester Linz wurde beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2020 als ›Orchester des Jahres‹ und 2024 mit dem ICMA Special Achievement Award für die Gesamteinspielung der Bruckner-Symphonien in allen Fassungen unter Markus Poschner ausgezeichnet.

Dirigent
Seit der Auszeichnung mit dem Deutschen Dirigentenpreis gastiert
Markus Poschner regelmäßig bei Spitzenorchestern und Opernhäusern der KlassikWelt, darunter das Deutsche SymphonieOrchester Berlin, die Staatskapelle Berlin, die Sächsische Staatskapelle Dresden, das SWR Symphonieorchester, die Bamberger Symphoniker, die Wiener Symphoniker, das Orchestre Philharmonique de Radio France, das NHK Symphony Orchestra Tokyo, die Staatsopern in Berlin, Wien, München und Hamburg sowie das Opernhaus Zürich. Im Jahr 2022 eröffnete er die Bayreuther Festspiele mit einer Neuproduktion von Tristan und Isolde und leitete diese Produktion auch 2023.
Zur Spielzeit 2026/27 wird der gebürtige Münchner, der zudem leidenschaftlicher Jazzpianist ist, neuer Chefdirigent des traditionsreichen ORF RadioSymphonieorchesters Wien, bereits 2025/26 tritt er die Position als Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel an und ab 2027/28 übernimmt
Markus Poschner außerdem die Position als Music Director der Utah Symphony. Von 2015 bis 2025 war er Chefdirigent des Orchestra della Svizzera italiana, mit dem er den renommierten International Classical Music Award (ICMA) 2018 für die Gesamteinspielung der BrahmsSymphonien sowie erneut 2025 für seine Hindemith/SchnittkeAufnahme gewann. Seine Einspielung von Jacques Offenbachs Maître Péronilla mit dem Orchestre National de France wurde mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2021 ausgezeichnet. Für die Gesamtaufnahme sämtlicher Bruckner-Symphonien mit dem Bruckner Orchester Linz, dessen Chefdirigent Markus Poschner seit 2017 ist, und dem ORF RadioSymphonieorchester Wien erhielt er 2024 den Special Achievement Award des ICMA. Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz wurde er außerdem beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2020 mit den Auszeichnungen ›Orchester des Jahres‹ und ›Dirigent des Jahres‹ geehrt.

Herausgeberin
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz
Redaktion
Andreas Meier
Biografien
Philipp Kehrer, Romana Gillesberger
Lektorat
Celia Ritzberger
Gestaltung
Lukas Eckerstorfer, Anett Lysann Kraml
Abbildungen
gemeinfrei (S. 7, 12, 15 & 19), Österreichische Nationalbibliothek Wien (S. 22–23), D. Barraco (S. 29), R. Winkler (S. 30–31), K. Kikkas (S. 33)
Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten
LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz
Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

vossentowels vossen_towels vossentowels