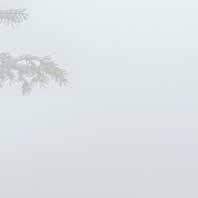Erdgas, Öl, Strom und Wasser
Wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her?
Elektromobilität
Das sollten Sie unbedingt wissen
Wasserstoff und die Zukunft
Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?



Wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her?
Elektromobilität
Das sollten Sie unbedingt wissen
Wasserstoff und die Zukunft
Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?


Bewegt sein ist schön. Besser ist sich selbst bewegen. Warum sind unsere Strompreise von Gasmärkten abhängig, obwohl wir in unserem Land nur erneuerbare Energie erzeugen?
Südtirol kann auf das Marktdesign und die Preisgestaltung einwirken. Man hat uns gesagt, dass sei nicht realisierbar. Aber es ist möglich. Das haben wir bewiesen. Wir können auf unseren eigenen Beinen stehen. Man muss es nur wollen.







Wir sind voller Energie
Heizungsfachhandel Bruneck
T. 0474 55 32 33 | www.imperial.bz


Topline 2120 vollmodulierende Lufwärmepumpe von KNV, die Wärmepumpe der Extraklasse



Nutzen Sie die ganze Energie, von der Sie umgeben sind!
• Wärmepumpen sind heute das sauberste und günstigste System zu heizen und Wasser zu erwärmen
• Sie können die Energie von der Erde, dem Wasser oder der Luft entziehen
• Jährliche Energiekosten deutlich unter 800 € bei einem Klimahaus A (Reihenhaus 110 m2)
• Ideal in Kombination mit Photovoltaik
Kein Haustechnik-System arbeitet kostengünstiger und energieeffizienter als Erdwärmepumpen. Im Winter nutzen sie das im Vergleich zur Außentemperatur relativ warme Erdreich. Beim Kühlen im Sommer schaffen sie ein angenehmes Raumklima, indem sie die Temperaturen des Erdbodens sanft ins Innere des Hauses übertragen. Die Wärme für die Erdwärmepumpen wird dem Erdreich entzogen und kommt entweder aus Flächenkollektoren, Ringgrabenkollektoren, Tiefenbohrungen oder von Grundwasserbrunnen.
Luftwärmepumpen sind der einfachste Weg, um kostengünstig zu heizen, zu kühlen und um Warmwasser aufzubereiten. Ihre Energie entziehen sie der Umgebungsluft, die praktisch überall zur Verfügung steht. Ihr zentraler Vorteil: Es herrscht weniger Raumbedarf, und die Anlagen lassen sich praktisch überall schnell und einfach installieren.




Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen
Nr. 26/01, am 27.11.2001
Chefredakteur: Franz Wimmer
Projektleiterin: Magdalena Pöder
Verkaufsleitung: Patrick Zöschg
Redaktion: Franz Wimmer, Nicole D. Steiner, Elisabeth Stampfer, Edith Runer
Werbung/Verkauf: Armin De Biasio, Michael Gartner, Elisabeth Scrinzi, Wolfgang Göller
Verwaltung: Weinbergweg 7 39100 Bozen | Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it
Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und OnlineArchive sowie Verkaufsunterlagen.
Konzept und Abwicklung: MediaContact, Eppan
Grafik/Layout: Simon Krautschneider, Elisa Wierer
Lektorat: Magdalena Pöder
Produktion: Athesia Druck Bozen www.athesia.com
Vertrieb: Als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand
Druckauflage: 23.000 Stück
Preis: Einzelpreis 2 Euro, A+D: 2,60 Euro
Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und der angeführten Webseiten.
Aktuell
6 Erdgas, Öl, Strom und Wasser, …
9 Stromerzeugung und Verbrauch
11 Eine dezentrale Energiewirtschaft
12 Mit der Kraft des Wassers
16 Wasserkraftwerk DUN
20 Elektromobilität
28 Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?
31 Kraftwerk Suldenbach
34 Natürliches Badevergnügen
36 Unser gutes Trinkwasser
40 20. KlimaHaus Awards
42 Mobil in die Zukunft
44 Gut gehäckselt
48 Unabhängig in der Energieversorgung?
53 Mobilitätszentrum Brixen
56 Power – woher auf Dauer?



14 Alpin GmbH, Bozen
15 Würth GmbH, Neumarkt
24 Niederstätter AG, Bozen
25 Selectra AG, Bozen
26 Hypo Vorarlberg Leasing AG, Bozen
27 GKN Hydrogen, Bruneck
30 Hydrocell GmbH, Bozen
35 Platter Biopools, Eppan
38 eco center AG, Bozen
46 ÖkoFEN Italia GmbH, Naturns
47 Leitner Electro, Bruneck
52 Frigoplan Kältetechnik, Andrian
59 Südtirol Chalets Valsegg, Vals
Rubriken
57 Gesundheit: Antibiotika sind die falsche Therapie
58 Portrait: Astrid Michaeler
60 Fragen an den Experten
62 Bunte Meldungen




Die Zeitenwende – könnte das Wort des Jahres werden. Zeitenwende steht nach dem brutalen Überfall von Russland auf die Ukraine, für eine geeinigte NATO, für eine gefestigte EU, für eine gewaltige Aufrüstung des Westens – möglicherweise für eine neue Phase des „Kalten Krieges“. Innerhalb weniger Wochen hat der oberste aller Oligarchen – Wladimir Putin, damit genau das Gegenteil erreicht von dem was er eigentlich wollte – abgesehen von einem schnellen Sieg über die Ukraine. Auch die enorme Aufwertung und die verstärkte Forschung in alternative Energieformen gehen damit auf seine Kappe. Die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die explodierende Energiepreise sind auch in dieser RadiusAusgabe ein Thema. Die Energie-Autonomie, BiogasAnlagen, Wasserstoff, E-Mobilität, Wasserkraft, usw., dass sind Schlagworte, welche in unserem Land eine ganz neue Bedeutung erfahren haben. Woher kommt das Erdgas, wie abhängig ist Italien von Russland, wo und wie kann Energie gespart werden, das und vieles mehr lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Franz Wimmer
Tankschiffe für zusätzliche LNG-Lagerkapazitäten wurden an der oberen Adria und an der ligurischen Küste platziert.

... wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her? Seit dem Ukrainekrieg ist uns schmerzlich bewusst geworden, wie abhängig wir von den verschiedensten Energieformen und lieferanten sind. Dabei sind die Energiepreise schon vorher aufgrund der massiven Verbrauchssteigerung durch die Neustarts der Industrie und anderer Branchen nach der CoronaPandemie empfindlich gestiegen.
Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ist eine, auch von den internationalen Öl- und Erdgaskonzernen gesteuerte Verknappung von Öl und Erdgas eingetreten. In Wahrheit gibt es keine Verknappung auf dem Weltmarkt, ganz im Gegenteil: Es gibt genug Erdgas – nur ist der Gaspreis in Höhen geklettert, wo es für die einzelnen
Daten zum Erdgas
• 2021 hat Südtirol 360 Millionen Kubikmeter Erdgas verbraucht.
• 68 Gemeinden werden mit Erdgas versorgt.
• Das Erdgasnetz umfasst eine Länge von über 2.000 Kilometern.
• In Südtirol gibt es 82.000 Gaszähler.
Länder wenig Sinn macht, die nationalen Speicher für den Winter zu füllen. Wobei die Abhängigkeit der einzelnen EU-Länder vom russischen Erdgas und Öl höchst unterschiedlich ist.
Südtirolgas als Verteiler im Land
Die Gesellschafter von Südtirolgas sind zu 51 Prozent die Selfin GmbH (112 Südtiroler Gemeinden) und zu 49 Prozent die TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, ein Tochterunternehmen der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG. Als
Netzbetreiber ist Südtirolgas verantwortlich für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung des Erdgasnetzes und der gesamten Anlagen zur Erdgasversorgung. Zählerablesung, Verwaltung und Erfassung der Verbrauchsdaten sind weitere Aufgaben. Südtirolgas ist nicht für den Verkauf zuständig, wohl aber für den Netzzugang der Verkaufs-Gesellschaften. Zu den Kennzahlen wie Menge, Bedarf nach Nutzung und Verteilernetz hier einige Daten und Grafiken.
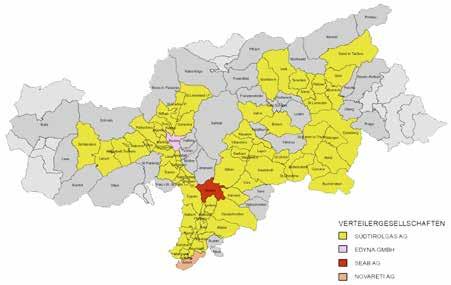
Unterteilungsgebiete von Erdgas in Südtirol
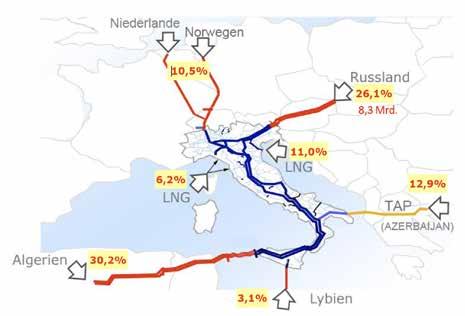
Der Import aus Russland konnte 2022 von 40 Prozent auf gut 23 Prozent reduziert werden
Italien steht vergleichsweise gut da In Europa sind die großen Volkswirtschaften ganz unterschiedlich aufgestellt. Durch den Ausstieg aus dem Atomstrom und die Reduzierung von Kohle stammen über 50 Prozent der Gasimporte Deutschlands aus Russland. Frankreich setzt nach wie vor auf Atomstrom, benötigt daher viel weniger Erdgas und bezieht nur 15 Prozent des Gasbedarfes aus Russland. Auch in Italien ist man seit dem letzten Jahr von Russland nicht mehr so abhängig. Dank der direkten Gasleitungen aus Libyen, Algerien und der neuen Gasleitung (siehe Grafik) von Aserbeidschan über die Türkei und Griechenland nach Apulien konnte der Import des russischen Erdgases von Jänner bis Juli 2022 von 40 Prozent auf gut 23 Prozent verrin-
Erdgas in Südtirol nach Bedarf
Erdgasnutzung in Prozent
Industrie + Handwerk 43,2 %
Gastgewerbe 12,1 %
Haushalte (Heizung, Kochen, Warmwasser) 33,5 %
Fernwärme 11,0 %
Mobilität 0,2 %
gert werden. Detail am Rande: Der Bau dieser neuen Leitung aus Aserbeidschan wurde von der 5-Sterne-Bewegung über Jahre hindurch massiv kritisiert.
Vorsorge für den Winter
Unabhängig von der Verfügbarkeit ist der Erdgaspreis innerhalb einiger Monate um das Dreifache gestiegen. Diese Tatsache führt in den meisten EULändern zu enormen Preissteigerungen und einer Inflationsrate, so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi reagierte unter anderem mit zwei Ministerial-Dekreten. Nachdem die privaten Gesellschaften zu wenig in Sachen Vorrats-Speicherung unternommen hatten, beauftragte er erst die staatliche SNAM und dann den

GSE (Gestore Servizi Energetici), die Speicher zu füllen. Die SNAM begann daraufhin, mit einer Menge von bis zu 100 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag die Gasspeicher zu füllen. Im April waren in Italien die Speicher zu 25 Prozent gefüllt, mittlerweile sind es 78 Prozent. Zudem verfügt Italien über drei LNG-Terminals zur Entladung von Flüssiggas. Im Vergleich dazu: In Deutschland hat man mit dem Bau des ersten Speichers gerade begonnen. Die Hauptlieferanten von LNG sind Katar und die USA (Produktion mit dem umstrittenen Fracking-Verfahren). Zudem wurden von SNAM zwei weitere Tankschiffe gekauft, um diese als zusätzliche LNG-Terminals, je eines in der Adria und eines an der ligurischen Küste, zu benutzen.

3-stufiger Notfallplan
Südtirol hat im vergangenen Jahr ca. 360 Millionen Kubikmeter Erdgas verbraucht. Wer davon wie viel verbraucht hat, kann am besten der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, existiert ein nationaler 3-stufiger Notfallplan; derzeit befinden wir uns auf Stufe 2. Das heißt unter anderem, dass die nationalen Versorger angehalten sind, die Speicher für die mögliche 3. Stufe zu füllen. Erst auf Stufe 3 wird von der Regierung eine Rationalisierung nach Bedarf, verbunden mit massiven Sparmaßnahmen, eingeführt. Einige Beispiele: Umstellung der thermischen Kraftwerke (Stromproduktion) von Erdgas auf Kohle, Umstellung der Industrie von Erdgas auf Schweröl, Temperatur-Reduzierung in privaten und öffentlichen Gebäuden im Winter, Verbot von Klimaanlagen bis 26 Grad Raumtemperatur im Sommer, Einschränkung des Individualverkehrs usw. Falls Italien bis Ende Oktober, wie dies wahrscheinlich ist, die Speicher zu 90 Prozent gefüllt hat, kann der Winter problemlos mit nur einigen dieser Maßnahmen überstanden werden.
Mit Biomethan in die Energiewende Biomethan ist eine Mischung aus Methan (50 bis 70 Prozent), CO2 und anderen Nebenkomponenten, wie Wasserdampf, Stickstoff und Schwefeloxidenn. Gewonnen wird Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen (Gülle, Mist, Biomüll) in Klär- und Vergärungsanlagen, Deponien und in der Landwirtschaft. Biomethan ist reines Methan
Milchproduktion circa 400.000.000 Liter pro Jahr Eine erste ungefähre Berechnung mit den folgenden Koeffizienten:
• 6 kg Gülle/Mist pro Liter Milch,
• 40 m³ Biogas pro Tonne Gülle/Mist,
• 0,55 m³ Biomethan pro m³ Biogas ergibt sich eine jährliche Biomethan-Produktion von ca. 52,8 Millionen m³.
• Gelingt es, auch nur die Hälfte davon zu nutzen, dann sind es 26,4 Millionen m³.
nicht fossilen Ursprungs und somit klimaneutral. Dieses Biogas ist qualitätsmäßig vom Erdgas nicht zu unterscheiden und ersetzt durch Einspeisung in das Verteilernetz das Erdgas eins zu eins. Sektoren für die Erzeugung sind: Landwirtschaft, Kläranlagen, Vergärungsanlagen und Mülldeponien. Als Beispiel Mist und Gülle aus der Landwirtschaft:
Dass diese Berechnungen nicht nur Theorie sind, beweist die Biogas Wipptal GmbH. Die Bauern produzieren etwa zehn Prozent der Südtiroler Milch. Die Biogasanlage im Wipptal produziert jährlich 5,5 Millionen Kubikmeter Biomethan, das sind in etwa 10 Prozent der geschätzt möglichen Produktion in Südtirol. Da die Anlage etwa 26 Kilometer vom nächsten Erdgasverteilernetzwerk entfernt ist, wird das Biomethan gekühlt, verflüssigt (LNG) und als LKW-Treibstoff genutzt.
Einige Tausend Ölbrenner sind in Südtirol in Verwendung.

Mit Biomethan angetriebene Motoren erzeugen elektrische Energie In der Vergärungsanlage Tisner Auen in Lana wird das Biogas in zwei Motoren verbrannt, um daraus Strom zu erzeugen. Auch von den größten Kläranlagen Südtirols könnte ein bedeutender Beitrag kommen. „Aus technischer Sicht ist eine Anlage zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan billiger und einfacher zu betreiben als ein BHKW (Blockheizkraftwerk)“, gibt Michele Gilardi von Südtirolgas zu bedenken. „Zudem macht es aus Umweltsicht viel mehr Sinn, weil die Energienutzung in einem Motor nicht optimal ist, da nur 45 Prozent der im Biogas enthaltenen Energie in elektrische Energie umgewandelt werden und der Rest als Wärme an die Atmosphäre verloren geht.“ Mit dem Potential für Biomethan könne in Südtirol schon in naher Zukunft die Energiewende eingeleitet werden, ist Michele Gilardi überzeugt.
Heizanlagen mit Öl oder Propan
In beiden Fällen handelt es sich um Heizanlagen nicht nur für Haushalte, die sich in Gemeinden finden, wo es kein Erdgas- oder Fernwärmenetz gibt, sondern auch für Haushalte, die vom Versorgungsnetz nicht erreicht werden bzw. die sich unterschiedlichen Gründen (die Heizungsanlage ist noch nicht so alt, keine Mehrheit in der Wohnungseigentümerversammlung usw.) nicht ans Netz anschließen wollen oder können.
Die Zahl von aktiven Heizanlagen mit Öl oder Propan ist also sicherlich nicht unerheblich. Erstaunlicherweise gibt es darüber nur ungenaue Angaben. Die Statistik erfasst nur Anlagen über 35 kW (Anlagen für Zweifamilienhäuser und Kondominien). Diese Statistik wurde über die Emissionsmessungen der Kaminkehrer erstellt. Demnach gibt es in Südtirol etwa noch 4.000 Heizanlagen, die noch mit Öl laufen. Nicht in dieser Statistik erfasst sind schätzungsweise einige Tausend kleinere Anlagen, welche z.B. in Wohnungen, Einfamilienhäusern oder Bauernhöfen zu finden sind.

Seit 125 Jahren wird in Südtirol die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt. 1897 ging in Mühlen im Pustertal das erste EWerk ans Netz. Im gleichen Jahr entstand in Töll bei Meran das erste große Wasserkraftwerk in Südtirol.
Im Jahr 1931 wurde das Kraftwerk in Kardaun als damals größtes Wasserkraftwerk Europas in Betrieb genommen. Zur Eröffnung war sogar Benito Mussolini nach Bozen gekommen. 1941 beginnen im Oberen Vinschgau die Arbeiten für den Bau des Reschen-Stausees. Erst nach der Staudamm-Katastrophe an der VajontTalsperre bei Longarone im Oktober 1963 verzichtet Italien auf den Bau weiterer Talsperren im Alpenbogen. Die einheimische Energieproduktion wird dem Einfluss des Landes Südtirol weitgehend entzogen.
Strom für Norditaliens Industrie
Auch für Wolfram Sparber von Eurac Research ist ein Rückblick in die Zeit zwischen den Kriegen und in die 40erund 50er-Jahre angebracht. Warum wird in Südtirol allein aus Wasserkraft fast doppelt so viel Strom erzeugt, wie selbst gebraucht wird? Weil die Wirtschaftszentren in Norditalien da-
mals einen enormen Bedarf an Strom hatten. „Die Südtiroler hätten niemals ihre besten Kulturgründe den Stauseen am Reschenpass, in Ulten oder im Schnalstal geopfert. Die Faschisten nahmen darauf keine Rücksicht, und im Zuge der Italienisierung von Südtirol kamen auch für den Bau der Kraftwerke und der Überlandleitungen Tausende Arbeiter aus dem Süden in unser Land“, so Sparer.
Doppelt so viel Strom wie Eigenbedarf Dank dieser Anlagen, gebaut von den Faschisten, um Norditalien mit Strom zu versorgen, produziert Südtirol neun Monate lang Strom im Überfluss, und nur im Winter wird Strom eingekauft.
Der Verbrauch insgesamt – saisonal bestehen große Schwankungen – liegt je nach Jahrestemperatur zwischen drei und vier Terrawattstunden. Die produzierte elektrische Energie wird nahezu zur Gänze an die italienische Strombörse verkauft, und die Haushalte bzw. die Firmen beziehen den Strom dann bei den verschiedenen Händlern wie Alperia, Enel, Ötzi (vom SEV) oder VION (in Mals). Auf Wunsch kann auch nur grün zertifizierter Strom eingekauft werden. Großabnehmer wie die Schwerindustrie oder IVECO haben eigene Anschlüsse bzw. Sondervereinbarungen mit den Produzenten. Das gilt auch für einige Energie-Genossenschaften,

Vernagt-Stausee im Schnalstal

Effizient, aber unbeliebt. Das Windrad von „Leitwind“ auf der Malser Haide musste wieder abgebaut werden. Ein Fehlentscheidung?
die schon vor der derzeitigen Regelung (seit dem Jahr 2010) ihre eigenen Kraftwerke und Stromleitungen hatten. Beispiele: genossenschaftlich organisierte Produzenten (non-profit) mit staatlichen Sondervereinbarungen wie im Ahrntal, im hinteren Passeiertal, in Villnöß, Wiesen/Pfitsch, Glurns und einigen weiteren Orten.
Machen Pumpspeicher-Kraftwerke Sinn?
Elektrische Energie ist tagsüber unterschiedlich teuer, da zu gewissen Tageszeiten unterschiedlicher Strombedarf besteht. Am teuersten ist der so genannte Spitzenstrom, der z.B. im Kraftwerk St. Anton (Bozen), in Schnals und im Martelltal erzeugt wird. Diese Werke können kurzfristig für einige Stunden eine hohe Leistung bringen, haben aber zu wenig Wasser für einen durchgehenden Betrieb. PumpspeicherKraftwerke basieren auf der Situation, dass im Moment von überschüssigem z.B. Nachtstrom Wasser zurück in die Speicher gepumpt wird, um zu Spitzenzeiten tagsüber genug Wasservorräte zu haben, um durchgehend Spitzenstrom zu produzieren. Sie dienen somit nur zum Teil als Kraftwerk, zum Teil arbeiten sie wie eine Batterie, welche in

Strom aus Solarenergie ist in Südtirol durchaus ausbaufähig. Solarparks dieser Größenordnung wird es wohl kaum geben.
bestimmten Momenten Strom aufnimmt, um sie in anderen (mit kleinen Verlusten) wieder abzugeben.
Ewig lange Genehmigungsverfahren
In Italien ist allerdings auch in Bezug auf erneuerbare Energie der Staat samt seiner Bürokratie der größte Bremser. 14 Jahre hat das Genehmigungsverfahren für einen Offshore-Windpark gedauert. Laut einer Studie des Unternehmerverbandes dauern die Genehmigungsverfahren für alternative Energie Anlagen im Durchschnitt 7,5 Jahre. Dabei könnte Italien auch ganz anders –wie es bei der Morandi-Brücke in Genua bewiesen hat. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren inkl. Verfahren stand die viel befahrene Brücke wieder. Und das Ganze in einer wirtschaftlich höchst diffizilen Zeit (Corona, Arbeitermangel, Mangel an Baumaterialien etc.).
Maßnahmen zum Stromsparen
Was das Energiesparen z.B. in einem Kondominium betrifft, so kann man kurzfristig im Winter mit einer Verringerung der Raumtemperatur um zwei Grad ca. zwölf Prozent der Heizenergie einsparen. Ähnlich verhält es sich im Sommer mit den Klimaanlagen, wenn

man statt auf 20 Grad nur auf 23 Grad Raumtemperatur abkühlt. Mittel- und langfristig ist die effizienteste Einsparung die Gebäudesanierung. Das geht zwar relativ langsam, in Südtirol werden pro Jahr etwa 1,5 bis 2 Prozent der Gebäude baulich (Fenster, Türen, Fassaden, Dach, Keller) saniert. Der Einsatz von Photovoltaik, von Biomasse und Wärmepumpen zur Energiegewinnung trägt natürlich auch dazu bei, fossile Energie zu sparen, und könnte in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag leisten.
Energiesparen mit Fernwärme Dazu Wolfram Sparber von Eurac Research: „Fernwärme ist eine effiziente Art der Wärmeerzeugung und -verteilung. Das Fernwärmenetz erlaubt es, Hunderte oder Tausende kleine Heizanlagen durch wenig große zu ersetzen. Diese sind meist effizienter, enthalten moderne Filtersysteme und werden ständig überprüft und gewartet. Zusätzlich können in einem Fernwärme-Netz diverse Heizanlagen (wie Biomasse, Erdgas, Abwärme, Wärmepumpen usw.) miteinander kombiniert werden. In Südtirol haben wir ca. 80 Systeme, davon laufen ca. 70 auf Biomasse.“

Als Branchendachverband unterstützt der Südtiroler Energieverband SEV eine dezentrale Energiewirtschaft, die in unserem Land vor mehr als 100 Jahren entstanden ist und ausschließlich mit erneuerbarer Energie arbeitet.
Mit seinem Kompetenzzentrum bietet der Verband mehr als 300 Mitgliedsbetrieben Dienstleistungen wie den Stromhandel, die Zählerfernauslese, das Erstellen und den Versand von Rechnungen, technischen Support, Weiterbildungsangebote und eine Rechtsberatung an –und ist damit als einziger Verband in Südtirol in der Lage, alle Bereiche der Energiewirtschaft abzudecken. A ls Lobbyist vertritt der SEV in Italien und in Europa die Interessen von Genossenschaften und Stadtwerken sowie von kleinen und mittleren privaten Betrieben.
Ein Blick in die Zukunft Eine Zeitenwende? Energiegemeinschaften, die mit erneuerbarer Energie ihren eigenen Strom erzeugen, sind ein Schlüsselelement einer klimafreundlichen Energieversorgung. Eine Energie gemeinschaft wird von ihren Anteilseignern oder Mitgliedern geführt und kann nicht nur Anlagen zur Stromproduktion errichten, sondern neben der Erzeugung, der

Verteilung und der Speicherung von elektrischer Energie auch Energiedienstleistungen anbieten. Um Strom produzieren zu können, muss die Energiegemeinschaft eine eigene Erzeugungsanlage errichten und betreiben. Die Leistungsgrenze liegt bei einem Megawatt. Zudem müssen alle Mitglieder der Energiegemeinschaft am selben Umspannwerk angeschlossen sein. Damit können auch Eigentümer weit entfernt voneinander liegender Liegenschaften eine Energiegemeinschaft bilden. 2020 führte der SEV mit der staatlichen Forschungseinrichtung RSE ein erstes Pilotprojekt im Vinschgau durch. In Cavalese betreut der SEV den Aufbau einer Energiegemeinschaft und bietet entsprechende Beratungsleistungen an.
Die Verbrauchergenossenschaft Ötzi Strom

2019 initiierte der Südtiroler Energieverband SEV die Gründung der Verbrauchergenossenschaft „Ötzi Strom“, die Haushalts- und Businesskunden beliefert. Demokratisch und nachhaltig, fair und transparent: Ötzi Strom bündelt die Leistung kleiner und mittlerer Wasserkraftwerke in Südtirol und bietet als genossenschaftlicher Stromversorger erneuerbare Energie aus einheimischer Produktion an. Ötzi Strom
entspricht damit einer Zukunftsvision der Gründungsmitglieder des SEV und ist eine Alternative für Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten, die sich wie viele Südtirolerinnen und Südtiroler, keiner lokalen Energiegenossenschaft oder keinem lokalen E-Werk anschließen können.
Die Energieautonomie
In der italienischen Energielandschaft nimmt Südtirol eine Ausnahmestellung ein. In Südtirol gibt es 48 Stromverteiler, in ganz Italien 131. In Südtirol werden jährlich 6,8 TWh Strom produziert. 6,6 TWh liefern erneuerbare Energiequellen, und 88 Prozent des „grünen“ Stroms erzeugen mehr als 1.000 Wasserkraftwerke. Südtirol verbraucht pro Jahr aber nur 3,2 TWh Strom. Südtirol kann auf die Ausgestaltung dieses lokalen Strommarkts einwirken. Im Frühjahr hat der SEV mit der Handelskammer Bozen ein Rechtsgutachten erstellen lassen, dessen Ergebnis eindeutig ist: Das Land kann nicht nur eine Regulierungsbehörde im Bereich Energie aufbauen, sondern es muss das sogar tun, wenn es seine im Autonomiestatut festgeschriebenen Zuständigkeiten nutzen will. Derzeit übernimmt diese Kompetenzen der Staat. Eine autonome Marktregelung schließt Handlungsspielräume in der Preis- und Vertragsgestaltung ein. Man muss nur den Mut haben, diese einmalige Gelegenheit aktiv zu nutzen.











































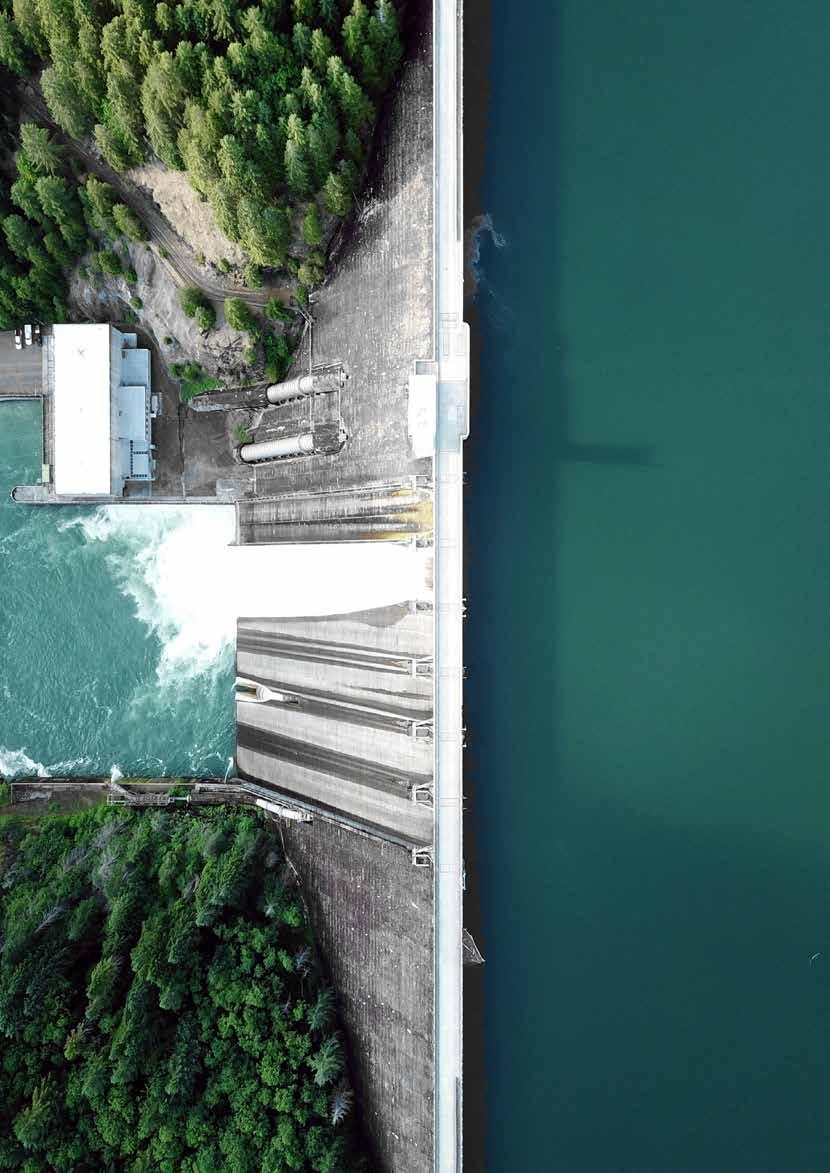
Bäche, Flüsse und Seen sind wichtige Energiequellen. Das wussten die Menschen schon vor Jahrhunderten. Bis heute lässt sich aus Wasser elektrischer Strom gewinnen – ganz ohne Emissionen. Damit das funktioniert, braucht es neben Wasser vor allem eines: Turbinen.

Weltweit gesehen ist Wasserkraft heute – nach Kohle und Erdgas –die drittwichtigste Energiequelle für die Gewinnung von Strom. Mehr als 16 Prozent des weltweiten Strombedarfs wird aus Wasserkraft gewonnen. Vor allem große Länder wie China und Brasilien setzen auf Wasserkraft. In Europa gelten Norwegen und Island als Vorreiter: Sie decken fast ihren gesamten Strombedarf mit Wasserkraft. In Südtirol kommen rund 90 Prozent des erzeugten Stroms aus Wasserkraft. Strom aus Wasserkraft gilt als nachhaltig und ressourcenschonend. Wasserkraftwerke nutzen nämlich die Ressource Wasser, verbrauchen sie aber nicht. Außerdem werden während der Stromproduktion keine klimaschädlichen Gase ausgestoßen. Spricht man von Strom aus Wasserkraft unterscheidet man zwischen Laufwasserkraftwer-
ken, Gezeitenkraftwerken, Speicherkraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken und Wellenkraftwerken. Das Funktionsprinzip der Kraftwerke bleibt im Wesentlichen aber immer dasselbe.
Wasserkraftmaschine Turbine Herzstück eines jeden Wasserkraftwerks ist die Turbine. Die Vorläufer der modernen Wasserturbine sind Wasserräder, die bereits in der Antike genutzt wurden. Bei einem Wasserrad trifft der Wasserstrahl von oben auf die Schaufeln und setzt das Rad in Bewegung. Dieses wiederum treibt dann zum Beispiel Mühlsteine an. Wasserräder zur Energiegewinnung funktionieren zwar, allerdings geht dabei auch sehr viel Energie verloren. Zwar funktionieren moderne Wasserturbinen noch immer nach demselben Prinzip, aber mit einem sehr viel höheren
Wirkungsgrad. Sie können die Wasserenergie zu über 80 Prozent in Bewegung umwandeln. Nur ein kleiner Teil der Wasserenergie geht – etwa durch Reibung in den Dichtungen – verloren. Wichtig ist es, die Wasserturbine genau an die Fallhöhe und die Durchflussmenge des Wassers anzupassen. Die meisten Turbinen sind daher Einzelanfertigungen. Im Wesentlichen unterscheidet man heute zwischen Kaplan-, Francis- und Pelton-Turbinen. Die Pelton-Turbine eignet sich für große Fallhöhen und kleine Durchflussmengen Wasser. Francis-Turbinen werden vor allem bei mittleren Fallhöhen und konstanten Wassermengen eingesetzt, Kaplan-Turbinen für große Durchflussmengen von Wasser bei geringem Wasserdruck und niedriger Fallhöhe. Das sind vor allem ruhig fließende Großgewässer wie Flüsse.


Der Energiedienstleister Alperia setzt bei der Durchführung von Vertriebs und AftersalesTätigkeiten auf die CRMSoftware Salesforce – integriert mit dem smarten DokumentenmanagementSystem „d.velop documents“.
Die Durchführung des Strategieplans „One Vision“ beinhaltet eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen, die bis 2024 erreicht werden sollen. Diese sehen auch einen Digitalisierungsplan vor. Dazu zählt die Implementierung der CRM-Software Salesforce sowie die Modernisierung der ERP- und Billing-Softwaresysteme. Das große Ziel der Salesforce-Einführung ist die Optimierung der Kundenkommunikation, um einerseits den geänderten Kundenanforderungen und andererseits auch dem schnellen Wachstum der letzten Jahre Rechnung tragen zu können.
Eine der großen Herausforderungen bei der Einführung von Salesforce war, anfallende Kundendokumente in den veränderten Sales-Prozessen effizient digital zu erfassen und zu bearbeiten. Dies konnte durch die Integration des bereits seit Jahren bei Alperia erfolgreich eingesetzten Dokumentenmanagement-Systems „d.velop documents“, implementiert vom Bozner IT-Unternehmen Alpin GmbH, vollumfänglich erreicht werden.
Übersicht bei Knopfdruck
Die Anwender von Alperia verfügen somit auch in den Benutzeroberflächen von Salesforce über einen erweiterten Werkzeugkasten, mit dem sie in der Lage sind, jederzeit per Knopfdruck eine Übersicht aller Kundendokumente (z.B. Angebote, Verträge, Rechnungen) zu erhalten. Die native Schnittstelle zwischen Salesforce und „d.velop docu-


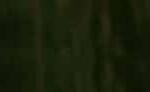
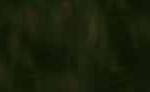



ments“ sorgt dafür, dass Dokumente zentral abgelegt und damit nur einmal gespeichert werden. Weitere Modernisierungsschritte ist die Automatisierung der eingehenden Kommunikation, indem beispielsweise PECMails und klassische E-Mails automatisiert einem Operator zugewiesen und in der Folge in der Salesforce-Oberfläche ersichtlich werden, sowie die Implementierung eines CloudArchivs für die digitale Archivierung der Abrechnungen von Strom und Gas.
Die Vorteile der Lösung
Durch die native Integration von „d.velop documents“ in Salesforce ist kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr nötig, inklusive sekundenschnellem Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce. Zudem lassen sich zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems wie interne Workflows bis hin zur digitalen Signatur eins zu eins in Salesforce nutzen. Das führt zu hocheffizienten Sales- und Aftersales-Prozessen und zu massiven Einsparungen in den Storage-Kosten.

streamline your business
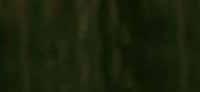
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen. Digitale Geschäftsprozesse mit Lösungen von Alpin prägen die Zukunft Ihres Unternehmens. Wir beraten Sie gern. alpin.it +39 0471 180 84 10
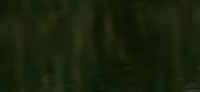














Ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft – Würth Italia setzt insbesondere in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft Projekte mit Signalwirkung für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung um. Der WürthWald, die Initiative für Gleichberechtigung „Valore D“, die Auszeichnung als „Top Employer 2022“ und das Projekt gegen Lebensmittelverschwendung „Too Good To Go“ sind nur einige Beispiele dafür, wie Würth sich für die Region, die Menschen und eine bessere Zukunft einsetzt.
Die Vereinten Nationen veröffentlichten 2015 die „ Agenda 2030“ mit 17 Zielen für ein nachhaltiges Wachstum. Acht dieser Ziele hat Würth Italia im eigenen Strategiepapier aufgegriffen. In diesen Bereichen sieht sich das Unternehmen ganz besonders in der Verantwortung – und auch in der Lage –, konkrete Veränderungen herbeizuführen: Gesundheit und Wohlbefinden, qualitative Aus- und Weiterbildung, Gleichberechtigung, würdevolle Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, Verhinderung von Ungleichheiten, Nachhaltigkeit in Stadt und Gesellschaft, verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion sowie Kampf gegen den Klimawandel.
Würth für die Zukunft
Bereits seit Jahren schließt Würth Italia sich immer wieder neuen Initiativen an und ruft innovative Projekte ins Leben, die zu einer möglichst lebenswerten Zukunft beitragen sollen. So entstand zum Internationalen Tag des Waldes der Würth-Wald: Im Fleimstal, wo der Jahrhundertsturm „Vaia“ 2018 große Waldflächen verwüstet hatte, wurde für alle Mitarbeitenden je ein Baum gepflanzt. Im Rahmen der Initiative „Too Good To Go“, die sich der Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung widmet, können in der hauseigenen Kantine hingegen „Magic Boxes“ mit unverkauften Lebensmitteln erworben werden. Und wie vom NeunPunkte-Programm der Initiative „Valore D“ empfohlen, wird die Gleichberechtigung firmenintern verstärkt gefördert. Für sein Engagement im Bereich des beruflichen und

persönlichen Wachstums und Wohlbefindens seiner MitarbeiterInnen hat Würth Italia 2022 das „Top Employer“-Zertifikat vom gleichnamigen Institut erhalten. Denn selbstverständlich stellen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine tragende Säule für die Nachhaltigkeit dar: „Würth ist ein multinationales Unternehmen, das seit jeher auf ein familiäres Arbeitsumfeld setzt. (...) Uns ist bewusst, dass das Wachstum und die Entwicklung der Menschen, die mit uns arbeiten, für eine starke Performance absolut ausschlaggebend sind“, so Lucia Simonato, HR Director Würth Italia.

Wirtschaft im Kreislauf Für Würth geht Nachhaltigkeit also klar über ökologische Themen hinaus – vielmehr denkt man das Thema im Unternehmen ganzheitlich und berücksichtigt dabei, dass das Zusammenspiel von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft die heutige Welt und erst recht eine nachhaltige Zukunft formen muss. Dafür müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich eingestehen, dass das lineare Wirtschaftsmodell ausgedient hat und stattdessen in Kreisläufen gedacht und gehandelt werden muss – davon ist man bei Würth überzeugt. Ressourcen müssen je nach Verfügbarkeit achtsam verwendet und wieder in den Kreislauf eingebracht oder an die Natur zurückgegeben werden. Zugleich müssen Abfall und CO2-Emissionen reduziert werden, um auf diese Weise zum Erhalt wertvoller Ökosysteme für zukünftige Generationen beizutragen.
Würth GmbH Bahnhofstraße 51 | 39044 Neumarkt www.wuerth.it

Wasserkraft ist nach wie vor die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Südtirol. Mit dem Doppelkraftwerk Dun hat die Stromgewinnung aus Wasser in der Gemeinde Vintl neue Dimensionen erreicht.
Seit 2019 ist das Wasserkraftwerk Dun, benannt nach dem Weiler im hinteren Pfunderer Tal, in Betrieb. Erst im Sommer 2022 wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben. Es handelt sich um ein
großes, vor allem für die Gemeinde Vintl wichtiges Projekt, zumal nun mit dem Wasser aus dem Weitenberger und dem Pfunderer Bach jährlich im Durchschnitt 6,5 Millionen Kilowattstunden produziert und als
„Geht nicht, gibst
Leitspruch der Firma Ploner




sauberer Strom ans Netz geliefert werden. Praktisch hat die Gemeinde damit eine wichtige Einnahmequelle. Sie kompensiert die aufgrund der wenigen Gastbetriebe nur die geringen GIS- Einnahmen.
Bauliche Meisterleistung
Die Realisierung des Wasserkraftwerkes war eine bauliche Meisterleistung, hatten die beteiligten Unternehmen aufgrund der schwierigen geologischen und landschaftlichen Gegebenheiten im alpinen Gelände doch einige Hürden zu überwinden. Doch die größte Hürde war zu Baubeginn bereits geschafft, nämlich überhaupt zu starten. Immerhin waren seit dem Beschluss, das Kraftwerk zu bauen, 17 Jahre vergangen. Langwierige Diskussionen um Beteiligungen im Vorfeld, fehlende Rechtssicherheit hinsichtlich der Fördermittel des Staates und anschließende bürokratische Verzögerungen hatten die Umsetzung über viele Jahre verhindert. 2018 aber gingen die beteiligten Firmen dann mit großem Einsatz ans Werk, sodass bereits nach einjähriger Bauzeit die Probephase für das Kraftwerk beginnen konnte.
Zwei Bäche, ein Weg
Beim Kraftwerk Dun handelt es sich streng genommen um zwei getrennte Kraftwerke, deren Maschinensätze aber in einem gemeinsamen Maschinenhaus untergebracht sind. Es gibt also zwei Bäche, damit zwei Wasserfassungen, zwei separate Druckrohrleitungen, zwei Turbinen und zwei getrennte Rückgabekanäle. Die Stromproduktion erfolgt dann im Maschinenhaus – mit unterschiedlichen Leistungsstärken, die auch ein unterschiedliches Niveau der Fördertarife nach sich ziehen. Interessant ist, dass das abgearbeitete Wasser nach der Rückgabe direkt zur Wasserfassung der Ableitung nach Meransen und von dort zum Großkraftwerk Mühlbach geleitet wird. Es handelt
sich beim Doppelkraftwerk also um eine Art OberliegerAnlage für Mühlbach.
Große Herausforderungen Welche waren nun die größten Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Projektes? Ein Beispiel ist die Was -
GESAMTPLANUNG BAULEITUNG
GEOLOGIE

ENERGIE & WASSER
BAUWESEN & INFRASTRUKTUREN
GEOLOGIE GEOTECHNIK & UMWELT


serfassung am Weitenberger Bach, der durchaus als Wildbach bezeichnet werden kann und wo die enge Duner Klamm den Baufirmen wenig Spielraum ließ. Hier dient nun ein robustes Tiroler Wehr als Fassung, während man sich beim Pfunderer Bach für einen Coanda-Rechen entschied. Aufwändig gestaltete sich zudem die Verlegung der Rohre im teils felsigen Gelände, zumal auch Unterquerungen der Bäche notwendig waren. Dennoch konnten innerhalb von fünf Monaten insgesamt 3,2 Kilometer an Druckrohrleitungen verlegt werden. Dabei wurden übrigens auch Glasfaserkabel fürs Internet verlegt.
Das Doppelkraftwerk Dun hat etwa 7 Millionen Euro gekostet. Geführt wird das Kraftwerk zu 60 Prozent von der Gemeinde Vintl, zu 40 Prozent von der eigens gegründeten Energiegenossenschaft Pfunders.

Letzte Hürde gemeistert
Bürgermeister Walter Huber zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit der Arbeit der beteiligten Firmen. Und nun, nach zwei Jahren Betriebszeit, weiß er auch, dass die Mühen rund um das Projekt nicht umsonst waren. „Die Witterungsverhältnisse in den ersten beiden Jahren 2020 und 2021 machten es möglich, dass die Jahresproduktion über den Erwartungen lag“, freut er sich. Heuer lassen der schneearme Winter und der trockene Sommer die Jahresproduktion zwar etwas geringer ausfallen: „Aber in Zeiten steigender Energiepreise ist die Investition in die umweltfreundliche Wasserkraft von großer Bedeutung, und sie stellt für den Haushalt der Gemeinde eine große Stütze dar. Preissteigerungen in den verschiedensten Bereichen können dadurch besser aufgefangen werden.“ Mit dem Bau dieses E-Werkes habe die Gemeinde Vintl neben anderen Projekten einen weiteren Akzent
zur Nutzung erneuerbarer Energien gesetzt und einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Eine letzte Hürde bei der Umsetzung des Projektes ist am Ende auch noch gemeistert worden: Die Straße nach Dun wurde mit dem Bau einer 270 Meter langen Steinschlaggalerie gesichert. „Diese Zufahrt stellte seit Jahren ein großes Sicherheitsproblem für alle Verkehrsteilnehmer dar“, erklärt der Bürgermeister. Fehlende Geldmittel hatten bislang aber den Bau einer Galerie verhindert. Im Zusammenhang mit dem E-Werk-Bau ist es gelungen, einen Finanzierungsweg zu finden. Rund 2,65 Millionen Euro konnten über das Land und Eigenmittel aufgebracht werden. Die Galerie wurde in zwei Baulosen während der Sommermonate in kürzester Bauzeit und unter schwierigsten Umständen errichtet, wofür der Bürgermeister allen an der Umsetzung Beteiligten sein Lob ausspricht.


Entdecken Sie, was perfekte Fenster ausmacht: Schönheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit.
Besuchen Sie uns im Studio und erleben Sie Fenster neu: bei einem persönlichen Termin, per Telefon oder Videochat. finstral.com/studios
Jetzt ist die Zeit für neue Fenster: Nutzen Sie den Ökobonus.


Südtirol ist mal wieder der Vorzeigeschüler. Insgesamt aber hätte Italien im „Fach“ Elektromobilität in Europa ziemlich schlechte Noten. Harald Reiterer, Leiter des Bereiches „Green Mobility“ in der Südtirol Transportstrukturen AG (STA), erklärt, woran das liegt, wie sich die aktuellen Krisen auf die Entwicklung der EMobilität auswirken und warum es sich angesichts der Strompreiserhöhungen dennoch lohnt, ein EAuto zu kaufen.

Radius: Elektromobilität scheint in Italien ein Fremdwort zu sein. Wie kann es sein, dass die Italiener bei den E-Fahrzeugen so deutlich hinter den meisten Ländern Europas liegen?
Harald Reiterer: Tatsächlich ist Italien kein Vorbild in Sachen Elektromobilität. Zum Vergleich: Im Juli 2022 waren rund 3,3 Prozent der neu zugelassenen Pkw in Italien mit einem E-Motor ausgestattet, in Deutschland waren es 14 Prozent. Für dieses Nachhinken gibt es mehrere Gründe. Die reichen vom schwach ausgeprägten Umweltbewusstsein der Italiener bis hin zur sinkenden Kaufkraft. Man muss bedenken, dass ein E-Auto beim Kauf teurer ist als ein Verbrenner und die Einsparungen erst im Laufe der Nutzung eintreten. Meiner Meinung nach sind aber in großem Maß auch die staatlichen Förderungen schuld an der Zurückhaltung. Sie sind absolut unzuverlässig.

Harald Reiterer, Leiter des Bereiches „Green Mobility“ in der Südtirol Transportstrukturen AG (STA)
Radius: Unzuverlässig inwiefern …?
H. Reiterer: Da gibt es mehrere Beispiele. Die Förderungen waren ja zunächst bis Ende 2021 angesetzt. Anstatt rechtzeitig eine Neuauflage vorzubereiten, gab es danach monatelang gar keine Förderung, bis endlich wieder eine Regelung in Kraft trat, die weitere Unterstützungen beim Kauf von EFahrzeugen zusicherte. Ein zweites Beispiel: Um noch in die alte Regelung von 2021 zu fallen, wurde festgelegt, dass das Fahrzeug innerhalb Juni 2022 zugelassen werden musste. In der Folge waren die Zulassungszahlen im Juni höher, im Juli dann umso schlechter. Einige Käufer schauten bei der Förderung auch durch die Finger, weil es nicht möglich war, ihr Auto rechtzeitig zuzulassen. So geht es natürlich nicht. Denn wenn gesetzliche Rahmenbedingungen ständig wechseln, erzeugt das Unsicherheit. Und dann hat Italien auch noch grundsätzliche Nachteile gegenüber anderen Ländern.
hypercharger HYC150 bei alpitronic, Schnellladesäule mit 150 kW

Radius: Welche zum Beispiel?
H. Reiterer: Die staatliche Regelung für die Stromanschlussleistung im eigenen Haus. In Österreich und Deutschland sind die Grundanschlussleistungen viel höher, und es spielt keine große Rolle, wie viel Kilowatt ein Haushalt hat. In Italien hingegen zahlt man bei mehr als 3 kW und erst recht über 4,5 kW erheblich mehr. Und um ein Auto aufzuladen, wären zumindest 4,5 kW empfehlenswert. Hier müssten sich die Rahmenbedingungen wesentlich ändern. Denn dass man angesichts dieser Voraussetzungen mitteleuropäisches Niveau erreicht, ist fraglich.
Radius: Stimmt es, dass die staatlichen Förderungen auch reduziert wurden?
H. Reiterer: Ja, in dem Sinn, dass es jetzt nur noch Geld gibt, wenn ein reines E-Auto nicht mehr als 35.000 Euro plus Mehrwertsteuer kostet. Außerdem muss es ein Privat-

fahrzeug sein. Bei Plug-in-Hybriden ist die Fördergrenze hingegen bei 45.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Das hat wahrscheinlich industriepolitische Hintergründe. Die italienischen Hersteller sollen damit wohl bevorzugt werden. Denn gängige Mittelklassefahrzeuge von ausländischen Herstellern fallen jetzt nicht mehr in die Förderklasse, wohl aber der Fiat 500, das einzige in Italien produzierte E-Auto.
H. Reiterer: Absolut nicht. Es fehlt auf staatlicher Ebene am politischen Willen. Italien versucht, seine mangelnde technische Innovationsleistung nun mit einem gewissen Protektionismus bei den Förderungen zu kompensieren.
„Italien versucht, seine mangelnde technische Innovationsleistung nun mit einem gewissen Protektionismus bei den Förderungen zu kompensieren. “
Wenigstens werden mit der neuen Regelung auch Nutzfahrzeuge mit Elektromotor gefördert.
Radius: Das klingt nicht, als ob man die klassische Familie dazu animieren möchte, umweltfreundlich Auto zu fahren …

Radius: Wie ist der Stand der Dinge in Südtirol im Vergleich zu Italien? Wie „elektroaffin“ sind Herr und Frau Südtiroler?
H. Reiterer: Zunächst zu den Zahlen: Ich schicke dabei voraus, dass viele Mietwagenunternehmen ihre Fahrzeuge aus steuerrechtlichen Gründen gerne in Südtirol anmelden. Diese mitberechnet liegen wir mehr oder weniger im gesamtstaatlichen Schnitt. Anders sieht es aus, wenn wir ausschließlich die Privatfahrzeuge betrachten. Dann steigt der Anteil

Hier könnte der Platz für unseren neuen Bildtext sein

an neu zugelassenen E-Fahrzeugen im Vergleich zu den Verbrennern auf zehn Prozent. Jedes zehnte neu gekaufte Auto ist also batteriebetrieben. Im Juni gab es sogar eine Spitze von 24,6 Prozent, aber das lag an der vorhin genannten Förderbestimmung. Insgesamt sind das sehr erfreuliche Werte, die zum einen auf ein stärkeres Umweltbewusstsein, zum anderen auch darauf zurückzuführen sind, dass das Land Südtirol eine zusätzliche Förderung gewährt.
Radius: Wie verlässlich sind die Landesförderungen?
H. Reiterer: Diese Förderungen waren von Beginn an stabil, und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich hier etwas zum Negativen ändert. Außerdem sind sie mit den staatlichen Förderungen vereinbar, was einen weiteren Anreiz darstellt.
Radius: Anderes Thema: Inwieweit treffen die aktuellen Lieferengpässe auch E-Fahrzeuge?
H. Reiterer: Die Wartezeiten betragen derzeit mindestens sechs Monate. Das liegt zum einen an der steigenden Nachfrage, aber auch am Ukraine-Krieg, zumal wichti -
ge Bestandteile für Autos aus dem umkämpften Land kommen. Deshalb sind alle Fahrzeuge im Moment schwerer zu haben. Bei Dieselfahrzeugen und Benzinern ist der Warenbestand auf dem Markt aber besser als bei E-Autos, sodass sich die Krise auf Letztere stärker auswirkt.
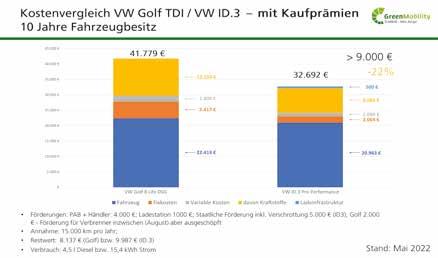


Radius: Inwieweit wird die Strompreiserhöhung die weitere Entwicklung des E-Fahrzeug-Marktes beeinträchtigen?
H. Reiterer: Schwer zu sagen. Natürlich wird die Strompreiserhöhung die Elektromobilität nicht befeuern. Aber man vergisst gern, dass auch die Preise für Benzin und Diesel ordentlich gestiegen sind. Nur hat der Staat hier mit dem Verzicht auf einen Teil der Steuern den Konsumenten unter die Arme gegriffen, während beim Strom nichts passiert ist. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein, wenn es um den Umweltgedanken und natürlich auch um die Elektromobilität geht. Stattdessen hat Italien sogar versucht, auf europäischer Ebene zu erwirken, dass der Verkaufsstopp für Verbrenner nach hinten verschoben wird. Das ist eine sehr kurzsichtige Politik, denn je massiver der Klimawandel wird und je weniger man dagegen tut, desto schlimmer werden die Auswirkungen sein. Heuer im Sommer haben wir einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen.
Radius: Aber ganz ehrlich: Zahlt sich ein E-Auto bei diesen Strompreisen überhaupt noch aus?
H. Reiterer: Ja, es rechnet sich nach wie vor, wenngleich sich der preisliche Vorteil bei den Treibstoffkosten gegenüber Diesel und Benzin verringert hat. Wir von Green Mobility haben unseren 10-Jahres-Kostenvergleich zwischen einem VW Golf Diesel und dem elektrischen Pendant „ID.3“ im Mai 2022 angesichts der Preissteigerungen aktualisiert – auf Stromkosten von 0,35 Cent pro kWh und Dieselkosten von 1,8 Euro pro Liter. Bei 15.000 Fahrkilometern im Jahr betragen die Kosten für den Diesel dann ungefähr 1.250 Euro, für den Strom beim E-Fahrzeug 809 Euro. Wenn man die staatlichen Förderungen mit einrechnet, spart man sich über eine Laufzeit von zehn Jahren mit dem Elektroauto rund 9.000 Euro im Vergleich

sigkeiten wie das Motoröl müssen nicht gewechselt werden. Außerdem zahlt man fünf Jahre keine Autosteuer und auch danach nur etwa ein Fünftel der normalen Steuer. Nicht zuletzt ist die Versicherung in der Regel günstiger. Und dann kommt noch das Wichtigste: die Vorteile für die Umwelt.
Radius: E-Fahrzeug-Besitzer wissen: Strom aufladen daheim ist viel günstiger als an der Ladesäule. Warum ist das eigentlich so? Und warum haben Ladesäulen so komplizierte Bezahlsysteme?
H. Reiterer: Dass der Strom an den Ladesäulen teurer ist, liegt daran, dass eine aufwändige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Zurzeit zahlt man im Schnitt rund 50 Cent pro kWh, daheim rund 35 Cent, bei der Schnelladesäule liegt der Preis etwa bei 80 Cent. Das ist aber überall unterschiedlich. Die Bezahlsysteme sind tatsächlich kompliziert, aber zumindest ist es jetzt in Südtirol bei allen öffentlichen Säulen möglich, mit Kreditkarte zu bezahlen.
Radius: Apropos Ladesäulen: Wie viele öffentliche Ladesäulen gibt es mittlerweile in Südtirol?
H. Reiterer: Rund 250, wobei einige Gemeinden wie Bozen und Meran jetzt auch selbst Interesse haben, öffentliche Ladesäulen zu errichten. Ich denke, Südtirol ist im Moment gut aufgestellt, denn bei den neuen E-Autos nimmt auch die Reichweite der Batterien zu, sodass der Bedarf an Ladesäulen nicht rapide steigt.
E-Mobility
PROFESSIONELLE LADELÖSUNGEN.

Elpo ist Ihr Fachmann.
Wir bieten Ladelösungen von 3kW – 150kW mit smartem Energiemanagement sowie Abrechnungssystemen. Egal ob smarte Wallbox oder Supercharger, wir beraten Sie mit langjähriger Erfahrung damit Sie die optimale Ladelösung für Ihren Haushalt, Ihr Hotel oder Ihr Unternehmen finden. Dafür stehen wir persönlich dahinter.
info@elpo.eu Tel. +39 0474 570 700

Radius: Wird das E-Fahrzeug das Fahrzeug der Zukunft sein? Viele meinen, es sei nur ein Übergang zu einer anderen Technologie.
H. Reiterer: Ob und wann eine noch bessere Technologie kommt, ist schwer zu sagen. Aber auf absehbare Zeit wird das E-Fahrzeug dominierend sein.
Radius: Kritiker sagen, die chemischen Stoffe wie Lithium und Kobalt seien auf der Welt nur begrenzt verfügbar, und deren Abbau sozial bedenklich –Stichwort Kinderarbeit.
H. Reiterer: Alle Bodenschätze sind begrenzt verfügbar, Lithium und Kobalt ebenso wie Erdöl und Erdgas. Aber die Batterietechnologie entwickelt sich ja weiter. Man geht demnächst schon auf
die neue Generation der Feststoffbatterien über, die eine größere Energiedichte haben. Das heißt, dass künftig weniger Rohstoffe für dieselbe Energiemenge gebraucht werden. Außerdem sind viele Hersteller dabei, durch neue Technologien den Anteil am umstrittenen Kobalt in den Batterien zu senken oder zu eliminieren.
Radius: Stimmt es, dass das Entsorgen der Batterien ein großes Umweltproblem darstellt?
H. Reiterer: Die Recyclingfähigkeit der Batterien ist sehr hoch, über 90 Prozent der Anteile können wiederverwertet werden. Das aktuelle Problem ist, dass das Recycling für die Industrie derzeit noch zu teuer ist, und weil die Herstellung der Batterien gleichzeitig günstiger wird, besteht erst recht kein Anreiz mehr zur Wiederverwertung. Hier bräuchte es gesetzliche Bestimmungen, die zum Recycling verpflichten. Bezüglich der Umweltfragen, die oft in Bezug auf die Batterien gestellt werden, gibt
Niederstätter hat mit der Gemeindeverwaltung Welschnofen eine Vereinbarung zur Wiederaufforstung des Waldes im Bereich des Karersees getroffen, der vom Sturm Vaia 2018 heimgesucht wurde. Für je 100 Euro, die für die Anmietung einer elektrischen Maschine ausgegeben werden, wird ein Baum gepflanzt.
Zwischen dem 29. und 30. Oktober 2018 wurden fast 1.000 Hektar Land – das entspricht etwa 1.300 Fußballfeldern – durch die Wucht des Windes und des Regens des Sturms Vaia zerstört. Heute ist die Räumung des Materials abgeschlossen, und die Natur nimmt ihren Lauf, um neues Leben entstehen zu lassen. Doch die Landschaft ist nicht mehr dieselbe.
Niederstätter nimmt sich daher des Waldes an und hat beschlossen, dieses Projekt zur Aufforstung zu starten. „Als Unternehmen haben wir beschlossen, dem Thema Nachhaltigkeit große Aufmerksamkeit zu schenken. Mit dieser Initiative können wir dies auf zwei Arten tun: zum einen, indem wir weiterhin neue emissionsfreie Fahrzeuge auf den Südtiroler Baustellen anbieten, und zum anderen, indem wir zur Anpflanzung von Bäumen beitragen, um den Wald an einem der faszinierendsten Flecken Südtirols wieder wachsen zu lassen“, so Daniela Niederstätter, Mitglied des Verwaltungs-
es eine ganze Reihe von Studien. Diese beweisen, dass Elektrofahrzeuge zwar nicht in der Produktion, aber über die gesamte Nutzungsdauer des Fahrzeuges deutlich umweltfreundlicher sind als Verbrenner und dass der Nachteil bei der Herstellung relativ schnell aufgeholt ist. Natürlich wäre es wichtig, dass der Strom, den die Fahrzeuge brauchen, aus nachhaltigen Quellen kommt. Generell aber denke ich, dass es sich bei solchen Kritiken häufig um Ablenkungsmanöver handelt.
Radius: Wovon will man ablenken? H. Reiterer: Bei den Verbrennern hat man nie darüber diskutiert, wie und wo Öl gefördert wird, wie viel bei Transporten verloren geht und die Gewässer verschmutzt, dass Abgase unsere Luft verpesten und viele Fördergebiete immens unter Umweltproblemen leiden. Bei der E-Mobilität, die in Summe deutlich sauberer ist, sind die Folgen für die Umwelt scheinbar das größte Problem.
Anzeige

rats des Unternehmens. Von Dumpern über Radlader bis hin zu Baggern können Privatpersonen und Unternehmen alle Arten von umweltfreundlichen Maschinen mieten, um bei der Bepflanzung und Aufforstung des Waldes zu helfen.
Niederstätter AG
Achille-Grandi-Straße 1 | 39100 Bozen Tel. 0471 061 141
rent@niederstaetter.it | www.niederstaetter.it
Seit einigen Jahren gewinnt die Elektromobilität zunehmend an Bedeutung und somit wächst auch das Interesse an intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastrukturen.
Der Elektrogroßhandel Selectra ist auch in diesem Fall der richtige Ansprechpartner für Unternehmen und Privatpersonen und bietet die ideale Ladestation für zu Hause oder den Betrieb.
Aufgrund der Tatsache, dass Elektrofahrzeuge dort aufgeladen werden, wo sie geparkt sind, ist die Bereitstellung geeigneter Ladelösungen von entscheidender Bedeutung.
Mit Selectra dir passende Lösung finden
Zum breiten Sortiment des Unternehmens gehören beispielsweise die Wallbox-Ladestationen: Sie lassen sich in Privathäusern, Garagen oder in halböffentlichen Bereichen, wie z.B. auf Firmenparkplätzen für Mitarbeiter oder Kunden, problemlos installieren.
Aber nicht nur das, auch die „klassischen“ Ladesäulen wurden modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht, um jetzt intelligenter, nachhaltiger zu sein und damit unkomplizierte Ladelösungen zu bieten. Durch eine
weitere Option wird beim Anstecken des Ladekabels das Fahrzeug erkannt und die Freigabe zum Aufladen erteilt. Dies vereinfacht nicht nur dem Anwender das Leben, nein, auch dem Betreiber der Ladeinfrastruktur, der nun auf komplette Anwender-Systemlösungen, sei es für Aufladungen, sei für Zahlungen, zurückgreifen kann. Im Sortiment von Selectra befindet sich zudem eine Reihe von Ladekabeln, die problemlos für alle Fahrzeuge geeignet sind und sowohl an Ladestationen als auch an Wallboxen mit Ladesteckdosen angeschlossen werden können. Das Team von Selectra berät Sie gerne rund um das Thema Elektromobilität. Im Hauptsitz in Bozen finden Sie garantiert die perfekte Lösung.


MENNEKES LADELÖSUNGEN FÜR e-MOBILITÄT
Zuhause, in der Firma, im Restaurant, in der Stadt... wo immer Sie sich gerade befinden, mit MENNEKES laden Sie schnell und unkompliziert zu jeder Zeit und an jedem Ort. Auf Wunsch auch mit Abrechnungsservice.
Unsere Produkte finden Sie im Elektrogroßhandel

„Wer nachhaltig investiert, profitiert“: Das ist der Weg, den Europa einschlagen will. Unternehmen, die bei ihren Entscheidungen die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt mitberücksichtigen, werden belohnt. Leasing ist ein Instrument, mit dem Betriebe ihre Investitionen besonders nachhaltig finanzieren können.
Die nächsten zehn bis 15 Jahre stehen ganz im Zeichen des Umbaus der Wirtschaft. Die Taxonomieverordnung der EU lässt dazu keine Zweifel offen. Diese beeinflusst, wie Betriebe künftig arbeiten werden. Banken und Finanzierungsgesellschaften üben eine wichtige Steuerungsfunktion aus. Wer sich nachhaltig entwickeln möchte, bekommt Finanzierungen zu besseren Bedingungen als jemand, der Gewinne um jeden – ökologischen und sozialen – Preis realisieren will.
Gemeinsamer Einsatz nötig
Auch bei der Hypo Vorarlberg Leasing, dem führenden Leasingfinanzierer in der Region Südtirol-Trentino, spielen Nachhaltigkeitsaspekte eine immer wichtigere Rolle. Dahinter steht die Überzeugung, dass die nachhaltige Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft des gemeinsa-

men Einsatzes aller Akteure bedarf – Politik, Unternehmen und Finanzdienstleistern.
Eine wesentliche Stärke Südtirols ist seine erstaunliche Vielfalt an Betrieben unterschiedlichster Dimensionen und Branchen. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, dabei muss es nicht immer um die ganz großen Projekte gehen. Manchmal genügt selbst der Austausch einer älteren Maschine oder Anlage im Betrieb, um die Energiebilanz des Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu sparen. Zu den Kunden von Hypo Vorarlberg Leasing zählt bereits eine Reihe von Betrieben, auch solche, die aus dem Handwerk kommen, wie etwa die Bozner Bäckerei Lemayr, die erst kürzlich mittels Leasing ihre Produktion auf den neuesten Stand brachte.
„Nachhaltig“ finanziert
Bei der Wahl der passenden Finanzierung bietet sich für immer mehr Betriebe das Leasing an. Warum? Mittels Leasing wird die neue Maschine oder Anlage zur genau planbaren –und betriebswirtschaftlich nachhaltigen – Investition: Statt der großen Kaufsumme werden kleine Leasingraten fällig, die noch dazu steuerlich abgesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil: Der Unternehmer profitiert ab der Übernahme von dem geleasten Objekt, das mit Beginn des Leasingvertrags bereits voll zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die Maschine finanziert sich so quasi selbst. Hypo Vorarlberg Leasing bietet seit diesem Jahr verstärkt das Leasing von Maschinen an. Die Gesellschaft ist seit über drei Jahrzehnten am Südtiroler Markt aktiv und eine Tochter der Hypo Vorarlberg Bank, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert.
Hypo Vorarlberg Leasing AG
Galileo-Galilei-Straße 10 H | 39100 Bozen info@hypovbg.it | www.hypoleasing.it

Sonne, Wind und Wasserkraft könnten heute schon mehr Energie liefern, als wir verbrauchen. Aber erneuerbare Energie ist nicht immer dann verfügbar, wenn wir sie benötigen. Eine Lösung für dieses Problem hat das Unternehmen GKN Hydrogen entwickelt, das derzeit in Pfalzen ein neues internationales Kompetenzzentrum für Wasserstoffspeichersysteme einrichtet.
Anfang August unterzeichnete die GKN Hydrogen Italy
GmbH mit der Alpinholz KG aus Pfalzen einen langfristigen Mietvertrag zum Aufbau eines neuen Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Pfalzen. Ziel ist es, die Fertigungskapazitäten des jungen Unternehmens im Bereich der Wasserstoffspeicherung weiter auszubauen.
Wetter und standortunabhängig
Doch worum geht es eigentlich? Ausgehend von der Tatsache, dass die Zukunft des Planeten nur über die „Erneuerbaren“ führt, braucht es Möglichkeiten zur Speicherung von Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Schließlich muss auch grüne Energie unabhängig von Wetter, Jahreszeiten und Standort zur Verfügung stehen, um konkurrenzfähig zu sein. Das heutige Unternehmen GKN Hydrogen hat in den vergangenen Jahren – damals noch als Start-up innerhalb der GKN Sinter Metals in Bruneck – nach Lösungen für diese Herausforderung gesucht. Und gefunden.
Jederzeit verfügbare Energie
Kern des neu entwickelten Systems ist die Speicherung von Wasserstoff in Metallhydriden. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: Energie aus Wind, Wasser und Sonne wird in Wasserstoff umgewandelt. Die Wasserstoffmoleküle fließen dann in das Innere eines Speichers und verbinden sich mit Metall zu Metallhydriden. Diese Metallhydride können Jahrzehnte ohne Verluste überdauern. Sie gelten als die sicherste und zu-
verlässigste Methode, Wasserstoff zu speichern. Wenn Energie benötigt wird, wird der im Metall eingelagerte Wasserstoff aus dem Speicher gelöst und in Wärme und Energie umgewandelt. Das Abfallprodukt ist reinstes Wasser. Das modulare System ermöglicht maximale Vielseitigkeit bei der Implementierung von netzunabhängiger Energieversorgung in Gebäuden, im Industrie- und Transportsektor.
Das Kompetenzzentrum der GKN Hydrogen wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 nach Pfalzen ziehen und wird in der Zukunft 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Weiterhin werden junge Ingenieure und Ingenieurinnen sowie Fachkräfte gesucht, die sich mit ihren Fähigkeiten für umweltfreundliche Energiesysteme einsetzen möchten.
Das Unternehmen
GKN Hydrogen ist aus der GKN Powder Metallurgy hervorgegangen und wurde im Mai 2021 gegründet. Es produziert und vermarktet Anlagen und Lösungen für die Nutzung von grüner elektrischer Energie und Wasserstoff. Die Grundlage der Technologie wurde in den vergangenen Jahren im ehemaligen Schwesterunternehmen GKN Sinter Metals in Bruneck entwickelt. Seit der Ausgründung der Wasserstofftechnologie baute GKN Hydrogen sein Produkt- und Dienstleistungsangebot stetig aus und entwickelte sich zum Wasserstoffspeicherexperten. Seit August 2022 wird die GKN Hydrogen von Melrose Industries PLC als eigenständiges und weltweit operierendes Unternehmen geführt. Aus diesem Grund musste auch für den Standort in Südtirol ein neuer Platz gesucht werden. Den hat man nun in Pfalzen gefunden.
GKN Hydrogen
Fabrikstraße 5 | 39031 Bruneck
Tel. 0474 570 211
info@gknhydrogen.com | www.gknhydrogen.com www.linkedin.com/company/gkn-hydrogen/

Die Brennstoffzelle gilt als Zukunftstechnologie in der Elektromobilität. Sind Brennstoffzellen umweltfreundlicher als andere Technologien? Grundsätzlich sei festgehalten, dass die Brennstoffzelle kein Energieträger ist, sondern ein Gerät, das die chemisch gespeicherte Energie von H2 (Wasserstoff) in Strom umsetzt.

SDer Wasserstoff-Pionier
Dr. Walter Huber, IIT
o wie ein Transformator nur ein Gerät zur Umsetzung von Stromvarianten ist, aber kein Energieträger? Als Antwort auf die eingangs gestellte Frage gilt ein klares Ja als Antwort, wenn man davon ausgeht, dass Wasserstoff aus lokal verfügbarer und erneuerbarer Energie erzeugt wird. In der Zukunft könnten wir mit Brennstoffzellenautos fahren, welche mit „grüner Energie“ erzeugten Wasserstoff in Strom verwandeln. Das Null-Emissionsauto wäre damit Wirklichkeit. Zugleich könnten in den Kellern unserer Häuser kleine Blockheizkraftwerke stehen – ebenfalls basierend auf Brennstoffzellentechnik. Dazu Walter Huber, der Südtiroler Wasserstoff-Pionier: „Die Brennstoffzellentechnik zwingt uns dazu, lokal verfügbare erneuerbare Rohstoffe zu verwenden. Wir stehen aber erst am Beginn einer starken Entwicklung. Brennstoffzellen sind immer in
Zusammenhang mit H2 zu sehen und werden in vielen Bereichen ihren Siegeszug antreten.“ Die Brennstoffzelle verbrennt keinen Brennstoff, sondern setzt ihn chemisch bei ca. 50 bis 70° C um, erzeugt dabei auch keine Stickoxide und andere Schadstoffe, was jeder Verbrennungsprozess tut. Übrig bleibt ausschließlich Wasserdampf.
Die Stromproduktion ist entscheidend Nur: Ist das, was technisch bereits möglich ist, auch sinnvoll für die Umwelt? Zunächst muss aus Strom Wasserstoff erzeugt werden. Dieser wird ins Auto getankt, im Auto wird aus Wasserstoff wieder Strom erzeugt. Diese doppelte Umwandlung senkt im herkömmlichen Vergleich die Effizienz. Allerdings sind solche Vergleiche nicht zielführend, wenn man berücksichtigt, dass der Strom zur Wasserstoff-Erzeugung aus im Überfluss erzeugter und nicht sofort genutzter Energie von Solar-, Wind- und Wasser-
kraftwerken kommt. Aktuell werden Wasserkraft, Windkraft- und Solaranlagen schlicht vom Netz genommen, wenn zu viel Strom auf dem Markt ist. Die Öko-Energie geht damit ungenutzt verloren. Die Brennstoffzelle wird eine wichtige Zukunftstechnologie sein, wenn Strom aus Wasser-, Wind- und Solarenergie in Form von Wasserstoff zwischengespeichert wird.
Mit der Speicherung in Form von Wasserstoff wird der Strom aus erneuerbaren Energien 24 Stunden verfügbar, kann somit auch als Grundlaststrom eingesetzt werden. Dazu Walter Huber weiter: „Es macht keinen Sinn, ein einziges Gerät in einem System zu bewerten, sondern es muss bewertet werden, was das System bringt, wenn es auf Wasserstoff umgestellt wird. Wenn die Gesamtnutzung von Strom und Wärme aus lokalen erneuerbaren Energien kommt und einen Wirkungsgrad von 90 Prozent aufweist, was gibt es da zu kritisieren – besser wäre nachmachen.“
Schema der Wasserstoff-Produktion auf dem Gelände von MPREIS
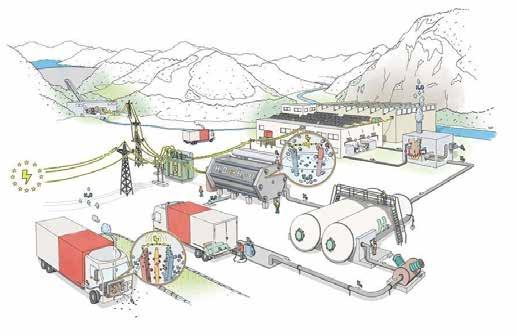
MPREIS setzt auf Wasserstoff
Das Land Südtirol betreibt in Bozen Süd seit über zehn Jahren eine Wasserstoffanlage – und war in der Region sogar einmal Vorreiter in dieser Technologie. Leider hat man diese Vorreiterrolle aus unerklärlichen Gründen abgegeben. Derzeit tut sich nördlich des Brenners in Sachen Wassersstoff wesentlich mehr. Von der MPREIS- Gruppe wird eine Wasserstoffproduktion in Betrieb genommen, und in weiterer Folge wird Schritt für Schritt die gesamte LKW-Flotte von MPREIS auf CO2freien Wasserstoffantrieb umgestellt. Möglich macht das die Wasserstoffinitiative von MPREIS, ein in Tirol und auch weit darüber hinaus einzigartiges, innovatives Projekt. Darum kommt der Strom, der dafür benötigt wird, auch zu 100 Prozent aus Tiroler Wasserkraft – einem von MPREIS selbst betriebenen E-Werk. Auch vom Projektpartner TIWAG könnte Strom aus Wasserkraft bezogen werden.

Wasserstoff auch zum Backen
Zudem verwendet MPREIS den Wasserstoff auch zum Backen in seiner Bäckerei und Konditorei. Zusammen mit der LKW-Flotte kommt das Tiroler Unternehmen auf einen Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent. Gemeinsam mit den Tiroler Technologiepartnern FEN Systems, ILF und TIWAG/TINETZ sowie dem Schweizer Unternehmen IHT wird MPREIS so zum Vorreiter für eine nachhaltigere, umweltfreundlichere und lebenswertere Zukunft. Auch der Spezialist für Wasseraufbereitung
HHWasser-Aufbereitungsanlage von Grünbeck
Grünbeck setzt seine Technologien nun für die Wasserstofferzeugung ein. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Wasseraufbereitungsanlagen für ein optimales Betreiben von Elektrolyseuren. Fast überall lassen sich damit fossile Energieträger ersetzen, und es lässt sich eine Energieversorgung ohne Treibhausgase schaffen, die zudem unabhängig von Gas-, Öl- und Kohleimporten ist. Grünbeck-Chef Günther Stoll ist fest davon überzeugt, dass die Wasserstoff-Technologie ganz wesentlich zur Energiewende beitragen wird.


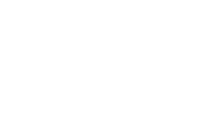



Klimaneutral mit H2 -Effekt: Grünbeck ist Ihr Partner im Wandel Wasser ist eine wertvolle Ressource. Genau deshalb haben wir es uns bei Grünbeck zur Aufgabe gemacht, diese in ihrer bestmöglichen Qualität und Form zur Verfügung zu stellen. Mit unseren Verfahren der Wasseraufbereitung tragen wir dazu bei, die Nutzung von grünem Wassersto möglich zu machen. Gemeinsam „Wasser verstehen“ für eine nachhaltigere Zukun .
Grünbeck Italia S.r.l. | Via Strada Nuova, 24 | 37024 Negrar (VR) +39 045 7513331 | info@gruenbeck.it | www.gruenbeck.it
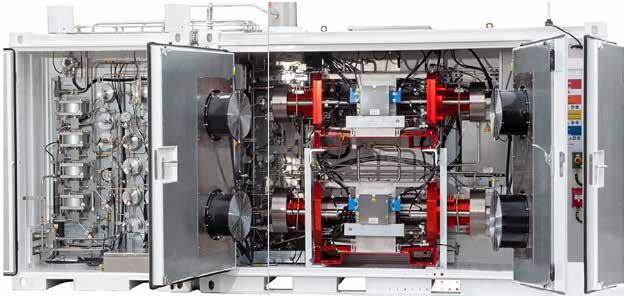
Hydrocell ist eine aufstrebende Firma, die Lösungen für viele anstehende Probleme im Energiesektor mit Wasserstoff entwickelt. Ihr Knowhow kommt von den Eigentümern, die zum Teil langjährige Erfahrungen in der WasserstoffTechnologie besitzen. Ein Beitrag von Dr. Walter Huber.
Klimawandel, die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen lokaler Herkunft als Strom-Grundlast zu nutzen, das heißt für 24/7/365 verfügbar zu machen, geht nur mit spezifischen Speichertechnologien und dem Zusammenführen verschiedener Produktionsverfahren aus unterschiedlichen Bereichen. Man nennt dies die Sektorenkopplung.
Stromspeicherung steht derzeit noch im Hintergrund Ohne die Möglichkeit, elektrische Energie zu speichern, kann die vielzitierte Energiewende mit erneuerbaren Energiequellen nicht gelingen und die fossilen Energien ersetzen. Erneuerbare Energiequellen wie die Photovoltaik oder Windenergie produzieren nur Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, was weder programmierbar noch steuerbar ist. Auch unsere Wasserkraft produziert das Jahr über ca. doppelt so viel grünen Strom, als wir selbst brauchen. Zwar wird im Sommer viel Strom produziert, aber im Winter ist Strom Mangelware, obwohl gerade dort der Verbrauch stark ansteigt. Hydrocell hat einen Langzeitspeicher entwickelt, der große Mengen an Strom mit Wasserstoff vom Sommer auf den Winter speichert. Mit mehreren Gigawattstunden Speicherfähigkeit kann die Lücke zwischen Sommer und Winter geschlossen werden. Jede Größenordnung ist machbar, es hängt vom Anwendungssystem ab.

Aus Biogas wird Wasserstoff
Ein weiteres System in Bearbeitung ist die Nutzung von Biogas aus tierischen Abfällen zur Produktion von Biomethan und daraus von Wasserstoff, an dem wir derzeit arbeiten. Biogas ist in den Wintermonaten verstärkt vorhanden, da die Tiere ab Herbst wieder von den Almen und Weiden in die Ställe zurückkehren. Damit ist diese H2-Produktionsintensität komplementär zu jener aus Wasserkraft in den Wintermonaten. Außerdem hilft sie den Biogasanlagen, wirtschaftlich weiterzuarbeiten. Würden in Südtirol alle Vergärungsanlagen zur Wasserstoffproduktion genutzt, könnten damit 30 bis 40 Prozent des derzeit benutzten fossilen Erdgases durch eigenes Biomethan ersetzt werden. Dass dabei auch ein wertvoller organischer Dünger anfällt, der andere Dünger aus weit entfernten Ländern ersetzt, ist ein großer Nutzen für die Landwirtschaft und die Umwelt.
Umfassende Beratung
Hydrocell entwickelt maßgeschneiderte Konzepte in allen Bereichen, bietet auch technische Umsetzungen von Projekten an. Hydrocell vermittelt und installiert H2-Betankungsgeräte wie Zapfsäulen, Kompressoren usw. der Firma Maximator Deutschland. Alle derzeitigen und geplanten Formen der Betankung für PKW, LKW, Busse und für Spezialgeräte werden damit bedient.
Demnächst wird Hydrocell auch mobile Lösungen zur H2-Versorgung von Tankstelle sowie für Anwendungen abseits von üblichen Tankstellen und Produktionsanlagen anbieten.
Systemlösungen mit Wasserstoff auf dem Energiesektor sind ganzheitliche Lösungen, die umweltgerecht, ökonomisch ertragreich und wertsteigernd sind.
Hydrocell GmbH
Alessandro-Volta-Straße 13 A | 39100 Bozen
Tel. 0472 273 654
info@hydrocell.com | www.hydrocell.com

Die Errichtung der Druckleitung wird auch dazu genutzt, eine neue Beregnungs- sowie Trinkwasserleitung zu verlegen, und auf der Trasse der Druckrohrleitungen wurde das erste Teilstück der Radaufstiegsroute zwischen Prad und Stilfser Brücke errichtet. Die Energie Werk Prad Genossenschaft suchte bereits seit Jahren nach Möglichkeiten, den Suldenbach hydroelektrisch besser zu nutzen. Das alte Kraftwerk Mühlbachwerk 1 konnte dem wachsenden Strombedarf der Genossen-



schaftsmitglieder nicht mehr gerecht werden. Im Vordergrund stand dabei eine bedarfs- und nutzungsgerechte Anlagengröße, denn die Schüttmenge des Suldenbaches bot und bietet dafür ausreichend Potenzial. Unter dem neuen Namen Energiewerk Suldenbach ist das neue Kraftwerk nun in Betrieb und kann pro Jahr rund 21 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das neue Kraftwerk – angetrieben über eine Peltonturbine der Firma Troyer –erzeugt somit ungefähr dreimal so viel
Seit Mitte Mai 2022 ist das neue Kraftwerk samt neuer Druckleitung zwischen Stilfserbrücke und Prad in Betrieb. Das wohl größte Bauprojekt im Vinschgau seit Jahren ist auch ein Vorzeigeprojekt in puncto Synergien.
Strom wie die drei alten Turbinen, die im Zuge des Umbaus weichen mussten. Zum Herzstück des Kraftwerks gehört neben der 4-düsigen Peltonturbine, welche die bisherigen drei kleinen Turbinen (Kaplan, Francis und Pelton) ersetzt, die neue 3,3 Kilometer lange Druckleitung (1.200 Millimeter), die von der neu errichteten Fassungsstelle mit einem hochmodernen Entsandersystem in Stilfser Brücke bis zum Krafthaus führt. Obgleich es sich um ein Infrastruktur-Projekt handelt, wurde auch auf architekto-




nische Besonderheiten geachtet. Die Außenfassade wurde in den Sandfarben des Suldenbaches bzw. Trafoibaches gestaltet. Im Dachgeschoss des Gebäudes entstand ein Sitzungssaal, der einen spannenden Blick auf das Innere des Turbinenraumes mit Zulaufstrecke, Turbinengehäuse und den wuchtigen Generator bietet.
Mammutprojekt mit vielen Vorteilen
Der Bau der neuen Druckleitung für das Suldenbach-Kraftwerk gab den Anstoß für drei weitere Bauprojekte, die schließlich – wenngleich es
sich um unterschiedliche Bauherren handelte – gemeinsam abgewickelt wurden. So wurde eine neue Beregnungsleitung mit sauberem Wasser aus dem Tramentanbach errichtet (Bauherr: Bonifizierungskonsortium Vinschgau) sowie entlang der Trasse der Druckleitung eine RadwegAufstiegsspur zum Stilfser Joch vorbereitet. Die Gemeinde Prad hat im Zuge des Großbauprojektes auch die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in die Wege geleitet, und nicht zuletzt wurde sogar die Staatsstraße zwischen Prad und Stilfser
Brücke versetzt. Die Abwicklung von gleich vier Bauvorhaben in diesem Ausmaß und mit so vielen beteiligten Bauherren ist einzigartig im Vinschgau. Synergien konnten optimal genutzt werden. Unter Federführung der EWP Genossenschaft und des Verfahrensverantwortlichen Michael Wunderer wurden die Arbeiten von der Bietergemeinschaft bestehend aus den lokalen Unternehmen Mair Josef & Co. KG, Hofer Tiefbau GmbH und Marx Hoch- und Tiefbau AG durchgeführt.
Die Umsetzung von gleich mehreren und doch miteinander verbundenen Bauprojekten war auch für die Bietergemeinschaft Mair Josef, Hofer Tiefbau und Marx Hoch und Tiefbau in dieser Größenordnung neu. Dank umfassender und guter Planung, viel Vertrauen der Bauherren, guter Materiallogistik und Baustellenorganisation konnten die Arbeiten jedoch in kurzer Bauzeit und mit geringer Umweltbelastung realisiert werden.
Höchste Qualität beim Materialeinbau gewährleisten und dabei die Umweltbelastung während der Bauarbeiten so minimalinvasiv wie möglich zu halten: Das war den Bauträgern besonders wichtig. So haben die Baufirmen alles wiederverwendbare Aushubmaterialien vor Ort aufbereitet und auf der Baustelle wieder eingebaut.
Materialaufbereitung „Just in time“
Die Materialaufbereitung erfolgte nach dem Prinzip „Just in time“, das heißt, das Aushubmaterial wurde zu den Lagerflächen transportiert, und in der Gegenfahrt von der Lagerfläche zur Baustelle wurde bereits das aufbereitete Material zurück auf die Baustelle gebracht. Somit konnte die Verkehrsbelastung um bis zu 50 Prozent reduziert werden, und auch die Baustelleneinrichtungsflächen konnten minimalinvasiv gehalten werden. Für die Aufbereitung wurden mobile Brech- und Siebanlagen verwendet, die das Material mittels Backenbrecher, auf die vom Geologen vorgegebene Korngröße, gebrochen haben. Das abgesiebte Feinmaterial wurde dann je nach Beschaffenheit für die Rohrbettung bzw. für die anschließende Begrünung wiederverwendet.

Verlegung der Hauptleitung
Herzstück des Bauprojektes ist ohne Zweifel die 3,3 Kilometer lange Druckleitung mit einem Durchmesser von 1200 Millimetern. Die Schweißarbeiten an der Hauptleitung aus Stahl erfolgten durch IDROWELD, einem Experten im Bereich Druckrohrleitungsbau. Das Anliefern und Einheben erfolgte, wo immer es möglich war, vom Suldenbach aus, um die Verkehrsbehinderungen auf der Staatsstraße auf ein Minimum zu reduzieren. Das Rohr wurde mit Material mit Größtkorn 25 Millimeter verfüllt und seitlich lagenweise verdichtet. Für die Bettung der Rohre hingegen wurden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Die rechtzeitigen Lieferungen der Rohrdruckleitungen über die Türkei nach Prad waren noch eine besondere Herausforderung, da die Bestellung erst im Herbst 2021 erfolgen konnte und

Über 40 Jahre fundierte



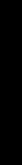

Freiverlegter Trassenabschnitt auf auskragendem Bauwerk mit Druckleitung aus Stahl (1.200 Millimeter), Beregnungsleitung aus Gusseisen (500 Millimeter), Trinkwasserleitung aus Gusseisen (200 Millimeter)
es witterungsbedingt in der Türkei zu erheblichen Verzögerungen gekommen war. Doch am 21. Februar 2022 trafen die ersten Stahlrohre mit zweimonatiger Verspätung in Prad ein. Die Leitung wurde am 29. März 2022 fertig verlegt und Mitte Mai in Betrieb genommen. Die Trassierung war zu diesem Zeitpunkt von den ausführenden Unternehmen bereits so gut vorbereitet worden, sodass sofort mit der Verlegung gestartet werden konnte. Das Wetter hat außerdem über den ganzen Winter mitgespielt, sodass es hier zu keinen Verzögerungen gekommen ist. Nichtsdestotrotz waren

Erdverlegter Trassenabschnitt mit Druckleitung aus Stahl (1.200 Millimeter), Beregnungsleitung aus Gusseisen (500 Millimeter), Trinkwasserleitung aus Gusseisen (200 Millimeter)
die Bedingungen und die Arbeiten zwischen Straße und Bach nicht einfach und musste gut koordiniert werden. Auch die äußerst knappe Kernbauzeit in den Wintermonaten von knapp sechs Monaten war für die ausführenden Baufirmen eine Herausforderung.
Sechs Bauherren und ein Bauprojekt
Eine der größten Herausforderungen war sicherlich, alles unter einen Hut zu bringen und dabei auch die zeitliche Abwicklung nicht aus den Augen zu verlieren. Denn neben der Energie Werk Prad Genossenschaft
und der E-Werk Stilfs Genossenschaft waren mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Bezug auf die Radroute, dem Amt für Straßenbau in Bezug auf die Verlegung bzw. Entschärfung von zwei Straßenabschnitten entlang der Stilfser-Joch-Straße, dem Beregnungskonsortium Vinschgau in Bezug auf die Neuverlegung der Beregnungsleitung und der Gemeinde Prad in Bezug auf die Trinkwasserleitung insgesamt sechs Bauherren unter Federführung der EWP Genossenschaft am Werk. Die Planungsarbeiten erbrachte das Planungsbüro Patscheider & Partner.




Kiefernhainweg 77

I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ) T. +39 0473 616 282 info@hofer-tiefbau.com
www.hofer-tiefbau.com

Die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und der Wunsch nach Freizeitvergnügen lassen sich nicht immer gut vereinbaren. Doch wo Bedürfnisse entstehen, wird auch nach Lösungen gesucht. So sind wohl die chlorfreien und naturnahen Schwimmteiche und Biopools entstanden. Badespaß ohne Chemie – wie und warum das funktioniert. Hier sind die Antworten.
Schwimmen im See – wer das schon einmal ausprobiert hat, weiß das natürliche, chlorfreie Ambiente zu schätzen. Doch nicht überall gibt es Seen, und nicht jeder traut sich, ohne Boden unter den Füßen zu schwimmen. Gute Alternativen für Naturliebhaber bieten da Schwimmteiche oder Biopools, auch Naturpools genannt.
Tatsächlich erfreut sich das Badevergnügen in biologisch aufbereitetem Wasser immer größerer Beliebtheit.
Schwimmteich oder Biopool?
Worin liegt aber nun der Unterschied zwischen einem Schwimmteich und einem Biopool? Welche Lösung eignet sich für welchen Zweck? Grundsätzlich handelt es sich bei beiden Arten um biologisch aufbereitete Badegewässer, die also ohne Chlorzusatz funktionieren. Kein Chlor bedeutet keine Chemie und damit auch Badespaß für Menschen, die Chlor schlecht oder gar nicht vertragen, und für solche, die aus gesundheitlichen oder Umweltschutzgründen ein „Naturschwimmbad“ bevorzugen.
Ein Schwimmteich ist allerdings ganz anders aufgebaut als ein Biopool.
Jörg Platter von Platter Biopools in
Eppan erklärt den Unterschied: „Beim Schwimmteich handelt es sich um ein stehendes Gewässer, das sich vor allem durch eine bestimmte Kombination von Wasserpflanzen selbst reinigt.“
Die Zone mit den Pflanzen ist dabei – von außen unsichtbar vom Schwimmbereich abgegrenzt, sodass keine oder nur einige Sedimente oder Pflanzenteile in diesen Bereich gelangen können.
Der Bio- oder Naturpool hingegen ist ein Fließgewässer: „Das bedeutet, dass das Wasser ständig durch einen Kiesfilter fließt und auf diese Weise gereinigt wird.“ Auf dem Kies bilde sich, ähnlich wie in einem Bach, eine Lebensgemeinschaft aus Mikroorganismen, Algen und Bakterien, der sogenannte Biofilm: „Dieser entzieht dem Wasser alle Nährstoffe, womit sich keine Algen bilden können und es auf diese Weise biologisch stabil und sauber bleibt.“

Mit weniger Energie kommt der Schwimmteich aus. Hierbei wird die Wasseroberfläche über einen Skimmer für einige Stunden täglich abgesaugt, um Verschmutzungen auf der Wasseroberfläche zu entfernen. Wer sich für diesen entscheidet, braucht jedoch viel Platz, denn die Aufbereitungszone mit dem Pflanzenbewuchs nimmt etwa die Hälfte der Fläche ein. „Mindestens 100 Quadratmeter sind da schon erforderlich“, sagt Jörg Platter. Ein Schwimmteich besticht vor allem durch seine Optik, ist also ein Blickfang und für die Nutzer auch ein Naturerlebnis. Das Quaken der Frösche, das Rascheln des Schilfs und gelegentliche Wassertrübungen sind für manche allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
Platz- und Energieverbrauch
Der Biopool ist in der Umsetzung recht praktisch, da er wie ein Schwimmbad konstruiert werden kann, das Schwimmen sich aber dennoch wie in einem See anfühlt. Allerdings: Um das Wasser in den Filter zu saugen, bedarf es Strom und damit Energie, wenngleich mit geringem Verbrauch, da die Pumpen meist mit Niederspannung angetrieben werden. Außerdem müssen leichte Beläge auf Boden und Wänden regelmäßig mit einem Poolroboter entfernt werden.
Baugenehmigung erforderlich „Die Naturpools überwiegen eindeutig“, antwortet der Eppaner Unternehmer auf die Frage, welche der beiden Lösungen mehr nachgefragt wird. Das vor allem am höheren Pflegeaufwand bei Schwimmteichen, deren Pflanzen selbstverständlich Zuwendung brauchen, aber zum Teil eben auch daran, dass das klare Wasser der Biopools bei vielen Nutzern als sauberer wahrgenommen wird. Außerdem können Letztere beheizt werden, etwa durch eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe, während das beim Schwimmteich nicht möglich ist. Wichtig: Wer sich einen Biopool oder einen Schwimmteich anschafft, braucht dafür eine Baugenehmigung!
Samtweiches Wasser, ganzjährig klar und rein für ein natürliches Badevergnügen – das ist ein Naturpool. Der Naturpool ist die Weiterentwicklung des klassischen Schwimmteiches, basiert aber auf dem von der Natur seit jeher erprobten Reinigungsprinzip eines Fließgewässers.
Man stelle sich einen kristallklaren Bergbach vor. Wenn man darin einen Stein umdreht, so findet sich hier auf der Unterseite eine Art Belag, den sogenannten Biofilm: eine Lebensgemeinschaft aus Algen, Bakterien und Mikroorganismen. Dieser Biofilm entzieht dem Wasser Phosphate und andere Nährstoffe, die ansonsten für die Entstehung von Algen verantwortlich sind. Das Wasser wird so auf biologische Art gereinigt und bleibt klar.
Natürliche Reinigung
In einem Naturpool wird das Wasser nach demselben Prinzip gereinigt. Das Wasser wird über einen Skimmer aus dem Schwimmbereich entnommen und dann durch eine entsprechend dimensionierte Kiesschicht geleitet. Dort bildet sich der Biofilm, der dem Badewasser sämtliche Nährstoffe entzieht, der Schwimmbereich bleibt dauerhaft sauber. Im Regelfall wird dieser Biofilm zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) entnom-


men. Somit werden die überschüssigen Nährstoffe aus dem System entfernt und der Kiesfilter bleibt dauerhaft funktionsfähig. Die Entnahme des Biofilms erfolgt durch Wasser- oder Luftspülung. Der Naturpool wird nach den Kundenwünschen individuell geplant und vor Ort ausgeführt. Architektonische Formen mit getrennten Filterbereichen sind ebenso möglich wie organische Formen mit integrierten Filterzonen. Ein Naturpool kann beheizt werden, um die Schwimmsaison noch länger zu genießen. Ebenso kann eine Abdeckung eingebaut werden, die hilft, Energie zu sparen, und außerdem für Sicherheit sorgt. Unterwasserleuchten schaffen nachts eine stimmungsvolle Atmosphäre.






Biologisch aufbereitete Naturpools für natürlichen Badegenuss



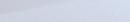
Trinkwasser ist für jeden von uns eine Selbstverständlichkeit. Erst durch die Trockenheit des heurigen Sommers, verbunden mit dem Wassermangel und Einschränkungen in diversen Gemeinden, wird diese Selbstverständlichkeit hinterfragt. Für über drei Milliarden Menschen weltweit ist TrinkwasserKnappheit ein permanentes Problem, das sich durch den Klimawandel ständig verschlimmert.

Wo kommt unser Trinkwasser her, wer baut die Leitungen, wer ist für die Versorgung zuständig und wer überwacht die Qualität? Die Trinkwasserversorgung Südtirols erfolgt über mehr als 500 öffentliche Wasserleitungen, welche von ca. 2.000 Quellen und ca. 50 Brunnen gespeist werden. Die Nutzung des Wassers zur Versorgung der Menschen mit Trinkwasser hat in Südtirol Vorrang gegenüber allen anderen Nutzungen. In Italien sind die Gewässer ein öffentliches Gut. Wenn jemand Wasser ableiten und benutzen will, muss er dafür die sog. „Wasserkonzession“ einholen. Diese wird nur genehmigt, wenn das Wasservorkommen ausreichend ist und die Qualität des Trinkwassers nicht beeinträchtigt wird.
Verantwortlich sind die Gemeinden
Die Gemeinden sind für den Trinkwasserversorgungsdienst in ihrem Gemeindegebiet verantwortlich und

erteilen die Wasserkonzessionen für die öffentlichen Trinkwasserleitungen. Sie organisieren diesen Dienst, um im Gemeindegebiet eine effiziente und wirtschaftliche Versorgung durch Rationalisierung und sparsamen Umgang mit den vorhandenen Wasservorkommen zu gewährleisten.
Externe Versorger
Sie können aber den Trinkwasserversorgungsdienst, auch für Teilgebiete der Gemeinde, mit einer Konvention anderen Betreibern übertragen. In diesem Fall trägt der Betreiber die Verantwortung für den Trinkwasserversorgungsdienst in dem ihm zugewiesenen Gebiet und die Wasserkonzession wird dem Betreiber des Trinkwasserversorgungsdienstes, beschränkt auf die Dauer der Konvention, erteilt bzw. übertragen. Bei Auflösung der Konvention aus jedwedem Grund fällt die Wasserkonzession an die Gemeinde zurück.
Gute geografische Bedingungen für hohe Qualität
Südtirol verfügt dank seiner geografischen Lage und den Eigenschaften des Untergrundes über Trinkwasser guter Qualität. Diese Tatsache bringt mit sich, dass es als natürliches Produkt angesehen werden kann; seine Frische bleibt erhalten, da großteils nur wenige Stunden vergehen, bis es von der Quelle zum Wasserhahn gelangt. Hygienische Bestimmungen, bauliche Normen und wasserrechtliche Richtlinien sichern die Trinkwasserversorgung und -qualität. Die hygienischen Bestimmungen sind durch EU-Richtlinien und entsprechende nationale Gesetze festgelegt. Deren Einhaltung wird in erster Linie von den einzelnen Gesundheitsbezirken (Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit) kontrolliert. Für den Schutz des Trinkwassers wurden sog. „Trinkwasserschutzzonen“ ausgewiesen. Alle Tätigkeiten im Einzugsgebiet der
















Wir liefern neben TrinkwasserspeicherAusrüstung auch einbruchhemmende Eingangstüren (Widerstandsklasse RC3 nach Norm EN 1627)

Trinkwasserquellen und der Brunnen, die sich auf die Wasserqualität schädlich auswirken können, sind verboten.
Niederschläge bestimmen die Wasserreserven
Unsere Wasserreserven werden von den Niederschlägen gespeist. Dadurch fällt in Südtirol jährlich eine Wassermenge von etwa 5.000 Millionen Kubikmeter an. Leider ist diese Menge nicht gleichmäßig auf unser Land verteilt. Während in der Nähe des Alpenhauptkammes genug Wasser vorhanden ist, gibt es auf den Hochplateaus wie am Ritten oder am Tschöggelberg bei langer Trockenheit immer wieder Wasserknappheit. In der folgenden Tabelle wird, bei durchschnittlichen Niederschlagsmengen, diese Gesamtwassermenge in Relation zum geschätzten Wasserverbrauch für die einzelnen Kategorien gesetzt (Daten von 2020):
Von den 5.000 Millionen Kubikmeter zur Verfügung stehendem Trinkwasser verbraucht:
• die Landwirtschaft: 150 Millionen Kubikmeter = 3 Prozent;
• die Industrie: 50 Millionen Kubikmeter = 1 Prozent;
• die Bewässerung von Grünflächen von 9 bis 20 Uhr sowie Trinkwasser: 45 Millionen Kubikmeter = 1 Prozent;
• die Schneeerzeugung: 10 Millionen Kubikmeter = 0,2 Prozent.

Wasserknappheit auch in Südtirol?
Die allgemeine Lage mit wenigen Niederschlägen, hohen Temperaturen, wenig Schmelzwasser und weniger vollen Speicherseen ist der Grund für die Wasserknappheit im Sommer 2022. Nach Angaben von Landesrat Giuliano Vettorato herrscht in Südtirol derzeit jedoch noch kein Notstand wie in Teilen Italiens, es wurde jedoch Voralarm gegeben. Die Niederschlagsmenge der vergangenen Monate entspricht im nordöstlichen Teil in etwa dem langjährigen Durchschnitt. Im westlichen Landesteil und in einigen Gemeinden wie Natz-Schabs weist er hingegen größere Defizite auf. Auf den Gletscherflächen ist dieses Jahr die Schneereserve um etwa 40 Prozent geringer als im langjährigen Durchschnitt. Durch diese geringe Schneemenge fehlt der Schmelzwasserbeitrag schon seit der ersten Junihälfte. Zur Versorgung der Abflüsse tragen damit laut dem Direktor der Umweltagentur, Flavio Ruffini, nur mehr die Gletscher bei. Er weist außerdem darauf hin, dass die Speicherseen in der westlichen Landeshälfte (insbesondere Reschen und Schnals) derzeit Füllstände aufweisen, die deutlich unter dem

langjährigen Durchschnitt liegen. Die Füllung des Reschensees liegt aktuell bei rund 38 Prozent (72,6 Millionen Kubikmeter) der Gesamtkapazität.
Große Herausforderung: das Stauseenmanagement
Dazu Flavio Ruffini: „Ist weniger Wasser im Stausee, gibt es weniger Stromproduktion, die Netzstabilität muss im Laufe des Jahres garantiert werden. Es sei wichtig, sich für die kommenden Wochen Reserven zu halten. Dies alles stellt das Abflussmanagement im Einzugsgebiet der Etsch –das einzige, das im Norden Italiens noch nicht das Notstandslevel „hoch“ ausgerufen hat – vor große Herausforderungen.“ Am Messpegel in Boara Pisani im Mündungsbereich der Etsch in die Adria muss eine Abflussmenge von mindestens 80 Kubikmeter pro Sekunde garantiert sein, damit es nicht zum Rückfluss des Meerwassers in den Flusslauf und damit zur Versalzung des Bodens und der Trinkwasservorkommen kommt. Denn zahlreiche Gemeinden im Mündungsbereich leben dort nämlich vom Trinkwasser, das aus Brunnen im Einflussbereich der Etsch gewonnen wird.


Seit fast 30 Jahren betreibt eco center die wichtigsten Umweltanlagen der Provinz Bozen mit einem einzigen Ziel: in Südtirol die Umwelt zu schützen. Effizienz, verantwortungsbewusste Ressourcennutzung und Transparenz sind die Grundsätze, welche die Gesellschaft bei der Abwicklung ihrer Tätigkeiten verfolgt, wobei sie die Lebensqualität der Bürger in den Mittelpunkt stellt.
eco center führt den Abwasserdienst des optimalen Einzugsgebiets 2 der Provinz Bozen, der 22 Kläranlagen und 251 Kilometer Kanalisation umfasst, und vier Abfallbehandlungsanlagen, darunter die Müllverwertungsanlage Bozen und die Vergärungsanlage Lana. Die Gesellschaft verfügt über ein akkreditiertes Analyselabor, das die Anlagen bei
der Kontrolle der Abflüsse und der Emissionen unterstützt, und steht den Mitgliedsgemeinden bei den regelmäßigen Trinkwasserkontrollen bei.
Wir reinigen die Abwässer
Die Kläranlagen von eco center behandeln alljährlich 40 Millionen Kubikmeter Abwässer mit einer sehr hohen Reinigungsleistung, und dies auch dank eines Rationalisierungsprozesses, der dazu geführt hat, dass die Abwässer der kleinen Anlagen in die mit Personal besetzten größeren Anlagen geleitet werden.
Auch die Energieeffizienz wurde verbessert: Aus den Klärschlämmen, die nach dem Abwasserreinigungsprozess übrigbleiben, wird Erdgas gewonnen, das zur Erzeugung
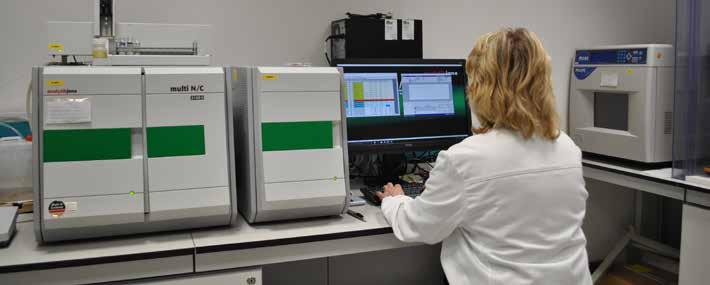

von Strom und Wärme dient. Alljährlich werden über 11 Millionen kWh Strom (davon werden 94 Prozent für den Anlagenbetrieb genutzt und der Rest nach außen abgegeben) und über 9 Millionen kWh Wärmeenergie erzeugt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die verantwortungsbewusste Nutzung des Brunnenwassers gelegt: In der Kläranlage Bozen gestattet ein System für die Behandlung und Wiederverwendung des Abwassers für industrielle Zwecke eine Einsparung von 750.000 Kubikmeter Brunnenwasser pro Jahr.
Die Gesellschaft kümmert sich außerdem um 251 Kilometer Kanalisation und verschiedene Pumpstationen, Messstationen und Rückhaltebecken für Notfälle. Das Leitungsnetz wird ständig mittels Videoinspektionen kontrolliert und

die Sanierungsarbeiten werden, sofern möglich, mit der No-dig-Technologie durchgeführt, d. h. ohne Aushub und daher mit einer geringeren Umweltbelastung als bei der herkömmlichen Technologie. Die Kläranlagen und die Kanalisation werden ständig mit einem Fernüberwachungssystem kontrolliert.
Wir wandeln die Abfälle in Energie um eco center behandelt alljährlich 173.000 Tonnen Müll und gewinnt dabei über 95 Millionen kWh Strom und über 100 Millionen kWh Wärmeenergie.
Das Einzugsgebiet der Müllverwertungsanlage Bozen umfasst ganz Südtirol. Sie ist eine der modernsten Anlagen auf europäischer Ebene und mit einem Rauchbehandlungssystem ausgestattet, das es gestattet, den Schadstoffausstoß weit unter den gesetzlichen Grenzwerten sowohl des Staates als auch der Provinz Bozen zu halten. Aus der Müllverbrennung gewinnt man alljährlich über 90 Millionen kWh Strom (wovon 85 Prozent nach außen abgegeben werden und der Rest für den Anlagenbetrieb genutzt wird) und über 100 Millionen kWh Wärmeenergie, die zur Gänze an das Fernwärmenetz der Stadt Bozen abgegeben wird, wodurch im Jahr 2021 zu einer Emissionseinsparung von 21.000 Tonnen CO2 beigetragen wurde.
Die Vergärungsanlage Lana entsorgt alljährlich 18.000 Tonnen Biomüll für 47 Südtiroler Gemeinden. Aus dem Abfallbehandlungsprozess erzielt man Biogas, das zur Erzeugung von Strom – ca. 5,5 Millionen kWh pro Jahr (davon 65 Prozent nach außen abgegeben und der Rest für den Anlagenbetrieb genutzt) – und Wärmenergie genutzt wird.
Verantwortungsbewusstsein
eco center setzt sich täglich dafür ein, die oben erwähnten Ergebnisse zu erzielen, aber grundlegend ist der Beitrag aller Bürger. Die verantwortungsbewusste Nutzung von Wasser und WC (nur Toilettenpapier einwerfen!), die Verringerung der Müllerzeugung und die richtige Mülltrennung – das sind Verhaltensweisen, die jeder Bürger im täglichen Leben befolgen kann, um Südtirol sauber zu halten.
eco center AG
Beschäftigte: 209
Umsatz: 53 Millionen Euro
Mitglieder: 105
Geführte Anlagen: 26
Behandelte Abfälle: 173.000 Tonnen
Gereinigte Abwässer: 40 Millionen Kubikmeter
Verwaltetes Leitungsnetz: 251 Kilometer
Analysierte Trinkwasserstichproben: 3.725
eco center AG
Rechtes Eisackufer 21A I 39100 Bozen
Tel. 0471 089 500
info@eco-center.it I www.eco-center.it

Vor zahlreichem Publikum fand am Mittwoch, dem 7. September 2022 in der Messe Bozen die 20. Ausgabe der KlimaHaus Awards statt. Von über 1.300 zertifizierten Projekten zeichnete die Agentur sieben herausragende Projekte aus. Der Publikumspreis ging dieses Jahr nach Venetien.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise ist das Thema KlimaHaus auch nach 20 Jahren aktueller denn je. Ein Gebäude nach KlimaHaus-Standard gebaut, schützt zum einen das Klima und hält die Ausgaben fürs Heizen auch bei steigenden Energiepreisen in Grenzen. Mit den goldenen Cubes werden Bauherren prämiert, die energieeffizientes und nachhaltiges Bauen besonders gelungen und innovativ interpretieren, und zwar unabhängig von Architekturstil, Bauweise oder Materialwahl. Die Siegerprojekte verteilen sich auf das gesamte Staatsgebiet und verkörpern Gebäude unterschiedlicher Art und Nutzung: private und öffentliche Einrichtungen ebenso wie Neubauten, aber auch gelungene Sanierungen.
Kompatscher, Vettorato und Caramaschi überreichen Preise Landeshauptmann Arno Kompatscher eröffnete den Abend mit herzlichen Grußworten. Darauf folgten kurze Reden von Landesrat Giuliano Vettorato und dem Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi. Im Anschluss daran führte Direktor Ulrich Santa durch den Abend und gab die Siegerprojekte bekannt, wobei es sich bei den ersten drei Preisträgern allesamt um sanierte Objekte handelt.
Überraschungsgast
Präsident der Emilia-Romagna Für die Übergabe des ersten goldenen Cube gesellte sich der Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, auf die Bühne. Er überreichte den Preis an das Projekt „Loft Sant’Agnese“ (Ing. Massimiliano Roberto) aus Modena. Aus einer ehemaligen Schuhfabrik entstanden fünf moderne und komfortable Wohnungen. Besondere Aufmerksamkeit wurde in diesem Fall auch auf die Erdbebenertüchtigung gelegt.
Der zweite Preis ging an das „Haus Fliri“ (Arch. Walter Prenner – columbosnext) in Taufers im Münstertal.

Nach dem „Haus-im-Haus-Prinzip“ wurde in einen ehemaligen Heustadel eine moderne Holzkonstruktion eingefügt. Das Ergebnis ist ein Wohnhaus und Kunstatelier in der KlimaHaus-A-Klasse.
Prämiert wurde auch das Projekt „Casa della Saluti di Voltri“ (Arch. Marta Scapolan) bei Genua, einem stillgelegten Industriegebäude, das nach dem Gütesiegel „KlimaHaus R“ saniert und zu einem Gesundheitszentrum umfunktioniert wurde. Der Bau hat das ganze Stadtviertel wiederbelebt und nachhaltig aufgewertet.
Die Fachjury entschied sich auch für den neuen Firmensitz der PROGRESS Group (Arch. Manuel Gschnell – DEAR studio) in Brixen. Das moderne, hocheffiziente Bürogebäude in Betonfertigteilbauweise bietet ihren Mitarbeitern ideale Arbeitsbedingungen. Ein KlimaHaus Work&Life, intelligent durchdacht und konsequent umgesetzt. Auch dieses Jahr durften Einfamiliengebäude nicht fehlen. Die Jury vergab einen Preis an Casa V. (Arch. Antonio Pandini) in Crema, ein Holzhaus, das mit seinen ökolo-

gischen Qualitäten und der Nutzung erneuerbarer Energien besticht.
Das Haus Moar (Arch. Felix Kasseroler –raumdrei architekten) in Klausen fasziniert mit einer modernen Formsprache, klaren Linien und kompaktem Volumen. Im Sinne des Umweltschutzes überzeugt es mit innovativer Anlagentechnik, der Nutzung von erneuerbaren Energien und geringen CO2-Emissionen. Ein Vorzeigeprojekt aus der EmiliaRomagna schloss den Reigen der Jurypreise ab. Die Nuova Scuola per l’Infanzia e Nido (Arch. Riccardo Ramberti, Studio Associato Preger) in der Gemeinde Sogliano al Rubicone (FC) wurde nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard KlimaHaus School errichtet und bietet ein ideales Umfeld für die Entwicklung der zukünftigen Generationen.
Publikumsfavorit aus Venetien Wie gewohnt, konnten auch heuer wieder Interessierte im Rahmen eines Online-Votings ihr Lieblingsprojekt küren. Der Publikumspreis erfreut sich jedes Jahr großen Interesses, über 17.000-mal wurde die Abstimmungsseite besucht. Am meisten Zustimmung erhielt dabei Villa N.E.S.T in Oderzo (TV). Das KlimaHaus Gold Nature sorgt mit PhotovoltaikAnlage und Wärmepumpe für sehr niedere CO2-Emissionen.
• 20. Ausgabe
• Über 1.300 zertifizierte Gebäude aus dem Vorjahr
• 30 Finalisten
• 7 Jurypreise und ein Publikumspreis www.klimahausawards.it






In Großstädten wie München, Wien und Mailand hat die Mobilitätswende bereits voll begonnen. Weg vom eigenen PKW hin zu einem starken ÖffiNetz und neuen Mobilitätsformen wie Ride Pooling und SharingAngeboten. Doch sind diese neuen Mobilitätsdienste auch in alpinen Regionen umsetzbar? Einiges wird in Südtirol bereits jetzt angeboten, und vor allem das Mobilitätsmanagement von großen Unternehmen wird immer wichtiger. Ein Überblick.
Das Südtiroler Landesstatistikinstitut ASTAT hat 2021 eine Studie zur lokalen Mobilität in Südtirol durchgeführt. Dabei wurden rund 2.000 Südtirolerinnen und Südtiroler zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Ergebnis der Studie: Zwar wird noch jeder zweite Weg in Südtirol mit dem Auto zurückgelegt, doch zeigten die Befragten die Bereitschaft, unter bestimmten Bedingungen noch mehr Wege mit den Öffis und auch mit dem Rad zurückzulegen. Vor allem das E-Bike kann bei Distanzen von mehr als fünf Kilometern eine tolle Alternative zum Auto sein. Doch wie sieht es in Südtirol mit anderen innovativen Mobilitätsformen wie Carsharing, On-Demand-Bussen etc. aus?
Geteiltes Auto
Bereits seit 2013 gibt es einen Carsharing-Dienst in Südtirol. Maßgeblich an dessen Entstehung beteiligt waren die Arche im KVW, die Gemeinde Mals, der Legacoopbund, die Confcooperative Bozen und engagierte Privatperso-
nen. Die ersten Carsharing-Stationen wurden im Herbst 2013 in Mals, Meran und Bozen eröffnet. Heute gibt es in Südtirol 23 Stationen in insgesamt neun Gemeinden. Über eine Kooperation mit der Deutschen Bahn (Flinkster) können über dasselbe System und dieselbe App 3.000 Carsharing-Fahrzeuge in Italien (Trient, Brescia, Rovereto, Riva del Garda), Deutschland und in der Schweiz genutzt werden.
Innovative Mobilitätsformen im Praxistest Zwischen 2019 und 2021 hat die Stadt Meran im Rahmen des Interreg-Projekts MENTOR eine ganze Reihe innovativer Mobilitätsformen getestet. Dabei ging es beim Projekt vor allem darum, das Konzept von „Mobility-as-a-Service“ (Mobilität als Dienstleistung) erstmals in kleineren Ortschaften im Alpenraum auszuprobieren. Partnerstadt des Projektes war die Schweizer Ortschaft Brig-Glis. Drei neue Mobilitätsdienste –Carpooling, Bikesharing und ein OnDemand-Bus – standen im Mittelpunkt des Projektes.
On-Demand-Busse
Ob in Städten oder in ländlichen Regionen: On-Demand-Angebote sind auf dem Vormarsch. Viele Verkehrsunternehmen setzen mittlerweile auf die abrufbare Mobilität, und das Konzept kommt gut bei Fahrgästen an. OnDemand-Verkehre bedeuten flexible Mobilität auf Nachfrage. Fahrgäste buchen per App oder telefonisch, werden dann an einem Startpunkt abgeholt und zu einer Haltestelle gebracht. In Südtirol wurde erstmals im Sommer 2021 ein solches Angebot in Meran getestet. Der so genannte Callbus verkehrt seither zwischen dem Stadtzentrum und Obermais und bietet eine interessante Ergänzung zum herkömmlichen ÖPNV.
Die Gemeinde Eppan hat es mit dem E-Bike-Projekt für Pendler schon 2018 vorgemacht. Zunächst wurde erhoben, wie sich die Pendler innerhalb der Gemeinde bewegen. Anschließend wurden 100 E-Bikes angekauft und gegen einen jährlichen Kostenbeitrag

an Pendler vermietet. An vier zentralen Punkten an den Metrobus-Haltestellen Pillhof, Gand, St. Pauls und St. Michael Bahnhof wurden zudem insgesamt 60 Boxen für E-Bikes aufgestellt. Dafür erhielt die Gemeinde 2019 den Südtiroler Mobilitätspreis. Auch die Projekte eBike2Work, die in den Gemeinden Meran und Brixen mit großem Erfolg laufen, funktionieren nach demselben Prinzip. Es geht darum, jene zu unterstützen, die bewusst für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das Elektrofahrrad umsteigen und damit einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten wollen.

Betriebliches Mobilitätsmanagement
Das Potential von betrieblichem Mobilitätsmanagement wird von immer mehr Südtiroler Unternehmen erkannt und genutzt: ein gutes Mobilitätsmanagement tut nicht nur der Umwelt gut, es bringt auch Einsparungen und steigert das Unternehmensimage bei Mitarbeitern und Kunden. Den Nutzen eines guten Mobilitätsmanagements hat auch
der Staat erkannt und mit dem „Decreto Rilancio“ aus dem Jahr 2020 den verpflichtenden „Mobility Manager“ mit einer Reihe von Verantwortlichkeiten ausgestattet. Unternehmen und öffentliche Verwaltungen mit mehr als 100 Mitarbeitern sind gesetzlich verpflichtet, einen „Mobility Manager“ zu ernennen. In Südtirol sind allerdings nur Unternehmen davon betroffen, die ihren Sitz in der Landeshauptstadt Bozen haben.
Aufgaben des „Mobility Manager“
Robert Burger, der Firma FIRESERVICE in Bruneck, erklärt, worauf man beim Kauf eines Feuerlöschers achten sollte:
„Die Empfehlung für den privaten Haushalt ist ein fach. Hier eignet sich ein Schaumlöscher, der auch für Fettbrände geeignet ist und nach dem Ge brauch nur lokal Spuren hinterlässt.“
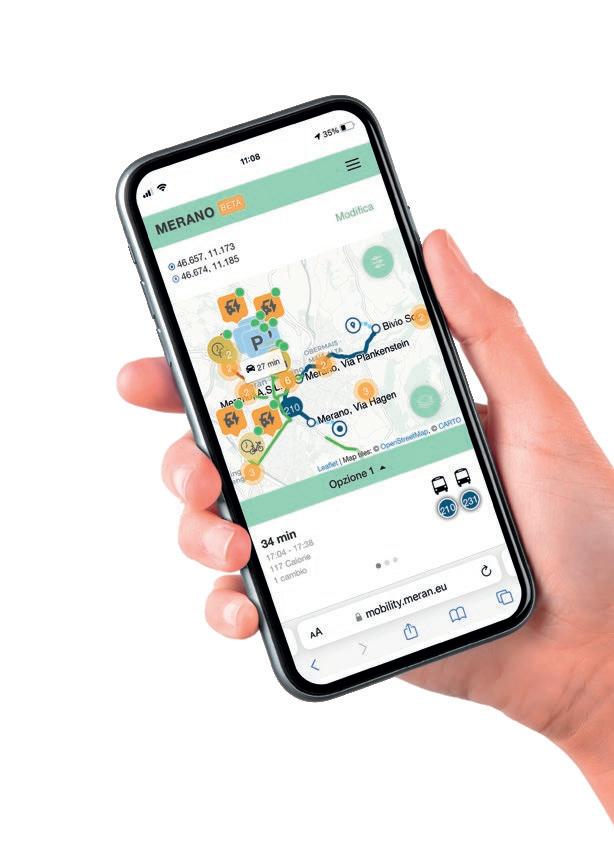
In vielen europäischen Ländern wurde auch in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen der Pulverlöscher schon längst vom Schaumlöscher
Der Mobility Manager soll Vorschläge ausarbeiten, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ihre Wege möglichst nachhaltig und ohne PKW zurücklegen können. Es geht dabei auch um konkrete Maßnahmen zur Organisation und Steuerung der Mobilität, aber auch um Information und Sensibilisierung für das Thema nachhaltige Mobilität. Konkrete Maßnahmen sind beispielsweise Verkehrsvermeidung durch Standortwahl, Homeoffice für Mitarbeitende und ein
verdrängt. erklärt: „In der am meisten ein Alleskönner: feste Stoffe (C). Allerdings zu bedenken, Staubwolke Brandherd gebung und Ein Schaumlöscher eingesetzt sich nur geringfügig.“
mit den Fahrtzeiten von Öffis sowie die Übernahme der Kosten für den Südtirol Pass. All das sind Anreize, mit denen Unternehmen eine nachhaltige Mobilität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern können.
„Brandschutzcheck: besser


Tragbarer Feuerlöscher 6 l geeignet zum löschen von Lithiumbatterien.
Getestet für Lithiumbatterien mit Kapazität 36 Volt750 W/h - 20,1A
Homologiert und CE zertifiziert
Brandschutz und Sicherheit
0474-572600 - Bruneck, J.G. Mahl-Straße 46 www.fireservice.bz




Der mobile Hackservice macht aus jedem Baum Hackschnitzel. Und das ganz bequem vor Ort. Hackschnitzel können dann zum Heizen und auch sonst vielseitig eingesetzt werden.
Hackschnitzel sind gefragt. Besonders jetzt, wo fossile Brennstoffe wie Gas und Öl immer knapper und immer teurer werden, sind Hackschnitzel zum Befeuern von Hackschnitzelheizungen beliebt. Aus Hackschnitzeln lassen sich aber auch Spanplatten oder Dämmplatten herstellen. Gefragt sind Hackschnitzel auch im Garten- und Landschaftsbau, wo sie als Schutz vor Unkraut dienen. Auf Spielplätzen eingesetzt schaffen sie einen natürlichen und stoßdämpfenden Belag, der Kinder bei Stürzen weich fallen lässt.
So werden Hackschnitzel hergestellt
Unter Hackschnitzel versteht man im Allgemeinen von Maschinen zerkleinerte, naturbelassene Holzstücke. Sie werden auch Holzhackschnitzel oder Hackgut genannt. Die entsprechenden Hackmaschinen können das Holz, je nach späterem Einsatzort, unterschiedlich zerkleinern. Automatische Feuerungsanlagen benötigen feines oder mittleres Hackgut, während Großanlagen vor allem grobes Hackgut für die Verarbeitung benötigen.
SELBSTFAHREND
Dabei gilt: Das gehäckselte Material sollte in erster Linie gleichförmig sein. Zu große oder zu kleine Stücke können zu Störungen in der Heizungsanlage führen.
Mobiler Hackservice
Gute Hackgeräte zur Schnitzelherstellung sind teuer, und nur in seltenen Fällen lohnt die Investition in so ein Gerät. So hat sich in den letzten Jahren der Trend zum mobilen Hackservice durchgesetzt. Verschiedene Firmen stellen einen leistungsfähigen mobilen Hackservice zur Verfügung. Diese mobilen Hackmaschinen können beinahe überall eingesetzt werden und häckseln verschiedenste Holzarten direkt vor Ort. Im Südtiroler Ahrntal gibt es – so steht es auf der Firmenwebseite – die größte selbstfahrende Holzhackmaschine der Welt. Diamant 2000 heißt das Prachtstück der Firma Brunner Leiter. Mit 700 PS und einem Allrad-Antrieb kann der mobile Hackservice auch im steilen und sogar schneebedeckten Gelände problemlos erbracht werden. Mit einer Einzugsbreite von fast zwei Metern und einer Einzugshöhe von fast einem Meter häckselt die Diamant 2000 in kürzester Zeit jegliche Art von Restholz. Pro Stunde schafft es diese Maschine, bis zu 500 Raummeter Hackgut zu verarbeiten. So kann der Winter kommen.
Wir bieten Komplettlösungen aus einer Hand!
Unser Diamant 2000, ist zurzeit die größte selbstfahrende Holzhackmaschine der Welt, mit einer Einzugsbreite von 1,73 Metern und einer Einzugshöhe von fast einem Meter. Dank dem starkem Motor ist die sind wir sehr flexibel und in fast jedem Gelände einsetzbar.
· Ankauf von Rest- und Abfallholz
· Mobiler Hackservice (auf Wunsch auch direkt bei Ihnen Zuhause)
· Verkauf von Hackschnitzel
· Transport von Hackschnitzel

Achtsamkeit bedeutet, behutsam zu sein.
Der sanfte Umgang mit der Natur war uns von Anfang an wichtig.

Wir verstehen die stetige Optimierung der Kühlanlagen als Dienstleistung für unsere Kunden. Über 35 CO 2 -Kältesysteme wurden von uns in Südtirol-Trient installiert und werden 365 Tage im Jahr betreut.
CO 2 -Kälteanlagen nutzen natürliches, hocheffizientes und umweltfreundliches Kältemittel.
Beständigkeit hat mit Erfahrung zu tun, seit 1933 Ihr Kältemeisterfachbetrieb.
Kälte - Klima - Einrichtung
Seit 1933
Meran, www.zorzi.oskar.it

Unabhängig zu 100 Prozent –365 Tage im Jahr mit myEnergy365 von ÖkoFEN.
Im Norden Österreichs – im schönen Mühlviertel (Bezirk Rohrbach, OÖ) – entwickelte ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletsheizungen, eine weltweit einzigartige Lösung: Das Komplettsystem myEnergy365 kombiniert neueste Technologien und erfüllt den Wunsch nach einhundertprozentiger Unabhängigkeit.
Mit dem Ziel, größtmögliche Ungebundenheit von fossilen Energieträgern und -lieferanten zu ermöglichen, entwickelte ÖkoFEN myEnergy365. Das Energiesystem kombiniert die stromerzeugende Pelletsheizung Pellemactic Condens_e mit einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher. Mit der innovativen Kombi-Lösung nutzen Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer ökologische Wärme und versorgen sich darüber hinaus sogar 100-prozentig mit selbst produziertem Strom – gewonnen aus Sonnenenergie und der Pelletsheizung.
Starke Leistung, hoher Nutzen
Mit zehn bis 16 Kilowatt thermischer Leistung eignet sich die Pelletsheizung optimal für Einfamilienhäuser. Ist die Heizung in Betrieb, produziert sie automatisch Strom. Jährlich werden so etwa 1.500 Kilowattstunden erzeugt. Das entspricht rund einem Drittel eines durchschnittlichen Jahresstromverbrauchs. Mit der zusätzlichen Nutzung des aus der PV-Anlage gewonnenen Stroms und einem Stromspeicher decken ÖkoFEN-Kundinnen und -Kunden so bis zu einhundert Prozent ihres Jahresstromverbrauchs mit erneuerbarer Energie ab.

Flexibles und erweiterbares System myEnergy365 ist die Antwort auf die Frage nach der unabhängigen und ökologischen Strom- und Wärmeerzeugung im Eigenheim. Das Konzept ist modular: So kann die Komplettlösung von Anfang an installiert oder Schritt für Schritt verwirklicht werden. Alle Details und weitere Informationen zum System finden Sie auf der ÖkoFEN-Website: www.oekofen. com/de-at/myenergy365/
• All-in-One-Produkte
• Plug&heat
• Unterstützung bei der Einbringung
• Gewebetank in 2 h montiert
www.oekofen.at
Bis zu 50% Installationszeit sparen mit den ÖkoFEN Zeitsparprodukten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem ÖkoFEN-Partner in Südtirol: Recuterm KG, Peter Mitterhoferstraße 23, 39025 Naturns, 0473-667128, info@recuterm.it



Unter Photovoltaik versteht man die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mittels Solarzellen. Mit einer Photovoltaikanlage sparen Sie Geld und schützen nebenbei die Umwelt.
Als eines der führenden Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien plant und installiert die Leitner Electro GmbH maßgeschneiderte Lösungen. Ob Privatkunde, Industrie- oder Gastronomiebetrieb – bei Leitner Electro sind Sie richtig!
Die Stärken des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien
• Leitner Electro ist Vorreiter für erneuerbare Energien und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich.
• Es wurden bereits über 1.400 Photovoltaikanlagen erfolgreich ans Netz angeschlossen.
• Hochspezialisierte Mitarbeiter erledigen die Planung und Ausführung der Photovoltaikanlagen.
• Leitner Electro übernimmt sämtliche Formalitäten: Ansuchen bei Gemeinde, Netzbetreiber, GSE, Terna, Zollagentur.
• Kompetente Beratung hinsichtlich aktuell gültiger Förderungsmöglichkeiten
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH

-Elektriker für Photovoltaikanlagen (m/w)
-Elektriker für Service & Wartungen (m/w)
-Elektriker / Vorarbeiter (m/w)
-Sicherheitstechniker (m/w)
-Lehrling Elektriker (m/w) personal@leitnerelectro.com
• Es werden ausschließlich Qualitätsprodukte von namhaften Herstellern verwendet.
• „Wir sind auch nach der Installation für Sie da,“ so Klaus Ploner, der Geschäftsführer, „unser Notdienst/unsere Serviceabteilung stehen 365 Tage im Jahr zur Verfügung“
Ihre Vorteile:
• Sie nutzen eine unbegrenzt vorhandene und vor allem kostenfreie Energiequelle.
• Sie machen sich unabhängig von steigenden Strompreisen.
• Sie tragen dazu bei, den CO2-Ausstoß zu verringern.
• Neue oder bestehende Heizsysteme können ideal mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden.
• Mit der Installation eines zusätzlichen Energiespeichers können Sie nachts bequem die gespeicherte Sonnenenergie nutzen und erhöhen dabei Ihre Energieautonomie.
Ihre Ansprechpartner
Dietmar Auer – Verkaufsleiter Photovoltaik
Dietmar.auer@leitnerelectro.com
Stefan Agreiter – Technischer Leiter
Stefan.agreiter@leitnerelectro.com

Hohe Energiepreise, Unsicherheiten bei der Gasversorgung und der Klimawandel. Es gibt viele Gründe, warum Menschen im Hinblick auf die eigene Energieversorgung derzeit umdenken. Die Möglichkeiten, das Haus in Sachen Strom und Heizung umweltfreundlicher und zugleich autonomer zu machen, sind vielfältig.

Strom aus der Photovoltaik-Anlage und Heizen mit Erdwärme. Seit Jahren liegen alternative Systeme zur Energiegewinnung im Trend. Der Krieg in der Ukraine und steigende Energiepreise haben jetzt zu einem regelrechten Boom geführt. Viele Menschen wollen unabhängiger werden von Strom- und Gasanbietern. Ein vollständig autarkes Haus wird zwar
auch in Zukunft noch die Ausnahme bleiben, aber mit verschiedenen kleineren Maßnahmen lassen sich die hauseigenen Energiekosten und der CO2-Ausstoß deutlich reduzieren.
quer - 195 x 67 mm - € 695,00.-
Heizen mit Geothermie: Wärmepumpe Wärmepumpen gelten heute als besonders saubere und effiziente Heiztechniken. Grundsätzlich wird zwischen
verschiedenen Wärmepumpen unterschieden: den Luft-, Wasser- und Erdwärmepumpen.
Die Wärmepumpe funktioniert nach dem Prinzip einer Wärmezufuhr am Verdampfer und einer Wärmeabfuhr am Kondensator. Der Wärmetransport erfolgt über einen anhaltenden Wechsel des Aggregatzustandes des verwendeten Kältemittels von flüssig in




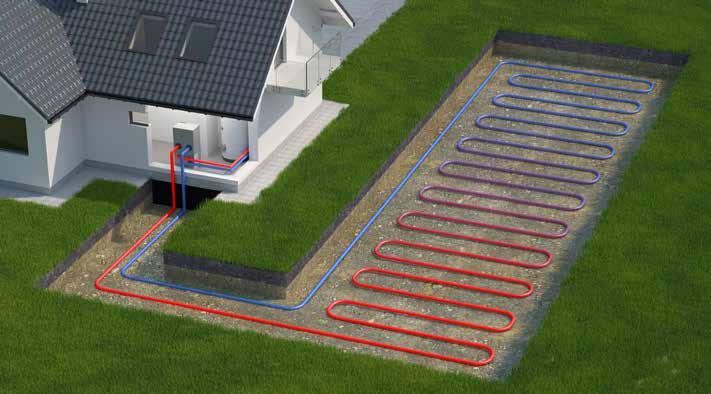
gasförmig und umgekehrt. Bei Umgebungstemperatur wird Wärme zugeführt und bei einer höheren Temperatur wieder abgeführt. Aufgrund dieses Prinzips kann die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen einen Raum gut temperieren. Um die von der Wärmepumpe bereitgestellte Energie möglichst effizient zu nutzen, bietet sich die Verbindung mit einer Fußbodenheizung an, vor allem wegen der großen Fläche und der Strahlungswärme, also der gleichmäßigen Abgabe über eine große Oberfläche. Denn je geringer der Unterschied zwischen der Umwelt-Temperatur und der für die Raumheizung erforderlichen Vorlauftemperatur ist, desto weniger muss die Wärmepumpe arbeiten. Die Fußbodenheizung ist gegenüber einem klassischen Heizkörper

3D-Darstellung eines Erdwärmesystems
daher klar im Vorteil. Neben den Fußbodenheizungen bieten sich aber auch Wandheizungen für den Einsatz mit einem Wärmepumpensystem an.
PV-Anlagen
ERNEUERBARE ENERGIEN
IST ELPO BESTENS VERTRAUT.

Seit Jahren realisieren wir schlüsselfertige Photovoltaikanlagen.
Seit 2007 sind wir Experten für PV-Anlagen. Unsere Erfahrung liefert uns das „Know-how“ PV-Anlagen aller Größenordnungen schlüsselfertig zu übergeben, immer genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Nach der Realisierung führen wir regelmäßige Wartung und Service durch. Rund 240.000 Module, umgerechnet 65 MW, haben wir in den letzten 15 Jahren verbaut.
Neben stromproduzierenden Anlagen bieten wir Erweiterungen durch Energiespeicher und E-Ladestationen an. Strom produzieren, speichern und bei Bedarf verwenden. So ein autarkes System ist geeignet für Haushalte, Gastronomie und Betriebe jeder Größe. Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner in Sachen erneuerbare Energien, denn wir stehen persönlich dahinter.
info@elpo.eu Tel.
Warmwasser vom Dach: Solarthermie
Bei der Solarthermie wird die Energie der Sonne für die Heizung und das Warmwasser genutzt. Der Vorteil davon ist, dass die Solarwärme in einen Pufferspeicher eingespeist wird. Sie kann also auch zu einem späteren Zeitpunkt noch für die Heizung verwendet werden. Trotzdem kann es vorkommen, dass in einem besonders dunklen Winter die Sonneneinstrahlung nicht mehr ausreicht. Deshalb empfiehlt es sich, die
Solarthermie immer in Verbindung mit einem anderen Heizsystem, etwa der Wärmepumpe, zu nutzen. In Südtirol ist die Nutzung von Solarthermie vor allem für die Warmwasserproduktion weit verbreitet.
Strom aus Sonnenlicht: Photovoltaik
Photovoltaik-Zellen verwandeln die Sonnenstunden in Strom: Sie erzeugen elekrische Spannung, die über einen Wechselrichter zu Wechselstrom umgewandelt
wird. Dieser kann dann gebäudeintern genutzt werden, in einer Batterie für eine spätere Nutzung gespeichert werden oder ins Stromnetz eingespeist. Je nach Dachfläche, Dachschräge und Sonneneinstrahlung entscheidet sich, ob die Anschaffung einer Solaranlage auch tatsächlich den erwünschten Nutzen bringen kann. Vor allem in Verbindung mit einer Wärmepumpenheizung, die einen relativ hohen Stromverbrauch hat, bietet sich eine Photovoltaik-Anlage an.
„Es gibt große Nachfrage nach Photovoltaik“
Seit über 75 Jahren ist das Bruecker Familienunternehmen Elpo im Bereich Elektrotechnik tätig. Ein Spezialgebiet von Elpo ist Photovoltaik. Firmenchef Robert Pohlin im Gespräch über die Chancen von Photovoltaik.
Radius: Photovoltaik gilt seit Jahren als zukunftsweisende Form der Energiegewinnung. Elpo hat sich dieser Technologie besonders verschrieben. Warum?
Robert Pohlin: Photovoltaik ist erneuerbare Energie, ist ein zuverlässiges und erprobtes Produkt und hat keine Nebenkosten. Wir konnten bereits 2007 die ersten Photovoltaik-
Anlagen bauen und viel an Erfahrung gewinnen. Mit der GSE-Einspeisevergütung in den Jahren von 2009 bis 2013 haben auch wir als Elpo viele mittlere und große Anlagen für Kunden realisieren können. Heute mit den hohen Stromkosten hat das Thema Photovoltaik eine enorme Wichtigkeit, es herrscht eine sehr große Nachfrage.
Radius: Welche wei teren Formen der nachhaltigen Energieerzeugung hat Elpo im Portfolio? Und welche davon wird sich



kühlen klimatisieren einrichten
in den kommenden Jahren in Südtirol am stärksten durchsetzen?
R. Pohlin: Anlagen für erneuerbare

Mit neuestem Know-how, fachmännisch, zuverlässig, ökologisch, nachhaltig.
Bereits in zweiter Generation ist Ungerer Ihr zuverlässiger Partner, wenn es ums Kühlen, Klimatisieren und Einrichten geht.
Der Meisterbetrieb mit Sitz in Partschins bietet mit einem Team aus erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern innovative Lösungen für Kühlung in der Gastronomie, der Landwirtschaft, dem Frisch- und Feinkostbereich, der Trocknung und Reifung von Lebensmitteln sowie Klimatisierung von Räumen.

Radius 190 x 93
satz ein und wir bauen eine Vielfalt an Anlagen zur Stromgewinnung. In erster Linie Photovoltaikanlagen, dann Biogas-, aber auch Wasserkraftwerke. Bei Letzteren ist das Potenzial in Südtirol ziemlich ausgeschöpft. Aktuell hat sich die Photovoltaik am stärksten durchgesetzt. Seit rund vier Jahren bauen wir auch Anlagen zur Gewinnung von Wasserstoff. Wasserstoff sehen wir als Energieträger der Zukunft, dessen Herstellung ist jedoch
sehr energieintensiv. Heute hat die Elektrolyse einen Wirkungsgrad von nur 50 Prozent.

Radius: Wie finden Privathaushalte, aber auch Unternehmen die passende Technologie? Wie gelingt der Umstieg von fossiler auf nachhaltige Energiegewinnung?
R. Pohlin: Man muss hier zwischen zwei Energieformen unterscheiden, die den Umstieg auf nachhaltige, erneuerbare Energie ermöglichen:
1. Den Strom, und hier ist für die Erzeugung die Photovoltaik absolut Spitzenreiter, kombiniert mit einer Batterie für die Speicherung der
15.9.22 energie&umwelt - pompe di calore T2
Tagesproduktion und Stromabgabe bei Nacht
2. Die Heizung, die bei uns in Südtirol mit Wasser, speziell mit Niedertemperaturheizung (Bodenheizung) erfolgt. Primär wird die Energie von den Fernheizwerken geliefert. Vermehrt werden sich aber Wärmepumpen etablieren, aber auch Photothermie, d. h. warmes Wasser aus der Sonne.
Industriell bzw. auf regionaler Ebene sehe ich noch Potenzial in Pumpspeicherkraftwerken, wo man überschüssigen Strom aus z.B. Photovoltaik oder Wasserkraft verwenden kann, um Wasser auf den Berg zu pumpen, um dann wiederum bei Bedarf Spitzenstrom zu erzeugen.

Effizienz und Innovation mit den besten Wärmepumpen. www.bautechnik.it
Das ideale Klima.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – das sind zwei Hauptargumente, wenn es um die Anschaffung von Kälteanlagen jeglicher Art geht. Doch wie ist es möglich, diese scheinbar gegensätzlichen Bedürfnisse der Kunden unter einen Hut zu bringen? Raimund Alton, Inhaber des Unternehmens Frigoplan, hat auf diese Frage eine klare Antwort. Das Unternehmen mit Sitz in Andrian ist seit fast 30 Jahren im Bereich der Kältetechnik tätig und zeichnet sich durch Erfahrung, Innovationsgeist und Kundennähe aus.
Radius: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der Kältetechnik? Geht das überhaupt, Herr Alton?
Raimund Alton: Ja, das geht. Unser Unternehmen Frigoplan wurde 1993 gegründet, und wir hatten uns schon damals Energieeffizienz auf die Fahne geschrieben. Nur lauteten die Schlagworte zu dieser Zeit „Stromeinsparen“ und „Langlebigkeit“. Also kann man sagen, wir haben darin eine jahrelange Erfahrung. Aber wir bleiben auch immer am Ball. In der Kältetechnik sind fortlaufende Innovationen von höchster Relevanz. Zum einen müssen die EU-Verordnungen zu den fluorierten Treibhausgasen (EU-Verordnung Nr. 517/2014 zu F-Gasen) konsequent umgesetzt werden, zum anderen geht es um den Kunden. Vor allem angesichts der aktuellen Entwicklung auf dem Energiesektor erwartet er sich, dass der Stromverbrauch bei der Kälteerzeugung möglichst gering ist. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. Damals sollte es nur „billig“ sein. Jetzt soll es effizient sein.

ausgelegt, mit dieser Regelungstechnik ausgestattet und von der Ferne aus geregelt. Das bedeutet: Wir passen die Anlage an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an und überwachen sie auch, ohne dass die Kunden etwas davon merken. Sie bemerken den großen Vorteil erst auf der Energiekostenabrechnung. Ein Beispiel: Bei einem unserer Kunden ist nach dem Umbau durch Frigoplan der Energieversorger erschienen, um zu kontrollieren, ob wohl alles in Ordnung ist, denn die Stromrechnungen waren auf einmal auffallend niedrig. Das sind Vorfälle, über die wir uns sehr freuen und die uns dazu motivieren, unsere Linie weiterzuverfolgen.
Radius: Nachhaltigkeit bedeutet aber auch Umweltfreundlichkeit …
R. Alton: Stimmt. Deshalb achten wir darauf, dass der Anteil der herkömmlichen Kältemittel bei unseren Anlagen kontinuierlich sinkt. Wir setzen stattdessen auf CO2- und Ammoniak-Anwendungen. Diese natürlichen Kältemittel sind kostengünstig, gut verfügbar, CO2-neutral und somit nicht umweltschädlich.
Radius: Kunden möchten immer auch gut beraten sein. Was tun Sie, um diesem Wunsch nachzukommen?
Radius: Was tun Sie, um dieser Anforderung gerecht zu werden?
R. Alton: Wir arbeiten mit erstklassigen Unternehmen zusammen, und das schon seit Jahren. Somit ergibt sich ein ständiger Austausch über Anwendungserfolge. Und wir haben einen hervorragenden Partner aus der Regelungstechnik. Unsere Kälteanlagen werden nach dem neuesten Stand der Technik
R. Alton: Wir legen viel Wert auf die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, intern wie extern. Bei uns wird Wissen geteilt, diskutiert und angewendet. Alle unsere Mitarbeiter sind hochmotiviert, auch in schwierigen Zeiten, und der Kunde merkt deutlich, dass er da in guten Händen ist. Es ist zwar manchmal eine Herausforderung, die Kunden davon zu überzeugen, etwas mehr Geld zu investieren, aber wenn man ihnen die Energie- und Folgekostenrechnung sowie die Möglichkeit der Industrieförderung 4.0 erklärt, sind sämtliche Zweifel widerlegt. Viele unserer Kunden hat das Argument der Industrieförderung 4.0, verbunden mit unserer Regelungstechnik, dann wirklich überzeugt, und sie haben die Investition umgesetzt. Das macht uns stolz und gibt uns den Ansporn, in diese Richtung weiterzuarbeiten.




Pünktlich, schnell und häufig sollten sie fahren. Das wünschen sich die Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln. So ganz wurde dieser Wunsch in Südtirol noch nicht erfüllt. In Brixen hat man aber schon mal die besten Voraussetzungen für ein vorbildliches Nahverkehrssystem geschaffen.
Das neue Mobilitätszentrum auf dem Bahnhofsareal, im Frühsommer offiziell seiner Bestimmung übergeben, besticht mit kurzen, zum Großteil barrierefreien Wegen, angenehmen Warte- und bequemen
Umsteigemöglichkeiten, Parkplätzen und Haltemöglichkeiten für Autos, Motorräder und vor allem für Fahrräder. „Es ist nicht nur eine wichtige Mobilitätsdrehscheibe für die Brixnerinnen und Brixner, sondern für den gesamten Bezirk Eisacktal“, unterstrich Landeshauptmann Arno Kompatscher anlässlich der Eröffnung.
Überdachter Busterminal
Deshalb war es das Ziel der Planer, vielen Menschen in unterschiedlichen Situationen den schnellen Zugang zum Zentrum und die einfache Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel zu ermöglichen. Ob Urlauber mit schwerem Koffer, Pendler mit Fahrrad, Rollstuhlfahrer oder Weltenbummler – für alle, die bereit sind, sich umweltfreundlich fortzubewegen, soll das problemlos erfolgen können.
Dafür ist der nunmehr überdachte Busterminal sehr wichtig. Hier ist es für die Fahrgäste nun auch bei schlechtem Wetter oder großer Hitze nicht unangenehm, einige Minuten zu verbringen. An digitalen Infotafeln, die kürzlich aufgestellt wurden, können die Wartenden zudem Ankünfte und Abfahrten in Echtzeit ablesen.


Viel Platz zum Parken
Ansonsten wurde der gesamte Bahnhofsplatz neu gestaltet, auch mit Sitzgelegenheiten sowie etwas Grün fürs
Auge. Schließlich betrachtet die Brixner Gemeindeverwaltung das Mobilitätszentrum als Visitenkarte der Stadt, und da ist der „Eingang“ das Erste, was die Nutzer wahrnehmen.
Der Pkw-Parkplatz am Mobilitätszenrum verfügt über rund 180 Stellplätze, von denen einige auch behindertengerecht ausgeführt wurden. Es gibt zudem Stellplätze für Motorräder sowie für Carsharing. Direkt vor dem Bahnhofsplatz sind mehrere Taxistände angesiedelt, auch die City-BusHaltestelle wurde in diesem zentralen Bereich positioniert.
Der private Verkehr kann nun über die Mozartallee herauf- und vor dem Bahnhofsplatz eine Schleife fahren. Hier gibt es die Möglichkeit, kurz anzuhalten.
„Kiss and Ride“-Platz nennt sich ein solcher Kurzzeitparkplatz, der für wenige Minuten – also im wörtlichen Sinn

nur für einen schnellen Abschiedskuss – kostenlos genutzt werden kann. Gedacht wurde natürlich an jene Autofahrer, die Öffi-Nutzer schnell absetzen oder abholen müssen. In diesem Bereich gibt es auch behindertengerechte Parkplätze. Eine Rampe mit geeigneter Neigung verbindet diese Parkplätze mit dem Bahnhofsplatz.
Radfahrer willkommen
Als „Herzstück“ des Mobilitätszentrums bezeichnete Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider bei der Eröffnung aber die Fahrradabstellplätze. Bis zu rund 1000 Fahrräder und E-Bikes sollen hier künftig sicher abgestellt werden können, wobei im kommenden Winter zusätzlich abschließbare Radboxen zur Verfügung stehen sollen. Bereits gut genutzt werden die überdachten Abstellplätze.
Dass die Fahrradparkplätze an verschiedenen Bereichen positioniert sind, kommt vor allem den Pendlern zugute, die morgens aus den un-
terschiedlichsten Richtungen zum Bahnhof kommen und ihren Zug oder Bus schnell erreichen möchten. Die meisten Fahrradabstellplätze sind im Norden des Areals angesiedelt, wo die Menschen aus dem Stadtzentrum zum Bahnhof kommen. Das Mobilitätszentrum wurde im Zuge der Eröffnung vom Verein Freunde der Eisenbahn zum „Bahnhof des Jahres“ gekürt.
Die Pkw-Parkplätze beim Mobilitätszentrum sind kostenpflichtig.
Zugpendler mit Südtirol Pass parken jedoch kostenlos. Wer seinen Pkw am Parkplatz abstellt und dort die Fahrt mit einem Regionalzug fortsetzt, zahlt als Tagestarif 6 Euro. Erfolgt am selben Tag eine Entwertung für eine Fahrt mit einem Regionalzug, so beträgt die Parkgebühr nur noch 3 Euro. Erfolgt am selben Tag eine Hin- und Rückfahrt mit einem Regionalzug, ist der Parkplatz gänzlich gratis.

Ihr

Für die architektonische Gestaltung des Mobilitätszentrums wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Als Sieger ging das Büro Lukas Burgauner Architecture & Design aus Bozen hervor. In der Folge wurde das Büro mit der der gestalterischen Planung sowie der architektonischen Bauleitung beauftragt. Das Architekturbüro mit Schwerpunkt auf repräsentative Architektur für Industrie- und Gewerbebauten bzw. Infrastrukturen für die Mobilität und Aufstiegsanlagen wurde von Lukas Burgauner im Jahr 2006 mit Sitz in Bozen gegründet. Finanziert wurde das Projekt Mobilitätszentrum Brixen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Am Bau des Mobilitätszentrums Brixen waren mit Klapfer Bau, Wipptaler Bau, Goller Bögl sowie Marx Bau heimische Unternehmen beteiligt. Die Planung und die Bauleitung wurden von einer Bietergemeinschaft, bestehend aus iPM-Ingenieurbüro und NET-Engineering, ausgeführt. Das Ingenieurbüro iPM mit Sitz in Bruneck wird von den beiden Eigentümern Ingenieur Udo Mall und Ingenieur Markus Pescollderungg geführt und ist seit 2002 im Hochund Tiefbau tätig. Zu den Hauptaktivitäten gehören die Planung und Bauleitung von gesamten Skigebieten, Hotels und Infrastrukturen in Italien und im internationalen Umfeld. NET-Engineering ist eine der größten Engineering-Gesellschaften in Italien mit Sitzen in Monselice (PD), Rom und Mailand und ist vor allem im Bereich der großen und mittleren Infrastrukturprojekte weltweit tätig.


Mit unseren persönlichen Energieverbrauch so hauszuhalten, dass wir die Anforderungen des Alltages gut bewältigen und dabei das Leben mit seinen Möglichkeiten genießen können, das ist die Aufgabe der Zukunft.
Ausgehen und tanzen, feiern und trinken, ein Wochenendtrip nach London, nach einem arbeitsreichen Tag schnell auf die nächste Veranstaltung, zeitgleich mit mehreren Freunden auf Instagram, Facebook und LinkedIn kommunizieren.
Schnelle Booster sind sexy und easy! Doch wie sieht der langfristige, nachhaltige Erfolg im Hinblick auf den persönlichen Energielevel dabei aus? Irgendwann kommt – so sicher wie der Herbst nach dem Sommer – der Moment der Überforderung, der Müdigkeit, vielleicht begleitet von einer Grippe, Schlafstörungen oder einem überreizten Magen.
Ein Erlebnis der anderen Art
Bei meinem Urlaub in einem fernen Land wurde ich zurückversetzt in die Zeit unserer Großeltern. Alles geschieht langsam, die einzige Kuh wird in der Früh auf die Weide begleitet und am Abend in den Stall zurückgebracht. Die Mittagspause wird ruhend im Schatten verbracht. Der Lebensstandard ist ein anderer – Urlaubsreisen, Kosmetikartikel und Markenkleidung gibt es hier nicht. Es drängt sich in dieser Situation die Frage auf: Schuften wir 48 Wochen im Jahr in einem sehr hohen Tempo, um uns viel „leisten“ zu können und um uns dann – in den wenigen Wochen Urlaub –vom restlichen Jahr zu erholen?
Nachhaltig, langfristig – langweilig?
Jeder weiß, was fit hält und guttut: Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung an der frischen Luft und genügend Ruhephasen werden seit Jahrzehnten propagiert und immer
wieder mal ins alltägliche Leben integriert. Zu Neujahr, nach einer Phase der Erschöpfung, werden gute Vorsätze gemacht und in manchen Momenten wird es wieder deutlich, dass es auch anders gehen würde. Doch der Rhythmus unserer Gesellschaft wird wieder stärker und diese unspektakulären, sanften, unaufgeregten Energiequellen werden wieder mal verdrängt von den „sexy Boostern“.
Gesundes Arbeiten
Wie wird darauf geachtet, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen? Wöchentlicher Obstkorb und zweimal im Jahr eine üppige Betriebsfeier? Oder regelmäßige Seminare zu Kommunikation und Konfliktbewältigung, zu Zusammenarbeit und partizipativer Mitgestaltung? Es ist derselbe Trend erkennbar wie auf der persönlichen Ebene: kurzfristig, lustig und wenig aufwendig versus langfristig, herausfordernd und persönlich. Die Akzeptanz der Mitarbeiter:innen für eine Weihnachtsfeier ist einfacher zu erhalten wie für monatelange Prozesse zur Verbesserung der internen Kommunikation.
Kurzfristig kann man sich mit den „sexy Boostern“ sehr gut behelfen, über manches Problem drüberschaukeln. Mittel- und langfristig funktionieren diese Konzepte weniger, und plötzlich steht man vor einer größeren Herausforderung: Reibungsverluste durch schlechte Kommunikation, Leerläufe durch fehlende Motivation, nicht gelöste Konflikte, endlose Sitzungen ohne Ergebnisse oder gar Kündigungen oder lange Krankenstände.
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist im deutschsprachigen Raum bereits sehr etabliert, bei uns in Südtirol beginnt dieser Ansatz verstärkt Fuß zu fassen.
BGM meint – in aller Kürze – gesunde und produktive Zusammenarbeit in Unternehmen zu stärken. Es wird nicht nur die Führungs-/ManagementEbene berücksichtigt, sondern alle Mitarbeiter:innen werden miteinbezogen. Dabei werden beim BGM-Prozess die inhaltlichen Schwerpunkte der jeweiligen betrieblichen Situation angepasst.
vival.institute ein innovatives Unternehmen
Als zentrales Produkt bietet das vival. institute betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für Betriebe an. Dazu Christa Delmonego: „Das vival. institute besteht aus einem Netzwerk von elf Beraterinnen und Beratern mit unterschiedlichen Schwerpunkten, umfangreicher Berufserfahrung und viel Know-how. Das macht es uns möglich, die unterschiedlichen Bereiche eines BGM-Prozesses qualitativ hochwertig anzubieten und durchzuführen.“
Dazu noch ein Tipp von der vival. institute-Partnerin: „Jeder sollte sich sowohl auf privater Ebene als auch im beruflichen Kontext immer wieder für nachhaltige Energiequellen entscheiden um dadurch sein Leben und Wirken gesund zu gestalten. Zwischendurch sind kurzfristige „sexy Booster“ willkommen und tun gut, als Dauerlösung sind sie nicht empfehlenswert. Sowohlals-auch statt Entweder-oder. In diesem Sinne freue ich mich auf die ausgedehnte Bergtour und auf die nächste Weihnachtsfeier“!

Autorin
Dott. Christa Delmonego – Betriebliche Organisation & Entwicklung – Coaching –Seminare www.schnittmenge.org; Partnerin von www.vival.institute –lebenswerte.arbeitswelten

„Chronisch abakterielle Prostatitis“ (CBSS) kann viele Ursachen haben und sollte stets urologisch abgeklärt werden.
Allein über den Schmerz spricht man(n) nicht gerne. Zumal das betroffene Organ – die Prostata – im Sexualleben des Mannes eine wichtige Rolle spielt. Denn diese kastaniengroße Drüse zwischen Blase, Schambein, Penis und Rektum produziert ein Sekret, das bei der Ejakulation in die Harnröhre geht und die Samenflüssigkeit befruchtungsfähig macht. Selbst wenn Bewusstsein, Vorsorge
und Therapie bei Prostata-Krebs heute stark verbessert sind, werden andere Prostata-Erkrankungen leicht übersehen und häufig älteren Männer zugeschrieben.
Schmerzhaftes Ziehen
Klinische Fallbeispiele einer typischen „Prostatitis“ (CBSS – chronisches Beckenschmerzsyndrom) jedenfalls zeigen, dass die genannten Symptome vorwiegend bei jungen Männern vorkommen, die beim Urologen Hodenschmerzen oder Miktionsbeschwerden beklagen und nicht an eine „Prostataverkühlung“ den -
ken. Als mögliche Ursachen gelten genetische Erbanlagen, ein defektes Immunsystem, psychische Mechanismen oder auch mechanische Druckfaktoren. Für Letztere sprechen etwa jene Patienten, deren Prostata – besonders häufig bei jungen Sportlern – einer bestimmten Belastung ausgesetzt ist. Ob Radfahrer (das Sitzen im Sattel), Wintersportler (der Druck von Aufstiegshilfen) oder auch Bauern (die Vibrationen von landwirtschaftlichen Geräten) – die Folge sind Missempfindungen im Dammbereich, die in den Hoden ausstrahlen. Ebenso von Miktionsbeschwerden wie ständigem Harndrang, „Brennen“ beim Urinieren und Ejakulationsstörungen berichten Betroffene. Und dass, obwohl im Falle von CBSS bei der urologischen Visite weder die Prostata selbst noch die Laborwerte des Prostatasekrets auffällig sind. Das wiederum macht die Therapie – im Gegensatz zur „bakteriellen Prostatitis“, die mit Antibiotika behandelt wird – schwierig. Zwar scheinen Entzündungshemmer den unangenehmen Schmerz zu lindern, doch als Abhilfe ist vor allem eine Wärmetherapie in Form von warmen Sitzbädern (in der Badewanne) meist erfolgreich, sodass die Symptome nach einer Woche nahezu verschwunden sind. Auch mit Phytopharmaka, Stoßwellen, Elektroakupunktur oder Nervenstimulation wurden bereits Behandlungserfolge erzielt. Ebenso wie mit Verhaltenstherapie bzw. Psychoanalyse: Denn ein gesundes Sexualleben ist auch in diesem Fall häufig vor allem reine Kopfsache.

Vorsorge, Potenzprobleme, Fertilitätsprobleme, Prostata-, Nieren-, Blasenleiden, ambulante Operationen
Vorsorge, Potenzprobleme, Fertilitätsprobleme, Prostata-, Nieren-, Blasenleiden, ambulante Operationen
Vorsorge, Potenzprobleme, Fertilitätsprobleme, Prostata-, Nieren-, Blasenleiden, ambulante Operationen
Vorsorge, Potenzprobleme, Fertilitätsprobleme, Prostata-, Nieren-, Blasenleiden, ambulante Operationen
Vorsorge, Potenzprobleme, Fertilitätsprobleme, Prostata-, Nieren-, Blasenleiden, ambulante Operationen
TERMINE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG
TERMINE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG
TERMINE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG
TEL.: 0474 497 063 | MOBIL 339 69 53 738
TERMINE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG
TEL.: 0474 497 063 | MOBIL 339 69 53 738
TEL.: 0474 497 063 | MOBIL 339 69 53 738
TERMINE NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG
39031 Bruneck – Kapuzinerplatz 9 www.drgasser.it
TEL.: 0474 497 063 | MOBIL 339 69 53 738 39031 Bruneck – Kapuzinerplatz 9 www.drgasser.it
TEL.: 0474 497 063 | MOBIL 339 69 53 738
39031 Bruneck – Kapuzinerplatz 9
39031 Bruneck – Kapuzinerplatz 9
www.drgasser.it

Astrid Michaeler ist eine überzeugte Teamworkerin und auch privat alles andere als eine Einzelgängerin. Zahlen, Daten, Fakten, Bilanzen, Controlling, Gesetze und Auflagen sind ebenso ihr tägliches Brot und ihre Leidenschaft wie Dinge richtigzustellen, schnell Lösungen zu finden und das, was am Markt gefühlt wird, in Zahlen wiederzugeben. Was anderen als eine überaus trockene Materie erscheinen mag, steckt für sie voll Leben. Eines allerdings braucht
Astrid Michaeler, Verwaltungsleiterin der Brixner Stadtwerke, unbedingt: Veränderungen und Abwechslung.
Während der jetzigen Ukraine-Krise und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Energiemarkt fehlt es ihr daran gewiss nicht! Energie, Strom und alternative Stromquellen sind im Augenblick ein heißes Eisen,

mehr noch als Recycling und eine verantwortungsvolle Abfallwirtschaft. Anstelle der einmal im Jahr anstehenden Planung gilt es, sich ständig anzupassen, um- und nachzurechnen, sich den Kopf zu zerbrechen, überall nach Einsparungen zu suchen und diese entsprechend zu kommunizieren. „Ich bin das finanzielle Gewissen der Stadtwerke und diejenige, die kontrolliert, Daten und Budgets einfordert. Dass ich damit nicht von allen „geliebt“ werde, damit kann ich gut leben.“
Einmal Brixen – immer Brixen
Die gebürtige Brixnerin zählt zum Urgestein der Stadtwerke. In Brixen geboren und zur Schule gegangen, hat sie nach der Matura, nach einem zweijährigen Intermezzo in einem Privatunternehmen bei den Stadtwerken begonnen. Dort ist sie geblieben und dort ist sie gewachsen. In mehr als 30

Jahren hat sie maßgeblich zum Wachsen der Stadtwerke und zur Verwandlung vom rein öffentlichen Dienstleister zu einem maßgeblichen und fairen Mitbewerber auf dem Energiemarkt beigetragen. Auch als sie nach mehreren Jahren beschlossen hat, ein Studium anzuhängen, hat sich Astrid Michaeler für eine Lösung entschieden, die von Brixen aus (neben dem Fulltime-Job) möglich war und sich am MCI | The Entrepreneurial School® - Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck eingeschrieben. Sie ist die erste Frau in einer leitenden Position in den Brixner Stadtwerken und in der Energie-, Wasser-, Recycle- und Abfallbranche. Zusammen mit Verena Trockner, Verwaltungsleiterin der Seab, steht sie nur männlichen Kollegen gegenüber. Gegenseitiger Respekt ist für sie eine Voraussetzung in einer von Männern beherrschten Welt. „Als Frau muss man sich die Wertschätzung der Kollegen erst durch Können und Wissen erkämpfen; Männer haben dieses Problem nicht, abgesehen davon, dass sie sich weniger hinterfragen als Frauen.“ Aber Jammern liegt ihr nicht. In ihrer Abteilung hat sie es nur mit weiblichen Mitarbeiterinnen zu tun, sie zu stärken, ist ihr ein Anliegen. Neben den Rechenkünsten braucht es bei ihrer Tätigkeit viel Fingerspitzengefühl.
Gesellschaft ist ein Lebenselixier
Die erfolgreiche Managerin ist Mitglied vieler Vereine, liebt Sport, vorausgesetzt, sie kann ihn gemeinsam mit anderen ausüben. Neben dem Tauchen sind im Augenblick – je nach Jahreszeit – Lau-


Astrid Michaeler mit einem Jugendlichen und zwei Kolleginnen von anderen Brixner Jugendorganisationen beim Altstadtfest
fen, Skitouren, Tennis und Zumba angesagt. Änderungen sind auch hier nicht ausgeschlossen. „Ich bin keine Extremsportlerin, aber Bewegung ist mir ein absolutes Bedürfnis!“ Auch in ihrer Vereinstätigkeit kann sie ihre Affinität zu Zahlen einbringen. Im Amateursportverein Pfeffersberg und in der Sektion Tennis ist sie für die Buchhaltung zuständig. Im Verein Jugendhaus Kassianeum lebt sie hingegen ihr soziales Engagement aus. Sie bezeichnet sich selbst als positiven Realisten, das gut gelaunte Naturell und die offene Ausstrahlung erkennt man schon an ihrer Stimme. Nach ihren
positiven Eigenschaften befragt, führt
Astrid Michaeler zielstrebig, sozial, flexibel, offen, ehrlich und gesellig an. Ihre negativen Eigenschaften? „Ich bin nicht sehr diplomatisch und vielen zu direkt und neige dazu, mein Licht zu sehr unter den Scheffel zu stellen. Und: Ich bin mir selbst nicht genug, kann nicht allein sein.“
Finanzen und Fantasy
„Ich bin nie aus Brixen herausgekommen“, sagt sie, „und meine Wohnung befindet sich in meinem Elternhaus.“ So ganz stimmt das allerdings nicht.
Das Chaletdorf Valsegg zeigt vor, wie nachhaltiger Urlaub in Südtirol gelingt. Wer sich nach Entschleunigung, dem Glück im Kleinen und naturnahem Urlaub in Südtirol sehnt, findet auf 1.300 Metern, gleich am Waldesrand von Vals, das perfekte Urlaubsrefugium.
Familie Lanz hat mit dem Chaletdorf Valsegg, das neun Holzchalets, ein Gourmetrestaurant, eine kleine Landwirtschaft und ein Waldbad umfasst, ein kleines Paradies der Ruhe erschaffen. Vermehrt gönnen sich auch Südtirolerinnen und Südtiroler eine Auszeit am Waldesrand, „Urlaub daheim“ gewinnt zunehmend an Attraktivität. Insbesondere weil hier im Valsegg ein gewisser Luxus auf gelebte Nachhaltigkeit trifft. Wo immer es möglich

Astrid Michaeler ist überaus reiselustig und hat vor Covid-19 viele (interkontinentale) Reisen unternommen. Allerdings nie allein. Die nächste Reise ist schon geplant, ein Urlaub mit ihrem Tauchclub auf Tremiti. Die Traumziele der Zukunft haben indirekt mit ihren sportlichen Aktivitäten zu tun: die Malediven, die Karibik und Südafrika. Den notwendigen (Rest-)Urlaub für Fernreisen hätte sie … Auch für eine Weltreise. Bleibt die Suche nach den Mitreisenden! Was sie alleine tut, ist Lesen. Wenn möglich täglich, beim Frühstück und vor dem Schlafengehen, das E-Book ist ihr ein treuer Begleiter und entführt sie in Fabelwelten. Lieblingslektüre: Fantasy!
Stress ist Astrid Michaeler ein Ansporn. An den Abenden länger im Büro zu bleiben, wenn es gilt, wichtige, anstehende Dinge zu erledigen, empfindet sie selten als Last. Am Wochenende allerdings heißt es ab Freitag 13 Uhr Weekend und abschalten. Urgestein hin oder her.
Anzeige
ist, greift Familie Lanz auf Ressourcen aus der unmittelbaren Umgebung zurück: Das Holz für die Chalets und das Quellwasser kommen aus dem eigenen Wald, die Wärme aus der Hackschnitzelanlage und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der direkten Nachbarschaft. Hier hegt und pflegt man, was man hat. Magdalena und Gregor Lanz sind von der nachhaltigen Philosophie überzeugt: „Wer kleine Kreise zieht, trägt das Seine zum großen Ganzen bei.“
Südtirol Chalets Valsegg Unterlände 5 | 39037 Vals/Mühlbach Tel. 388 770 74 44 info@valsegg.it | www.valsegg.it


Die RadiusThemenausgaben informieren und vermitteln zeitgemäßes Wissen in kompakter Form. In dieser Rubrik beantworten unsere Experten aktuelle Fragestellungen. In dieser Ausgabe werden zum übergeordneten Thema „Kostenmanagement“, einige spezielle Detailfragen geklärt.
Thomas K., Ritten: Wir sind ein kleiner Tischlereibetrieb und unsere Kosten, vor allem die Energiekosten, gehen aktuell durch die Decke. Wir sind Handwerker und am Ende des Monates wollen wir wissen, wofür wir gearbeitet haben. Wie können wir die Überwachung und Steuerung der Kosten verbessern, wo jetzt die Preise ständig steigen?

SMART HOME
Florian Burger: Globalisierung und Digitalisierung sorgen für stetigen Wandel mit Vorteilen für den Anbieter, der seine Leistung kostengünstig herstellen kann. Doch Preissteigerungen durch hohe Energiepreise und Rohstoffmangel lassen den Kostendruck in den Unternehmen steigen. Die Unternehmen müssen in Krisen, egal ob es sich um Finanzmärkte, Rohstoffmangel, Krieg oder Pandemie handelt, sofort handeln, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Maßnahmen zur Kostenoptimierung werden zusammen mit den Fachabteilungen geplant. Erfolg oder Misserfolg wird festgestellt und mit Reaktionen versehen. Nicht nur auf inhaltliche Aspekte sollen die

Gebäudeautomation, Lüftung und Klimatisierung, Beleuchtung, Sonnenschutz, Zutrittskontrolle und Alarmanlagen, verschiedene Bussysteme.
VoIP und Unified Communication Telefonzentralen, Videoüberwachung, Glasfaser-, Funkverbindungen und WirelessNetzwerke.
Maßnahmen ausgerichtet werden, sondern auch der zeitliche Aspekt spielt eine große Rolle.
Kurzfristiges Kostenmanagement ist notwendig, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen. Bei Krisen ist dies oft der Fall. Stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ein großer Kunde zur Konkurrenz gewechselt ist. Ist die Krise hausgemacht? Werden mehrmals im Jahr die Preise für Rohstoffe erhöht? Wie können diese Preissteigerungen kompensiert werden?
Mittelfristiges Kostenmanagement wird vorwiegend von den Veränderungen auf den Märkten erzwungen. Dazu zählen zum Beispiel die geänderten Kaufgewohnheiten der Verbraucher, Nachfragerückgänge oder

ELECTRICAL ENGINEERING
Verteilernetze,

Konkurrenzdruck durch Niedriglohnländer. Da stellt sich die Frage, ob die Preise gesenkt werden müssen oder das Geschäftsmodell noch zielführend ist.
In Krisensituationen werden Sie nun die Maßnahmen versuchen konsequent umzusetzen, wofür es inzwischen auch in Südtirol viele Spezialisten gibt. Ein permanentes Kostenmanagement ist aber auch ohne Krisen im Controlling notwendig. Die Maßnahmen unterscheiden sich mit oder ohne Druck nur selten, werden aber ohne Krise entspannter umgesetzt. Kostenmanagement gehört im Betrieb zur typischen Führungsaufgabe. Durch Analysen unterstützt und hilft das Controlling die Potenziale des Kostenmanage-
geschäft betrachtet und auf Veränderungen reagiert wird. Da dies auf der operativen Ebene stattfindet, müssen die Mitarbeiter durch ihre Kompetenzen und Erfahrung Verantwortung übernehmen und Maßnahmen in die Wege leiten. Damit können kleine, auf Abteilungen beschränkte Problemsituationen zusammen mit dem Controlling gemanagt werden. Anders sieht es bei großen Krisen aus, welche das gesamte Unternehmen betreffen und sich auf mehrere Abteilungen auswirken. Hier ist gemeinsame Beratung zwischen Führungskraft und Controlling für die kurzfristig wirksamen Maßnahmen notwendig.
Bei mittelfristigem Kostenmanagement wird mehr Zeit bis zur Wirkung
die Rolle des Vermittlers zu und je nach Unternehmensstruktur und -kultur kann diese Rolle intern oder extern besetzt werden.
Damit Sie diesbezüglich nun eine nachhaltige Entscheidung treffen, bitte ich Sie, Ihre Situation zeitnah mit einem Fachexperten ihres Vertrauens abzuklären.
Florian Burger ist freiberuflicher
Buchhalter und Controller und arbeitet auf Projektebene interdisziplinär über die gemeinsame Plattform von Vinburg Projects zusammen – der Südtiroler Unternehmensberatung mit Spezialisierung in den Bereichen Sustai






Senden Sie uns eine Nachricht mit der benötigten Menge sowie dem Lieferort und erhalten Sie in Kürze ein individuelles Angebot!


Am Samstag, 27. August, fand das siebte FORST Sporthilfe Golf-Charity im Golfclub St. Vigil Seis statt. Nachwuchssportler, ehemalige Spitzensportler, Unternehmer sowie Golfbegeisterte folgten der Einladung der Südtiroler Sporthilfe und nahmen am Turnier im bekannten Golfclub teil.
130 Teilnehmer, darunter auch verheißungsvolle Nachwuchssportler der Südtiroler Sporthilfe und ehemalige Spitzensportler, waren auf dem Green im Einsatz. „Die Vorfreude bei vielen Teilnehmern war so groß, dass wir

bereits am Montag vor dem Turnier ausgebucht waren und nur mehr eine Warteliste geführt wurde“, sagte der Geschäftsführer Stefan Leitner, der nach dem großen Erfolg im Vorjahr noch einen drauflegen konnte. Beim anschließenden FORST Aperitif
Die Treibhausgasemissionen konnten in den vergangenen drei Jahren um 14 Prozent gesenkt werden. Eine weitere Verbesserung soll die neue Photovoltaik-Anlage bringen, die rund ein Viertel des derzeitigen Stromverbrauchs produziert.
„Die Kellerei Bozen hat sich vorbildhaft für die Zukunft aufgestellt“, befindet Sonja Abrate, stellvertretende Direktorin des Ökoinstituts Südtirol. Das Institut hat erstmals eine KellereiGenossenschaft unter die Lupe genommen und einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt. Das Zertifikat wurde der Kellerei vor Kurzem offiziell verliehen. „Wir verfolgen das Ziel, unsere Arbeit im Einklang mit der Natur zu verrichten“, erklärte der Obmann der Genossenschaft, Michl Bradlwarter, bei dem Festakt. Und Kellermeister Stephan Filippi ergänzte: „Mit dem Nachhaltigkeitsbericht stellen wir fest, wo wir heute stehen und wie wir auch in Zukunft Weine mit hoher Qualität erzeugen und gleichzeitig Verantwortung für die nächsten Generationen übernehmen können.“

berichteten die anwesenden Spitzenathleten aus ihrem Sportlerleben. Außerdem wurde eine Tombola veranstaltet, bei der zahlreiche tolle Preise verlost wurden. Der Gesamterlös von 13.500 Euro kommt der Südtiroler Sporthilfe zugute.

Um die Brenner achse mehr zu einem Green Corridor zu machen, hat die Landesregierung einen Grundsatz beschluss zu einem Projekt fürs Erzeugen, Lagern und Verteilen von Wasserstoff gefasst. Auf dem Weg zum „grünen Korridor“ auf der Brennerstrecke spielen die Produktion und Verwendung von Wasserstoff laut Mobilitätslandesrat eine wichtige Rolle. Es sei ein zentrales Anliegen, auf diesem wichtigen alpenquerenden und länderverbindenden Verkehrsweg vor allem eine nachhaltige und emissionsfreie Mobilität gemeinsam mit den Nachbarländern weiterzuentwickeln. Deshalb sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass emissionsfreie Fahrzeuge auf der Strecke verkehren können. So sieht das gutgeheißene Projekt vor, eine solide WasserstoffVersorgungskette zu schaffen, die auf konkreter Nachfrage beruht und sich aufs Nutzen von Wasserstoff als Energieträger konzentriert. Insgesamt 14 Tankanlagen sollen im Rahmen des Projekts entstehen.
www.alpitronic.it/karriere

Wir sind ein stark wachsendes, innovatives und international agierendes Unternehmen im Bereich der E-Mobility mit Sitz im Herzen Sütdtirols, in Bozen. Die alpitronic wurde im Jahr 2009 mit dem Ziel leistungselektronische Systeme zu entwickeln gegründet. Seit 2017 fokussieren wir uns nunmehr auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Schnellladesäulen für Elektro-Fahrzeuge.
In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft mit unserem Produkt – dem „hypercharger“ – Marktführer in Europa zu werden.
Unser bunt gemischtes Team umfasst inzwischen mehr als 300 MitarbeiterInnen und leistet täglich Großartiges, um die Zukunft etwas grüner zu gestalten. Möchtest auch du Teil dieses unglaublichen Teams sein?
Offene Stellen:
www.alpitronic.it/karriere
alpitronic GmbH
www.alpitronic.it Bozner-Boden-Mitterweg, 33

Die Energie, die das Land uns schenkt, geben wir weiter an die Menschen. Um Energie zu spenden und damit aktiv eine energiereiche Zukunft zu gestalten.




260 Mio. €
generierter Mehrwert für Südtirol







1.692.112 tCO2e
vermiedene Emissionen
entspricht der Menge an gereinigter Luft durch etwa 72.195 Bäume in einem Jahr



4,1 TWh
Nettoenergiepoduktion aus erneuerbaren Energiequellen
entspricht dem Verbrauch von ca. 1.518.000 Familien
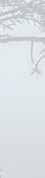








74 % unterirdisch verlegte Stromleitungen