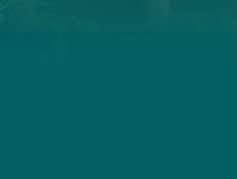Nr. 5
Oktober/November 2023 € 8,00
Österreichische Post AG MZ 18Z041474 M advantage Media GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
SPEZIAL


Nr. 5
Oktober/November 2023 € 8,00
Österreichische Post AG MZ 18Z041474 M advantage Media GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee





addIT informiert über KI
Kärntens größter IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen auf dem digitalen Weg.
Gekommen, um zu bleiben!
Mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz in der breiten Ö�entlichkeit angekommen.
Koralm ohne Tunnelblick
Kärnten und die Steiermark bekräftigen ihre bundesländerübergreifende Zusammenarbeit.
Technologien nachhaltig nutzen
Wie digitale Lösungen den idealen WindkraftStandort ermitteln und das Klima schonen.













Innovation aus Prinzip. Qualität als Versprechen – diese Grundidee zeichnet die Handlungen der Lindner-Recyclingtech GmbH aus. Raiffeisen begleitet das Unternehmen seit vielen Jahren als verlässlicher Partner.
Regional verwurzelt, global geschätzt
Lindner Recyclingtech in Spittal an der Drau blickt auf eine lange und traditionsreiche Geschichte als österreichisches
Familienunternehmen zurück. Als Pionier und Branchenleader entwickelt und produziert Lindner seit nun bereits über 70 Jahren innovative und effiziente Maschinen und Anlagen für die Recyclingindustrie.
„Lindner ist der Spezialist für Zerkleinerungsmaschinen und Systeme für die Abfallwirtschaft. Unsere Maschinen bereiten unterschiedliche Abfallströme so auf, dass aus diesen wiederwertbare Rohstoffe entstehen.“
Manuel Lindner, Geschäftsführer der Lindner-Recyclingtech GmbH
Des einen Müll, ist des andren Gold Richtiges Recycling ist nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch des richtigen Equipments. Lindner entwickelt und produziert auf insgesamt 14.000 m2 mit modernsten Fertigungsanlagen und neuester Robotik und Automatisierungstechnik, innovative Maschinen und Anlagen für die Recyclingindustrie.
Raiffeisen – nah an der Kärntner Wirtschaft
Raiffeisen begleitet den Erfolgsweg der Lindner Recyclingtech bereits seit vielen Jahren und steht als verlässlicher Part
ner hinter dem technologieführenden Hersteller von Recyclinganlagen.
„Raiffeisen ist für uns viel mehr als bloßer Geldgeber – nämlich ein loyaler und beständiger Partner.“
Michael Lackner, Geschäftsführer der Lindner-Recyclingtech GmbH
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Wertesystems von Raiffeisen. Wir glauben an das Geschäftsmodell von Lindner und sind beeindruckt von der Innovationskraft und Leidenschaft, mit der das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur globalen Abfallwirtschaft leistet.
„Was uns in unserer Geschäftsbeziehung verbindet, ist nicht nur die regionale Verwurzelung, sondern auch der Blick über die Grenzen. Wir vereinen die Vorteile einer regionalen Bank mit den Leistungen eines internationalen Bankinstituts und begleiten Unternehmen auch ins Ausland.“
RLB-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer
Mehr zu den Erfolgswegen, die Raiffeisen seit Jahren begleitet, erfahren Sie unter www.erfolgswege.at |

Digitale Balance finden und den Menschen ernst nehmen
Eine wesentliche Säule des Wertewandels ist die Digitalisierung. Neben der Nachhaltigkeit wirkt sie als zentraler Innovationstreiber im 21. Jahrhundert. Als Herausgeber des advantage Magazins ist es mir ein Anliegen, diese Entwicklungen sichtbar zu machen.
Die innere Haltung kann uns niemand nehmen. Klimaschutz und Biodiversität sind Themen, die nicht spurlos an uns vorüber gehen dürfen! Auch zahlreiche Unternehmen beschäftigen sich damit und nehmen ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Natur ernst. Bleiben wir kritisch und übernehmen
Eigenverantwortung.
Wenn wir für uns und unsere Kinder Gutes tun wollen, dann sind wir gut beraten mit der Familie und Freunden Zeit zu verbringen, Sport zu treiben oder bei einem Spaziergang bewusst die Natur zu genießen. Wer das Handy dabei zuhause lassen kann, ist auf einem guten Weg zur „digitalen Balance“!
Ihr Walter Rumpler

Emotionale Intelligenz als wahrer Game Changer?
Künstliche Intelligenz hat sich in Wirtschaft und Leben gewebt und ist längst mehr als nur ein Trend. Es gilt dem Neuen offen zu begegnen, denn KIbasierte Tools bringen innovative Ansätze in den unterschiedlichsten Bereichen hervor und schaffen damit auch Mehrwert in Unternehmen. Gleichermaßen wichtig ist es „dem Echten“ Raum zu geben. Jetzt ist emotionale Intelligenz gefragt, denn das „HERZliche“ darf nicht auf der Strecke bleiben. Die Begegnung, der persönliche Austausch, die zwischenmenschliche Erfahrung – hier stößt jede Technologie irgendwann an ihre Grenzen. Verlieren wir also nicht den Mut, das Wunderbare im Unscheinbaren zu erkennen, denn es braucht im Leben nicht viel um glücklich zu sein.
Dieses Vorwort sowie die nachfolgenden Texte der advantage Redaktion sind übrigens ChatGPT frei – genährt aus der persönlichen, unmittelbaren menschlichen Erfahrung.
Viel Freude beim Lesen!
Herzlichst, Petra Plimon
Advantage Wirtschaftsmagazin advantage Wirtschaftsmagazin advantage.magazin www.advantage.at
PEFC/06-39-364/11
PEFC-zertifiziert DiesesProdukt stammtaus nachhaltig bewirtschafteten Wäldernund kontrolliertenQuellen www.pefc.at

COVER: © GettyImages. Grafik: Werk1
OFFENLEGUNG nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24 , 25 Mediengesetz. IMPRESSUM: Gründung 1997. Herausgeber: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Verlag & Medieninhaber: advantage Media GmbH. Geschäftsführer: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Chefredaktion: Petra Plimon, petra@plimon.at. Redaktion: Beatrice Torker, Monika Unegg. Fotos: advantage, pixelio.de, pixabay.com, unsplash.com bzw. beigestellt lt. FN. Büroanschrift: advantage Media GmbH, Villacher Ring 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, T: +43 (0)650 7303400. Die Meinungen von Gastkommentatoren müssen sich nicht mit der Meinung der advantage-Redaktion decken. Alle Rechte, auch Übernahme von Beiträgen gem. §44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. AGB/Haftungsausschluss/rechtlicher Hinweis: www.advantage.at

4 Gekommen, um zu bleiben! Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz transformiert nahezu alle Branchen.
18 Zwischen digital und persönlich
Die digitale Amtsstube ist längst Realität und entwickelt sich weiter.
22 Kooperation auf Augenhöhe Die beiden Technologiereferentinnen Gaby Schaunig und Barbara EibingerMiedl im Zukunftsgespräch.
34 Neues Cyber Security-Gesetz
Die Umsetzung der NIS2Richtlinie bringt komplexe Herausforderungen mit sich.
54 ChatGPT im Bildungswesen KIbasierte Tools markieren einen Paradigmenwechsel in Schulen und Universitäten.
60 Klimawandel und Windkraft Künstliche Intelligenz unterstützt dabei künftige WindkraftStandorte gut zu wählen.
64 Mehr Sicherheit im OP-Saal
Die Digitalisierung von Prozessabläufen im Gesundheitswesen birgt großes Potenzial.
70 Einfach mal abschalten
Digitale Pausen in der Natur steigern unser Wohlbefinden und die Lebensqualität.



Ob Startup, Bank oder Holzbranche –KI ist längst in der Wirtschaft angekommen.
Von Petra Plimon




In der aktuellen advantage Ausgabe beleuchten wir den Megatrend Digitalisierung und haben Persönlichkeiten im Wirtschaftsraum Südösterreich die Frage gestellt: Welchen Einfluss hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auf das Unternehmen bzw. die Branche, wo Sie tätig sind?





Christian Tippelreither, Geschäftsführer Holzcluster Steiermark
„In der Holzbranche wird tatsächlich mehr KI eingesetzt, als man vermuten würde. Als Holzcluster Steiermark erkennen wir eine klare Steigerung bei der Nachfrage von KIgestützten Lösungen, etwa um die Qualität von Holzprodukten zu verbessern und die Produktion zu optimieren. Zurzeit begleiten wir Projekte in der Forstwirtschaft, um durch autonome Transport und Erntesysteme die Kosten zu senken und nachhaltiger agieren zu können. Eine EchtzeitDatenanalyse bei der Weiterverarbeitung liefert Informationen über die Qualität des Holzes, um Ausschuss zu minimieren und die Rentabilität zu steigern. Durch die Implementierung der Routenoptimierung werden Transportrouten des Holzes optimiert. Kurz gesagt: KI transformiert auch die Holzbranche und wir als steirischer Holzcluster unterstützen Unternehmen und entwickeln Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ © Holzcluster Steiermark

Delphine Rotheneder, Social Media-Expertin bei „rothi.media“
„Bei rothi.media nutzen wir KITools aktuell für Strategien, Analysen und in der Contenterstellung. Unsere Praxiserfahrung zeigt: KITools wie ChatGPT ersetzen kreative Köpfe nicht – sie unterstützen und fördern sie. Das Ergebnis: Mehr Effizienz und Erfolg. Vielen Unternehmern macht die Entwicklung von KI Angst, sie fühlen sich unter Druck gesetzt und testen die Tools daher gar nicht selbst. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig und die wollen wir als Pioniere auf diesem Gebiet vorantreiben. Daher bieten wir KIVorträge und Workshops für Firmen an. Zusätzlich haben wir mit der rothi. member Academy ein OnlineProgramm für Unternehmer ins Leben gerufen, bei dem wir sie Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit und Selbstverständnis im Umgang mit den sozialen Medien und KITools bringen.“
© rothi.media

Horst Bischof, Rektor der TU Graz
„Artificial Intelligence (AI), im Deutschen oft fälschlicherweise als KI übersetzt, spielt an der TU Graz seit vielen Jahren eine große Rolle. Allen voran in der Forschung, wo wir mit dem interdisziplinären Forschungsnetzwerk Graz Center for Machine Learning (GRAML) die vorhandene Expertise bündeln und die neuesten Ergebnisse der Grundlagenforschung in allen Fakultäten zur Anwendung bringen wollen. Der Forschungsprozess kann dadurch erheblich beschleunigt werden. In der Lehre bieten AI Systeme ganz neue Möglichkeiten der individuellen Unterstützung von Studierenden (Stichwort: Learning Analytics). Aber auch in der Verwaltung beginnen wir, AISysteme zur Optimierung von administrativen Prozessen einzusetzen (TU Graz GPT). Wir sehen viele neue spannende Möglichkeiten, wenn AISysteme als Unterstützung für den Menschen eingesetzt werden.“ © TU Graz/Lunghammer

Anita Kloss-Brandstätter, Professorin an der FH Kärnten
„Die Künstliche Intelligenz (KI) ist ein essentieller Bestandteil meines Alltags als Mathematikprofessorin an der Fachhochschule Kärnten. In den Studiengängen Applied Data Science und Health Care & IT vermitteln wir Algorithmen des maschinellen Lernens. Im Rahmen des AICIForums (Artificial Intelligence in Clinical Imaging) widmen wir uns zudem der KIin der radiologischen Diagnostik. KIgestützte Algorithmen analysieren medizinische Bilder schneller und präziser und erhöhen dadurch die Diagnosegenauigkeit. Das Forum fördert den Austausch von Erkenntnissen, um KITechnologien in der klinischen Praxis zu integrieren. Zusätzlich organisieren wir die jährliche Konferenz ,Women in Data Science (WIDS) in Villach, welche Wissen und Vernetzung im KIBereich fördert und die Präsenz von Frauen in der Datenwissenschaftsgemeinschaft stärkt.“
© J. Dulnigg/ FH
Kärnten









Marc Gfrerer, Geschäftsführer Logmedia GmbH & Berufsgruppensprecher IT der Fachgruppe UBIT
Bernhard Weber, Geschäftsführer
Unicorn Startup & Innovation Hub
„Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Ein markanter Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung war die Veröffentlichung von Chat GPT. In meiner Arbeitswelt hat KI einen festen Platz eingenommen, auch als praktisches Tool im täglichen Einsatz. KI ist vom Buzzword in Pitchdecks zum zentralen Motor der digitalen Geschäftsmodelle geworden. Im Unicorn in Graz sitzen Startups, die Energiesensordaten in Gebäuden mittels KI nutzbar machen oder Anwendungsgebiete von Enzymen erforschen. Sie stehen jedoch auch vor großen Herausforderungen, nicht nur durch Giganten wie Microsoft und Co., sondern auch durch Kosten für Rechnerleistungen, Daten und Training der Algorithmen. KIExpertise ist ein Engpass und für Startups nicht immer bezahlbar. Das umfasst für mich übrigens neben technischem Knowhow auch den Umgang damit in rechtlichen und ethischen Fragen.“
„Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird aus meiner Sicht nicht nur viele Geschäftsprozesse, sondern nahezu alle Branchen radikal verändern. In meiner Branche beginnt das beim Thema Kundensupport, Wissenstransfer und geht hin bis zur automatisierten Erstellung von Präsentationen und Grafiken.
Klug ist der, der weiß, wo er findet was er nicht weiß! Und KI ,weiß‘ mittlerweile recht viel. Daher rate ich allen Unternehmen sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Jeder Betrieb kann davon profitieren, wenn er es annimmt. KI ist keine Modeerscheinung. Man kann vieles optimieren.“ © WKK/UBIT

Gabriele Semmelrock-Werzer, Vorständin Kärntner Sparkasse AG
„In der Kärntner Sparkasse arbeiten wir bereits seit einigen Jahren mit ,Machine learning tools‘, um einfach Arbeitsschritte automatisiert zu erledigen. KI ist für uns die natürliche Weiterentwicklung, in der wir große Chancen sehen. Wesentlich für die Kärntner Sparkasse ist allerdings, dass unsere Kundendaten streng geschützt bleiben und nicht an Dritte weitergeben werden können. Derzeit experimentieren unsere Expert:innen in speziellen abgeschlossenen Systemen intensiv mit KI und prüfen die Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen. Die Kärntner Sparkasse ist das älteste und gleichzeitig modernste Finanzinstitut Kärntens.
In unserer fast 190jährigen Geschichte hat sich das Bankwesen massiv verändert und wir werden uns auch künftig für unsere Kund:innen weiterentwickeln.“ © D. Waschnig

Michael Katzlberger, KI-Experte aus der Kreativindustrie und Geschäftsführer Katzlberger Consulting GmbH
„Der verstärkte Einsatz von KI hat unser Unternehmen in ein aufregendes Kreativlabor verwandelt. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es uns, datengetriebene Einblicke in Echtzeit zu gewinnen und revolutioniert unsere Entscheidungsfindung (früher: Bauchgefühl). KI fungiert dabei wie ein zusätzlicher Mitarbeiter, der datengetriebene Erkenntnisse in –teils ausgesprochen kreative – Meisterwerke (Text, Bild, Video und Musik) verwandelt. Zudem steigern wir die Effizienz und Produktivität durch automatisierte Prozesse bei 3LIOT.ai erheblich. Die Synergie von Mensch und Maschine treibt unsere Wettbewerbsfähigkeit an und ebnet den Weg für zukünftiges Wachstum in einer KIgetriebenen Welt. Intelligente Chatbots werden dabei zu virtuellen Geschichtenerzählern und persönlichen Kuratoren. Wir sehen KI nicht als Werkzeug, sondern als kreativen Partner, mit dem wir Seite an Seite die Zukunft gestalten. Schon bald wird KI das Rückgrat eines jeden Teams sein, egal in welcher Industrie oder Branche man sich bewegt.“ © Wolfgang POHN
Bildgeneratoren, die mittels künstlicher Intelligenz Bilder aus Text erzeugen, sind im Vormarsch und zaubern innovative Grafiken wie diese. © Katzlberger

mit Dieter Jandl, Geschäftsführer addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG
addIT-Geschäftsführer Dieter Jandl spricht über die Erfolgsgeschichte von Kärntens führenden IT-Dienstleister.

advantage: addIT wurde erneut als attraktiver Arbeitgeber prämiert. Wodurch zeichnet sich das Unternehmen aus?
Dieter Jandl: Als führender ITDienstleister in Kärnten zeichnen wir uns durch spezialisierte Beratungsleistungen und Lösungen zur Optimierung von ITProzessen aus und sind besonders stolz auf unser gut ausgebildetes und motiviertes addITTeam von Expert:innen. Mit über 20 Jahren Erfahrung haben wir eine starke Präsenz in Kärnten aufgebaut und wurden bereits zwölf Mal in Folge von „Great Place to Work® als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet. Unsere Erfolge lassen sich auf unsere Unternehmenskultur zurückführen, die Innovation fördert und gleichzeitig ein unterstützendes Umfeld für die Mitarbeiter:innen schafft. In diesem Zusammenhang freut es uns, dass addIT 2023 vom Market Institut als führendes Unternehmen in den Bereichen Arbeitszeitmodell, Betriebsklima und Innovation ausgezeichnet wurde. Weiters haben wir als addIT globale Reichweite über unseren Mutterkonzern Atos, was uns ermöglicht, flexibel zu sein und optimale TimetoMarketLösungen anzubieten.
Wie verändert KI Ihr Unternehmen und wie unterstützt addIT seine Kunden in dieser Entwicklung? KI ist kein neues Thema. Der Begriff entstand bereits 1956 bei einer Konferenz am


Dartmouth College im USBundesstaat New Hampshire. Neu ist die unglaubliche Dynamik, mit der sich KIbasierte Lösungen weiterentwickeln und die damit einhergehende Veränderung von Gesellschaft und globaler Arbeitswelt.
Als addIT haben wir drei KISchwerpunktthemen. Wir setzen, wie auch die Präsentationen bei der addSUCCESS gezeigt haben, auf Partnerschaften mit international führenden Herstellern wie CISCO, Checkpoint oder TrendMicro. Zusätzlich haben wir in den letzten Monaten unser Partnernetz mit Kärntner KIExperten und mit Startups, die sich mit KI beschäftigen, gezielt ausgebaut. Drittens investieren wir in die KIAus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen.
Im Mittelpunkt dieser drei Aktivitäten stehen unsere Kunden, die wir auf ihrem Weg in KIbasierte Lösungen unterstützen.
Was sind derzeit die größten Herausforderungen als IT-Unternehmen und wie werden diese bewältigt? Als ITUnternehmen sehen wir grundsätzlich die hohe Inflation und die damit verbundene unsichere Wirtschaftslage als Herausforderung für unsere Kunden und uns selbst an. Gerade deshalb freut es uns, dass unsere Kunden bei den addIT DienstleistungsKernthemen Netzwerk Consulting, Cloud und RechenzentrumLeistungen, digitaler Arbeitsplatz und
„Unsere Erfolge lassen sich auf unsere Unternehmenskultur zurückführen, die Innovation fördert und gleichzeitig ein unterstützendes Umfeld für die Mitarbeiter:innen schafft.“
Dieter Jandl, addIT-Geschäftsführer
Technologie Services wie Beratung zu KI und Cyber Security, verstärkt auf unsere lokale Kompetenz setzen.
Als Arbeitgeber beschäftigt uns nach wie vor der Fachkräftemangel. Wir erwarten im Jahr 2024 keine wesentliche Verbesserung zu der Herausforderung qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. Diesbezüglich setzen wir daher auf unser flexibles Arbeitsmodell bzw. auf Ausbildung der Mitarbeiter:innen und sehen, dass diese Maßnahmen auf sehr positive Resonanz stoßen.
Welche Pläne hat addIT für die Zukunft?
Wir setzen auch in Zukunft auf die Punkte, die uns erfolgreich gemacht haben. Als Kärntens größter ITDienstleister wollen wir weiterhin ein verlässlicher Arbeitgeber und mehrwertbringender Partner für die Kärntner Unternehmer sein und freuen uns auf die neuen Möglichkeiten des Wirtschaftsraums Südösterreich. |


ROMAN PRINZ,
Country
Manager
Österreich, Check

Point Software Technologies
Erstklassige Sicherheit
mit der Kraft der KI
KI-Technologien scheinen das neue Lieblingswerkzeug der Cyberkriminellen zu werden.
Zumindest zeigen sie erhebliches Interesse und stürzen sich auf diesen Trend, um bösartigen Code zu generieren. Aber die Cybersicherheitsbranche schläft nicht und profitiert ihrerseits.
Kürzlich führten unsere Sicherheitsforscher von Check Point Research ein Experiment durch und erstellten mit KITools eine vollständige Infektionskette – ohne selbst eine einzige Zeile Code zu schreiben. Sie nutzten ChatGPT, um eine nahezu perfekte PhishingEMail zu erstellen. Als Nächstes verwendeten sie ebenfalls ChatGPT, um einen VBACode –auch bekannt als ExcelMakro – zu schreiben, der eine ausführbare Datei von einem Server im Internet herunterlädt und ausführt. Sie verwendeten sogar KI, um diesen Code zu verschleiern, damit er von Antivirensoftware weniger leicht entdeckt werden kann. Kein Wunder also, dass Kriminelle KI lieben.
Und doch: Die Cybersicherheitsbranche profitiert noch viel mehr von diesen KITechnologien – und wir tun das auch. Wir haben bereits vor Jahren beschlossen, bei unserer Arbeit zum Schutz unserer Kunden auf KI zu setzen. KI ist ein mächtiges Werkzeug, wir nutzen es etwa in unserer ThreatCloud, um CyberAngriffe in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren. Durch die kontinuierliche Erforschung von Bedrohungen sowie der riesigen Datenmengen, mit denen wir täglich konfrontiert werden – Daten, die aus Millionen von Datenquellen stammen – SicherheitsGateways, Endpunkt und mobilen Agenten, CloudWorkloads und mehr, und durch die Nutzung der KIExpertise, die wir in einem Team aus KI und Datenexperten aufgebaut haben, sind wir in einer einzigartigen Position, um mit der Kraft der KI erstklassige Sicherheit zu bieten. |






ELMAR LICHTENEGGER, Head of Operations


addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG
Künstliche Intelligenz wird immer wieder als „Gamechanger“ eingeordnet. Ist das so?
Die meisten Personen assoziieren mit dem Begriff KI Anwendungen wie ChatGPT oder den gut gelaunten Roboter, der den Menschen die Arbeit streitig macht. Genauer betrachtet werden zwei grundlegende Arten von KI unterschieden.
Starke KI (Artificial General Intelligence – AGI), eine Form von KI, die selbständig schlussfolgern, Wissen auf andere Bereiche übertragen und ihr Umfeld „bewusst“ wahrnehmen und interpretieren kann. Ein Roboter würde beispielsweise in der Lage sein, in Situationen zu handeln, mit denen er noch nie konfrontiert wurde. Starke KI sollte damit ähnliche Fähigkeiten wie ein menschliches Gehirn haben. AGI in der Form gibt es noch nicht.
Schwache KI (Narrow AI) bezieht sich auf Systeme, die so programmiert sind, dass sie eine Vielzahl von Problemen innerhalb eines vordefinierten Funktionsbereiches lösen können. Sie braucht menschliche Unterstützung. Typische Anwendungen sind zum Beispiel die Erkennung von Gesichtern in Bildern, Übersetzungssoftware oder Alexa und Siri. Fakt ist, dass die aktuell verfügbaren Algorithmen das Potential haben, viele Bereiche unseres menschlichen Lebens zu revolutionieren. Autonome Systeme wie selbstfahrende Autos, medizinische Diagnosen, kreative Werkzeuge oder KI im Kundenservice sind heute schon vielfach eingesetzte Technologien. Im unternehmerischen Kontext ist aber eindeutig die Produktivitäts und Effizienzsteigerung durch KI das primäre Einsatzgebiet.
Neue Chiptechnologien werden einen explosionsartigen Anstieg dieser spezialisierten KI ermöglichen. Die Antwort ist eindeutig ja – KI ist ein absoluter Gamechanger. Der Roboter mit menschlicher Intelligenz bleibt noch ein Traum. |








KI ist die Antwort –Was war die Frage?
UDO SCHNEIDER,



Security Evangelist

Europe bei Trend Micro



Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Dennoch sollten wir uns eine Auszeit vom Hype gönnen.
KI gibt es schon seit Jahren. Dennoch wird die Technologie noch immer kaum verstanden – was zum Teil am Hype der Anbieter liegt. Deshalb ist KI aktuell häufig die Antwort auf alles, auch wenn die Frage noch gar nicht klar definiert ist. Im Kern ist KI aber auch „nur“ ein Algorithmus, der aus vorhandenen Eingaben wie Trainingsdaten und Kontext einen Output erzeugt. Die Modelle sind daher nur so gut wie die Daten, auf deren Grundlage sie trainiert werden. Gerade generative KI ist dank großer Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT in aller Munde. Ihre Fähigkeit in natürlicher Sprache zu interagieren, ist bemerkenswert. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Ausgabe per se kein Original ist, sondern ein fortschrittlicher „Remix“ aus dem Input. Solche Modelle eignen sich am besten zum Zusammenfassen und Präsentieren von Informationen und Fakten in natürlicher Sprache. Die Herausforderung für den Menschen besteht dabei darin, die hohe Qualität der Sprache nicht automatisch mit der Qualität des Inhalts gleichzusetzen.
Natürlich investieren auch Cyberkriminelle in generative KI, beispielsweise um fehlerfreie Inhalte für PhishingKampagnen zu bekommen. Gleichzeitig ist sie aber keine Wunderwaffe! Sie kann noch keine einzigartige Malware oder Exploits generieren und ist nur für Bedrohungsakteure nützlich, die wissen, welche Art von Code sie anfordern müssen. Die gute Nachricht ist, dass KITools weniger mächtig sind, als mancher MarketingHype vermuten lässt – auf Seite der Verteidiger wie auch der Angreifer. Wir sollten deshalb einmal tief durchatmen und die Technologie zunächst verstehen, bevor wir dem Hype verfallen. |






HANS GREINER, General Manager


Cisco in Österreich, Kroatien und Slowenien




Herausforderungen und Lösungen im Zeitalter der KI
Im Zeitalter künstlicher Intelligenz spielt die Cybersicherheit eine immer wichtigere Rolle.
Während die Vorteile von KI unbestreitbar sind, stehen Unternehmen vor immer komplexeren Herausforderungen im Bereich Cybersecurity. Die fortschreitende Implementierung von KI in Unternehmen bringt neue Sicherheitsrisiken mit sich. Ein Hauptproblem besteht darin, dass KIAlgorithmen anfällig für Angriffe und Manipulationen sein können. Dies kann zu schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen führen, bei denen vertrauliche Daten gestohlen oder geschäftskritische Systeme sabotiert werden können. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass KISysteme oft große Mengen an Daten sammeln und analysieren. Die Datenschutzbestimmungen und vorschriften müssen sorgfältig beachtet werden, um sicherzustellen, dass persönliche und geschäftliche Informationen nicht in falsche Hände gelangen.
Die Komplexität und Vielfalt der Bedrohungslandschaft erfordert von Unternehmen eine proaktive Herangehensweise an die Sicherheit. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, schnell auf neue Bedrohungen zu reagieren und Angriffe zu erkennen, bevor Schaden angerichtet wird. Die Fähigkeit, Angriffe zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren, erfordert jedoch umfangreiche Ressourcen und Fachwissen.
Durch die Integration von KITechnologien in ihre Sicherheitsprodukte bietet Cisco Unternehmen eine effektive Möglichkeit, sich gegen Cyberangriffe zu schützen. Durch die Kombination von maschinellem Lernen und menschlicher Expertise kann Cisco Unternehmen dabei unterstützen, Angriffe frühzeitig zu erkennen und effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. |





























MARKUS HRIBAR, KI und Security Experte bei addIT











Die digitale Transformation hat die Geschäftswelt verändert. Mit künstlicher Intelligenz und wachsenden Online-Aktivitäten sind Cybersicherheitsbedrohungen zur noch größeren Herausforderung geworden.
Die Bedrohungslandschaft hat sich gewandelt. Von Phishing bis Ransomware sind Cyberkriminelle durch den Einsatz von KI fortschrittlicher geworden. KI ermöglicht aber auch Unternehmen, Daten in Echtzeit zu analysieren und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Machine Learning und KIAlgorithmen erkennen Angriffsmuster vor der Klassifizierung.
Kärntens größte IT-Fachveranstaltung lockte über 100 Gäste aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung in das kärnten.museum und war ein voller Erfolg.
Unter dem Motto „Neue Zeitenrechnung“ lud addIT am 12. Oktober gemeinsam mit seinen internationalen Partnern CISCO, CheckPoint und TrendMicro in das neu eröffnete kärnten.museum“. Im Fokus standen die rasanten Entwicklungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie deren Einfluss in punkto Cybersicherheit. „KI ist eine Technologie, die tiefgreifende Veränderungen quer durch alle Branchen und Unternehmen mit sich bringt. Diese Dynamik ist vergleichbar mit der Industriellen Revolution“, betont Dieter Jandl, Geschäftsführer der addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG, der sich sichtlich über das rege Interesse der Besucher:innen freute.





Daher sollten Unternehmen in KIgestützte Cybersicherheitslösungen investieren. Intrusion Detection Systems, Firewalls und EndpointSicherheitstools, die auf KI basieren, bieten kontinuierliche Überwachung und ermöglichen es schneller auf Angriffe zu reagieren. Unternehmen dürfen sich aber nicht nur auf KITools verlassen. Es ist weiterhin wichtig, dass die Mitarbeiter im Sicherheitsbewusstsein geschult werden, um Social EngineeringAngriffe zu minimieren. Cybersicherheit kann als Wettbewerbsvorteil dienen. Ein sicherer Ruf stärkt das Vertrauen der Stakeholder.
Zukunft verstehen Neben spannenden Fachvorträgen gab es auch eine traditionelle Podiumsdiskussion, bei der sich Eva Eggeling, Hugo Auernig, Christian Inzko, Roderik Michiels van Kessenich und Roland Obtresal unter der Moderation von Ute Pichler über die praktische Umsetzung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft austauschten. Mit Sascha Lobo war ein prominenter Digitalisierungs und KIExperte am Wort, der eine inspirierende Keynote rund um die Frage „Müssen wir Angst vor KI haben?“ hielt und einen interessanten und unterhaltsamen Bogen über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken von KI spannte. |






Insgesamt zeigt sich, dass sich die Cybersicherheitslandschaft weiterentwickelt. Die Kombination von KITechnologien, aufgeklärten Mitarbeitern und proaktiver Sicherheit kann dazu beitragen, die Gefahren im Internet erfolgreich zu bewältigen. Cybersicherheit ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und abzusichern. Wir als addIT unterstützen gerne dabei.
Verpflichtung, Wir




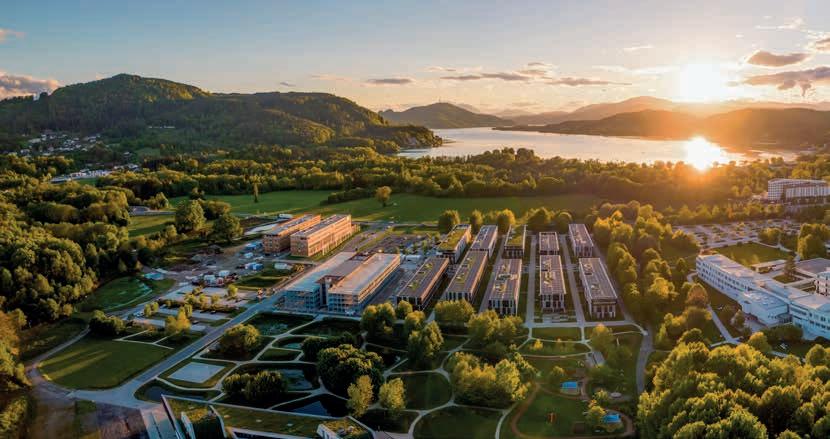
„Gemeinsam inspirieren, gemeinsam innovieren“
Mit dem Zukunftsformat „CARINTHIA innovates...“ schlägt die BABEG am 28. November eine Brücke zwischen Wirtschaft und Forschung in Kärnten.
Kärnten durchläuft derzeit eine bedeutende Transformation in den Bereichen Betriebsansiedlung und Forschung, Technologie und Innovation (FTI). Diese Entwicklung wird unter anderem von der BABEG (Kärntner Betriebsansiedlungs und Beteiligungsgesellschaft mbH.) maßgeblich vorangetrieben.
Für eine nachhaltige Zukunft
Die BABEG übernimmt eine wesentliche Rolle in der Weiterentwicklung von Wirtschaft und Forschung in der Region. „Wir streben danach, Kärnten als einen begehrten Wirtschaftsstandort zu positionieren, der Unternehmen durch vielfältige Anreize und Unterstützungsmöglichkeiten anzieht. Dabei fungieren wir als treibende Kraft in punkto Betriebsansiedlungen und dem
„Erleben Sie den Wandel und die Vision von Kärnten bei ‚CARINTHIA innovates… – einem Ereignis, das den Weg zu einer blühenden Zukunft für Wirtschaft und Forschung ebnen soll.“
Thereza Christina Grollitsch, Leitung internationales Investorenservice bei BABEG
Management von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) in Kärnten“, erklärt Markus Hornböck, Geschäftsführer der BABEG. Ziel ist es Kärnten als bedeutenden Forschungs und Innovationshub im Herzen des Wirtschaftsraums Südösterreich zu etablieren.
„CARINTHIA innovates...“
Um den Forschungs und Wirtschaftsstandort Kärnten gezielt ins Licht zu rücken, hat die BABEG ein neues Format ins Leben gerufen. „CARINTHIA innovates...“ wird erstmalig am 28. November 2023 im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt über die Bühne gehen und soll zukünftig als Leitevent und Plattform fungieren, um Akteur:innen aus unterschiedlichen Bereichen der Kärntner Wirtschaft und Forschung zusammenzuführen.
Am



Twin Transition im Fokus
Leitthema der Veranstaltungspremiere ist die Twin Transition. Der Begriff umfasst die gleichzeitige Bewältigung von digitalen und nachhaltigen Herausforderungen, wie der Kreislaufwirtschaft – einem Thema von zentraler Bedeutung, auch für Kärnten. „In den Diskussionen und Präsentationen während der Veranstaltung werden Robotik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Ein hochkarätiger PanelTalk mit Vertreter:innen des Landes Kärnten, kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Großunternehmen, Startups, der Fachhochschule Kärnten sowie der Universität Klagenfurt, bietet zudem eine breite Perspektive auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in diesen Schlüsselbereichen“, so Hornböck.
Gemeinsam vernetzen
In enger Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Lakeside Labs, Wood K Plus, KI4LIFE, JOANNEUM RESEARCH und Silicon Austria Labs wird auch ein World Cafe stattfinden. Das Format bietet den Teilnehmer:innen eine einzigartige Gelegenheit, um bewährte Praktiken und innova

„Wir streben danach, Kärnten als einen begehrten Wirtschaftsstandort zu positionieren, der Unternehmen durch vielfältige Anreize und Unterstützungsmöglichkeiten anzieht.“
Markus Hornböck, BABEG-Geschäftsführer
tive Ansätze im Bereich Forschung und Technologie zu diskutieren. Ziel ist es, von den Erkenntnissen und Erfahrungen der Forschungseinrichtungen zu profitieren, um eigene Projekte voranzutreiben oder sogar neue Kooperationsprojekte zu initiieren. Bei „CARINTHIA innovates...“ gibt es für Interessierte zudem direkt vor Ort die Möglichkeit, persönliche Beratungstermine mit den Kooperationspartnern zu vereinbaren, um gezielt Unterstützung und Ressourcen für Projekte und Ideen zu generieren und damit Kärntens Position als Innovationsland weiter zu stärken.
Erfolgreich kooperieren ,CARINTHIA innovates...‘ versteht sich somit nicht nur als Event, sondern vor allem als Wegweiser für Kärnten auf dem Weg zur Spitze in den Bereichen Forschung, Innovation und Entwicklung. „Erleben Sie den Wandel und die Vision von Kärnten bei ‚CARINTHIA innovates... – einem Ereignis, das den Weg zu einer blühenden Zukunft für Wirtschaft und Forschung ebnen soll. Seien Sie Teil dieser spannenden Reise, wenn es heißt ,Gemeinsam inspirieren, gemeinsam
innovieren‘“, betont Thereza Christina Grollitsch, Leitung internationales Investorenservice bei BABEG. Mit Initiativen wie diesen setzt sich die BABEG auch weiterhin leidenschaftlich dafür ein, die Betriebsansiedlung und das FTIManagement in Kärnten voranzuteiben und die Region zu einem aufstrebenden Zentrum für Innovation und Wachstum weiterzuentwickeln. |
BABEG Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Völkermarkter Ring 21–23
9020 Klagenfurt am Wörthersee event@babeg.at content.babeg.at/carinthia-innovates Anmeldungen hier


Das build! Gründerzentrum vergab erstmals eine Zusatzförderung an drei herausragende Kärntner AplusB Startups.
NeedNect Solutions GmbH, Solution Zero OG und trastic GmbH zählen zu jenen drei Kärntner AplusB Startups, die aufgrund besonderer Leistungen im letzten Jahr vom build! Gründerzentrum im Rahmen des „AplusB South West Projekts“ der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) mit je 10.000 Euro Fördergeld zusätzlich belohnt wurden. Mit dieser Initiative soll die Weiterentwicklung herausragender Geschäftsideen und innovativer Projekte – in den relevanten Zukunftsthemen „Klima & Umweltschutz“ und „Female Empowerment“ – noch stärker vorangetrieben werden.
Nachhaltigkeit im Tourismus
Gewinner in der Kategorie „Female und Green“ ist NeedNect Solutions. Das Kärntner Startup wurde von Ines Ganner, Fabio Wilhelmer und Raphael Duhs gegründet. NeedNect hat eine digitale Plattform für das individuelle Reiseerlebnis entwickelt, um Hotels und Gäste miteinander zu verknüpfen. So erhalten Hotels unter anderem aggregierte Gästedaten, können sich im Sinne der Nachhaltigkeit besser und individueller auf die ankommenden Gäste und ihre Wünsche vorbereiten und erhalten Planungssicherheit in allen Abtei
„Für Startups und Jungunternehmen gehören Förderungen – vor allem in der Frühphase –zu den wichtigsten Finanzierungsmitteln, um ihre Business-Idee erfolgreich umzusetzen und das Unternehmen auf ein stabiles Fundament zu stellen.“
Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum!
lungen. Damit wurde NeedNect Solutions im Dezember 2022 zum Travel Startup 2022 gekürt. Das Jungunternehmen hilft auch bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen mit Demand Management durch Vorhersagen zur nachhaltigen Nutzung von Gästedaten. Im Februar 2022 wurde das Startup vom Bundesministerium für Digitalisierung als Finalist der ‚Teller statt Tonne‘ Challenge ausgezeichnet. Derzeit arbeitet man an der Erschließung neuer Märkte. Bis dato hat sich NeedNect bereits in Österreich und Slowenien einen soliden

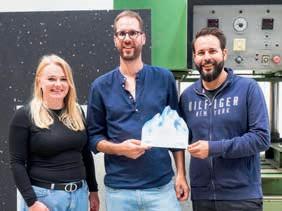
Kundenstock aufgebaut. „Wir möchten als nächsten Schritt den arabischen Markt für unser Produkt sensibilisieren. Das Preisgeld soll daher als Unterstützung für den geplanten Markteintritt dienen“, erklärt CEO und Gründerin Ines Ganner.
Klimaneutrales Bauen von morgen
Ein weiterer Gewinner in der Kategorie „Green“ ist das Kärntner Startup Solution Zero, das 2023 von den beiden jungen Architekten Julien Presland und Joseph Gansger gegründet wurde. Mit ihren Lösungen möchten sie das Bauen und Wohnen auf natürliche und nachhaltige Weise verbessern und dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Eine vielversprechende Produktentwicklung von Solution Zero stellt der „ZebraZiegel“ dar. Er ist der einzige Dachziegel am Markt, der in der Lage ist, die Sommersonne gezielt in das All zurück zu reflektieren und die Wintersonne zu absorbieren. Die eigentliche Innovation besteht aber darin, dass der Ziegel im Sommer kühlt und im Winter die Wärme absorbiert, um ein Auskühlen der Gebäude zu verhindern. Damit hilft er in der kalten Jahreszeit, Heizenergie zu sparen. Mit dem Preisgeld will das Startup den Prototyp gemeinsam mit Kooperationspartner:innen in einem Realversuch über ein Jahr hinweg testen. „Wir wollen mit dem ,ZebraZiegel‘ ein reales Dach mit einem in Klagenfurt ansässigem Dachbedeckungsunternehmen bauen. So können wir neben der HightechFunktionalität auch den Beweis für einen leistbaren und flächendeckenden Einsatz antreten. Immerhin machen alle Hausdächer
„Wir freuen uns sehr mit den drei Kärntner Startups und sind überzeugt davon, dass alle drei mit ihren innovativen BusinessIdeen und ihrem persönlichen Einsatz auf dem Weg sind, erfolgreiche Unternehmen in Österreich aufzubauen.“
Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum!
in Wien etwa ein Achtel des gesamten Stadtgebiets aus. Eine innovative Lösung, um das Leben in den europäischen Metropolen trotz des Klimawandels erträglicher zu machen und dabei noch große Mengen an CO2 zu sparen“, betont CoGründer Julien Presland.
Möbel aus recyceltem Kunststoff Last but not least ist auch das innovative Kärntner Startup trastic GmbH ein verdienter Gewinner in der Kategorie „Green“. Das von Arnold Trinkl und Wolfgang Rauter Anfang 2020 gegründete Unternehmen hat ein neuartiges Verfahren zur Herstellung von Möbelplatten aus recyceltem Kunststoff entwickelt, um daraus Designmöbel zu produzieren. Die Gründer waren auf der Suche nach einem optisch unverwechselbaren Material, das höchsten Anforderungen gerecht wird. Über allem stand die Nachhaltigkeit des Werkstoffes. In einem eigenen, klimaneut
ralen Pressverfahren werden Designmöbel aus Joghurtbechern, PETFlaschen und anderem Plastikmüll hergestellt. Bereits jetzt zählen große Unternehmen zu den zufriedenen Kund:innen. Ziel ist es, die Produkte zukünftig in der Einrichtungsbranche zu etablieren. Das Preisgeld wollen die beiden Gründer in eine neue Produktionsmaschine investieren. „Mit der Anschaffung dieser neuen Maschine können wir einen wirklichen Meilenstein für die zukünftige Plattenproduktion erreichen. Das bedeutet für uns den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt,“ so Wolfgang Rauter, CoGründer und Leiter Technik und Design.
„Wir freuen uns sehr mit den drei Kärntner Startups und sind überzeugt davon, dass alle drei mit ihren innovativen BusinessIdeen und ihrem persönlichen Einsatz auf dem Weg sind, erfolgreiche Unternehmen in Österreich aufzubauen“, betont Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum abschließend. |
Du hast eine innovative Businessidee und möchtest selbstständig werden?
Dann informiere dich im build! Gründerzentrum für deine Möglichkeiten!
Lakeside B01, 9020 Klagenfurt Europastraße 12, 9500 Villach T: +43 463 2700 8740 startup@build.or.at www.build.or.at
Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Firma Hexagon und dem Fraunhofer Institut (KI4life) durchgeführt wird, erfreut sich hoher Beliebtheit.
Auf Basis umfangreicher Geodaten und mittels Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wurde ein digitaler Zwilling, also ein virtueller Nachbau der Landeshauptstadt, entwickelt. Klagenfurt nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Österreichweit einzigartig dient der Nachbau für Analysen, Simulationen und „Was wäre wenn“Szenarien.
Meilenstein in der Digitalisierung Wie hoch ist die Baumbeschaffenheit in Klagenfurt? Wie viele verbaute Flächen gibt es? Welche Flächen sind versiegelt? Wie fällt der Schatten eines Baumes oder eines Gebäudes im Tages oder Jahresverlauf? Auf welchen Dächern sind Photovoltaikanlagen möglich und wie viel Energie könnte auf den Dächern produziert werden? Wie heiß wird der Asphalt an Hochsommertagen durch die Sonneneinstrahlung? Antworten auf all diese Fragen liefert der digitale Zwilling der Stadt Klagenfurt, dargestellt in 2D oder 3D. Seit geraumer
Klagenfurt in 3D: Die Landeshauptstadt Klagenfurt setzt auf einen digitalen Zwilling. © Hannes Krainz
Zeit arbeitet die Abteilung Vermessung und Geoinformation an diesem Mammutprojekt. Das komplette Klagenfurter Stadtgebiet wurde mit speziellen Luftbildkameras erfasst, die mittels Flugzeug die Stadt „abgescannt“ haben. KI sorgt für eine automatisierte Klassifizierung der Bodennutzung und die Erzeugung eines photorealistischen 3DAbbildes des gesamten Stadtgebietes. Ein kleines, aber interessantes Detail der KI ist, dass sich bewegende Objekte und Personen automatisch ausgeblendet werden.
Klagenfurt in 3D Fünf Applikationen stehen zur Auswahl, die insgesamt drei große Themen abdecken: Expertenmodus 3DModell, Landnutzung/Bodennutzung sowie Solarpotenzial (Photovoltaik und Solarthermie) in 2D und 3D. „Die ideale Stadt ist nachhaltig, lebenswert und liebenswert. Wie aber können wir das erreichen? Woher wissen wir, wie sich unsere Grünflächen entwickeln, welche Hitzeinseln es gibt usw. Der digitale Zwilling hilft uns dabei. Das Projekt gilt österreichweit als ,Best Practice Beispiel‘ in diesem Bereich. Es bietet die Grundlage für weitere professionelle Planungen und die Zukunft Klagenfurts“, betont Stadträtin Corinna Smrecnik.
„Das Projekt gilt österreichweit als ,Best Practice Beispiel‘ in diesem Bereich. Es bietet die Grundlage für weitere professionelle Planungen und die Zukunft Klagenfurts.“
Corinna Smrecnik, Stadträtin Klagenfurt
Themen in einer Applikation dargestellt und der User muss die einzelnen Themen selbst ein und ausschalten bzw. aktiv schalten.
Die Landnutzung / Bodennutzung visualisiert die Land bzw. Bodennutzung und die grüne Vegetation, zusätzlich wird auf Grundstücksbasis ein Grundstücksindex dargestellt, der die zusammengefassten Bodennutzungsklassen, das 3DGrünraumvolumen und den Versiegelungsgrad am Grundstück anzeigt.
Das Solarpotential zeigt für jede Dachfläche im Stadtgebiet das Potential für die Erzeugung von Solarstrom bzw. von Warmwasser unter Berücksichtigung der atmosphärischen Bedingungen und des Schattenwurfes durch andere Objekte über das Jahr an. Denkt man also über die Installation einer Anlage auf dem eigenen Dach nach, stellt die Karte die mögliche Fläche sowie die potenziellen Energiewerte dar.

Potenziale erkennen
Der Expertenmodus 3D bietet einen allgemeinen Überblick, es werden sämtliche verfügbare
Chancen der KI nutzen
Aktuell werden die Bilder der Befliegung vom Juni diesen Jahres eingearbeitet und der digitale Zwilling adaptiert. Dabei wird auf die Erfahrungen des aktuellen Zwillings zurückgegriffen, um die Usability weiter zu verbessern. KI erkennt dabei die einzelnen Objekte und definiert die Pixel als solche. So „weiß“ jeder Pixel, ob er entweder Teil einer Straße, eines Baumes oder eines Fahrzeuges ist.
Der digitale Zwilling ist öffentlich zugänglich über den Link www.klagenfurt.at/digitaler-zwilling |
Die digitale Amtsstube ist längst Realität und entwickelt sich weiter. Parallel dazu ist die analoge Form nach wie vor erwünscht. Viele Menschen schätzen den persönlichen Kontakt. Von Monika Unegg
Alles mit Maß und Ziel“, sagt Stefan Deutschmann, Bürgermeister der Marktgemeinde Grafenstein. „Selbstverständlich verschließen wir uns den neuen Entwicklungen nicht. Aber es ist jedem selbst überlassen, ob er sie nutzt oder nicht.“ „Die Menschen kommen nach wie vor gern aufs Gemeindeamt“, weiß Deutschmann. Und das sei ziemlich altersunabhängig. Auch Jüngere bevorzugen in manchen Fällen den direkten Kontakt. Bauangelegenheiten beispielsweise seien ein solcher Bereich, obwohl es möglich wäre, die Pläne hochzuladen und die Formalitäten digital abzuwickeln. Soziales und alle Fälle, in denen es der Beratung bedürfe, finden nach wie überwiegend im persönlichen Gespräch statt. Sämtliche Formulare seien online verfügbar, können aber auch abgeholt werden. Alle seien eben nicht so technikaffin, sie sollen die gleichen Möglichkeiten vorfinden wie jene, die lieber alles von zu Hause aus per Mausklick machen, so der Bürgermeister. „Wer möchte, kann heute auf unserer Gemeinde alles digital erledigen“, sagt Deutschmann. „Fast alles“, fügt er hinzu. „Zum Heiraten müssen die Leute nach wie vor persönlich aufs Standesamt kommen“, lacht er.
Hilfe bei Digitalisierung
Unterstützung bei ihren Schritten in die Digitalisierung finden die Kommunen beim GemeindeServicezentrum (GSZ). Es ist bemüht, den Gemeinden immer neue Tools und Möglichkeiten vorzustellen, dient aber auch als Ansprechpartner, wenn eine Kommune von sich aus ein
Anliegen hat und beratende Unterstützung braucht. „Vieles ist schon umgesetzt, ebenso viele Bereiche stehen vor der Digitalisierung“, erzählt der Geschäftsführer des GSZ, Michael Sternig. So gab es beispielsweise für die Installation unterschiedlicher Apps Förderungen. Um das Marketing, diese Anwendungen bekannt zu machen, mussten sich die Gemeinden selbst kümmern.
Digitale Leuchttürme
Gerade gestartet ist das Projekt „Digitale Leuchttürme“. Dabei werden in einigen Pilotgemeinden verschiedene Systeme installiert und getestet. Dazu zählt beispielsweise eine elektronische Terminverwaltung, die den Büros der Gemeindeoberhäupter oder auch dem Bauamt zur Verfügung gestellt werden. Die Bürgermeister können Terminblöcke bereitstellen, die Bürger dann online buchen können. Wer einen




„Digitalisierung ist wichtig, aber der persönliche Kontakt mit den Menschen ist noch wichtiger.“
Günther Novak, Bürgermeister Mallnitz
(Nicht nur) in der kommunalen Welt spielt der persönliche Kontakt nach wie vor eine zentrale Rolle. © Adobe Stock
Termin wünscht, kann ihn selbst buchen und verwalten, das heißt auf Wunsch verschieben oder stornieren. Das Zwischenschalten einer Sekretariatsleistung wird damit überflüssig. Ein weiteres Tool soll Bauwerbern ermöglichen, jederzeit Einblick in ihren Akt zu nehmen und damit festzustellen, wie weit das Verfahren schon gediehen ist. Diese Pilotgemeinden sollen dann für andere Kommunen als „Leuchttürme“ dienen, bei denen sie sich bei ihrem nächsten Schritt in die Digitalisierung informieren können.
Zentrales Rechenzentrum
Das GSZ bietet den Kommunen und Gemeindeverbänden auch ein zentrales Rechenzentrum an. 101 der 132 Kärntner Gemeinden und weitere 26 Gemeindeverbände machen bereits davon Gebrauch. Sie haben keine eigenen Server vor Ort, die komplette Arbeitsumgebung befindet sich auf dem zentralen Rechner. Das hat mehrere Vorteile. Die Gemeinden brauchen sich weder um Wartungen noch um Updates kümmern. Auch kann jeder Mitarbeiter von seinem Laptop aus ortsunabhängig auf die benötigten Oberflächen zugreifen. Auf diese Weise kommt die Gemeinde bei Bedarf zum Bürger. Die Lizenzen für die OfficeProgramme oder MSTeams beispielsweise werden ebenfalls vom GSZ zur Verfügung gestellt. Es gibt Bestrebungen, einheitliche Programme für bestimmte Bereiche zur Verfügung zu stellen. Damit kann längerfristig gemeindeübergreifend zusammengearbeitet werden. Doch in ihrer Entscheidung sind die Gemeinden autonom. Im Finanzbereich hat sich die Vereinheitlichung großteils


„Wer möchte, kann heute auf unserer Gemeinde alles digital erledigen.“
Stefan Deutschmann, Bürgermeister Grafenstein
durchgesetzt. Hier verwenden laut Sternig rund 80 Prozent der österreichischen Gemeinden dieselbe Software. Ein weiteres Pilotprojekt, mit dem man auch auf den steigenden Personalmangel antwortet, ist die zentrale Baurechtsverwaltung, die sich im Bezirk Feldkirchen im Probelauf befindet. Abseits der technischen Hilfe, wie sie auch in anderen Bezirken bereitgestellt wird, profitieren die Gemeinden ebenfalls von juristischer Unterstützung. Dies birgt den Vorteil, dass Expertenwissen zentralisiert wird, sodass die Gemeinden bei Bedarf darauf zugreifen können.
Persönliche Kontakte
Auch Mallnitz ist in das GSZ digital eingebunden. Die Erleichterungen in der Verwaltungsarbeit werden gern angenommen. So laufen beispielsweise Lohnverrechnungen oder Ausschreibungen zentral über den Rechner, doch für eine durchgehende Digitalisierung sei Mallnitz zu klein, und gerade diese Kleinheit ermögliche noch den direkten Kontakt, erklärt Bürgermeister Günther Novak. „Digitalisierung ist wichtig, aber der persönliche Kontakt mit den Menschen ist noch wichtiger“, präzisiert er. Die digitale Amtstafel und Formulare beispielsweise sind auf der Website verfügbar, aber vieles geht nur oder besser im direkten Kontakt. Diese Erfahrung hat Novak gemacht. Nach einem Radunfall hatte er einen Arm eingegipst und war gezwungen, längere Zeit aufs Auto zu verzichten. Daher war er regelmäßig zu Fuß in der Gemeinde unterwegs und überrascht, wie oft er angesprochen wurde und wie intensiv er mit den Menschen ins Gespräch kam. Dieses Erlebnis bestärkte ihn nun darin, sein Auto auch nach geheiltem Knochenbruch öfter einmal stehen zu lassen.
Lehrlingsausbildung digital
Die Lehrlingsausbildung funktioniert in den Kärntner Gemeinden zum Teil eben
falls digital. „Hier sind wir in unserem Bundesland sehr weit und können diese Leistung längerfristig auch anderen Bundesländern anbieten“, sagt Sternig. Geboten werden Fachvideos inklusive Wissensüberprüfung. Damit können junge Leute auch in abgelegenen Regionen Teile ihrer Lehre als Gemeindemitarbeiter vor Ort absolvieren. „Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, unsere künftigen Mitarbeiter:innen selbst auszubilden, und das ist uns sehr wichtig“, erklärt der GSZGeschäftsführer. |



„Das Gemeinde-Servicezentrum unterstützt die Kärntner Kommunen bei ihren Schritten in die Digitalisierung,“
Michael Sternig, Geschäftsführer GSZ
Im Februar 2024 wird gemeinsam mit dem advantage Wirtschaftsmagazin eine Sonderpublikation herausgegeben.
Als langjähriger Netzwerkpartner freut es uns als advantage Verlag bekannt geben zu dürfen, dass im Februar 2024 wieder eine Sonderpublikation produziert wird. Die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen werden den roten Faden durch die Lektüre legen. Alle VZ Netzwerkpartner werden eingeladen sein. Nähere Informationen erhalten Sie direkt beim Netzwerk Verantwortung zeigen!. Denn was eint, ist das Anliegen einer guten Zukunft. Für alle im Land!
Stark in Nachhalti gkeit
Verantwortung zeigen! ist Ansprechpartner für Unternehmen, die verantwortlich wirtschaften und beitragen wollen, dass Wirtschaft und Gesellschaft gut verbunden bleiben. Das gleichnamige Netzwerk für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ist gemeinsame Lern und Gestaltungsplattform. Über das Jahr finden im Süden Österreichs regelmäßige Veranstaltungen, Engagementaktionen und Pilotprojekte statt, an denen Unternehmen quer durch alle Branchen mitwirken können. |

Netzwerkbüro
Verantwortung zeigen!
St. Veiter Straße 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Iris Straßer T 0664 313 5957 iris.strasser@ verantwortungzeigen.at
Yasmine Benischke T 0463 507755-52 yasmine.benischke@ verantwortung-zeigen.at

Der KWF engagiert sich auf betrieblicher, überbetrieblicher und infrastruktureller Ebene für das Zukunftsbild Kärntens als nachhaltige Region.
Deshalb verleiht der KWF jedes Jahr den Preis KWF.nachhaltig!
Für dieses Jahr sind folgende Unternehmen nominiert:
→ E.C.O. Institut für Ökologie
→ Kooperation der 5 großen Tourismusregionen
∙ Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH
∙ NLW Tourismus Marketing GmbH
∙ Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH
∙ Region Villach Tourismus GmbH
∙ Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH
→ Trastic GmbH
→ Woody GmbH
Mehr Infos zu den nominierten Unternehmen sowie Preisträgerinnen und Preisträgern:

Wirtschaftsraum Südösterreich
Die von beiden Landesregierungen unterzeichnete Absichtserklärung soll die bestehende Zusammenarbeit bekräftigen. Von Petra Plimon
Mit dem Koralmtunnel rücken Kärnten und die Steiermark noch näher zusammen: Der neue Wirtschafts und Lebensraum Südösterreich bringt Chancen für beide Bundesländer. Um diese optimal zu nutzen, ist eine enge und koordinierte Zusammenarbeit erforderlich. Im Rahmen der ersten KärntenSteiermarkKonferenz in Wolfsberg wurde im September ein gemeinsamer Kurs mit klar definierten Kooperationsfeldern diskutiert und mit einer Absichtserklärung untermauert.
Synergien nutzen
„Der neue Zentralraum, der hier entstehen wird, bringt für beide Länder unschätzbare Vorteile“, so Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler sowie die beiden stellvertretenden Landeshauptmänner
Martin Gruber und Anton Lang unisono. „Mit 1,1 Mio. Einwohnern, über 500.000 Arbeitskräften und einer demographischen Wachstumsrate von 2,5 Prozent wird der neu entstehende Zentralraum zu einem der dynamischsten Mitteleuropas“, so Kaiser. Im Rahmen der Konferenz wurden Arbeitsprozesse vereinbart und gemeinsame Ziele und Maßnahmen definiert. „Wir fangen dabei nicht bei Null an, sondern haben schon sehr viel Gemeinsames in Angriff genommen“, so der Kärntner Landeshauptmann weiter. Ziel ist eine neue Form der Interregionalität auf allen Ebenen.
Südösterreich als Chance Beschlossen wurde u. a. die gemeinsame Präsentation auf den europäischen Märkten, die Erstellung einer gemeinsamen Bodendatenbank für Betriebsansiede

lungen und der regelmäßige Austausch im Bereich der Elementarpädagogik. „Geplant ist auch eine länderübergreifende Hochschulkonferenz sowie eine noch engere Verbindung im Bereich der Kultur“, so Kaiser. Um die Anbindung der Regionen an die Koralmbahn effizient zu gestalten, ist ein „SüdösterreichTicket“ in Planung. Darüber hinaus will man auch im Katastrophenschutz verstärkt zusammenarbeiten. „Die Chemie in der bisherigen, aber noch mehr in der zukünftigen Zusammenarbeit stimmt jedenfalls. Die Umsetzung aller Vorhaben ist aber nur dann möglich, wenn wir die dafür nötigen Mittel über den Finanzausgleich sicherstellen können“, betonte Kaiser.
Kooperation auf Augenhöhe
„Die Regierungen in Kärnten und in der Steiermark haben bereits bewiesen, dass sie nicht nur gut arbeiten, sondern vor allem gut zusammenarbeiten“, so Drexler. „Diese Qualität der Zusammenarbeit wollen wir nun über die Landesgrenzen hinaus etablieren, denn es ist eine Zusammenarbeit im Interesse der Menschen in unse
Im Wolfsberger Rathaus fand erstmals eine Konferenz mit Regierungsvertretern aus Kärnten und der Steiermark statt. © LPD Kärnten/Steinacher
„Der neue Zentralraum, der hier entstehen wird, bringt für beide Länder unschätzbare Vorteile.“
Kärntens Landeshauptmann
Peter Kaiser und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler
ren Ländern.“ In einer Zeit mit vielen Herausforderungen schafft die neue Infrastruktur positive Rahmenbedingungen, welche die Perspektiven für beide Länder grundlegend verändert. „Es wird sich ein neues Band von Wohlstand und Arbeit entwickeln, das die beiden Länder miteinander verbindet“, so Drexler. Wenn es gelingt, die Kooperation auch auf die Bereiche Nachhaltigkeit und Kultur auszuweiten, könnte der neue Zentralraum zu einer Benchmark in der interregionalen Zusammenarbeit werden. |

Bei den Innovationsgesprächen der Innoregio Süd wurde beleuchtet, wie das Jahrhundert-Infrastrukturprojekt zum Erfolg für Südösterreich werden kann.
Mit der Fertigstellung der Koralmbahn entsteht eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten. „Die Zusammenarbeit zwischen der IV Kärnten und der IV Steiermark war schon immer sehr intensiv und wird durch die neue Südachse weiter verstärkt“, bekräftigt Timo Springer, Präsident IV Kärnten. Innoregio Süd nimmt in diesem Kontext eine zentrale Rolle ein. „Die gemeinsame Plattform ist ein wichtiger Hebel zwischen Wissenschaft,
„Ganz wesentlich ist, dass durch die Koralmbahn ein komplett neuer Lebensraum entsteht, den man noch aktiv entwickeln muss.“
Stefan Stolitzka
Forschung, Industrie und Wirtschaft. Das wird intensiviert“, betont Stefan Stolitzka, Präsident IV Steiermark.
Öresund-Brücke als Best-Practice Wie bestehende Stärken bestmöglich gemeinsam gesteigert werden können, zeigten die Vorträge von Jakob Svane (Seniorchefkonsulent Dansk Industri, Kopenhagen) und Johan Wessmann (Leiter des Öresund Institutes, Malmö). Die Experten referierten über die durch die Eröffnung der Öre


sundBrücke im Jahr 2000 ausgelöste wirtschaftliche Dynamik in der ÖresundRegion, die zu zahlreichen positiven Entwicklungen geführt hat. Das Beispiel „ÖresundBrücke“, die die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet, zeigt aber auch, dass sich dieser Erfolg nicht ohne entsprechende Maßnahmen in den beiden Regionen eingestellt hat.
Von der Straße auf die Schiene
Eines ist klar, die Koralmbahn wir nach Ihrer Verkehrsfreigabe Ende 2025 großen Einfluss auf Südösterreich haben. Nicht nur, dass sich die Fahrzeit im Personenverkehr zwischen Klagenfurt und Graz enorm reduziert, auch der Güterverkehr wird durch die bessere Entflechtung mit dem Personenverkehr profitieren, wie Christoph Schneider vom EconomicaInstitut im Auftrag der IV Kärnten und Steiermark feststellte. Die Koralmbahn erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber der Straße massiv. Sie kommt „gerade richtig“ in der entscheidenden Phase der Dekarbonisierung des Verkehrs. Dadurch, dass ein derart leistungsfähiger Verkehrsträger innerösterreichisch realisiert wurde, reduziert sich außerdem die Gefahr, dass Österreich auf Alternativrouten entlang des baltischadriatischen Achse umfahren wird.
Wichtiger Seezugang
Mehrere Studien (u. a. auch von Economica) haben zuletzt zudem die Wichtigkeit des Seezugangs für den Exporterfolg gezeigt. Hier ist in Kärnten mit dem ersten grenzüberschreitenden Zollkorridor zwischen Triest und Fürnitz (LCA Süd) einiges gelungen. Die Koralmbahn wird im
Zubringer gestalten

Zubringerverkehr eine wertvolle Hilfe sein, allerdings ist in der Verbesserung der Infrastruktur (Verladestation) noch einiges zu tun.
Timo Springer Wirtschaftsraum
Ein zentraler Begriff in der Verkehrswissenschaft ist jener der Erreichbarkeit. Hier wird die Koralmbahn schon ohne Begleitmaßnahmen einiges bringen. Es wird etwa möglich sein, täglich zwischen dem Kärntner und dem steirischen Zentralraum zu pendeln. Seine volle Stärke wird das System aber erst ausspielen können, wenn auch die Zubringerverkehre entsprechend gestaltet werden und die Raumordnung auf volkswirtschaftlich profitable Weise darauf reagiert. Die Definition von Ansiedlungsflächen für Unternehmen, Forschungszentren, Bildungseinrichtungen und leistbarem Wohnraum für die in beiden Bundesländern aufgrund der schlechten Wanderungsbilanz dringend erforderliche Zuwanderung sind Gebot der Stunde. Am intensivsten bereitet sich derzeit eine der am raschesten wachsenden Städte Österreichs, nämlich Villach, darauf vor. Viele dieser Themen sind in der Studie „Der Koralmtunnel – Chance für Südösterreich?“ angesprochen.
Aus Sicht von IV Kärnten und Steiermark sind folgende Maßnahmen notwendig, um die Eröffnung der Koralmbahn entsprechend vorzubereiten: Es braucht eine begleitende Evaluierung, die Maßnahmen und Förderungen aus relevanten regionalen und überregionalen Politikfeldern anhand von geeigneten Kriterien (Indikatorenpool) analysiert und bei Bedarf anpasst.
Zahlreiche Teilnehmer nutzten vorab die Möglichkeit eines Betriebsbesuches bei der PMS Gruppe in St. Stefan, welche mit wesentlichen Teilen der elektrotechnischen Installationen im Koralmtunnel beautragt ist und quasi „Heimvorteil“ genießt. © PMS
„Ich würde mir von der Politik mehr Mut bei der Entscheidung über und für Infrastrukturprojekte wünschen.“
Economica schlägt ein mehrstufiges Verfahren aus Bestandsaufnahme, Wirkungsanalyse, Instrumentarium vor.
So gut die beiden Länder Kärnten und Steiermark inzwischen auch zusammenarbeiten, ohne eine gemeinsame Struktur, etwa wie in der ÖresundRegion eine gemeinsame Agentur, die im komplexen Zusammenspiel der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Strömungen klare Strategien erarbeitet bzw. auch verantwortet, wird es nicht gehen. „Ganz wesentlich ist, dass durch die Koralmbahn, die Ende 2025 eröffnet wird, ein komplett neuer Lebensraum entsteht, den man noch aktiv entwickeln muss. Das gilt für alle Bereiche,“ so Stefan Stolitzka, Präsident IV Steiermark. „Ich würde mir von der Politik mehr Mut bei der Entscheidung über und für Infrastrukturprojekte wünschen, weil am Ende sind das Entscheidungen, die für die nächste Generation getroffen werden“, so Timo Springer, Präsident der IV Kärnten abschließend. |
Die Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark legten ihr Maßnahmenprogramm für die Area Süd vor.
Mit dem Jahrhundertprojekt Koralmbahn rücken die beiden Zentralräume Graz und Klagenfurt näher zusammen, ein starker Impuls für die Entstehung eines gemeinsamen Wirtschafts und Lebensraums. Aus diesem Grund haben die Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark die neue Dachmarke „AREA Süd“ initiiert.
Zweitgrößter Wirtschaftsraum
Ziel ist es, national und international als zweitgrößter Wirtschaftsraum Österreichs Akzente zu setzen. „Jetzt geht es darum, eine gemeinsame regionalpolitische Agenda zu definieren, um den Wirtschaftsraum zu einem Vorzeigestandort in Europa zu machen. Diese Agenda beginnt am Arbeitsmarkt – Stichwort Skills – und führt über

den weiteren Infrastrukturausbau sowie den F&E und Innovationsbereich bis hin zu einer gemeinsamen Vermarktung mit der neuen Dachmarke Area Süd“, betont Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark.
Unendliche Chancen
In einer Dreiviertelstunde von Graz nach Klagenfurt – die Koralmbahn lässt ab 2025 die Zentralräume rund um die beiden Landeshauptstädte zusammenwachsen.
„Eine europäische Metropolregion mit mehr als 1,8 Mio. Menschen, hunderttausenden Unternehmen und unendlichen Chancen für mehr Wachstum, noch mehr Lebensqualität und weniger Abwanderung. Die bessere Sichtbarkeit als Wirtschaftsstandort und Logistikdrehscheibe, die stärkere Vernetzung von Bildungseinrichtungen, die bequeme Mobilität zwischen Stadt und Land – all das macht Kärnten und die Steiermark zu einem neuen Lebensmittelpunkt im AlpenAdriaRaum“, bekräftigt Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.
Maßnahmen für die Zukunft
Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen wurden in den letzten Monaten von Expert:innen auf beiden Seiten der Pack erarbeitet und in einer Maßnahmenagenda gebündelt, mit der sich die Spitzenvertreter der Wirtschaft in beiden Bundesländern an die Politik wenden. Kern des Programms ist der Ausbau der Infrastruktur in den Regionen der Area Süd, der Ausbau der Haupt, Begleit und Zubringerinfrastruktur zur Koralmbahn, die Attraktivierung des Wirtschafts und Lebensraumes, die Attraktivierung des Bildungs und Innovationsstandortes sowie des F&EStandortes Südösterreich. |
Herwig Draxler, Reinhard Wallner, Benjamin Wakounig, Jürgen Mandl, Andrej Rajh, Gerhard Oswald, Meinrad Höfferer, Robert Karlhofer, Peter Weidinger, Johann Weber (v. l. n. r.) © P. Just
Um die Potenziale der „Area Süd“ sichtbar zu machen, tourte die Wirtschaftskammer Kärnten mit einer Road-Show durch die Bezirke.
Im Lichte der neuen Hochleistungsbahnstrecke entwickeln sich Kärnten und die Steiermark zu einem gemeinsamen Wirtschafts und Lebensraum
Südösterreich. Umso wichtiger ist es, dass die Chancen in den Regionen und von den einzelnen Betrieben erkannt und optimal genutzt werden. Aus diesem Grund tourte die Wirtschaftskammer im Oktober mit der Road Show „Area Süd“

gemeinsam mit renommierten Experten zum zweiten Mal durch Kärnten.
Internationale Strahlkraft
Dass das größte Infrastrukturprojekt im Süden Österreichs weit über die Grenzen hinaus wirkt, war besonders bei der Veranstaltung in St. Kanzian am Klopeiner See spürbar. Neben Unternehmern aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt
Auch Jungtalente aus Kärnten und der Steiermark zeigten bei der achten Berufseuropameisterschaft in Danzig ihr Können.
44 junge Talente machten Österreich bei der diesjährigen Europameisterschaft der Berufe in Danzig zur erfolgreichsten Nation. Der Nachwuchs aus Kärnten und der Steiermark konnte sich besonders hervorheben.
Erfolgsgeschichte Kärnten
Die österreichische Erfolgsgeschichte bei den Maler:innen konnte bei den EuroSkills durch die Kärntnerin Johanna Stabenthei

fanden sich auch slowenische Wirtschaftsvertreter ein, um ihre Perspektiven einzubringen. „Die Koralmbahn ist ein Schlüsselprojekt für ganz Europa. Jetzt müssen wir die Region gemeinsam zu einem Motor für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch machen“, betonte Benjamin Wakounig, Präsident Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ). |

ner fortgesetzt werden. Die gelernte Beschichtungstechnikerin der Malerei Wieser wurde Dritte. Für eine zweite Kärntner Medaille sorgte Bettina Veratschnig vom Parkhotel Pörtschach, die sich Bronze im Skill Restaurant Service sichern konnte.
Siegerteam Steiermark
Besonders stark abgeschnitten hat auch der steirische Nachwuchs mit insgesamt vier Medaillen, davon zwei in Gold. Lara Tynnauer erzielte den ersten Platz in der Disziplin „Schönheitspflege“. Anna Maria
(links) Die Kärntner Talente stellten ihre Spitzenklasse in Danzig unter Beweis. © WK Kärnten (rechts) Der steirische Nachwuchs sicherte sich vier Medaillen bei den Euroskills. © WKO Steiermark
Theurl sorgte mit ihrem Sieg in „ModeTechnologie“ für eine Überraschung. Über eine SilberMedaille darf sich darüber hinaus auch Möbeltischler Jürgen Perhofer freuen, eine weitere Bronzemedaille ging an Hotelrezeptionistin Denise Gringl. Bautischler Johannes Sommer wurde außerdem eine „Medallion of Excellence“ für seine hervorragende Leistung verliehen. |
mit LHStv.in Gaby Schaunig (Kärnten) und LRin Barbara Eibinger-Miedl (Steiermark)
Kärnten und die Steiermark arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr eng in Wirtschaft und Forschung zusammen. Von Petra Plimon
Im Interview mit advantage sprechen die beiden Technologiereferentinnen
Gaby Schaunig (Kärnten) und Barbara EibingerMiedl (Steiermark) über ihre Zusammenarbeit.
advantage: Wieso ist diese bundesländerübergreifende Technologieund Innovationsachse so wichtig?
LHStv.in Gaby Schaunig: Europas Regionen stehen zunehmend im Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir müssen attraktiv sein für Forscher:innen, Studierende, Fachkräfte, denn das ist entscheidend, um auch künftig Innovationen zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung und des Lebensstandards vorantreiben zu können. Die Kooperationen zwischen Kärnten und der Steiermark schaffen Wettbewerbsvorteile. Sie verhelfen dem „Wirtschaftsraum Süd“ zu einer kritischen Größe und erhöhter internationaler Anziehungskraft. Darüber hinaus können wir gemeinsamen Herausforderungen – wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Energiewende oder der Digitalisierung – durch Kooperationen weit effizienter und effektiver begegnen. LRin Barbara Eibinger-Miedl: Wir sind davon überzeugt, dass wir im internationalen Wettbewerb mit globalen Playern gemeinsam mehr erreichen können und sichtbarer sein werden. Gerade bei den großen Herausforderungen, insbesondere bei der grünen und digitalen Trans
„Wir können gemeinsamen Herausforderungen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Energiewende oder der Digitalisierung durch Kooperationen weit effizienter und effektiver begegnen.“
Gaby Schaunig
formation, gilt es, die Kräfte zu bündeln. Die Steiermark und Kärnten haben bereits in der Vergangenheit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vorgelebt. Mit der Koralmbahn entsteht nun ein großer gemeinsamer Wirtschaftsraum. Daraus ergeben sich enorme Chancen, die es aktiv zu nutzen gilt. Daher werden wir die Zusammenarbeit weiter intensivieren und setzen dabei auf unsere gemeinsamen Stärken.
Was sind die Stärken des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Südösterreich?
Schaunig: Kärnten und die Steiermark haben einige gemeinsame Stärkefelder: Mikroelektronik, Green Technologies, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft – mit starken Industriepartnern, einem breiten Feld an innovativen Klein und Mittelbetrieben und TopForschungseinrichtungen am Puls der Zeit. Darüber hinaus können
wir mit besonders hoher Lebensqualität und einem reichhaltigen Angebot an unterschiedlichsten Lebensräumen punkten: Von den lebendigen Universitätsstädten Graz und Klagenfurt über eine Vielzahl an charmanten Kleinstädten und Dörfern bis hin zu wunderbaren Naturlandschaften wie den Kärntner Seen, der steirischen Weinstraße, den Berglandschaften hüben wie drüben. Was uns ebenfalls eint, ist die geographische Lage im Herzen Europas, die uns in besonderem Maße für kulturelle Offenheit und sprachliche Vielfalt prädestiniert.
Eibinger-Miedl: Ich kann mich dem nur anschließen. Unseren beiden Bundesländern ist es hervorragend gelungen, wirtschaftliche Dynamik mit guter Lebensqualität zu vereinen. Im Wirtschaftsraum Südösterreich finden sich unglaublich viele Möglichkeiten: Vom Job in einem HochtechnologieUnternehmen oder in einem Startup bis zum innovativen Familienbetrieb reicht diese Bandbreite. Mit unseren Universitäten, Fachhochschulen und forschungsintensiven Unternehmen zählen wir zu den innovativsten Regionen Europas. Neben den genannten Stärkefeldern Mikroelektronik und Green Tech sind bei uns weiters die Mobilitätsindustrie und die Humantechnologie im Fokus.
Welche Kooperationen sind bereits entstanden?

Eibinger-Miedl: Gemeinsam haben wir 2016 den ersten bundesländerübergreifenden Cluster gebildet und wir können unsere bestehenden Kooperationen schon jetzt als Erfolgsmodelle bezeichnen. So sind unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Green Tech Valley Vorreiter in der Entwicklung von grünen Technologien, wir verfügen hier im internationalen Vergleich über ein besonderes Knowhow. Und mit dem Silicon Alps Cluster nimmt der Süden Österreichs im Halbleiterbereich europaweit eine Spitzenposition ein. Beide Landesregierungen sind sich einig, dass diesen Initiativen noch zahlreiche weitere folgen sollen.
Schaunig: Im Bereich Forschung und Entwicklung kooperieren unsere beiden Bundesländer schon seit Jahren erfolgreich, u.a. im Bereich der Silicon Austria Labs, bei der Forschungsgesellschaft Joanneum Research und dem Digital Innovation Hub Süd. Auch diese Formen der Zusammenarbeit werden wir weiterhin ausbauen.
Barbara Eibinger-Miedl und Gaby Schaunig.
© Kainz
Und unsere Netzwerke werden durch die Koralmbahn noch enger zusammenwachsen. Das Green Tech Valley beispielsweise – der Unternehmenscluster rund um grüne Technologien – hat erst kürzlich ein Büro in Klagenfurt eröffnet und verfügt nun als erste Organisation überhaupt über zwei Standorte in Gehdistanz zu Stopps der künftigen Koralmbahn.
Welche Projekte sind für die Zukunft im Bereich Innovation und Technologie geplant?
Eibinger-Miedl: Die stärkere Vernetzung unserer Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat meiner Meinung nach noch viel Potenzial. Und auch die Aktivitäten unserer gemeinsamen Forschungsgesellschaften Joanneum Research und Silicon Austria Labs werden wir definitiv weiter ausbauen und weiterentwickeln.
Schaunig: Wir haben bereits sehr erfolgreich gemeinsame Projekte bei der
„Wir sind davon überzeugt, dass wir im internationalen Wettbewerb mit globalen Playern gemeinsam mehr erreichen können und sichtbarer sein werden.“
Barbara Eibinger-Miedl
Forschungsförderungsgesellschaft FFG eingereicht – das ist sicher ein Kooperationsbereich, den wir vertiefen werden. Im Bereich Mobilität und Logistik ist eine bundesländerübergreifend abgestimmte Planung der infrastrukturellen Maßnahmen essenziell, um die Anbindung der Regionen an die Koralmbahn zu sichern. Auch ein rascher Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein gemeinsames Ziel der Bundesländer.
Welche Rolle spielt der Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Eibinger-Miedl: Als Innovations und Forschungsregionen haben wir ideale Voraussetzungen, um die Chancen des digitalen Wandels erfolgreich nutzen zu können. Die künstliche Intelligenz zählt dabei zu den zentralen Themen, die es auf die Unternehmensebene herunterzubrechen gilt. KI kann in vielen Bereichen zum „Gamechanger“ werden und ich bin davon überzeugt, dass auch das kürzlich präsentierte KIMaßnahmenpaket des Bundes einen wichtigen Beitrag leisten wird.
Schaunig: Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeits und Lebenswelten intensiver revolutionieren als wir es uns heute vorstellen können. Wichtig ist, dass die Politik diese Prozesse gut und aufmerksam begleitet und über Reglements sicherstellt, dass immer das Wohl der Menschen im Vordergrund steht. |
Im Rahmen einer Petition fordern Wirtschaft und Politik die vollständige Reaktivierung der Lavanttal-Bahn als Zubringer für die Koralmbahn.
Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn als Teil der neuen Südstrecke gewinnen auch die Nebenlinien mehr und mehr an Bedeutung. Manche davon sind inzwischen stillgelegt oder nur mehr teilweise in Betrieb, so auch die LavanttalBahn.
„Die Hausaufgaben müssen in den Regionen gemacht werden, unser Baustein ist die Lavanttal-Bahn.“
Gerhard Oswald, WK-Bezirksstellenobmann Wolfsberg
Chance für die Region
„Die LavanttalBahn ist nicht nur ein historisches Eisenbahnsystem, sondern ein bedeutender Standortfaktor für unsere Betriebe“, betont WKBezirksstellenobmann Gerhard Oswald. Um den Stellenwert der LavanttalBahn für eine positive Entwicklung der Gesamtregion sichtbar zu machen, lud die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Wolfberg kürzlich zu einer Entwicklungskonferenz
nach Bad St. Leonhard. Mit dabei waren u. a. Vertreter von Leitbetrieben wie Asco, Geislinger, Hermes, Johann Offner, Mondi, KLH und Stora Enso, dem Regionalmanagement Lavanttal, die Bürgermeister:innen des Bezirkes Wolfsberg sowie der angrenzenden steirischen Gemeinden Obdach und Weißkirchen.
Potenziale nutzen
Die Wiederbelebung der LavanttalBahn stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung von Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus sowie zur Verbesserung der Arbeits und Lebensqualität für die Menschen im Wirtschafts und Lebensraum Südösterreich und darüber hinaus dar. „Mit einer direkten Anbindung an die Koralmbahn eröffnet sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Die Hausaufgaben müssen aber in den Regionen gemacht werden, unser Baustein ist die LavanttalBahn“, so Oswald. Das Aufrechterhalten von bestehenden Bahnstrecken trägt zudem wesentlich zu einer Verminderung des CO2Ausstoßes bei. Demnach wäre eine Investition in die LavanttalBahn nicht nur eine wirtschaftliche und verkehrspolitische Entscheidung, sondern ist auch als zentraler Beitrag zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz zu sehen.
An einem Strang ziehen Gemeinsam mit dem Regionalmanagement Lavanttal (RML) und den betroffenen Gemeinden wurde eine Petition erarbeitet, um die Revitalisierung der LavanttalBahn über Parteigrenzen hinweg voranzutreiben und die notwendigen Mittel bei den zuständigen Stellen zu lukrieren. Am 23. November soll die Petition „Wiederbelebung der LavanttalBahn“ den zuständigen Regierungsmitgliedern in Wien präsentiert werden. Bundespolitisch unterstützt wird das Vorhaben von den Nationalratsabgeordneten Johann Weber und Peter Weidinger. Befürwortet wird die Initiative auch auf EUEbene von Christian Gsodam, Kabinettschef im Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel, der die grenzüberschreitende Verbindung von Zeltweg nach Dravograd im Hinblick auf die Anbindung an die Koralmbahn als von europäischer Bedeutung ansieht. |

Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik: Gemeinsam wurde die Petition „Wiederbelebung der Lavanttal-Bahn“ auf die Beine gestellt. © WKK / Jasmin Pieber

Ratspräsident Zentralraum Kärnten Bgm. Günther Albel (links) und Regionsvorsitzender Südweststeiermark NR Bgm. Joachim Schnabel (rechts) beim gemeinsamen Austausch am 9. Oktober 2023. © RM SWS GmbH
Prognosen deuten schon länger darauf hin, der gemeinsame Zukunftsraum entwickelt sich bereits.
Oftmals muss man nicht weit wegfahren, um Erfahrungen auszutauschen und gelebte best practiceBeispiele besichtigen zu können. Unter der Leitung der Vorsitzenden der Regionen Südweststeiermark und des Kärntner Zentralraumes wurden Projekte in der Südweststeiermark, genauer gesagt im Laßnitztal, besucht.
Laßnitztal als Vorbild
Eben in diesem Raum zwischen Deutschlandsberg und Groß St. Florian ist auf steirischer Seite derzeit am besten zu beobachten, wie ein Jahrhundertinfrastrukturprojekt eine Region verändert. Ausgehend vom zukünftigen Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian wird zukünftig eine ganze Region mit hochrangigem öffentlichem Verkehr erschlossen. Aus wirtschaftlicher Sicht bemüht sich die Laßnitztal Entwicklungs GmbH seit mittlerweile zehn Jahren darum, die Potenziale der Koralmbahn zum Wohle der gesamten Region nutzbar zu machen. Die Kooperation von sechs Gemeinden und der Region Südweststeiermark ist oftmals Ziel von Exkursionsgruppen und findet weithin Beachtung. Der selbstgegebene Zeitplan wird eingehalten und im Jubiläumsjahr der Gründung werden die ersten Unternehmen auf den gemeinsamen Arealen ihren Betrieb aufnehmen.

Mikro-ÖV als Schlüssel
Seitens der Südweststeiermark wird aber auch intensiv daran gearbeitet, die Gesamtregion näher an die Koralmbahn heranzuführen. Ein Beispiel dafür ist das regionale MikroÖV System regioMOBIL. Zusammen mit der GrazKöflacher Bahn wird das System in Ergänzung zu Bus und Bahn laufend weiterentwickelt und ist damit der am dynamischsten wachsende ondemandService der Steiermark.
„Die Südweststeiermark ist zukünftig nicht der Raum zwischen Villach, Klagenfurt und Graz, sondern der Kern einer sich entwickelnden Metropolregion.“
NR Bgm. Joachim Schnabel, Regionsvorsitzender Südweststeiermark
Im Austausch miteinander sind sich die beiden Vorsitzenden einig, dass es zukünftig geboten sein wird, ausgetretene Pfade zu verlassen und Chancen gemeinsam zu nutzen. Die einzelnen Teilregionen haben
„Wir müssen entlang der Route als ein gemeinsamer Raum denken, kooperativ arbeiten, voneinander lernen und uns regelmäßig interkommunal austauschen.“
Bgm. Günther Albel, Ratspräsident Zentralraum Kärnten
zwar spezifische Herausforderungen zu lösen, dennoch muss es in Zukunft einen permanenten, engen Austausch geben. Gemeinsame Entwicklung ist das Ziel, denn nur im Wechselspiel Stadt und Land, Wirtschaft und Naturraum wird das volle Potenzial dieser Region sichtbar. Welche Metropolregion hat schon Weltmarktführer, eine international beachtete Weinregion, eine unvergleichliche Seenlandschaft in sich vereinigt und ist innerhalb einer Fahrzeit von nur 60 Minuten erschlossen? Mit der Koralmbahn ist das schon bald verwirklicht und eine aufstrebende Großregion entsteht. |
Unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes.


Das Projekt Koralmbahn verbindet weltweit anerkanntes österreichisches Bahnbau-Know-How mit Produkten höchster Qualität – größtenteils ebenfalls „made in Austria“. © ÖBB/Zenz, Plimon

Nahe der Jauntalbrücke erfolgte der historische Abschluss der Gleisarbeiten in Kärnten.
Die TeilInbetriebnahme der Koralmbahn in Kärnten findet bereits am 10. Dezember 2023 statt. Der „goldene Nagel“ bildet das letzte Puzzlestück der Gleisarbeiten auf der Zulaufstrecke bis zum Koralmtunnel. Rund 6,1 Mrd. Euro werden in den Bau der Koralmbahn investiert.
„Die ÖBB sind ein langjähriger Kunde und wertvoller Entwicklungspartner für unsere Bahninfrastruktursysteme.“
Franz Kainersdorfer, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG
Bahnverkehr wird revolutioniert Im Beisein von Vertreter:innen von ÖBB und voestalpine AG fanden im Oktober die finalen Schweißarbeiten in Kärnten statt. Judith Engel, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG: „Der ,Goldene Nagel‘ ist symbolisch der letzte Schwellennagel, der versetzt wird und markiert einen wichtigen Meilenstein in jedem Bahnprojekt. Ein großer Dank allen Projektbeteiligten zur Fertigstellung des Gleisbaus der Koralmbahn in Kärnten.“ Hier werden die Züge der ÖBB künftig über ultralange Hochleistungsschienen der voestalpine Tochter
voestalpine Railway Systems rollen, die auch die Hochgeschwindigkeitsweichen und die dazugehörige digitale Technik zur Weichenüberwachung liefert. „Als weltweit führender Anbieter für komplette Bahninfrastruktursysteme freut es uns ganz besonders, mit unseren HighTechProdukten für die neue Südstrecke der ÖBB einen wichtigen Beitrag zu einem der größten heimischen Infrastrukturvorhaben zu leisten, um sowohl die Weichen und Schienensystemtechnik als auch die Digitalisierung der Bahn konsequent voranzutreiben“, so Franz Kainersdorfer, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Metal Engineering Division.
100 High-Tech-Weichen
Insgesamt wurden für die Koralmbahn rund 290 km Gleise und rund 100 HighTechWeichen mit Verschluss und Überwachungstechnologien der voestalpine Railway Systems geliefert. Insgesamt werden an der Koralmbahn etwa 235 Weichen eingesetzt. Die Produktion der 120Meterlangen Premiumschienen erfolgt im steirischen Donawitz, von wo aus die Schienen justintime innerhalb weniger Stunden zum benötigten Standort transportiert werden. Neben der außergewöhnlichen Länge von 120 Metern zeichnen sich die Schienen durch eine hervorragende GleisPerformance aus. Am Standort Zeltweg
„Der „Goldene Nagel“ markiert einen wichtigen Meilenstein in jedem Bahnprojekt.“
Judith Engel, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG
werden innovative Weichensysteme und die dazugehörige digitale Technik zur Weichenüberwachung entwickelt.
Endspurt vor Inbetriebnahme
Bis die Koralmbahn im Bereich zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal im Dezember in Betrieb geht, heißt es testen, üben und einschulen. Der so genannte Oberbau – also die Fahrbahn bzw. der Gleiskörper – ist freigegeben. Die Bahnstromanlagen sind dann ab Ende Oktober auf der gesamten Kärntner Strecke auf Rot – Achtung Starkstrom. Es folgen noch weitere Tests zur Abnahme und Kontrolle des Zugsicherungssystems ETCS. Das System kontrolliert per Funk die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der Züge, ist europaweit einheitlich und sorgt so für eine hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Parallel erfolgen weitere Tunnelsicherheitsübungen mit Einsatzkräften, Belastungstests sowie Schulungsfahrten. |
Mehr Leistung.
Mehr Wachstum.
Mehr Wirtschaftskraft.

150.000 Betriebe.
770.000 Beschäftigte.
70 Milliarden Euro Wertschöpfung.
Die sich ständig weiterentwickelnde Geschäftswelt stellt Unternehmen vor vielfältige und komplexe Herausforderungen.
Von der Bewältigung globaler Unsicherheiten bis hin zur Anpassung an schwankende Markttrends und sich wandelnde Kundenerwartungen ist eine proaktive und flexible Herangehensweise unerlässlich. Hier tritt die Digitalisierung als entscheidendes Instrument in den Vordergrund. Das Datenmanagement nimmt dabei eine zentrale Position ein.
Die zentrale Rolle von Daten Daten bieten eine solide Grundlage, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Effizienz zu steigern und Kundenbedürfnisse präzise zu erfüllen. Durch den richtigen Umgang mit Daten können Unternehmen Trends frühzeitig erkennen, ihre Angebote optimieren und einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielen.
Ein umfassendes Verständnis von Produktions und Anlagendaten ermöglicht nicht nur Optimierungen in Bezug auf Effizienz und Kosten, sondern eröffnet auch Wege zu einem ressourcenschonenden Wirtschaften. Unternehmen können

so ihren Energieverbrauch minimieren, den CO2Fußabdruck reduzieren und letztlich nachhaltiger agieren.
PMS als Partner für den digitalen Wandel
Als erfahrene Akteure auf diesem Gebiet unterstützen PMS Digital Solutions (PMS DS) und die PMS Gruppe Unternehmen dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Sie bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der von der Strategieentwicklung bis hin zur Implementierung reicht und unterstützen Unternehmen dabei, eine kohärente und effektive Digitalisierungsstrategie umzusetzen.
Maßgeschneiderte Lösungen
Unternehmen, die Schwierigkeiten bei der Handhabung großer Datenmengen haben oder sich in einem unübersichtlichen Technologieumfeld zurechtfinden müssen, erhalten durch PMS DS gezielte Unterstützung. „PMS DS bietet hier Lösungen an, die genau auf individuelle Anforderun

gen zugeschnitten sind und hilft dabei, digitale Prozesse erfolgreich zu implementieren und zu managen. Damit sind Unternehmen bestens aufgestellt, um eine erfolgreiche digitale Zukunft zu gestalten. Sie erhalten nicht nur Zugang zu modernsten Technologien und Methoden, sondern profitieren auch von der umfassenden Erfahrung der gesamten PMS Gruppe“, betont Andreas Terler, Geschäftsführer PMS DS.
Die tiefgreifende Kenntnis des Industriesektors zählt zur wesentlichen Stärke der PMS Gruppe. Durch jahrelange Erfahrung hat die Gruppe ein profundes Verständnis für die spezifischen Anforderungen, Anlagen und Herausforderungen entwickelt, mit denen Industrieunternehmen konfrontiert sind. Diese Expertise macht PMS zu einem idealen Partner, wenn es um die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im industriellen Umfeld geht. Wenn Unternehmen mit der PMS Gruppe zusammenarbeiten, investieren sie nicht nur in Digitalisierung, sondern auch in eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Industrie basiert. Das Ergebnis? Nachhaltige Lösungen, die echten Mehrwert bieten und Unternehmen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche, digitale Zukunft führen. |
KONTAKT
PMS Digital Solutions GmbH
PMS Straße 1, 9431 St. Stefan T +43 050 767-0 office@pms.at www.pms.at www.pms-ds.at


FAn jedem Ort, zu jeder Zeit: App und Banking-Portal der BKS Bank bieten rund um die Uhr Zugriff zu Konten, Depots und Sparkonten. © Getty Images



Wie die BKS Bank die Digitalisierung meistert und welche Vorteile der neue Finanzplaner bietet.
arblich abgestimmt, in Kategorien geordnet: Den Kunden der BKS Bank steht seit kurzem ein Finanzplaner als neue AppFunktion zur Verfügung.
Geboten wird ein optimaler Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse. In einer übersichtlichen Grafik sehen die Kunden, wofür sie wie viel – im individuell festgelegten Zeitraum – ausgegeben haben. Die Ausgaben werden in Kategorien zusammengefasst, die vom Kunden erweitert und geändert werden können. „Eine wichtige Funktion, die einen guten Überblick bietet und bei der persönlichen Finanzplanung unterstützt“, betont Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank.
Der Finanzplaner ist eines von mehreren Projekten, die in den vergangenen Monaten abgeschlossen wurden. So können nun unter anderem die Zahlungsverkehrskonten anderer Banken in die BKS BankApp eingebunden werden – ein Service, das Kunden gerne nutzen. „Unser Anspruch bei jedem Digitalisierungsschritt ist es, unseren Kunden das tägliche Bankgeschäft zu erleichtern. Die neuen Technologien sehen wir als Werkzeug, mit denen wir unsere Kundenbeziehungen noch weiter vertiefen können. Die Digita

„Die Digitalisierung ermöglicht uns, die Nähe zu unseren Kunden weiter zu erhöhen und gleichzeitig unser Serviceangebot zu erweitern.“
Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank
lisierung ersetzt die persönliche Beratung also nicht, sondern macht sie noch besser“, sagt Stockbauer.
Mit technologischem Fortschritt die Zukunft meistern
„Wir sind davon überzeugt, dass die Bankenbranche auch in Zukunft von technologi
schem Fortschritt geprägt sein wird“, so Stockbauer. Deshalb arbeitet die BKS Bank bereits an den nächsten Digitalisierungsschritten wie beispielsweise der Depoteröffnung und der Wertpapierorder in der BKS App. Auch die verstärkte Digitalisierung des Firmenkreditprozesses kommt gut voran. Firmenkunden wird damit künftig die Möglichkeit geboten, schnell und unkompliziert ein unverbindliches Angebot einzuholen. „Die fortschreitende Digitalisierung sehen wir nicht nur als Herausforderung, sondern vor allem als Chance. Sie ermöglicht uns, den Fokus noch stärker auf Kundenorientierung zu legen und eine verantwortungsbewusste Zukunft zu gestalten.“ |
Dislaimer: Die Veranlagung in Wertpapieren birgt neben Chancen auch Risiken.
BKS Bank
St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt am Wörthersee T 0463-5858-0 karriere@bks.at www.bks.at
mit Holger Schmitz, Sprecher der IT-Security-Experts Group – Kärnten
„Cyber
Die NIS2-Richtlinie enthält rechtliche Maßnahmen zur Steigerung des allgemeinen Cybersicherheitsniveaus.
Von Petra Plimon
Holger Schmitz, Sprecher der ITSecurityExperts Group – Kärnten, spricht im Interview mit advantage über das Thema Cyber Security und die neue NIS2Richtlinie.
advantage: Warum ist Cyber Security ein zentraler Faktor für jedes Unternehmen?
Holger Schmitz: Das Internet und die neuen Technologien haben die Art und Weise der Kommunikation weltweit verändert. Ob HomeOffice, Datenspeicher in der Cloud oder das Internet der Dinge. All diese Services funktionieren nur dank des Internets. Allerdings haben die aktuellen Technologien und ihre weit verbreitete Nutzung auch neue Bedrohungen gebracht. BusinessEMail Compromise oder Romance Scams sind nur zwei Beispiele für aktuelle Cyberangriffe, mit denen Unternehmen heute konfrontiert werden. Um ihre Mitarbeiter:innen, Abläufe, Netzwerke und Daten zu schützen, müssen Firmen effektive Cybersicherheitsrichtlinien und Werkzeuge einführen, denn Cyberangriffe werden in absehbarer Zeit nicht aufhören. Der Anstieg bei dem Angriffsziel Informations und Kommunikationstechnologien (IKT) im engeren Sinn, der gemeldeten bzw. zur Anzeige gebrachten
Fälle, liegt 2022 bei 44,5%.
Cyber Security ist ein abstraktes Thema. Viele Unternehmen können die Risiken eines Angriffes auf Ihre Daten nicht abschätzen. Cybercrime ist heute eine Wachstumsbranche, in der Anbieter ihre ‚Services‘ wie Dienstleistungen – „Cybercrime as a Service“ – anbieten und verkaufen. Während die Kriminellen noch vor einigen Jahren vor allem auf ungezielte Massenangriffe setzten, gehen sie heute wesentlich gezielter vor und bereiten ihre Angriffe von langer Hand vor. Die wenigsten Unternehmen haben ein Konzept bzw. Strategiepapier, wie sie bei einem Ausfall der eigenen Informationstechnologie, zumindest eine Woche, ohne ihre digitalen Daten überleben können.
Welche Neuerungen bringt die NIS2-Richtlinie mit sich und sind alle Unternehmen gleichermaßen betroffen?
NIS steht für „Network and Information Security“. Die europäische NIS2Richtlinie, welche seit Jänner 2023 in Kraft ist und bis 17. Oktober 2024 in Österreich umgesetzt werden muss, bringt neue und strengere Vorschriften zur Cybersicherheit für viele Unternehmen. Betriebe sollten nicht pauschal davon ausgehen, dass das

„Cyber Security ist ein abstraktes Thema. Viele Unternehmen können die Risiken eines Angriffes auf Ihre Daten nicht abschätzen.“
Holger Schmitz, IT-Experte
eigene Unternehmen vom Geltungsbereich der NIS2 ausgenommen ist, nur weil es nicht unter die ursprüngliche NISRichtlinie gefallen ist. Die derzeit geltenden Regelungen betreffen vorwiegend Unternehmen der kritischen Infrastruktur und Anbieter digitaler Dienste. Mit NIS2 werden weit größere Teile der Wirtschaft eingebunden, die Regelung erstreckt sich nun auf 18 Sektoren, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Bisher waren Unternehmen der kritischen Infrastruktur und Anbieter digitaler Dienste wie z. B. Internetserviceprovider bzw. Rechenzentrumanbieter betroffen. Die Gesetzgebung richtet sich nun an Betriebe in gesellschaftlich relevanten Bereichen, wobei hier zwischen wesentlichen Einrichtungen und wichtigen Einrichtungen unterschieden wird. Die Zuordnung erfolgt dabei anhand der Unternehmensgröße sowie des Tätigkeitsbereichs. Auch kleinere Betriebe können betroffen sein, wenn es sich um den einzigen Anbie


Die Absicherung von IT-Systemen ist eine komplexe Aufgabe, bei der es viele unterschiedliche Aspekte zu beachten gilt. © Unsplash
Risikoanalysen, die Kontrolle der eigenen Lieferkette, der Aufbau eines IT-Sicherheitsprogramms und die Auswahl geeigneter Security-Produkte benötigen viel Zeit. Unternehmen sind daher angehalten so rasch wie möglich nachfolgende Aufgabenliste abzuarbeiten und umzusetzen:
• Cybersicherheit in der Führungsebene nachweislich verankern.
• Etablierung eines Informationssicherheits-Managementsystem mit Vorgaben für die Informationstechnologie und die Mitarbeiter:innen.
ter in Österreich handelt bzw. ein Ausfall erhebliche Konsequenzen für die Wirtschaft und öffentliche Versorgung hätte. Viel größer ist jedoch die Anzahl von Unternehmen, welche als Lieferant oder Dienstleister dieser wesentlichen und wichtigen Einrichtungen indirekt davon betroffen sind. Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie bestimmte digitale Dienste fallen unabhängig von ihrer Größe unter die NIS2Richtlinie.
Betroffene Unternehmen und Organisationen müssen die neuen Vorschriften bis spätestens Herbst 2024 erfüllen, sonst drohen hohe Geldbußen. Neben dem Risiko von Geldbußen besteht nun auch ein Haftungsrisiko. Geschäftsführer und Vorstände werden bei Verstößen persönlich zur Verantwortung gezogen. Tritt ein solches Ereignis ein, fällt es allen Beteiligten schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. Deshalb macht es für Unternehmen Sinn, Vorkehrungen zu treffen. Ein Schnellcheck, ob ein Unternehmen unter die Richtlinie fällt, kann auf der WKOSeite unter https://ratgeber.wko.at/nis2/ erfolgen.
Was bedeutet das konkret für Unternehmen bzw. was gilt es umzusetzen?
Die NIS2Richtlinie soll die Widerstands
fähigkeit und die Reaktion auf einen Incident im öffentlichen Sektor und bei Privatunternehmen verbessern. Betriebe sind durch NIS2 verpflichtet, geeignete und verhältnismäßige technische operative und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der ITSysteme zu beherrschen und die Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten. Die Richtlinie schreibt vor, die Sicherheitsmaßnahmen an den Stand der Technik sowie die individuelle Gefährdungslage anzupassen. Die Schutzmaßnahmen müssen zudem einem gefahrenübergreifenden Ansatz folgen, es gilt also nicht nur Cyberangriffe zu berücksichtigen, sondern alle Arten von Vorfällen, die die eigene ITUmgebung und damit die Erbringung der wesentlichen Dienstleistung beeinträchtigen können. Die Absicherung von Informationssystemen ist eine komplexe Aufgabe, bei der es viele unterschiedliche Aspekte zu beachten gilt. Rund um die NIS2 Richtlinie gibt es noch einige Details zu klären, da die Überleitung der EURichtlinie in nationales Recht noch nicht erfolgt ist. Betroffene Organisationen sind jedoch nach Ablauf der Frist zur Umsetzung der geforderten Maßnahmen, vermutlich ab 18. Oktober 2024, verpflichtet. |
• IT-Notfallpläne erstellen, um auf Vorfälle richtig reagieren zu können und den Betrieb aufrecht zu erhalten.
• Risikomanagement zur Bewertung und Behandlung von Cybersicherheitsrisiken einführen.
• Bewertung der Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen.
• Sicherheit in der Lieferkette, im Umgang mit Geschäftspartnern und Dienstleistern.
• Cybersicherheitsmaßnahmen auf technischer, operativer und organisatorischer Ebene umsetzen.
• Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter:innen durchführen.
• Kritische Cybersicherheitsvorfälle umgehend melden.
Bei Sicherheitsvorfällen ist die Behörde binnen 24 Stunden grob zu informieren, binnen drei Tagen muss eine ausführliche Meldung an die Behörde erfolgen, nach einem Monat ist ein Abschlussbericht zu übermitteln.
Bei Nichterfüllung drohen Sanktionen bis zu 10 Mio. Euro oder 2 % des Gesamtjahresumsatzes des Konzerns bei wesentlichen Einrichtungen bzw. 7 Mio. Euro oder 1,4 % des Gesamtjahresumsatzes des Konzerns bei wichtigen Einrichtungen. Geschäftsführung bzw. der Vorstand haften mit seinem Privatvermögen für Verstöße, wenn essenzielle Risikoabwägungen vernachlässigt oder ignoriert wurden.
Während KI die Prävention von Cyberrisiken erleichtert, trägt sie gleichzeitig auch dazu bei, bestehende Sicherheitsgefahren zu erhöhen oder sogar neue zu erzeugen.





Judit Tumpek, Leiterin Stabstelle Recht –Großschäden, Spezialrisiken bei KOBAN SÜDVERS © www.martinjager.com
Künstliche Intelligenz ist seit der Markteinführung von ChatGPT zur Alltagsrealität geworden. Wie das in der Reise durch die Digitalisierung bisher oft der Fall war, neigt die Menschheit dazu, zuerst den Nutzen zu ernten und sich erst dann mit den möglichen Gefahren auseinanderzusetzen, wenn diese bereits Realität sind. Auch die Gesetzgebung reagiert tendenziell erst später, um nach Identifizierung der Problemzonen die Risiken in Grenzen zu halten (siehe DSGVO, EUSicherheitsrichtlinie NIS1, NIS2, AI Act).
KI im Risikomanagement
Mittlerweile haben ITExperten erkannt, dass die digitale Entwicklung nur Hand in Hand mit ITSicherheit erfolgen kann. Die ITSecurity Branche
setzt zur Bekämpfung der CyberRisiken mittlerweile auch KI ein. Mithilfe von KI können Daten aus unterschiedlichen Quellen schneller und strukturierter gesammelt bzw. analysiert werden, um proaktiv eine bessere Verteidigungsstrategie aufzubauen. Auch im gesamten Risikomanagement, z.B. im Bereich Cyberversicherungen, kommt KI immer mehr zum Einsatz, obgleich das Geschäftsrisiko eines Unternehmens und dessen Verständnis viele Komponenten voraussetzen, bei denen die menschliche Psyche oder das Erfordernis kreativen Denkens unabdingbar sind. Beispielweise muss ein Geschäftsführer in einem CyberKrisenfall eine Reihe von Entscheidungen treffen (z. B. in Bezug auf Mitarbeiter:innen oder in der Krisenkommunikation), wo Empathie und emotionale Intelligenz gefragt sind.
Neue Sicherheitsgefahren
Während also KI die Prävention von bzw. die Reaktion auf Cyberrisiken erleichtert, trägt sie gleichzeitig wesentlich dazu bei, bestehende Sicherheitsgefahren zu erhöhen oder sogar neue zu erzeugen. Durch das immer mehr verbreitete und unkontrollierte Einsetzen von ChatGPT und anderer Machine Learning Tools werden Angriffsflächen geschaffen. KI erstellt Inhalte aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit bereits bestehender Informationen, daher kann sie den menschlichen Verstand, der mit oder neudenken kann, nicht ersetzen. Deshalb und weil die eingegebenen Informationen weder auf Richtigkeit noch auf Aktualität oder Vertraulichkeit geprüft werden, besteht erhebliche Gefahr von Informationsmissbrauch, der Verbreitung von Desinformationen sowie für Datenspionage.
Missbräuchliche Verwendung von KI Deepfakes sind verschiedene Formen der audiovisuellen Manipulation mittels einer auf KI basierten Tech
nologie, die ein sicherheitspolitisches Risiko darstellen, weil sie zur Verbreitung von Populismus und Destabilisierung der Gesellschaft führen können. Ein großes Problem stellen auch KIHalluzinationen dar: Wenn die Algorithmen aufgrund mangelnden Trainings bzw. unzureichender Informationen objektiv falsche, ungerechtfertigte teilweise sogar erfundene Resultate erzeugen. Nicht zu verharmlosen ist, dass die Anwendung von ChatGPT schnell zur groben Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten, Geschäftsgeheimnissen sowie weiterer sensibler Informationen führen kann. Auch hier ist noch abzuwarten, wie die Gesetzgebung auf dieses neue Risikofeld reagieren wird.
„Die Aspekte der Risikominimierung sind vielfältig. Wir möchten unsere Kunden bestmöglich unterstützen.“
Dr. Judit Tumpek
Richtig von falsch unterscheiden
KITechnologien erleichtern gleichzeitig auch die Arbeitsprozesse von Cyberkriminellen. „Cyber Crime as a Service“ oder „Ransomware as a Service“ sind zu rentablen Geschäftsmodelle geworden. Dabei ermöglichen KIbasierte Methoden Angriffe gezielter und genauer auszuführen. Täter können zudem absichtlich zur Datenvergiftung der KI beitragen, indem sie die Domains beschaffen und Inhalte manipulieren. Betrugsmaschen, wie Scamming oder Phishing werden qualitativ hochwertig ausgeführt. Methoden wie Profiling durch KI oder Deep Learning werden dazu beitragen, dass richtig von falsch, real von unreal schwer bis unmöglich zu unterscheiden sein wird.
Dynamische Entwicklungen
Die möglichen – insbesondere finanziellen – Konsequenzen sind vielfältig und grenzenlos. Aufgabe des Risikomanagements auf Unternehmensebene ist es, sich auf die dynamische Entwicklung der CyberBedrohungslage gut vorzubereiten und rechtzeitig zu
reagieren. Als Teil der CyberverteidigungsStrategie kann zusätzlich eine maßgeschneiderte Cyberversicherung, die insbesondere aus Beratung in der Prävention, Support im Krisenmanagement sowie Übernahme der finanziellen Konsequenzen im Falle eines Cybervorfalls besteht, viel beitragen. Die Cyberbedingungswerke schließen derzeit die Gefahren im Zusammenhang mit Einsetzung der oder verursacht durch KI nicht aus. Hinsichtlich der Risikominimierung auf der Gesellschaftsebene gilt nach wie vor: Individuelles und kollektives Verantwortungsbewusstsein ist im Bereich Cybersicherheit gefragt. Im Kampf gegen Cyberrisiken steht jede:r Einzelne von uns in der Frontlinie und hat sowohl zur Prävention als auch zur Abwehr beizutragen.
Kompetente Unterstützung
Die KOBAN SÜDVERS Group bietet Beratung im Bereich Cyberrisiken und Cyberversicherungen für Unternehmen in allen Branchen an. „Die Aspekte der Risikominimierung sind vielfältig. Wir möchten unsere Kunden bestmöglich unterstützen, weshalb wir unter anderem Vorschläge für die Risikoerhebung und bewertung, Sicherheitsanalyse, Erstellung von Maßnahmenkatalogen, Steuerung in der Implementierung, Prüfung der Ergebnisse, Zertifizierung, etc. erarbeitet und exzellente KooperationsPartner in diesen Bereichen ausgesucht haben“, betont Dr. Judit Tumpek und führt weiter aus: „Das umfassende Risikomanagement abgerundet durch den vorsorglich und mit den besten Konditionen aufgesetzten Versicherungsschutz wird durch regionale Anwesenheit (damit wir besser zuhören), sowie internationale Verbindungen (damit wir besser verstehen), begleitet.“ |
Dr. Judit Tumpek
Leiterin Stabstelle Recht, Großschäden, Spezialrisiken KOBAN SÜDVERS Group GmbH judit.tumpek@kobangroup.at
mit Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer High Tech Campus Villach und Lakeside Science & Technology Park
Der High Tech Campus Villach ist ein Leuchtturmprojekt inmitten des Technologielandes Kärnten.
Im Interview mit advantage spricht Geschäftsführer Bernhard Lamprecht über die neuesten Entwicklungen am High Tech Campus Villach (HTCV).
advantage: Was ist die Vision hinter dem High Tech Campus Villach (HTCV)?
Bernhard Lamprecht: Im Zentrum der Vision des High Tech Campus Villach (HTCV) steht die Schaffung eines führenden Innovationszentrums, das sich auf die Schlüsselbereiche Mikroelektronik und Sensorik konzentriert. Eingebettet in den tpv Technologiepark Villach profitiert er somit von einem idealen Umfeld.
Der HTCV und seine Mieter stellen erstklassige Forschungs und Bildungsinfrastrukturen bereit. Dies beinhaltet modernste Laboratorien, Reinräume, Messund Prüfeinrichtungen sowie Seminarräume und Büros. Diese Infrastrukturen tragen dazu bei, Forschung und Entwicklung auf höchstem Niveau zu ermöglichen, was wiederum die Forschungstätigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Region steigert.
Ein weiterer zentraler Aspekt des HTCV ist die Schaffung eines freundlichen Umfelds für StartUps, SpinnOffs und SkaleUps. Der Campus ist mit dem eingemieteten build! Gründerzentrum Inkubator für Startups und innovative Unternehmen, indem Ressourcen, Unterstützung und Expertise bereitgestellt werden. Dieses proaktive Gründermilieu trägt dazu bei, junge Unternehmen zu fördern und bietet ihnen somit auch die Möglichkeit, zu wachsen und erfolgreich inner
halb des High Tech Campus partnerschaftlichen Austausch zu finden.
Der High Tech Campus Villach ist nicht nur Arbeitsstätte, sondern stellt als Science Park zweifellos einen innovativen Arbeits und Lebensraum dar. So zieht er nicht nur erfahrene Fachkräfte an, sondern bietet auch jungen Menschen die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Der HTCV ist eingebettet in einer einzigartigen Umgebung, die sowohl Bildungs als auch Arbeitsmöglichkeiten bereitstellt, wo aber auch im Umfeld das Freizeitangebot nicht zu kurz kommt. Auch dies ist im HTCV wichtig.
Der High Tech Campus in Villach-St. Magdalen entwickelt sich zum Hotspot für Mikroelektronik und Sensorik. © HTCV
„Der High Tech Campus Villach strebt danach, eine treibende Kraft für Innovation und Fortschritt in den Bereichen Mikroelektronik und Sensorik zu sein.“
Bernhard Lamprecht
Welcher Stellenwert kommt dem HTCV im Technologieland Kärnten zu?
Der High Tech Campus Villach strebt danach, eine treibende Kraft für Innovation und Fortschritt in den Bereichen

„Die Weiterentwicklung des HTCV ist in Planung und wir sind zuversichtlich, dass
dies die gesamte Region nachhaltig voranbringen wird.“
Bernhard Lamprecht
Mikroelektronik und Sensorik zu sein. Mit einem klaren Fokus auf erstklassiger Infrastruktur, Gründerförderung und Talententwicklung nimmt der HTCV zweifellos eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft des Technologielandes Kärnten und der Achse Villach – Klagenfurt – Graz als Area Süd ein.
Insgesamt hat es Kärnten in den letzten Jahren geschafft, sich vor allem mit seinen vielen innovativen Technologieunternehmen erstklassig zu positionieren und damit die regionale Entwicklung im Süden
Österreichs voranzutreiben. Dies unterstreicht auch die Erfolgsgeschichte beider Kärntner Science und Technologieparks, des Lakeside Parks in Klagenfurt und des High Tech Campus Villach im tpv Technologiepark Villach.
Im Zuge der Fertigstellung der zweiten Baustufe ist Österreichs größter Forschungsreinraum (SAL) entstanden.
Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Mit Juni 2022 wurde den Silicon Austria Labs (SAL) das Gebäude B02 im High Tech Campus Villach zum Ausbau übergeben. In diesem Reinraumlabor entsteht nun mit modernsten Geräten und hochqualifizierten Mitarbeiter:innen eine ideale Forschungsumgebung. Somit steht den unterschiedlichsten Unternehmen mit der SAL im High Tech Campus ein verlässlicher Partner mit Ressourcen für Forschung und Entwicklung ihrer Projekte zur Verfügung.
Im HTCV befindet sich Österreichs größter Forschungsreinraum. © SAL/H. Bauer

Welche weiteren Entwicklungsschritte sind geplant?
Der High Tech Campus ist aktuell vollständig vermietet, was seine Attraktivität als Innovationszentrum deutlich unterstreicht. Aufgrund dieser vollen Auslastung setzen wir unsere Planung weiterhin konsequent fort. Der Fokus bleibt unverändert auf einer klaren strategischen Ausrichtung, denn das ist der Mehrwert, den ein Science Park ausmacht. Diese Strategie zielt darauf ab, die Weiterentwicklung Kärntens und der Region Area Süd voranzutreiben, indem wir perfekte Rahmenbedingungen für die Ansiedelung weiterer Unternehmen bieten und damit die Vielfalt auf dem Campus erhöhen. Die Weiterentwicklung des HTCV ist in Planung und wir sind zuversichtlich, dass dies die gesamte Region nachhaltig voranbringen wird. |
Der High Tech Campus Villach steht im Eigentum der BABEG sowie der Stadt Villach. Die Geschäftsführung hat seit 2021 Mag. Bernhard Lamprecht inne. Derzeit sind neben den Silicon Austria Labs (SAL) auch das build! Gründerzentrum Kärnten und der Silicon Alps Cluster im HTCV eingemietet, wo derzeit rund 190 Mitarbeiter:innen arbeiten. Die vermietbare Fläche beträgt rund 8.000 m2 Büro-, Seminar- und Laborflächen und beinhaltet u.a. den größten Forschungsreinraum Österreichs. Das derzeitige Investitionsvolumen im HTCV liegt bei rund € 28 Mio.
High Tech Campus Villach GmbH Europastraße 12 9524 Villach T +43 4242 24800 office@hightechcampus.at www.hightechcampus.at
EXPERTENTIPP
von Mag. Andreas Schwaighofer
Notarielle Dienstleistungen können – bei Einhaltung gewisser gesetzlicher
Anforderungen – auch zur Gänze online abgewickelt werden.

Ein Bankkonto eröffnen, Nachhilfestunden nehmen, eine Versicherung abschließen oder den Energieanbieter wechseln – viele Angelegenheiten lassen sich bereits digital von zu Hause oder unterwegs erledigen. Auch die österreichischen Notar:innen sind Vorreiter im Bereich digitaler Serviceleistungen. Das digitale Dienstleistungsangebot umfasst aktuell nahezu sämtliche Bereiche der notariellen Tätigkeit. So können etwa notarielle Protokolle, wie sie zum Beispiel zur Dokumentation von Gesellschafterversammlungen errichtet werden, und auch Notariatsakte, die zur Aufnahme von Rechtserklärungen und Rechtsgeschäften dienen, online errichtet werden. Aber auch die Bestätigung der Echtheit von Unterschriften (digitalen Signaturen) kann digital erfolgen. Ausgenommen sind jedoch Testamente und sonstige letztwillige Verfügungen, deren Errichtung auf digitalem Weg nicht möglich ist.
Digitaler Notariatsakt
Soll online ein Notariatsakt errichtet oder eine Beglaubigung der Echtheit einer digitalen Signatur durchgeführt werden, muss zunächst die Identifikation des Klienten erfolgen. Grundlage dafür ist ein technisches Verfahren, bei dem im Rahmen einer Videokonferenz die Identität festgestellt wird. Sobald die zu unterfertigenden Dokumente vorbereitet sind, vereinbaren der Notar und der Klient einen Termin, um etwa den Notariatsakt aufzunehmen oder die Beglaubigung durchzuführen. Die Beteiligten sind dabei durchgehend optisch und akustisch in einer Videokonferenz miteinander verbunden; es können Fragen gestellt, der Inhalt der Urkunden besprochen und natürlich auch Anpassungen der Dokumente vorgenommen werden. Die „Unterfertigung“ erfolgt nach umfassender Belehrung und gegebenenfalls Verlesung der Urkunde, indem die qualifizierte elektronische Signatur durch den Klienten unter Aufsicht des Notars am elektronischen Dokument angebracht wird. Ebenso wie bei Papierurkunden werden digitale Dokumente danach auch vom Notar signiert. Diese digital errichteten Urkunden entfalten dieselben rechtlichen Wirkungen wie Papierurkunden.
Unterfertigen mit Handysignatur Wer bereits über eine Handysignatur verfügt, kann damit Urkunden in diesem Prozess digital „unterfertigen“. Sollte man seine Handysignatur noch nicht aktiviert haben, ist das kein Problem; im Rahmen der Videoidentifizierung wird eine qualifizierte elektronische Signatur ausgestellt.
Hybridurkunden
Seit 1. Juli 2022 wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, sogenannte Hybridurkunden zu errichten. Waren bis zu diesem Zeitpunkt entweder nur reine Papieroder Digitalurkunden möglich, kann mittlerweile eine Person elektronisch signieren und die andere Person dieselbe Urkunde auf herkömmlichen Weg händisch vor Ort unterfertigen.
Unkomplizierte Abwicklung
Durch die erfolgte Digitalisierung können Geschäfte unkompliziert abgewickelt werden, die ansonsten mitunter nur mit großem zeitlichem und finanziellem Aufwand bewerkstelligt werden konnten, etwa wenn eine Partei nicht vor Ort ist oder im Ausland lebt. Die Abwicklung eines Liegenschaftskaufs, die Übergabe des Familienbesitzes an die Kinder oder die Gründung einer GmbH – alle diese Angelegenheiten (und viele mehr) können digital bei ihrem Notar erledigt werden! Das schafft Flexibilität und spart Aufwand!
Wichtig ist: Digital wie analog steht Beratung und Unterstützung der Menschen für den Notar im Vordergrund, um maßgeschneiderte rechtliche Lösungen mit Bestand zu schaffen. |
KONTAKT
Die Kärntner Notar:innen stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: www.notar.at
Notariatskammer für Kärnten: 0463/ 51 27 97
Der Traditionsbetrieb
aus
Der DIH Süd erkundete mit Anton Ruhdorfer das digitalisierte Familienunternehmen.
Im Jahr 1924 gründete Franz Ruhdorfer in Gundersdorf bei Straßburg ein kleines Sägewerk. Die Geschichte dieses Unternehmens ist nicht nur von Tradition und Beständigkeit geprägt, sondern auch von einer bemerkenswerten Bereitschaft zur Digitalisierung und Modernisierung. Heute ist die Ruhdorfer GmbH ein international tätiges Holzhandels und Holzweiterverarbeitungsunternehmen, das einen Großhandel mit Schnittholz, Holzprodukten und Pellets betreibt und seine Waren in verschiedene Länder exportiert.
Industrie 4.0 im Fokus
Die Ruhdorfer GmbH erkannte die Bedeutung der Digitalisierung früh. Unter der Leitung von Bruno Ruhdorfer wurden Geschäftsprozesse kontinuierlich modernisiert und auf aktuelle Standards angehoben. Die Nutzung einer Branchenlösung zur digitalen Verwaltung des Warenwirtschaftssystems ist besonders bemerkenswert. Diese hat nicht nur die Anwendung für KMUs verbessert, sondern auch die Ruhdorfer GmbH trotz ländlicher Region und ohne Glasfaseranschluss auf den neuesten Stand gebracht. Ende 2020 investierte die Familie Ruhdorfer erneut in die Zukunft des Unternehmens, indem sie am Standort eine hochmoderne Anlage zur

Produktion von Konstruktionsvollholz errichtete. Diese wurde nach den Prinzipien von Industrie 4.0 geplant und konzipiert. Nahezu alle Arbeitsprozesse wurden digitalisiert. Angefangen von der Angebotsstellung mit digitalem Lagerabgleich bis hin zur digitalen Lieferscheinerstellung, werden sämtliche Schritte des Geschäftsprozesses auf digitalem Weg abgewickelt.
Optimierung der Geschäftsprozesse
Doch nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle. Durch die Digitalisierung der Produktion von Konstruktionsvollholz wird nicht nur ein transparenter Produktionsprozess gewährleistet, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, Fehler und Probleme schneller zu erkennen und zu korrigieren. Die Kommunikation über Prozesse erfolgt digital und beschleunigt somit den Informationsfluss von der Führungsebene zu den Mitarbeiter:innen. Fehlermeldungen können sogar aus der Ferne behoben werden, was zu einer effizienteren Produktion führt und den Mitarbeiter:innen eine höhere Sicherheit bietet. Zudem ermöglicht die Digitalisierung der Geschäftsprozesse einen RundumdieUhrZugriff auf Informationen und Zahlen aus der Produktion sowie eine Echtzeitverfolgung des Lagerbestands.
Die Ruhdorfer GmbH zeigt, dass der Mut zur Digitalisierung und die Bereitschaft zur Anpassung an moderne Technologien entscheidend für den Unternehmenserfolg
„Auch als KMU kann man genügend Prozesse finden, in denen die Digitalisierung einen Vorteil und eine Verbesserung für das Unternehmen bringt.“
Anton Ruhdorfer
sein können. Die Kombination aus Tradition und Innovation hat dieses Unternehmen zu einem Vorzeigebeispiel für digitale Transformation in der Holzbranche gemacht und zeigt, dass die Zukunft im Holzhandel digital ist. „Beginnen Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte, wie die Ruhdorfer GmbH. Nutzen Sie dafür die kostenlose Unterstützung des Digital Innovation Hub Süd, um Ihr Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen“, betont Martina Eckersdorfer vom DIH Süd, der weit mehr als nur eine Unterstützungsplattform für Klein und Mittelbetriebe (KMU) auf dem Weg zur Digitalisierung ist. |
KONTAKT
DIH SÜD GmbH
Tamara Olipitz
Völkermarkter Ring 21–23
9020 Klagenfurt am Wörthersee M +43 664 13 25 318
E tamara.olipitz@dih-sued.at www.dih-sued.at

Das Villacher Familienunternehmen Wiegele beging kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum als Scania-Partner.
Im Fokus der Feierlichkeiten stand neben der langjährigen Zusammenarbeit auch das Zukunftsthema Elektromobilität. Mit über 2.000 verkauften Fahrzeugen blickt Wiegele Trucks auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Scania zurück. Neben einer Nutzfahrzeugausstellung gab es zum Jubiläum, das am 15. und 16. September am Villacher Standort gefeiert wurde, auch spannende Produktpräsentationen im Bereich der EMobiltät.
„In den letzten 50 Jahren wurden über 2.000 Scania-Fahrzeuge verkauft. Wir sind einer der letzten freien Händler in Österreich.“
Hannes Wiegele
Erfolgreiche Kooperation
Ralph Schwaiger, seit 2001 Geschäftsführer von Wiegele Trucks, betont mit Stolz: „Es ist eine große Ehre das 50JahrJubiläum ausführen zu dürfen. Wir spüren großen Zuspruch auch bei den Ehrengästen, was eine Bestätigung unseres Erfolges ist.“ Für den exklusiven VIPAbend wurde die LKWWerkstatt schließlich in einen Ballsaal verwandelt. Neben zahlreichen Kunden fanden sich auch Harald Woitke, Geschäftsführer Scania Deutschland Österreich, Robert Techler, Direktor Scania Österreich, Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, WKBezirksstellenobmann Bernhard Plasounig sowie Spartenobmann Raimund Haberl ein, um dem WiegeleTeam persönlich zu gratulieren. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten von Günter Walder (Präsident Klub der Köche Kärnten), Hermann Andritsch, Bernhard Trügler und Konditormeister Josef Hassler. Die Band „Tohuwaboohu“ umrahmte den VIPAbend musikalisch.
Familienbetrieb mit tiefen Wurzeln
Das Familienunternehmen Wiegele ist in seiner Geschichte tief mit dem Handel von Nutzfahrzeugen verwurzelt. Ursprünglich wurde mit Landmaschinen und Traktoren gehandelt. Danach wurden PKWs von NSU (daraus ging in weiterer Folge das VW und AudiAutohaus hervor) und LKWs der Marke Hanomag Henschel vertrieben. 1973 übernahm man schließlich die Scania Landesvertretung für Kärnten und Osttirol. „In den letzten 50 Jahren wurden über 2.000 ScaniaFahrzeuge verkauft. Wir sind einer der letzten freien Händler in Österreich, alle anderen sind Filialen des Herstellers bzw. werkseigene Betriebe,“ bekräftigt Eigentümer Hannes Wiegele. 2026 steht bereits das nächste Jubiläum ins Haus: Das Villacher Traditionsunternehmen wird sein 140jähriges Bestehen feiern.






Nachhaltigkeit im Fokus
„Bei allem was wir machen, denken wir generationsübergreifend. Wir setzen auf Nachhaltigkeit und haben auf unseren Betrieben PhotovoltaikAnlagen mit einer Gesamtleistung von 600 kWp installiert. Wir sind auch weg von den fossilen Brennstoffen und heizen mit Hackschnitzel“, erzählt Hannes Wiegele weiter. Zudem verfügt man auch über eine 225KWSchnellladestation für ELKWs und EPKWs. „Im Schnitt finden fünf bis sechs Ladungen pro Tag statt. Es ist eine öffentliche ETankstelle, auch Außenstehende können kommen“, so Wiegele.
„Wir wollen auch weiterhin als DER Premium Scania-Partner gesehen werden. Das soll bewahrt und weiterentwickelt werden.“
Felix Wiegele
Zukunftsthema E-Mobility
Vor rund eineinhalb Jahren verkaufte Wiegele Trucks den ersten elektrischen LKW in Österreich. „Die von Scania hergestellten ElektroLKWs verfügen derzeit über eine Reichweite von rund 250 Kilometern. Die nächste Generation soll in ihrer Reichweite verdoppelt werden“, betont Hannes Wiegele. Die Neugier an EMobilität im Nutzfahrzeugsektor ist geweckt, das Thema für viele aber noch neu. Wiegele Trucks gibt Informationen an Interessierte und Kunden gerne weiter.
Die fünfte Generation
Mit Felix Wiegele ist seit Juli 2023 bereits die fünfte Generation des Familienunternehmens im Einsatz. Der 26jährige wird Wiegele Trucks in den nächsten Jahren übernehmen. „Mir ist es wichtig, dass der Kontakt zu den Mitarbeitern aber auch zu den Kunden weiterhin so gut bleibt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Mitarbeiter über 20 Jahre im Unternehmen hat. Wir wollen auch weiterhin als DER Premium ScaniaPartner gesehen werden. Das soll bewahrt und weiterentwickelt werden“, so Felix Wiegele über seine Ziele und seine Vision. „Irgendwann muss sich die eine Generation zurückziehen, damit die nächste sich entfalten kann. Denn auch unsere Kunden ändern sich mit den Generationen,“ betont Hannes Wiegele, der sich abschließend bei Ralph Schwaiger und dem gesamten Wiegele TrucksTeam für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die Organisation der Jubiläumsveranstaltung bedankt. |










Ein Event mit World-Cafe I
Gemeinsam inspirieren, gemeinsam innovieren! 28/11/23
Jetzt anmelden!

Im Oktober feierte der Kongress „Frauen in der Führung“ erfolgreiche Premiere in Kärnten.
Rund 300 Teilnehmer:innen fanden sich im Casineum Velden ein, um sich über Branchengrenzen hinweg zu vernetzen. Ziel war es nicht nur, wertvolle Informationen und Tipps rund um die Führungsposition zu bieten, sondern Frauen zu motivieren, ihr Bewusstsein zu stärken und Mut auf den Weg in die obere Führungsetage mitzugeben. Neben Inputs zu Themen wie Mindset, Führungskompetenz und Selbstbewusstsein gab es spannende Podiumsdiskussionen mit Role Models, die ihre persönlichen Karrierewege sowie die damit verbundenen Barrieren schilderten.

Die Begeisterung der Teilnehmer:innen am ersten Kongress „Frauen in der Führung“ hat Organisatorin Gabriele Stenitzer überwältigt: „Der Mix aus TOPKeynotes, Podiumsrunden mit beeindruckenden Frauen, einem unterhaltsamen Kabarettprogramm sowie der Möglichkeit zum Netzwerken und dem persönlichen Austausch haben das Publikum überzeugt. Die sehr positiven Rückmeldungen und die vielen Wünsche nach einer Fortsetzung bestätigen mich, am 9. Oktober 2024 den zweiten Kongress ,Frauen in der Führung‘ zu veranstalten. Liebe Frauen, liebe Leaderinnen: Unsere Zeit ist jetzt!“ |

Den ganzen Artikel inkl. Bildergallerie finden Sie auch online.
Sie haben eine Körper-, Sinnesbehinderung oder eine chronische Erkrankung?
ÖZIV SUPPORT Kärnten
Pers ö n l hci – hciluartreV –Kostenlos –Kontakt und Fragen
Standort Klagenfurt:
Kumpfgasse 23–25, 9020 Klagenfurt, T: +43 (0) 720 208 200
Standort Villach
Gerbergasse 32, 9500 Villach
Das Angebot ist kostenlos oeziv-kaernten.at/unser-service/coaching
Gefördert von:
SUPPORT Kärnten

Die Angebote helfen Ihnen Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Schritt für Schritt werden Sie von den Coaches und Berater:innen von SUPPORT Kärnten unterstützt.
Coaching (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben Klärung von Problemen im Berufs- und Privatleben Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung Entdecken von Talenten und Fähigkeiten
Beratung
Beratung in schwierigen Lebenssituationen
Unterstützung bei behördlichen Anträgen Begleitung bei langen Krankenständen Abklärung Ihrer Fragen zu Arbeitsrecht, Förderungen u. v. m.
Wir helfen Ihnen gerne!
mit Dr. Daniel Gradenegger, CEFA, CIIA, Vorstand Raiffeisenbank Mittelkärnten
„Der persönliche Kontakt ist entscheidend!“
Digital und regional: Raiffeisen Mittelkärnten setzt auf nachhaltige Kundenbeziehungen.
Vorstandssprecher Daniel Gradenegger spricht im Interview mit advantage über aktuelle Chancen und Herausforderungen am Bankensektor.
advantage: Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Prozesse im Bankenwesen aus?
Daniel Gradenegger: Digitalisierung nimmt nicht nur in der Beziehung zu unseren Kund:innen, sondern auch in den internen Prozessen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Sie ermöglicht uns effizientere Abläufe und eine schnellere Bearbeitung von Kundenanfragen. Gleichzeitig hilft sie uns, auf ein geändertes Kundenverhalten zu reagieren: Beinahe unser gesamtes Produkt und Dienstleistungsangebot ist in der Zwischenzeit online verfügbar und kann über die digitalen Kanäle in Anspruch genommen werden. Die zunehmende Digitalisierung stellt uns gleichzeitig jedoch auch vor große Herausforderungen in Hinblick auf Datensicherheit und Betrugsprävention und ist daher natürlich auch mit enormen Kosten verbunden.
Wie hat sich das Kundenverhalten aufgrund der Digitalisierung verändert?
Unsere Kund:innen nehmen unsere Dienstleistungen heute 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche in Anspruch. Der Trend zum elektronischen Zahlungsver
kehr ist ungebrochen und wurde durch die Pandemie zusätzlich verstärkt. Mehr als 95 % aller Transaktionen werden elektronisch abgewickelt. Gleichzeitig haben die Schaltertransaktionen in unseren Bankstellen innerhalb von fünf Jahren um mehr als 40 % abgenommen und das, obwohl wir die Öffnungszeiten in diesem Zeitraum unverändert belassen haben.
Kundennähe in einer digitalen Welt: Welchen Stellenwert nimmt die persönliche Beratung ein?
Trotz des geänderten Kundenverhaltens setzen wir auch in Zukunft auf einen wesentlichen Eckpfeiler unseres genossenschaftlichen Wertesystems: Regionalität! Auch wenn sich das Massengeschäft auf die digitalen Kanäle verlagert, sind wir davon überzeugt, dass in vielen Lebensmomenten der persönliche Kontakt in Verbindung mit Beratungsqualität und Kompetenz die entscheidenden Kriterien für eine nachhaltige KundenBankBeziehung.
Die Anforderungen unser Kund:innen werden immer spezieller und der Bankberater als Generalist hat ausgedient. Egal ob im Firmenkundengeschäft oder im Veranlagungsbereich, aber auch bei privaten Wohnraumfinanzierungen oder im Landwirtschaftsbereich ist es notwendig denKundenSpezialKnowhowundAnsprechpartner auf Augenhöhe zur Verfügung zu stellen. Durch den Zusammenschluss der

RaiffeisenBezirksbank St. VeitFeldkirchen mit der Raiffeisenbank Mittelkärnten und den Kompetenzzentren in St. Veit, Althofen und Feldkirchen haben wir die Möglichkeit unseren Kund:innen genau diesen Mehrwert zu liefern.
Was sind die aktuellen Herausforderungen?
Die raschen Zinsanhebungen der EZB führen dazu, dass sich das konjunkturelle Umfeld zunehmend eintrübt, wenngleich wir in unserem Haus aktuell noch keinen nachhaltigen Anstieg der Risikokosten beobachten. Die Liquiditätsausstattung ist in vielen Branchen nach wie vor gut, wobei die Auftragsbücher dünner werden. Natürlich haben einige Kunden mit der steigenden Zinslast zu kämpfen, die nur einen Puzzleteil im aktuellen Teuerungsumfeld darstellt. Wir versuchen bestmöglich zu helfen und individuelle Lösungen zu finden. |
Raiffeisenbank Mittelkärnten Oktoberplatz 1
9300 St. Veit an der Glan T +43 4212 5566-0 daniel.gradenegger@rbgk.raiffeisen.at
von Mag. Gerda Oborny
Die Umsatzsteuer begegnet uns tagtäglich auf Rechnungen oder Kassenbelegen und muss zusätzlich zum Wert einer Ware oder Dienstleistung bezahlt werden.

Die Umsatzsteuer ist eine vom Letztverbraucher (Konsumenten) zu zahlende Objektsteuer. Sie bezieht sich auf den Umsatz, das ist ein Leistungsaustausch mit einem Unternehmen. Sie wird von liefernden oder leistenden Geschäftsleuten einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Der Unternehmer hat die Möglichkeit, jene Umsatzsteuern, die von ihm für Vorleistungen (Eingangsrechnungen) bezahlt wurden, als sogenannte Vorsteuern von der zu entrichtenden Steuer abzuziehen. Ein Wirtschaftstreibender zahlt daher an das Finanzamt nur jene Umsatzsteuer, die für seine eigene Leistung oder den geschaffenen „Mehrwert“ entsteht.
Was unterliegt der Umsatzsteuer?
Das Umsatzsteuergesetz beschäftigt sich mit vier steuerbaren Umsatzarten. Man
unterscheidet Lieferungen und sonstige Leistungen, den Eigenverbrauch, die Einfuhr (Warenlieferungen aus dem Drittland) und den innergemeinschaftlichen Erwerb (Warenlieferungen aus einem anderen EUMitgliedsstaat).
Steuerbar sind alle Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Umsatzsteuerpflichtig sind jedoch nur Lieferungen und Leistungen jener Unternehmer, die über der Nettoumsatzgrenze von € 35.000 (Jahresumsatz) liegen und somit nicht in die Kleinunternehmerregelung fallen. Umsätze eines Kleinunternehmers gelten als unecht steuerbefreit, d. h. diese Wirtschaftstreibenden haben neben der Umsatzsteuerbefreiung auch kein Recht auf den Vorsteuerabzug. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere unecht steuerbefreite Umsätze wie z. B. ärztliche Leistungen, Bildungsleistungen bestimmter privater Schulen und anderer allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen, Leistungen von Versicherungsvertretern, Umsätze von Kur und Pflegeanstalten sowie Altersheimen und viele mehr.
Wie hoch ist die Umsatzsteuer? Kommt keine dieser Befreiungen zur Anwendung, so gibt es in Österreich drei verschiedene Steuersätze. Im Regelfall beträgt die Umsatzsteuer 20 % der Bemessungsgrundlage. Der ermäßigte Steuersatz in
Höhe von 10 % wird beispielsweise bei Lieferung von Nahrungsmitteln, Zeitungen und Zeitschriften oder bei Vermietung von Wohnungen an Privatpersonen verrechnet. Darüber hinaus gibt es einen Mehrwertsteuersatz von 13 %, dieser kommt z. B. bei der Lieferung von Pflanzen, Holz oder auch Most zur Anwendung. Die Umsatzsteuer muss vom Unternehmer auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Sofern eine Steuerbefreiung zur Anwendung kommt, hat ein entsprechender Hinweis zu erfolgen.
Fristen und Abgabetermine
Die Umsatzsteuervoranmeldung und Entrichtung einer etwaigen Zahllast müssen durch Unternehmer grundsätzlich monatlich und immer bis zum 15. des zweitfolgenden Monats erfolgen. Sofern der Vorjahresumsatz € 100.000 netto nicht überschritten hat, darf die Meldung an das Finanzamt auch quartalsmäßig erstattet werden. |
KONTAKT
Mag. Gerda Oborny
Aicher & Partner Steuerberater OG Tel. 04212/2211
g.oborny@aicher.biz
„Digital und persönlich sind
advantage: Welche Rolle spielt Digitalisierung in Ihrem Unternehmen?
Wolfgang Gratzer: Beim Thema Digitalisierung ist die Generali seit vielen Jahren Vorreiterin in der Branche. So erfolgen im Breitengeschäft bereits mehr als 98 Prozent der Anträge papierlos. Mit dem Generali Kundenportal und die Meine Generali App erhalten unsere Kund:innen die Möglichkeit, Versicherungsangelegenheiten wie Schadensmeldungen zu erledigen, Rechnungen in der Krankenversicherung online einzureichen, Polizzen einzusehen oder die eigenen Daten zu ändern – und zwar rund um die Uhr. Wir bieten aber weiterhin alle Möglichkeiten: von komplett papierlos über Hybridformen bis hin zum direkten Kontakt für alle, die keine Affinität zu neuen Technologien haben. Am Mix aus physischer und digitaler Kundennähe hält die Generali auch in Zukunft fest.
Also sind digital und persönlich kein Widerspruch?
Keineswegs. Auch wenn sich die Art der Interaktion verändert, so bleibt der menschliche Faktor in unserer digitalen Welt essenziell. Unsere Mitarbeiter:innen sind durch Maschinen nicht ersetzbar. Durch die Digitalisierung und Automatisierung bleibt mehr Zeit für persönlichen Kontakt und Beratung. Und dafür suchen wir nach wie vor Verstärkung in unseren Teams.

Ein weiteres Thema dieser Zeit ist Nachhaltigkeit. Wie steht Ihr Unternehmen dazu?
Die Generali Group hat sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet und diese fest in der Unternehmensstrategie verankert. In Österreich stellen wir zudem unsere gesamte Flotte auf EAutos um. Mit der Teilnahme am Climate Action Day zeigen wir unseren Mitarbeiter:innen, wie auch kleine Veränderungen große Wirkung schaffen. An diesem Tag wird in unseren Betriebsrestaurants nur vegetarisches und veganes Essen angeboten. Und beim Thema Nachhaltigkeit schließt sich auch der Kreis zur Digitalisierung.
Wie ist das zu verstehen?
Dank unserer Mobility App können alle Menschen in Österreich über das Handy ihren Fahrstil beobachten. Für umweltfreundliches und sicheres Fahren gibt es dann Belohnungspunkte in Form von Verlosungen und kleinen Aufmerksamkeiten wie Getränken oder Snacks an den Autobahnstationen. Davon abgesehen ist auch soziale Verantwortung ein wesentlicher Eckpfeiler der Unternehmenskultur.
Können Sie Beispiele nennen?
Wie ziehen in Graz in ein komplett ESGkonformes Gebäude. Außerdem engagieren sich Mitarbeiter:innen in ihrer Freizeit im Rahmen von The Human Safety Net
bei „younus“, einem Mentoringprogramm für Familien mit Kindern im Vorschulalter. Ich selbst habe daran auch teilgenommen.
Lehrlingsausbildung und Weiterbildung waren für die Generali immer ein wichtiges Thema. Das ist es nach wie vor. Wir bilden derzeit zehn Lehrlinge in der Steiermark, Kärnten und Osttirol aus, die bei uns sämtliche Abteilungen durchlaufen. Lehrlingscoaches und Lehrlingsbeauftragte kümmern sich um unseren Nachwuchs. Daneben gibt es verschiedene Entwicklungsprogramme in der Fort und Weiterbildung. Im Bereich des lebenslangen Lernens sind wir breit aufgestellt und sehr stolz darauf. Die TopBewertungen unserer Mitarbeiter:innen und die Auszeichnungen als TopLehrbetrieb sind ein Beweis dafür.
Aber auch bei den Makler:innen stand die Generali immer hoch im Kurs. Wie sind hier die aktuellen Bewertungen?
Die Generali hat 2023 zum siebenten Mal in Folge den Sieg bei den AssCompact Awards in der Kategorie „Bester Service für Vermittler“ erreicht und in der Sparte „Eigenheim/Haushalt“ ebenfalls ihre Führungsposition bestätigt. Podestplätze gab es auch in den Bereichen „Unfall“ und „Kranken“. Darüber freuen wir uns sehr, bestätigt es doch den Weg, den wir mit unseren Teams gehen. |
Die Inklusion im Handel und das damit verbundene Arbeitskräftepotenzial waren Thema beim Zero Project Unternehmensdialog in Kärnten.
Die Veranstaltung, eine Initiative der Essl Foundation und der autArK Soziale DienstleistungsGmbH gemeinsam mit dem Land Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten, dem AMS Kärnten sowie weiteren Partnern knüpfte heuer an aktuelle Themen des Fachkräfte und Mitarbeitermangels sowie der beruflichen Inklusion im Handel an. Als BestPracticeBeispiele mit dabei: BILLA, IKEA und die Trafik Kolmann aus Klagenfurt.
Scheuklappen abnehmen
„Inklusion ist alternativlos – in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Miteinander“, bekräftigte Kärntens Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig. Zero Project zeige, dass Dinge, die man sich als unglaublich kompliziert vorstellt, sehr gut funktionieren können. „Probiert es aus“, appellierte BILLAVertriebsdirektor Kurt Aschbacher an die Unternehmen. Er hob die soziale Verantwortung hervor, die man bei REWE Group, BILLA wahrnehme.

Bei autArK ist das NEBA Betriebsservice die erste Anlaufstelle für Unternehmen. Durch das kärntenweit kostenlose Angebot können Potenziale von Menschen mit Beeinträchtigung erkannt und für Unternehmen genutzt werden.
365 Tage gelebte Inklusion Als BestPracticeBeispiel mit dabei war auch Alina König, die seit zwei Jahren eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau in der Trafik Kolmann in Klagenfurt absolviert. Alina (21) hat Epilepsie. „Durch die Tätigkeit in der Trafik habe ich viel Selbstvertrauen gewonnen, Selbstständigkeit gelernt und eine Perspektive bekommen.“ Markus Raffer, CSRBeauftragter der Monopolverwaltung (MPV): „Derzeit sind 54 % der selbstständigen Unternehmer, die eine Trafik führen, Menschen mit einer Behinderung.“ Auch Inhaberin Astrid Kolmann ist sehr dankbar: „Damals habe ich selbst vor 22 Jahren die Chance von der MPV bekommen, diese möchte ich nun weitergeben.“ |




mit Peter Oraže, Druckerei Hermagoras/Mohorjeva Tiskarna
„Wir
In Kärntens ältester Druckerei wird persönlicher Kontakt nach wie vor großgeschrieben, wie Peter Oraˇze im Interview mit advantage betont.
Die seit 1871 bestehende Hermagoras/Mohorjeva Druckerei ist Teil des 1851 gegründeten Hermagoras Vereins. Die Bandbreite der DruckereiLeistungen ist groß. Von jeher wird großes Augenmerk auf die Qualität der Produkte gelegt.
advantage: Wodurch zeichnet sich der Traditionsbetrieb aus?
Peter Oraže: Wir sind nicht nur die älteste Druckerei in Kärnten, sondern auch die einzige Ganzbogendruckerei, die auf einem Format 70 x 100 cm drucken kann. Unser 150JahrJubiläum wollten wir bereits 2021 feiern. Aufgrund der CoronaPandemie war es damals nicht möglich. Heuer konnten wir das mit einem „Tag der offenen Tür“ am Standort in KlagenfurtViktring im Mai gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern gebührend nachholen.
Welche Rolle spielt der Faktor Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit nimmt einen hohen Stellenwert bei Hermagoras ein. Wir sind als PEFCzertifizierte Druckerei bestrebt, mit dem wertvollen Rohstoff Holz verantwortungsvoll umzugehen und diese wichtige Ressource zu schützen. Dabei geht es vor
allem um Nachvollziehbarkeit, Regionalität und eine geschlossene Wertschöpfungskette. Die Einhaltung der PEFCRichtlinien wird ständig mittels VorOrtKontrollen geprüft.
Zudem haben wir unsere letzten Investitionen so getätigt, dass wir so viel wie möglich inHouse anbieten können und den CO2Fußabdruck damit so gering wie möglich halten. Ziel ist es, dem Kunden das Bild zu vermitteln: Von der Hermagoras Druckerei bekomme ich wirklich alles aus einer Hand, ein TopGesamtpaket –von der persönlichen Beratung über die Gestaltung, bis zum Druck, Endfertigung und Qualitätskontrolle. Wir bieten eine Vielfalt an Drucksorten: von Visitenkarten, Flyern, Foldern, Broschüren über Bücher mit Hardcover, Magazine, etc.
Wie wichtig ist der persönliche Kontakt in Zeiten der Digitalisierung?
Sehr wichtig! Bei uns stehen die Menschen im Vordergrund. Wir legen viel Wert auf die persönliche Beratung und individuelle Betreuung unserer Kunden. Um flexibel auf die Kundenwünsche eingehen zu können, nehmen wir uns Zeit. Wir laden die Kunden auch ein, persönlich zu uns in die Druckerei zu kommen. Es gibt die Mög

„Wir haben unsere letzten Investitionen so getätigt, dass wir so viel wie möglich in-House anbieten können und den CO2Fußabdruck damit so gering wie möglich halten.“
Peter Oraže, leitet die Traditionsdruckerei Hermagoras/Mohorjeva seit 2020
lichkeit beim Druck mit dabei zu sein. Die Rückmeldungen sind phänomenal. Mir ist es auch wichtig zu vermitteln, wie der Arbeitsablauf ist und welche Schritte notwendig sind. Auch die persönliche Qualitätskontrolle der Produkte wird bei uns großgeschrieben. Aus meiner Sicht braucht es generell ein stärkeres Bewusstsein für heimische Qualität. Wir als Hermagoras Druckerei bieten Produkte mit sehr hoher Qualität, die durch eine regionale Wertschöpfungskette gekennzeichnet sind. |
gesammelt von Isabella Schöndorfer
„Freuen uns, Familie und Arbeit vereinbaren zu können“, betonen Edlinger und Lorenz.
© Schöndorfer

Herzensmission: Rettung der Rehkitze vor dem Mäher nimmt Fahrt auf!
Das LEADERProjekt „Rehkitzrettung Lungau“ wurde in Bad Kleinkirchheim präsentiert. Im Fokus stand die Kooperation mit Biosphärenparkmanagements, um Mähtodunfälle von Rehkitzen zu vermeiden. Im Jahr 2023 hatte der Verein 160 Einsätze und rettete 90 Rehkitze. Wegen dieses Erfolgs plant der Biosphärenpark Nockberge, das Projekt in der Nockregion einzuführen. Bei der Vorstellung wurde eine Drohnensuche demonstriert, und eine mögliche Ausweitung nach Kärnten angeregt.

Dietmar Rossmann (Biosphärenparkmanagement Kärntner Nockberge), Christine Sitter (LEADER Nockregion Oberkärnten), Julia Bogensperger (Rehkitzrettung Lungau), Petra Lüftenegger (LEADER Biosphäre Lungau), Othmar Purkrabek (Biosphärenparkmanagement Salzburger Lungau) und Michael Doppler (Rehkitzrettung Lungau) © Biosphärenpark Kärntner Nockberge

3D-Zukunftsvisionen
Das steirische Startup „chrivesolutions“ von Christian Veit spezialisiert sich auf 3DGebäudetechnikPläne und digitale Produktzwillinge für die Baubranche und öffentliche Einrichtungen. Mit einem Auge fürs Detail und BIMExpertise werden Fehler in der Planungsphase minimiert. Neben exakter Gebäudereplikation bietet das Unternehmen 3DProduktzwillinge für alles von SMARTHomeSystemen bis Einrichtungen und fasziniert mit VirtualRealityRundgängen.
© Gerhard Dornauer C & G Graphics
Holz trifft Herz: Nachhaltiger Familientreff im Krümelchen
Am 4. November eröffnet in der ehemaligen NKDFiliale in Viktring das „Krümelchen“, ein ElternKindCafé, gegründet von Carina Edlinger und ihrer Schwester, GastroProfi Natascha Lorenz. Als Treffpunkt von Eltern für Eltern gestaltet, bietet das Café auf 300 m² eine stressfreie Zone mit hochwertigem Holzspielzeug und kindgerechten Einrichtungen, darunter ein Stall, eine Bobby CarGarage und ein spezieller Partyraum für Kleinkinder. Edlinger, die bereits ein Pole DanceStudio betreibt, und Lorenz setzen auf Qualität und Sicherheit: Ein kindersicherer Eingang (FerdinandWedenigStraße), babysicherer Bereich und kindergerechte Toiletten runden das ausgeklügelte Konzept ab. Nachhaltigkeit steht im Vordergrund, wobei regionale Lieferanten zum Einsatz kommen und Portionen speziell für Kinder angeboten werden. Geplant sind auch Themenabende und ein FranchiseProgramm.
Mehr Einblicke auf Instagram:

Kuttnig GmbH bringt Behaglichkeit nach Villach
Die renommierte Kuttnig GmbH, bekannt für Design und Montage von Öfen, Bädern und Fliesen, feiert ihr 125jähriges Jubiläum mit der Eröffnung einer neuen Filiale in Villach. Erstmalig seit Gründung expandiert das in St. Veit ansässige, familiengeführte Unternehmen. Die neue Filiale, gelegen an der MariaGailerStraße, bietet auf 200 m² hochwertige Kaminöfen renommierter Hersteller. Hinter dem Schritt steht eine wachsende Nachfrage nach autarken Heizsystemen. Der Geschäftsführer Karl Nussbaumer betont die Bedeutung moderner, nachhaltiger Heizlösungen. Geöffnet ist das Studio seit September.

Wandgeschichten
Die talentierte Illustratorin Anja Grohmann bringt mit einzigartigen Wandbildern („Murals“) Unternehmensgeschichten zum Leben. Seit 2019 kreiert sie lebendige Illustrationen, die sowohl unternehmerische als auch gesellschaftliche Werte reflektieren. Mit ihren Murals verleiht Anja Geschäftsräumen in der Steiermark und darüber hinaus Individualität und Charakter, wobei jedes Kunstwerk eine Geschichte erzählt. Ihre Arbeiten wurden bereits international anerkannt und dieses Jahr auf der „Creative Night“ in Graz präsentiert.

Von der Fitness-Vision zur Gesundheitsmission
Zum dritten Jubiläum feiert die Körperschmiede in Graz ihre einzigartige Vision von Fitness. Die Spezialität? EMSTraining: In nur 15 Minuten wird der ganze Körper effektiv trainiert, ideal für jeden – vom Berufstätigen bis zum „Best Ager“. Mit einem Schwerpunkt auf persönlicher Betreuung setzt sich das Studio von der Massenbetreuung anderer Fitnessstudios ab. Die Gesundheitsmission ist klar, und 2024 steht auch wieder das innovative „Almworkout“ auf dem Programm.

Gemeinsam effizienter unterwegs!
„In naher Zukunft könnten Privatpersonen auf ihren Wegen Pakete mitnehmen“, prophezeit Hannes Jagerhofer, CEO der checkrobin GmbH. Das Unternehmen betreibt mit myrobin eine Crowdlogistikplattform, die Menschen unterwegs mit Versendern verbindet. Angesichts des Booms im ECommerceMarkt und den logistischen Herausforderungen des traditionellen Versandsystems bietet myrobin umweltfreundlichere Lösungen, die den CO2Fußabdruck reduzieren. Ein weiterer Vorteil: der Fahrtkostenzuschuss. In Zeiten hoher Spritpreise ermöglicht die Plattform erhebliche Einsparungen. © myrobin
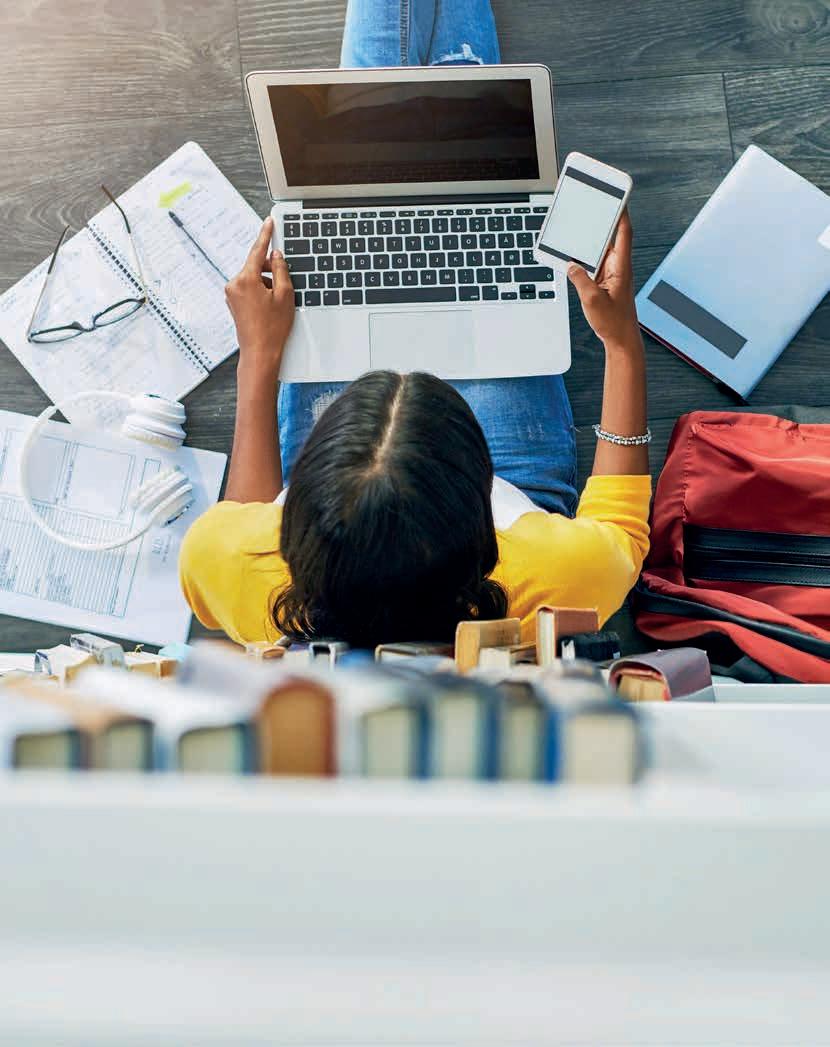
Bildung der Zukunft: Chatbots halten auch in Schulen und Universitäten Einzug und nehmen Einfluss auf die Unterrichts- und Prüfungskultur.

Mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz in der breiten Öffentlichkeit angekommen und beeinflusst auch das Bildungssystem.
Von Monika Unegg
Künstliche Intelligenz (KI) ist nichts Neues, diese Gruppe von Computeralgorithmen wird seit den 1950er Jahren erforscht. Sie hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und wird in verschiedenen Bereichen angewandt. Im Gesundheitswesen hat sie ebenso Einzug gehalten wie im Finanzwesen, in der Sprachverarbeitung sowie im Bereich Sicherheit und Überwachung. Personalisierte Produktempfehlungen werden durch KI erstellt, Autonomes Fahren funktioniert ebenfalls mit KIUnterstützung. Ohne es zu wissen, verwenden Milliarden Menschen seit Jahren KI, denn auch in der Suchmaschine Google beispielsweise legt sie fest, welche Vorschläge
ganz oben gereiht werden. In den Bereichen Kunst, Musik und Literatur wird KI zur Erzeugung von Kunstwerken, Komposition von Musik und Generierung von Texten eingesetzt.
Es gibt kein Zurück Und hier kommt ChatGPT ins Spiel, die künstliche Intelligenz in der Texterstellung. ChatGPT ist der bekannteste Chatbot, aber es gibt längst weitere. „Neuroflash“ oder „Jasper“ nennt Martin Schellrat, der unter anderem „Digital Transformation Management“ an der Fachhochschule Kärnten unterrichtet, als Beispiele. Auch Amazon steigt nun in das sich rasant entwickelnde Feld ein und hat für einen MilliardenDollarBetrag die KISchmiede „Anthropic“ erworben. An alle jene, die KI, ob bei der Textgenerierung oder in anderen Bereichen, aus Angst oder Überzeugung ablehnen: Gewöhnen Sie sich daran und machen Sie das Beste daraus. KI ist gekommen, um zu bleiben. Oder um Schellrat zu zitieren: „Wir haben keine Ahnung, wohin der Weg führt, nur eines ist klar: Es gibt kein Zurück mehr.“
Im Lehrplan verankert
Diese Meinung vertritt auch Corinna Mößlacher vom Department für
Medienpädagogik und Informationstechnologien der Pädagogischen Hochschule Kärnten Viktor Frankl Hochschule (PH Kärnten) in Klagenfurt. Studierende, auch Schüler:innen, arbeiten damit und werden es auch in Zukunft tun. „Und sie sollen es auch“, sagt sie. Sie sollen lernen, mit diesen neuen Werkzeugen umzugehen. Denn Chatbots bringen nur dann die erwünschten Ergebnisse, wenn die richtigen Fragen gestellt werden und das sei manchmal gar nicht so einfach.

Die digitale Bildung und in diesem Zusammenhang auch der Bereich KI sind im Lehrplan der PH Kärnten bereits verankert. Die Schüler:innen sollen beschreiben können, „wie künstliche Intelligenz viele Software und physische Systeme steuert“ und sie sollen erlernen, „die Grenzen und Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu reflektieren“.
ChatGPT als Schlagwort
Dabei geht es nicht oder nicht nur um ChatGPT. „Das ist ein Programm und zum Schlagwort für die neue Entwicklung geworden“, sagt Mößlacher. „Es gibt viele und es werden weitere kommen.“ In der Wissensvermittlung sowohl in der PH als auch in den Schulen gehe es darum zu ver
mitteln, wie KI funktioniere und das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man KITools nutzt. „Denn KI macht nur, was man ihr anschafft“, so Mößlacher.
Und was im Netz vorhanden ist. Und das ist auch die große Unbekannte. „Von vielen Informationen, die wir geliefert bekommen, wissen wir nicht, wer sie hineinstellt“, sagt Schellrat. Auch sollte man gut überlegen, was man über sich oder sein Unternehmen ins Internet stellt. Dabei sei es möglich, bestimmte Informationen für den Zugriff zu sperren. Sie sind dann nur auf der Website sichtbar. Das konnte man bisher auch für die GoogleSuchmaschine schon machen.
Anpassung von Prüfungen
Wer ChatGPT oder einem anderen Chatbot mit gezielten Fragen einen Text schreiben lässt, hat damit seine Aufgabe noch lange nicht erfüllt. „Dann beginnt die eigentliche Arbeit“, lacht Mößlacher. Die Inhalte müssen durch Nachrecherche überprüft werden, der Text sollte dem eigenen Stil angepasst werden. Und genau das müsse in den Bildungseinrichtungen auch vermittelt werden. Selbstständiges Denken und kritisches Hinterfragen müssten in diesem Zusammenhang gezielt eingefordert werden.
Auch Schellrat glaubt, dass kritisches Denken in Zukunft noch wichtiger wird. Die Prüfungskultur an der FH wird bereits an die neue Entwicklung angepasst. „95 Prozent der Studierenden kann mit Chatbots umgehen“, meint Schellart. Reine Literaturarbeiten werden dadurch wertlos. Daher sind jetzt nicht nur wie bisher für die Masterthesis auch für die BachelorArbeit empirische Anteile vorgeschrieben.

Voneinander lernen
Lehrkräfte werden in Zukunft damit rechnen müssen, dass sich ihre Schüler:innen auch außerhalb des Unterrichts mit Chatbots und anderen KIProgrammen beschäftigen und sie daher mit Fragen konfrontiert werden, auf die sie unter Umständen keine Antwort wissen. „Das ist aber nichts Negatives, man kann ja voneinander lernen“, beschreibt Mößlacher einen Paradigmenwechsel im Bildungssystem. Fortbildungskurse für Lehrkräfte würden laufend angeboten und man werde versuchen, stets die neuesten Entwicklungen zu berücksichtigen und die entsprechenden Lehrgänge anzupassen, so Mößlacher. Flexibilität wird gefragt sein, sagt Schellrat. Denn die Tools werden sich laufend ändern. Einige werden verschwinden, andere wieder entstehen. Und wovon niemand spricht: „KI benötigt eine enorme Rechenkapazität und das bedeutet einen ebenso enormen Energiebedarf“, erklärt Schellrat. Daher sind auch hier die Folgen nicht absehbar. |
An der Pädagogischen Hochschule beschäftigt man sich ebenfalls mit der Anpassung von Unterricht und Prüfung. Die Fragestellungen müssen konkreter werden, verschiedene Aspekte kombiniert und eigene Standpunkte eingearbeitet werden, beschreibt es Mößlacher. So könnte man KI auch bewusst zulassen und die Texte dann hinterfragen, nennt sie als Beispiel.





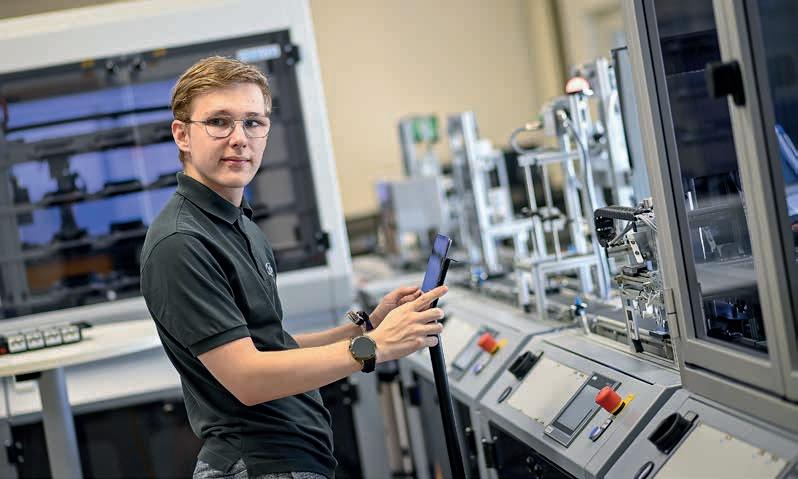
Am bfi-Standort in St. Stefan im Lavanttal wird ein praxisorientiertes Lern- und Simulationsumfeld rund um die Industrie 4.0 geboten.
Innovative Ausbildungs und Qualifizierungsmöglichkeiten entlang der gesamten Automatisierungspyramide stehen in der bfiLernfabrik in St. Stefan im Lavanttal im Fokus. Ab Herbst finden weitere wegweisende Kurse und Workshops statt, um Fachkräfte bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und die digitale Transformation in Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
Die Fabrik der Zukunft erleben
Das bfi als eine der größten Bildungseinrichtungen in Kärnten bietet ein umfangreiches Portfolio an Aus und Weiterbil

„Die Lernfabrik ist einzigartig in Kärnten.
Nicht nur am Puls der Zeit, sondern ein Stück voraus.“
Amir Mujkanovic, bfi-Experte
dungsmöglichkeiten quer durch alle Bereiche: Von der Wirtschaft und Technik, über die Persönlichkeits und Führungskräfteausbildung bis zu den Themen Pflege, Soziales und Gesundheit. Um dem Trend der Digitalisierung Rechnung zu tragen, hat man sich entschlossen knapp drei Millionen Euro in den Standort St. Stefan im Lavanttal zu investieren. „Die digitale Transformation hat sich auch in der industriellen Fertigung zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. Wir wollen in jenen Bereichen, wo wir die Kompetenzen haben, Vorreiter sein und den Unternehmen einen Mehrwert bieten. Zusätzlich


Digitalisierung und Industrie 4.0 im Fokus: Im Jahr 2022 wurde am bfi-St. Stefan eine intelligente Modellfabrik eröffnet.
zur Metall, Elektro und ITAusbildung können Mitarbeiter und Fachkräfte in der Modellfabrik in St. Stefan die Skills der Zukunft erwerben und Prozesse in Unternehmen optimieren,“ so bfiGeschäftsführer Gottfried Pototschnig, Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist groß wie nie. Vieles muss nachgelernt werden, weil sich auch die Berufsbilder verändern.
Einzigartig in Kärnten
Die Lernfabrik soll auch Bewusstsein schaffen, was alles in einer zukünftigen Fabrik möglich ist und dabei helfen das Wissen in das eigene Unternehmen zu transferieren. „Sie ist quasi wie ein Flugsimulator – hochtechnologisch mit vielen Bausteinen. Die Lernfabrik ist einzigartig in Kärnten. Nicht nur am Puls der Zeit, sondern ein Stück voraus, weil sie zusammenhängend Tools anbietet, die die meisten Unternehmen noch gar nicht haben“, betont Amir Mujkanovic, technischer Experte, der die Lernfabrik in St. Stefan mit „der kleinen Welt am Wörthersee“ vergleicht: „Ganz Kärnten geht ja ins Minimundus, um sich Modelle anzuschauen. Nach St. Stefan gehst du, um in einer Modellfabrik zu lernen, was du im eigenen Betrieb optimieren kannst.“
Neue Formate in der Lernfabrik
Der bfiStandort St. Stefan fungiert zudem als praxisorientiertes Lernumfeld und

Bauer
© Helge
„Wir wollen in jenen Bereichen, wo wir die Kompetenzen haben, Vorreiter sein und den Unternehmen einen Mehrwert bieten.“
Gottfried Pototschnig, bfi-Geschäftsführer
Zulieferer für jene Kompetenzen, die Unternehmen zukünftig benötigen. Unternehmen können auch individuelle und firmenspezifische Trainings in der Lernfabrik abhalten. Das Programm wird laufend weiterentwickelt „Wir sind quasi das Puzzlestück, das vielen Unternehmen noch fehlt, um zu erkennen, was sie für die Zukunft brauchen. Wir arbeiten u. a. daran, eine Ausbildung als ,Smart Factory Experte‘ anbieten zu können. Im Fokus wird dabei die interdisziplinäre Kompetenzerweiterung stehen“, verrät Amir Mujkanovic, technischer Experte.
Grüner, digitaler, innovativer Ab Herbst startet ein umfangreiches Kursangebot an der Lernfabrik. Ziel ist es Fachkräfte bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und die digitale Transformation in Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Im Fokus stehen dabei Themen wie „Industrie 4.0 sinnvoll einsetzen“, „Optimierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen (MES)“, „Datenqualität in der Produktion“ oder „Prozessregelegung und Prognosen mit künstlicher Intelligenz“. „Der Großteil unserer Ausbildungsinhalte und Kursangebote ist zudem bereits auf die Ziele des European Green Deals ausgerichtet. Grüner, digitaler, innovativer lautet das Motto“, betont Pototschnig abschließend. |
Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44 9020 Klagenfurt T +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at www.bfi-kaernten.at



Die „4ward Energy Research GmbH“ ist eine Forschungseinrichtung für Energietechnologien und Energiewirtschaft mit Sitz in Graz. © 4ward Energy Research GmbH

mit Johanna Ganglbauer, 4ward Energy Research GmbH
Das Grazer Unternehmen „4ward Energy“ untersucht mittels Künstlicher Intelligenz, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Windkraft hat. Von Petra Plimon
Aktuell werden rund zehn Prozent des österreichischen Stroms aus Windkraft produziert (Quelle: BMK). Das Interesse an einer professionalisierten Planung, Errichtung und Wartung von Windparks und Windturbinen steigt kontinuierlich. Die Ausstattung der Windparks mit moderner Sensorik sowie eine automatisierte Datenverarbeitung spielen dabei eine wichtige Rolle. Welchen Beitrag maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz (KI) leisten können, erklärt Johanna Ganglbauer im Interview mit advantage.
advantage: In welchem Kontext kommt KI im Bereich der Windkraft zum Einsatz?
Johanna Ganglbauer: Einerseits bei der Fehlererkennung und in der vorrausschauenden Wartung. Durch automatisierte Datenerfassung und Mustererkennung können kleine Abweichungen in der Leistungsbereitstellung der Windturbinen schnell erkannt und behoben werden. So erhöht sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Windparks. Hier kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um die Charakteristiken jeder einzelnen Turbine und jedes Standortes anhand vergangener Daten zu lernen und Abweichungen schnell und mit einer hohen Aussagekraft
zu erkennen. Außerdem können mit Hilfe von maschinellem Lernen Vorhersagen darüber getroffen werden, wann bestimmte Komponenten einer Windturbine wahrscheinlich ausfallen werden.
Andererseits auch in punkto Sensorik. Die Ausstattung von Windturbinen und Windparks mit allen notwendigen Messgeräten und Sensoren ist sehr teuer. KI kann eingesetzt werden, um die Informationen von anderen Messpunkten so gut zu kombinieren, dass einzelne Sensoren eingespart und Datenausfälle gut kompensiert werden können.
Layoutoptimierung und Fallstudien sind ein weiterer Einsatzbereich: Viele grundlegende Entscheidungen bei der Errichtung von Windparks haben langfristige Auswirkungen. So gibt es Regionen mit hohem Windpotential und Regionen mit niedrigerem Windpotential. Vor allem im Gebirge können sich die Windvoraussetzungen innerhalb weniger Meter stark ändern. Außerdem können sich Turbinen auch gegenseitig den „Wind aus den Segeln nehmen“, wenn sie ungünstig stehen. Je nach Wetterlage und Hauptwindrichtung muss hier die Lage der Turbinen zueinander genaustens untersucht werden, um ungünstige Effekte möglichst zu vermeiden. Hier kann KI zum Einsatz kommen, um viele verschiedene Möglichkeiten von

„Windkraft fasziniert mich sehr, weil die Dimensionen und die Menge an erzeugter Energie so groß sind. Ich bin überzeugt, dass der Ausbau von Windparks viel zur Erreichung der Klimaziele beitragen wird.“
Johanna Ganglbauer
Windparklayouts virtuell vorab durchzuspielen.
Worum geht es beim Projekt „AI4Wind“?
„AI4wind“ ist ein gefördertes Forschungsprojekt, das im Juli 2022 startete und insgesamt drei Jahre dauert. In Kooperation mit der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG), der Energie Steiermark, der WEB und der Burgenland Energie werden die Klimawandelauswirkungen auf die Windkraft in Österreich untersucht.
Aktuell basiert die Planung und LayoutOptimierung von Windparks auf detaillierten Windmessungen aus der Vergangenheit. Änderungen in der




„Das Projekt ,AI4wind‘ ist ein kleiner Beitrag, um die Standorte von Windparks gut zu wählen und Windkraftbetreiber im Ausbau zu unterstützen.“
Johanna Ganglbauer
Charakteristik von Wind aufgrund des Klimawandels werden noch nicht berücksichtigt, obwohl sich der Klimawandel natürlich auch auf das regionale Windpotential auswirken könnte, und sich damit auch die Eignung bestimmter Regionen für die Errichtung von Windparks verbessern oder verschlechtern würde.
Was bedeutet das konkret?
Natürlich kann niemand ganz genau sagen, wie sich der Klimawandel auf einzelne Regionen in Österreich auswirken wird, aber es gibt sogenannte globale Zirkulationsmodelle (englisch: global circulation model oder GCM) und regionale Klimamodelle (englisch: regional climate model oder RCM), die eine gute Abschätzung erlauben. So werden die Auswirkungen verschiedener CO2Emissionsszenarien auf den Temperaturanstieg in unterschiedlichen Regionen Österreichs genauestens untersucht. Bezüglich des Windes gibt es bisher sehr wenige Studien und Informationen, auch weil es ein sehr volatiles und komplexes Phänomen ist. Während sich die Temperatur im Verlauf eines Tages nur
langsam ändert, kann sich die Windgeschwindigkeit in einem Windstoß innerhalb kürzester Zeit verzehnfachen.
Um auf diesem Themengebiet trotzdem voranzukommen und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wind in Österreich zu untersuchen, kommen beim Projekt „AI4wind“ statistische Methoden und maschinelles Lernen zum Einsatz. Informationen aus der regionalen Windcharakteristik der Vergangenheit werden mit Ergebnissen aus den Klimamodellen verknüpft, um einen möglichst guten Einblick in die Auswirkungen des Klimawandels auf regionale Windcharakteristiken und Windkraftpotentiale zu erlangen. Um diese Erkenntnisse auch für Windkraftbetreiber nutzbar zu machen, werden Planungstools entwickelt, die die Auswirkungen des Klimawandels auf bestehende und zukünftige Windparks aufzeigen.
Welche weiteren Projekte werden aktuell umgesetzt bzw. sind in Planung ?
Aktuell läuft ein weiteres Forschungsprojekt „wind4future“, in dem die Klimawandelauswirkungen auf die Windkraft in Österreich im Kontext von verschiedenen Windkraftausbauszenarien untersucht werden.
Als Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien und Energiesysteme interessieren wir uns insbesondere auch für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserkraft in Österreich. Auch die Anforderungen an Gebäude und
Das Team von „4ward Energy“ (von links):
Martin Schloffer, Geschäftsführer
Martina Heidenhofer, Projektleiterin
Stefan Janisch, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Thomas Nacht, Prokurist © 4ward Energy Research GmbH
Heizsysteme werden sich ändern. Mit höheren Durchschnittstemperaturen sinken die Anforderungen an Heizungssysteme im Winter, im Gegenzug werden Klimaanlagen und Kühlsysteme wichtiger. Im Bezug auf KI leiten wir auch ein Projekt names „AI4Grids“, indem es darum geht, die Rahmenbedingungen zu erheben, die notwendig sind, um Verteilnetzbetreiber dazu zu ermächtigen genügend Sensorik in die jeweiligen Netze zu implementieren, um in weiterer Folge durch die Anwendung von Prognosen und KI die Effizienz der Netze zu steigern und Verluste zu minimieren. |
„4ward Energy Research GmbH“ ist eine 2010 gegründete Forschungseinrichtung mit Standort Graz. Johanna Ganglbauer hat Physik studiert und ist seit drei Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team rund um Alois Kraußler und Martin Schloffer tätig.
Unternehmensgegenstand: Entwicklung von Technologien, Erarbeitung von Businessmodellen, Erstellung von Konzepten und Studien, Durchführung von Simulationen sowie Know-how Transfer in den Themenfeldern Energietechnologien und Energiewirtschaft.
Weitere Informationen www.4wardenergy.at

Ein Gletscherbegräbnis als Mahnmal für den Klimawandel.
© Luca Jaenichen
Die Pasterze wird früher als gedacht ihre Zunge verlieren und damit nicht mehr Österreichs größter Gletscher sein.
Von Petra Plimon
Um eine sachliche und überparteiliche Auseinandersetzung anzustoßen, wurde Anfang September seitens „Protect Our Winters Austria“ (POW) ein symbolisches Gletscherbegräbnis in der Umgebung des Großglockners und der Pasterze organisiert. Neben einer symbolischen Beisetzung und einem Sarg aus Eis von dem aus Heiligenblut stammenden Künstler Max Seibald fand u. a. eine Prozession, geleitet von Bischofsvikar Engelbert Guggenbichler, statt.
Klimawandel ist messbar „Österreichs größter Gletscher, die Pasterze, ist ein Fieberthermometer. Er zeigt uns den rasanten globalen Temperaturanstieg durch sein Schmelzen“, betont Christian Salmhofer, Klimabündnis Kärnten. In früheren Zeiten konnte man sich Klimazusammenhänge schwer bis gar nicht erklären. Es fehlten die Messinstrumente. „In ihrer Verzweiflung fanden die Menschen oft im Aberglauben Zuflucht. Das hat sich inzwischen geändert, denn erstmals in der Menschheitsgeschichte kann mithilfe von Messinstrumenten der Zustand des Planeten analysiert werden“, so Salmhofer. Seien es die Satellitendaten oder die historischen Erkenntnisse aus den Eisbohrkernen: Sie geben uns die Möglichkeit die Auswirkun
gen der Menschheit auf dem Lebensraum Planeten Erde zu beschrieben.
Globale Zusammenhänge
Die Menschheit steht demnach vor einer Reihe schwerwiegender, langfristiger Herausforderungen, die als „globale systemische Risiken“ bezeichnet werden, wie auch Sabine Seidler, Gründerin vom Forum Anthropozän, bekräftigt: „Zur Vermeidung einer Polykrise müssen alle relevanten politischen und wirtschaftlichen Institutionen auf globaler Ebene zusammenarbeiten. Dabei spielen auch die Weltreligionen eine bedeutsame Rolle! Besonders wenn wir uns mit Klimagerechtigkeit befassen, muss dies auf Basis einer völlig neuen Weltsicht geschehen.“
Mensch und Natur im Einklang
Angekommen im Anthropozän, dem Zeitalter, in dem sich der Mensch unumkehrbar in die Erdgeschichte eingeschrieben hat, mühen sich insbesondere die christlichen Kirchen um eine Neubestimmung im Verhältnis des Menschen zur Natur. „Nicht ganz zu Unrecht wird dem Christentum der Vorwurf gemacht, durch eine missverstandene Interpretation biblischer Schöpfungserzählungen, Anteil an einer ,Komplizenschaft‘ am Raubbau der Erde zu
„Alle relevanten politischen und wirtschaftlichen Institutionen müssen auf globaler Ebene kooperieren. Und keinesfalls darf dabei auf die Weltreligionen vergessen werden!“
Sabine Seidler, Gründerin Forum Anthropozän
haben. Die Idee vom Menschen als ,Krone der Schöpfung‘ hat ihre destruktive Wirkung gezeigt“, erklärt Harald Jost, Referat für Schöpfungsverantwortung der Katholischen Kirche Kärnten.
Mutter Erde als Leitmotiv „In den letzten Jahrzehnten erinnern wir uns wieder an die Ideale eines Franz von Assisi. ,Mutter Erde‘ als Leitmotiv führt uns zur Anerkennung der Natur als Schöpfung, die uns zu einer Vision einer planetarischen Solidarität leitet“, so Jost. Denn an der Pasterze zeigt sich der dramatisch voranschreitende Klimawandel für alle augenscheinlich. „In einer ökumenischen Initiative beteiligten wir uns deshalb an einem Gletscherbegräbnis. Wir griffen dabei selbstverständlich auf kirchlichen Traditionen zurück, luden Menschen zu einer tiefer gehenden Selbstreflexion des eigenen Lebensstils ein und appellierten an die politischen Verantwortlichen verlässliche Rahmenbedingungen für effektiven Klimaschutz vorzugeben. Als Kirchen sind wir bereit gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die notwendigen Veränderungen zu unterstützen“, so Jost abschließend. |
Künstliche Intelligenz könnte künftig auch dabei unterstützen Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen. © AdobeStock
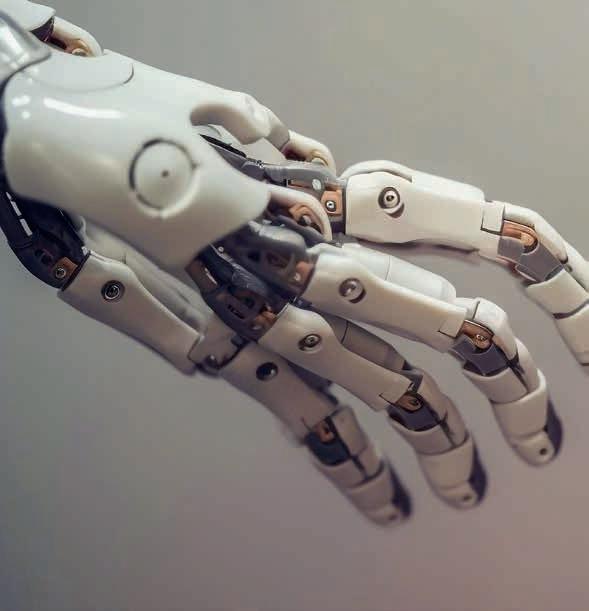

In einer Kooperation mit der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft entwickelte die JOANNEUM RESEARCH eine digitale Lösung zur Verbesserung der OP-Sicherheit.
iel ist es, Risiken bei chirurgischen Eingriffen zu minimieren, Transparenz zu gewährleisten und den administrativen Aufwand für die Mitarbeiter zu verringern. Mit der Einführung des digitalen Systems ist ein Meilenstein in der chirurgischen Sicherheit gelungen. Die Gruppe Digital Healthcare Solutions von JOANNEUM RESEARCH HEALTH forscht zudem an der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die eine frühzeitige Erkennung von Gesundheitsrisiken ermöglicht.

„Surgical Safety Checklist“
Seit 2018 entwickeln Teams der JOANNEUM RESEARCH und der KAGes gemeinsam eine digitale Lösung für die 2008 von der WHO entwickelte und auf Papier verwendete „Surgical Safety Checklist“. Diese analogen Checklisten erfordern aber einen erhöhten Zeitaufwand und bilden nicht den gesamten Prozess ab. Die neue digitale Lösung lässt sich einfach in bestehende Arbeitsabläufe integrieren, vermeidet durch automatische Datenübernahmen redundante Dokumentation, bietet eine moderne benutzerfreundliche Oberfläche, ist mobil einsetzbar und bringt für alle Beteiligten eine durchgehende Transparenz. Ein entsprechend den WHOSicherheitskriterien qualitätsgesicherter Prozess in der OPVor
„Seit September 2023 wird die digitale OP-Checkliste schrittweise in allen chirurgischen Einheiten des LKH-Univ. Klinikum Graz eingeführt und dann in weiterer Folge in allen KAGes-Einrichtungen der Steiermark verwendet.“
Dr. Franz Feichtner
bereitung kann damit optimal unterstützt werden.
Die digitale OPProzessunterstützung „OPCheck“ war gegen Ende 2022 so weit, dass sie in zwei OPBereichen pilotiert werden konnte. Das geschah im LKH Deutschlandsberg und in der Universitätsklinik für Neurochirurgie des LKHUniv. Klinikum Graz. „Wir haben nun genug Daten und Rückmeldungen, auf Basis derer wir in die Finalisierung des Produkts gehen können“, erklärt Dr. Franz Feichtner, Direktor von HEALTH, dem Institut für Biomedizinische Forschung und Technologien der JOANNEUM RESEARCH. Und weiter: „Seit September 2023 wird die digitale OPCheckliste schrittweise
Mit der Einführung eines digitalen Systems ist ein Meilenstein in der chirurgischen Sicherheit gelungen. ©
„Die ausgezeichnete Kooperation zwischen JOANNEUM RESEARCH und der KAGes zeigt, dass das Potenzial für Digitalisierung von Prozessabläufen im Krankenhaus noch lange nicht erschöpft ist.“
Dr. Franz Feichtner
Meduni Graz

in allen chirurgischen Einheiten des LKHUniv. Klinikum Graz eingeführt und in weiterer Folge in allen KAGesEinrichtungen der Steiermark verwendet. Für den Routinebetrieb wurde auch ein Wartungsund Betreuungsvertrag mit der KAGes abgeschlossen. In Zukunft wollen wir das Produkt auch anderen Krankenhäusern und deren Betreibern zugänglich machen.“
Transparentere Prozesse
„Der digitale ‚OPCheck‘ wird zur Steigerung der Sicherheit im OPProzess beitragen, bei gleichzeitiger Entlastung unserer Mitarbeiter:innen. Bereits existierende Daten werden übernommen, alle relevanten Informationen stehen allen Beteiligten jederzeit und ortsunabhängig zur Verfügung. Der gesamte OPProzess wird dadurch transparenter und entsprechend unserer LEANHospitalStrategie ‚gestreamlined‘, betont Univ.Prof. Ing. Dr. Dr. Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender der KAGes.
Software als Medizinprodukt
Zuständig für die Produktentwicklung ist die Forschungsgruppe Digital Healthcare Solutions. Das dynamische Team ist spezi
alisiert auf die Entwicklung und klinische Validierung von IKTbasierten Systemen zur medizinischen Entscheidungs und Arbeitsprozessunterstützung. „Die ausgezeichnete Kooperation zwischen JOANNEUM RESEARCH und der KAGes zeigt, dass das Potenzial für Digitalisierung von Prozessabläufen im Krankenhaus noch lange nicht erschöpft ist. Unsere Ziele sind ein erleichterter Datenaustausch, eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit und Unterstützung, beziehungsweise das Empowerment systemrelevanter Berufsgruppen“, betont Feichtner.
Frühzeitige Risikoerkennung
Die Gruppe „Digital Health Care“ forscht zudem mit Krankenhausbetreibern und Unternehmenspartnern an der Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz (KI), die eine frühzeitige Erkennung von Gesundheitsrisiken ermöglicht. Konkret konzentriert sich das Team dabei auf die Behandlung älterer Menschen. Das stellt im Krankenhaus nämlich oft eine Herausforderung dar. Mit dem Alter werden Menschen naturgemäß gebrechlicher und die Wahrscheinlichkeit, einfach oder mehrfach zu erkranken, steigt. Die medizinische Behandlung ist somit meist komplex, da viele verschiedene Dinge berücksichtigt werden müssen. Dabei können zahlreiche Risiken übersehen werden. Das kann beispielsweise eine Sturzneigung, das Vorhandensein eines Deliriums (Verwirrtheitszustand) oder eine Schluckstörung sein. Ein zu spätes Erkennen dieser Faktoren
kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen und somit weitreichende Folgen für die Betroffenen mit sich bringen. Um hier eine echte Verbesserung für Patienten aber auch für das medizinische Personal im Behandlungsverlauf zu schaffen, ist es notwendig, mögliche Risiken im Blick zu haben, bevor sie zu einer realen Bedrohung werden. Und genau hier hilft die KI: Sie behält den Überblick, indem sie Risikopotenziale frühzeitig erkennt und warnt. Medizinisches Fachpersonal kann dann rechtzeitig präventive und therapeutische Maßnahmen einleiten, um mögliche Komplikationen zu verhindern.
Gesundheitsdaten und KI
Natürlich kann auch KI das nicht einfach so – sie muss gezielt für ihre Aufgabe trainiert werden. Dazu werden elektronische Gesundheitsdaten genutzt, mit welchen die KI übt und dabei lernt, selbstständig RisikoMuster in Daten erkennen zu können. Die Digitalisierung bietet großen Chancen für Verbesserungen in so gut wie jedem Lebensbereich – so auch ganz besonders im Gesundheitswesen. „Das Sammeln von Daten aller Art ist hierbei das Herzstück, denn Gesundheitsdaten spiegeln einen enormen Erfahrungsschatz wider, den wir Menschen ohne die Hilfe von KI gar nicht mehr bewältigen könnten. Aber gemeinsam mit KI können wir sehr viel aus diesen Daten lernen und so die medizinische Versorgung nachhaltig verbessern“, so Feichtner abschließend. |
Mit 28. Juni 2025 tritt das neue Bundesgesetz über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BaFG) in Kraft.
Damit wird der sogenannte „European Accessibility Act“ von 2019 in Österreich umgesetzt. Zahlreiche Produkte und Dienstleistungen mit Digitalisierungsbezug müssen künftig durchgängig barrierefrei sein, damit sie am EUBinnenmarkt bereitgestellt werden dürfen und die Produkte eine CEKennzeichnung erhalten.
Im Fokus des neuen Gesetzes stehen kurz zusammengefasst die Bereiche rund um Computer und Smartphone, Zahlungsterminals, Geld und Fahrkartenautomaten etc., Bankdienstleistungen, bestimmte Dienste im Personenverkehr, OnlineShops, Elektronische Kommunikationsdienste (Sprach/Videotelefonie, OnlineMessenger
dienste), Apps und Webseiten audiovisueller Medien. Für Kleinstunternehmen sieht das Gesetz zur Vermeidung eines unzumutbaren Aufwandes Erleichterungen vor. Erwartet wird, dass durch die EUweite Harmonisierung der Anforderungen Angebot und Nachfrage steigen und barrierefreie Produkte und Dienstleistungen künftig kostengünstiger zur Verfügung stehen werden. Profitieren werden vor allem Menschen mit Seh oder Hörbehinderungen, aber auch Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wem das neue Gesetz Kopfzerbrechen bereitet, der könnte vielleicht mental den Ausdruck „barrierefrei“ durch „kundenfreundlich“ ersetzen. Denn es liegt im ureigensten Interesse jedes Unterneh

mens, dass alle potentiellen Kunden Zugang zu den Angeboten haben und die Dienstleistungen nutzen können. Wer das nutzerfreundlichste Angebot hat, hat die Nase vorn.
Professionelle Beratung bietet das Team von ÖZIV ACCESS. |
ÖZIV Kärnten
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23–25
9500 Villach, Khevenhüllergasse/ Gerbergasse 32 buero@oeziv-kaernten.at www.oeziv-kaernten.at

Sabrina Primus, Kundenbetreuerin Kärnten

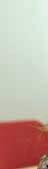











Sie wollen mehr erfahren? App downloaden und Video ansehen!

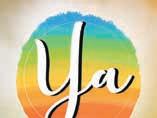


Emotionale Intelligenz wird im Zeitalter der Digitalisierung zum Schlüsselfaktor. © Adobe Stock



Warum neben künstlicher Intelligenz dringend Platz für Menschlichkeit bleiben muss. Von Petra Plimon
Die Digitalisierung mit ihrer Vielzahl an innovativen Technologien wirkt als Treiber für eine Transformation, die alle Lebensbereiche durchdringt. Aktuell ist es insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), der in aller Munde ist.
Platz für „das Echte“
Um die Zukunft mit ChatGPT und Co. zu entdecken und von KI zu profitieren, gibt es mittlerweile zahlreiche Tools, Programme und Angebote. Im selben Atemzug tun sich aber auch einige Fragezeichen auf: Wieviel Platz bleibt noch für „das Echte“? Ist es vielleicht sogar die emotionale Intelligenz, die in unserer Arbeits und Lebenswelt in Zeiten wie diesen vielfach fehlt? Was können wir tun, damit das Menschliche –das „HERZliche“ – nicht auf der Strecke bleibt? Der Versuch einer Annäherung.
Respektvolles MITeinander
Emotionale Intelligenz ist ein Begriff, der u. a. von Daniel Goleman in den 1990er Jahren aufgegriffen wurde. Goleman definierte dazu ein Bündel an zwischenmenschlichen Fähigkeiten (siehe InfoBox). Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz sind demnach in der Lage, eigene und fremde Gefühle gut wahrnehmen und einschätzen zu können. Sie verfügen auch über die Fähigkeit, ihre Gefühle so zu steuern, dass diese angemessen und effektiv ausgedrückt werden. Soziale Kompetenzen spielen eine wesentliche Rolle: In Beziehungen zu denken und sein Gegenüber respektvoll zu behandeln sind dabei essentiell. Laut Goleman ist emotionale Intelligenz eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg am Arbeitsplatz.
Wege zum WIR
Das Positive gleich vorweg: Emotionale Intelligenz ist quasi „erlernbar“. Die Entwicklung von sozialemotionalen Fähigkeiten ist ein lebenslanger Prozess, der auf Herzensbildung beruht. Er beginnt mit einer
„gesunden“ Beziehung zu sich selbst. Soll heißen: Eine realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit, das Erkennen und Verstehen der eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Motive und Ziele, aber auch ein Bewusstsein über die persönlichen Stärken und Schwächen zu entwickeln. Gleichermaßen bedeutsam ist es, „gesunde“ Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und diese dauerhaft aufrecht zu erhalten.
„Wohin du auch gehst, gehe mit deinem ganzen Herzen!“
Konfuzius
Hilfreich dabei: (wieder) lernen facetoface miteinander zu kommunizieren und seine Kritikfähigkeit zu verbessern. Die wohl größte Herausforderung dabei ist, dass die Entwicklung von sozialemotionalen Fähigkeiten eine innere Bereitschaft voraussetzt. Fazit: Es braucht die persönliche, unmittelbare menschliche Erfahrung. KI stößt hier an seine Grenzen. Emotionale Intelligenz wird immer mehr zum Schlüsselfaktor – in Wirtschaft und Leben. Ohne Werte keine Zukunft!
Quelle „EQ. Emotionale Intelligenz“ von Goleman, D.
Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz
• Selbstwahrnehmung: Eigene Gefühle bewusst wahrnehmen
• Selbstregulierung: Impulse aus eigenen Emotionen kontrollieren
• Empathie: Gefühle anderer Menschen wahrnehmen und verstehen
• Motivation: Bereitschaft, erforderliche Handlungen umzusetzen
• Soziale Kompetenz: Sich als Teil eines Systems sehen und sich respektvoll verhalten


Entschleunigung durch Naturerfahrung liegt nicht nur im Trend, sondern macht auch Sinn. Von Petra Plimon
Ein Spaziergang im Grünen gepaart mit dem bewussten Verzicht auf Smartphone und Co. steigert die Lebensqualität. Gerade der Wald hat zu jeder Jahreszeit einen besonderen Reiz.
Der Wald als Kraftquelle
Neben seiner Nutz und Schutzfunktion dient der Wald für viele Menschen vor allem als Erholungsort, er ist eine wichtige Kraft und Energiequelle. Die positive Wirkung von Waldbaden ist mittlerweile in aller Munde. Der Begriff, der zum Modewort avancierte,
„Frieden findet man nur in den Wäldern.“
Zitat von Michelangelo
beschreibt das Eintauchen in die Natur, die Stille und Idylle des Waldes sowie das bewusste Wahrnehmen seiner belebenden Wirkung mit dem Ziel der (Selbst) heilung. Es sind Fähigkeiten, die viele Menschen im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung und Konsumorientierung „verlernt“ haben und Stück für Stück beginnen wieder zu entdecken.
Bewusst o�ine gehen
Denn ununterbrochenes OnlineSein bringt auch enormes Stresspotenzial mit sich und signalisiert der Außenwelt stets erreichbar bzw. auf Abruf bereit zu sein. Zeitspannen zu fixieren, in denen auf die Nutzung von Smartphone und Co. gänzlich verzichtet wird, sind demnach immer wichtiger. Bewusstes offline gehen impliziert nämlich weit mehr als einen

bloßen technischen Zustand. Das temporäre Abstandnehmen von der virtuellen Welt – mittlerweile bekannt unter dem Begriff „Digital Detox“ – trägt auch zu einem bewussteren Umgang mit Technologien bei und wirkt sich positiv auf Produktivität und Wohlbefinden aus.
Stress abbauen in der Natur Regelmäßige Spaziergänge durch den Wald in Kombination mit SmartphonePausen wirken sich demnach förderlich aus. Waldluft enthält Stoffe, mit denen Pflanzen untereinander Botschaften austauschen und kommunizieren. Die sogenannten bioaktiven Terpene stärken außerdem das menschliche Immunsystem und sollen sogar antikrebswirksam sein. Aufenthalte und Spaziergänge ohne elektronische Endgeräte in der Natur führen zu einer Verbesserung der Konzentration, Lernfähigkeit und der Wahrnehmung und wirken stressmindernd, weil das menschliche Gehirn sozusagen in seinen Ursprungsmodus verfällt und sich leichter erholt.
Quelle „Digital Detox im Arbeitsleben“ von Welledits, V. / Schmidkonz, C./ Kraft, P.

© Plimon


Die nächste Ausgabe von YAvida – Ja zum Leben! erscheint im Dezember gemeinsam mit dem advantage Wirtschaftsmagazin!



GLOSSE
von Hans Lach
„Die
Ende August 2023 trat das EU-weite Zensurgesetz DSA (Digital Services Act) in Kraft. Die medialen Plattformen müssen künftig härter gegen „Hassrede“ und„Desinformation“ vorgehen. Weder Politik noch Medien äußern sich zu dieser Bevormundung kritisch.
Die zahlreichen mehr oder weniger künstlich erzeugten Krisen der letzten (und wahrscheinlich auch der künftigen) Jahre sind Erscheinungsbilder, die sich gegen das eigenverantwortliche Denkvermögen richten und unsere Individualität sowie Kreativität massiv einschränken. Dieser Indoktrinationsprozess ist darauf ausgelegt, dass die Menschen ein neues „Betriebssystem“ akzeptieren, welches sie ihrem Naturell entsprechend grundsätzlich ablehnen würden. Die These, es handelt sich um einen stillen Krieg gegen das Denkvermögen, ist nicht von der Hand zu weisen. Stichwort Great Reset. Ende August 2023 ist mit dem „Digital Services Act“ (DSA) in der EU ein neues Gesetz in Kraft getreten. Die großen medialen Plattformen sind demnach verpflichtet, künftig härter gegen „Desinformation“ vorzugehen. Allerdings sind die vorgegebenen Einschränkungen weder exakt definiert, unabhängig festgelegt noch transparent nachvollziehbar. Eine übernational politisch besetzte Organisation bestimmt, wie die Nutzer „geschützt“ werden müssen. Eine kleine Kaste erdreißt sich, zu bestimmen, wer zu welchen Informationen Zugang hat. Kritische Stimmen sind weder von der Politik noch von den MainstreamMedien zu vernehmen. Die Statistenrolle der Politiker wird immer mehr sichtbar. Egal, welcher Partei sie angehören.
Die Rolle von Obrigkeit und Untertan gegenüber absolutistischen Standardannahmen wurde längst ins Gegenteil verkehrt. Die Begrifflichkeit „demokratische Werte“ wird über die medialen Leierkästen rund um die Uhr gesendet. Es ist kaum möglich, sich der Gehirnwäsche zu entziehen. Um es deutlich zu sagen: Der Betrug des Volkes ist ein Betrug am Souverän, was abzulehnen ist.
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, war die Dichterin Ingeborg Bachmann (1926–1973) überzeugt. Aber ist sie das wirklich? Gerade in der Zeit, in
der wir leben? Die „Beruhigungspille“, die wir uns einwerfen, lautet: Bis hierher ging es noch gut! „Der Mensch ändert sich meist nur dann, wenn er Schmerz erleidet. So wird er für die Erfahrung empfindlicher und insbesondere für die Wahrheit“, schrieb Bachmann in einem Aufsatz aus dem Jahre 1959. Noch ist der Anteil von jenen Menschen groß, die alles glauben, was der in Zukunft mit Zwangsmitteln finanzierte ORF berichtet oder die mit InseratenKampagnen angefütterten Massenmedien den Konsumenten aufdrängen bzw. was die Politiker so von sich geben.
Ein Blick in die nahe Vergangenheit zeigt jedoch deutlich, dass es nicht um Information, sondern um Propaganda gegangen ist bzw. geht. Alle – ausnahmslos alle – Politiker hatten und haben eine Einheitsmeinung. Wahlen ändern nichts. Denn würden Wahlen etwas ändern, wären sie verboten. In Zeiten wie diesen ist es nicht leicht, eine Meinung zu haben, die nicht dem MassenNarrativ entspricht. Im Netz tummeln sich Tausende sogenannte „CyberKrieger“, die „Meinungen“– ausgeschildert als Wahrheit – verbreiten.

Unser mentales Immunsystem steht im Fadenkreuz der Angriffe, die derzeit gegen die Menschen geführt werden. Der Prozess der Indoktrination ist heimtückisch.
Das Zitat „Propaganda ist überall um uns herum und sie verändert unser mentales Bild“, wird dem Vater der modernen Propaganda, Edwar Bernays zugeschrieben. Edward Louis Bernays (1891–1995) gilt als einer der Begründer der von ihm später in Public Relations umbenannten modernen Theorie der Propaganda. In seinem Buch „Propaganda“ legt der FreudNeffe freimütig dar, wie sich über den gezielten Zugriff auf das Unbewusste Waren verkaufen oder gesellschaftlich unpopuläre Maßnahmen durchsetzen lassen. |
ZUR PERSON HANS LACH Autor und Verleger office@alpenadria-verlag.at





„Seeimmobilien in Kärnten werden mehr und mehr interessant. Die Menschen erkennen diese Besonderheit, denn Leben am Wasser ist beruhigend und entspannt.“
Immobilienexperte Alexander Tischler
Alexander Tischler und sein Team stehen seit mehr als 50 Jahren beratend zur Seite, wenn es darum geht einzigartige Wohnträume zu erfüllen.
„Seeimmobilien in Kärnten werden mehr und mehr interessant. Die Menschen erkennen diese Besonderheit, denn Leben am Wasser ist beruhigend und entspannt,“ betont Tischler.
Nachhaltiges Wohnen im Fokus
Ein rundum Wohlfühlerlebnis vermitteln etwa die Wohnanlagen „The Lakes“ in Steindorf am Ossiacher See, Pörtschach am Wörthersee sowie am Faaker See aber auch „Cloud P“, ein weiteres Neubauprojekt, welches am Faaker See im Entstehen ist. Bei diesen exklusiven Objekten wird nicht nur auf modernes Ambiente gesetzt, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Demnach überzeugen die Wohnanlagen auch mit der Integration von energieeffizienten

„Das Leben am Wasser bietet
Mit exklusiven Wohnprojekten wie „The Lakes“ und „Cloud P“ sorgt ATV Immobilien für ein unvergleichliches Wohnerlebnis rund um die Kärntner Seen.
Technologien, wie etwa mit modernen Heizsystemen sowie PhotovoltaikAnlagen und Klimageräten am Dach. Der atemberaubende Blick auf die Kärntner Seen und die umliegende Natur runden das Wohnerlebnis ab. Die Wohnanlagen verfügen zumeist auch über einen beheizten Pool, große Terrassen sowie Tiefgaragen und Carportstellplätze.
Einzigartiges Wohnerlebnis
ATV Immobilien vermittelt mehr als nur Wohnraum, es geht um das Lebensgefühl.
Das Neubauprojekt „Cloud P“ überzeugt etwa mit modernen GlasFassaden sowie einem eigenen Badestrand am Faaker See. Beim geplanten Wohnbauprojekt von Architekt Peter Pichler sind gerade 20 große Wohnungen, verteilt auf drei Villen, im Entstehen. Wer eines dieser begehrten Objekte in Zukunft erwerben möchte, darf neben Exklusivität und Privatsphäre ebenso eine einmalige Aussicht auf den südlichsten See Kärntens sowie einen Swimmingpool, welcher ein rundum Baderlebnis am Standort ermöglicht, erwarten.
Komfort und Privatsphäre
Das Seepenthaus „The Lakes“ am Ossiacher See ermöglicht einen luxuriösen Lebensstil in vollkommener Privatsphäre. Mit moder
ner Ausstattung und einem eigenen Privatstrand ist dies der perfekte Ort für Menschen, die etwas Besonderes suchen. In der knapp 110 Quadratmeter großen Seewohnung warten neben einer großzügigen Raumaufteilung auch wunderbare Sonnenuntergänge auf der Seeterrasse, um die Tage in Ruhe und mit atemberaubender Aussicht ausklingen lassen zu können.
Kärnten als Top-Lebensstandort
Die Wohnanlagen „The Lakes“ und „Cloud P“ sind der perfekte Ort für alle, die Ruhe und Entspannung gepaart mit einem einzigartigen Wohnerlebnis suchen.
„Kärnten überzeugt zudem mit stabilem Wetter und einer verlängerten Badesaison,“ so Tischler. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Erreichbarkeit der Städte Villach und Klagenfurt. Ein Besuch der Wohnanlagen wird schnell zeigen: Hier wird der Traum von einem ruhigen und entspannten Leben am Wasser Wirklichkeit. |
KONTAKT
ATV-Immobilien GmbH
Mag. Alexander Tischler www.atv-immobilien.at
T: +43 4248 3002
E: office@atv-immobilien.at

seelage.at

The Lakes am Faaker See Seewohnungen von 45 - 80 m² Wfl. zzgl. großen Seeterrassen, sind in Kürze bezugsfertig. KP.a.A.
#Seewohnungen #Faaker See #Kärnten #Sommer2023







Tel. +43 4248 3002 office@atv-immobilien.at atv-immobilien.at @seelage

am Wörthersee, Seeresort Bellevue. KP a.A.
Als Spezialist für Seeimmobilien seit 1971 informieren und beraten wir Sie gerne über sehr interessante Gelegenheiten am See. Hier ein Teil aus unserem aktuellen Angebot an Kärntens Seen:
• Wörthersee: Einmalige Seeliegenschaft in Pörtschach mit ca 2.900 m², 200 m² Wfl, 2x Bootshaus. KP a.A.
• Wörthersee: Faszinierende Seewohnung in den „Bellevue Residenzen“ mit 2 Zimmer und großer Seeterrasse ... KP a. A.
• Wörthersee: Großzügiger Seelogenplatz in Velden „Marina Village“ mit Privatstrand + Bootsplatzoption. KP € 2,47 Mio.
• Ossiacher See: Romantisches Seehaus mit ca. 800 m² Seegrund, 220 m² Wfl., breites Ufer, Steg. KP a.A.
• Ossiacher See: Außergewöhnl. Seeliegenschaft, 5.000 m², mit Bootshaus, für touristische Vermietung. KP € 10 Mio
• Faaker See: Cloud P, Seeresort mit Großresidenzen in 3 Villen, Pool & Seezugang mit Badehaus. KP a.A.
Ossiacher See, Seehaus

See, Cloud P

Wörthersee, Seelogenplatz „Marina Village“


#THINKABOUT
von Iris Straßer
Es ist an der Zeit, sich hinsichtlich E, S und G kundig zu machen. Damit Sie später sagen können: Die Mühe hat sich ausgezahlt, der Einsatz hat sich gelohnt.

Wen das Thema ESG* und Nachhaltigkeit umtreibt, hält aktuell Ausschau nach einschlägigen Fachveranstaltungen. Allein letzte Woche habe ich sieben Stunden in solchen Sessions verbracht. Die großen Beratungsgesellschaften übertreffen einander gerade mit ESGFrühstückswochen und Deep Dives Sessions, Wirtschaftsprüfer erklären Bedeutung und Umfang künftiger Nachhaltigkeitsberichtspflichten für große Unternehmen, erläutern die Taxonomieverordnung, die regelt, was grüne Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU sind. Schließlich soll nicht nur das politische Ziel der Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität gelingen, sondern auch die künftige erweiterte Wirtschaftsprüfung.
In fünf Vorträgen wurde ebenso oft gebeten: „Stimmen Sie ab, wie gut Sie über die neuen Regelungen Bescheid wissen.“ Fünf Mal dasselbe Ergebnis: Die Mehrheit weiß noch nicht oder kaum Bescheid.
Und auch jene, die bereits wissen, was hinsichtlich ESGReporting erwartet wird, haben das Gefühl, noch viel zu wenig zu wissen hinsichtlich der Qualität der bisherigen Umsetzung und dessen, was noch folgen wird.
Wissen Sie Bescheid... was Ihre Bank künftig von Ihnen an Nachhaltigkeitsinformationen benötigen wird? Suchen Sie bei nächster Gelegenheit das Gespräch und fragen Sie nach, was künftig an Anforderungen auf Sie zukommt, wenn Sie beispielsweise Investitionen planen. wo Sie nachblättern können, wenn Ihnen klimakritische Geister im Unternehmen erklären, das Thema der Dekarbonisierung sei für Ihr Unternehmen nicht relevant? Für jene, die viel wissen möchten, lohnt sich etwa ein Blick auf klimafakten.de wer in Ihrem Unternehmen eingebunden sein wird, um Nachhaltigkeitsmanagement organisatorisch richtig aufzusetzen? Und welche Kollegin und welcher Kollege offen ist für das Thema, wer mitgestalten möchte? Denn die betriebliche Umsetzung setzt mehrerlei voraus: Commitment, organisatorische Verankerung, Systematik und Motivation.
ZUR PERSON
IRIS STRASSER leitet Verantwortung zeigen!, ein Unternehmensnetzwerk für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft und lehrt Nachhaltigkeit und CSR an mehreren Hochschulen. Sie erreichen die Autorin unter iris.strasser@ verantwortungzeigen.at
Kommt daher im Moment die Frage auf: Wissen Sie Bescheid? Dann lautet die Antwort meist „nein“. Ein interessanter Befund, der einem selbstverantwortlichen wirtschaftlichen Vorgehen und zukunftsgerichteten unternehmerischen Handeln nicht genügen kann.
Unwissenheit schützt vor Schaden nicht Sind solche Themen für Ihr Unternehmen künftig gesetzlich verpflichtend? Machen Sie sich rasch kundig. Sprechen Sie mit dem Wirtschaftsprüfer, lesen Sie Fachartikel zur Corporate Sustainability Reporting Directive. Tauschen Sie sich überbetrieblich zu den Anforderungen aus. Damit Sie bald Bescheid wissen. Aber Achtung: Auch wenn Sie nicht regulatorisch verpflichtet sind, sind die Themen relevant.
Wissen Sie auch Bescheid... was junge Menschen über Unternehmen denken, die in ‚nichtnachhaltigen‘ Branchen tätig sind und „business as usual“ betreiben? Das weiß ich, ich frage es jedes Mal die Studierenden in den Lehrveranstaltungen, die ich zum Thema Nachhaltigkeit geben darf. Sie schätzen solche Betriebe immer nicht, weil Sicherheit, Perspektive und Sinn gefragt sind.
Wissen Sie nicht zuletzt, was Sie antworten werden, wenn Sie in zwanzig Jahren gefragt werden, welchen Teil Sie in Ihrer Position geleistet haben, um unsere Welt in eine gute Zukunft zu bekommen? Hoffentlich können Sie sich dann zufrieden zurücklehnen und sagen: Wir waren bei der Transformation hautnah dabei. Die Mühe hat sich ausgezahlt, der Einsatz hat sich gelohnt. |
*ESG = Environmental – Social – Governance
INTERVIEW
mit VDir. Johannes Jelenik, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kärnten eG
Vermögen
– Infl ation schlagen – die Volksbank Kärnten eG zeigt’, wo’s drauf ankommt
Wer finanziell die Inflation ausgleichen oder eine höhere Rendite erzielen möchte, braucht heute mehr als ein Sparbuch. Das weiß VDir. Johannes Jelenik, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kärnten eG.
Der Finanzmarkt ist in stetiger Bewegung. Wieso ist es für Kund:innen der Volksbank Kärnten dennoch wichtig, mehr als nur ein Sparbuch zu besitzen?
Johannes Jelenik: Die Märkte können zwar kurzfristig volatil sein, die Rückblicke zeigen aber, dass auf lange Sicht Aktien immer zugelegt haben. Die Zinsen auf Spareinlagen sind wieder zurück, aber um der hohen Infl ation entgegenzuwirken, sind auch Geldanlagen in Aktien und Fonds sinnvoll. Eine Diversifi kation in den Anlagen ist der Schlüssel zu einem sichereren und ertragreicheren Investment.
Wie kommt man bei der Volksbank Kärnten zur passenden Anlagestrategie?
Am einfachsten geht das mit unseren Berater:innen. Sie nehmen sich die Zeit, die Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft der Kund:innen zu verstehen und daraus die Anlagestrategie, mit den passenden Produkten, zu entwickeln.
Sie bieten seit heuer eine eigene Vermögensverwaltung an. Wo liegen die Vorteile für die Kund:innen? Als regionale Bank ist es uns nun möglich die weltweit besten Produkte in unser Portfolio zu nehmen. Investmentspezialisten beobachten und





beurteilen täglich das Geschehen der Finanzmärkte. Unsere Kund:innen profi tieren von dieser Expertise und können ihre Zeit für andere wichtige Dinge nutzen. Eine professionelle Vermögensverwaltung ermöglicht einen realen Kapitalerhalt und langfristigen Kapitalzuwachs durch Zinserträge und Kapitalgewinne. Entsprechend der Risiko- und Ertragsneigung stehen unseren Kund:innen ab einer Anlagesumme von 100.000 Euro drei unterschiedliche strategische Konzepte zur Verfügung.
Stichwort „Nachhaltige Veranlagung“. Mehr als ein Trend?
Bei nachhaltigkeitsorientierten Veranlagungen wird nach klaren Regeln investiert, die ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichti-
gen. So bieten zum Beispiel eine Vielzahl nachhaltiger Fonds der Union Investment Austria Zugang zu zukunftsfähigen Investmentthemen, wie erneuerbarer Energien, Gesundheit, Digitalisierung, fairer Handel, Bildung, Recycling und vielem mehr. Rendite und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Es kommt schlicht darauf an, welche Produkte Sie kaufen. |
KONTAKT
Volksbank Kärnten eG Pernhartgasse 7 9020 Klagenfurt am Wörthersee T +43 (0) 5 09 09-0 info@vbktn.at volksbank-kaernten.at


„Achtsamkeit
und Nachhaltigkeit spielt gerade im eine große Rolle. Unseren Familienbetrieb haben Hausbank - mit dem Bau einer PV-Anlage nahezu
Mag. Carlo Egger und Siegfried Egger hagebau EGGER GmbH | Feldkirchen
Volksbank. Vertrauen verbindet.

Investieren auch Sie mit uns in das Wachstum Ihres Unternehmens.
im Bau- und Gartenfachmarkt haben wir, unterstützt durch unsere nahezu energieautark gemacht.“
Erfolg fängt an, wo man vertraut.


T: 05 09 09
volksbank-kaernten.at