

JEDEN SCHNEE.
JEDE ANWENDUNG.



JEDE ANWENDUNG.
BESUCHEN SIE UNS AM DEMOPARK IN EISENACH STAND: D-415

Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik


Mehr Raum für Leistung
Gesteigerter Arbeitskomfort mit neuer, großzügiger Fahrerkabine und ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung.
Hohe Benutzerfreundlichkeit durch gut zugängliche Bedienelemente und intuitive Bedienlogik. Optimale Rundumsicht durch große Fensterflächen. Und noch mehr Leistungsstärke und Flexibilität im Ganzjahreseinsatz mit Optionen wie 4x4-Antrieb und Allradlenkung. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
Psst! Mit der neuen vollelektrischen MC 250 e!ectric halten Sie Ihre Strassen so leise und effizient sauber wie noch nie. Ohne lokale CO₂-Emissionen. Dafür mit viel Ausdauer, überlegener Reinigungsleistung und einem Höchstmass an Komfort. kaercher.ch/municipal


Patricia Pfister Chefredakteurin

Das kommunale Umfeld gilt oft als eher beständig und von bewährten Strukturen geprägt –eine Qualität, die Verlässlichkeit garantiert, jedoch manchmal auch den Blick auf neue, effektivere Lösungen erschwert. Vielerorts dominieren nach wie vor manuelle Prozesse und isolierte Insellösungen die Automatisierungslandschaft. Fehlende Daten verhindern dabei häufig, dass bestehende Optimierungspotenziale erkannt und genutzt werden. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Thalmässing: In der mittelfränkischen Gemeinde setzt die Pyraser Landbrauerei auf eine moderne Cloudlösung zur digitalen Überwachung ihres Energiemanagements und sämtlicher technischer Anlagen. Was dort im familiengeführten Unternehmen bereits erfolgreich etabliert ist, bietet auch für kommunale Anwendungen großes Potenzial – mehr dazu ab Seite 44. Auch in der Forstwirtschaft schreitet die Digitalisierung voran. Mit TimberVision steht nun ein neu entwickelter, öffentlich zugänglicher Bilddatensatz samt KI-Modell zur Verfügung, der Baumstämme zuverlässig erkennt und deren Konturen präzise erfasst. Diese neue Grundlage erlaubt es, forstwirtschaftliche Prozesse – von der Inventur bis zur Holzernte – effizienter und automatisierter zu gestalten (ab Seite 28). Doch nicht nur digitale Innovationen sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinden. Auch nachhaltige Technologien und umweltschonende Verfahren gewinnen zunehmend an Bedeutung. Elektrobetriebene Geräteträger und Kehrmaschinen zeigen bereits in der Praxis, wie klimafreundliche Mobilität im kommunalen Alltag gelingen kann (unter anderem Seite 14 und 26). Ebenso wichtig ist der sensible Umgang mit dem Straßenbegleitgrün, um die Artenvielfalt zu erhalten – eine entsprechende Lösung stellen wir ab Seite 22 vor. Über ein nachhaltiges Konzept bei einem großen Infrastrukturprojekt erfahren Sie ab Seite 36 mehr: In Salzburg musste die Trinkwassertransportleitung zu einem der beiden Hochbehälter nach fast 100 Jahren erneuert werden – ein langlebiges Gussrohr hatte bis dahin zuverlässig seinen Dienst getan. Dass die Stadt auch bei der neuen Leitung wieder auf dieses bewährte Material setzte, überrascht also nicht. Diese und viele weitere zukunftsweisende Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe von zek KOMMUNAL. Ich wünsche Ihnen eine anregende und erkenntnisreiche Lektüre!
Ihre

Patricia Pfister
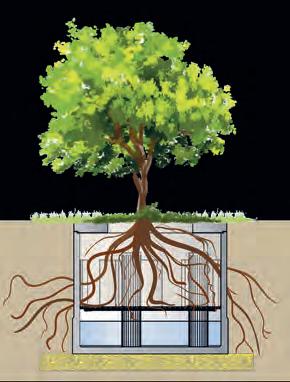
+ Integrierte Zisterne zur Versorgung von Bäumen
+ Adiabate Kühlung und Beschattung
+ Schutz der Wurzeln vor Vernässung und Beschädigung


CaviLine - der Sickertunnel aus Beton
+ Ideal zur Kombination mit einer Regenwasserbehandlung
+ Hohe Stabilität - befahrbar bis SLW 60
+ Gesamte Anlage zugänglich nach DGUV Regel 103-003





Inhalt
AKTUELL 06 Interessantes & Wissenswertes
Impressum
KOMMUNALTECHNIK
11 Mit Systemlösungen von Hako ganzjährig nachhaltig pflegen Geräteträger
12 Zaugg und Westa starten strategische Kooperation Winterdienst
KOMMUNALTECHNIK
14 Saubere Straßen, sauberer Antrieb: die vollelektrische MC 250 e!ectric Kehrtechnik
16 Schnelleres Trocknen am Steilhang: der Rapid Worber Grünfutterernte
18 Hohe Nutzlast und Vielseitigkeit: der Hansa XL im Testeinsatz Schmalspurfahrzeug
20 Flexibel und stark zugleich: der neue Viarox-Schneepflug Winterdienst
KOMMUNALTECHNIK
22 Moderner Straßenbegleitdienst erfordert innovative Konzepte Grünpflege
25 Ein Friedhofsbagger als Kraftpaket auf schmaler Spur Friedhofspflege
26 Intelligente Lösungen für einen nachhaltigen Kommunaldienst Straßenreinigung
28 Open-Source-Datensatz für KI-gestützte Forsttechnik Forsttechnik



32 Kärcher zeigt Winterdienst-Kompetenz bei Kommunal-Roadshow Nachbericht
VERANSTALTUNGEN
30 Technik zum Anfassen bei der Swiss Demo Park Nachbericht
32 Globales Gipfeltreffen bei der Interalpin in Innsbruck Nachbericht
34 ASTRAD als Hotspot für kommunale Praxislösungen Nachbericht
TRINKWASSERVERSORGUNG
36 Herausforderung am Mönchsberg: Salzburgs Trinkwasserleitung Erneuerung
ENERGIEVERSORGUNG
40 Schichtspeicher als Gamechanger für kommunale Wärmebereitstellung Speichertechnik
42 Versorgungssicherheit für Alltag und Ausnahmezustand Krisensichere Energieversorgung
44 Die vollständig vernetzte Familienbrauerei Pyraser Automatisierung


PATENTIERTES MESSSYSTEM VON ACS SETZT
NEUE STANDARDS BEI DER PEGELMESSUNG
Mit einem patentierten, redundanten Pegelmesssystem setzt ACS Control-System neue Maßstäbe in der Wasserwirtschaft. Zwei Sensoren mit unterschiedlichen physikalischen Messprinzipien –z. B. Ultraschall, Radar oder hydrostatische Messung – arbeiten unabhängig voneinander an einem Messpunkt und überprüfen sich gegenseitig. Das erhöht die Datensicherheit, reduziert Kontrollmessungen und ermöglicht vorausschauende Wartung. Die Datenlogger DLF4 und HLF4 übertragen die Messwerte via Mobilfunk ins ACS-Web-Portal, wo sie analysiert und visualisiert werden können. Alarmfunktionen und Schnittstellen zu gängigen Systemen wie WISKI sind integriert. Die robuste Technik (bis IP68) bewährt sich bereits an über 1.500 Messstellen – etwa in der Grundwasserüberwachung, im Hochwasserschutz oder bei Wasserkraftwerken.
INTERNATIONALE GAMING-SZENE GASTIERT BEI LINDNER
Normalerweise informieren sich im Lindner-Innovationszentrum Einsatzprofis aus ganz Europa über die Stärken der Lintrac-Traktoren und Unitrac-Transporter des Tiroler Familienunternehmens. Am 5. und 6. Juli 2025 wird Kundl zur Bühne für die FarmCon 25, bei der sich alles um den Landwirtschafts-Simulator 25 drehen wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vor Ort nicht nur die aktuellste Version der Agrarsimulation spielen, sondern bekommen auch fundierte Einblicke in die künftigen Projekte des Spieleherstellers. Mit dem Landwirtschafts-Simulator, der seit 2008 mehr als 40 Millionen Mal verkauft wurde, hat GIANTS Software eines der weltweit erfolgreichsten Computerspiele im Programm. Der Tiroler Traktoren- und Transporterhersteller Lindner ist ein langjähriger Partner von GIANTS Software. Im Landwirtschafts-Simulator können Spielerinnen und Spieler ihre Einsätze mit einem Lintrac 130 und einem Unitrac 122 LDrive von Lindner bestreiten. „Wir setzen seit vielen Jahren auf Digitalisierung und Gamification. Denn wir wollen gezielt junge Menschen ansprechen, Begeisterung für moderne Landtechnik wecken und die Brücke zwischen Hightech und Landwirtschaft schlagen“, erläutert Geschäftsführer David Lindner. Innovationen wie das TracLink-System, das zum Beispiel Anbaugeräte automatisch erkennt, tragen außerdem maßgeblich dazu bei, die tägliche Arbeit am Feld und in den Gemeinden zu erleichtern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der FarmCon 25 dürfen ihr Können aber nicht nur auf den verschiedenen Spieleplattformen zeigen, sondern auch am Steu-

Erfolgreiche Passöffnung der Großglockner Hochalpenstraße.
GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE ÖFFNET IM JUBILÄUMSJAHR BEREITS VOR OSTERN
Erstmals seit fast 50 Jahren wurde heuer die legendäre Hochgebirgsstraße am Großglockner bereits zum Osterwochenende für den Verkehr freigegeben. Der sogenannte „Durchstich am Hochtor“ erfolgte heuer am 18. April – so früh wie nur fünfmal zuvor in der gesamten Geschichte der Straße seit ihrer Eröffnung im Jahr 1935. Begünstigt durch einen schneearmen Winter und gut vorbereitete Einsatzteams konnte der Sommerbetrieb ungewöhnlich früh starten. Der jährliche Durchstich – die Schneeräumung von Norden und Süden bis zum Treffen der Fräsen am Hochtor auf 2.504 Metern Seehöhe – gilt als spektakulärer Auftakt in die Saison. Trotz moderater Schneemengen in diesem Winter stellte die Schneeräumung im hochalpinen Gelände wie jedes Jahr eine besondere Herausforderung dar. Windverwehungen, Lawinen und unvorhersehbare Wetterumschwünge erforderten von den Schneeräumtrupps aus Salzburg und Kärnten einmal mehr Präzision und Einsatzbereitschaft. Auch heuer wurden die historischen Schneefräsen Rotationspflüge System Wallack wieder von HVO100-Fuel, einem nahezu klimaneutralen Bio-Treibstoff aus hydrierten Pflanzenölen und tierischen Fetten, betrieben.

Kann bei der FarmCon 25 auf der Spielkonsole oder im echten Leben ausprobiert werden: der Lintrac 130. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es online auf lindner-traktoren.at/de-at/lindner-welt/gaming/farmcon
er eines echten Traktors. Dafür ist die Teststrecke beim Lindner-Innovationszentrum geöffnet. Darüber hinaus stehen Werksführungen auf dem Programm, bei denen exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Produktion warten.


FACHMESSE KOMMUNALE IN NÜRNBERG
Die KOMMUNALE 2025 – Deutschlands größte Fachmesse für Kommunalbedarf – findet am 22. und 23. Oktober in Nürnberg statt. Seit ihrer Gründung 1999 hat sich die Messe zu einem zentralen Treffpunkt für Bürgermeister:innen, kommunale Entscheider:innen und Fachleute aus Verwaltung, Technik und Planung entwickelt. Dabei präsentiert die KOMMUNALE ein umfassendes Angebot rund um Digitalisierung, IT-Sicherheit, Energieversorgung, Nachhaltigkeit, Mobilität, Stadtplanung und vieles mehr. Die Aussteller zeigen innovative Lösungen, die Kommunen fit für die Zukunft machen – von smarter Infrastruktur über moderne Verwaltungssoftware bis hin zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten. Ein Highlight ist das hochwertige Rahmenprogramm mit dem DIGITAL-Kongress, dem Kongress des Bayerischen Gemeindetags und den beliebten Ausstellerfachforen. Hier werden aktuelle Herausforderungen diskutiert und Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Zudem wird der DIGITALAward verliehen, der wegweisende Digitalprojekte auszeichnet. Mit über 400 Ausstellern und rund 6.000 Fachbesuchern im Jahr 2023 setzt die KOMMUNALE Maßstäbe als Plattform für Austausch, Innovation und Vernetzung im kommunalen Bereich. Mit dem exklusiven Gutscheincode KOM25zek können unsere Leser kostenfrei die KOMMUNALE 2025 besuchen, einlösbar online unter: www.messe-ticket.de/Nuernberg_SHOP/KOMMUNALE2025/Shop

MACHER. Stark. Vielseitig. Hako. – eine Kampagne, die den Leistungsträgern hinter der Technik auf der demopark 2025 ein Gesicht gibt und ihnen für ihren Einsatz dankt.
MIT KIPPSTER UND KI-MESSSYSTEM GEGEN KIPPEN
Seit Sommer 2023 wurden im norddeutschen Kiel 20 sogenannte Kippster, auch als Kippen-Orakel bekannt, aufgestellt. Es handelt sich um spezielle Doppel-Aschenbecher, mit denen Raucher durch Einwurf ihrer Zigarettenkippen über eine Frage abstimmen können – etwa: „Warst du schon in der Förde baden?“ Die originelle Idee hinter dem Konzept: Durch die spielerische Beteiligung sollen Kippen häufiger ordnungsgemäß entsorgt werden. Der Effekt kann sich sehen lassen: Pro Kippster wurden im Testzeitraum zwischen 800 und 1.000 Kippen gesammelt. Insgesamt bedeutet das rund 16.000 bis 20.000 korrekt entsorgte Zigarettenstummel – Abfall, der andernfalls vermutlich auf Straßen, Gehwegen oder in der Natur gelandet wäre. Zur Unterstützung und gezielten Steuerung des Kippster-Einsatzes kam zusätzlich das KI-basierte System CORTEXIA zum Einsatz. In einem Pilotprojekt stattete der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel eine Kehrmaschine mit dem System aus, das während der Fahrt mit Kameras über 20 verschiedene Abfallarten erkennen und deren Vorkommen zeitlich sowie räumlich erfassen kann. Diese Daten ermöglichen die Erstellung von Heatmaps, die Müll-Hotspots – insbesondere auch für Zigarettenkippen – sichtbar machen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden Kippster an neue, stärker frequentierte Standorte versetzt.
HAKO RÜCKT MASCHINENBEDIENER IN DEN MITTELPUNKT Unter dem Motto „MACHER. Stark. Vielseitig. Hako.“ spricht das Unternehmen mit seiner neuen Kampagne alle Anwender von Kommunal- und Wasserstrahltechnik an, die sich als lösungsorientiert und leistungsstark verstehen. Der offizielle Kampagnenstart erfolgte Mitte Mai und erreicht ihren Höhepunkt zur demopark, Europas größter Freilandausstellung für die Grüne Branche. „Unsere Maschinen und Fahrzeuge sind leistungsfähig – aber ohne die Menschen, die sie bedienen, bleibt selbst die stärkste Technik stehen. Es war Zeit, diese Leistung sichtbar zu machen“, sagt Sonja Grazia D’Introno, Director Marketing von Hako. Deshalb sind die Gesichter der Kampagne echte Macher, die täglich mit Hako-Produkten arbeiten und deren Leistungsstärke und Vielseitigkeit in ihrem Arbeitsalltag zu schätzen wissen.
IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. · zek-VERLAG · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · M +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Patricia Pfister · pp@zek.at · M +43 664 214 06 14 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · M +43 664 240 67 74 | Gestaltung: Mag. Roland Gruber e.U. · zek-VERLAG · Brunnenstraße 1 · A-5450 Werfen · M +43 664 115 05 70 · office@zek.at · www.zek.at | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt: A-5450 Werfen | Grundlegende Richtlinien: zek KOMMUNAL ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für erneuerbare Energien und zukunftsorientierte Technologien sowie Management im kommunalen Bereich | Abopreis Österreich € 78,00 · Ausland € 89,00 inklusive Mehrwertsteuer | zek KOMMUNAL erscheint viermal im Jahr · Auflage 8.000 Stück · ISSN 2791-4100 · 23. Jahrgang.

Der neue Füllstandsmelder mit integrierter Überwachung der Maschinenfunktion ist auch als Nachrüstoption erhältlich.
FACELIFT FÜR RASENPFLEGEMASCHINEN FÜR MEHR
EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Mit einem umfassenden Facelift hebt der Hersteller von Maschinen für die Rasenpflege Wiedenmann seine Super-Serie auf ein neues Niveau. Ziel sei dabei gewesen, die Zuverlässigkeit des multifunktionalen Geräts zum Mähen, Vertikutieren und Kehren deutlich zu steigern und Anwendern ein effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Ein zentraler Bestandteil des Facelifts ist die Überarbeitung der elektromagnetischen Fernbedienung für die Hydraulikfunktionen. Diese Neuerung gewährleistet eine höhere Zuverlässigkeit und reduziert potenzielle Störungen im Betrieb. Speziell für die Super 600 wurde eine zusätzliche Überwachung der Behälterfalle eingeführt, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Dieses Update erhöht die Betriebssicherheit und schützt die Maschine vor unnötigen Ausfallzeiten, was den reibungslosen Ablauf insbesondere bei größeren Pflegearbeiten sicherstellt. Eine weitere wesentliche Neuerung ist die Integration moderner Sensorik, die nach dem Prinzip einer Lichtschranke arbeitet. Dieses System bietet dem Anwender in Echtzeit Informationen zur Maschinenfunktion und zeigt an, wenn etwa 80 Prozent des Behälters gefüllt sind. Der sogenannte Vollmelder verbessert nicht nur die Effizienz des Arbeitsprozesses, sondern trägt auch dazu bei, dass die Maschinen optimal genutzt werden können. Der neue Füllstandsmelder mit integrierter Überwachung der Maschinenfunktion ist auch als Nachrüstoption erhältlich. Damit stellt Wiedenmann sicher, dass bereits vorhandene Maschinen mit modernster Technik aufgerüstet und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden können. Die „Supermaschinen“ von Wiedenmann zählen zu den vielseitigsten Pflegegeräten für Naturrasen. Mit Funktionen wie Schlegelmähen, Vertikutieren und Gras- sowie Laubaufnahme lassen sie sich intensiv und somit rentabel von Frühjahr bis Herbst einsetzen.


v.l.n.r.: EVN Wärme Geschäftsführer Gerhard Sacher, Ärztliche Direktorin Andrea Zauner-Dungl, Pflegedirektorin Regina Kern, Kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikums Roman Semler
NACHHALTIGE KÄLTEVERSORGUNG IN KREMS
Krems rüstet sich für heiße Tage: Mit steigenden Außentemperaturen erhöht sich der Bedarf an zuverlässiger Gebäudekühlung. Vor diesem Hintergrund hat die EVN am Universitätsklinikum Krems eine besonders umweltfreundliche Kälteanlage in Betrieb genommen, die Maßstäbe setzt: Sie nutzt keine stromintensiven Kompressoren wie herkömmliche Klimaanlagen, sondern basiert auf der innovativen Absorptionskältetechnologie. Der Clou: Die Kälte wird nicht mit Strom erzeugt, sondern mit nachhaltig gewonnener Wärme aus dem benachbarten Biomasseheizkraftwerk. Diese clevere Technik nutzt Energie, die sonst ungenutzt bliebe – ein Paradebeispiel für Effizienz im Energiesystem. Durch die Verbindung von Wärme- und Kälteversorgung entsteht eine ressourcenschonende Lösung, die sowohl ökologische Vorteile bietet als auch langfristig wirtschaftlich sinnvoll ist. Die neue Anlage liefert die notwendige Kälte für die Klimatisierung sensibler Krankenhausbereiche, den Betrieb medizinischer Geräte sowie die Kühlung von IT-Infrastruktur. Zwei großzügig dimensionierte Kältespeicher mit jeweils 120 m³ Volumen ermöglichen eine besonders bedarfsgerechte Versorgung. Sie speichern überschüssige Kälte und geben sie bei Spitzenbedarf wieder ab – ein wichtiger Faktor für Effizienz und Versorgungssicherheit. Durch die Vermeidung klassischer Kompressionskälte spart das System nicht nur Stromkosten, sondern reduziert auch die CO2-Emissionen erheblich. Die neue Lösung zeigt eindrucksvoll, wie intelligente Energietechnik den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit gleichzeitig voranbringen kann. Die Technologie am Klinikum Krems ist ein wegweisendes Beispiel dafür, wie sich auch ein steigender Kühlbedarf klimafreundlich decken lässt.

© Hargassner
Das Holzparkhaus der Biomassespezialisten Hargassner wurde mit dem Holzbaupreis in Gold bei den gewerblichen Bauten ausgezeichnet.
HARGASSNER PARKHAUS SIEGT BEIM HOLZBAUPREIS
Im Zuge der 45 Mio. Euro Investition in das neue Service Center des Heizkesselherstellers Hargassner in Weng im Innkreis entstand mit einem Parkhaus für 500 Fahrzeuge ein neuer außergewöhnlicher Holzbau. Durch insgesamt 2.300 m3 verbautes Holz und den minimalen Einsatz CO2-intensiver Materialien wird langfristig Kohlenstoffdioxid gespeichert und eingespart. Außerdem wird das Holz im Sinne einer zirkulären Immobilie in ferner Zukunft auch wiederverwendet werden können. All das wurde Mitte Mai von der zuständigen Jury bei einer feierlichen Gala in der JKU Linz mit dem Holzbaupreis in Gold 2025 ausgezeichnet. Tektonisch und ingenieurtechnisch gilt das 77 m lange Holzgebäude als beispielhaft in vielen Aspekten. „Die Stapelung in Split-Level-Bauweise verringert die versiegelte Fläche für den Parkplatz um 80 Prozent. Das schützt mehr als 11.300 m2 Grünland“, freut sich Hargassner Projektleiter Florian Pommer.

© Salzburg
Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens, und Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG
Die Dekarbonisierung spielt für die Salzburg AG eine entscheidende Rolle. Diese treibt das Unternehmen mit ihrem Fernwärmeausbau voran. „Wir wollen bis 2030 unsere CO2-Emissionen um 50 Prozent verringern und bis 2040 zu 100 Prozent klimaneutral und nachhaltig sein. Mit dem Anschluss des Flughafens an unser Fernwärmenetz geht nicht nur einer unserer größten Kunden ab 2026 ans Netz, der Anschluss ist ein wichtiger Meilenstein für den Fernwärmeausbau im Stadtgebiet“, so Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG. Aktuell wird das Gebäude des Flughafens noch mit Gas beheizt. Ziel ist aber der konsequente Ausstieg aus Öl und Gas. „Mit dem Umstieg auf klimafreundliche Fernwärme kommen wir unserem Klimaziel einen großen Schritt näher, denn ab 2026 können wir mit der Fernwärme fast 510 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen“, sagt die Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens, Bettina Ganghofer.

Neben der neuen Scan- und Foto-Funktion bietet Conpur auch eine integrierte Handschrifterkennung. Diese ermöglicht es, handschriftliche Notizen auf PDF-Dokumenten automatisch zu erfassen.
Die digitale Beschaffung in der Bauwirtschaft wird noch effizienter: Die Cloudlösung von Conpur kann ab sofort nicht nur klassische PDF-Dokumente, sondern auch gescannte oder fotografierte Unterlagen automatisiert einlesen, erfassen und weiterverarbeiten. Damit geht Conpur einen wichtigen Schritt in Richtung nahtloser digitaler Prozesse am Bau. Die Software erkennt automatisch relevante Informationen, strukturiert diese und überführt sie in digitale Workflows. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und sorgt für volle Transparenz in der Beschaffung. Ein zentrales Highlight ist der neue, kostenlose Converter, den Conpur ab sofort bereitstellt. Damit lassen sich PDF-Dokumente mit Angebots- oder Leistungsbeschreibungen direkt in das GAEB-Format umwandeln, das als Standardformat in der Bauwirtschaft gilt.




LINK3 GmbH www.link3.at office@link3.at

Tunnelbaustelle an einer der beiden Konverterstationen, die den Gleichstrom aus der Leitung in den Wechselstrom für die Versorgungsnetze umwandeln.
BAU DER NEUEN EU-STROMTRASSE
SPANIENS – 300 KM UNTER DEM MEER
Der große Stromausfall im April in Spanien und Portugal offenbarte die fragile Versorgungsstruktur auf der iberischen Halbinsel. Optimierungsmaßnahmen haben daher höchste Priorität. Das Projekt INELFE (INterconnexion ÉLectrique France-Espagne) der beiden Netzbetreiber Red Eléctrica und RTE ist daher ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Energieinfrastruktur. Es ermöglicht den Stromtransfer zwischen Frankreich und Spanien, um deren elektrische Versorgungssicherheit ab 2028 zu verbessern. Dies ist besonders wichtig für Spanien, das über vergleichsweise wenige Anschlusspunkte ans europäische Netz verfügt. Kernstück des mittlerweile auf 3,1 Milliarden Euro veranschlagten Projekts ist der Bau einer 393 Kilometer langen Gleichstromleitung mit vier Kabelsträngen. Diese verläuft von Cubnezais nördlich von Bordeaux durch den Golf von Biskaya nach Gatika bei Bilbao.



Mit einer Übertragungskapazität von zweimal 1.000 MW erweitert das Projekt die bestehende Verbindung auf rund 5.000 MW. Damit liegen die Verbundkapazitäten auf einem Niveau, wie es Frankreich auch zu anderen Nachbarländern aufgebaut hat. Der Weg durch das Meer wurde gewählt, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, zumal die bestehenden 400 kV-Freileitungen den Durchsatz nicht bewältigen können. Erst nach jahrelanger Prüfung durch die Aufsichtsbehörden konnte mit dem Bau der neuen Hochspannungsleitung begonnen werden – dafür geht es jetzt voran. In der anspruchsvollen Umgebung, die komplett unterirdisch und zu drei Vierteln unter dem Meer verläuft, kommt der Wasserhaltung eine entscheidende Bedeutung zu. Der beteiligte Tunnelbauer BESSAC setzt dabei auf Schmutzwasserpumpen von Tsurumi, die sich bereits bei ähnlichen Herausforderungen bewährt haben.

Vielseitig und emissionsfrei: Der Multicar M31 ZE mit Schwemmbalken, Kipper und Sinkkastenreiniger auf der
Mit einem breiten Portfolio an Maschinen für Reinigung, Pflege und Transport zeigt Hako auf der demopark praxisnahe Technik für die grüne Branche. Im Fokus stehen dabei emissionsfreie Antriebstechnologien, modulare Trägerfahrzeuge und durchdachte Systemlösungen – ideal für den kommunalen Ganzjahreseinsatz. Auf großzügiger Freifläche gibt das Unternehmen Einblick in aktuelle Entwicklungen und präsentiert seine Maschinen live im Einsatz.
Nachhaltigkeit ist längst ein zentraler Faktor in der kommunalen Flächenpflege und im GaLaBau. Wer heute in moderne Technik investiert, stellt die Weichen für mehr Klimaschutz, Effizienz und Zukunftssicherheit. Hako unterstützt Profis mit durchdachten, multifunktionalen Maschinenlösungen, die rund ums Jahr im Einsatz sind – ob auf Grünflächen, Wegen oder im Winterdienst. Intelligente Technik, Elektromobilität, modulare Systeme und hohe Servicequalität helfen dabei, Ressourcen zu schonen und Betriebskosten zu senken. Auf der demopark in Eisenach wird die Praxisnähe der Hako-Lösungen eindrucksvoll demonstriert.
Drei Produktwelten, ein Ziel: natürlich die Zukunft gestalten Von multifunktionalen Trägerfahrzeugen über nachhaltige Antriebstechnologien bis hin zu leistungsstarken Wasserstrahlsystemen präsentiert Hako ein breites Gerätesortiment. Die gesamte Citymaster Produktlinie ist live und in verschiedenen Ausstattungen zu erleben: der kompakte Citymaster 400 mit Mäh-Saug-Kombination, der Vollprofi für urbane Flächen Citymaster 650 mit 2-Besen-Kehreinheit, der vielseitige Citymaster 1650 mit unterschiedlichen An- und Aufbauten sowie der große Citymaster 2250 mit Kehrtechnik und Streuer. Ein besonderes Highlight bildet die vollelektrische „Zero Emission“-Lösung Citymaster 1650 ZE. Neben dem emissionsfreien Antrieb steht eine Live-Demonstration des Schnellwechselsystems im Fokus, das einen zeiteffizienten, werkzeuglosen Tausch der Anbaugeräte ermöglicht.
Auch die Multicar Produktwelt setzt auf emissionsfreie Technik: Der Multicar M31 ZE wird mit Schwemmbalken, Kipper und Sinkkastenreiniger präsentiert. Ergänzt wird das Port-
folio durch die Lasten- und Geräteträger Multicar M29, M31 und M41 mit vielseitigen An- und Aufbauten – darunter MähSaug-Kombination, Gießanlage und Leitpfostenwaschanlage.
Unter Hochdruck demonstriert sich die Produktwelt der Wasserstrahltechnik: Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger Oertzen C230-21 E mit Elektromotor überzeugt durch Leistungsstärke und Effektivität bei der Graffiti-Entfernung. Am Oertzen C170-9 E wird gezeigt, wie ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit dem passenden Zubehör beispielsweise auch für die Rohrreinigung eingesetzt werden kann. Auch Heißwasser-Geräte sind vertreten.

präsentiert leistungsstarke Wasserstrahltechnik – von Graffitientfernung bis Rohrreinigung – live auf der demopark.

Die Schweizer Zaugg AG und die deutsche Westa GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre Position im Winterdienstmarkt weiter auszubauen. Zwei erfahrene Hersteller von Schneeräumtechnik bündeln damit ihre Stärken. Ziel der Kooperation ist es, Vertriebsnetze zu erweitern, Serviceleistungen zu verknüpfen und gemeinsam neue Kundengruppen zu erschließen – mit Blick auf den Nutzen für Anwender im kommunalen Einsatz.
Die Schweizer Zaugg AG aus Eggiwil und die deutsche Westa GmbH mit Sitz in Weitnau gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Marktpräsenz beider Unternehmen nachhaltig zu stärken, neue Kundengruppen zu erschließen und langfristiges Wachstum zu sichern. Durch den gezielten Austausch von Vertriebsrechten und Know-how entsteht ein Schulterschluss zweier starker Marken, die sich sowohl technologisch als auch geografisch ideal ergänzen. Die Kooperation sieht vor, dass die Westa GmbH künftig Produkte der Zaugg AG in definierten Märkten aktiv vertreibt – und umgekehrt. Beide Unternehmen erweitern dadurch nicht nur ihre Vertriebsreichweite, sondern auch ihr Leistungsangebot für Kunden im Bereich der professionellen Schneeräumung.
Gebündelte Kräfte
„Die Zusammenarbeit mit Westa ist ein bedeutender Schritt für uns“, betont Wilhelm Rieder, CEO der Zaugg AG. „Zwei traditionsreiche Unternehmen mit hoher technischer Kompetenz bündeln ihre Kräfte, um neue Marktchancen zu nutzen. Wir freuen uns auf eine enge Partnerschaft, die innovative Impulse in der Branche setzen wird.“ Auch Alois Weber, Geschäftsführer der Westa GmbH, blickt optimistisch auf die Kooperation: „Zaugg verfügt über ein starkes Produktportfolio mit internationalem Renommee. Durch die Zusammenarbeit entsteht eine echte Win-win-Situation – wir erweitern unser Sortiment gezielt und stärken unsere Position im Markt.“
Zwei traditionsreiche Unternehmen im Winterdienst
Die 1893 gegründete Zaugg AG gilt als ein international führendes Maschinenbauunternehmen im Bereich der Schneeräumtechnik. Mit rund 150 Mitarbeitenden entwickelt und


Gebündelte Kompetenz: Die Schweizer Zaugg AG und die deutsche Westa GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre Position im Winterdienstmarkt weiter auszubauen.
produziert das Unternehmen im Emmental hochwertige Geräte für Straßen, Schienen, Flughäfen und Skipisten. Dank jahrzehntelanger Erfahrung, zahlreichen Patenten und einem konsequenten Qualitätsanspruch steht der Name Zaugg für Schweizer Präzision und Innovationskraft in anspruchsvollsten Einsatzbereichen. Die Westa GmbH wiederum ist seit 1981 ein fester Bestandteil der deutschen Winterdienstbranche. Mit Sitz im bayerischen Allgäu und mit rund 30 Mitarbeitenden entwickelt und fertigt das Unternehmen leistungsstarke Schneefräsen und Sonderlösungen für den professionellen Einsatz in Hochgebirgslagen, auf Flughäfen, in Kommunen sowie im privaten Bereich. Die kompakte Struktur und hohe Fertigungstiefe ermöglichen dabei individuelle Lösungen und eine hohe Kundenorientierung.
Die strategische Kooperation trat mit Mai in Kraft, erste gemeinsame Projekte befinden sich bereits in Planung. Dabei steht der Kundennutzen klar im Fokus: Durch die koordinierte Ersatzteilbevorratung und die enge Zusammenarbeit im Service wollen beide Unternehmen ihre Reaktionsfähigkeit erhöhen und einen flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Kundendienst gewährleisten. Langfristig soll die Partnerschaft auch technische Synergien erschließen – von der gemeinsamen Produktentwicklung bis hin zur Optimierung von Schnittstellen und Kompatibilität der Geräte. Für beide Unternehmen bietet die Zusammenarbeit die Chance, ihre jeweilige Innovationskraft mit praxisnaher Erfahrung zu verbinden und ihre Marktposition weiter auszubauen.

Westa-Schneefräsen sind unter extremen Bedingungen im Hochgebirge bei Passöffnungen ebenso unterwegs wie auf Flughäfen und im kommunalen Einsatz in Städten und Gemeinden.

Mit der MC 250 e!ectric bringt Kärcher Municipal eine vollelektrische Kehrmaschine auf die Straße, die nicht nur leise und emissionsfrei arbeitet, sondern auch mit hoher Reichweite und praxisnahen Details überzeugt. Ein leistungsstarker Akku, intelligentes Wasserrecycling und ein ergonomisches Bedienkonzept machen sie zur vielversprechenden Option für die kommunale Reinigung – und dabei zu einem wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtpflege.
Mit der MC 250 e!ectric bringt Kärcher Municipal für die 2-m3-Klasse ein batteriebetriebenes Modell auf den Markt, das konsequent auf Nachhaltigkeit setzt. Die Maschine verfügt über eine Lithium-Ionen-Batterie, sodass keine lokalen CO2-Emissionen anfallen. Zudem hat die neue Kompaktkehrmaschine das bewährte Wasserrecyclingsystem an Bord, das für einen sparsamen Einsatz von Frischwasser sorgt. Der Geräuschpegel liegt deutlich unter dem für Nachtarbeiten geltenden Grenzwert von 98 dB (A). Da die Maschine auf dem erprobten Konzept der konventionell betriebenen Variante MC 250 aufsetzt, bietet sie Anwendern einen komfortablen, ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz mit einem voll gefederten Fahrwerk.
Arbeiten ohne nachzuladen
Eine grundlegende Anforderung an elektrische Kehrmaschinen ist, dass sie eine reguläre Arbeitsschicht ohne Nachladen absolvieren. Um dies zu ermöglichen, verwendet Kärcher Municipal bei der MC 250 e!ectric eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie auf Basis der NMC-Technologie (Nickel-Mangan-Kobalt), die über eine Nennkapazität von 78 kWh verfügt. Darüber hinaus wurde das Gesamtsystem technisch auf Energieeffizienz getrimmt, angefangen bei Antrieb und Turbine über das Hydrauliksystem bis hin zur Klimatisierung. Über ein On-Board-Ladegerät ist die MC 250 e!ectric innerhalb von vier Stunden geladen und einsatzbereit. Neben der Vermeidung lokaler CO2-Emissionen hat
Bildunterschtift

Kärcher Municipal den sparsamen Einsatz von Frischwasser im Blick, was über ein Recyclingsystem umgesetzt ist. Es funktioniert als Kreislauf und erhöht somit die Wasserreichweite.
Mehr Volumen macht längere Einsätze möglich
Um effizientes Arbeiten zu ermöglichen, bietet die MC 250 e!ectric einen Kehrgutbehälter mit einem Volumen von 2,5 m3 sowie eine Transportgeschwindigkeit von 60 km/h. Dadurch lassen sich längere Einsätze und Strecken zwischen zwei Standorten zügig absolvieren. Beim Kehren werden dank des optimierten Luftstroms feine Staubpartikel oder Sandkörner ebenso mühelos aufgenommen wie grobe Verschmutzungen, was für eine sehr gute Reinigungsleistung sorgt. Das Besensystem gestattet eine individuelle Einzelsteuerung, so dass sich zwei bzw. drei Besen sowie Unkrautbesen nach Bedarf einsetzen lassen. Sämt-

Alle Servicekomponenten sind durch leicht zugängliche Wartungspunkte schnell erreichbar – das spart Zeit im täglichen Einsatz.
liche Servicekomponenten sind über Wartungszugänge einfach zu erreichen, was im Arbeitsalltag Zeit spart.
Gütesiegel „Aktion gesunder Rücken e.V.“
Die Gestaltung der Kabine ist darauf ausgelegt, Anwendern einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz zu bieten. Zusätzlich zum großzügigen Platzangebot profitieren Fahrer und Beifahrer von der Klimaautomatik und einem sehr niedrigen Geräuschpegel. Die hydropneumatische Federung mit Einzelradaufhängung an der Vorderachse dämpft Bodenunebenheiten wirksam ab, weshalb die Maschine mit dem Gütesiegel des „Aktion gesunder Rücken e.V.“ ausgezeichnet wurde. Für angenehmes Arbeiten sorgen LED-Beleuchtung, USB-Lademöglichkeit und viel Stauraum. Das bewährte Bedienkonzept via Zentraldisplay und ergonomisch gestaltetem Bedienpanel erleichtert die Steuerung der Maschine.

Die Kehrmaschine bleibt mit ihrem Geräuschpegel deutlich unter dem zulässigen Grenzwert für nächtliche Einsätze von 98 dB(A).

Wo Maschinen an ihre Grenzen stoßen, beginnt oft mühsame Handarbeit – das gilt insbesondere für die Heutrocknung in Steilhanglagen. Mit dem neuen Worber schließt Rapid eine lang bestehende Lücke in der Grünfutterernte: Das Anbaugerät überträgt das bewährte „Worbern“ vom manuellen zum maschinellen Prozess und ermöglicht damit eine effiziente Trocknung des Mähguts auch auf abschüssigem Terrain. Entwickelt für den Einsatz an Rapid-Einachsern, verbindet die Innovation Praxisnähe mit ökologischem Mehrwert – und überzeugt durch Funktionalität, Leichtbau und einfache Handhabung.
Die Herausforderung besteht, seit Menschen begonnen haben, auch die steilsten Hänge der Alpen landwirtschaftlich zu nutzen: Das Mähen ist das eine – doch wie bringt man das geschnittene Futter im steilen Gelände effizient und gleichmäßig zum Trocknen? Auf abschüssigem Terrain fehlen oft geeignete Geräte zum Wenden und Belüften des Schnittguts. Das Ergebnis: aufwendige Handarbeit mit der Heugabel und unregelmäßige Trocknung des Schnittguts. Dem Problem hat sich nun ein Schweizer Unternehmen angenommen: Mit dem neuen Rapid Worber präsentiert der Einachsspezialist Rapid eine Lösung, die genau diese Lücke schließt. Das Anbaugerät ergänzt den Prozess der Grünfutterernte um eine mechanisierte Stufe zwischen Mähen und Twistern – und bringt damit Effizienz dorthin, wo bisher Handarbeit dominierte.
Mechanisierung eines alpinen Arbeitsschritts
Trocknung braucht Zeit – und Zeit ist knapp
Gerade in den Alpen ist das Zeitfenster zwischen Regenfronten oft kurz. Steigende Wetterextreme, spontane Gewitter und anhaltende Feuchte machen das Erzeugen hochwertigen Heus zu einem Rennen gegen die Zeit. Hier bringt der Worber einen entscheidenden Vorteil: Er verschafft Landwirten wertvolle Stunden für die Trocknung, die im Flachland durch breites Wenden leicht gewonnen werden können – in Steilhängen aber bisher fehlten. Neben dem Zeitgewinn ist auch die Qualitätssteigerung ein zentrales Argument. Gut durchlüftetes Futter trocknet nicht nur schneller, sondern auch hygienischer – Schimmelbildung und Nährstoffverluste werden reduziert.
Stabil und leicht – für schwieriges Gelände konstruiert
Die Rapid-Ingenieure entwickelten den Worber gezielt für steilstes Gelände. Die Bauweise ist gewichtsoptimiert, mit niedrigem Schwerpunkt und robuster Leichtbaukonstruktion. Die Führung des Anbaugeräts erfolgt über Kufen, was eine stabile, bodenschonende Arbeitsweise auch bei schwieriger Hangneigung erlaubt. Mit einer Arbeitsbreite von zwei
Die namensgebende Bezeichnung „Worbern“ stammt aus dem alpinen Sprachgebrauch und beschreibt das manuelle Aufschütteln und Verteilen von frisch gemähtem Gras, traditionell mit der Heugabel. Rapid überträgt diesen uralten Arbeitsschritt in ein neues, maschinelles Konzept: Der Worber wird werkzeuglos an einen Rapid-Einachser gekoppelt und in sicherer Vorwärtsfahrt betrieben. An einer quer rotierenden Walze greifen speziell geformte Kunststoffzinken in das Mähgut ein, heben es vom Boden ab und schleudern es nach hinten aus. Dabei wird das Schnittgut aufgelockert und durchmischt abgelegt. Der Effekt ist eindeutig: Die Trocknung verläuft gleichmäßiger und schneller, es entstehen keine „nassen Nester“, wie sie sonst häufig auftreten. In Praxistests konnte die Wirkung deutlich nachgewiesen werden – unter anderem durch den Vergleich unterschiedlich bearbeiteter Parzellen.
Metern deckt der Worber eine beachtliche Fläche ab. Zusätzlich kann er in Rückwärtsfahrt auch zum Einrechen von Randzonen eingesetzt werden – ideal für den nachfolgenden Einsatz des Twisters oder zum Abräumen des Heus.
Biodiversität im Blick
Doch nicht nur in der Landwirtschaft kann man vom Worber profitieren, auch im kommunalen Bereich – etwa in Berggemeinden mit großen Grünflächen an Böschungen, Straßenrändern oder Hanglagen – kann das Gerät punkten. Hier spielt neben der Pflege auch der ökologische Aspekt eine Rolle: Durch das Aufwirbeln des Schnittguts werden Samen gelöst und verbreitet, was die natürliche Regeneration von Pflanzenbeständen fördert. In Zeiten rückläufiger Insektenpopulationen ist das ein nicht zu unterschätzendes Argument, das für den Rapid Worber spricht.
Vom Prototyp zur Serie
Der Worber basiert auf einem historischen Vorbild: Im Rapideigenen Archiv fand sich ein fast 100 Jahre altes Ausstellungsstück mit mechanischen Zinken – dieses Prinzip stand Pate für die Konstruktion des Worbers. Nach rund dreijähriger Entwicklungsphase stehen ab Sommer 2025 erste Vorseriengeräte für Praxistests zur Verfügung. Die Serienproduktion beginnt im Winter 2025/26 am Rapid-Hauptsitz in Killwangen (AG). Die Markteinführung ist pünktlich zur Saison 2026 geplant. Damit erweitert Rapid seine bewährte Einachs-Plattform um ein weiteres Spezialgerät, das – ebenso wie Mähwerk und Twister –mit wenigen Handgriffen montiert werden kann. Für Landwirte und Kommunen im Bergland bedeutet das mehr Flexibilität und weniger Aufwand, auch unter schwierigsten Bedingungen. Mit

Die speziell geformten Kunststoffzinken des Rapid Worbers heben das Mähgut an, wirbeln es auf und sorgen so für eine schnellere und gleichmäßigere Trocknung – selbst in steilstem Gelände.
dem Worber gelingt Rapid ein überzeugender Innovationsschritt für die Grünlandbewirtschaftung in Hanglagen. Das Gerät erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern verbessert auch die Qualität und Effizienz der Heuernte. Dank robuster Technik, praxisnaher Konstruktion und einfacher Handhabung dürfte der Worber schon bald zur Standardausstattung für viele Berglandwirte gehören – und perspektivisch auch für kommunale Anwender mit anspruchsvollem Gelände interessant werden.


Wenn ein neues Fahrzeugkonzept auf den kommunalen Arbeitsalltag trifft, zeigt sich schnell, auf welche Fahreigenschaften es in der Praxis wirklich ankommt. Fachjournalist Johannes Mautner-Markhof nahm auf Einladung des Salzburger Kommunalfahrzeugspezialisten Pappas den neuen Hansa APZ 1003 XL genau unter die Lupe – und stellte fest: Der XL macht seinem Namen alle Ehre, ohne dabei die typischen Stärken eines Schmalspurfahrzeugs zu verlieren.
Der Fachjournalist Johannes Mautner-Markhof, bekannt für seine Expertise in der Kommunaltechnik, hat den APZ 1003 XL des Kommunalfahrzeugherstellers Hansa einem intensiven Praxistest unterzogen. Im Auftrag von Pappas prüfte er die Leistungsfähigkeit des Hansa XL unter realen Einsatzbedingungen. Das Ergebnis: Ein außergewöhnlicher Geräteträger, der Leistung und Kompaktheit perfekt vereint.
Gelungener Lückenschluss zwischen den Fahrzeugklassen Hervorgegangen ist der APZ 1003 XL aus dem Modell APZ 1003, das mit seiner schmalen Bauweise und Wendigkeit punktet. Entwickelt und gebaut wird das bewährte Schmalspurfahrzeug im niedersächsischen Selsingen und überzeugt bereits seit den

70er Jahren vor allem Kunden der öffentlichen Hand. Die neu auf den Markt gekommene Variante APZ 1003 XL kombiniert Handhabung und Wendigkeit des Vorgängers mit der Zugkraft in der 9,5-Tonnen-Klasse. Der Geräteträger eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche, bei denen Flexibilität und Leistung gefragt sind. Der 175 PS starke FPT-Turbodieselmotor erfüllt die Abgasnorm Euro 6 und sorgt in Verbindung mit dem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb für eine effiziente Kraftübertragung. So bietet der APZ 1003 XL auch in anspruchsvollen Situationen zuverlässige Leistung. Mit einer Länge von nur 4,25 m und einem zulässigen Gesamtgewicht von 9,5 Tonnen ist der Hansa XL der ideale Begleiter für enge Einsatzbereiche. Er überbrückt die Lücke zwischen kleinen Schmalspurfahrzeugen


Je nach Anwendungsgebiet kann das Fahrzeug mit unterschiedlichen Aufbaugeräten ausgestattet werden – im Gegensatz zu kleineren Ausführungen auch mit schwereren Gerätschaften wie beispielsweise für den Winterdienst.
und den größeren, schwereren Allroundern wie dem Unimog und überzeugt mit einer beeindruckenden Nutzlast von 5,5 Tonnen.
Ideal für enge Einsatzbedingungen
Das Fahrerhaus des Hansa XL bietet nicht nur Platz für bis zu drei Personen, sondern auch exzellente Rundumsicht – unterstützt durch moderne Kamerasysteme und leistungsstarke Scheinwerfer. Der zentrale Joystick sorgt für eine intuitive Bedienung und komfortables Fahren, während der 175 PS starke Dieselmotor zusammen mit dem hydrostatischen Allradantrieb und der Allradlenkung für herausragende Manövrierfähigkeit sorgt –sowohl auf engen Straßen als auch im schwierigsten Gelände.
Kompakt und leistungsstark
Im Praxistest zeigte der Hansa XL seine wahre Stärke: Mit vier Hydraulikkreisen und Schnellverschlüssen lässt er sich im Handumdrehen mit Anbaugeräten wie Kehrmaschinen oder Streuern ausstatten. Auch bei schweren Anhängelasten bleibt der Hansa XL souverän: Er zieht problemlos Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen. Johannes MautnerMarkhof zieht ein positives Fazit: „Der Hansa XL ist nicht nur eine kompakte Lösung, sondern auch ein äußerst flexibles und leistungsstarkes Gerät für kommunale Aufgaben. Egal ob Sommer- oder Winterdienst – dieser Fahrzeugtyp wird zum unverzichtbaren Partner für Gemeinden und Dienstleister.“
MASSGESCHNEIDERT
AUF IHRE ANFORDERUNGEN.
Premium-Produktportfolio
Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Lösungen
Original-Ersatzteile
Regionaler Partner
Fahrzeug-Einschulung

Leise, flexibel und robust: Mit dem Viarox-Schneepflug bringt der Tiroler Winterdiensthersteller Kahlbacher eine neue Generation von Räumtechnik auf die Straße. Dank innovativer Gleitschar-Technik und intelligenter Dämpfung räumt das Gerät nicht nur effizient, sondern auch besonders schonend – für Fahrer, Maschine und Straße.
Wenn es darauf ankommt, muss im Einsatz jeder Handgriff sitzen – und jede Gerätschaft einwandfrei funktionieren. Gerade im kommunalen Winterdienst, wo Einsatzzeiten oft in der Nacht beginnen und unter schwierigen Bedingungen ablaufen, sind Verlässlichkeit, Präzision und technischer Vorsprung bei Winterdienstgerätschaften entscheidend. Der neue Viarox Gleitschar-Schneepflug des Tiroler Herstellers Kahlbacher bringt diese Eigenschaften serienmäßig mit – und macht damit dem Fahrer die Arbeit spürbar leichter. Das Herzstück des Viarox ist eine geteilte Bauform mit einzeln aufgehängten Gleitschar-Segmenten, die sich bei Hindernissen flexibel zurückklappen. Der Clou: Diese Ausweichfunktion geschieht nicht ruckartig, sondern kontrolliert – durch spezielle Gummilagerungen und eine durchdachte Wippentechnik, die von Kahlbacher entwickelt wurde. Das Ergebnis: mehr Sicherheit bei Kontakt mit Kanaldeckeln, Randsteinen oder Bodenwellen, weniger Verschleiß, und ein durchgehend ruhiger Lauf auch auf unebenem Terrain.
Weniger Lärm, mehr Komfort – für Fahrer und Umwelt
Die Viarox-Dämpfung basiert auf Gummibuchsen, die zwischen Rahmen und Scharsegmenten sitzen. Diese absorbieren Stöße und Schwingungen effektiv – und reduzieren gleichzeitig die Geräuschentwicklung. In der Praxis bedeutet das einen ruhigeren Lauf, geringere Belastung für Mensch
und Maschine, und spürbar angenehmeren Arbeitskomfort in der Fahrerkabine – besonders bei langen Einsätzen.
Längere Lebensdauer
Besonderes Augenmerk wurde auf die Überlastsicherheit gelegt. Anders als starre Pflüge, die bei einem harten Aufprall beschädigt werden können, reagieren die Viarox-Gleitscharsegmente dynamisch: Trifft ein Segment auf ein Hindernis, weicht es kontrolliert in eine definierte Schlitzführung zurück – und zwar nach hinten oben, mit einem Ausweichwinkel von bis zu 64 Grad. Das schützt das Trägerfahrzeug, die Straße und das Gerät selbst. Bei stärkerer Belastung geben spezielle Kahlbacher-Gummi-Rückholelemente nach, die eigentliche Schareinheit bleibt dabei unversehrt. Ein Vorteil, der sich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in der Lebensdauer und Wartungsbilanz bemerkbar macht.
Maximale Belastbarkeit
Der Viarox ist auf maximale Belastbarkeit ausgelegt. Der Grundrahmen besteht aus einem stabilen Doppelrohrrahmen, der durch ein durchgehendes Scharblech im oberen Bereich zusätzlich verstärkt wird. Im unteren Bereich kommen gewichtsoptimierte Gleitscharsegmente zum Einsatz – so durchdacht konstruiert, um bei Kollisionen nur die Abscherelemente zu belasten, während der Hauptkörper des Pflugs

Die einzeln gelagerten Gleitscharsegmente des Viarox folgen präzise dem Straßenprofil – für sauberes Räumen auch bei Unebenheiten.
unversehrt bleibt. Das reduziert nicht nur die Reparaturkosten, sondern auch die Ausfallzeiten im Winterdienst.
Technik aus Tirol – Kahlbacher seit 1949
Hinter dem Viarox steckt ein Unternehmen mit langer Tradition: Die Kahlbacher Machinery GmbH mit Sitz in Kitzbühel entwickelt seit über 75 Jahren innovative Technik für den Winterdienst. Was 1949 als Schmiedewerkstatt begann, ist heute ein international gefragter Spezialist für
Schneepflüge, Fräsen und Räumgeräte mit eigenen Produktionsstandorten in Österreich. Kahlbacher setzt auf langlebige Materialien, praxisnahe Entwicklung im Dialog mit Anwendern – und nicht zuletzt auf kontinuierliche Innovation, wie es sich beim Viarox beispielhaft zeigt. Optimale Fahrbahnanpassung, geringe Geräuschentwicklung, hohe Überlastsicherheit und einfache Wartung machen den Schneepflug zu einem durchdachten Helfer für anspruchsvolle Einsätze im Winterdienst.

Die robuste Doppelrohrrahmen-Konstruktion sorgt für Stabilität selbst unter härtesten Winterbedingungen.

Die Anforderungen im kommunalen Straßenunterhalt steigen stetig – nicht nur wegen wachsender Sicherheits- und Effizienzansprüche, sondern auch im Hinblick auf ökologische Aspekte wie den Insektenschutz und den Erhalt der Biodiversität. Gleichzeitig müssen Bedienkomfort, Einsatzflexibilität und Fahrzeugkompatibilität gewährleistet bleiben. Mit innovativen Auslegerlösungen und speziell entwickelten Mähsystemen bietet das Schwarzwälder Unternehmen MULAG moderne Werkzeuge für einen wirtschaftlichen und gleichzeitig naturschonenden Ganzjahreseinsatz im kommunalen Bereich. Besonders hervorzuheben: Der neue Frontausleger MFK 300 für Kleingeräteträger und die ECO-Grünpflegeköpfe, die durch wissenschaftlich belegte Insektenschonung neue Maßstäbe setzen.
Bei der Straßenunterhaltung sind viele Anforderungen durch die Beschaffenheit des Straßenbegleitgrüns, immer wichtiger werdende ökologische Aspekte, aber auch der Komfort für Bediener und technische Grenzen der Trägerfahrzeuge zu berücksichtigen. Mit den bewährten Auslegerprodukten von MULAG können Kommunen effizient, wirtschaftlich und auch ökologisch bei ihren Aufgaben im Straßenbetrieb arbeiten.
Das Spezialfahrzeugunternehmen aus dem Schwarzwald ist einer der führenden Hersteller von innovativer Straßen-

Der Grünpflegekopf ECO 1200 ermöglicht eine besonders schonende Mahd entlang von Straßenrändern – wissenschaftlich bestätigt und praxisbewährt.
unterhaltungstechnik für Unimog, Kommunaltraktoren und andere Systemträger: Professionelle Auslegersysteme zum Böschungsmähen, Freischneiden, Gehölzpflege, Wascharbeiten und Tunnelreinigung stehen zur Auswahl. Alle Ausleger können mit einer Vielzahl von Arbeitsgeräten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche ausgestattet werden, um einen optimalen Ganzjahreseinsatz zu ermöglichen.
Innovativer Ausleger für Kleingeräteträger
Der neue Frontausleger MFK 300 eignet sich zum Einsatz an Kleingeräteträgern, besonders für die Bearbeitung von Grünflächen entlang schmaler öffentlicher Straßen und Wege. Im kommunalen Bereich können mit flexibel austauschbaren Arbeitsgeräten zum Beispiel Mäharbeiten oder Gehölzpflege durchgeführt werden. Mit einer Reichweite von 4,3 m ab Fahrzeugmitte, einsetzbar in Rechts- und Linksarbeit, und einer Querverschiebung von 1.200 mm kann der Ausleger effizient in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden. Angebaut über ein Fronthubwerk oder eine vorhandene Frontanbauplatte und angetrieben von der fahrzeugseitigen Proportionalhydraulik kann der MFK 300 mit einer CAN-BUS/proportional Steuerung mit Auslegerentlastungsregelung Typ AER oder auch optional mit der komfortableren Auslegerentlastungssteuerung Typ m|tronic eingesetzt werden. Der neue MULAG-Frontausleger rundet das bewährte Produktprogramm im Bereich Frontausleger ab.
Effektive ECO-Grünpflegeköpfe
Auch für eine ökologische Bearbeitung des Straßenbegleitgrünes zum Schutz von Insekten bietet MULAG seit Jahren

Der neue MULAG-Frontausleger MFK 300 überzeugt mit 4,3 m Reichweite ab Fahrzeugmitte und einem Querverschub von 1.200 mm – ideal für enge Einsatzbereiche an schmalen Straßen und Wegen.
ausgereifte Profi-Lösungen an. Für den Hersteller hat das Thema „Erhaltung der Biodiversität“ eine herausragende Bedeutung. Daher wurde unter wissenschaftlicher Begleitung mit der ECO-Grünpflegekopf-Serie ein insektenschonendes Mähwerk entwickelt und in den Markt erfolgreich eingeführt, mit dem die durch Mahd bedingten Verluste von Insekten minimiert werden. Die Wirksamkeit des innovativen Mähkonzeptes konnte im Rahmen von Studien der deutschen Universitäten Hohenheim und Tübingen mit einem bis zu 80 Prozent geringeren Insektenverlust beim Mähen mit dem ECO 1200 plus Grünpflegekopf nachgewiesen werden. Der Anwender kann somit auf wissenschaftlich fundierte Techno-


logien bei den immer wichtiger werdenden Fragen des ökologisch-nachhaltigen Straßenunterhalts zurückgreifen und muss sich nicht nur auf werbewirksame Aussagen verlassen.
Professionelle Lösungen
Damit stehen mit den Auslegerprodukten von MULAG professionelle Arbeitsgeräte zur optimalen Umsetzung aller Anforderungen an eine moderne Pflege des Straßenbegleitgrüns bereit. Sowohl bei der Neubeschaffung von professionellen Mählösungen als auch zur Ergänzung vorhandener Lösungen eignet sich die umfangreiche Produktpalette mit bewährter Technik.


22. – 23. Oktober 2025
Kommunale Bedarfe auf den Punkt gebracht.

KOMMUNALE.de
In Zusammenarbeit mit:
KOMMUNALE.de/linkedin #KOMMunity


Kompakt, leistungsstark und sicher: Der Friedhofsbagger von Maschinenbau Riebsamen meistert auch schwierigste Einsätze auf engstem Raum. Live erlebbar vom 22.–24. Juni 2025 auf der demopark in Eisenach – Europas größter Freilandausstellung für den Kommunalbereich.

Eng, empfindlich, anspruchsvoll – Arbeiten auf Friedhöfen stellen ganz besondere Anforderungen an Mensch und Maschine. Mit einem speziell entwickelten Friedhofsbagger liefert Maschinenbau Riebsamen eine durchdachte Lösung für kommunale Bauhöfe: kompakt in der Bauweise, leistungsstark im Einsatz und sicher im Handling.
Auf vielen kommunalen Friedhöfen wird die maschinelle Unterstützung bei der Grabherstellung zur Herausforderung: Eng geschnittene Wege, empfindliche Bodenbeläge und schwierige Geländeverhältnisse verlangen Maschinen, die präzise, zuverlässig und sicher arbeiten. Mit dem eigens für diesen Zweck entwickelten Friedhofsbagger bietet Maschinenbau Riebsamen eine Lösung, die diese Anforderungen erfüllt, denn mit einer Fahrwerksbreite von nur 60 cm ist der Bagger ein echtes Raumwunder. Dank optionaler hydraulischer Spurverstellung lässt sich das Fahrwerk auf bis zu 90 cm verbreitern, um bei Bedarf zusätzliche Standsicherheit zu gewinnen. Das ermöglicht nicht nur ein einfaches Manövrieren durch schmale Wege und zwischen Grabreihen, sondern auch den sicheren Stand selbst auf anspruchsvollem Untergrund. Seine hohe Reichweite – bis zu 6,2 m mit Verlängerung – erlaubt es, aus der zweiten Reihe zu arbeiten, was besonders auf belegten oder sensibel gestalteten Friedhöfen ein großer Vorteil ist. Bei einer Ausladung von 5 m stemmt der kompakte Bagger noch 500 kg – ideal für die meisten gängigen Hebe- und Grabarbeiten im Friedhofsalltag. Mit einer Grabtiefe von bis zu 4 m deckt er dabei die typischen Anforderungen vollständig ab. Ein echtes Plus in puncto Sicherheit bieten die vier hydraulischen Abstützungen. Sie sind stufenlos um 90 Grad schwenkbar und lassen sich flexibel an die Platzverhältnisse anpassen. Die serienmäßigen aufsteckbaren „Schuhe“ vergrößern zusätzlich die Abstützfläche – ein wirksamer Schutz gegen Einsinken bei weichen Böden. Der integrierte Hangausgleich, der tiefe Schwerpunkt und das robuste Raupenfahrwerk sorgen zudem für Stabilität auch in Hanglagen oder auf unebenem Gelände. Besonderes Augenmerk legte Riebsamen auf die Bedienung. Der Friedhofsbagger ist mit einer feinfühligen Funkfernsteuerung ausgestattet, die Zugriff auf alle Baggerfunktionen erlaubt. Das ermöglicht dem Bediener eine exakte Steuerung aus sicherer Entfernung und vom jeweils optimalen Standpunkt aus – ein unschätzbarer Vorteil beim Arbeiten auf engen und sensiblen Flächen. Gleichzeitig reduziert die Fernbedienung den Personalbedarf und erhöht die Arbeitssicherheit erheblich. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören unter anderem ein Kranhaken, ein endlos drehbarer Zweischalengreifer mit Auswerfer sowie eine leistungsstarke Endlosdrehfunktion des Baggerarms. Umfangreiche Zusatzausstattungen – darunter ein hydraulischer Meißel, Erdbohrer, Elektroantrieb (380 V) oder Alu-Überfahrschienen – runden das Angebot ab. Mit dem Friedhofsbagger von Maschinenbau Riebsamen erhalten kommunale Bauhöfe ein hochspezialisiertes Arbeitsgerät, das Sicherheit, Effizienz und Bedienkomfort überzeugend vereint – und das in einem Format, das selbst den Anforderungen historischer oder denkmalgeschützter Friedhöfe gerecht wird.

Bucher Municipal baut sein Spektrum von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Straßenreinigung, Kanalreinigung und den Winterdienst weiter aus. Elektrische Fahrzeuge und Aufbauten sorgen in allen Sparten für einen emissionsarmen Kommunaldienst. Smarte Assistenzsysteme und KI-gestützte Autonomie entlasten die Fahrer bei ihrer täglichen Arbeit. Intelligente Lösungen vernetzen die Fahrzeuge miteinander und bringen Flottenmanagern einen genauen Durchblick im Maschinen- und Gerätepark.
Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio deckt Bucher Municipal unterschiedlichste Anforderungen im kommunalen Alltag ab. Von der kompakten Kehrmaschine über effiziente Schwemmfahrzeuge bis hin zu modular aufgebauten Großkehrmaschinen bietet der Hersteller Lösungen, die gleichermaßen auf Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und Praxisorientierung setzen.
Kompakte Stärke: Bucher CityCat V20 Serie
In der städtisch besonders gefragten 2-m³-Klasse bietet die Bucher CityCat V20 Serie eine leistungsstarke Kombination aus Wendigkeit, Kehrleistung und Variantenvielfalt. Die vier Modelle – CityCat V20, V20e, VS20 und VS20e – decken verschiedene Einsatzszenarien ab. Während die Dieselvarianten mit Euro-6- bzw. Stufe-5-Motoren betrieben werden, ermöglichen die vollelektrischen Ausführungen einen leisen, emissionsfreien Betrieb über eine komplette Arbeitsschicht hinweg. Die leichten 3,5-t-Modelle sind zudem mit Führerschein Klasse B fahrbar und besonders geeignet für den Einsatz auf Geh- und Radwegen oder in historischen Innenstädten. Für den Winterdienst sind sämtliche Varianten vorbereitet.
Schwemmtechnik mit hoher Reichweite: W20 und W20e
Die auf der Bucher CityCat-Plattform basierenden Schwemmfahrzeuge W20 und W20e bringen bis zu 2.000 l Wasser mit und überzeugen mit hoher Reichweite sowie effizientem Sprühsystem. Ein an der Fahrzeugfront montierter TeleskopSprühbalken mit hydraulischer Steuerung deckt einen Reinigungsbereich von 1,3 bis 2,4 m ab. Die leistungsstarke 60-barPumpe liefert 70 l/min, wobei der Wasserdruck stufenlos aus
der Kabine reguliert werden kann. Die vollelektrische Bucher CityCat W20e ist mit einem 80 kWh-Batteriepaket ausgestattet – genug für einen ganztägigen Einsatz bei Null-Emissionen.
Neue Maßstäbe in der Kompaktklasse:
Bucher CityCat VR50e
Mit einem Volumen von 5,6 m³, Vierradlenkung und 137 kWh
Batteriekapazität setzt die vollelektrische Bucher CityCat VR50e ein deutliches Zeichen in Richtung nachhaltiger Stadtsauberkeit. Das Fahrzeug erreicht dieselbe Kehrleistung wie das Dieselpendant und ist optional mit 50 km/h (Elektro und Diesel) bzw. 80 km/h (nur Diesel) Höchstgeschwindigkeit erhält-


Der Schneepflug Bucher Wingx überzeugt mit zwei flexibel schwenkbaren Seitenflügeln und großer Räumleistung.
lich. Rechts- oder Linkslenkung, gezogenes oder geschobenes Kehraggregat – die Konfigurationen sind flexibel wählbar.
Maximale Flexibilität: Bucher MaxPowa V Serie
Die Aufbaukehrmaschinen der Bucher MaxPowa V Serie kombinieren hohe Flächenleistung mit intelligenter Ausstattung und geringem Energiebedarf. Die vier verfügbaren Größen (5, 6,5, 8 und 12 m³) bieten ein ausgewogenes Verhältnis aus Wasser- und Schmutzbehältervolumen. Assistenzsysteme wie CSI (Clean Street Index), SmartPickup und SmartSetup analysieren und optimieren in Echtzeit Kehrintensität, Gebläsestärke und Aggregatposition – ein Vorteil insbesondere bei wechselnden Einsatzbedingungen und hohen Effizienzanforderungen.
Fahrerassistenz und Automation
Die zunehmende Komplexität kommunaler Einsätze erfordert intelligente Unterstützung. Mit SafeSweep bietet Bucher Municipal ein Kollisionsvermeidungssystem, das Front- und Seitenbesen sowie das Fahrzeug selbst überwacht und bei Bedarf automatisch abbremst. Das System PathFollow ermöglicht eine automatisierte Randführung entlang von Bordsteinen oder parkenden Fahrzeugen. Beide Systeme reduzieren die Belastung für Fahrpersonal und erhöhen die Sicherheit im täglichen Betrieb.
Kanalreinigung mit System – auch vollelektrisch
Im Bereich der Kanalreinigung bietet Bucher Municipal kompakte Zwei-Achs-Fahrzeuge der Bucher CityFlex Serie mit bis zu 4.000 l Tankvolumen sowie das Mittelklassemodell GullyFlex C80 mit 8.000 l. Für emissionssensible Zonen kommt das vollelektrische Modell CityFlex C40e zum Einsatz. Es vereint geringe Geräuschentwicklung mit hoher Effizienz und arbeitet vollständig abgasfrei.
Zukunftsfähige Winterdiensttechnik
Mit dem Dreiachs-Schneepflug Wingx präsentiert Bucher Municipal eine robuste Lösung für großflächiges Räumen. Zwei bewegliche Seitenflügel erlauben variable Arbeitsbreiten. Einzigartig ist das MBS-System von Bucher Municipal
– ein Räumschild mit integriertem Solesystem – das Streumaterial spart und Räumintervalle verlängert. Der vollelektrische Schneckenstreuer Bucher Husky V10e sowie der vielseitig umrüstbare Bucher VarioMax sorgen für nachhaltige, flexible Einsätze im kommunalen Winterdienst.
Digitales Flottenmanagement mit Bucher Connect
Mit Bucher Connect bietet der Hersteller einen digitalen Service für das Management Ihrer Reinigungs- und Räumarbeiten sowie für die Einsatzplanung und Wartung der Fahrzeuge. Ein Teil davon ist das satelliten- und cloudbasierte System Bucher Assist, mit dem Bucher Municipal seine bereits etablierten digitalen Systeme für automatisierte Streueinsätze, Datenerfassung und Abrechnung erweitert. Ob Kehrmaschine, Schwemmfahrzeug, Winterdiensttechnik oder Kanalreiniger: Bucher Municipal bietet ein breites, praxisnahes Portfolio für moderne kommunale Anforderungen. Vollelektrische Modelle, smarte Assistenzsysteme und digitale Services machen die Fahrzeuge zu zukunftssicheren Partnern im kommunalen Einsatzalltag.

Digital vernetzt und leistungsstark im Einsatz: Die Bucher MaxPowa V Serie integriert moderne Assistenzsysteme für maximale Effizienz im täglichen Reinigungsbetrieb.

Der vom AIT entwickelte Bilddatensatz ermöglicht die präzise Erkennung, Konturverfolgung und geometrische Analyse von Baumstämmen – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen, Verdeckungen oder variierenden Umgebungsbedingungen. Mit über 2.000 Bildern und mehr als 51.000 erfassten Stamm-Komponenten stellt TimberVision den größten öffentlich verfügbaren Datensatz für KI-gestützte Anwendungen in der Forstwirtschaft dar.
Mit „TimberVision“ stellt das AIT Austrian Institute of Technology den weltweit größten öffentlich verfügbaren Bilddatensatz zur Baumstammerkennung vor. Die Kombination aus präziser Geometrieanalyse und Objekterkennung sowie frei zugänglicher Software schafft eine neue Grundlage für automatisierte Prozesse in der Forstwirtschaft – von der Inventur bis zur Holzernte.
In der Forstwirtschaft sind viele manuelle Tätigkeiten wie Inventurarbeiten, Holzernte und Rundholzvermessung nicht nur zeitaufwändig, sondern erfordern auch Einsätze in schwer zugänglichen oder gefährlichen Umgebungen. Automatisierte Arbeitsmaschinen und -prozesse können hier Abhilfe schaffen und die Arbeitskräfte unterstützten, aber auch vor Risiken schützen. Dazu ist eine robuste Technologie erforderlich, die Baumstämme zuverlässig erkennt, vermisst und die erfassten Daten für weitere Arbeitsprozesse bereitstellt. Bislang fehlte es an ausreichenden Trainings- und Referenzdaten, die für die Entwicklung und Validierung KI-basierter Modelle unerlässlich sind. Hier setzen die Expert:innen Julia Simon, Daniel Steininger, Andreas Trondl und Markus Murschitz vom Center for Vision, Automation & Control des AIT Austrian Institute of Technology an. „Mit TimberVision schafft das AIT durch ein leicht zugängliches System und einen einzigartigen Bilddatensatz die Basis für die nächste Generation autonomer Maschinen in der Forstwirtschaft,“ erläutert Markus Murschitz, Projektleiter am AIT.
TimberVision – der weltweit größte öffentlich verfügbare Bilddatensatz für die Digitalisierung in der Forstwirtschaft „Unsere Arbeit stellt einen neuartigen Algorithmus vor, um in Echtzeit Baumstämme inklusive ihrer geometrischen Eigenschaften wie Umrisse und Mittellinien zu erkennen. Unser Ansatz bestimmt die Baumstämme und ihre Bestandteile mit hoher Genauigkeit. Alle Daten werden zu einer einheitlichen Darstellung fusioniert,“ erläutert Julia Simon. „Das Besondere ist, dass unser System selbst unter herausfordernden Bedingungen wie beispielsweise schwierigen Witterungsverhältnissen oder teilweisen Verdeckungen verlässlich funktioniert und die Baumstämme präzise über Bildsequenzen hinweg verfolgt, das heißt sie auch immer wieder erkennt,“ ergänzt ihr Kollege Daniel Steininger.
Mehr als 51.000 erfasste Baumstamm-Komponenten Mit TimberVision haben sie einen neuartigen, öffentlich zugänglichen Bilddatensatz und ein KI-Modell entwickelt, das Baumstämme zuverlässig erkennt und deren Konturen präzise erfasst. Über 2.000 annotierte Farbbilder und mehr als 51.000 erfasste Baumstamm-Komponenten, inklusive Schnitt- und Mantelflächen, machen ihn zur größten Sammlung ihrer Art. Dafür hat das Team die Daten mit handelsüblichen RGB-Kameras aufgenommen und mit einer eigens entwickelten semiautomatischen Verarbeitungspipeline annotiert. Es wurden mehrere KI-Modelle trainiert und auf vielfältige Umfeldbedingungen, unterschiedliche Standorte, Distanzen, Licht- und Wet-

Praxisvorteil durch KI: TimberVision erleichtert Vermessung, Dokumentation und Automatisierung in der Forstwirtschaft.

terverhältnisse sowie Baumstammvariationen systematisch evaluiert, um eine hohe Modellrobustheit sicherzustellen. Die Genauigkeit des Modells wurde in mehreren Tests erfolgreich bestätigt. Durch Kombination mit weiteren Sensoren kann das System beispielsweise für eine automatisierte Inventur sowie eine optimierte Holzernte und Verladung eingesetzt werden.
TimberVision als Open Source
Um die Forschung weiter voranzutreiben, stellt das AIT-Team den gesamten TimberVision-Datensatz sowie die entwickelten Algorithmen für akademische Zwecke öffentlich zur Verfügung. Wissenschafter:innen weltweit sind eingeladen, das System zu nutzen und weiterzuentwickeln.



Größter verfügbarer Bilddatensatz zur Baumstammerkennung
• KI-gestützte Algorithmen zur exakten Positions- und Konturbestimmung
Vereinzelung und Verfolgung individueller Baumstämme über Bildsequenzen hinweg
Geometrische Analyse zur Berechnung von Mittelachsen und Baumstammdimensionen für eine präzisere Handhabung
Know-how-Transfer via GitHub für wissenschaftliche Kooperationen













Wenn Maschinen nicht nur bestaunt, sondern gleich selbst ausprobiert werden dürfen, wenn Fachleute direkt am Gerät beraten und die Praxis den Takt vorgibt, dann steht kein gewöhnlicher Messetag an. Genau dieses Erlebnis bot die erste Swiss Demo Park, die am 21. und 22. Mai 2025 auf dem Gelände der Swiss Future Farm in Tänikon stattfand. Die Premiere überzeugte mit echtem Praxisbezug, breitem Fachangebot und einer klaren Botschaft: Kommunale Technik muss unter Realbedingungen ihre Leistung unter Beweis stellen – und das ließ sich das Publikum der Swiss Demo Park live im Feldeinsatz zeigen.
Zwei Tage lang wurde die Swiss Future Farm im thurgauischen Tänikon zum Zentrum für kommunale Technik im Feldeinsatz. Im Rahmen der ersten Swiss Demo Park präsentierten 24 namhafte Schweizer Anbieter am 21. und 22. Mai ihre neuesten Maschinen und Fahrzeuge für den Kommunaleinsatz – nicht nur statisch, sondern in Bewegung. Auf über 3.000 m² Fläche

Der Einachsgeräteträger ist dank einer Vielzahl an Anbaugeräten für diverse Einsatzzwecke geeignet.
konnten rund 500 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz Technik live erleben, vergleichen und in direktem Austausch mit Fachleuten diskutieren. Gezeigt wurden Lösungen für den professionellen Unterhalt von Grünflächen, Hartplätzen, Hecken und Straßenrändern, ebenso wie für Bodenbearbeitung, Reinigung, Bewässerung, Transport und Logistik.



Sichere und komfortable Distanz-Bedienung per Funk mit dem ferngesteuerten Raupengeräteträger RoboFlail von Rapid.
Technik in Aktion
Im Zentrum der Veranstaltung standen Maschinen im praktischen Einsatz: Ob Mähgerät, Kehrmaschine oder multifunktionales Trägerfahrzeug – auf verschiedenen Parcours demonstrierten die Hersteller die Leistungsfähigkeit ihrer Technik unter realistischen Bedingungen. Viele der Geräte durften von den Gästen selbst gefahren oder bedient werden – ein Angebot, das auf großes Interesse stieß. Die Swiss Future Farm bot mit ihrer Infrastruktur die idealen Voraussetzungen für praxisnahe Vorführungen auf Wiesen, Böschungen und befestigten Flächen.
Direktkontakt mit den Fachleuten
Ein besonderer Pluspunkt war der persönliche Austausch: Fragen zu Einsatzmöglichkeiten, Umbauten oder Wartung konnten direkt vor Ort an den Ständen der Anbieter besprochen werden – kompetent, unkompliziert und praxisnah. Für Fachleute aus Werkhöfen, Gartenbauunternehmen oder Unterhaltsbetrieben war dies ein entscheidender Mehrwert.

Demo statt klassischer Messe
Im Unterschied zu traditionellen Messeformaten punktete die Swiss Demo Park mit direkter Nutzererfahrung: Maschinen konnten bei der Veranstaltung nicht nur eingehend besichtigt, sondern im echten Einsatz auf dem Gelände getestet werden. Das offene Format ermöglichte spontane Gespräche und den fachlichen Austausch, den unmittelbaren Vergleich verschiedener Anbieter sowie ein authentisches Bild der Alltagstauglichkeit der unterschiedlichen Geräte.
Positive Resonanz – Fortsetzung geplant
Das Echo auf die Veranstaltung war durchwegs positiv – sowohl von Ausstellern als auch von Besucherinnen und Besuchern. Die praxisorientierte Ausrichtung und der direkte Zugang zur Technik überzeugten auf ganzer Linie. Eine Fortsetzung der Swiss Demo Park ist bereits angedacht: Die nächste Ausgabe soll voraussichtlich im Mai 2027 erneut in Tänikon stattfinden.


Von 6. bis 9. Mai wurde die Interalpin auf der Messe Innsbruck zum internationalen Zentrum der Seilbahn- und Alpintechnik für alle wesentlichen Key Player, Entscheidungsträger aus allen Kontinenten und hochrangige internationale Wirtschaftsdelegationen. Die Fachmesse steht für einen einmaligen Branchenüberblick und die Präsentation technologische Weltneuheiten und Innovationen sowie zukunftsweisender Konzepte. Die 25. Ausgabe der Interalpin als Weltleitmesse der Branche im 50. Jubiläumsjahr war getragen von einer positiven Dynamik und Investitionsinteresse.
Rund 650 Aussteller aus 50 Nationen und 36.800 Fachbesucher aus allen Teilen der Welt – damit untermauerte die Interalpin Anfang Mai ihre Führungsrolle als Weltleitmesse für Seilbahn- und Alpintechnologie. Präsentiert wurden technologische Neuheiten und zukunftsweisende Lösungen aus allen relevanten Bereichen der Branche: Seilbahntechnologie und Aufstiegshilfen, urbane Mobilitätskonzepte, alpine Planung und Architektur, Pistendienst und Beschneiung, Zutritts- und Kassensysteme, Sicherheitslösungen sowie Anlagen für Freizeit und Sport. Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI) resümiert: „Die Interalpin hat mit ihrer 25. Ausgabe und zu ihrem 50-jährigen Jubiläum ihre führende Stellung als globale Leitmesse für alpine Technologien deutlich bestätigt. Die enorme internationale Beteiligung, die hohe Qualität der Aussteller und Fachbesucher, die Innovationsdichte und das große geschäftliche Interesse zeigen, wie stark die Messe als Plattform in der Branche verankert ist.“
Internationale Entscheidungsträger, hohe Investitionsbereitschaft
Die internationale Strahlkraft der Interalpin zeigte sich 2025 in den Besucherzahlen und der Zusammensetzung des Fachpublikums: Über 60 Prozent der registrierten Besucher reisten aus dem Ausland an, das Zutrittskontrollsystem der Messe Innsbruck vermerkte Registrierungen aus rund 130 Nationen – darunter Vertreter aus etablierten Märkten wie beispielsweise den USA, Frankreich, Italien, Japan oder Kanada ebenso wie aus aufstrebenden und neuen Regionen wie Südkorea, Kasachstan, Rumänien, Argentinien, Usbekistan oder Chile. Als Hauptgründe für den Messebesuch nann-
ten die Fachbesucher den vollständigen Überblick über alle marktführenden Anbieter, den Zugang zu technologischen Weltneuheiten und Innovationen sowie die Möglichkeit, internationale Geschäftskontakte zu knüpfen und Investitionsprojekte anzustoßen.
Neu: City Cable Car Solutions Erstmals präsentierte die Interalpin mit „City Cable Car Solutions“ (3CS) urbane Mobilitätslösungen mit seilbahnbezogener Technologie praktisch genauso wie in der Wissensvermittlung. Die steigende Bedeutung nachhaltiger Verkehrsmodelle in urbanen Räumen wurde mit Best-Practices, praxisnahen Anwendungsbeispielen und technischen Konzepten eindrucksvoll veranschaulicht. Bereits 10 Prozent der Fachbesucher zeigten Interesse an diesem Themenschwerpunkt.

Westa-Geschäftsführer Alois Weber stand interessierten Besuchern mit fundierten Informationen zu Winterdienstlösungen zur Verfügung.






Impressionen von den über 650 ausstellenden Unternehmen auf der Interalpin.
Wissenschaft trifft Praxis Erstmals fand die Europäische Inter-Alpine Natural Hazards Conference (INAC) statt, die sich mit aktuellen und künftigen Herausforderungen zu Naturgefahren im alpinen Raum beschäftigt. Das Konzept der Überlappung von INAC und Interalpin hat zu einem einzigartigen intensiven Austausch von Wissenschaft, Infrastruktur und Technik mit der Industrie unter dem Motto „Industry meets Science“ geführt.
Zentrale Plattform für Branchendialog und hochkarätiges Rahmenprogramm Neben der umfangreichen Leistungsschau bot die Interalpin 2025 erneut eine starke inhaltliche Plattform für Wissenstransfer, Networking und strategischen Dialog. Die Interalpin


Inspiration Days überzeugten mit einem Programm zu zentra len Zukunftsthemen der Branche – von nachhaltigem alpinem

Tourismus über urbane Seilbahnlösungen und Naturgefahrenmanagement bis hin zu den Potenzialen von Künstlicher Intelligenz. „Es ist sehr erfreulich, dass die hohe Qualität des Angebots verbunden mit der Interalpin auch zu einer steigenden Nachfrage für die Fort- und Weiterbildungsangebote führt“, berichtet Projektleiter Stefan Kleinlercher. Hochkarätige Parallelveranstaltungen belegen die Verankerung der Fachmesse in der Branche, darunter die Österreichische Seilbahntagung des Österreichischen Seilbahnverbands, die Generalversammlung und die Tagung der Internationalen Organisation für das Seilbahnwesen (OITAF) oder die SIEPPUR Sustainable Snow Management Konferenz der International Biathlon Union (IBU). Die nächste, und damit 26. Interalpin findet vom 20. bis 23. April 2027 auf der Messe Innsbruck statt.



Wie gestalten wir die kommunale Infrastruktur von morgen – effizient, digital und klimafit? Antworten auf diese Fragen lieferte die ASTRAD & austroKOMMUNAL 2025 vom 14. bis 15. Mai, die sich einmal mehr als wichtigste Fachmesse Österreichs für kommunale Technologien präsentierte. Bei ihrem 15. Jubiläum vereinte die Veranstaltung wegweisende Technik, praxisnahe Lösungen und zukunftsgerichteten Austausch an einem Ort.
Mit praxisnahen Fachimpulsen und zahlreichen Technikpremieren hat die 15. ASTRAD & austroKOMMUNAL in Wels ihre Vorreiterrolle im Bereich kommunaler Technologien bestätigt. Am 14. und 15. Mai 2025 wurde das Messegelände zum Treffpunkt für Fachbesucher aus Politik, Verwaltung, Praxis und kommunalen Dienstleistungsbetrieben. Rund 4.500 Teilnehmende aus dem In- und Ausland informierten sich über aktuelle Entwicklungen in der Kommunaltechnik, Straßenerhaltung und Umweltwirtschaft. Begleitet von frühsommerlichem Wetter, präsentierten 130 Aussteller auf 25.000 m² Ausstellungsfläche Lösungen für Gegenwart und Zukunft.

Anlaufpunkt für kommunale Fachwelt
Mit ihrer kompakten Zwei-Tages-Struktur, dem klaren Themenfokus und der gelungenen Mischung aus Ausstellung, Fachprogramm und Praxisvorführungen hat sich die ASTRAD & austroKOMMUNAL als bedeutende kommunale Fachmesse etabliert. Bürgermeister Harald Gnadenberger aus Gresten brachte es auf den Punkt: „Hier bekommen wir in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick – das hilft uns, fundierte Entscheidungen für anstehende Investitionen zu treffen.“ Auch Bürgermeister Helmut Haslinger aus St. Willibald zeigte sich überzeugt: „Die Messe ist gut organisiert, bietet eine große


Kommunalhersteller Hydrac war mit seinem Winterdienstprogramm vertreten.
Produktvielfalt und ist eine ideale Gelegenheit, sich mit den Mitarbeitern über mögliche Anschaffungen zu informieren.“
Gelegenheit zum Vernetzen
Die Stimmung unter den ausstellenden Unternehmen war sehr positiv. Qualitativ hochwertige Kontakte und reges Interesse des Fachpublikums waren der allgemeine Tenor unter den Ausstellern. „Hier trifft man alle, die in der kommunalen Infrastruktur mitreden – von Politikern über Einkäufer bis zu Praktiker“, so das Resümee eines Ausstellers aus der Fahrzeugtechnik. Die entspannte Atmosphäre und der persönliche Austausch wurden von vielen als entscheidende Stärken der Messe hervorgehoben. Besonders erfreulich: Auch junge Fachkräfte waren verstärkt präsent.
Fachwissen im Fokus: ASTRAD Symposium liefert Antworten Parallel zur Ausstellung bot das ASTRAD Symposium fachlich fundierte Einblicke in aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Unter dem Motto „Nachhaltig, effizient, praxisnah“ reichte das Themenspektrum von biodiversitätsfördernder Grünraumpflege über GIS-gestützte

Das insektenfreundliche Mähsystem von Mulag stieß auf reges Interesse.
Routenoptimierung bis zur Elektromobilität im kommunalen Einsatz. Besonders nachgefragt waren die Vorträge zu Winterdienststrategien und Grünflächenmanagement. Der direkte Austausch mit Experten machte das Symposium zu einem echten Mehrwert für Entscheidungsträger und Anwender.
Technologie im Einsatz – vom Testgelände in den Arbeitsalltag Ein Fokus der Messe sind greifbare Lösungen für den kommunalen Alltag: Ob Geräteträger, Kehrmaschine oder Abfallsammelfahrzeug – auf dem Testgelände konnten Besucher Maschinen selbst steuern oder sich vom Fachpersonal demonstrieren lassen. Das praxisorientierte Format erwies sich erneut als Publikumsmagnet.
Zukunft zum Mitnehmen: Erster E-Müllwagen für die Stadt Wels Ein deutliches Signal setzte die feierliche Übergabe eines vollelektrischen Abfallsammelfahrzeugs an die Gastgeberstadt. „Eine funktionierende Daseinsvorsorge ist für die Bevölkerung selbstverständlich – wir setzen dabei zunehmend auf klimafreundliche Technologien“, erklärte Bürgermeister Andreas Rabl bei der Schlüsselübergabe.

Als einer der größten privaten Händler für Land- und Baumaschinen in Österreich bietet Mauch eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, über die man sich am Messestand des Unternehmes eingehend informieren konnte.

Ein Helikopter als Lastenträger, eine äußerst beengte Baufläche und Steilhänge mit bis zu 100 Prozent Steigung, die es zu überwinden galt: Die Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Mönchsberg in Salzburg war wahrlich kein gewöhnliches Bauprojekt – sondern eine Herkulesaufgabe im Dienste der Trinkwasserversorgungssicherheit, die trotz aller widrigen Umstände ohne nennenswerte Zwischenfälle mit Bravur gemeistert wurde.
Auf einer der wichtigen Verkehrsachsen zwischen dem Süden und dem Westen von Salzburg passierte es: Ein Rohrbruch der Trinkwasserversorgungsleitung, die 7 km vom Fuße des Untersbergs zu einem der beiden Hochbehälter im Herzen der Stadt auf den Mönchsberg führt. „Die Straße war komplett geflutet, glücklicherweise ist diese gut entwässert, sodass kaum Schäden entstanden sind“, erinnert sich Dipl.-Ing. Ludwig Staiger, Leiter der Trinkwasserversorgung beim Versorgungsunternehmen Salzburg AG. Bereits seit 1929 versorgt diese Leitung große Teile Salzburgs mit exzellentem Wasser: Die über Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur bestand zuletzt aus drei parallel geführten Rohrleitungen unterschiedlicher Baujahre (1929 und 1964). Trotz regelmäßiger Wartung kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Rohrbrüchen, was die Dringlichkeit einer umfassenden Erneuerung verdeutlichte. Besonders gravierend waren ein Längsriss in einer Graugussleitung 2017 sowie der erwähnte spektakuläre Rohrbruch 2023, der die Verbindungsstraße entlang des Stadtbergs teilweise überflutete. Auch wenn die Planungen zur Erneuerung bereits vor diesem Ereignis angelaufen waren, bildete der Vorfall den konkreten Auftakt für die Umsetzung eines rund 480 m langen Abschnitts der Transportleitung, die als Hauptader der Versorgung gilt.
Aufgabe für Experten
Steile Hänge, mittelalterliche Mauern, Denkmal- und Naturschutz machten die Sanierung der Transportwasserleitung am Mönchsberg zu einer echten Herausforderung für Planung, Logistik und Bau. Die Baustelle am Mönchsberg stellte die Experten von Salzburg AG und das Team der Kohlhofer Ziviltechniker GmbH vor logistische Prüfungen. Die neue Leitung musste unter extrem beengten Bedingungen durch steile Gartenanlagen und historische Baustrukturen wie den Bertholdsturm – einem Teil einer historischen Befestigungsanlage – verlegt werden. Die anspruchsvolle Bautätigkeit übernahm die Gebrüder Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH, bei den Leitungsrohren vertraute man auf die Qualität der Gussrohre von der Tiroler Rohre GmbH (TRM)
Berücksichtigung von Eigentümern und Naturschutz
Bevor das Bauvorhaben starten konnte, musste jedoch ein einvernehmliches Auskommen mit den Eigentümern gefunden werden, durch deren Gärten die Leitungstrasse führt. Den Unannehmlichkeiten der Baustelle in dem eng bebauten Wohngebiet wurde dank beständiger und offener Kommunikation seitens Salzburg AG mit Verständnis begegnet – keine Selbstverständlichkeit bei einem Projekt dieses Ausmaßes. Zusätzlich galt es, dem Naturschutz Rechnung zu tragen: Amphibienzäune wurden aufgestellt und Ersatzlebensräume gebaut.
Knifflige Bauetappe in Hanglage Abschnitte mit bis zu 100 Prozent Steigung und die Nähe zu denkmalgeschützten Bauwerken verlangten Fingerspitzengefühl sowohl in der Planung als auch in der Durchführung. „Das Gelände auf der Baustelle war teils so steil, dass nach längeren Regenschauern die Bautätigkeit für ein paar Tage pausieren musste – der Bagger hätte wegrutschen können“, berichten Bauleiter Ing. Andreas Keutz und Polier Heiko Krill unisono von den widrigen Umständen vor Ort. Doch die größte Schwierigkeit wartete am Tor des denkmalgeschützten Turms: Aufgrund der begrenzten Zufahrtsmöglichkeiten – Transportfahrzeuge konnten die Engstelle nicht passieren – wurden die Leitungsrohre mittels Hubschrauber auf den Mönchsberg transportiert und im Flug punktgenau abgesetzt. Auch am Fuße des Bergs kam es zu technischen Herausforderungen: Eine Querung einer vielbefahrenen Straße und die Unter-
querung des historischen Almkanals verlangten hohe Präzision und Koordination. Dieser besonders enge Bauabschnitt mit nur 2 m Höhe und 4 m Breite – gerade groß genug für die Arbeiten und um alle Rohrleitungen nebeneinander unterzubringen – erforderte größte Vorsicht beim Umgang mit den druckbelasteten Altleitungen.
Schlüsseltechnologie duktile Gussrohre Angesichts der komplexen baulichen und logistischen Bedingungen war die Wahl des Rohrmaterials entscheidend. Die duktilen Gussrohre von TRM zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit dank Zementmörtelummantelung und ihre unkomplizierte Verlegung mittels Steckmuffensystem aus. Insbesondere in Bereichen mit geringem Arbeitsraum ermöglicht diese Bauweise kurze offene Baugruben und reduziert die Eingriffe in sensible Naturflächen erheblich. „Bei anderen Materialien, die geschweißt werden müssen, bräuchte man schlicht viel mehr Platz“, erklärt Dr. Igor Roblek, Vertriebsmanager bei TRM, der zusammen mit seinem Kollegen Ing. Rudolf Stelzl, welcher auf insgesamt 34 Jahre Erfahrung bei der TRM zurückgreifen kann, das Projekt in Salzburg betreute. Die gute Zusammenarbeit mit TRM war laut Dipl. Ing. Leonhard Kohlhofer, Geschäftsführer des gleichnamigen Planungsbüros, „entscheidend für den Projekterfolg. Es wäre logistisch mit einer durchgängig offenen Baugrube nicht durchführbar gewesen.“ Da es sich um keinen gewöhnlichen Austausch einer Trinkwasserleitung handelt, sondern um eine über

Mit dem Abschluss der technisch und logistisch herausfordernden Erneuerung der Hauptwasserleitung wurde ein bedeutender Meilenstein für die Versorgungssicherheit Salzburgs gesetzt. Im Bild: der beengte Bauabschnitt der Gewässerunterquerung des Almkanals.
Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur einer Hauptversorgungsleitung und die benötigten Rohrteile in DN700 nicht in Serie produziert werden, war vorausschauendes Planen unabdingbar. Salzburg AG, Gebrüder Haider & Co und die Planer von Kohlhofer ZT waren deswegen in ständigem Austausch über die jeweilige Bauetappe und die dafür erforderlichen Rohrteile. Besonders hervorgehoben wird dabei die Rolle von TRM, die über den Dienst des reinen Zulieferns hinausging –Beratung bei Problemstellen und die schnellstmögliche Produktion von Sonderteilen inklusive. Zusätzlich leisten die Gussrohre durch ihre hundertjährige Lebensdauer einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Projekts – unterstützt durch die ressourcenschonende Produktion, bei der Alteisen wieder zu Gussrohren recycelt wird. Der Umwelt zu Gute kam außerdem die Verlegeweise der Gussrohre mit Zementmörtelumhüllung: Hierbei kann der gesiebte Erdaushub zur Bettung der Rohre verwendet werden. Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt entfällt dadurch eine nicht zu unterschätzende logistische und finanzielle Belastung durch Materialtransporte.
Stetige Wasserversorgung als oberste Priorität
Während der gesamten Bauzeit musste die Wasserversorgung Salzburgs über ein reduziertes Leitungsnetz sichergestellt und dabei höchste Vorsicht im Umgang mit bestehenden, druckbelasteten Altleitungen gewahrt werden. Teilweise wurde die ge-

samte Trinkwasserversorgung Salzburgs nur über den zweiten Hochbehälter der Stadt aufrechterhalten. „Die beiden Behälter sind kommunizierende Gefäße: Sie sind gleich groß, liegen ungefähr auf gleicher Höhe und sind durch Leitungen miteinander verbunden“, erklärt Dipl.-Ing. Ludwig Staiger von der Salzburg AG. Abgesehen von dieser rund einmonatigen Bauphase konnte die Wasserversorgung über den Hochbehälter Mönchsberg durch ausgeklügelte Logistik und eine etappenweise Umschaltung der alten und neuen Rohre gemeistert werden. Um einwandfreies Trinkwasser zu garantieren, wurden die neu angeschlossenen Leitungsabschnitte gespült – in Summe wurden laut Projektleiter Ing. Nico Leitner von der Salzburg AG über 150.000 m3 Wasser zur Spülung der neuen Leitungen bewegt. Somit konnte eine sichere Inbetriebnahme ohne chemischer Desinfektion gewährleistet werden

Meilenstein für Salzburgs Trinkwassersicherheit
Mit Präzision, Teamgeist und hoher Flexibilität wurde die Hauptschlagader der städtischen Trinkwasserversorgung mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Millionen Euro erneuert – kein gewöhnliches Bauprojekt wie Ing. Jürgen Stauder bestätigt: „Ich bin seit 40 Jahren bei Kohlhofer ZT als Projektleiter tätig, aber das war auch für mich keine alltägliche Baustelle – sondern noch einmal eine richtige Herausforderung.“ Mit der abgeschlossenen Erneuerung dieses komplexen Abschnitts ist ein bedeutender Schritt zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung
Salzburgs gelungen. Der Einsatz von Gussrohren hat sich als wesentlicher Erfolgsfaktor erwiesen: Robustheit, einfache Verlegung und Nachhaltigkeit überzeugten unter den herausfordernden Bedingungen gleichermaßen. Bis 2040 bereits in Planung sind die nächsten Etappen zur Erneuerung der gesamten sieben Kilometer langen Transportleitung, die teilweise über 100 Jahre zuverlässig ihren Dienst getan hat – das wird nun auch von der neuen Gussrohrleitung erwartet. TRM-Vertriebsmanager Igor Roblek ist hierzu sehr zuversichtlich: „Leitungen aus unseren Rohren sind ein Jahrhundertbauwerk.“

Aufgrund der limitierenden Zufahrtsmöglichkeiten erfolgte der Materialtransport teilweise per Helikopter. Eingesetzt wurden duktile Gussrohre von TRM, die sich unter den anspruchsvollen Bedingungen als ideale Lösung bewährten.






Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf setzt auf Schichtspeicher von LINK3 für hygienisch einwandfreies Wasser bei gleichzeitiger Energieeinsparung. 8.000 Liter Heizöl und 250 Arbeitsstunden pro Jahr fallen seit der Umstellung der Frischwarmwasser-Bereitung weg.
Von Wohnanlagen über Hotels bis hin zu Krankenhäusern mit hohen Hygieneansprüchen – die Schichtspeicher des österreichischen Unternehmens LINK3 machen Heizanlagen um bis zu 30 Prozent sparsamer bei gleichzeitig reduziertem Aufwand für Errichtung, Betrieb und Wartung. Nicht nur die Wärmeabnehmer profitieren von dem System, auch Nahwärmebetreiber können ihre Netze dank der innovativen Technologie effizienter betreiben. Durch die bisher über 4.000 eingebauten LINK3-Systeme können jährlich rund 6.240 Tonnen CO2 eingespart werden.
In Zeiten, in denen Gemeinden unter hohem wirtschaftlichem und ökologischem Druck stehen, rücken kommunale Gebäude wie Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser, Sportanlagen und Beherbergungsbetriebe zunehmend in den Fokus effizienter Energienutzung. Genau hier setzt die LINK3-Technologie aus Österreich an. Für ihr innovatives Konzept zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, welches konventionelle Speichertechnologien empfindlich übertrifft, gewann LINK3 am 27. Mai 2025 den 2. Platz des Salzburger Landes-Innovationspreises WIKARUS in der Kategorie „Innovation“, und ist somit auto-
matisch nominiert für den Österreichischen Staatspreis – der höchsten öffentlichen Auszeichnung für Innovation.
Speicherhydraulik ein Schlüsselelement der Energiewende „Nicht alles, was sich Schichtspeicher nennt, ist es auch“, sagt Robert Laabmayr, der Entwickler und Gründer der Integrierten Gegenstromtauscher-Technik (IGT), und verweist auf gleich drei Testergebnisse unterschiedlicher Institute, die die Wirksamkeit seiner Speichertechnik beweisen. Die Schweizer Hochschule SPF-Rapperswil weist LINK3 Speicher mit der höchsten Schichtungseffizienz aus. In mittlerweile neun



Statt 14.700 Liter Boiler wurden vier Powerlinks mit insgesamt 3.600 Liter installiert. Dank der innovativen Schichtspeicher reicht eine nur 70 kW Booster-Wärmepumpe aus, um das Hotel normgerecht zu betreiben.
Jahren ist es keinem anderen System gelungen beim uneingeschränkten Prüfverfahren „ohne Warmwasserzeitfenster“ dieses Ergebnis auch nur annähernd zu erreichen. Eine Vergleichsprüfung am WPZ-Buchs CH bestätigt 30 Prozent Stromeinsparung gegenüber Puffer-Boiler Systemen. 2024 hat die Hochschule Düsseldorf HSD ZIES in einem Feldtest eine Vorher-Nachher-Messung durchgeführt. 29 Prozent Einsparung wurden attestiert. Mangelnde Schichtungseffizienz schlägt sich bei anderen Systemen in höherem Verbrauch, höherem Platzbedarf und höherer Nachladeleistung nieder, da permanente Systemverluste kompensiert werden müssen.
Der LINK3-Ansatz: Exergie maximieren und Technik reduzieren LINK3-Technik nutzt konsequent Thermodynamik und Strömungslehre. Durch richtige Formgebung im Speicher und am Wärmetauscher werden Turbulenzen dort verhindert, wo sie Durchmischung verursachen, aber dort erzeugt, wo sie die Leistung vervielfachen. Es geht um eine „exergetisch geordnete“ Speicherhydraulik durch die Kombination laminarer Strömungsführung, exakter Temperaturzonentrennung und patentierter Hochleistungswärmetauschertechnik. Ein Speicher ist das hydraulische Bindeglied aller Wärmeerzeuger- und -verbraucherkreise. Wenn hier nicht höchste Schichtungsqualität gegeben ist, wird mit jedem Systemkreis die Durchmischungsquote potenziert. Ist sie jedoch durch die LINK3-Technik gegeben, verringert sie sogar noch die Anzahl technischer Komponenten wie Pumpen, Ventile, Schaltelemente und Regeltechnik, minimiert den Heizmitteleinsatz und belohnt mit Betriebssicherheit.
Praxisbeispiel: Quellenhotel Bad Waltersdorf Österreichs viertgrößte Heiltherme, das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, betreibt einen Hotelbetrieb für 350 Gäste mit großem Thermenbereich. 2022 wurde von 14.700 Liter Boiler auf eine 3.600 Liter (4 Stk. POWERLINK) Frischwarmwasser-Bereitung umgestellt. Durch die schichtende Technik gelingt hocheffizient die Wärmerückgewinnung aus dem Thermen-Fortwasser. Zur Einhaltung der thermischen Hygieneanforderungen genügt eine Booster-Wärmepumpe mit nur 70 kW, um Hotel und Thermenbetrieb normgerecht zu betreiben. Dies musste zuvor mittels Einsatz von 8.000 Litern Heizöl und 250 Arbeitsstunden pro Jahr für die regelmäßige thermische Desinfektion gesichert werden. Zu dieser
Einsparung kommt nun auch der Verzicht der gesamten Ölkesselanlage, welche abgebaut werden konnte. In der Technikzentrale stehen seither mehr als 10 m² Platz zur Verfügung und die Amortisation ist binnen weniger Jahre gesichert.
Effizienz in Wärmenetzen: Schulen, Altersheime, Sportanlagen Viele Wärmenetze sind an ihrer Kapazitätsgrenze. Wie effizient ein Wärmenetz betrieben wird, drückt sich in der Kennzahl „Energie pro bewegtem Netzmedium“ aus. Der Massenstrom hat seine Obergrenze – somit kommt es auf das Temperatur-Delta zwischen Netz-Vorlauftemperatur und Netz-Rücklauftemperatur an. Diese Jahresnetzkennzahl m³/MWh gibt Aufschluss über die Effizienz. Anhand einer Praxisstudie im Heizwerk Alpendorf bei St. Johann im Pongau konnte mit LINK3-Technik gegenüber herkömmlichen Netzabschnitten diese Kennzahl um bis zu 65 Prozent reduziert werden. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Netzkapazität, welche punktuell sogar bis zum Dreifachen verbessert werden konnte.
CO2-Einsparung und Resilienz
Der geringere Energieeinsatz durch Schichtungsstabilität, geringe Speicherverluste und hohe Übertragungsleistung wirkt sich direkt auf die CO2-Bilanz aus. Ab 2030 zahlt Österreich aus heutiger Sicht zwischen 45 und 80 Euro je nicht erreichter Tonne CO2, die eingespart werden soll. Am Beispiel der Zielverfehlung von 2024 von 1,9 Mio Tonnen ergäbe dies bei 80 Euro/t eine Strafzahlung von 152 Mio Euro. Damit könnten 20.000 nachhaltige Heizungen mit je 7.500 Euro gefördert werden. Durch die Vereinfachung könnten zusätzlich über Jahrzehnte Wartungs- und Instandhaltungskosten eingespart werden.
Normsicherheit und Zukunftsfähigkeit
Dass Speicher für die Trinkwarmwassererwärmung den hygienischen Anforderungen gerecht werden, ist in Hygienenormen eindeutig geregelt. Mit der Zukunftsfähigkeit in punkto Nachhaltigkeit sieht es damit allerdings noch sehr mager aus. Obwohl Speicher einen enormen Einfluss auf die Effizienz von Heizungs- bzw. Warmwasserbereitungsanlagen haben, gibt es bis heute keine taugliche Norm. Die Ökodesignrichtlinie als EU-weit gültiges Regelwerk beachtet lediglich die Warmhalteverluste, welche im Gegensatz zu den Schichtungswärmeverlusten nur einen geringen Anteil einnehmen. Vielmehr wird die Angelegenheit dahingehend verwirrend, weil damit der Anschein von Effizienz entsteht, was sich im Betrieb als Trugschluss erweisen kann. „Der vom Schweizer Institut SPF-Rapperswil entwickelte ‚Schichtungseffizienztest‘ wäre hingegen die richtigere Herangehensweise, weil er den tatsächlichen Heizmittelaufwand für ein standardisiertes Nutzerprofil vergleicht. Die dabei ermittelte Schichtungseffizienzzahl wäre der richtige Ansatz – leider gelang es bis heute nicht, diesen Testansatz auf EU-Basis als Qualitätskriterium anzuerkennen“, erklärt Robert Laabmayr. Diese Liste führt LINK3 seit 2016 sogar beim schwierigeren Prüfmodus „ohne Warmwasserzeitfenster“ unangefochten an.
Kommunale Systeme profitieren doppelt Kommunen, die heute in zukunftssichere Energiesysteme investieren, müssen auf einfache, robuste und wirkungsvolle Lösungen setzen. LINK3 bietet genau das: eine Speichertechnologie, die mit weniger mehr erreicht. Mehr Hygiene, mehr Effizienz, mehr Sicherheit – mit weniger Aufwand, weniger Technik, weniger Platzbedarf. Ein echter Gamechanger in der kommunalen Gebäudetechnik.
In der Gemeinde Wackersdorf in der Oberpfalz ist ein zukunftsweisendes Energiesystem entstanden, das nicht nur nachhaltig und effizient arbeitet, sondern auch krisensicher ist. Mit einer Kombination aus Blockheizkraftwerken, Photovoltaik und Batteriespeicher setzt das Projekt neue Maßstäbe in der dezentralen Energieversorgung. Dabei wird demonstriert, wie innovative Technik, regionale Zusammenarbeit und Weitblick zu einem Modellprojekt mit Vorbildfunktion verschmelzen – für Alltag und Ausnahmezustand gleichermaßen.
In der oberpfälzischen Gemeinde Wackersdorf wurde ein zukunftsweisendes Versorgungskonzept umgesetzt, das eine dezentrale, nachhaltige und krisensichere Energieversorgung ermöglicht. Das Energiesystem, bestehend aus zwei effizienten Blockheizkraftwerken (BHKW), einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher mit Notstromfunktion, versorgt im Regelbetrieb mehrere zentrale Gebäude der Gemeinde und bietet gleichzeitig eine robuste Absicherung für den Katastrophenfall.
Versorgung im Normalbetrieb: effizient und nachhaltig
Im Kern des Energiesystems stehen zwei smartblock-BHKW mit jeweils 50 kW elektrischer und rund 100 kW thermischer Leistung. Die hocheffizienten Aggregate stammen von der Firma KW Energie, einem Spezialisten für dezentrale Energieerzeugung mit Sitz im bayerischen Freystadt. Installiert wurden sie von der Bayernwerk Natur GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wackersdorf und dem Institut für Energietechnik (IfE) an der OTH Amberg-Weiden. Gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage speisen sie einen Batteriespeicher – ebenfalls geliefert von KW Energie – der sowohl als Puffer als auch als Sicherheitskomponente dient. Im Normalbetrieb versorgt das System ein Mehrgenerationenhaus, ein Ärztehaus und eine Schule zuverlässig mit Strom und Wärme. Ziel des Projekts ist die lokale Sektorenkopplung zur Stärkung der regionalen Energieautonomie – nachhaltig, effizient und wirtschaftlich. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Zukunftsfähigkeit der Anlage: Die BHKW können mit Erdgas als auch mit Bio-Methan aus der Region oder sogar mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Damit erfüllt das Projekt nicht nur aktuelle Anforderungen an Versorgungseffizienz und Klimaschutz, sondern ist auch auf die 100 Prozent regenerative Energiezukunft vorbereitet.
Batteriespeicher als Herzstück der Notstromversorgung
Das zentrale Bindeglied zwischen Erzeugung und Verbrauch ist der smartblock battery Batteriespeicher von KW Energie mit einer Nettokapazität von 110 kWh. Der verbaute Wechselrichter ist in der Lage, bis zu 100 kW Leistung bereitzustellen oder aufzunehmen. Im Tagesbetrieb dient der Speicher zur Optimierung der Eigenstromnutzung und zum Lastspitzenausgleich. Im Falle eines Stromausfalls übernimmt der Speicher die Versorgung innerhalb von weniger als 20 Millisekunden – schnell genug, um sensible Verbraucher unterbrechungsfrei weiter zu versorgen. Damit wird sichergestellt, dass neben dem Ärztehaus auch das Mehrgenerationenhaus und die Schule weiterhin mit Energie versorgt werden können.

Die beiden smartblock-BHKW von KW Energie liefern zuverlässig Strom und Wärme für zentrale Einrichtungen der Gemeinde.
Krisenzentrum für den Katastrophenfall
Seine volle Stärke entfaltet das System im Katastrophenfall: Eine angrenzende Turnhalle wird automatisch mit Strom versorgt und dient als Krisenzentrum für Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und weitere Hilfsorganisationen. Dort können Einsatzkräfte untergebracht, technische Ausrüstung betrieben und Kommunikationssysteme aufrechterhalten werden – unabhängig von der Netzsituation. Die Kombination aus lokaler Strom- und Wärmeerzeugung, Batteriespeicher und schneller Reaktionszeit macht das System zu einem entscheidenden Baustein der kommunalen Krisenvorsorge.
Modellprojekt mit Vorbildfunktion
Das Wackersdorfer Energiesystem zeigt eindrucksvoll, wie sich Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und technische Innovation in Einklang bringen lassen. Es bietet eine Blaupause für andere Kommunen, die ihre Infrastruktur widerstandsfä-

Mehrgenerationenhaus und Ärztehaus sind Teil des Versorgungskonzepts: Die Gebäude profitieren im Alltag von der nachhaltigen Energieversorgung und bleiben auch im Krisenfall voll funktionsfähig.

Die oberpfälzische Gemeinde Wackersdorf zeigt, wie lokale Energiewende und kommunale Krisenvorsorge Hand in Hand gehen.
hig und zukunftsfähig gestalten wollen. Die Kombination von Technologien – BHKW, PV, Batteriespeicher und Notstromfunktion – ist das Ergebnis enger Kooperation zwischen kommunalen Akteuren, Wirtschaft und Forschung. Insbesondere die Firma KW Energie leistet mit ihren modularen, auf Wasserstoff umrüstbaren BHKW und intelligenten Speichersystemen einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energiewende.
Mehr als ein lokales Energievorhaben
Das Projekt in Wackersdorf ist mehr als nur ein lokales Energievorhaben – es ist ein Beispiel für gelungene kommunale Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert. Mit der Integration von Strom- und Wärmeerzeugung, Speicherung und Notstromversorgung wird eine ganzheitliche Lösung geschaffen, die sowohl den Alltag als auch den Ausnahmezustand absichert. Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie KW Energie, dem IfE und Bayernwerk Natur zeigt, wie durch Expertise, Engagement und Innovationsgeist echte Resilienz entsteht – lokal gedacht, zukunftsorientiert umgesetzt.
Die KW Energie GmbH & Co. KG feiert 2025 ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Seit drei Jahrzehnten entwickelt und produziert das Unternehmen hocheffiziente, dezentrale Energieanlagen und gehört heute zu den führenden Anbietern im Bereich Blockheizkraftwerke. Die modularen Anlagen decken einen Leistungsbereich von 7,5 kW bis 150 kW ab und lassen sich flexibel in unterschiedlichste Versorgungskonzepte integrieren. Darüber hinaus bietet KW Energie intelligente Stromspeicherlösungen, die insbesondere in Kombination mit Kraft-WärmeKopplung-Systemen neue Maßstäbe bei Versorgungssicherheit und Energieeffizienz setzen. Ein besonderer Fokus liegt auf Zukunftstechnologien – alle Anlagen sind bereits heute für den Betrieb mit Bio-Methan oder Wasserstoff vorbereitet. Mit langjähriger Erfahrung, Innovationskraft und regionaler Fertigung beliefert KW Energie Kommunen, Stadtwerke, Gewerbebetriebe und Energiedienstleister in ganz Europa – und trägt so maßgeblich zur Umsetzung der dezentralen Energiewende bei.

Die smartblock-BHKW von KW Energie sind nicht nur effizient, sondern auch umrüstbar auf klimafreundliche Brennstoffe wie Bio-Methan oder Wasserstoff.

Der smartblock battery speichert überschüssige Energie und sichert die Versorgung bei Netzausfällen – und ist in Millisekunden einsatzbereit.

Wie gelingt die Digitalisierung einer traditionellen Brauerei – ohne hohe Investitionskosten und mit bestehender Technik? Die Pyraser Landbrauerei zeigt eindrucksvoll, wie mit einer cleveren Cloudlösung von BeEA GmbH selbst jahrzehntealte Anlagen vernetzt und zentral gesteuert werden können. Das Ergebnis durch das Digitalisieren der Gewerke: Weniger Handarbeit, mehr Transparenz, vereinfachte Arbeitsprozesse und verbesserte Energieeffizienz. Ein Praxisbericht, der zeigt, wie Industrie 4.0 auch im Mittelstand Wirklichkeit wird. Denn wo manch Großbrauerei noch zögert, setzt die Familienbrauerei bereits Maßstäbe.
In vielen Unternehmen und Kommunen ist die Automatisierungslandschaft von inhomogenen Insellösungen und handschriftlicher Datenerfassung geprägt. Die Übersicht über Produktionsprozesse und Medienversorgung ist aufwendig, Optimierungspotenziale bleiben aufgrund fehlender Daten im Verborgenen. Thalmässing zeigt, wie es besser geht: In der mittelfränkischen Gemeinde überwacht die Cloudlösung des Energiemanagement- und Automatisierungsspezialisten BeEA mittlerweile sämtliche technischen Gewerke der Pyraser Landbrauerei digital. Die vorhandenen HMI-Systeme blieben bestehen, wurden aber sinnvoll ergänzt – und anstelle eines kompletten Neubeginns setzte man auf vorhandene Technik. Die Steuerungen von Kälteanlagen, Pasteur und Füllerei waren im Nuh angebunden und dort wo benötigt, wurden günstige Steuerungen nachgerüstet. Innerhalb weniger Monate wurden 21 Systeme angekoppelt, die zuvor noch als Insellösung auch außerhalb des Firmengeländes werkelten. Neben der Produktionslinie wurden auch Gebäudetechnik, BHKWs, PV-Anlage, Brunnen, betriebseigene Kläranlage und weitere Anlagen der zentralen Überwachung zugeführt.
Medienversorgung im Blick
In der Brauerei kommen verschiedene Medien zum Einsatz: Kälte, Dampf, Wasser, Druckluft, Stickstoff und Elektrizität. Für den reibungslosen Brauereibetrieb müssen all diese Medien zuverlässig zur Verfügung stehen. Deshalb hat sich das Dashboard für die Medienversorgung als ein wichtiges Werkzeug des Braumeisters entwickelt. Hier können live sämtliche Zustände und Kennzahlen übersichtlich eingesehen werden. Zudem erscheinen dort alle relevanten Störungen und Warnungen, so-
dass reagiert werden kann, noch bevor ein Anlagenstillstand droht.
Brauerei ferngesteuert
Die Arbeitswoche des Braumeisters Achim Sauerhammer beginnt Sonntagnacht um 3 Uhr. Denn dann muss die Flaschenwaschmaschine eingeschaltet werden. Ist diese um 6 Uhr nicht vollständig aufgeheizt, verschiebt sich der Produktionsbeginn. Früher fuhr der Braumeister hierfür in den Betrieb. Heute geschieht dies automatisch. Tritt bei dem automatisierten Hochfahren der Anlage ein Fehler auf, wird er umgehend alarmiert und er kann über Smartphone eingreifen. So müssen sowohl Braumeister als auch Anlagenfahrer seltener zur Brauerei fahren.
Kein Listenschreiben mehr
Wie in jedem Unternehmen müssen Daten erhoben und ordnungsgemäß protokolliert werden. Hierzu zählen Pegelstände des betriebseigenen Brunnens, Temperaturen und Produktionsdaten. Durch die vollständige Digitalisierung werden all diese Informationen automatisch erfasst und mehrfach redundant in der Cloud gespeichert. Autorisierte Mitarbeiter haben Zugriff auf diese Daten. So kann beispielsweise auch das Labor sekundenaktuell auf die Betriebsdaten zugreifen. Das Landratsamt hingegen erhält automatisch generierte Reports mit den Brunnendaten und Kläranlagendaten.
Betriebsdatenanalyse leicht gemacht
Aufgrund der gewerkeübergreifenden Betriebsdatenaufzeichnung ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Schnell konnten Einsparpotenziale bei der Druckluftversorgung fest-

Durch präzise Datenerfassung und anschauliche Visualisierung konnten Lastspitzen gezielt identifiziert werden – etwa beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Druckluftkompressoren. Diese werden nun koordiniert gesteuert, wodurch teure Leistungsspitzen vermieden werden.
gestellt werden, wodurch innerhalb von nur vier Wochen 10 MWh eingespart werden konnten. Die komfortable Datenauswertung unterstützt zudem bei der Fehlersuche: Gerade in Bezug auf die BHKWs und die damit verbundene Wärmeführung können Probleme schnell diagnostiziert und behoben werden. So hilft die BeEA GmbH mit ihren Lösungen Energiekosten zu senken, Störungen zu reduzieren und die Betriebssicherheit zu erhöhen.
Schnelles Handeln im Störfall
Jedes Unternehmen kennt die Folgen, wenn wichtige Komponenten unbemerkt ausfallen. Die Alarmierungslösung von BeEA ermöglicht eine Benachrichtigung über E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigung oder Sprachanruf. So können gleich mehrere Mitarbeiter im Störfall informiert werden. Für jeden Benachrichtigungsempfänger kann eine Verzögerung hinterlegt werden, sodass eine Alarmierungskette entsteht, die erst beendet ist, wenn der Alarm quittiert wird.
Höherer Anteil erneuerbarer Energien
Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen setzt die Brauerei auf regenerative Energien. Hierzu wurden PV-Anlagen mit einer Leistung von 500 kWp installiert. Zudem erzeugen zwei BHKWs Strom und Wärme aus Methan der Abwasseraufbereitung und der anliegenden Mülldeponie. Schon im Jahr 2021 kam der Betrieb auf einen regenerativen Anteil von 36 Prozent. Dieser konnte seitdem deutlich ausgebaut werden. Mittlerweile wurde auch eine Nahwärmeversorgung installiert und die eigen erzeugte Energie bestmöglich genutzt. Die Cloudlösung hilft dabei den Energiefluss zu optimieren und den Anteil der Fremdenergie auf ein Minimum zu reduzieren.
Kaum Neuanschaffungen notwendig
Viele Unternehmen schrecken vor umfangreichen Digitalisierungsprojekten zurück. Zu oft liest man von hohen Investitionen, ausufernden Kosten und mangelnder Amortisierung. Dass dies nicht der Fall sein muss, wurde bei der Pyraser Landbrauerei unter Beweis gestellt. Zunächst wurde von BeEA die kostenlose Cloud-Adapter-Applikation, die als Brücke zwischen lokaler Technik und BeEA Cloud dient, auf einen vorhandenen Server installiert. Fortan konnten alle Ethernet-basierenden Systeme,
wie Siemens-Steuerungen oder Gasanalysatoren, angekoppelt werden. Doch im Betrieb befinden sich eine Reihe weiterer Komponenten, die noch nicht netzwerkfähig sind. Diese durch moderne Komponenten zu ersetzten, würde hohe Aufwendungen erfordern und zunächst kaum Mehrwert bringen. So wurden in Summe 36 Zähler, Regler und Aktoren über 2-Draht-Bus angekoppelt. Mit Ausnahme der erschwinglichen Kabel waren hierfür keine Investitionen notwendig. Selbst die 25 Jahre alten Stickstoffgeneratoren und der ebenso alte Druckluftkompressor konnten auf diese Weise digital vernetzt werden.
Nutzung unterschiedlicher Protokolle
Eine der Herausforderungen bei der Digitalisierung im Bestand sind die vielen unterschiedlichen Kommunikationsprotokolle. Je nach Hersteller und Alter werden verschiedene Standards verwendet. Die in der Familienbrauerei eingesetzte Cloud unterstützt größtenteils alle Automatisierungsprotokolle, welche in diversen Gewerken vorzufinden sind. In Pyras konnten die meisten Komponenten mit Modbus TCP, Modbus RTU und Siemens TCP angekoppelt werden. Für die BHKWs wurden jedoch noch zwei weitere Integrationsmöglichkeiten genutzt: Über das VNC-Protokoll wird der Bildschirminhalt der Bedienpanels beider BHKWs in die Cloud gespiegelt. Da auch Mausbewegungen und Tastatureingaben übertragen werden, können die Anlagen von beliebiger Stelle eingesehen und bedient werden. Zusätzlich wurde eine Webcam installiert. Dessen Bewegtbilder werden über das HTTP-Protokoll sicher zur Cloud Lösung übertragen. Damit stehen neben den Betriebsdaten auch Bedienpanel und Live-Bilder zur Verfügung.
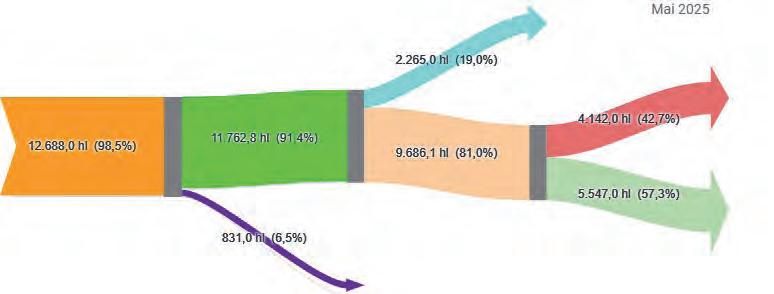
Das Dashboard für die Medienversorgung liefert in Echtzeit einen umfassenden Überblick über Verbrauch, Verluste und Verteilung – wie hier am Beispiel des Wasserverbrauchs. So erkennt der Braumeister frühzeitig Abweichungen, kann gezielt gegensteuern und sorgt für einen störungsfreien Brauereibetrieb.
Ankopplung über weite Entfernung
Herausfordernd erschien die Digitalisierung der weit entfernten Brunnenanlage. Auch hier sollten Zählerstände übertragen werden. Mittels LTE Router konnte eine Verbindung aufgebaut werden, welche zuverlässig Daten austauscht und beliebig erweitert werden kann. So zeigt sich, dass auch externe Standorte auf einer Oberfläche digitalisiert werden können.
Lastspitzen reduzieren
Ein umfangreiches Energiemanagement dient nicht nur zur

Wo manch Großbrauerei noch zögert, setzt die Familienbrauerei aus Mittelfranken bereits Maßstäbe. Dank smarter Cloud Lösung von BeEA GmbH wurden in Pyras alle Gewerke digitalisiert, Arbeitsprozesse vereinfacht und Energie eingespart.
Steigerung der Energieeffizienz. Auch das Reduzieren der Lastspitzen spielt eine wichtige Rolle, denn so können Leistungspreise des Stromanbieters gesenkt werden. Besonders relevant werden Lastspitzen, wenn diese an die Leistungsgrenze des örtlich installierten Transformators ragen. So muss Pyraser sicherstellen, dass die Leistungsgrenze von 350 kW nicht überschritten wird. Nur durch umfangreiche Datenerhebung und aussagekräftige Visualisierung können Ursachen für Lastspitzen erkannt und vermieden werden. Schnell wurde herausgefunden, dass der gleichzeitige Betrieb mehrerer Druckluftkompressoren für hohe Spitzen sorgt, die nunmehr vermieden werden.
Sicherheit an erster Stelle
Ohne Sicherheit keine Digitalisierung: So ist es selbstverständlich, dass jegliche Datenströme außerhalb der Feldebene verschlüsselt werden und die Unternehmensfirewall weiterhin keine eingehenden Verbindungen zulässt. Wo unterschiedliche

Mit der Cloudlösung können Verbrauchsdaten jeder Art erfasst, ausgewertet und überwacht werden. Visuell aufbereitet in Diagrammen und Tabellen hat man immer einen Überblick alle Daten, egal von welchem Endgerät aus.
Personengruppen zusammenarbeiten, bedarf es zudem einer Benutzerverwaltung, die den Zugriff auf das Nötige eingrenzt und eine sichere Multifaktor-Authentifizierung ermöglicht. Um Sicherheitsupdates, Wartung und Backup kümmert sich der SaaS (Software-as-a-Service). So wird die IT-Abteilung entlastet und die Brauerei verfügt über stets aktuelle Software.
Schnell erweitert
Nach Einführung des Cloudsystems durch den Automatisierungsexperten Richard Bernreuther von BeEA, erfolgt der weitere Ausbau durch eigenes Fachpersonal. Die einfache Erweiterbarkeit macht die Cloudlösung zu einem Werkzeug, dass in jedem technischen Gewerk bzw. Unternehmen zum Einsatz kommen kann. Die Ankopplungsmöglichkeiten von unterschiedlichsten technischen Einrichtungen sind mannigfaltig.
Brauerei profitiert umfangreich von Cloudlösung Digitalisierungsmaßnahmen können mit einer modernen Cloudlösung sehr kosteneffizient umgesetzt werden. Dabei wird die vorhandene Infrastruktur weiterhin genutzt und Stück für Stück an die Cloud angebunden, wodurch auch eine Vernetzung der Einzelkomponenten entsteht. Mit Hilfe der Datenerfassung und Analyse werden schnell Nichtkonformitäten mit hohen Einsparpotenzialen gefunden. Durch die Verbindung von IT und OT sind alle Abteilungen immer auf dem aktuellen Stand – ganz ohne Zettelwirtschaft.
Autoren: Thomas Hepp und Richard Bernreuther, BeEA GmbH

rotary snow plough
Die Hochleistungsfräse TYP 950 für UNIMOG ist jetzt mit freiem Auswurf und asymetrisch lieferbar!



VORSPRUNG DURCH INNOVATION
Die Schneefräsen für Profis können mit Innovationen vom Schneefräsenspezialisten WESTA ausgestattet werden, z.B.:
Konstruktion, Entwicklung & Produktion von zweistufigen Schneefrässchleudern für den Winterdienst und Pistenservice für Fahrzeuge mit einer Leistung von 20-350 PS
KURVENFAHRTEINRICHTUNG
ANFAHRSCHUTZ
FREIER AUSWURF
FREISICHTKAMIN | GLEITPLATTE
Vorteile von WESTA Schneefräsen Kurvenfahreinrichtung | Gleitplatte | Anfahrschutz | Freisichtkamin | Freier Auswurf
GmbH | Schneeräummaschinen Am Kapf 6 • 87480 Weitnau (Germany)










