Stauanlage Gigerwald für die Zukunft gerüstet
Brandneuer Ökostromproduzent im Kleinsölktal
KW Auwehr nach Modernisierung wieder am Netz
Schwerpunkt Hydrauliksysteme für die Wasserkraft




Stauanlage Gigerwald für die Zukunft gerüstet
Brandneuer Ökostromproduzent im Kleinsölktal
KW Auwehr nach Modernisierung wieder am Netz
Schwerpunkt Hydrauliksysteme für die Wasserkraft







Alles aus einer Hand – ETERTEC unterstützt Sie bei Rohrleitungsprojektierung, Engineering und der Auswahl der richtigen Produkte und Zubehörteile, sorgt für die Logistik zur punktgenauen Lieferung und führt die Baustellenbetreuung bei der Verlegung der Rohrsysteme oder der Sanierung durch.
ETERTEC ist Ihr Spezialist für GFK-Rohrsysteme und verkauft GFK-Rohre von namhaften ISO 9001 zertifizierten Herstellern. Mit unseren GFKFormteilen – Kurzrohre und Sonderrohre aus GFK – runden wir unser Lieferprogramm ab.


Produktportfolio:
• Kreisrund Nennweiten DN100 bis DN 4000
• Druckstufen PN 1 bis PN 32
• Standardbaulängen 3, 6 bzw. 12 Meter
• Standardfestigkeiten SN 2500, 5000 und 10000
• Sonderrohre (Oval, Ei, Maul, Quadrat) bis DN 3000 auf Anfrage!
Gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, von der Beratung bis hin zur Ausführung, sind unser Markenzeichen.
Mag. Roland Gruber Herausgeber | rg@zek.at

Sagt Ihnen der Name Oseja de Sajambre etwas? Ja? Dann haben Sie die Medien zuletzt sehr akribisch verfolgt. Für alle, die wie ich es nicht wussten: Oseja de Sajambre ist jenes kleine spanische Bergdorf, das dem überregionalen Blackout Ende April trotzte. Während weite Teile der Bevölkerung Spaniens und Portugals Ende April im Dunkeln saßen, brannte in dem kleinen Dorf in Nordspanien weiter Licht, die Kühlschränke brummten und die Stromversorgung funktionierte wie gewohnt. Die abgelegene Gemeinde in den Picos de Europa wurde nicht zum Opfer des landesweiten Stromausfalls – dank einer dezentralen Insellösung, getragen vor allem durch Wasserkraft. Ein unscheinbares Beispiel mit beträchtlicher Signalwirkung. In Zeiten globaler Energiekrisen und zunehmender Extremwetterereignisse wird eines immer deutlicher: Die hochkomplexen Stromnetze großer Industrienationen sind anfällig für Systemfehler und tun sich sichtlich schwer, im Ernstfall flächendeckend für Stabilität zu sorgen. Der Blackout in Spanien war kein statistischer Ausreißer, keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Warnung. Oseja de Sajambre zeigt, was zentrale Stromnetze nicht können: Stabilität in der Krise und wurde damit zum Paradebeispiel moderner Resilienz. Die häufig unterschätzte Wasserkraft präsentierte sich dabei als veritabler Trumpf: grundlastfähig, wetterunabhängig, zuverlässig und leistungsstark. In Oseja mit seiner Insellösung, bestehend aus Dieselgeneratoren und einem Kleinwasserkraftwerk, verbrauchen fünf Dörfer gerade mal ein paar Prozent der eigenen Produktion – der Rest geht ans Land. Oder eben nicht, wenn es mal darauf ankommt. Auch in Österreich und den umliegenden Ländern gibt es bereits einzelne Dörfer und Gemeinschaften, die auf Autarkie im Kleinen – also auf dezentrale Energieversorgung setzen und damit sicher sind im Falle eines Blackouts. Die nächste Krise kommt bestimmt – die dezentral organisierten Gemeinden sind gerüstet. Ich möchte nicht verabsäumen, mich für die zahlreichen positiven Reaktionen zu unserem neuen Look zu bedanken. Es freut unser ganzes Team, dass unser neues Erscheinungsbild goutiert wird. Auch inhaltlich arbeiten wir weiter hart, um unseren eigenen Standards in Sachen Wasserkraft-News gerecht zu werden. In der aktuellen Ausgabe finden Sie wie gewohnt einige interessante Projektberichte, angesiedelt zwischen den kleinen „Quetschen“ und den großen „Brummern“, dazu noch Branchennews, Interviews und ein Schwerpunktthema, das sich diesmal dem Thema „Hydraulikaggregate“ widmet, eine wichtige Technologie, die nicht allzu häufig im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.
Ihr
Mag. Roland Gruber



Mit dem Retrofit-Programm von Schubert CleanTech erhöhen Sie die Performance Ihrer Anlage und starten zeitgleich in die Digitalisierung der Wasserkraft.
Hochautomatisierte Abläufe
Intelligente Software-Tools
Integration moderner Messverfahren
Schonende Symbiose mit dem Altbestand IHR


Ing. Christian Schwarzenbohler Divisionsleiter Energieerzeugung
+43 676 832 53 164
c.schwarzenbohler@schubert.tech





03 Editorial
06 Inhalt
AKTUELL
08 Interessantes & Wissenswertes Kurznachrichten
09 Impressum
RECHT
18 Auflagen im Bewilligungsverfahren – Darf’s ein bissl weniger sein? Kolumne Lindner
PROJEKTE
19 Neues Kleinkraftwerk erzeugt Ökostrom im Kleinsölktal Kraftwerk Bröckelbach
PROJEKTE
24 Wichtige Anpassungen machen Stauanlage zukunftsfit Staumauer Gigerwald
28 Erster Laufradtausch in Donaukraftwerk erfolgreich abgeschlossen Kraftwerk Jochenstein
32 Neues Kleinkraftwerk im Aostatal seit Frühling am Netz Kraftwerk St. Barth
35 Neue Automatisierungslösung für Mürz-Kraftwerk in Kaplan-Ort Kraftwerk Auwehr
VERANSTALTUNG
38 Eplan bringt die Energiewende in Schwung Branchendialog Energie
PROJEKTE
42 Strom aus den „Nocky Mountains“mit viel Einsatz zum Erfolg Kraftwerk Power-Hansl
46 Unermüdlicher Pioniergeist seit 75 Jahren PSKW Grande Dixence
VERANSTALTUNG
48 Anwenderforum findet 2025 in den Bündner Alpen statt Vorschau Anwenderforum


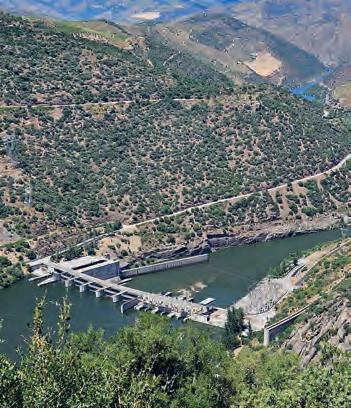

PROJEKTE
49 Schweizer Kleinkraftwerk punktet mit neuem technischem Equipment Kraftwerk Sursee
TECHNIK
52 Effizienz trifft Präzision: SUHNER Schleiftechnik für die Wasserkraft Schleifen
BRANCHE
54 Komplettanbieter von Hydrauliksystemen für nachhaltige Energie Präsentation
VERANSTALTUNG
55 Wasserkraft neu denken – Rückendeckung von der Politik gefordert Bayerisches Wasserkraftforum
SCHWERPUNKT
56 Hydrauliksysteme in Wasserkraftwerken: unverzichtbare stille Kraft Schwerpunkt Hydrauliksysteme
59 Maßgeschneiderte Hydrauliklösungen für den Kraftwerksbau Schwerpunkt Hydrauliksysteme
62 Moderne Hydraulikanlage für Kraftwerk in Guatemala Schwerpunkt Hydrauliksysteme
64 Fokus auf Kavitationsdetektion und neuartiges Effizienzmanagement Interview Prof. Busboom


Die LEW-Kraftwerke an der Wertach produzieren Strom für über 20.000 Haushalte in der Region. KW Mittelstetten wird aktuell modernisiert.

Ein neuer Bericht zeigt das Potenzial von heute bekannten Wasserkraftprojekten in periglazialen Gebieten, die bis 2050 gebaut werden könnten.
MEHR POWER FÜR DIE WERKSGRUPPE MALTA-REISSECK
Im Kärntner Mölltal wurde Anfang Juni der Abschluss umfangreicher Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte in Österreichs leistungsstärkster Kraftwerksgruppe gefeiert. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 200 Mio. Euro in die Modernisierung der bestehenden Kraftwerke Malta Hauptund Oberstufe sowie in die Errichtung des Pumpspeichers Reißeck II+ und des neuen Pumpwerks Kolbnitz investiert. Die Werksgruppe Malta-Reißeck verfügt nun über eine Turbinenleistung von mehr als 1.500 MW und kann damit bei Bedarf auf Knopfdruck die Leistung der sechs größten Donaukraftwerke ins Netz einspeisen. Der Grundstein für die heute leistungsstärkste Wasserkraftwerksgruppe Österreichs wurde in den 1950er-Jahren mit dem Bau des Kraftwerks Reißeck gelegt. Mit der Modernisierung und Erweiterung der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck erfüllt VERBUND bereits heute eine der wesentlichen Anforderungen an ein klimaneutrales Energiesystem.
LEW MODERNISIERT KRAFTWERK MITTELSTETTEN
LEW modernisiert derzeit das Wasserkraftwerk Mittelstetten an der Wertach umfassend. Die Maßnahmen reichen von der vollständigen Revision der Turbine über die Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen bis hin zur Digitalisierung der Steuerungstechnik. Ziel ist es, die Anlage für eine zuverlässige und nachhaltige Stromerzeugung in den kommenden Jahrzehnten zu rüsten – und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Bayerisch-Schwaben zu leisten. Mittelstetten ist das erste von fünf Wasserkraftwerken an der Wertach, das umfassend revisioniert wird. Die weiteren Standorte sind Großaitingen, Bobingen, Inningen und Schwabmünchen. Die Modernisierungsmaßnahmen an jedem einzelnen Kraftwerk dauern jeweils rund sechs Monate. Die Modernisierung des Kraftwerks Mittelstetten steht exemplarisch für den regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien im Gebiet der LEW Verteilnetz.
GLETSCHERSCHMELZE KÖNNTE NEUE OPTIONEN ÖFFNEN
Der Schweizer Bundesrat hat in seiner Sitzung vom Dezember 2024 den Bericht „Analyse des Wasserkraftpotenzials der Gletscherschmelze“ gutgeheißen. Die periglazialen Gebiete bieten für den Ausbau der Schweizer Wasserkraft ein großes theoretisches Potenzial. Ob dieses erschlossen werden kann, hängt aber von der Abwägung verschiedener Interessen in diesen Gebieten, sowie von rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Der Klimawandel treibt die Gletscherschmelze in den Alpen weiter voran. Aktuelle Modelle gehen davon aus, dass die Gletscher in der Schweiz bis ins Jahr 2100 rund 60 bis 90 Prozent ihres Eisvolumens verlieren werden. Dadurch werden Flächen frei, die unter anderem auch für die Erstellung von Speicherkraftwerken in Frage kommen. Diese Projekte würden eine zusätzliche Jahresproduktion von rund 1.470 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr bringen, davon 1.130 GWh aus Neuanlagen und 340 GWh aus Ausbauten.

Amiblu produziert glasfaserverstärkte Kunststoffrohre, die weltweit zum Einsatz kommen - wie etwa bei einem Wasserkraftprojekt in Afrika.
ROHRSPEZIALIST AMIBLU AUF EXPANSIONSKURS
Die Nachfrage nach Wasserinfrastruktur steigt weltweit –durch Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und den Klimawandel. „Das Marktpotenzial ist enorm“, sagt Regina Zorn im KURIER-Interview. Sie ist neue Finanzvorständin der Wietersdorfer-Tochter Amiblu, die sich auf langlebige Kunststoffrohre für Wasserlösungen spezialisiert hat. Diese halten 60 Jahre und mehr. Amiblu produziert zwar nicht in Österreich, hat aber seinen Sitz in Klagenfurt. Werke gibt es u. a. in Deutschland, Spanien, Rumänien und Australien – bald auch in der Türkei. Die Einsatzgebiete von Amiblu Rohrsystemen reichen von Beund Entwässerung über Trinkwasserleitungen bis zu Wasserkraft- und Industrierohrsystemen sowie Kanalsanierung. „Gerade in Europa ist die Kanalsanierung ein wichtiges Thema“, betont Zorn. Die Amiblu Holding GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist ein Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffrohren; das Unternehmen ist 2017 aus einer Fusion von Hobas Europe und Amiantit Europe hervorgegangen.


Alpine Solaranlagen wie NalpSolar leisten einen wichtigen Beitrag, gerade wenn der Strombedarf am höchsten ist.
FÜR ALPINES SOLARPROJEKT NALPSOLAR Mit einem feierlichen Spatenstich hat Axpo Anfang Mai den offiziellen Baustart für das alpine Solarprojekt NalpSolar in der Gemeinde Tujetsch (GR) markiert. Mit diesem Projekt sammelt Axpo wertvolle Erfahrungen im Bereich alpiner Solarenergie – ein Pionierschritt, der wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung dieser Technologie in herausfordernden Lagen ermöglicht. Das Projekt ist Teil des Solarexpress und ein weiterer Baustein der Strategie von Axpo zur Förderung der Energiewende in der Schweiz. Das Projekt wird gemeinsam mit CKW umgesetzt. NalpSolar entsteht oberhalb von Tujetsch, in unmittelbarer Nähe des bestehenden Stausees Lai da Nalps. Die Anlage wird eine installierte Leistung von rund 8 Megawatt erreichen und jährlich knapp 11 Gigawattstunden Strom produzieren – was dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2.000 Haushalten entspricht. Der produzierte Solarstrom wird für die Dauer von 20 Jahren von der SBB abgenommen und für die Bahnstromversorgung verwendet.

IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. zek-Verlag · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · T. +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Mag. Roland Grube · rg@zek.at · +43 664 115 05 70 | Redaktio: Mag. Andreas Pointinger · ap@zek.at · T. +43 664 22 82 323 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · T. +43 664 240 67 74 | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt 5450 Werfen · P.b.b. „03Z035382 M“ · Grundlegende Richtlinien | zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich. | Abopreis Österreich: € 78,00 · Ausland: € 89,00 · inklusive Mehrwertsteuer | zek HYDRO erscheint 6x im Jahr Auflage: 8.000 Stück · ISSN: 2791-4089 · 23. Jahrgang.
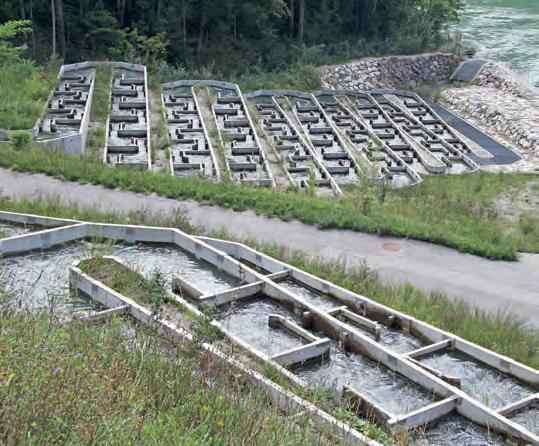
Fischaufstiegshilfe beim VERBUND-Kraftwerk Annabrücke: Sie überwindet auf 750 m Länge einen Höhenunterschied von 26 m.

14 JAHRE ENATURE®-SYSTEM VON MABA IM EINSATZ
Im Zuge der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und wachsender Anforderungen an die Durchgängigkeit von Fließgewässern sind innovative Fischaufstiegshilfen für Betreiber von Wasserkraftwerken längst Standardthema. Die MABA Fertigteilindustrie GmbH, die 2025 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, bietet mit dem enature® Fishpass-System seit über 14 Jahren eine modular-industrielle Lösung, die sich im gesamten DACH-Raum und in Südtirol etabliert hat. Das System basiert auf industriell vorgefertigten Betonelementen, die vor Ort modular zusammengesetzt werden. Die Anordnung von Schlitzen und Becken steuert gezielt Strömungsgeschwindigkeit und Energiedissipation. Damit werden die Anforderungen an die Passierbarkeit für unterschiedliche Fischarten – von schwimmschwachen bis zu bodenorientierten Arten – erfüllt. Die Bemessung und Ausführung erfolgt bei MABA inhouse, was eine hohe Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Vorgaben ermöglicht. Die Entwicklung des Systems begann 2009 und wurde in enger Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) wissenschaftlich begleitet.
Wie mehrere Graubündner Lokalmedien übereinstimmend berichteten, hat die Bündner Regierung der Kraftwerk Fideris AG (in Gründung) die Konzession für das Wasserkraftwerk Fideris erteilt. Geplant ist, den Fideriser Bergbach bei Laflina auf 1.776 m ü. M. zu fassen und das Wasser via Druckleitung zur Zentrale Strahlegg auf 877 m ü. M. zu leiten. Dort soll es dann zur Stromproduktion genutzt werden. Mit einer installierten Leistung von 4,5 MW wird mit einer jährlichen Produktionskapazität von rund 13,1 GWh gerechnet – genug für ca. 3.300 Haushalte. Die Konzession gilt für 60 Jahre ab Inbetriebnahme. Bereits 2016 hatte die Gemeindeversammlung Fideris die Wasserrechtsverleihung einstimmig erteilt. 2019 wurde sie im Zuge einer Schutz- und Nutzungsplanung angepasst: Der bereits genutzte Bergbach soll verstärkt genutzt werden, der unberührte Malanserbach hingegen geschützt bleiben. Der Bundesrat stimmte diesem Ausgleich 2022 zu. Träger des Projekts sind die SN Energie AG und die Gemeinde Fideris, deren Beteiligung allerdings noch offen ist.
Energieverteilung
Wasserversorgung
Wasserkraftanlagen
Inselanlagen
Mittelspannungsanlagen
Niederspannungsanlagen
Automatisierungen
Regelungen
Schutztechnik
Planung / Konstruktion
Wasserkraftanlagen
Haus interne Fertigung von:
Hochdruck-Turbinen
Niederdruck-Turbinen
Inselanlagen
Anlagen Revitalisierung
Service & Montage
Ihr zuverlässiger Partner für die elektromechanische Kraftwerkausrüstung



Bisher sind rund 20 Millionen Kubikmeter Wasser vom Zoggler Stausee in St. Walburg/Ulten regulär und kontrolliert abgeflossen.
ZOGGLER STAUSEE VERLIERT MASSIV AN WASSER
Seit dem Nachmittag des 13. Mai gibt es einen Wasseraustritt aus einem Zugangsstollen zu einer Steuerkammer unterhalb der Staumauer des Zoggler Stausees in St. Walburg im Südtiroler Ultenal. Seitdem haben sich Vertreter der Agentur für Bevölkerungsschutz, Alperia, der Freiwilligen Feuerwehren und des Bezirksfeuerwehrverbandes Burggrafenamt sowie die Bürgermeister täglich zu einer Lagebesprechung getroffen. Der Abfluss erfolge kontrolliert und regulär, insgesamt seien bisher rund 20 Millionen Kubikmeter Wasser abgeflossen, hieß es von Seiten der Teilnehmer der Besprechung Ende Mai. Thematisiert wurde dabei auch die Notwendigkeit für Maßnahmen, mit denen der Fischbestand geschützt bzw. überwacht werden sollen.

Stark auch bei kleinen Dimensionen: Hitzinger bietet seit Neuestem auch Kleingeneratoren als standardisierte Varianten an.
HITZINGER BRINGT KLEINGENERATOREN AUF DEN MARKT
Auf Grund vermehrter Nachfrage nach kleineren Leistungen im Generatorbereich hat sich HITZINGER dazu entschieden, die Kleingeneratoren als standardisierte Variante ins Portfolio aufzunehmen. Die HITZINGER-Kleingeneratoren sind nicht nur universell einsetzbar, sondern bieten durch die Standardisierung der Bauteile auch einen Preisvorteil. In der technischen Ausführung und der Fertigung der Generatoren wird weiterhin hohes Augenmerk auf die bewährte HITZINGER-Qualität gelegt: Die Generatoren werden sowohl für Anwendungen mit Riemenantrieb als auch für die Anbindung mit Kupplung in horizontaler und vertikaler Ausführung ausgelegt. Außerdem sind sie Grid-Code-Konform dimensioniert und mit digitalem Spannungsregler ausgestattet. Das bewährte Nachschmiersystem von HITZINGER ist integriert.

Erfahren Sie mehr über unsere Serviceleistung

Fische und andere Wasserlebewesen können beim Kraftwerk Flumenthal auf ihrem Weg die Aare aufwärts neu in einem weitgehend naturnahen Fischpass vom Unterwasser ins Oberwasser gelangen.

Dr. Dietmar Thomaseth, TIQU; Matthias Obrist, Südtir. Energieverband (SEV); Bettina Geisseler, GEISSELER LAW; Dr. Walter Gostner, Ingenieure Patscheider & Partner; Magdalena Neuhauser, ANDRITZ Hydro; Michael Class, EnBW; Prof. Markus Aufleger, Universität Innsbruck (v.l.)

Die Alpiq Hydro Aare AG hat den Fischpass des Kraftwerks Flumenthal im Kanton Solothurn durch einen 480 Meter langen, naturnahen Fischpass ersetzt. Die moderne Anlage, die nun offiziell eröffnet wurde, ermöglicht es den Fischen in der Aare, das Kraftwerk sicher zu umgehen, und schafft neue Biotope und Laichhabitate. Beim Fischpass, der den modernsten Normanforderungen entspricht, handelt es sich um eines der größten neu geschaffenen künstlichen Gewässer des Kantons Solothurn. Es befindet sich in Fließrichtung am linken Ufer der Aare auf Höhe der Kraftwerksanlagen in der Gemeinde Riedholz (SO) und überwindet rund acht Meter Höhenunterschied. Nach den rund zwei Jahre umfassenden Arbeiten ersetzt der neue Fischpass die alte Anlage. Diese stammte aus dem Jahr 1970 und genügte den Anforderungen an die Fischwanderung nicht mehr. Insgesamt wurden rund 20 Millionen Schweizer Franken über den nationalen Netzzuschlagfonds im Rahmen der ökologischen Sanierung der Wasserkraft in den Bau dieser Anlage investiert. In Zusammenarbeit mit dem Bund, dem Kanton Solothurn und Umweltschutzorganisationen erarbeitete Alpiq Hydro Aare für das Wasserkraftwerk Flumenthal eine geeignete und auf die in der Aare lebenden Fischarten wie zum Beispiel Barbe, Egli oder Alet abgestimmte Lösung.
INTERALPINE ENERGIE- UND UMWELTTAGE MALS 2025
Die sehr geschätzte und im deutschsprachigen Raum etablierte Fachtagung in Sachen Wasserkraft wird dieses Jahr zum siebten Mal wieder im schönen Mals in Südtirol stattfinden. Den Initiatoren dieser Veranstaltung – dem Büro Ingenieure Patscheider & Partner, der Anwaltskanzlei GEISSELER LAW und der zur TIWAG Gruppe gehörenden Gesellschaft TIQU –Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe - ist es auch dieses Jahr gelungen, hochkarätige Referent/innen zu gewinnen, die unter dem Tagungsthema „Wasserkraft – Aktuelle und zukünftige Herausforderungen“ Innovationen und technisch herausragende Leistungen aus Bau & Betrieb sowie zum Thema „Ökonomie & Ökologie – Ecksäulen der Nachhaltigkeit“ vorstellen und Best–Practice-Beispiele aufzeigen werden. Neben dem immer wichtiger werdenden Thema der Pumpspeicherkraftwerke wird ein weiterer Schwerpunkt der Tagung auf Digitalisierungsfragen liegen. Den Abschluss der Tagung bildet die Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema „Blackout – eine reelle Bedrohung?“.
Mehr dazu finden Sie im Web unter: https://www.ibi-kompetenz.eu/energieumweltmals2025/


IREM SpA a socio unico Via Abegg 75 - 10050 Borgone - Torino - ITALY Tel. +39 011 9648211 - Fax +39 011 9648222 www.irem.it - e-mail: irem@irem.it


Die alte Wehranlage im Wolfsberger Stadtgebiet soll durch ein modernes Flusskraftwerk ersetzt werden.
NEUES FLUSSKRAFTWERK IN WOLFSBERG GEPLANT
Ein neues Wasserkraftprojekt hat die niederösterreichische Kittel Mühle Wasserkraft GmbH im Rathaus der Kärntner Stadtgemeinde Wolfsberg im April vorgestellt, berichtet das Onlineportal „Klick Kärnten“. Die Planungen sehen vor, das bestehende Auslaufkraftwerk Ritzing im Laufe des kommenden Jahres durch den Bau eines neuen Flusskraftwerks zu ersetzen. Mit dem Neubau wollen die Betreiber mehrere Ziele erreichen. Die jährliche Energieproduktion soll von 1 GWh auf 2,2 GWh erhöht werden, das entspricht umgerechnet dem Stromverbrauch von rund 600 durchschnittlichen Haushalten. Mit dem Kraftwerksbau soll auch auf einer Länge von 800 m ein Hochwasserschutzprojekt umgesetzt werden. Darüber hinaus ist für die ökologische Durchgängigkeit eine bislang nicht vorhandene Fischaufstiegshilfe geplant. Im Idealfall könnte bereits im ersten Quartal 2026 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Der Stausee Moiry ist der wichtigste Speicher der Anlage.
Die Forces Motrices de la Gougra SA haben Ende Mai mit einer Einweihungsfeier die 2018 begonnene Sanierung des Kraftwerks Mottec abgeschlossen. Das 1958 in Betrieb genommene Kraftwerk Mottec im Val d’Anniviers im Mittelwallis befindet sich im Zentrum der Wasserkraftanlage der Forces Motrices de la Gougra. Es erzeugt rund 20 Prozent der Gesamtproduktion der Anlage und ist ein entscheidendes Verbindungsglied zwischen der Staumauer Moiry, dem wichtigsten Stausee des Kraftwerks, und der Staumauer Tourtemagne im angrenzenden Tal. Dank der Revitalisierung konnte die Produktionskapazität des Kraftwerks um 5 Mio. kWh pro Jahr gesteigert werden, was dem Verbrauch von über 1.000 Haushalten entspricht. Die Leistung der Anlage erhöht sich von 69 auf 87 MW, wodurch noch flexibler auf Schwankungen im Stromnetz reagiert werden kann.






MEILENSTEINE FÜR SALZACHKRAFTWERK STEGENWALD
Im April wurden beim Salzachkraftwerk Stegenwald, einem Gemeinschaftsprojekt von VERBUND und Salzburg AG, die nächsten Meilensteine erfolgreich absolviert. Anfang des Monats wurde der Stauraum erstmals mit Wasser gefüllt und nach Ostern der erste der beiden Maschinensätze mit dem Stromnetz synchronisiert. Für das Salzachkraftwerk Stegenwald wird erstmalig ein neu entwickeltes, innovatives Anlagenkonzept umgesetzt. Zum ersten Mal wurden zwei vertikale Kaplanturbinen horizontal eingebaut. Das Wasser wird somit nicht von vorne, sondern von oben zur Turbine geleitet. Damit kann im Betrieb auch das Maschinenhaus überströmt und zur Hochwasserabfuhr verwendet werden. Das Resultat ist, dass das Kraftwerk im Hochwasserfall 20 Prozent mehr Wasser abführen kann, als es mit einem dritten Wehrfeld möglich gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil dieser Kombination ergibt sich in der kompakten, kosteneffizienten Bauweise und raschen Umsetzung. Im Vergleich zu einem klassischen Flusskraftwerk reduziert sich die Bauzeit um ein Viertel. Im Regeljahr wird das neue Flusskraftwerk rund 73 GWh saubere Energie erzeugen.
Die Fertigstellung des VERBUND-Pumpspeicherkraftwerks Limberg III in Kaprun rückt immer näher. Am 9. Mai wurde als nächster Meilenstein der Rotor von Maschine 2 erfolgreich installiert. Dazu musste das 355 Tonnen schwere Stahlteil mit einem speziell für diesen Zweck ausgerichteten Deckenkran millimetergenau in den Stator eingehoben werden. Damit ist auch das letzte große Maschinenteil an seinem Einsatzort. Davor lag gut ein Jahr an Vorarbeiten und Planungen. Da der fertige Rotor für einen Transport durch die 5,5 Kilometer an Tunneln auf der Baustelle in Kaprun viel zu groß und schwer gewesen wäre, wurde er in mühsamer Arbeit vor Ort in der Kraftwerkskaverne auf einem Montageplatz in rund 12 Monaten zusammengebaut. Millimeter um Millimeter steuerte der Kranführer das Maschinenteil in den Hohlraum im Stator. Die nur 4 - 5 mm Spielraum wurden dabei laufend von seinen Einweisern überprüft. Die Freude und Erleichterung war laut VERBUND förmlich zu spüren, als der schwerste Hub des gesamten Kraftwerksprojekts gegen 23:30 Uhr erfolgreich absolviert wurde. Die offizielle Inbetriebnahme ist für kommenden September geplant.
Normen einhalten, Versorgung sicherstellen, Lastverteilungen optimieren:
Die Herausforderungen im Energiesektor sind groß.
Gleichzeitig erfordern Klimaschutzziele und der Wandel der Energiepolitik innovative Lösungen und eine nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz.
Meistern Sie diese Aufgaben mit einem leistungsfähigen Anlagen-Engineering als Grundlage für die Erzeugung, Verteilung oder Nutzung von Strom.
Mehr erfahren unter: eplan.at/energie


Gemeindevertreter, Bauspezialisten und Repower-Repräsentanten beim ersten Spatenstich
SPATENSTICH FÜR ERNEUERUNG DES KRAFTWERKS SILVAPLANA
Am 11. Juni meldete die Repower AG den Beginn der Bauarbeiten für die Sanierung des Kraftwerks Silvaplana. Der offizielle Spatenstich für die Gesamterneuerung der Anlage im Oberengadin fand im Beisein von Daniel Bossard, Gemeindepräsident von Silvaplana, Guido Giovannini vom Bauamt Silvaplana und Curdin Barblan von der Energia Engineering SA statt. Ebenfalls anwesend waren Andriu Maissen, Gesamtprojektleiter, und Michael Roth, Mitglied der Geschäftsleitung – beide von Repower. Um das Kraftwerk auch in Zukunft sicher und zuverlässig betreiben zu können, investiert Repower ca. 8,6 Mio. Franken. Die bestehende Wasserfassung oberhalb des Dorfes wird zurückgebaut und durch eine moderne, ökologischere Anlage ersetzt. Zudem werden die Überleitung von der Wasserfassung zum Reservoir und ein Teil der Druckleitung neu gebaut. In der Zentrale in Silvaplana wird die alte Maschinengruppe durch eine neue, effizientere Maschine ersetzt. Auch die Schutz- und Steuerungssysteme werden modernisiert. Die Inbetriebsetzung des umfassend erneuertern Kraftwerks mit ca. 5 GWh Erzeugungskapazität ist für das Frühjahr 2026 geplant.

KRAFTWERKSBAUSTELLE TAUERNBACH-GRUBEN AUF KURS
Gute Nachrichten meldete der Tiroler Energieversorger TIWAG im Mai vom neuen Kraftwerk Tauernbach-Gruben. Seit dem Baustart im Oktober 2023 sind die Arbeiten mittlerweile weit fortgeschritten. „Derzeit wird an allen Abschnitten auf Hochtouren gearbeitet“, informierte TIWAG-Projektleiter Klaus Mitteregger. Bei der Wasserfassung wurde im vergangenen Winter während der Niederwasserperiode der Tauernbach umgeleitet und die Wehranlage mit dem Einlaufbauwerk fertiggestellt. Auf der rechten Seite des Baches wird aktuell der Entsander mit der Entnahmekammer errichtet. Im 2,3 km langen Druckstollen laufen die Betonarbeiten an der Innenschale: Mit einem eigens dafür hergestellten Schalwagen wird täglich ein 18 m langer Betonabschnitt hergestellt. Ende Juni wird der Schalwagen am Nordportal erwartet und zerlegt werden. Im zweiten Abschnitt des Triebwasserweges, der ca. 6,1 km langen, erdverlegten Druckrohrleitung bis nach Gruben, wird an vielen Angriffspunkten gearbeitet. Besonders anspruchsvolle Abschnitte wie die Unterquerung des Tauernbaches konnten bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Anlage mit ca. 85 GWh Regelarbeitsvermögen ist für Mitte 2026 vorgesehen.
GENERALPLANER & FACHINGENIEURE
GENERALPLANER & FACHINGENIEURE
Verkehr Industrie Kraftwerke
ÖffentlicheSpezialthemenAuftraggeber






• Wasserkraft

• Wärmekraft
• Biomasse
• Sonderprojekte

BHM INGENIEURE
Engineering & Consulting GmbH
Europaplatz 4, 4020 Linz, Austria Telefon +43 732 34 55 44-0 office.linz@bhm-ing.com Follow us on
FELDKIRCH • LINZ • GRAZ SCHAAN • PRAG



KELAG PLANT SCHWALLAUSGLEICHSKRAFTWERK
Um das Schwall-Sunk-Problem an der Kraftwerksgruppe Fragant zu lösen, plant der Kärntner Energieversoger Kelag die Errichtung des Schwallausgleichskraftwerks Kolbnitz. Dazu soll ein Stollen vom Kraftwerk Außerfragant bis Kolbnitz in der Nähe des bestehenden Ausgleichsbeckens Rottau errichtet werden. Das neue Kraftwerk ist für die Nutzung des Wasserschwalls aus dem Kraftwerk Außerfragant sowie für einen Teil des Schwalls aus dem Kraftwerk Gößnitz am Stollenausgang konzipiert. Mit dem neuen Kraftwerk sollen der gewässerökologische Zustand der Möll auf einer Fließstrecke von 21 Kilometern sowie der Hochwasserschutz verbessert werden. Die Anlage könnte Strom für 25.000 Haushalte produzieren.
KRAFTWERK BONDO PRODUZIERT WIEDER STROM
Bei einem verheerenden Bergsturz im August 2017 wurde die Wasserfassung Prä des ewz-Kraftwerks Bondo im Kanton Graubünden von gewaltigen Murgängen verschüttet. Fast acht Jahre später ist die Stromproduktion wieder angelaufen. Rund 11 Mio. Franken wurden vom Betreiber ewz investiert, um die Wasserfassung neu und deutlich widerstandsfähiger aufzubauen. Zudem wurden umfangreiche Revisionsarbeiten im Kraftwerk sowie der Druckleitung durchgeführt. Das eigentliche Kraftwerk am südwestlichen Rand des Dorfs Bondo war vom Bergsturz 2017 nicht direkt betroffen, stand aber infolge der zerstörten Wasserfassung jahrelang still. Seit Anfang Mai 2025 kann die Anlage wieder rund 18 GWh Ökostrom jährlich produzieren. Am 16. August kann die erneuerte Anlage bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.
ANDRITZ HYDRO UND FH HAGENBERG KOOPERIEREN
Andritz Hydro hat ein gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) in Oberösterreich zur Anwendung von KI beim Turbinen-Design gestartet, berichtete das Online-Portal „brutkasten.com“ im Juni. Im Rahmen von AIPRA (AI-unterstützte präskriptive Analytik) wird untersucht, wie KI die hydraulische Entwicklung von Turbinen in jeder Phase des F&E-Prozesses unterstützen kann. Dabei soll etwa der Designprozess durch die Vorhersage des hydraulischen Verhaltens von Turbinenkomponenten beschleunigt werden. Methoden des „Reinforcement Learning“ werden eingesetzt, um die Optimierung des hydraulischen Designs zu unterstützen.


Der optimierte Bauablauf des Lünerseewerks II sieht einen Baustart 2029 und die Inbetriebsetzung im Jahr 2036 vor.
Seit der Projektvorstellung im Herbst 2021 hat die illwerke vkw intensiv an der Konkretisierung der Pläne für Österreichs größtes Pumpspeicherkraftwerk, das Lünerseewerk II, gearbeitet. Das Kraftwerk soll Speichermöglichkeiten und flexible Regelenergie für das europäische Verbundnetz bieten. Ende April konnte ein wichtiger Fortschritt erzielt werden, so Christof Germann, Vorstandsvorsitzender der illwerke vkw: „Nun wird ein erster wichtiger Meilenstein erreicht – das technische Projekt steht, und wir können die Planunterlagen zum freiwilligen UVP-Vorverfahren einreichen.“ Ziel ist dabei, offene Fragen mit der Behörde frühzeitig zu klären und das eigentliche UVP-Verfahren bestmöglich vorzubereiten. Aus technischer Sicht wurde das Projekt in mehrfacher Hinsicht optimiert, erläutert Vorstandsmitglied Gerd Wegeler. „So konnten wir eine Steigerung der Leistung auf rund 1.100 MW im Turbinenbetrieb und 1.050 MW im Pumpbetrieb erreichen.“


ERFOLGREICHE PRAKTIKERKONFERENZ IN GRAZ
Vom 5. bis 7. Mai fand in der steirischen Bundeshauptstadt im Congress Graz zum 28. Mal die Praktikerkonferenz „Pumpen in der Verfahrens-, Kraftwerks- und Abwassertechnik“ statt. Mit 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort, 10 weiteren online, 24 Vortragenden, 22 Fachbeiträgen und 10 Fachausstellern bestätigte die Konferenz erneut ihre Rolle als zentrale Plattform für den praxisnahen Austausch zwischen Betreibern, Planern und Herstellern in der Pumpenbranche. Die Veranstalter freuen sich über die durchgängig positiven Rückmeldungen, wie etwa „Mit Abstand die qualifizierteste Veranstaltung dieser Art, nicht nur in den DACH-Ländern, sondern darüber hinaus“, „interessante Vorträge“, „lebhafte, gründliche Diskussionen“ und „sehr gute Organisation“ – so lauten zahlreiche Stimmen zur 28. Praktikerkonferenz. Die 29. Praktikerkonferenz Graz wird vom 13. bis 15. April 2026 wieder im Veranstaltungszentrum Congress Graz stattfinden.
Effizienz trifft Präzision: SUHNER Schleiftechnik für die Wasserkraft Innovation und Präzision in der Metallverarbeitung
SUHNER-Schleiflösungen decken den gesamten Lebenszyklus einer Wasserkraftturbine ab.
Das Produktangebot von SUHNER umfasst ein breites Spektrum an Schleifwerkzeugen, Schleifmaschinen und abrasiven Materialien – darunter Hochleistungsschleifmaschinen, Schleifbänder, Schleifstifte, Schleifpasten, sowie Logistiklösungen für Verbrauchsmaterial.

Auflagen sind Nebenbestimmungen zur eigentlichen Bewilligung. Durch die Vorschreibung von Auflagen sollen Projekte bewilligungsfähig gemacht und ein Widerspruch mit öffentlichen Interessen beseitigt werden. Mit zunehmender Regelungsdichte nimmt die Vorschreibung von Auflagen in den Bewilligungsverfahren aber immer mehr überhand. Kurz vor dem Ziel, dem Erhalt des Bewilligungsbescheids, sind Projektwerber:innen bereit, allerlei Auflagen anzuerkennen und Vorschreibungen zu akzeptieren, die bei Umsetzung und Betrieb teuer sind. Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwiefern derartige Auflagenvorschreibungen überhaupt akzeptiert werden müssen.
Die Zulässigkeit der Vorschreibung von Auflagen, ergibt sich immer aus dem jeweiligen Gesetz (etwa WRG, NSchG, ElWOG).
Diese sehen unterschiedliche Vorgaben vor, ihnen allen ist es aber gemein, dass durch die Auflagen die Bewilligung eines Projektes ermöglicht werden soll.
Die Judikatur hat zur Zulässigkeit von Auflagenvorschreibungen bestimmte Kriterien entwickelt, die erfüllt sein müssen, um die Zulässigkeit der Auflage zu begründen. Auflagen, die grundsätzlich in keinerlei Zusammenhang mit dem eigentlichen Projekt stehen, sind daher schon per se unzulässig (etwa die Installation von Messstationen für wissenschaftliche Zwecke).
Nach der Judikatur müssen Auflagen bestimmt, erforderlich und geeignet sein, um den erforderlichen Zweck herbeizuführen: Auflagen müssen so bestimmt gefasst sein, dass einerseits dem Bescheidadressaten die Möglichkeit gegeben ist, der Auflage zu entsprechen und andererseits ohne weiteres Ermittlungs-
verfahren und neuerliche Entscheidungen eine Vollstreckungsverfügung (für eine Ersatzvornahme) ergehen kann. Es muss (zumindest) einer fachkundigen Person klar sein, was durch die Auflage verlangt wird.
Unter der Erforderlichkeit von Auflagen versteht man die Fähigkeit, durch die Auflage ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im WRG muss die Auflage also dazu dienen, den öffentlichen Interessen (§ 105) zu entsprechen. Dient eine Auflage nicht der Erreichung dieses Ziels, ist sie nicht erforderlich. Dem Bewilligungswerber dürfen aber nur für die Zielerreichung erforderlichen Auflagen vorgeschrieben werden, nicht bloße Wunschzettel der Behörde. Ist es etwa tatsächlich erforderlich, gewässerökologische Untersuchungen alle paar Jahre vorzunehmen, um die Auswirkungen des Kraftwerks zu überprüfen oder können diese bereits nach einer mehrmaligen positiven Überprüfung eingestellt werden?
Auflagen sollen überprüft und hinterfragt werden Ein großer Streitpunkt im Bewilligungsverfahren ist letztlich die Geeignetheit der Auflagen. Kann durch die vorgeschriebene Auflage das Ziel erreicht werden, welches es zu erreichen gilt? Ist die Abgabe einer höheren Restwassermenge geeignet, um den Zielzustand des Gewässers herbeizuführen, oder ist diese Restwasserabgabe überschießend? Würde etwa eine höhere Restwasserabgabe die Tiefe des Gewässers nicht merkbar beeinflussen und daher auch keine bessere Fischpassierbarkeit ermöglichen, so wäre die Vorschreibung einer höheren Restwasserabgabe nicht geeignet.
Dr. Berthold Lindner

Berthold Lindner berät und begleitet Wasserkraftbetreiber:innen bei der Umsetzung von Projekten und im laufenden Betrieb. Als Mitautor des WRG-Kommentars von Oberleitner/Berger ist er als kompetenter Ansprechpartner im Wasserrecht bundesweit tätig.
Auflagen, die nicht sämtliche dieser geforderten Grundlagen erfüllen, sind unzulässig und dürfen daher nicht vorgeschrieben werden. Es liegt jedoch am Betreiber im Zuge der Verhandlung die Auflagen zu überprüfen und diese auch gegebenenfalls vor dem Hintergrund dieser Kriterien zu hinterfragen. Üblicherweise sind Sachverständige durchaus bereit, die Hintergründe für die Auflagenvorschreibung zu argumentieren und allenfalls auch alternative Vorschläge zu akzeptieren. Wird die Auflage aber im Bescheid vorgeschrieben und nicht bekämpft, so erwachsen die Auflagen in Rechtskraft und sind unabhängig von der Frage, ob diese zulässig waren oder nicht, vom Betreiber einzuhalten. Es ist daher unbedingt erforderlich, im Zuge der Verhandlung alle Auflagen zu prüfen und diese gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen.
Das WRG kennt allerdings Möglichkeiten auch nachträglich Auflagenvorschreibungen abzuändern. Nach § 21b sind die vorgeschriebenen Auflagen auf Antrag mit Bescheid aufzuheben und abzuändern, wenn und soweit die Voraussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vorliegen. Hier besteht zumindest nachträglich in engen Grenzen eine Möglichkeit überschießende Auflagen nachträglich abzuändern. Dieser Weg ist erfahrungsgemäß langwierig und sollte möglichst vermieden werden.
Achtung: Der Weg für eine Verschärfung steht der Behörde ebenso offen (§ 21a), dazu aber an anderer Stelle.
Von Berthold Lindner
Kontakt: Lindner Stimmler Rechtsanwälte GmbH & Co KG Lindner@lindnerstimmler.at

Die Wasserfassung des neuen Kleinwasserkraftwerks am Bröckelbach mit rund 300.000 kWh Regelarbeitsvermögen.
Seit November 2024 erzeugt im steirischen Kleinsölktal ein neues Kleinwasserkraftwerk am Bröckelbach sauberen Strom. Realisiert wurde das Projekt vom Ehepaar Thomas und Christine Zach und der Haider Energieerzeugung GmbH, wobei die gesamten Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Rohrverlegung vom Bauunternehmen Gebr. Haider durchgeführt wurden. An der Wasserfassung kommt für den Einzug von maximal 240 l/s Ausbauwassermenge das bewährte Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal zum Einsatz. Für eine maximal effiziente Stromerzeugung im Krafthaus sorgt eine 4-düsige Pelton-Turbine von der Osttiroler Maschinenbau Unterlercher GmbH. Im Regeljahr wird das neue Wasserkraftwerk rund 300.000 kWh Ökostrom produzieren.
Im Kleinsölktal, einem Seitental des steirischen Ennstals, wurden in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe von Kleinwasserkraftanlagen neu gebaut bzw. auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Einen wesentlichen Anteil am Ausbau der Wasserkraftkapazitäten hatte der Energiedienstleister E-Werk Gröbming, der inklusive Beteiligungen mit insgesamt 15 Wasserkraftwerken in der Region sauberen Strom erzeugt. Beim Neubau des Kraftwerks Kleinsölkbach, das zwischen 2021 und 2023 vom E-Werk Gröbming, der Haider Energieerzeugung GmbH und der Gemeinde Sölk realisiert worden ist, wurden bereits die baulichen Vorkehrungen für den Bau eines weiteren Kleinwasserkraftwerks geschaffen.
Bauliche Synergien ausgenutzt
„Als die Druckrohrleitung für das Kraftwerk Kleinsölkbach, die über unseren Grund verläuft, verlegt wurde, haben wir uns mit dem Polier der Baufirma Gebr. Haider in Verbindung gesetzt“, sagt Thomas Zach, der mit seiner Frau Christine einen Milch-
viehbetrieb im Kleinsölktal betreibt: „Wir haben uns anfänglich erkundigt, ob die Möglichkeit besteht, bei der Rohrverlegung gleich die baulichen Voraussetzungen für unser eigenes Kraft-



Die Druckrohrleitung besteht zur Gänze aus GFK-Rohren von Amiblu. Die Gebr. Haider erledigten die Bauarbeiten und die Rohrverlegung.
werk am Standort zu schaffen. Nach der Kontaktaufnahme wurde die Angelegenheit schließlich mit Hubert Haider, dem Geschäftsführer der Gebr. Haider, weiter konkretisiert. „Ursprünglich wollten wir nur eine Leerverrohrung zur Rückleitung des Triebwassers in den Kleinsölkbach vorsehen, damit unser Sohn das Kraftwerk in der Zukunft bauen kann. Nachdem aber die Planungen und die Behördenwege während der Projektierung bereits sehr weit fortgeschritten waren, haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt gleich selber in die Realität umzusetzen“, so Kraftwerksbetreiber Thomas Zach beim zek HYDRO-Lokalaugenschein im Kleinsölktal.
Projekt kooperativ umgesetzt
„Die Entscheidung für eine gemeinsame Umsetzung wurde bereits im Herbst 2022 getroffen“, sagt Christian Mandell, Be-
reichsleiter Energie bei der Unternehmensgruppe Haider: „Danach wurde gleich mit den Planungsarbeiten begonnen – somit konnte im Spätsommer 2023 die wasserrechtliche Bewilligung für diese Anlage erlangt werden. Die abschließende naturschutzrechtliche Bewilligung wurde dann im Frühjahr 2024 zuerkannt. Nach der ebenso durchgeführten internen Ausführungsplanung konnte schlussendlich der Baubeginn Ende Juni 2024 erfolgen.“ Durchgeführt wurden die gesamten Hoch- und Tiefbauarbeiten inklusive der Druckrohrverlegung von der Bausparte der Gebr. Haider, wobei auch die Familie Zach tatkräftig mitanpackte. Für den rechtlichen Rahmen des Ökostromprojekts wurde die KW Bröckelbach Wibmer GmbH gegründet, an der Thomas und Christine Zach mit jeweils 35 Prozent beteiligt sind, die restlichen Anteile hält die Haider Energieerzeugung GmbH. Christian Mandell lässt nicht uner-

• 10x leichter als Beton
• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen
• Optimale hydraulische Eigenschaften
• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit
• Einfache Verlegung in jedem Gelände
• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering
• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)
• Entwickelt für Generationen

Das Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion von der Wild Metal GmbH sorgt für die Ausleitung von maximal 240 l/s Triebwasser.
wähnt, dass die gesamte Projektabwicklung, die Planungsarbeiten, die Behördenverfahren, die Förderungs- und Finanzierungsabwicklung, die Bauaufsicht sowie der Stromverkauf von der Haider Energieerzeugung GmbH durchgeführt wurden.
Südtiroler Grizzly fasst Wasser
Die Wasserfassung der Anlage wurde am Bröckelbach kurz unterhalb der Einmündung von zwei kleineren Seitengerinnen errichtet. Vor dem Fassungsbauwerk wurde ein großzügig dimensioniertes Becken angelegt, in dem sich die Sedimente des Gebirgsbachs vor der Ausleitung absetzen können. Da der Bröckelbach durch natürliche Gefällestufen für Fische nicht passierbar ist, konnte auf eine ansonsten obligatorische Fischaufstiegshilfe verzichtet werden. Der Einzug von maximal 240 l/s Ausbauwassermenge erfolgt durch das Coanda-System „Grizzly Protec Vibro“ vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal GmbH, das seine Praxistauglichkeit im gesamten Alpenraum mittlerweile an mehr als 500 Standorten unter Beweis
stellt. Besonders geschätzt wird von Kraftwerksbetreibern das namensgebende Coanda-Prinzip des Systems. Dieses sorgt dafür, dass das vom Gewässer mitgeführte Geschwemmsel automatisch durch den Wasserstrom von der Feinrechenfläche, deren Spaltweite bei der Wasserfassung des Kraftwerks Bröckelbach lediglich 0,6 mm beträgt, abgespült wird. Für zuverlässigen Schutz vor grobem Treibgut wie Felsen, Ästen oder Wurzelstöcken sorgt hingegen das über dem Feinrechen positionierte Schutzgitter, die sogenannten „Vibro Bars“. Komplettiert wurde der Lieferumfang der Südtiroler durch die elektromechanisch angetriebenen Absperr- und Regulierorgane wie Grundablass-, Einlauf-, Spül- und Restwasserschieber sowie den Einlaufkonus der Druckrohrleitung.
Druckrohrleitung aus GFK-Material
Nach dem Endsanderbecken beginnt die insgesamt 585 m lange Druckrohrleitung der Anlage, die in einer nahezu linearen Trassenführung zwischen der Wasserfassung und
Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schützen & Stauklappen
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
• Komplette Wasserfassungssysteme
• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY
Wild Metal GmbH www.wild-metal.com
Handwerkerzone Mareit 6 info@wild-metal.com 39040 Ratschings +39 0472 595 100
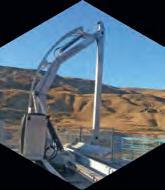








Die 4-düsige Pelton-Turbine von der Osttiroler Maschinenbau Unterlercher GmbH gewährleistet eine maximal effektive Ökostromproduktion.
dem Maschinengebäude 74 m Bruttofallhöhe überwindet. Der komplett erdverlegte Kraftabstieg besteht zur Gänze aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GKF) in der Dimension DN400 vom international renommierten Hersteller Amiblu. Die Rohre kombinieren hohe Festigkeit mit geringem Gewicht und ermöglichen so eine einfache und kosteneffiziente Verlegung – selbst in schwierigem Gelände. Dank der äußerst glatten Rohrinnenfläche werden die Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert und in weiterer Folge eine Optimierung der Energieeffizienz der Anlage erreicht. Durch die materialbedingte Druckstabilität und die Formbeständigkeit kommt das Rohrsystem auch mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen problemlos zurecht. Mit den Druckrohren mitverlegt wurden zudem ein Stromkabel zur elektrischen Anbindung der Wasserfassung sowie ein Lichtwellenleiter für die digitale Kommunikation. Für die visuelle Fernkontrolle der Wasserfassung sorgt eine Videokamera, mit der sich die Betreiber rund um die

Visualisierung der modernen Kraftwerkssteuerung

Uhr einen Eindruck von der Situation an der Wehranlage verschaffen können.
4-düsiges Kraftpaket im Maschinenhaus
Bei der elektromechanischen Ausstattung des Maschinengebäudes setzten die Betreiber auf die Kompetenz des Kleinwasserkraftallrounders Maschinenbau Unterlercher GmbH. Die Osttiroler lieferten eine 4-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung, die bei vollem Wasserdargebot 148 kW Engpassleistung erzielt. Die Turbinenschaufeln des Laufrads werden bei der Fertigung aus einem Edelstahlblock gefräst und anschließend mit einer stoff- und formschlüssigen Verbindung mit Seitenscheiben zu einem hochwertigen Bauteil zusammengefügt. Durch diese patentierte Fertigungsmethode erreicht Unterlercher ein Höchstmaß an Genauigkeit und Betriebssicherheit. Dank der vier elektrisch geregelten Turbinen-Düsen kann die Maschine auch bei stark verringertem Wasserdargebot mit maximaler Effizienz Strom erzeugen. Vervollständigt wird der Maschinensatz durch einen direkt mit dem Laufrad gekoppelten Synchron-Generator in luftgekühlter Ausführung, der auf 400 V Spannung und 180 kVA Nennscheinleistung ausgelegt wurde. Das gesamte elektro- und leittechnische Equipment stammt von der im Kleinwasserkraftbereich viel-
• Ausbauwassermenge: 240 l/s
Bruttofallhöhe: ca. 74 m
• Druckrohleitung: 585 m
Material: GFK
Ø: DN400
Fabrikat: Amiblu
Wasserfassung: Coanda-System „Grizzly“
• Hersteller: Wild Metal GmbH
Turbine: 4-düsige Pelton
• Turbinenachse: Vertikal
Drehzahl: 750 U/min
• Engpassleistung: 148 kW
Hersteller: Maschinenbau Unterlercher GmbH
• Generator: Synchron Nennscheinleistung: 180 kVA
• Hersteller: Marelli Motori
Jahresarbeit: ca. 300.000 kWh

fach bewährten MBK Energietechnik GmbH aus der steirischen Gemeinde Ilz. Die Automatisierungsspezialisten hatten schon zuvor eine ganze Reihe von Kraftwerken der Gebr. Haider mit ihren zuverlässigen Lösungen ausgestattet. Beim neuen Kraftwerk am Bröckelbach konnten die Steirer ihre jahrzehntelange Erfahrung ein weiteres Mal unter Beweis stellen. „Unser Lieferumfang erstreckte sich auch bei diesem Projekt wieder über die gesamte elektrotechnische Ausrüstung – von der Energieausleitung für den Anschluss an das örtliche EVU bis zur Fernwartung haben wir alles geliefert, montiert und in Betrieb gesetzt“, so MBK-Geschäftsführer Christian Mund: „Eine generelle Herausforderung bei Projekten dieser Größenordnung sind die Kosten. Vor allem elektrotechnisch unterscheiden sich kleinere Anlagen grundsätzlich ‚nur‘ durch die Netzanbindung bzw. den Energieteil von größeren Kraftwerken – alle anderen Anforderungen sind gleich und unabhängig von der Projektgröße. Generator, Turbine und Stahlwasserbau werden mit den gleichen Signalen und Überwachungen geliefert wie bei größeren Anlagen und müssen natürlich dementsprechend behandelt werden. Auch bei den Anforderungen seitens der Behörden (Pflichtwasserabgabe, Rohrbruchüberwachung, usw.) werden keine Unterschiede gemacht und müssen entsprechend der je-


Thomas und Christine Zach freuen sich über ihr gelungenes Wasserkraftprojekt im steirischen Kleinsölktal.
weiligen Bescheide ausgeführt werden.“ Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert der Anlagenbetrieb vollständig automatisiert. Dank der gesicherten Online-Anbindung können die Betreiber über ein Endgerät ihrer Wahl – PC, Tablet oder Smartphone – rund um die Uhr auf die Anlage zugreifen, diese überwachen bzw. gegebenenfalls individuelle Anpassungen vornehmen.
Seit November 2024 am Netz Nach einer bemerkenswert kurzen Bauphase, die weniger als sechs Monate in Anspruch genommen hat, konnte die mustergültig realisierte Anlage mit rund 300.000 kWh Regelarbeitsvermögen am 14. November des Vorjahres zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Im Gespräch mit zek HYDRO ziehen Thomas und Christine Zach ein durchwegs positives Fazit über ihr Wasserkraftprojekt: „Sowohl die Projektierungs- als auch die Bauphase sind schnell und unkompliziert über die Bühne gegangen. Seit der Inbetriebnahme sind keine nennenswerten Probleme an der Anlage aufgetreten. Die maximale Leistung der Anlage konnte bislang zwar noch nicht abgerufen werden, das liegt aber an den geringen Niederschlagsmengen der vergangenen Monate, und nicht an der Technik.“


Vogelperspektive auf den Installationsplatz an der Staumauer des Gigerwaldsees während der vergangenen Wintermonate.
An der Stauanlage Gigerwald im Schweizer Kanton St. Gallen erfolgte zwischen dem Herbst 2024 und dem Frühling 2025 eine großangelegte Teilsanierung. Notwendig geworden war das sowohl baulich als auch logistisch herausfordernde Projekt der Kraftwerke Sarganserland AG (KSL), um der zunehmenden Verlandung des Speichersees durch Sedimente entgegenzuwirken. Während der rund 6-monatigen Umsetzungsphase wurden der Grundablass und der Triebwassereinlauf durch die Errichtung eines neuen Bauwerks um rund 20 m nach oben versetzt. Zudem wurde der Betriebsstillstand der Anlage für Wartungs- und Sanierungsarbeiten am Triebwasserweg und in der Kraftwerksstufe Mapragg sowie den Grundablassschützen genutzt. Dank des vorbildlichen Einsatzes der beteiligten Unternehmen und eines eng getakteten Zeitplans konnte der Wiederaufstau des Gigerwald-Speichers bereits einen Monat früher als geplant erfolgen.
Der Gigerwaldsee auf dem Gebiet der Gemeinde Pfäfers ist ein Speicherreservoir, das in den 1970er-Jahren beim Bau des Pumpspeicherkraftwerks Mapragg errichtet wurde. Gespeist wird der über 30 Millionen Kubikmeter fassende Speicher durch Zuflüsse aus dem Weisstannental und dem Calfeisental. Die Höhe der Staumauer vom Fundament bis zur Mauerkrone beträgt 147 m, die Kronenläge erstreckt sich zwischen den Talflanken über 430 m. Gemeinsam mit der weiter unten gelegenen Kraftwerksstufe Sarelli erzeugt die KSL, an der die Axpo mit 98,5 Prozent und der Kanton St. Gallen mit 1,5 Prozent beteiligt sind, im Regeljahr rund 460 GWh Ökostrom.
Sedimente erfordern Baumaßnahmen
Nach einer Betriebszeit von knapp 50 Jahren war es am Fuß der Staumauer Zeit für ein großangelegtes Erneuerungsprojekt, erklärt Axpo-Projektleiter Erich Schmid:„ Die zunehmende Verlandung am Seegrund, die durch den Eintrag von Sedimenten aus den Zubringerbächen im Durchschnitt 43 Zentimeter pro Jahr beträgt, hatte eine Erhöhung der Einlaufbauwerke für das Triebwasser und den Grundablass dringend notwendig gemacht.“ Ursprünglich wollte die Axpo das Projekt bereits im Herbst 2022 in Angriff nehmen. Auf-
grund der Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten, die auch in der Schweiz zu Befürchtungen von Stromengpässen während der Wintermonate geführt hatten, wurde das Bauvorhaben zeitlich nach hinten versetzt. Der rund 2-jährige Aufschub war allerdings mit erheblichen Zusatzkosten ver-

XXXL-Rohrtransport DN3500 für den neuen Grundablass

Die vorgefertigten Betonelemente wurden mit dem Schwerlastkran punktgenau eingehoben.
bunden. Die Zufahrt zur Stauanlage ist im Winter einer dauerhaften Lawinengefährdung ausgesetzt – wenn ein Lawinenzug runterkommt, ist die Baustelle von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Aus diesem Grund wurden die Baustelleninstallationen am Standort dergestalt ausgeführt, dass die Arbeiten auch bei Lawinenabgängen unterbrechungsfrei fortgesetzt werden konnten. „Unsere Lager vor Ort waren gut gefüllt, wir hatten genug Zement, Zuschlagsstoffe, Armierungseisen und Schalungen auf der Baustelle, um im Anlassfall 14 Tage durcharbeiten zu können. Zudem wurde eine temporäre Halle errichtet, in der 1.400 m³ Kies gelagert waren, auch die Zementsilos

Hydraulikzylinder für die Revisions- und Betriebsschütze nach der fachgerechten Sanierung durch die Fäh AG.

Der neue Grundablasseinlauf wurde um rund 18 m erhöht, der Triebwassereinlauf wurde um rund 24 m nach oben versetzt.
waren sehr groß dimensioniert. Nachdem schließlich im September 2022 beschlossen wurde das Projekt aufzuschieben, waren in weiterer Folge kontinuierliche Mieten für die Installationen und Gerätschaften fällig – und die waren teuer. Beispielsweise
finanziellen Gründen als richtig herausstellen. Denn im Sommer 2024 wurden laut Erich Schmid bereits erhöhte Sandanteile im Triebwassersystem der Anlage festgestellt. Das war ein klares Zeichen, dass die Sedimente am Seegrund die Höhe der bestehenden Ein-

Hydrauliksteuerungen, Aggregate und Zylinder
Revisions- und Retrofit-Arbeiten für bestehende Anlagen
Anlagenverrohrung
Inhouse-Fertigung mit hoher Präzision und Qualität
Hagenbuch – Ihr Systempartner für Wasserkraft-Hydraulik. Jetzt anfragen.




Erich Schmid: „Die Ableitung der kontinuierlichen Zuflüsse durch den alten Grundablass zählten zu den wichtigsten Randbedingungen des Projekts. Das war auch der Grund, warum die Sanierung in den zuflussärmeren Wintermonaten stattgefunden hat. Während der Schneeschmelze im Frühling und Sommer, in der die Zuflüsse durchschnittlich 20 bis 30 m³/s betragen, wäre eine sichere Wasserableitung nicht zu schaffen gewesen.“ Bevor die Wasserableitung hergestellt werden konnte, musste zunächst der von Geröll und Treibholz massiv verlegte Grobrechen am bestehenden Einlauf freigelegt werden. „Der teilweise verstopfte Einlauf war ein Problem, mit dem wir zuvor nicht gerechnet haben. Dank des vorbildlichen Einsatzes der beteiligten Unternehmen konnten die Verklausungen aber rasch gelöst werden“, betont Erich Schmid. Hergestellt wurde die Ableitungsinfrastruktur von den Rohrleitungsspezialisten der Schweizer Josef Muff AG. Die Installation der provisorischen Bypassleitung DN600 und der Hauptableitung DN1000 stellte dem Unternehmen zufolge eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Nach der Demontage des Bypasses stand
den Fachkräften ein äußerst knapp bemessenes Zeitfenster von nur 24 Stunden zur Verfügung, um diese kritischen Komponenten zu montieren. Eine detaillierte Planung und eine einwandfreie Umsetzung waren für die Bewältigung dieser zeitlichen Herausforderung unerlässlich. Neben der Herstellung der Wasserableitung war die Josef Muff AG auch für die Lieferung von vier massiven Rohrschüssen DN3500 für den neuen Grundablassschacht zuständig.
Bewährte Unternehmen am Zug Realisiert wurde die Höherlegung des neuen Grundablasses und des Triebwassereinlaufs durch die Errichtung eines insgesamt rund 24 m hohen Bauwerks. Der Projektleiter hebt hervor, dass dank der Verwendung von Fertigteilen in vergleichsweise kurzer Zeit große Baufortschritte erzielt werden konnten: „Der Einsatz der vorgefertigten Betonelemente hat das Projekt enorm beschleunigt. Damit es beim Einbau aufgrund von fehlerhaften Abmessungen keine unangenehmen Überraschungen gibt, wurden die Komponenten bei der Herstellung mittels 3D-Scans eingehend überprüft. Durchgeführt wurden die

Bauarbeiten von der Marti AG. Darüber hinaus waren noch eine ganze Reihe weiterer Schweizer Branchenspezialisten an der Erneuerung bzw. der Sanierung der Anlageninfrastruktur beteiligt. Die Stahlwasserbauexperten der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG sorgten für die Erneuerung der Hydraulikaggregate inklusive Verrohrungen an der Drosselklappe der Kraftwerksstufe Mapragg, an der Drosselklappe Gigerwald sowie am Grundablass der Staumauer. Sämtliche Hydraulikaggregate stammen von der bewährten Schweizer Hagenbuch Hydraulic Systems AG. Zudem war die Fäh AG für die Sanierung der Revisions- und Betriebsschützen und den dazugehörigen Hydraulikzylindern am Grundablass zuständig. Die Sanierung der Panzerung am Grundablass sowie die Revision des Umleitungsstollens durch die Erneuerung des Korrosionsschutzes zählte ebenfalls zu den Aufgaben der Fäh AG. Umgesetzt wurde die Erneuerung

Die Sandstrahlwerk First AG war für die Erneuerung des Korrosionsschutzes am Grundablass zuständig.


der Korrosionsbeschichtung am 30 m langen Umleitungsstollen DN800 und der 80 m langen Panzerung DN2800 am Grundablass durch die als Subauftragnehmer engagierten Experten der Sandstrahlwerk First AG. Neben den Arbeiten an der Staumauer und dem Triebwasserweg nutzte die KSL den Betriebsstillstand auch zur Revision der Maschinengruppen in der Zentrale Mapragg.


Investition macht sich bezahlt
Dank der günstigen Witterungsbedingungen und des eng getakteten Terminplans, der eine 6-Tage Woche und einen 2-Schicht-Betrieb beinhaltete, konnten die Hauptarbeiten des Projekts weitaus schneller als geplant zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Fast vier Wochen früher als geplant startete am 2. April rechtzeitig vor dem Einsetzen der Schneeschmelze der Wiederaufstau des Gigerwaldsees. „Man kann guten Gewissens von einem geglückten Projekt sprechen. Bis auf die unerwartet massive Blockade des Einlaufrechens am alten Grundablass gab es keine negativen Überraschungen. Sehr erfreulich war auch, dass keine schweren Arbeitsunfälle geschehen sind. In technischer Hinsicht haben alle geplanten Konzepte funktioniert. Zu verdanken ist dies dem großen Engagement der vielen Unternehmen und Personen, die am Projekt beteiligt waren“, resümiert Erich Schmid. Die Investition von rund 25 Millionen Franken hat sich definitiv bezahlt gemacht. Mit dem Projekt konnte die KSL die langfristige Betriebssicherheit der Stauanlage Gigerwald sichern und einen substanziellen Beitrag für die Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien leisten.

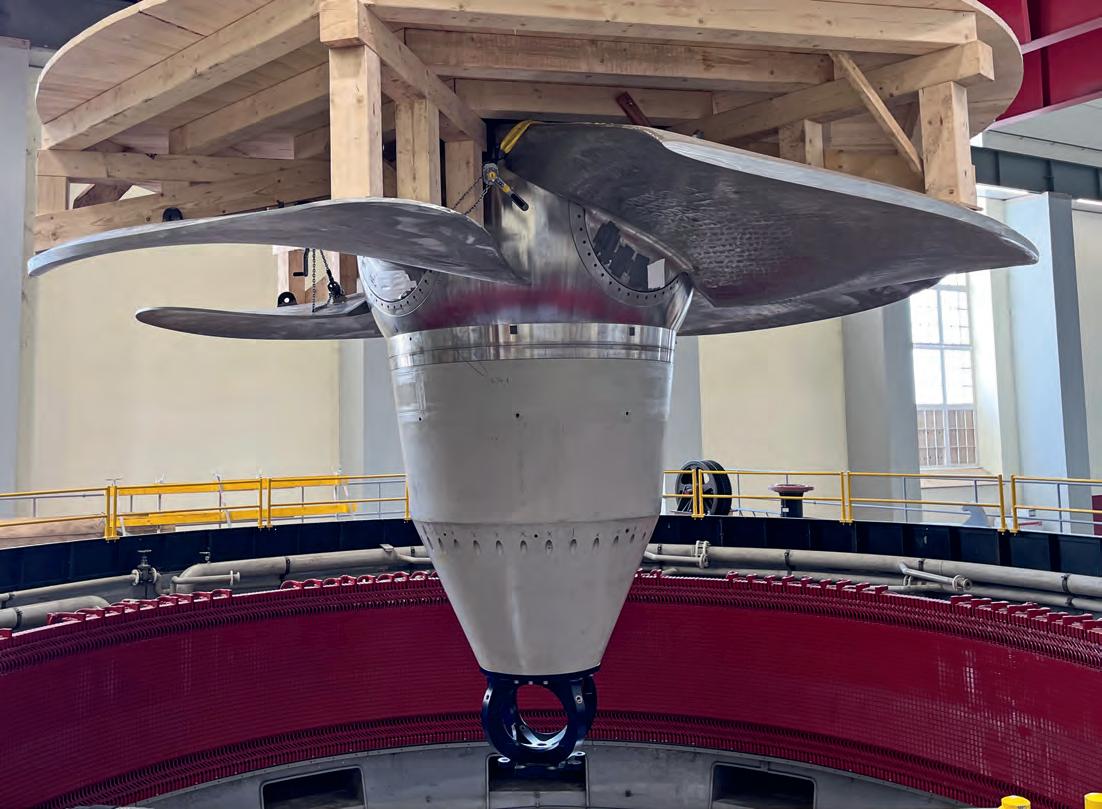
Das Einheben des 150 Tonnen schweren Laufrads im KW Jochenstein ist Präzisionsarbeit. Ein moderner 4-Flügler ersetzt das alte 5-flügelige Laufrad.
Mit einem spektakulären Schwerlasthub wurde Mitte März die erste von insgesamt fünf Maschinen im Donaukraftwerk Jochenstein erfolgreich erneuert. Das Einheben des 210 Tonnen schweren Rotors markierte den Abschluss der Montagearbeiten an Maschine 1 und zugleich einen ersten Höhepunkt der mehrjährigen Revitalisierung, bei der bis 2030 alle Turbinensätze des historischen Grenzkraftwerks zwischen Deutschland und Österreich modernisiert werden. Zeitgleich wird zudem die Energieableitung erneuert. Am Ende des Projekts wird das von VERBUND betriebene Kraftwerk Jochenstein 55 Millionen Kilowattstunden mehr Strom pro Jahr erzeugen – genug, um 17.000 Haushalte mit sauberem, nachhaltigem Strom zu versorgen.
Die beiden Schwerlastkrane sind annähernd bis an die Grenzen ihrer maximalen Tragfähigkeit gefordert, als der 210 Tonnen schwere Rotor langsam in Richtung der geöffneten Maschinenhausluke geführt wird. Zentimeter für Zentimeter senkt sich der Maschinenkoloss, bis er exakt auf der Nabe und im Stator-Ring sitzt. Nach einem halben Tag Präzisionsarbeit ist es geschafft. Der Maschinensatz ist wieder komplett. Das Einheben des schwersten Maschinenbauteils war einer dieser Momente, in denen alles zusammenpassen muss und einfach nichts schiefgehen darf. „Das ist der kritischste Moment“, sagt VERBUND-Projektleiter Christoph Wimmer. „Jeder im Team muss sich auf den anderen verlassen können. Und die Arbeiten müssen auf den Zehntelmillimeter genau sein, sonst drohen Schäden und wochenlange Verzögerungen.“ Der junge Ingenieur aus dem Salzburger Pongau führt an der Kraftwerksbaustelle am Donaukraftwerk ein Team von bis zu 40 Personen, das sowohl aus VERBUND-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen aus Österreich als auch aus Bayern besteht. In seiner 8-jährigen Laufbahn bei VERBUND leitete Christoph Wimmer bereits einige Kraftwerksprojekte. Die Modernisierung von Kraftwerk
Jochenstein ist sein bislang größtes Projekt. Die Herausforderungen für ihn und sein Team liegen zum einen in der Technik, zum anderen aber auch in der Logistik.
Neue Krananlage erleichtert De- und Remontage
Besonders die Frage der Belastbarkeit der bestehenden Krananlage bereitete den Verantwortlichen Kopfzerbrechen, wie Christoph Wimmer betont: „Im Vorfeld war nicht bekannt, wie viel das alte Laufrad exakt wiegt. Man musste sich im Prinzip auf die alten Zeichnungen verlassen – oft ohne zu wissen, ob diese noch dem aktuellen Revisionsstand entsprachen“, so der Projektleiter. Die entscheidende Frage lautete: Sind die bestehenden Krane auf das enorme Gewicht der Maschinenteile ausgelegt. Die Antwort: Jein. „Natürlich waren die alten Krane dafür gemacht, dass man die Maschinenteile damit ausheben konnte. Allerdings mussten diese dafür in ihre Einzelteile zerlegt werden. Als Ganzes konnte man das Laufrad oder den Rotor nicht ausheben. Dafür waren die Krane zu schwach. In der Vergangenheit bedeutete das, dass man zum Beispiel den Rotor zerlegen und die Keile heraustreiben musste, um die Bauteile

ausheben zu können. Das war mechanisch gesehen ein risikobehafteter Prozess, der aufgrund dieses Aufwands zudem die Stillstandszeit erheblich verlängerte.“
Aus diesem Grund wurden zwei neue, deutlich leistungsstärkere Krane angeschafft, die im Herbst von der Haslinger GmbH Metallbau + Krantechnik geliefert und in Betrieb genommen wurden. Dank dieser neuen Schwerlastkrane kann der Rotor nun in einem Stück ausgehoben werden, was nur noch einen halben Tag dauert und so insgesamt fast einen ganzen Monat an Arbeits- und Stillstandszeit einspart.
Moderner 4-Flügler ersetzt altes 5-Flügler-Laufrad
Nachdem der Rotor im Spätherbst letzten Jahres ausgehoben worden war, wurde er sicher und trocken gelagert. „Am Generator selbst wurden keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Statoren wurden bereits vor 15 Jahren saniert, sodass sich die Generatoren insgesamt in einem sehr guten Zu-

Das Einheben des 210 Tonnen schweren Rotors ist Präzisionsarbeit, die viel Know-how und Fingerspitzengefühl erfordert.
stand befinden. Der ausgebaute Generator wurde daher nur gereinigt, und natürlich wurde darauf geachtet, dass er keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist“, erklärt Christoph Wimmer. Beim Laufrad sah die Sache allerdings anders aus: Es wurde im Gegensatz zum Generator vollständig erneuert. „Die Turbinen aus den 1950er Jahren waren keineswegs schlecht. Trotzdem muss man eingestehen, dass knapp 70 Jahre Betrieb unvermeidlich Verschleißerscheinungen nach sich ziehen. Und zum anderen hat es in dieser Zeit einige Entwicklungen im Hinblick auf das hydraulische Design einer Kaplan-Turbine gegeben“, sagt Projektleiter Wimmer. Vor diesem Hintergrund wurde das bislang installierte 5-flügelige Laufrad gegen eine moderne 4-flügelige Variante ausgetauscht. „Der größere Durchflussquerschnitt mit der kleineren Nabe und die verbesserten Wirkungsgrade des neuen hydraulischen Designs bringen uns deutliche Effizienzgewinne“, erläutert Wimmer. Modellversuche bei Litostroy in Tschechien bestätigten im Vorfeld die avisierte Leistungssteigerung.
Turbinen: 5
• Bauart: Kaplan-Turbine vertikal
Drehzahl: 65,2 U/min
Laufraddurchmesser Ø: 7,4 m
• Laufradflügel: vor Umbau: 4 Neu: 5
Turbinenleistung: je 28,9 MW (vor Modernisierung)
Ausbauwassermenge: je 410 m³/s
• Generatoren: Synchrongeneratoren (5x)
Nennleistung: je 35 MVA
Nennspannung: je 9,0 kV
• Wehranlage: 6 Wehrfelder
• Wehrfeldbreite: je 24 m
Doppelhakenschütze: Verschlusshöhe 11,8 m
Stauraumlänge: ca. 27,4 km
• Jahresarbeit: 850 GWh (vor Modernisierung)
Erzeugungsplus ab 2030: 55 GWh
Inbetriebnahme: 1955
Zusammenbau des neuen Laufrads vor Ort
Das Design des neuen 4-flügeligen Kaplan-Laufrads, das speziell für die Gegebenheiten am Standort Jochenstein entwickelt wurde, kommt bei drei der fünf Turbinen zum Einsatz. Für die anderen beiden wird aktuell noch an entsprechenden Anpassungen getüftelt. Schließlich ersetzen diese Turbinen zwei Maschinen eines anderen Herstellers, die vom Grunddesign der anderen drei ein wenig abweichen.
Vormontiert wurde die neue Maschine vom MaschinenbauTeam des VERBUND in der Werkshalle in Schwarzach im Pongau, wo in den vergangenen Jahren für derartige Projekte eine moderne Infrastruktur geschaffen wurde. „Für den Maschinentransport von Schwarzach nach Jochenstein, der kurz vor Weihnachten letzten Jahres erfolgte, musste das Laufrad allerdings noch einmal auseinandergenommen werden. Mit einem Laufraddurchmesser von 7,4 Meter wäre das Bauteil konventionell nicht anzuliefern gewesen. Nachdem wir die Flügel hier in Jochenstein wieder montiert hatten, konnten wir das neue Laufrad einheben.“ Rund 150 Tonnen bringt dieser Maschinenteil auf die Waage. Angesichts der enormen Last bewiesen die neuen Schwerlastkrane auch bei dieser Aufgbe, wie wichtig sie für das Projekt sind. „Früher war auch das Ausheben des Laufrads enorm aufwändig, weil es nur mithilfe von Stützstangen möglich war. Das war nicht ganz risikofrei. Heute können wir das Laufrad als Ganzes ausheben, benötigen keine Stützstangen, was das Vorhaben viel sicherer und effizienter macht“, erläutert Christoph Wimmer. Mitte Jänner konnte das neue Laufrad erfolgreich eingesetzt werden.
Moderne Steuerung für maßgeschneiderte Krananlage Ein wesentlicher Baustein für den Projekterfolg liegt laut Christoph Wimmer in der Erneuerung der Krananlage, die sowohl mechanisch als auch steuerungstechnisch eine absolute Sonderlösung darstellt. In ihrem Entstehungsprozess und während der gesamten Projektdauer spielte die Firma Haslinger Metallbau + Krantechnik, gemeinsam mit ihrem Partner STAHL CraneSystems, eine entscheidende Rolle. Die Haslinger Metallbau + Krantechnik aus Alderbach, im Landkreis Passau und somit aus der Region, übernahm die vollständige Planung, Fertigung,
Ein Kraftwerk mit Geschichte
Das Donaukraftwerk Jochenstein, majestätisch an der Donau zwischen Bayern und Oberösterreich gelegen, zählt zu den schönsten Flusskraftwerken Europas. Geplant vom Münchner Architekten Roderich Fick, entstand es nach einem Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Österreich im Februar 1952. Noch im selben Jahr begann der Bau, und bereits 1955 gingen die ersten drei Maschinensätze ans Netz, die anderen beiden gingen in den Folgejahren in Betrieb. Jochenstein ist ein Laufwasserkraftwerk mit fünf Kaplan-Turbinen, die zusammen eine Ausbauleistung von 132 Megawatt mitbringen. Das mittlere Jahresarbeitsvermögen beträgt rund 850 Millionen Kilowattstunden – genug, um etwa 221.000 Haushalte mit nachhaltigem Strom zu versorgen. Die Wehranlage liegt nahe dem österreichischen Ufer, während das markante Krafthaus mit den Turbinen direkt beim Felsen Jochenstein errichtet wurde. Auf der bayerischen Seite befinden sich die Schiffsschleuse und die Schaltanlage. Das Kraftwerk gehört zur Kraftwerksgruppe „Grenzkraftwerke“, die durch ihre Lage an den Grenzflüssen Inn und Donau geprägt ist. 2013 übernahm die österreichische Verbund AG

Projektleiter Christoph Wimmer leitet das Modernisierungsprojekt am Donaukraftwerk Jochenstein. Bis 2030 soll es abgeschlossen sein.
Montage und realisierte die termingerechte Inbetriebnahme im Herbst 2024. In der Schweißtechnik spielt die Haslinger Gruppe seit Jahren in der obersten Liga, ein Aspekt, der gerade bei der Herstellung der Kranbrückenträger enorm wichtig war. Im Tandembetrieb können mit dem neuen Kransystem nun doppelte Lasten gehoben werden, also 240 t – das ist ausrei-

alle Anteile am Kraftwerk von der deutschen E.ON, wodurch Jochenstein vollständig in österreichischem Besitz überging. Heute steht das Bauwerk in beiden Ländern unter Denkmalschutz. Es dient nicht nur der Energiegewinnung, sondern auch als wichtiger Grenzübergang für Radfahrer und Fußgänger. Jochenstein ist bis heute ein Symbol europäischer Zusammenarbeit, nachhaltiger Energie und ein beeindruckendes Denkmal der Nachkriegszeit.

800-mm-Seiltrommel aus Blech statt serienmäßigem Rundrohr
chend für die Rotoren einschließlich ihrer Pole und natürlich für das komplette Laufrad. Der Tandembetrieb ermöglicht ein effizientes Handling der schweren Bauteile und ihren sicheren Transport aus der Kraftwerkshalle und über das Stauwehr bzw. die Schleusenkammern. „Früher waren für den Tandembetrieb zwei erfahrene Kranführer erforderlich, die in enger Abstimmung zusammenarbeiten mussten, um die schweren bzw. sperrigen Lasten sicher und präzise zu navigieren. Die beiden neuen Krane könne jetzt nur durch einen Bediener, mittels einer Funkfernsteuerung koordiniert und gefahren werden“, erklärt der Projektleiter. Dabei können an der Fernbedienung verschiedene Betriebsarten ausgewählt werden. Die Funkfernsteuerung ist im Datenbus des Krans eingebunden. Beide Krane kommunizieren über ein Industrie-WLAN miteinander und ermöglichen so auch den Tandembetrieb durch einen Bediener.
Zusätzlicher Strom für 17.000 Haushalte
Neben dem Tausch der Laufräder werden zeitgleich auch die Transformatoren sowie die Energieableitung von den Trafos zu der Schaltanlage erneuert. Diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtprojekts mit einem Investitionsvolumen von 61,5 Millionen Euro. Bis 2030 wird jedes Jahr eine weitere Maschine erneuert. Nach Abschluss der Arbeiten wird Jochenstein jährlich etwa 55

Neue Tandem-Krananlage im Kraftwerk Jochenstein für große Lasten
Millionen Kilowattstunden mehr Strom erzeugen – das entspricht der Versorgung von rund 17.000 Haushalten. „Die Revitalisierung im Donaukraftwerk Jochenstein markiert einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen und nachhaltigeren Energiewirtschaft. Wir sind stolz auf die Leistung unseres ganzen Teams und die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts“, so VERBUND-Projektleiter Christoph Wimmer.
In den letzten Frühlingswochen 2025 stehen nun die Inbetriebsetzungsarbeiten auf dem Programm, die Schritt für Schritt von den Fachexperten und -expertinnen aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik umgesetzt werden. Nachdem im April die ersten Trockentests und die ersten Testläufe durchgeführt wurden, stand dem ersten Synchronisieren mit dem Netz Anfang Mai nichts mehr im Weg. Dazu der Projektleiter: „Auch die Inbetriebnahme bietet heikle Momente, in denen man durchaus mitfiebert. Umso schöner, wenn – wie in unserem Fall – alles wie am Schnürchen läuft.“ Nachdem die renovierte Maschine aktuell in den Probebetrieb übergeführt wird, ist der Fokus von Projektleiter Christoph Wimmer bereits auf Maschine 2 gerichtet. Er und sein Team sind bereit für den nächsten Schritt: „Mit den Erfahrungen aus dem ersten Teilprojekt können wir zuversichtlich an die Modernisierung der zweiten Maschine herangehen.“ In fünf Jahren soll das Großprojekt abgeschlossen sein.


Generator beim Einheben in das unterirdische Maschinengebäude des neuen Kleinwasserkraftwerks Saint Barthélemy
Seit dem Frühjahr 2025 erzeugt im italienischen Aostatal ein neues Kleinwasserkraftwerk am Gewässer Saint Barthélemy sauberen Strom. Bei der Errichtung des Ausleitungskraftwerks mit rund 3,5 GWh Erzeugungskapazität konnten sowohl die erzeugungstechnischen Anforderungen als auch die gewässerökologischen Belange vereinbart werden. Das Maschinengebäude der Anlage, in der sich eine vertikalachsige Pelton-Turbine mit 1.305 kW Engpassleistung befindet, wurde aus Landschaftsschutzgründen komplett unter der Erde errichtet. An der Wasserfassung, die für die fischökologische Durchgängigkeit mit einem Vertical-Slot-Pass ausgerüstete wurde, kommt das bewährte Coanda-System „Grizzly“ vom Südtiroler Branchenspezialisten Wild Metal zum Einsatz. Das patentierte System dient einerseits für den Einzug von 1.000 l/s Ausbauwassermenge und gewährleistet zudem die optimale Filtration der anfallenden Sedimente.
Die knapp 3.000 Einwohner zählende Gemeinde Nus im norditalienischen Aostatal ist bei Weinkennern vor allem für die lokale Rebsorte Vien de Nus bekannt. Darüber hinaus bietet die idyllische Region aufgrund ihrer alpinen Topographie optimale Bedingungen für die Stromgewinnung aus Wasserkraft, wovon eine Vielzahl von Anlagen im Tal zeugen. Eines der jüngsten Kleinwasserkraftwerke im Aostatal wurde am Gebirgsbach Saint Barthélemy errichtet. Realisiert wurde das im Frühjahr 2025 fertiggestellte Projekt von der Kraftwerksgesellschaft Soc. Idroelettrica St Barth Alto srl.
Wasserkraftwerk und Bewässerungssystem kombiniert
Die ersten Konzeptionen für den Bau des neuen Kraftwerks entstanden dem Generalplaner Alessandro Mosso zufolge, der das Projekt gemeinsam mit dem Unternehmen Blue Energy Srl. geplant hat, bereits vor fast 20 Jahren: „Das Projekt begann im Jahr 2007 mit dem ersten Konzessionsantrag. Im Laufe der Jahre mussten zahlreiche Überarbeitungen und Optimierungen vorgenommen werden, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und die Energieeffizienz der Anlage zu verbessern. Dabei wurde etwa die vorhandene Bewässerungsinfrastruk-
tur der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Projektgebiet in das Funktionskonzept des Wasserkraftwerks miteinbezogen.

Coanda-System an der Wasserfassung bei der Montage

Das patentierte Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion von der Südtiroler Wild Metal GmbH sorgt für die vollautomatische Ausleitung des Triebwassers.
Durch diese Integration konnten die Projektauswirkungen auf die Umwelt minimiert und gleichzeitig die hydraulische Effizienz des Kraftwerks maximiert werden.“ Der Planer betont, dass durch den Kraftwerksbau eine Optimierung des landwirtschaftlichen Bewässerungssystems erzielt werden konnte und somit auch ein Beitrag für die regionalen Nachhaltigkeitsziele geleistet wurde. Hinsichtlich der Projektierungsphase spricht der Planer von einem komplexen Genehmigungsverfahren, das sich über mehr als ein Jahrzehnt hingezogen hat und mehrere Projektprüfungen, hydraulische und ökologische Folgeabschätzungen sowie Umweltverträglichkeitsverfahren umfasste. Letztendlich konnte eine Lösung gefunden werden, bei denen sowohl die bautechnischen als auch die ökologischen Belange erfüllt werden konnten.
Baustart im Sommer 2022
Die Realisierungsphase des Projekts startete schließlich im Juli 2022. Aufgrund der Höhenlage des Projektgebiets zwischen ca. 1.480 und 1.650 m. ü.M. wurden die primären Arbeiten zwischen den Frühlings- und Herbstmonaten durchgeführt. Während der Wintermonate waren wegen der Lawinengefahr Bauunterbrechungen erforderlich. Laut Alessandro Mosso stellten die instabilen geologischen Verhältnisse eine große
Ausbauwassermenge: 1.000 l/s
• Nettofallhöhe: 159,11 m
Druckrohrleitung: 1.622 m
• Ø: 800 mm
Turbine: 4-düsige Pelton
• Turbinenachse: Vertikal
Drehzahl: 600 U/min
Enpassleistung: 1.305 kW
Generator: Synchron
Nennscheinleistung: 1.500 kVA
• Regelarbeitsvermögen: ca. 3,5 GWh

Die über 1,6 km lange Druckrohrleitung besteht zur Gänze aus Stahlrohren DN800.
Herausforderung während der Bauarbeiten dar. Diesen Bedingungen wurde insofern Rechnung getragen, als von den ausführenden Unternehmen bautechnische Verstärkungsmaßnahmen an den Bauwerken sowie der Druckrohrleitung durchgeführt wurden. So wurden an der insgesamt 1.622 m langen Druckrohrleitung, die abschnittweise über sehr steiles Gelände verläuft, entsprechende Fixpunkte aus Beton hergestellt. Der Kraftabstieg an sich besteht zur Gänze aus robusten Stahlrohren mit der Dimension DN800, dieser überwindet einen Höhenunterschied von rund 160 m. Mit der Druckrohrleitung mitverlegt wurde zudem ein Lichtwellenleiterkabel, das die digitale Kommunikation zwischen den technischen Gewerken an der Wasserfassung und der Kraftwerkszentrale ermöglicht. Neben der Druckrohrleitung für das Wasserkraftwerk wurde noch eine zusätzliche Leitung für den Anschluss an das landwirtschaftliche Bewässerungssystem hergestellt. Diese ca. 950 m lange Leitung besteht ebenfalls aus Stahlrohren und wurde in der Dimension DN150 ausgeführt.
Innovatives Wasserfassungssystem mit Selbstreinigungsfunktion
An der Wasserfassung setzten die Betreiber zur Ausleitung des Triebwassers auf das innovative Coanda-System „Grizzly“ vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal GmbH. Bei dem patentierten System handelt es sich im Prinzip um ein nahezu selbstreinigendes Schutzsieb, das seine Praxistauglichkeit im gesamten Alpenraum mittlerweile mehrere hunderte Male unter Beweis stellt. Der Wassereinzug erfolgt durch ein Feinsieb mit lediglich 0,6 mm Spaltweite, wobei durch den namensgebenden Coanda-Effekt Treibgut und Geschwemmsel automatisch von der Rechenfläche gespült werden. Zuverlässigen Schutz vor grobem Schwemmgut wie Ästen und Felsen gewährleistet wiederum ein über dem Feinsieb angeordnetes Stahlgitter in feuerverzinkter Ausführung. Nach der Ausleitung durch das Coanda-System gelangt das Triebwasser in ein Entsanderbecken, in dem sich die feinen Sedimente des Triebwassers vor dem Beginn der Druckrohrleitung langsam absetzen können. Neben dem „Grizzly“ lieferten die Südtiroler auch noch das restliche Stahlwasserbauequipment für die Wehranlage,

4-düsige Pelton-Turbine von Tamanini Hydro bei der Montage
dazu zählten die Spülklappe für das Entsanderbecken sowie diverse Absperr- und Regulierorgane sowie das Hydraulikaggregat zur vollautomatischen Regelung der Schützen. Für die Gewährleistung der gewässerökologischen Durchgängigkeit wurde ein Vertical-Slot-Pass errichtet, der die Fische an der Wehranlage vorbei vom Unter- ins Oberwasser führt.
Leistungsstarkes Maschinengespann unter der Erde Um den optischen Eingriff in das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten, wurde das Maschinengebäude der Anlage komplett unterirdisch errichtet. Das Herzstück der gut verborgenen Anlagenzentrale bildet eine 4-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung, die einen direkt mit dem Laufrad gekoppelten Generator antreibt. Geliefert wurde der Maschinensatz vom italienischen Hersteller Tamanini Hydro. Bei einer Ausbauwassermenge von 1.000 l/s und 159,11 m Nettofallhöhe schafft die Turbine bei vollem Wasserdargebot 1.305 kW Engpassleistung. Dank der mehrdüsigen Ausführung kann die Maschine über ein breites Betriebsband hinweg effektiv arbeiten und auch bei stark verringertem Zufluss hohe Wirkungsgrade erreichen. Komplettiert wird der Maschinensatz durch den 3-phasigen Synchron-Generator mit 1.500 kVA Nennscheinleistung. Der luftgekühlte Generator stammt vom Hersteller Marelli

Unter Volllast schaffft der Maschinensatz über 1,3 MW Engpassleistung
Motori und wurde auf 3.000 V Betriebsspannung ausgelegt. Das komplette elektro- und regelungstechnische Equipment im Krafthaus wurde ebenfalls von Tamanini Hydro geliefert. Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert die Stromproduktion der Anlage vollständig automatisiert. Über eine gesicherte Online-Anbindung kann das Kraftwerk rund um die Uhr auch aus der Ferne überwacht und bedient werden. Die Anlagensteuerung wurde mit einer intuitiven Visualisierung versehen, die auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum aktuellen Status des Kraftwerks zur Verfügung stellt.
Seit dem Frühjahr 2025 am Netz
Nach dem Abschluss der Bauarbeiten konnte das neue Kleinwasserkraftwerk Saint Barthélemy im Frühling 2025 erstmals sauberen Strom produzieren. Ins öffentliche Netz eingespeist wird der Ökostrom durch ein neu verlegtes Erdkabel mit ca. 3,5 km Länge. Der Generalplaner Alessandro Mosso zeigt sich mit dem Endergebnis des Projekts rundum zufrieden: „Die ersten Tests haben die hohe Effizienz des elektromechanischen Equipments bereits unter Beweis gestellt. Ich bin mir sicher, dass die Betreiber in der Zukunft noch viel Freude mit ihrem Kraftwerk haben werden.“ Im Regeljahr wird die mustergültig realisierte Anlage im Aostatal rund 3,5 GWh Ökostrom erzeugen.
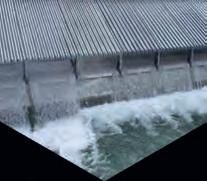
Wild Metal GmbH
Handwerkerzone Mareit 6 39040 Ratschings
www.wild-metal.com
info@wild-metal.com
+39 0472 595 100




Das Wasserkraftwerk Auwehr, dessen Regelungstechnik Anfang 2025 umfassend erneuert wurde, erzeugt im Regeljahr rund 5 GWh Ökostrom.
Anfang des Jahres wurde die Regelungstechnik des Kleinwasserkraftwerks Auwehr in der Stadtgemeinde Mürzzuschlag auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Durchgeführt wurde die Modernisierung vom niederösterreichischen Branchenspezialisten Schubert CleanTech GmbH. Das von der Eigentümer- und Betreibergesellschaft viktor kaplan muerz gmbh in Auftrag gegebene Erneuerungsprojekt konnte innerhalb weniger Wochen erfolgreich über die Bühne gebracht werden. Im Prinzip umfasste der Schubert-Leistungsumfang die Modernisierung des gesamten elektro- und leittechnischen Equipments im Maschinengebäude, der Wehranlage, der Vakuumstation und des Auslaufbauwerks. Dank der großangelegten Erneuerung, die eine umfassende Optimierung der Fernüberwachung- und Regelbarkeit mit sich brachte, ist die Anlage in regelungstechnischer Hinsicht bestens für die Zukunft gerüstet.
Die steirische Kleinstadt Mürzzuschlag am namensgebenden Fluss Mürz hat schon viele bekannte Töchter und Söhne hervorgebracht. Zu den international bekanntesten zählen wohl die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, der bildende Künstler Josef Pillhofer und der Turbinenpionier Viktor Kaplan. Dass sich die in Mürzzuschlag ansässige viktor kaplan muerz gmbh mit der Erzeugung sauberer Energie beschäftigt, ist keine Überraschung. Diese betreibt im Gemeindegebiet den Windpark auf dem 1.580 m hohen Moschkogel und finalisiert derzeit eine Agri-PV-Anlage, die mit Energiespeichersystemen ausgestattet wird.
Klassisches Ausleitungskraftwerk mit technisch aufwändiger Rückleitung
Am Standort des stillgelegten Kleinwasserkraftwerks Reinbacher wurde das neue Kraftwerk Auwehr in den Jahren



Die umfassend vorgeplante Erneuerung der Elektro- und Leittechnik konnte innerhalb von nur zwei Wochen erfolgreich abgeschlossen werden.
2000 bis 2022 von der viktor kaplan muerz gmbh errichtet. Grundsätzlich handelt es sich bei der Anlage um ein klassisches Ausleitungskraftwerk. Die Wehranlage besteht aus einem Betonbauwerk mit aufgesetzter Wehrklappe, Grundablass- und Spülschützen. Die Entnahme des Triebwassers erfolgt durch ein seitlich angeordnetes Einlaufbauwerk. Zur Entfernung von Treib- und Schwemmgut am vertikalen Schutzrechen sorgt eine mit zwei Teleskoparmen versehene Rechenreinigungsmaschine. Für die ökologische Durchgängigkeit am Wehrstandort, an dem der Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasserbereich 5,2 m beträgt, dient ein naturnah angelegter Beckenpass. Die vorgeschriebene Restwasserdotation wird durch eine Dériaz-Turbine der Firma Geppert zur Stromerzeugung genutzt. Bei der Errichtung des Kraftwerks wurde die 1.040 m lange Druckrohrleitung aus Holzrohren hergestellt. Der Abrieb des scharfkantigen Sedimentgesteins aus dem Karst, dem die Mürz entspringt, führte im Laufe der Jahre allerdings zu ei-

Die 1.040 m lange Druckrohrleitung wurde im Jahr 2023 durch neue GFK-Rohre in der Dimension DN2700 und DN2500 vollständig ersetzt.
nem erheblichen Abrieb der Holzrohrleitung und diversen kleineren Leckagen. Im Herbst 2022 entschieden sich die Betreiber für einen Komplettaustausch des Kraftabstiegs, der im darauffolgenden Jahr durchgeführt wurde. Die neue Druckrohrleitung besteht zur Gänze aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK) mit den Dimensionen DN2700 und DN2500. Der Austausch der Druckrohrleitung machte sich nicht nur im Hinblick auf die Betriebssicherheit bezahlt. Durch die erheblich geringeren Reibungsverluste der GFK-Leitung konnte die Engpassleistung der Anlage um rund 15 Prozent auf ca. 1,1 MW gesteigert werden, das Regelarbeitsvermögen erhöhte sich um ca. 10 Prozent auf jährlich rund 5 GWh. Im Maschinengebäude kommen zwei im Verhältnis 1:2 ausgelegte doppeltregulierte Kaplan-Schachtturbinen der Firma Voith mit direkt gekoppelten Synchron-Generatoren zum Einsatz. Mit den unterschiedlich groß dimensionierten Turbinen kann auch bei schwankenden Zuflüssen ein Maximum an Effizienz erzielt werden. Der erzeugte Ökostrom wird im Krafthaus auf 20 kV hochgespannt und in das öffentliche Netz eingespeist. Eine Besonderheit des Kraftwerks Auwehr bildet die 270 m lange Rückgabeleitung des abgearbeiteten Triebwassers in die Mürz. Diese besteht aus zwei parallel angeordneten, doppelt umgelenkten GFK-Rohrleitungen DN2200 und musste mit einem Hochpunkt ausgeführt werden, damit die Unterquerung der Eisenbahntrasse der Semmeringbahn ohne größeren Bauaufwand bewerkstelligt werden konnte. Zur Entlüftung infolge des Unterdrucks wurde am Hochpunkt der Leitung eine Vakuumstation mit zwei automatisch gesteuerten Entlüftungspumpensystemen der Firma Vatec installiert.
Zeit für neue E-Technik
„Anfang des Jahres 2025 war die Zeit für eine elektrotechnische Modernisierung gekommen. Nach über 20 Jahren Einsatzdauer gibt es üblicherweise zwar noch regelungstechnische Ersatzteile, aber keine neuen Komponenten mehr. Um die Betriebssicherheit der Anlage für die Zukunft zu gewährleisten, hatten sich die Betreiber für eine umfassende Modernisierung der Regelungs- und Schutztechnik entschieden“, erklärt Projektleiter Markus Kerschner vom niederösterreichischen

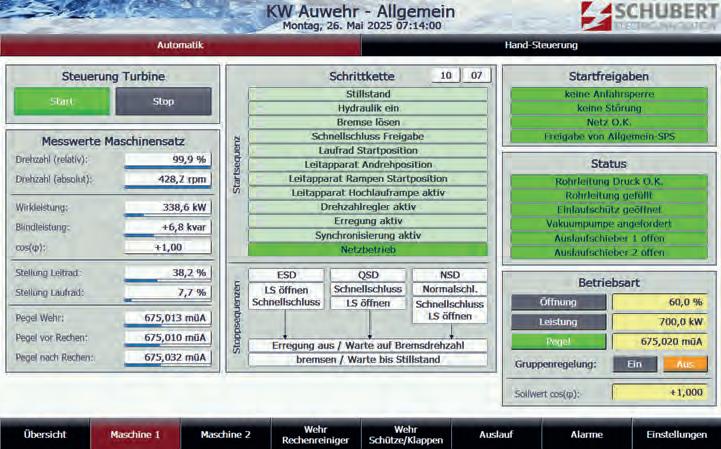
Automatisierungsspezialisten Schubert CleanTech GmbH, der mit der Erneuerung beauftragt wurde: „Ein großer Vorteil war natürlich die Tatsache, dass Schubert die Anlage bereits bei der Errichtung in den 2000er-Jahren ausgestattet hatte. Wir wussten über die alten Komponenten und die Software sehr gut Bescheid und konnten somit die wichtigsten Inputs in die Programmierung der neuen Steuerung mitnehmen.“ Als größte Projektherausforderung nennt Markus Kerschner die kurze Zeit, in der die Modernisierung nach Möglichkeit umgesetzt werden sollte. Die umfangreichen Vorplanungen starteten im Herbst des Vorjahres, als Umsetzungszeitraum wurde die Niederwasserperiode während der kalten Wintermonate gewählt, um die Erzeugungsverluste während des Betriebsstillstands möglichst gering zu halten.
Umfassende Erneuerung
Das Projekt umfasste die Neuprogrammierung der gesamten Kraftwerkssteuerung für die beiden Kaplan-Maschinensätze im Krafthaus, die Wehranlage und deren technische Gewerke wie Stauklappe, Schützen und Rechenreinigungsmaschine, die übergeordnete Kraftwerkssteuerung inklusive Alarmierung und Fernzugriff sowie die Steuerung

der Auslaufverschlüsse der saugseitigen Rohrleitung. Die ausgedienten Steuerungen von Mitsubishi wurden durch moderne SPS-Systeme von Siemens ersetzt. Darüber hinaus wurden der Generator- und Netzentkopplungsschutz sowie die Sychronisierungskomponenten komplett erneuert. Zudem wurde von Schubert auch die Steuerung der Restwasserturbine an der Wehranlage neu programmiert. Dieser Zusatzauftrag erfolgte einen Monat nach der Inbetriebnahme des Hauptkraftwerks.
Modernisierung macht sich bezahlt
Markus Kerschner lässt in seinem Resümee nicht unerwähnt, dass das Projekt dank der exakten Vorplanung in äußerst kurzer Zeit reibungslos realisiert werden konnte. „Die Umsetzung hat sogar noch besser geklappt, als wir es uns vorgestellt hatten. Mit Ausnahme des Wehrkraftwerks wurde der komplette Vor-Ort-Austausch aller Steuerungen inklusive der Schutz- und Synchronisierungskomponenten sowie die Wiederinbetriebnahme innerhalb von zwei Arbeitswochen durchgeführt. Eine große Unterstützung hat dabei auch das Betriebspersonal der Anlage geleistet. Denn im Zuge der Umbauten sind auch die einen oder anderen Defekte ans Tageslicht gekommen, mit denen wir nicht gerechnet hatten – beispielsweise hat die Sensorik bei gewissen Druck- oder Endschaltern nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Diese Komponenten wurden vom Kundenpersonal schnellstmöglich organisiert und direkt ausgetauscht.“
Dass sich die elektro- und leittechnische Erneuerung gelohnt hat, steht außer Zweifel. Neben der verbesserten Betriebssicherheit stehen dem Betriebspersonal nun weitaus umfangreichere Fernwirk- und Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem wurde auch das Restwasserkraftwerk in die übergeordnete Kraftwerkssteuerung eingebunden. Man darf durchaus davon ausgehen, dass Viktor Kaplan dem modernisierten Kraftwerk in seinem Geburtsort ein sehr gutes Zeugnis ausstellen würde.


Mit smarter Planung die Aufgaben der Energiewende just in time zu meistern – das war der Aufruf des Eplan Events „Branchendialog Energie“, dem am 09. April 2025 im AKW Zwentendorf rund 60 Besucher folgten. „Höchst aufschlussreich und intensiv praxisbezogen“, lautete der allgemeine Tenor der Gäste am Ende der rundum gelungenen Veranstaltung, die den Anspruch einer Plattform zum regelmäßigen informativen Austausch verfolgt.
Den Auftakt des Events leitete seitens Eplan Österreich, Alexander Raschendorfer, Director Professional Services, ein: „Hier, im AKW Zwentendorf befinden wir uns in einem voll funktionsfähig gebauten Atomkraftwerk, das aufgrund einer 1978 gehaltenen Veto-Volksabstimmung niemals ans Netz gebracht wurde. Und ausgerechnet hier, wo niemals Strom floss, fließen heute Gedanken, Ideen und Energien zu den Themen Netzausbau und neue Technologien von einer Gesellschaft ein, die vernetzt und nachhaltig denkt, um die Energiewende meistern zu können. Aus diesem Grund sprechen wir heute u.a. auch über die All Electric Society, die ein Zukunftsbild der Welt beschreibt, das nicht nur die CO2-neutral gewonnene Elektrizität ins Zentrum stellt, sondern auch der klimatischen Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen nachkommt.“
Ambitionierte All Electric Society „Wahrscheinlich steht unsere Gesellschaft weltweit mitten in einem der größten Change-Prozesse der Menschheit“, hält Jochen Förster-Kugler, Leiter der Projektkommunikation und des Klimadialogs bei der EVN, zu Beginn seiner Keynote fest und führt dazu die allgemeine Emotionslage der heutigen Jugend aus: „Basierend auf seitens der EVN durchgeführter Schulbesichtigungen des AKWs Zwentendorf
mit anschließenden Schülerbefragungen, erhielten wir von der Hälfte bis zwei Drittel der jugendlichen Gäste deren düsteren Wahrnehmungen, dass die Menschheit an den Folgen des Klimawandels zugrunde gehen wird. Doch, wo steht Österreich tatsächlich auf seinem Weg in die energetische Zukunft?“ Laut jüngsten österreichischen Erhebungen verzeichnete Niederösterreich 2024 den heißesten Sommer des Jahrtausends

Die Organisatoren freuten sich über das rege Interesse der Besucher.

mit nachfolgenden größten je gegebenen Niederschlägen. Dahingehend bestätigen auch neueste Aufzeichnungen, dass Europa der am intensivsten vom Klimawandel betroffene Kontinent der Erde sein wird. „Doch die gute Nachricht dazu ist, dass wir Lösungen dazu haben, die auch längst auf den Weg gebracht werden“, so ist Förster-Kugler der festen Ansicht, dass die Strategie der Gewinnung erneuerbarer Energien für stabile Preise, für autarke Versorgungssicherheit und für eine Förderung der heimischen Wertschöpfung sorgen kann. „Dies sind ganz wichtige Botschaften, die wir den Menschen – und besonders der Jugend – unbedingt zu vermitteln haben“, betont Förster-Kugler.
Der klimatechnische Wirtschaftsbeitrag
Was speziell österreichische Unternehmen zur Erreichung der Klimaziele beitragen, drückt sich bereits durch deren breitgefächerte Leistungskataloge aus. Als eines der herausragenden Paradebeispiele zeigt sich hierzu die EVN, als Veranstaltungsort des Eplan Events: So ist die EVN einerseits als Inhaber und Vermieter des nie in Betrieb genommenen AKWs Zwentendorf und andererseits als Betreiber von Wasserkraftwerken in Österreich sowie in weiteren sechs Ländern mit der gesamten Palette der erneuerbaren Energieerzeugung tätig. Demnach ist die EVN auch über ihre Tochtergesellschaft, der WTE Wassertechnik, zusätzlich in zehn Ländern in den Bereichen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung aktiv. An ihrem Stammsitz in Niederösterreich rangiert die EVN in Sachen Windkraftanlagen sogar als Nummer Eins und nimmt in dieser Sparte in gesamt Österreich den dritten Platz ein. Dazu sind sie auch noch ein aufstrebender Photovoltaik-Betreiber. Selbst in der Naturwärme-Erzeugung, die über Fernwärme auf nachhaltiger Basis vertrieben wird, ist die EVN engagiert und ist zusätzlich dahingehend in Niederösterreich der Netzbetreiber. Doch dem nicht genug, verfolgt der Energieanbieter fortlaufend innovative Pilotprojekte, um künftig die Treibhausgase entsprechend dem Pariser Klimaabkommen bis 2034 um 60 Prozent reduzieren zu können.
Eplan & Rittal User-Nutzen im Best Practice-Format
Wie die Eplan Engineering-Angebote im Verbund mit den Rittal Systemlösungen Unternehmen der Energiebranche in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und helfen, den Wandel zur Klimaneutralität voranzubringen, gaben Vertreter der Unternehmen Schubert CleanTech, der illwerke vkw sowie der entegra beim Event zum „Besten“:
Den Auftakt zur Best-Practice-Vortragsreihe leitete Stefan Haslinger, Prokurist und Leiter Innovation & Divisionsleiter Energieverteilung der Schubert CleanTech GmbH, ein. Das Unternehmen ist bereits seit über 55 Jahren ein gefragter Partner für alle Bereiche der Kraftwerkstechnik und Netzinfrastruktur, Wasserversorgung und Wasserentsorgung sowie der Energieversorgung von Industriebetrieben und großen Gebäuden. Für das klassische Engineering sämtlicher zu projektierender Kundenanlagen nutzt Schubert CleanTech intensiv die Software-Tools von Eplan. Und in der Fertigung greift das Unternehmen immer gerne auf die Lösungskompetenzen von Rittal zurück, wie z. B. auf das Rittal Wire Terminal, das ihre Drahtsätze automatisiert fertigt.

Auch für Publikumsfragen war natürlich genug Zeit eingeplant.

Auch die illwerke vkw macht seit mehr als hundert Jahren mit Bodenständigkeit und visionären Ideen Energie für das Bundesland Vorarlberg nutzbar. Mit dem Vortrag „Vom KKS zum digitalen Zwilling“, von Marcel Bitschnau, zuständig für die Elektrotechnik Sekundärtechnik Projektierung im Geschäftsfeld der Wasserkraft der illwerke vkw, wurde ein weiterer Einblick zu den vielfältigen Eplan Projektierungsmöglichkeiten geboten. Die dazu verwendeten Eplan Plattformlösungen, wie Eplan Preplaning, Eplan Electric P8 und Eplan Pro Panel, wurden von Rupert Pfaffeneder, Eplan Senior Consultant, beschrieben. Bei dieser Gelegenheit betonte Marcel Bitschnau, die von seinem Unternehmen sehr geschätzte Beratungskompetenz des Eplan Consulting Teams, welche sich mittels Consultings und Trainings über die Einführung von Eplan und darüber hinauszog. Und diese Eplan Leistungen will die illwerke vkw auch gerne zukünftig für die Schulung neuer Mitarbeiter beanspruchen. entegra hingegen unterstützt ihre Kunden bei der Optimierung und Automatisierung von Planungs- und Konstruktionsprozessen bis hin zur Integration in ERP-Systeme. Dafür verwendet entegra für den Bereich der Primärtechnik ihre Lösung primtech sowie für die Seite der Sekundärtechnik Eplan. Mit dieser Kombination wird gezeigt, wie Datensilos der Primär- und Sekundärtechnik aufgebrochen werden können. So erstellt primtech Punktwolken mit Hilfe von Laserscans und nimmt auch Fotos von Geräteschildern auf, die dann in primtech zu einem 3D-Modell und digitalen Zwilling eines Umspannwerks zusammengesetzt werden. Diese Datensätze der technischen Primärseite werden dann in Eplan Preplanning
über vordefinierte Datenfelder via einer Schnittstelle (und teilweise automatisiert per Drag & Drop) in einzelne Liniendiagramme überführt, die die verschiedenen Bereiche eines Umspannwerks aus elektrotechnischer Sicht beschreiben. Aus der Vorplanung kann auch das Detailengineering (Sekundärtechnik) abgeleitet werden. Damit wird die Verbindung zwischen Primärtechnik und Sekundärtechnik hergestellt. Das weitere Engineering in Eplan (nach Anforderung in 2D oder 3D) kann daraufhin nahtlos erfolgen. Mathias Schuy, Business Development Manager für die primtech-Lösung der entegra, nahm in seinem Applikationsbeitrag hierzu Bezug auf die Digitale Revolution im energietechnischen Umfeld am Beispiel der naturenergie Netze. Thematisch ergänzend, dokumentierte Dirk Blechschmidt, Consultant Energy bei Eplan, die Projektierung des Umspannwerks Rheinfeld, deren Planung und Weiterentwicklung unter Nutzung des digitalen Zwillings aus der Anreicherung unterschiedlicher Systeme immens beschleunigt werden konnte.
Die Digitalisierung der Energielieferkette
Wie die Engineering-Tools von Eplan und die Lösungen von Rittal innovativ die Energiewende beflügeln können, das wurde plakativ wie praxisbezogen seitens Eplan von Mathias Kapeller, Dirk Blechschmidt, Stefanie Kudak und Alexander Raschendorfer sowie seitens Rittal von Martin Österreicher und Christoph Unger präsentiert.
„Die Energiebranche steht inmitten großer Veränderungen, die Eplan voller Elan begleiten und mitgestalten will“, betonte


Die Veranstaltung bot neben den Fachvorträgen auch ein ideales Umfeld zum Netzwerken und Austausch unter den Branchenvertretern.
Mathias Kapeller, Eplan Sales Manager Industrial Energy, und führte das Eplan Leistungsspektrum dazu aus: „Dies gelingt zum einen mit unseren vielfältigen Software-Angeboten mit denen Planer, Projektanten und Betreiber für ihre energietechnischen Anlagen z. B. automatisiert Schaltpläne und daraus verlässlich richtige Dokumentationen effizient und nachhaltig erstellen können. Das Potenzial, das sich daraus ergibt, ermöglicht nebst Projekten im Bereich der Niederspannung auch komplette Umspannwerke mit Hoch- und Mittelspannung zu planen. Ergänzend bietet Eplan entsprechende Digitalisierungssysteme, die diese Dokumentationen für alle Projektbeteiligten informativ machen, deren Zusammenarbeit unterstützen und Fehlerquoten auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus ermöglichen die Digital-Tools von Eplan auch die Vorplanung eines Projektes.“ Exemplarisch demonstriert wurde dahingehend von Dirk Blechschmidt, wie rasch, effektiv und sicher die Planung eines dezentralen Energiesystems, wie z. B. einer PV-Anlage, anhand der Eplan Plattformlösungen zu bewerkstelligen ist.
AI-Driven Industrial Automation
Auf jüngste Eplan Innovationen in Sachen Künstlicher Intelligenz machte Mathias Kapeller mit der Vorstellung eines in Planung befindlichen Use Cases, wie den eines Eplan Copilots, aufmerksam, mittels dem die Engineering-Prozesse in naher Zukunft noch weiter verbessert werden können. Stefanie Kudak, Vertical Market Managerin bei Eplan, verwies dazu auch auf die KI-getriebene Eplan Kooperation mit Siemens, die vor kurzem auf der Hannover Messe per Use Case vorgestellt

wurde: Beide Unternehmen arbeiten an der weitreichenden End-to-End Integration, die in Zukunft den gesamten Engineering-Prozess digitalisieren und automatisieren wird. Durch KI-gestützte Werkzeuge könnten Entwickler dann innerhalb weniger Minuten verschiedene Szenarien simulieren, die bisher Tage oder sogar Wochen beanspruchen.
Fortschritt per smarter Synergieeffekte
Auf die Synergieeffekte, die über kollaborative Leistungen von Eplan und Rittal erreicht werden, gingen Martin Österreicher und Christoph Unger mit der Eplan-Projektierung der VX25 Ri4Power Schalt- und Energieverteilanlage von Rittal ein. Anhand einer dazu dargestellten Applikation konnten die Eventbesucher erleben, wie einfach, sicher und rasch diese ganzheitliche Projektierung mittels Eplan Electric P8 sowie Eplan Pro Panel in 2D oder 3D umsetzbar ist. Bei diesem bidirektionalen Zusammenspiel kommt auch das Erweiterungsmodul „Copper Design“ von Eplan Pro Panel zum Zug, das die Planung und Fertigung von Strom- und Sammelschienen effizient unterstützt.
Führung durch das AKW Zwentendorf
Am Ende des kurzweilig informativen Tages, erhielten die Event-Teilnehmer die Gelegenheit zu einem Rundgangs durch das AKW Zwentendorf – es sei nur so viel dazu gesagt, dass sich dieses Angebot kaum einer der Gäste entgehen ließ!
www.eplan.at/energie


Mit viel eigenem Know-how gelang es der Familie Hudelist, ihr neues Kleinwasserkraftwerk in den Nockbergen zu verwirklichen.
Inmitten der imposanten Landschaft des Biosphärenparks Nockberge in Kärnten wurde mit großer Eigeninitiative ein bemerkenswertes Ökostrom-Projekt verwirklicht: das neue Kleinwasserkraftwerk Hansl-Power, das die Quelle der Bärengrubenalm nutzt, um jährlich rund 340.000 kWh grünen Strom zu erzeugen. Nicht einmal drei Jahre benötigten der junge Projektbetreiber DI Jörg Hudelist und seine Frau DI Anja Hudelist, ihre Kraftwerkspläne in die Tat umzusetzen. Zentrale Herausforderung des Projekts war die Verlegung der 1,2 km langen Druckrohrleitung, die aus hochwertigen Gussrohren der Tiroler Rohre GmbH, kurz TRM, gebaut wurde. Die Arbeiten dafür wurden im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Im Krafthaus sorgt eine moderne 1-düsige Peltonturbine aus dem Hause EFG für zuverlässige Energieerzeugung. Mit dem neuen Kraftwerk Hansl-Power konnte eine Muster-Anlage geschaffen werden, die beispielgebend für die Energiewende in der Region steht.
Die Nockberge, eine der malerischen Gebirgsgruppen in Österreich, prägen als sanfte, grasbewachsene Gipfel das Bild der westlichen Gurktaler Alpen. Natur, Tradition und Innovation gehen hier Hand in Hand. Der UNESCO-Biosphärenpark Nockberge ist ein Refugium für seltene Pflanzen- und Tierarten – und zugleich ein Modellgebiet für nachhaltige Nutzung. Schon immer haben die Menschen hier die natürlichen Ressourcen klug genutzt: in der Landwirtschaft, im Tourismus – und zunehmend auch für erneuerbare Energien. Mit ihren Wasserläufen und ihrer Topografie bieten die Nockberge ideale Voraussetzungen für kleine Wasserkraftwerke, die lokal grünen Strom erzeugen, ohne die empfindliche Natur zu belasten. Daher findet man in der Region auch einige Kleinwasserkraftwerke, die zumeist privat betrieben werden und in die landwirtschaftlichen Strukturen eingebunden sind. Die Nutzung von Wasserkraft in den Nockbergen erfolgt im Einklang mit dem Schutzstatus des Biosphärenparks, wobei streng auf ökologische Verträglichkeit geachtet wird
Leidenschaft, Fachwissen und viel Eigenregie Für Jörg Hudelist, einen jungen Ingenieur, Baumeister und Wasserwirtschaftsexperten aus Klagenfurt und seine Frau, die Technische Physikerin Anja Hudelist, war es ein Herzensprojekt. Auf 320 ha eigenem Waldbesitz, den die Familie in den 1990er Jahren erworben hatte, hat man die Wasserkraftquelle an der Bärengrubenalm erschlossen, um ein modernes Kleinwasserkraftwerk zu errichten. „Die Idee dafür haben wir seit 2022 entwickelt, und drei Jahre später läuft das Kraftwerk. Das erfüllt mich mit Stolz, weil wir auch gezeigt haben, was mit Engagement und Know-how machbar ist“, erzählt Hudelist. Die behördlichen Genehmigungen wurden erstaunlich schnell erteilt, was für die akribische Vorarbeit des jungen Ingenieurs spricht. Doch die Umsetzung war auch von Herausforderungen geprägt: ein früher Wintereinbruch mit Schneefall und Bauunterbrechungen. Teilweise mussten die Arbeiten sogar im Schnee durchgeführt werden – was Jörg Hudelist und seinem Bauteam alles abverlangte. Besonders
beeindruckend erscheint die enge Verzahnung von Planung, Umsetzung und Betrieb: Hudelist plante selbst viele Details der Anlage, er überwachte die Baustelle und wird auch den Betrieb mit Leidenschaft begleiten.
Herausforderung – Verlegung der Druckrohrleitung
Vom Konzept her handelt es sich um ein Hochdruck-Kleinkraftwerk. Auf ca. 1.900 m wurde auf der Bärengrubenalm eine Wasserfassung im dort bestehenden Teich angelegt. Hier werden laut Konzession bis zu 30 Sekundenliter entnommen und über die Druckrohrleitung zur Turbine zugeführt, wo die eigentliche Stromerzeugung passiert. „Was die Quelle auf der Bärengrubenalm auszeichnet: Dass das Wasser sehr sauber und relativ sedimentfrei ist. Dank des kleinen vorgelagerten Teichs setzt sich hier schon viel Sediment ab“, erklärt der Betreiber. Das schont das Laufrad.
Laut seinen Angaben lag die zentrale Herausforderung des Bauprojekts im Bau des Kraftabstiegs, der im Wesentlichen von der Baufirma Dullnig aus Feldkirchen realisiert wurde. Das Kriterium lag einerseits an der schwierigen Topographie des Geländes, aber auch an den Witterungsbedingungen. Der erste Teil der 1.200 m langen Leitungstrasse verlief dabei entlang eines bestehenden Weges, im weiteren Verlauf mussten die Rohre durchs Gelände verlegt werden – inklusive der Querung von zwei Wegen und einer Straße, wobei der tiefste Einschnitt 8 m betrug. Jörg Hudelist: „Dem Bauteam ist es gelungen, die gesamte Druckrohrleitung im Gefälle zu verlegen. Somit weist die Leitung keinen Hoch- bzw. Tiefpunkt auf.“ Dass dabei nur ganz wenige Formstücke verbaut wurden, lag an der durchdachten Trassenplanung und der gewählten Technologie. Neben der Druckrohrleitung wurden auch Strom- und Lichtwellenleiterkabel mitverlegt.
TRM Gussrohre: langlebig und wirtschaftlich
Bei der Wahl des Rohrmaterials setzte der Betreiber ganz bewusst auf auf den hohen Qualitätsstandard der Gussrohre der Tiroler Rohre GmbH (TRM). Konkret kamen Rohre vom Typ Pur Longlife in der Rohrdimension DN200 und der Druckstufe PN40 zum Einsatz, die durchgehend mit schub- und zuggesicherten VRS-T-Verbindungen verlegt wurden. Dieses Verbindungssystem garantiert maximale Standfestigkeit. Die Leitung kann da-


Über eine Trassenlänge von 1,2 km wurden für das Projekt Gussrohre von TRM der Dimension DN200 und der Druckstufe PN40 unterirdisch verlegt.
mit höchsten Druck- und Zugbelastungen standhalten – sogar Muren und Hangrutschungen. Durch die Abwinkelbarkeit der Muffen um bis zu 4 Grad konnten die erforderlichen Richtungsänderungen elegant gelöst werden, ohne aufwändige BetonFixpunkte. Die gewählte Rohrdimension gewährleistet einen optimalen Durchfluss und Top-Wirtschaftlichkeit. Bei der Querung der Nockalmstraße kam zudem ein ZMU-Rohr zum Einsatz, das in ein Stahlrohr eingeschoben wurde, um maximalen Schutz zu bieten. Die enge Abstimmung mit den Technikern von TRM ermöglichte es, das Rohrsystem optimal an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, auch bei schwierigen



Microtunneling für die Unterquerung der Nockalmstraße. Ein ZMU-Rohr wurde gut geschützt in ein Stahlrohr hineingeschoben.
Abschnitten. DI Jörg Hudelist betont, dass es beruhigend gewesen sei, dass man die Rohrspezialisten von TRM jederzeit zu Rate ziehen konnte.
Nachhaltigkeit als entscheidender Faktor
Ein weiterer wichtiger Grund, warum der Betreiber auf die Gussrohre aus dem Hause TRM vertraut: Die Rohre bestehen aus nahezu 100 % recyceltem Alteisen, was ebenso einen minimalen CO2-Fußabdruck garantiert wie die kurzen Transportwege zur Baustelle. Dank der Kombination aus Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit eignen sie sich perfekt für ein ökologisch sensibles Gebiet wie die Nockberge. Die optimale Wirtschaftlichkeit des Rohrsystems ist nicht zuletzt auch ein Resultat aus der schnellen Verlegbarkeit der Gussrohre. „Weil die Bauphase auf dieser Seehöhe begrenzt ist, war uns wichtig, dass die Rohrverlegung schnell geht. Und das war ebenfalls ein wichtiges Argument für das Gussrohrsystem von TRM“, erklärt Jörg Hudelist. Selbst unter widrigsten Bedingungen – wie dem Wintereinbruch im Herbst 2024 – konnte die Rohrverlegung fortgesetzt werden, was die einfache Handhabung des Systems unter Beweis stellte.

Die Idylle im Fassungsbereich der Quelle auf der Bärengrubenalm auf 1.800 m Seehöhe wurde durch das Projekt kaum beeinträchtigt.
Herzstück der Stromerzeugung
Besonders stolz ist Hudelist auf die technische Lösung im kleinen Maschinenhaus. Er setzt dabei auf die Technik des etablierten Kärntner Wasserkraftspezialisten EFG. Das Unternehmen unter Führung des Vater-Sohn-Gespanns Ing. Werner und DI Martin Goldberger ist bekannt für seine innovative Technik und zuverlässigen Service. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Planung und Fertigung von Turbinen hat sich EFG als bevorzugter Partner in der Branche etabliert. Die 1-düsige Peltonturbine wurde im September 2024 geliefert und unter der Leitung von Projektleiter Lukas Frisch von den EFG-Technikern fachgerecht installiert. Sie ist perfekt auf die Ausbauwassermenge von 30 l/s und die NennFallhöhe ausgelegt – und erreicht damit eine Nennleistung von 55 kW.
EFG überzeugte auch bei diesem Projekt: von der Beratung über die Auslegung bis zur Inbetriebnahme. Ihr Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen garantiert, dass jedes Projekt optimal umgesetzt wird. „Gerade bei einem Erstprojekt wie dem unse-

Ausbauwassermenge: 30 l/s
Turbine: 1-düsige Peltonturbine
• Fabrikat: EFG
• Ausbauleistung: 55 kW
Drehzahl: 1.500 Upm
Generator: Asynchron
• Druckrohrleitung: Guss
Fabrikat: TRM (Tiroler Rohre GmbH)
Länge: 1,2 km Ø: DN200 Druckstufe: PN40
• Regelarbeitsvermögen: 340.000 kWh
ren war es entscheidend, einen Partner zu haben, auf den wir uns voll verlassen können“, erklärt die Familie Hudelist. „EFG hat hier Maßarbeit geliefert.“ Zudem zeichnet sich EFG durch nachhaltige Produktionsmethoden, hohe Qualitätsstandards und eine ausgeprägte Kundennähe aus – Faktoren, die bei anspruchsvollen Projekten wie in den Nockbergen entscheidend sind.
Ein Vorzeigeprojekt für die Region
Mit einer konservativ gerechneten Jahresleistung von 340.000 kWh leistet das Kraftwerk einen wichtigen Beitrag zur regionalen Energieversorgung. Durch die geschickte Einbindung ins Landschaftsbild bleibt die Anlage für Wanderer und Naturfreunde nahezu unsichtbar. Sie fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, ohne das landschaftliche Bild zu stören – ein Paradebeispiel für ökologisch verträgliche Infrastruktur. Hinzu kommt, dass das abgearbeitete Triebwasser in der Fischzucht des benachbarten Landwirts übernommen wird. Dank der Verwirbelung in der Turbine wird es mit Sauerstoff angereichert - und ist daher in den Fischpools hoch willkommen.
Das Kleinwasserkraftwerk Hansl-Power zeigt beispielhaft, wie technologische Innovation, Nachhaltigkeit und regiona-

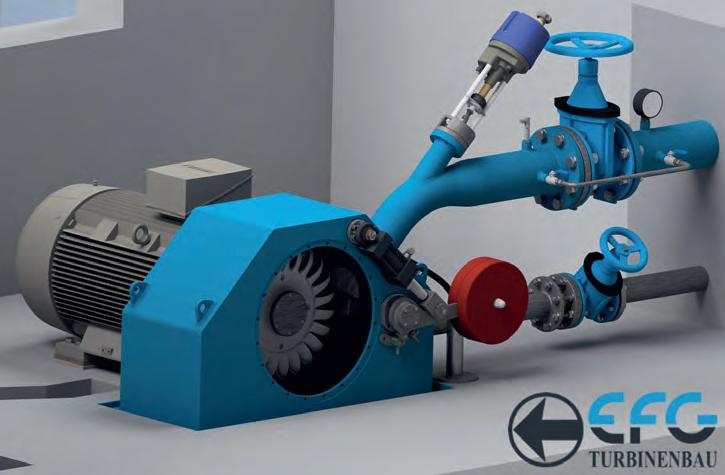
Klein – aber fein und leistungsstark: Die 1-düsige Peltonturbine aus dem Hause EFG mit 55 kW Leistung liefert im Jahr rund 340.000 kWh. (3D-Darstellung im Rendering von EFG)
le Wertschöpfung Hand in Hand gehen können. Es ist nicht nur ein VorzeigeKraftwerk, sondern auch ein positives Signal für die Energiewende in den Alpen. „Ich hoffe, dass wir mit diesem Projekt andere motivieren, ähnliche Initiativen zu starten“, sagt Hudelist. „Denn die Zukunft gehört den dezentralen, nachhaltigen Energielösungen.“ Neben der technischen Dimension hat das Projekt

auch eine gesellschaftliche: Es stärkt die regionale Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und bietet ein echtes Vorbild für klimafreundliche Energiegewinnung. Mit starken Partnern wie TRM und EFG an seiner Seite hat die Familie Hudelist ein Projekt realisiert, das weit über die Region hinausstrahlt. Für Jörg Hudelist war es sein erstes Kraftwerk, aber höchstwahrscheinlich nicht sein letztes.


Die sichere Wasserversorgung. www.trm.at

Grande Dixence SA feiert das 75-jährige Bestehen des Kraftwerks, das wie kaum ein anderes für die Energieunabhängigkeit der Schweiz steht..
Vor 75 Jahren wurde die Gesellschaft Grande Dixence SA gegründet, um ein Wasserkraftwerk zu bauen und zu betreiben, das einmal das größte der Schweiz werden sollte. Mit 285 Metern ist der gewaltige Sperrriegel aus Beton die höchste Gewichtsstaumauer der Welt – ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, Symbol menschlicher Entschlossenheit und zugleich eine zentrale Säule der Schweizer Energieversorgung. In den kommenden Monaten wird das 75-Jahr-Jubiläum unter anderem mit einer Wanderausstellung in den konzedierenden Gemeinden, der Herausgabe eines historischen Buches, einer Ausstellung auf der Mauerkrone der Staumauer Grande Dixence sowie einem Tag auf der Foire du Valais gebührend gefeiert.
Am 25. August 1950 gründete EOS (Energie Ouest Suisse, heute Alpiq) die Grande Dixence SA in Sitten, um angesichts des steigenden Strombedarfs der Westschweiz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wasserkraftwerk zu bauen und anschließend zu betreiben. 75 Jahre später ist Grande Dixence nach wie vor die größte Wasserkraftanlage der Schweiz und hält mehrere Weltrekorde, unter anderem den für die höchste Gewichtsstaumauer. Der Bau von Staumauern und Produktionsanlagen hat wesentlich zur Entwicklung der jeweiligen Alpentäler beigetragen. „Die Gesellschaft Grande Dixence hat von Anfang an großen Pioniergeist bewiesen, der das Wallis, die Schweiz und die Welt der Wasserkraft geprägt hat. Wir sind stolz auf dieses Erbe und möchten unser 75-jähriges Bestehen gemeinsam mit der Bevölkerung feiern, indem wir einen Blick auf die Vergangenheit
75 Jahre in der Retrospektive
• Wanderausstellung: Von Mai bis Dezember präsentiert sich die Grande Dixence der Bevölkerung der 20 konzedierenden Gemeinden – Gemeinden, die dem Unternehmen Wasserrechte zur Stromproduktion gewährt haben – und zweier Standortgemeinden.
• Buchveröffentlichung «Grande Dixence SA, Pioniergeist seit 75 Jahren»: Brigitte Kalbermatten, Historikerin und Archivarin, begibt sich in ihrem Buch für Geschichtsinteressierte auf
dieses außergewöhnlichen Bauwerks werfen und gleichzeitig die bestehenden Infrastrukturen an die zukünftigen Bedürfnisse anpassen“, betont Amédée Murisier, Präsident der Grande Dixence SA.
Vielfältiges Programm
Anlässlich ihres Jubiläums hat die Grande Dixence in den kommenden Monaten verschiedenste Aktivitäten geplant. „Grande Dixence hat zur Entwicklung der Alpentäler beigetragen und ist Teil der Geschichte der Region. Mit einer Wanderausstellung für alle konzedierenden Gemeinden möchten wir die Bedeutung unserer Wasserkraftanlage in Erinnerung rufen und der Öffentlichkeit unser Know-how näherbringen“, erklärt Beat Imboden, Geschäftsleiter der Grande Dixence SA.
die Spuren der Vergangenheit der Grande Dixence SA. Die Vernissage fand in Anwesenheit der Autorin am 4. Juni 2025 in Sitten statt.
• Ausstellung auf der Staumauer: Von Juni bis Oktober wird die Staumauer in neuem Glanz erstrahlen und rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern auf eine Zeitreise mitnehmen.
• Foire du Valais: Am Freitag, 3. Oktober, wird die Grande Dixence SA auf der Foire du Valais am Stand von Alpiq im Mittelpunkt stehen.

Aufwändige Bauarbeiten für die 285 m hohe Staumauer am Lac des Dix
Geschichte eines Jahrhundert-Bauwerks
Zwischen 1951 und 1961 arbeiteten rund 3.000 Männer an der größten Gewichtsstaumauer der Welt, die am Ende drei Jahre füher als geplant fertiggestellt werden konnte. Der letzte Kübel Beton wurde am 22. September 1961 verbaut. Die Zahlen sind schlichtweg beeindruckend: Mehr als 15 Millionen Tonnen schwer, besteht die Mauer aus sechs Millionen Kubikmetern Beton, sie ist damit schwerer als die Cheops-Pyramide in Ägypten. In Summe wurde genug Material verbaut, um eine 1,5 Meter hohe Mauer rund um den Äquator zu bauen.
An der Basis misst die Mauer 198 Meter, an der Krone noch 15 Meter. Die Krone selbst liegt auf 2.365 Metern über Meer und erstreckt sich über 695 Meter Länge. Hinter ihr staut sich der Lac des Dix, der mit einem Volumen von 400 Millionen Kubikmetern Wasser den größten künstlichen See der Schweiz bildet. Dieses Stauvolumen entspricht rund einem Fünftel der gesamten in der Schweiz speicherbaren elektrischen Energie.
Unterirdisches Netzwerk mit mehr als 100 Kilometer Länge
Das Wasserkraftsystem der Grande Dixence ist ein verborgenes Netzwerk aus über 100 Kilometern Stollen und Schächten.
Diese Tunnel, die ohne Laser und Drohnen, aber mit unglaublicher Präzision gebaut wurden, verbinden 75 Wasserfassungen aus 35 Walliser Gletschern. Vier Pumpstationen leiten das Wasser zum Lac des Dix, von wo es über Druckleitungen zu den Produktionszentralen in Fionnay, Nendaz und Bieudron strömt.
1993 bis 1998 wurde das System mit dem Optimierungsprojekt Cleuson-Dixence erweitert, das die Produktionskapazität um

die Errichtung wurden insgesamt 6 Mio. Tonnen Beton verbaut.
den Faktor 2,5 steigerte. Mit 1.200 MW ist das unterirdische Kraftwerk Bieudron die leistungsstärkste Zentrale der Schweiz. Insgesamt liefert der Komplex jährlich durchschnittlich zwei Milliarden Kilowattstunden – genug, um 400.000 Haushalte zu versorgen. Damit trägt die Grande Dixence rund ein Fünftel zur nationalen Speicherkapazität bei und ist insbesondere in Trockenperioden oder im Winter ein flexibler Energielieferant.
Ein Vermächtnis an die nächsten Generationen
Die Grande Dixence ist nicht nur ein Bauwerk der Superlative, sondern auch ein Denkmal menschlichen Willens. Die Lebensbedingungen der Arbeiter waren hart: Sie lebten in einfachen Baracken nahe der Baustelle, medizinische Versorgung war spärlich, Arbeitsunfälle waren häufig. Trotzdem schufen sie ein gigantisches System, das bis heute hervorragend funktioniert. Heute ist die Grande Dixence auch eine touristische Attraktion. Das ehemalige Arbeitergebäude ist mittlerweile Hotel und Restaurant. Jährlich besuchen tausende Menschen den Staudamm und den Lac des Dix, um die Anlage zu bestaunen. Auch die Zukunft der Wasserkraft wird in der Region weitergedacht: Ein neues Projekt sieht den Bau des Gornerli-Stausees oberhalb von Zermatt vor, der neben Stromproduktion auch Hochwasserschutz bieten soll.
Die Grande Dixence steht exemplarisch für ein Jahrhundertwerk, das Innovation, Naturkraft und Ingenieurskunst vereint. Sie erzählt von Pionierarbeit, vom Mut, die Natur zu bändigen, und von der Fähigkeit, aus Wasser saubere Energie zu gewinnen – ein Vermächtnis, das bis heute das Wallis und die gesamte Schweiz prägt.

Ein Bauwerk der Superlative: Grande Dixence, die höchste Gewichtsstaumauer der Welt, ist mehr als doppelt so hoch wie der Prime Tower in Zürich.

Die diesjährige Ausgabe des bewährten Anwenderforum Kleinwasserkraft findet im Forum Landquart im Schweizer Kanton Graubünden statt.
Traditionell bringt das Anwenderforum Kleinwassesrkraft Fachleute, Betreiber, Planer, Hersteller und Entscheidungsträger aus allen deutschsprachigen Alpenländern zusammen, um sich über technische Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Strategien für eine nachhaltige Zukunft der Kleinwasserkraft auszutauschen. Durch die Fokussierung auf Praxiserfahrungen und Anwendung füllt das Forum eine wichtige Lücke bei der Weiterentwicklung der Kleinwasserkraft. 2025 findet die Veranstaltung vor der eindrucksvollen Kulisse der Bündner Alpen am 24. und 25. September im Forum Landquart statt.
Die Region rund um Landquart ist wie geschaffen für diesen Dialog: Sie vereint eine jahrhundertealte Tradition der Wassernutzung mit modernen Kleinwasserkraftwerken und bietet damit das ideale Umfeld für das Forum. Historische Wassermühlen stehen hier Seite an Seite mit aktuellen Technologien – ein Spiegelbild der Themen, die in den zwei Tagen im Mittelpunkt stehen.
Das Programm greift zentrale Aspekte der modernen Kleinwasserkraft auf:
• Bau und Modernisierung von Anlagen
• Neue Entwicklungen in Technik und Materialtechnologie
• Innovative Turbinenkonzepte abseits klassischer Nutzung
• Integration von Fischschutzmaßnahmen
• Interaktives Diskussionsforum Antriebssysteme
Der Vortrag „Die Entwicklung des Kleinwasserkraftsektors im Rahmen europäischer Politik“ von Dirk Hendricks, EREF Small Hydro Chapter, gibt Einblicke in die aktuelle Regulierung. Eine spannende Exkursion zum Wasserkraftwerk Schaniela-

bach führt die Teilnehmenden direkt an die Quelle der Praxis. Netzwerken in familiärer Atmosphäre – Raum für Dialog und neue Impulse.
Neben fundierten Fachbeiträgen und Diskussionen steht der persönliche Austausch im Fokus. Die familiäre Atmosphäre schafft Raum für informelle Gespräche und nachhaltiges Netzwerken – ein Aspekt, den viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders schätzen. Beim geselligen Apéro mit Getränken und Fingerfood im Ausstellungs- und Cateringbereich, der von der Repower AG gesponsert wird, können die Erkenntnisse des Tages noch einmal vertieft werden.
Im gesamten Alpenraum steht die Kleinwasserkraft vor großen Herausforderungen: Wie lassen sich ökologische Verantwortung, technische Innovation und wirtschaftlicher Betrieb intelligent verbinden? Genau darüber wird im Forum diskutiert – mit einem klaren Fokus auf praxisnahe Lösungen.
Mehr Informationen und Anmeldung unter https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.de/
Conexio-PSE organisiert renommierte Fachkonferenzen mit den Schwerpunkten Erneuerbare Energien, Transformation der Energiewirtschaft und Ressourceneffizienz. Das Portfolio umfasst Energiewirtschaft-Events, wissenschaftliche Konferenzen und die Organisation aller Konferenzen der globalen The Smarter-E Reihe. Conexio-PSE fördert Innovation durch Vernetzung und Wissensaustausch, indem man die eigene fachliche Kompetenz aus der Energiebranche und Wissenschaft mit dem langjährigen Veranstaltungs-Know-how und innovativen Konzepten kombiniert: So treffen inhaltliche Tiefe und fachliche Qualität auf ein zielgruppenspezifisches, modernes Veranstaltungsdesign. https://www.conexio-pse.de/

2024 wurde das Kraftwerk Sursee modernisiert: An der Wasserfassung wurde unter anderem die Horizontal-Rechenreinigungsmaschine erneuert.
Das Kleinwasserkraftwerk Sursee an der Suhre im Kanton Luzern steht seit 2001 als Musterbeispiel für die gelungene Verbindung von effizienter Energiegewinnung, ökologischer Nachhaltigkeit und moderner Ingenieurskunst. Nun wurde das Kraftwerk, das von der Genossenschaft Windenergieanlage Diegenstal betrieben wird, modernisiert. Neben der Sanierung der Fischwanderhilfe und der Erneuerung der bestehenden Schlauchwehr wurde auch der bestehende Lochrechen durch einen horizontalen Feinrechen mit modernster Horizontalrechenreinigungsmaschine ersetzt. Das stahlwasserbauliche Equipment wurde dabei vom renommierten Südtiroler Branchenspezialisten Wild Metal geliefert, der international für seine maßgeschneiderten Stahlwasserbau-Lösungen bekannt ist. Seit kurzem ist die Anlage wieder in Vollbetrieb.
In der Zentralschweizer Kleinstadt Sursee, idyllisch gelegen am Ausfluss der Suhre aus dem Sempachersee, blickt man auf eine lange Geschichte der Wasserkraftnutzung zurück. Schon seit Jahrhunderten wurde das Gefälle der Suhre genutzt, um Mühlen und andere traditionelle Gewerke anzutreiben – Spuren dieser frühen Wasserbauten sind bis heute im Stadtbild sichtbar. Die moderne Stromgewinnung begann jedoch erst richtig mit der Inbetriebnahme des Kleinwasserkraftwerks Sursee im Herbst 2001, mit dessen baulicher Umsetzung im November 2000 begonnen wurde. Das durchaus Spezielle an der Ökostromanlage: Es handelt sich um das erste Kleinwasserkraftwerk im Kanton Luzern der Neuzeit, das an einem neuen Standort ohne bestehendes Wasserrecht gebaut wurde. Von seinem Konzept her ist das Kraftwerk Sursee ein Laufkraftwerk, das rund 3.5 km unterhalb des Sempachersees situiert ist und die Suhre mit seinem rund 8 m breiten Schlauchwehr (Fabrikat Hydro-Construct) aufstaut. Im Turbinenhaus ist eine horizontalachsige, doppeltregulierte Kaplan-S-Rohrturbine eingebaut, die über einen Flachriemen einen 55 kW Asynchrongenerator antreibt. Die S-Rohrturbine ist bei einem Bruttogefälle von 3 m auf Ausbauwassermengen zwischen 0,3
und 2,0 m3/s ausgelegt. Mit diesem Equipment produziert das Ökostromkraftwerk seit 2001 zuverlässig sauberen Strom, im Regeljahr rund 200.000 kWh. Genug, um damit etwa 50 bis 60 durchschnittliche Haushalte zu versorgen.
Neues Design für die fischökologische Durchgängigkeit
Während die elektromechanische Ausrüstung sich zuletzt noch immer in Top-Zustand präsentierte, wies die rechtsufrig angelegte Fischaufstiegshilfe erhebliche Mängel auf. Für die Betreiber von der Genossenschaft Windenergieanlage Diegenstal war klar, dass es diese Mängel zu beheben galt. Außerdem bemühte man sich um die Integration einer Fischabstiegshilfe, die bislang nicht vorhanden war. Es lag Handlungsbedarf vor, um die Anlage nicht nur technisch, sondern auch ökologisch fit für die Zukunft zu machen. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde daher ein neuer Mäanderfischpass (MFP) am rechten Ufer gebaut, der die fischökologische Durchgängigkeit verbessert. Um die Platzverhältnisse optimal zu nutzen, besteht der MFP im unteren Bereich aus gestreckten Becken und im oberen Bereich aus runden Becken. Für den Fischschutz und den sicheren Fischabstieg wurde der bisherige Lochrechen durch einen
modernen Feinrechen mit horizontalen Stäben und einem lichten Stababstand von 15 mm ersetzt. Am unteren Ende des Rechens schließt der Bypasskanal an, der über einen Wehrhöcker und eine Stahlklappe reguliert wird und mit einer permanenten Dotation von 190 l/s beschickt wird. Die neue Rechenanlage wurde dabei vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal geliefert.
Neuartiges Schlauchwehrsystem ermöglicht Fischabstieg
Ein spannendes und sehr innovatives Beispiel für die enge Verbindung von Technik und Ökologie stellt die Erneuerung des bestehenden Schlauchwehrs dar. Als fischabstiegstaugliche Schlauchwehranlage wurde sie am Kraftwerk Sursee erstmalig in Zusammenarbeit von Hydro-Construct mit der IUB Engineering AG aus Bern realisiert. Für den verletzungsfreien Fischabstieg bei Überwasser wurde das alte Schlauchwehr durch ein neues Schlauchwehr mit Konturmembran ersetzt. Dank der ausreichenden Spannkraft der Membrane wird ein harmonischer Überfall ins Tosbecken gewährleistet. Mit dieser speziellen Bauweise wird beim Wehrübergang ein hartes Aufprallen der absteigenden Fische auf der Wehrplatte verhindert. Positive Nebeneffekte liegen einerseits in einer Minderung der Lärmentwicklung und andererseits im Erosionsschutz für die betonierte Wehrplatte. Um die biologische Wirkungskontrolle sicherzustellen, wird eine Kombination aus Videomonitoring und PIT-Tag-Kampagne eingesetzt. Am oberen Ende der Fischaufstiegshilfe entsteht dazu ein spezieller Videoraum mit Glasscheibe zur Fischbeobachtung.
Kernstück horizontale Rechenreinigungstechnik
Neben den ökologischen Maßnahmen lag ein Hauptaugenmerk der Modernisierung auf der Installation einer neuen, modernen horizontalen Rechenreinigungsanlage samt zusätzlichem Stahlwasserbauequipment – geliefert und installiert von der Südtiroler Wild Metal GmbH, einem international gefragten Spezialisten für maßgeschneiderte Stahlwasserbaulösungen. Am Einlaufbereich eines Wasserkraftwerks entscheidet sich oft, wie effizient die gesamte Anlage arbeitet. Der Rechen, der Schwemmgut zurückhält und gleichzeitig auf die Fischwanderung Rücksicht nimmt, ist der einzige Zugang, durch den alles

Mäanderfischpass mit runden Becken im oberen Bereich

Die neue Rechenreinigungsmaschine von Wild Metal ist mit Holzbagger und Schwemmgutgreifer ausgestattet.
Triebwasser strömt. Hier spielen die horizontalen Rechenreinigungssysteme, wie jenes aus dem Hause Wild Metal, ihre Stärken aus: Sie bieten eine gleichmäßigere Anströmung, reduzieren die Sogwirkung und verhindern, dass Fische in gefährliche Bereiche gelangen. Für Sursee lieferte Wild Metal einen Horizontalrechen mit einer Breite von 7,8 m und einer Höhe von 1,2 m, der durch das strömungsoptimierte Fischschonprofil und die feine lichte Spaltweite von 15 mm besticht.
Reinigung – vollautomatisch und auf höchstem Niveau
Die zentrale Rolle spielt dabei die horizontale Rechenreinigungsmaschine (RRM) – ein hydraulisch betriebenes HightechSystem, das mit einem Holzbagger und einem Schwemmgutgreifer samt Steuersitz ausgestattet ist. Auf einem Laufwagen montiert, kann der Greifer an jeder Position des Verfahrweges eingesetzt werden und entfernt effizient alles - vom feinen Laub bis hin zu schweren Baumstämmen. Unterstützt wird das System von einem leistungsfähigen Hydraulikaggregat, einer hydraulischen Fischabstiegs- und Spülklappe (400 x 850 mm) sowie einem elektromechanischen Grundablassschieber (1000 x 800 mm), die gezielt das Rechengut ins Unterwasser leiten. Ein manuell über ein Handrad zu bedienender Fischeinlaufschieber ergänzt das umfassende Paket.
Gewässer: Suhre
Brutto-Fallhöhe: 3,0 m
• Ausbauwassermenge: 2,0 m³/s
Turbine: Kaplan-S-Rohrturbine
Turbinenleistung: 55 kW
• Generator: Asynchron
Schlauchwehr: Breite: 8,5 m
Fabrikat: Hydro-Construct
• Stahlwasserbau & RRM: Wild Metal
Horizontalrechen: Breite 7800 mm x Höhe 1200 mm
Lichte Stabweite: 15 mm
• Fischabstiegs- und Spülklappe: Breite 400 x Höhe 850 mm
• Grundablassschieber: Breite 1000 x Höhe 800 mm
Fischeinlaufschieber Breite 1100 x Höhe 1000 mm
Jahresarbeit: 200.000 kWh
• Inbetriebnahme: 2001 Umbau: 2024

Horizontale Rechenreinigungsmaschinen erfüllen die heute geforderte Fischfreundlichkeit und verringern darüber hinaus Effizienzverluste.
Gesteuert wird die gesamte Anlage vollautomatisch. Wasserstandssensoren überwachen kontinuierlich den Druckunterschied vor und nach dem Rechen, und dank der Fernanbindung kann der Betrieb effizient auch aus der Ferne überwacht und gesteuert werden – ein großer Vorteil gerade für kleinere Betreiberteams.
Horizontale Rechenreinigung: Vorteile, die überzeugen Warum setzen immer mehr Kraftwerksbetreiber auf horizontale Rechenreinigungssysteme? Die Vorteile sind vielfältig. Zum einen erfüllen sie die geforderte Fischfreundlichkeit und verbinden diese mit einer hohen hydraulischen Effizienz. Horizontalrechen reduzieren nicht nur die Strömungsgeschwindigkeit am Rechen selbst, sondern verringern auch den Energieverlust der Anlage. Durch die gleichmäßigere Anströmung werden Turbinen besser ausgelastet, und die Gefahr eines Laub- oder Eisstaus wird erheblich gesenkt. Ein weiteres Plus, die gerade Anlagen von Wild Metal mitbringen: Sie zeichnen sich durch extreme Robustheit und Langlebigkeit aus. Selbst unter widrigsten Bedingungen – etwa bei Hochwasser, Eisbildung oder starkem
Geschwemmsel – bleiben sie zuverlässig in Betrieb. Nicht zuletzt sorgt die durchdachte Wartungs- und Ersatzteilstrategie dafür, dass die Betriebskosten langfristig niedrig bleiben. Dank der hochwertigen Ausführung und der robusten Bauweise lassen sich sowohl Ausfallzeiten als auch Wartungsaufwand minimieren.
Maßgeschneiderte Lösungen für nachhaltige Wasserkraft Mit der Modernisierung des Kraftwerks Sursee unterstreicht Wild Metal einmal mehr seine führende Rolle im internationalen Stahlwasserbau. Geschäftsführer Markus Wild betont: „Wir verstehen die individuellen Herausforderungen unserer Kunden und liefern Lösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Maschinen sind nicht nur technisch ausgefeilt, sondern auch ein Versprechen an Qualität, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit.“
Das Kraftwerk Sursee ist damit bestens gerüstet, um auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig saubere Energie zu liefern – und das auf eine Weise, die Technik und Natur harmonisch miteinander verbindet.
Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schützen & Stauklappen
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
• Komplette Wasserfassungssysteme
• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY
Wild Metal GmbH www.wild-metal.com Handwerkerzone Mareit 6 info@wild-metal.com 39040 Ratschings +39 0472 595 100
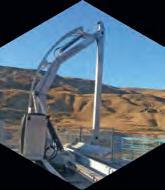







Der Name SUHNER steht für bewährte Schleifgeräte und Schleifmittel für die Oberflächenbearbeitung von Metallbauteilen in der Wasserkraft.
Die Wasserkraftindustrie stellt höchste Anforderungen an Präzision, Langlebigkeit und Effizienz. SUHNER positioniert sich als starker Partner für alle Schleifprozesse – von der Fertigung über die Instandhaltung bis zur Wartung von Wasserturbinen. Mit einem breiten Produktportfolio, praxisorientierten Schulungen und dem SUHNER@Work-Service bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um die Leistungsfähigkeit von Wasserkraftanlagen langfristig zu sichern.
Wasserkraftturbinen – egal ob Kaplan, Francis oder Pelton – sind im Betrieb hohen Belastungen ausgesetzt: Wasserdruck, Strömungswirbel und abrasive Sedimente im Triebwasser setzen den betroffenen Oberflächen zu und führen mit der Zeit zu Verschleiß. Um die Leistungsfähigkeit der Anlagen dauerhaft zu gewährleisten, ist daher regelmäßige Wartung unverzichtbar. Nur so lassen sich Leistungsverluste vermeiden und kostspielige Ausfälle verhindern. Die regelmäßige Pflege der Turbinenkomponenten ist somit nicht nur eine Frage der Betriebsfähigkeit, sondern auch der langfristigen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der gesamten Anlage. Ein Schlüsselfaktor dabei ist die Oberflächenbearbeitung durch Schleifen. Ein Unternehmen, das sich seit Jahren als zuverlässiger Partner für alle Schleifprozesse – vom Schleifen und Entgraten bis hin zum Polieren – am Markt positioniert hat, ist das Schweizer Technologieunternehmen SUHNER mit Hauptsitz im Aargauer Lupfig.
Fokus richtet sich auf Reparatur und Refurbishment
Das breite Sortiment von SUHNER umfasst Produkte und Dienstleistungen, die u.a. für die Herstellung und Wartung von Wasserkraftturbinen entwickelt wurden. Mit präzisen Schleifgeräten und Schleifmitteln lassen sich metallische Oberflächen auf höchstem Qualitätsniveau bearbeiten. Ganz gleich, ob es sich um Fertigungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten han-
delt: SUHNER liefert maßgeschneiderte Lösungen, die Prozesse optimieren und gleichzeitig Stillstandzeiten der Maschinen minimieren. Somit kommt die Technik aus dem Hause SUHNER in jeder Phase des Lebenszyklus einer Wasserkraftturbine zum Einsatz: von der Instandhaltung und regelmäßigen Wartung bis hin zu Reparatur. Besonders fokussiert sich SUHNER auf den Bereich der Reparaturen und des Refurbishings aller Varianten von Wasserturbinen, insbesondere Pelton-, Francis- und Kaplan-Turbinen, wobei prinzipiell Kleinstkraftwerke weniger stark im Fokus stehen.
Die Vorteile auf einen Blick:
• Hochpräzise Bearbeitung: SUHNER-Werkzeuge und Schleifmittel ermöglichen exakte Ergebnisse – unerlässlich angesichts der feinen Toleranzen der Wasserkrafttechnik.
• Lange Lebensdauer: Die hohe Qualität der Schleifmittel sorgt auch bei intensiver Nutzung für eine überdurchschnittliche Haltbarkeit.
• Effiziente Wartung: Produkte von SUHNER unterstützen Wartungsarbeiten und gewährleisten, dass alle Komponenten optimal arbeiten.
• Anpassbare Systeme: Die Schleifgeräte lassen sich flexibel an verschiedene Anforderungen anpassen – ideal sowohl für die Fertigung als auch für die Instandhaltung.

Hochkarätiger Know-how-Transfer inklusive
Um seine Position am Markt zu stärken, organisiert SUHNER regelmäßig Seminare und Veranstaltungen, bei denen externe Referenten praktische Anwendungen und mögliche Lösungen vorstellen. Es handelt sich um praxisorientierte Schulungen und Seminare, mit denen Kunden ihr Wissen erweitern und optimieren können. Egal, ob es sich um das Thema Rissprüfungen, oder Schweißen, oder die Wahl des richtigen Schleifmittels, oder etwa auch die Gefahren durch Schleifstaub und Schweißgase handelt: Im Prinzip werden Lösungen aufgezeigt, die dem Wasserkraftbetreiber zu mehr Wissen und Eigenkompetenz verhelfen und zugleich das Vertrauen in SUHNER als verlässlicher Partner in der Wasserkraft stärken. Somit wird nicht nur das eigene Leistungsportfolio, sondern auch jede Menge praktisches Know-how vermittelt. Das nächste Seminar findet am 10. Juli 2025 im hauseigenen Application-Center in Lupfig statt. Als besonderes Highlight gilt der SUHNER@Work-Service: Hier können Schleifgeräte direkt vor Ort getestet werden, um sich von ihrer Qualität und Praxistauglichkeit zu überzeugen.
Warum das Schleifen entscheidend ist
Das Schleifen von Turbinenkomponenten ist eine Schlüsselkompetenz, um Effizienz und Betriebsfähigkeit einer Wasserkraftanlage zu sichern. Durch das ständige Einwirken von Wasser und Schwebstoffen entstehen Materialschäden vor allem Abrasion. Professionelles Schleifen glättet diese Oberflächen

Service: Schleifgeräte vor Ort testen. Das Produktangebot umfasst ein breites Spektrum an Schleifwerkzeugen, Schleifmaschinen und abrasiven Materialien.
wieder und stellt so den optimalen Zustand für die beste Performance der Maschine her.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Verbesserte Oberflächenqualität reduziert Reibung und minimiert Turbulenzen
• Effizienzsteigerung durch optimierten Wasserfluss erhöht die Leistung und den Energieertrag
• Verlängerte Lebensdauer der Komponenten dank rechtzeitiger Bearbeitung
• Minimierte Stillstandzeiten durch die Vermeidung größerer Schäden
SUHNER als Partner für die Wasserkraft
SUHNER-Schleiflösungen decken den gesamten Lebenszyklus einer Wasserkraftturbine ab. In allen Kraftwerken, in denen Pelton- oder Kaplan-Turbinen installiert sind, sind exakte und gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen essenziell, um langfristig einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Das Produktangebot umfasst ein breites Spektrum an Schleifwerkzeugen, Schleifmaschinen und abrasiven Materialien – darunter Hochleistungsschleifmaschinen, Schleifbänder, Schleifstifte, Schleifpasten, sowie Logistiklösungen für Verbrauchsmaterial. Eine sorgfältige Wartung, zu der auch das Schleifen gehört, schützt nicht nur die technischen Anlagen eines Wasserkraftwerks, sondern steigert auch die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Betriebs.
Mehr unter: www.suhner.com

Die Energiewende erfordert innovative, nachhaltige Lösungen – insbesondere in der Nutzung regenerativer Quellen wie Wasserkraft. Hagenbuch Hydraulic Systems AG ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für die Entwicklung, Fertigung und Modernisierung von Anlagenkomponenten in Wasserkraftwerken. Unsere Kernkompetenz liegt in der ölhydraulischen Systemtechnik und – je nach Anwendung – in der Steuerung der Systeme.
Als Komplettanbieter von Hydrauliksystemen bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand: von der ersten Analyse über Planung und Engineering bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme – alles unter einem Dach in unserer modernen Produktion.
Umfassende Leistungen für höchste Anforderungen Unsere Stärke liegt in der Kombination aus Erfahrung, technologischem Knowhow und InhouseProduktion.
Das Leistungsportfolio im Überblick:
• Beratung und Engineering: Projektbegleitung ab der ersten Idee mit Machbarkeitsstudien, Berechnungen und Auslegung der Antriebe unter Berücksichtigung der betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
• Fertigung und Montage: Bau und Lieferung kompletter Antriebssysteme bestehend aus Aggregaten, Zylindern, Motoren, Steuerungen und Verrohrungen.
• Inbetriebnahme und Support: Testläufe und Betreuung – vor Ort oder bei uns im Haus.
• Service und Retrofit: Revision und Modernisierung bestehender Anlagenkomponenten zur Verlängerung der Lebensdauer und Verbesserung der Energieeffizienz.
Steuerungssysteme – präzise und flexibel Steuerungen sind das Herzstück jeder Wasserkraftanlage. Hagenbuch entwickelt, berechnet und fertigt diese – mechanisch oder teilelektrisch – inklusive kundenspezifischer Schnittstellen. Bereits in der Planungsphase erfolgen die Erstellung von Schemata und die Auslegung für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.
Typische Anwendungen im Bereich Wasserkraft sind Aggregate und Zylinder für Turbinenregler, Schützen, Drosselklappen, Kugelschieber, Entsanderanlagen usw.. Alle Antriebe werden individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Anlage angepasst. Dabei haben hohe Zuverlässigkeit und einfacher Unterhalt stets Priorität.
Aggregate – individuell und leistungsstark
Unsere Hydraulikaggregate werden projektspezifisch geplant, konstruiert und gefertigt. Sie kommen z. B. bei der Steuerung von Turbinen, Drosselklappen, Wehranlagen oder zur Schmierung von Gleitlagern zum Einsatz.
Leistungsumfang:
• Detaillierte VorOrtErfassung
• Konzeption und Angebot mit Schnittstellenklärung
• Konstruktion mit Festigkeitsanalyse der kritischen Bauteile
• Baugruppenfertigung mit modernster Technik
• VorOrtMontage und Inbetriebnahme

Das Ergebnis: wirtschaftliche Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen Ihrer Anlage abgestimmt sind.
Zylinder – maßgeschneiderte Kraftübertragung
Unsere Zylinder sind zentrale Komponenten für Bewegungsund Steuerungsprozesse in Wasserkraftwerken. Sie werden individuell gefertigt und je nach Bedarf als Einzelkomponenten oder vormontierte Baugruppen inklusive Elektrik geliefert.
Typische Einsatzgebiete:
• Düsennadel, Strahlablenker, Leitradantriebe
• Wehrklappen, Tafelschützen und Segmente
• Kugelschieber
• Drosselklappen
Auch bei kniffligen Aufgaben, insbesondere bei RetrofitProjekten, finden wir wirtschaftlich und technisch sinnvolle Lösungen.
Umfassendes Portfolio
Das Portfolio von Hagenbuch umfasst zudem die Sektoren Verrohrungen, Umbauten und Retrofitprojekte sowie die Bereiche Service und Revision. Mit Hagenbuch sichern Sie den langfristig zuverlässigen Betrieb Ihrer Wasserkraftanlagen – effizient, professionell und partnerschaftlich.


Michael Amerer, GF VERBUND WK Bayern; Theresa von Hassel, GZ; Ministerialdirigentin Monika Rauh, Bayer. Wirtschaftsministerium; Constanze von Hassel, GZ; LR Erwin Schneider; Erster Bgm. Töging, Dr. Tobias Windhorst und Dr. Karl Heinz Gruber, GF VERBUND WK Bayern. (v.l.)
Fundierte Einblicke, technische Innovationen und politische Diskussionen zur Zukunft der Wasserkraft im Freistaat Bayern bot das 11. Bayerische WasserkraftForum in Töging am Inn. Die Bayerische GemeindeZeitung als Veranstalterin begrüßte dazu über 100 Fachleute aus Politik, Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft zum Austausch und zur Vernetzung. Viele Teilnehmer nutzten im Anschluss die Gelegenheit, das 2022 modernisierte Wasserkraftwerk Jettenbach-Töging zu besichtigen.
GZ-Verlegerin Constanze von Hassel betonte in ihrer Begrüßung, dass Wasserkraft-Energie – CO2-frei, grundlastfähig und regional verfügbar – im aktuellen Diskurs zu wenig Beachtung finde, obwohl sie politischen Rückhalt brauche. Die Nutzung sei stets eine Abwägung zwischen Energiegewinnung, Ökologie und Naturschutz. Pauschale Einschränkungen würden aber die Potenziale der Wasserkraft verkennen.
Landrat Erwin Schneider schlug in die selbe Kerbe, als er in seiner Rede die zentrale Rolle der Wasserkraft für den Wohlstand des Landkreises Altötting unterstrich. Alzkanal und Innkanal seien tragende Säulen der regionalen Entwicklung und Töging sei das Zentrum der deutschen Wasserkraft. Tögings Bürgermeister Dr. Tobias Windhorst verwies auf wirtschaftliche Vorteile durch das Kraftwerk Jettenbach-Töging – etwa über Gewerbesteuern und Ausschüttungen.
Kompetenzzentrum im historischen Krafthaus
Karl Heinz Gruber, Geschäftsführer der Verbund Wasserkraft Bayern, stellte das neue Projekt im denkmalgeschützten Krafthaus Töging vor: Für 52 Mio. Euro entsteht dort in drei Jahren ein

modernes Mehrzweckgebäude mit rund 150 Arbeitsplätzen für Verwaltung und Betrieb. Damit erhält das Gebäude ein „zweites Leben“ als Kompetenzzentrum. Gruber bezeichnete Wasserkraft als Grundpfeiler der erneuerbaren Energieversorgung in Bayern. Sie müsse weiterentwickelt und politisch gestärkt werden. Die Stromerzeugung der Inn- und Grenzkraftwerke leiste bereits heute einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit.
Monika Rauh vom Bayerischen Wirtschaftsministerium betonte die Bedeutung der Wasserkraft für die Energiewende. Mit 11 bis 14 TWh jährlich stamme rund 60 Prozent des deutschen Wasserkraftstroms aus Bayern. Der Koalitionsvertrag sehe u.a. ein neues Laufwasserkraftwerk an der Salzach sowie die Sanierung des Pumpspeicherkraftwerks Happurg bis 2028 vor. Auch zum Projekt Riedl laufe aktuell das Anhörungsverfahren. Mit einer Leistung von 300 MW werde mit dem Speicher Riedl die Pumpspeicherkapazität in Bayern um über 50 Prozent steigen, die Speicherkapazität um mehr als 70 Prozent.
Zehn Partner und Aussteller präsentierten ihre innovative Lösungen. Begleitet wurde das Forum medial durch TV Bayern live.

Teilnehmer konnten das Kraftwerk Jettenbach-Töging besichtigen. Mehr als 100 Teilnehmer besuchten das 11. Bayerische WasserkraftForum.

Moderne Hydrauliksysteme tragen maßgeblich zur Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Wasserkraftnutzung bei.
In der öffentlichen Wahrnehmung stehen bei Wasserkraftwerken meist die mächtigen Turbinen, Generatoren und das stahlwasserbauliche Equipment im Mittelpunkt. Doch hinter der sichtbaren Technik verbirgt sich ein unscheinbares, aber unverzichtbares Rückgrat dieser Anlagen: die Hydrauliksysteme. Ohne diese Hilfseinrichtungen wäre der sichere, zuverlässige und effiziente Betrieb moderner Wasserkraftwerke kaum denkbar.
Die Hydraulik in Wasserkraftwerken hat sich über die Jahrzehnte hinweg stark gewandelt. Ursprünglich auf einfache, robuste Mechanik und klassische Anwendungen wie die Bewegung von Wehrklappen beschränkt, sind moderne Systeme heute hochkomplexe technische Lösungen. Sie nutzen unterschiedliche Hydraulikflüssigkeiten zur präzisen Übertragung mechanischer Energie. Dabei ermöglichen sie nicht nur die Steuerung großer Kräfte auf engstem Raum, sondern garantieren auch millimetergenaue Bewegungsabläufe – selbst unter extremen Umweltbedingungen. Hohe Drücke, starke Temperaturschwankungen oder feuchte Umgebungen beeinträchtigen ihre Funktionsweise kaum, denn moderne Komponenten sind auf Langzeitbetrieb unter anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt.
Entwicklungssprünge in den letzten Jahren
Die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat diese Systeme grundlegend verändert. Während in früheren Zeiten hauptsächlich Stahlkomponenten und einfache Dichtsysteme zum Einsatz kamen, werden heute hochfeste Leichtmetalle, Verbundmaterialien und spezialisierte Dichtungen verwendet. Diese modernen Werkstoffe zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einflüssen und ihre Langlebigkeit aus, wodurch Wartungsintervalle verlängert und die Betriebssicherheit erhöht werden. Einen ebenso
großen Entwicklungssprung erlebte die Steuerungstechnik von Hydrauliksystemen. Wo früher mechanische oder pneumatische Systeme dominierten, findet man heute überwiegend elektrohydraulische Regelungen, die sich nahtlos in umfassende Automatisierungs- und Fernüberwachungssysteme einfügen. Diese Integration erlaubt nicht nur eine präzisere Steuerung, sondern auch die zentrale Überwachung ganzer Kraftwerksbereiche – ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsgewinn.
Auch im Bereich der Energieeffizienz hat sich viel getan. Moderne Systeme arbeiten mit variablen Pumpen, intelligenten Steuerstrategien und energiesparenden Antrieben. Der Energieverbrauch konnte auf diese Weise deutlich gesenkt werden, was nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch von Bedeutung ist. Zugleich ist die Wartungsfreundlichkeit gestiegen: Sensoren überwachen in Echtzeit den Zustand der Anlagen, ermöglichen vorausschauende Wartungsstrategien und vermeiden so ungeplante Stillstände.
Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen gefordert
Ein qualitativ hochwertiges Hydrauliksystem zeichnet sich durch eine ganze Reihe an Eigenschaften aus. Es muss im Dauerbetrieb zuverlässig funktionieren und darf selbst unter Extrembedingungen keine Schwächen zeigen. Besonders in sicherheitsrelevanten Bereichen, etwa bei der Steuerung von

Schnellschlussklappen oder Notabsperrorganen, sind fehlerfreie Abläufe unabdingbar. Ebenso bedeutend ist die Präzision – etwa bei der Regelung von Leitschaufeln oder Turbinen, wo kleinste Abweichungen direkte Auswirkungen auf den Wirkungsgrad haben können. Wartungsfreundlichkeit bedeutet nicht nur, dass Komponenten gut zugänglich sind, sondern auch, dass der Austausch verschleißanfälliger Teile ohne großen Aufwand möglich ist. Energieeffizienz und die Einhaltung von Sicherheitsstandards auf nationaler wie internationaler Ebene runden das Anforderungsprofil ab. Nicht zuletzt spielt auch die Langlebigkeit eine entscheidende Rolle, denn viele Wasserkraftwerke sind über
Jahrzehnte hinweg in Betrieb – da müssen auch die unterstützenden Systeme mithalten.
Wenn moderne Technik die alte unterstützt
Ein zunehmend wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Sanierung bestehender Hydraulikanlagen. Viele Wasserkraftwerke stammen aus Zeiten, in denen Automatisierung, Digitalisierung und energieeffiziente Technik noch keine zentrale Rolle spielten. Im Zuge der Modernisierung gilt es, alte und neue Technologien sinnvoll zu kombinieren. Das bedeutet oft mehr als nur den Austausch veralteter Komponenten – vielmehr geht es um die vollständige

Ihr Partner für Kühler und Systeme


HYBRID COOLING


Optional: Marine, Edelstahl, Titan, ASME
HYBRID FAILSAFE COOLING





Leckagesicher, Industrie 4.0

schnelle, kontrollierte Aufheizung

Oil-Air COOLING





Optional: ATEX, Edelstahl, Bypass
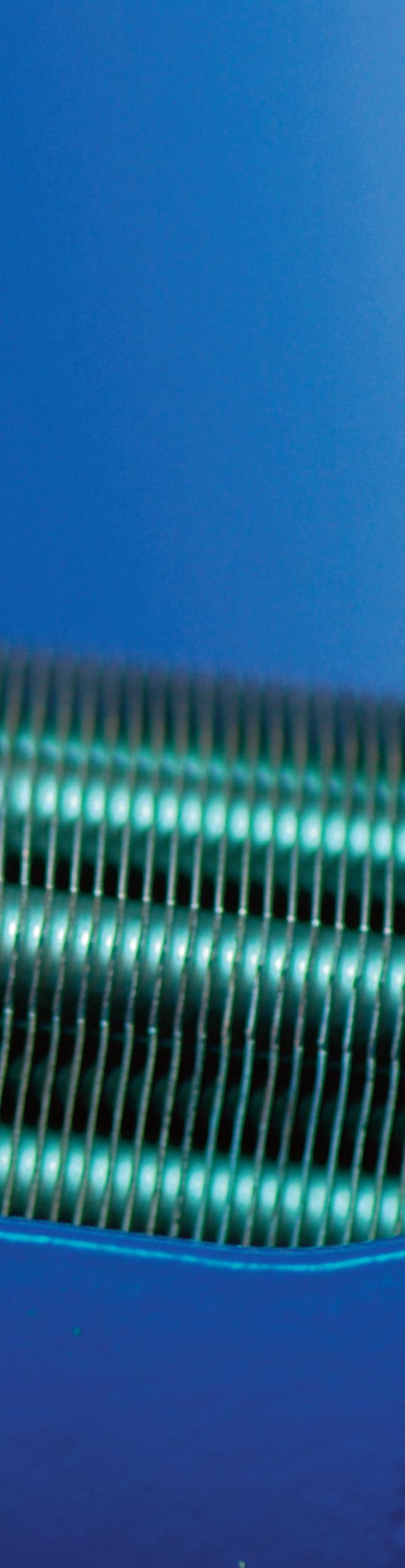






Universal Hydraulik GmbH
Siemensstraße 33 61267 Neu-Anspach Fon 06081/9418-0 Fax 06081/941849
eMail info@universalhydraulik.com www.universalhydraulik.com

Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen gehört zu den Qualitätskriterien zeitgemäßer Hydrauliksysteme.
Integration moderner Steuerungstechnik, um die Nutzung effizienterer Pumpen und optimierter Dichtungslösungen sowie um die Realisierung eines höheren Automatisierungsgrads. Damit solche Modernisierungen erfolgreich verlaufen, ist eine gründliche Analyse der bestehenden Systeme unabdingbar. Schwachstellen müssen identifiziert und betroffene Komponenten entsprechend angepasst werden. So können Retrofit-Lösungen nicht nur die Lebensdauer verlängern, sondern auch die Betriebssicherheit und Effizienz deutlich steigern.
Einsatzbereiche in der Wasserkraft mannigfaltig
Die Einsatzbereiche hydraulischer Systeme in Wasserkraftwerken sind vielfältig und durchdringen nahezu alle technischen Kernbereiche. Eine besonders wichtige Rolle spielt die Hydraulik bei der Steuerung von Leit- respektive Turbinenschaufeln – etwa bei Francis- oder Kaplan-Turbinen – sowie bei der präzisen Verstellung der Leitschaufeln, mit denen die Strömung des Wassers gezielt auf die Turbine gelenkt wird. Auch bei der Regulierung von Wasserständen durch Wehrklappen und Schleusen ist die Hydrauliktechnik unersetzlich. Weitere zentrale Anwendungsbereiche sind die Notabsperrorgane, bei denen es im Störfall auf Sekundenbruchteile ankommt, sowie die Ölversorgung und Kühlung der Hydraulikaggregate. Selbst in Bremssystemen von Generatoren –beispielsweise bei Wartungsarbeiten – sorgt die Hydraulik für sicheres und kontrolliertes Stillsetzen der beweglichen Komponenten.
Hydrauliklösungen als unverzichtbarer Bestandteil Insgesamt zeigt sich: Die Hydraulik ist das oft unterschätzte, aber unverzichtbare Rückgrat der Wasserkrafttechnik. Ihre Entwicklung spiegelt nicht nur den technischen Fortschritt wider, sondern trägt maßgeblich zur Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit dieser Energieform bei. Gerade im Kontext der Energiewende, in der Wasserkraft als stabiler, grundlastfähiger Pfeiler gefragt ist, gewinnen zuverlässige, langlebige und energieeffiziente Hydrauliklösungen weiter an Bedeutung. Es ist diese stille Kraft im Hintergrund, die dafür sorgt, dass Wasserkraftwerke ihre volle Leistung entfalten können – Tag für Tag, Jahr für Jahr.
BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL
ECOSYNT HEPR
l Biologische Abbaubarkeit
l Hydrolytische Stabilität
l Hohe Materialverträglichkeit
l Gutes Luftabscheidevermögen
l Verlängerte Serviceintervalle




Dorninger Hytronics hat sich als zuverlässiger Partner der Wasserkraftbranche etabliert.
Die Dorninger Hytronics GmbH hat sich seit mehr als 15 Jahren mit innovativen Hydraulikaggregaten und Hydraulikzylindern für Kraftwerks- und Anlagenbetreiber auf der ganzen Welt als verlässlicher Partner bei Neu- und Umbauten sowie für Modernisierungen etabliert. Daneben fertigt das Unternehmen hydraulische, elektrische und mechatronische Lösungen für viele andere Branchen, wie beispielsweise die Bau-, Holz- und Papierindustrie. Aber auch in der Metallurgie und Prüftechnik ist die Dorninger Hytronics GmbH mit ihren Hydrauliklösungen vertreten.
Das jährliche Produktionsvolumen von rund 100 maßgefertigten Hydraulikaggregaten für die Wasserkraftbranche wird direkt am Firmensitz im oberösterreichischen Unterweitersdorf mit etwa 200 bestens qualifizierten und engagierten Mitarbeitern gefertigt“, erzählt Christian Dorninger, kaufmännischer Geschäftsführer und Miteigentümer des Unternehmens. „Vier von acht Vertriebsgruppen arbeiten bei uns immer wieder an größeren und kleineren Wasserkraftprojekten rund um den Globus. Die Aggregate reichen dabei von kleiner 100 Litern bis zu 10.000 Litern Tankvolumen und bringen eine anforderungsabhängige Antriebsleistung von 1,5 kW bis 90 kW.“
Hydraulik als Herzstück in Kraftwerken
Die technisch durchdachten und energieeffizienten Hydraulikaggregate übernehmen in der Turbinensteuerung,
also der LeitapparatVerstellung, Laufradverstellung oder beim Schnellschluss der Turbine, zentrale Aufgaben und müssen daher
absolut zuverlässig und dauerhaft verfügbar sowie oft auch redundant ausgelegt sein, um den betrieblichen Anforderungen vor Ort jederzeit zu 100


Blick in die Fertigungshalle des international renommierten Branchenspezialisten im oberösterreichischen Unterweitersdorf
Prozent zu entsprechen. Auch im Stahlwasserbau müssen Hydraulikaggregate, Schütze, Wehr und Schleusenanlagen störungsfrei, stabil und sicher steuern. Daneben übernehmen Schmieraggregate, die auf höchste Betriebssicherheit und Langlebigkeit ausgelegt sind, essenzielle Funktionen für einen reibungslosen und verschleißarmen Betrieb der Wasserkraftanlagen.
Die Dorninger Hytronics GmbH bringt ihre umfangreiche Erfahrung und wertvolle Expertise aus zahlreichen Projekten in die Planung, Auslegung und Realisierung ein, um langlebige Lösungen für die spezifischen Anforderungen jeder Anlage zu entwickeln. Neben den Schnittstellen zu SPSSteuerungen oder Leitsystemen wird auch die Service und Wartungsfreundlichkeit bereits frühzeitig in der Planung berücksichtig, damit auch bei beengten Platzverhältnissen vieler Bestandskraftwerke eine bestmögliche Zugänglichkeit und Instandhaltung gewährleistet wird.
Projektabwicklung im engen Schulterschluss In einem partnerschaftlichen Diskurs mit dem Auftraggeber bzw. dem Endkunden und den Projektverantwortlichen

Die Schulungsaggregate bieten umfangreiche Testmöglichkeiten.
bei Dorninger Hytronics wird letztlich die technisch beste Lösung für das Projekt gemeinsam entwickelt. Diese intensive Abstimmung beginnt in der Regel bereits vor der Auftragserteilung und reicht über die Projektplanung bis in die letzte Projektphase. Zu jedem Zeitpunkt wird daran gearbeitet, für das aktuelle Kraftwerksprojekt die sowohl funktional, als auch wirtschaftlich bestmögliche Lösung zu finden. „Dorninger Hytronics bringt sich dabei nicht nur als Lieferant, sondern als technischer Entwicklungspartner mit tiefem Verständnis für die hydraulischen Anforderungen im Kraftwerksbau ein“, weist Christian Dorninger auf einen der Erfolgsfaktoren seines Unternehmens hin. Der Schlüssel zum Erfolg liegt damit in der engen Zusammenarbeit und Abstimmung mit allen Projektbeteiligten – unabhängig vom Unternehmensstandort.
Expertise über das Produkt hinaus: Schulungen und Wissenstransfer Einen besonderen Mehrwert bietet das Unternehmen Kraftwerksbetreibern mit praxisnahen Schulungen und Hydraulikseminaren direkt am jeweiligen Standort. Diese Trainings qualifizieren das Personal für Service und Wartungsarbeiten und fördern auch ein grundlegendes Verständnis der hydraulischen Vorgänge und Funktionsweise der eigenen Anlage. Das Personal kann die spezifischen Funktionen und Wartungsanforderungen der eigenen Anlage besser verstehen wodurch in weitere Folge Ausfallzeiten minimiert werden können. Gerade im Umgang mit sicherheitsrelevanten Systemen wie Turbinen und Schmieraggregaten ist dieses Knowhow entscheidend bei der Anlagenverfügbarkeit. Beim Grundlagenseminar wird HydraulikBasiswissen vermittelt, kombiniert mit praktischen Übungen am selbst entwickelten, mobilen Schulungsaggregat. Zur Abrundung und Festigung des Gelernten kann ein Praxistag, also eine praktische Schulung direkt an den Anlagen des Kraftwerksbetreibers, angeschlossen werden. Unterrichtet wird von Praktikern, die sich selbst täglich mit Hydraulik beschäftigen bzw. weltweit Hydraulikanlagen in Betrieb nehmen, und ihr Expertenwissen an die Teilnehmer weitergeben.

Individuell gefertigte Hydraulikzylinder stehen bereit zur Auslieferung: Dorninger Hytronics bietet Servomotoren für die Turbinenverstellung bis 1.000 mm Zylinderdurchmesser.
Maßgeschneiderte Lösungen für nachhaltige Energie
Rund 15 Prozent ihres Umsatzes erzielt die Dorninger Hytronics GmbH im Bereich Kraftwerksbau – ein deutliches Zeichen für das Vertrauen, das Kunden weltweit in die hydraulische Kompetenz des Unternehmens setzen. Ob als Partner im Neubau oder bei der Modernisierung bestehender Kraftwerke: Dorninger Hytronics bietet individuelle, robuste und wartungsfreundliche Hydrauliklösungen, die einen wichtigen Beitrag zur effizienten
und sicheren Stromerzeugung leisten. Einer der vielen Kunden des Unternehmens ist der technische Leiter der Achen Kraftwerke AG, Ing. Thomas Mayr. Dieser zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit bei den Aus und Umbauten an der Gasteiner und der Rauriser Ache, am Dientenbach sowie im Felbertal: „Die Dorninger Hytronics GmbH ist für uns weit mehr als nur ein Lieferant – sie ist ein engagierter Partner, der mitdenkt, mitgestaltet und Mitverantwortung übernimmt.“


Das modulare Hydraulikblock System von WWS ermöglicht unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Hydrauliksysteme spielen in Wasserkraftwerken eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Steuerung großer Schütze, Segmentwehre und Rechenreiniger. Sie gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und ermöglichen präzise Bewegungssteuerungen bei anspruchsvollen Bedingungen. Die oberösterreichische WWS Wasserkraft GmbH hat sich in den letzten Jahren auf die Entwicklung und den Bau maßgeschneiderter Hydraulikanlagen spezialisiert. Durch umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie zahlreiche Eigeninnovationen im Bereich der Hydraulikblocktechnik konnte das Unternehmen seine Lösungen international erfolgreich positionieren.
Für das aktuelle WWS-Projekt Achigauate in Guatemala, das sich am Fuße des Vulkans Fuego in der Nähe der Hauptstadt Guatemala City befindet, wurde eine Wehranlage in einer abgelegenen Schlucht errichtet. Das Bauwerk ist mit drei Segmentwehren ausgestattet, die am Fuß der Staumauer platziert sind, um den Sedimenttransport zu regulieren. Aufgrund der starken Sedimentation und der Stauhöhe – die mehr als sieben Meter betragen kann – sind erhebliche Kräfte erforderlich, um die Schütze zu öffnen. Hierfür wurden spezielle Zylinder mit einem Kolben-Durchmesser von 360 mm und einem Hub von über 3,3 Metern eingesetzt.
Herausfordernde Rahmenbedingungen
Die Lage der Staumauer gestaltet den Einbau der Hydraulikaggregate äußerst herausfordernd: Der Zugang ist durch die schwierige Topografie stark einge-
schränkt. Zudem konnten die Aggregate aufgrund begrenzter Platzverhältnisse nicht direkt neben der Staumauer installiert werden. „Daher wurden über 600 Meter Edelstahlrohrleitungen entlang der Felswand verlegt, um die Hydraulikzylinder mit dem Aggregat zu verbin-
den. Diese Leitungen mussten unter extremen Bedingungen installiert werden, was besondere technische Anforderungen an Materialqualität und Montage stellte“, erklärt WWS-Vertriebstechniker Markus Peherstorfer. Das zentrale Hydraulikaggregat verfügt über drei Pum-

Hydraulikaggregate inkl. Steuerungsschrank von WWS im Wartungshäuschen

Steuerschrank-Zusammenbau für die Modernisierung einer Turbinensteuerung/Hydraulik.

für das Entsanderbecken des Kraftwerks in Guatemala
pen mit jeweils 30 kW Leistung sowie einen Tank mit einem Volumen von über 1.000 Litern. Es stellt somit ausreichend Energie bereit, um die Schütze zuverlässig zu öffnen und zu schließen – auch unter hoher Wasser- und Sedimentbelastung. Zusätzlich wurden zwei kleinere Hydraulikaggregate installiert, die speziell für die Rechenreinigungsanlagen vorgesehen sind. Diese sind mit Ölkühlern ausgestattet, um einen kontinuierlichen Betrieb auch bei hohem Schwemmgutaufkommen sicherzustellen. „Dieses Projekt demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit moderner Hydrauliklösungen unter anspruchsvollen Bedingungen und unterstreicht die Kompetenz von WWS Wasserkraft bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung innovativer Wasserbaulösungen weltweit“, betont Markus Peherstorfer.
Hydrauliklösungen für Turbinen und Revitalisierung alter Anlagen – weltweit im Einsatz Nicht nur in Guatemala, sondern in zahlreichen Ländern weltweit sind zuverlässige Hydraulikantriebe für den Betrieb und die Wartung von Wasserkraftanlagen unverzichtbar. Die professionelle Planung sowie eine konsequente Qualitätssicherung während der Ausführung sind entscheidend, um langle-
bige und effiziente Hydrauliksysteme zu gewährleisten. WWS Wasserkraft hat sich hier als kompetenter Partner etabliert: Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Hydraulikanlagen inklusive Steuerungssysteme für Turbinen und Stahlwasserbauprojekte Made in Austria – genauer gesagt im Mühlviertel. In den vergangenen Jahren hat WWS über 500 kundenspezifische Hydraulikaggregate gefertigt. Besonders bei älteren Turbinen, die bereits seit Jahrzehnten in Betrieb sind, sind Modernisierungen und Umbauten notwendig, um die Anlagen zukunftssicher zu machen und zu automatisieren, und um den Betreib effizienter und sicher zu gestalten. Hierbei werden hydraulische Steuerungen so angepasst oder neu installiert, dass eine automatische Regelung auch aus der Ferne möglich ist. Diese Revitalisierungsmaßnahmen verlängern nicht nur die Lebensdauer der Anlagen, sondern verbessern auch deren Effizienz und Sicherheit. „Durch den Einsatz modernster Hydrauliktechnik gelingt es WWS Wasserkraft, alte Anlagen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen – stets mit Blick auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und einfache Wartbarkeit. Damit trägt das Unternehmen wesentlich dazu bei, die nachhaltige Nutzung bestehender Wasserressourcen weltweit zu sichern“, so Markus Peherstorfer.


„UNSERE
Seit kurzem läuft das EU-geförderte Forschungsprojekt ReHydro, das ein weites Spektrum an Forschungsthemen in der Wasserkraft abdeckt. Ein Teil davon fokussiert auf das portugiesische Kraftwerk Valeira, das der Erforschung neuer Ansätze in der Kavitationsdetektion sowie der Effizienzmessung dient. Die Projektpartner sind Voith und EDP, Portugal, als Betreiber des Kraftwerks sowie die Hochschule München. Es handelt sich um ein EU-gefördertes 48-Monats-Projekt, das im Mai 2024 angelaufen ist. Es läuft also noch bis April 2028. Wir sprachen mit Prof. Dr. Axel Busboom von der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen, der an der Hochschule München die Untersuchungen leitet.
zek: Herr Professor, wo liegt der Schwerpunkt dieses Teilprojekts?
Busboom: Es gibt zwei Schwerpunkte: Der eine ist die Kavitation. Dafür gibt es bei Voith bereits ein Kavitations-Detektionssystem, dieses soll noch weiterentwickelt werden. Einerseits unter dem Aspekt, dass man die Kavitationseffekte klassifizieren möchte. Es soll darüber hinausgehen, dass man lediglich feststellen kann, dass etwas im Gange ist. Schließlich gibt es ja auch Kavitationsvorgänge, die für die Turbine nicht schädlich sind. Andererseits ist es Ziel, dass man auf Basis dieser Unterscheidungsmöglichkeit auch Rückschlüsse auf aktuelle oder zukünftige Schäden ziehen kann. Und der zweite Schwerpunkt lautet Effizienz. Diese wird ja üblicherweise im Rahmen
der Inbetriebsetzung über ein standardisiertes Verfahren eruiert, wird danach aber in den allermeisten Fällen nicht mehr weiter überwacht. Wenn nun die Effizienz aus irgendwelchen Gründen –wie Kavitation, Verschleiß oder mechanische Fehler – mit der Zeit schleichend sinkt, merkt das der Betreiber unter Umständen nicht gleich. Wir gehen nun der Frage nach, ob man mithilfe von Durchflusssensorik die kinetische Energie bestimmen und im Abgleich mit dem Output die Effizienz errechnen kann. Und daraus leitet sich eine zweite Forschungsfrage ab, die noch gänzlich offen ist: Ob man dabei sogar komplett ohne Durchflusssensorik auskommen könnte? Das heißt, ob es möglich ist, über eine Art „virtuellen Sensor“ – lediglich auf Basis
anderer relevanter Betriebsparameter Rückschlüsse auf die Effizienz ziehen zu können. Das übergeordnete Ziel ist also ein kontinuierliches Effizienzmanagement im Kraftwerksbetrieb.
zek: Was brauchen Sie technisch dafür?
Busboom: Grundvoraussetzung ist, dass wir zuerst einmal den Durchfluss sauber messen können. Im zweiten Schritt werden wir der Frage nachgehen, ob wir da mögliche Korrelationen von anderen Parametern finden können.
zek: Wie sieht dabei der aktuelle Status quo der Forschungen aus?
Busboom: Wir haben aktuell den Punkt erreicht, an dem die Instrumentierung abgeschlossen ist. Dabei standen zu Beginn Fragen der Logistik, aber auch der Sicherheit im Vordergrund. Es ging

darum, dass man auch aus der Ferne auf die Daten zugreifen kann und um die Einrichtung einer funktionierenden Infrastruktur zur Datenerfassung.
zek: Wie sieht die Sensorik genau aus?
Busboom: Bei den Sensoren für die Erfassung von Kavitation handelt es sich um Ultraschall-Mikrofone, die eine Mess-Range bis zu 500 kHz aufweisen, also weit darüber hinaus, was das menschliche Ohr noch wahrnehmen kann. Die von der Firma Voith erdachte Methodik misst dabei nicht den Luftschall, sondern Körperschall. Zu diesem Zweck werden für die Sensoren Sackbohrungen außen am Turbinengehäuse durchgeführt. Es muss also nicht durchbohrt werden, somit gibt es auch keinen Eingriff in die Hydraulik. Die Anlage kann bei der Montage sogar weiterlaufen. Für die Messung werden die Sensoren
an verschiedenen Stellen des Gehäuses platziert.
zek: Welcher Schall wird nun genau gemessen?
Busboom: Bei der Kavitation kommt es ja zu einem Implodieren der Wasserdampfbläschen, wobei die dabei erzeugten Schallwellen auf die Oberfläche des Turbinenblatts treffen. Diese werden dann als Körperschall übertragen. Unser Ziel ist es, diese Schallwellen eindeutig zu identifizieren.
zek: Worin liegen dabei für Ihr Team die Herausforderungen?
Busboom: Das Hauptproblem ist, dass die Sensorik natürlich alles Mögliche an Schall aufgreift. Voith hat an seinen Testständen in Heidenheim herausgefunden, dass es sich um sehr hochfrequente akustische Signale handelt, die mit dem Ohr nicht wahrnehmbar sind. Die Vielzahl

Das Kraftwerk Valeira ist ein Laufwasserkraftwerk im portugiesischen Distrikt Viseu, das den Douro nutzt. Mit ihren drei baugleichen KaplanTurbinen erreicht die Anlage eine Leistung von ca. 240 MW.
an Geräuschen setzt sich unter anderem zusammen aus Schall von Vibrationen, Reibungsgeräuschen vom Wasser, vom Lager oder vom Generator und einigem mehr. Daher auch der Ansatz des Big Data getriebenen Machine Learning. Die KI lernt aus der Fülle an Daten, was letztlich relevant ist.
zek: Worin erwarten Sie den zentralen Unterschied zwischen den Daten, die aus Valeira kommen werden und den Teststanddaten von Voith?
Busboom: Die Teststanddaten sind optimal einzuordnen. Schwieriger wird die Interpretation der gemessenen Daten aus dem Kraftwerk Valeira, weil wir nicht wissen, wie zum Messzeitpunkt der Kavitationszustand war. Man spricht dabei von „ungelabelten Daten“.
zek: Erwarten Sie sich am Ende eine Vergleichbarkeit aus den Daten, die ein-
ReHydro ist ein neues EU-finanziertes Forschungsprojekt, das sich darauf konzentriert, die Möglichkeiten einer nachhaltigen Sanierung und Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke in ganz Europa aufzuzeigen. ReHydro soll demonstrieren, wie europäische Wasserkraft im Kontext des Klimawandels weiterhin eine führende Rolle in einem nachhaltigen Energiesystem der Zukunft spielen kann. Dabei werden neue Methoden und Werkzeuge erprobt, um nicht zuletzt eine Steigerung der europäischen Wasserkraftkapazitäten zu ermöglichen. Am ReHydro-Projekt sind 22 Partner aus sieben europäischen Ländern beteiligt: Jeder von ihnen bringt seine eigene einzigartige Expertise in das Projekt ein.
heitliche Rückschlüsse auch auf andere Anlagen zulässt?
Busboom: Wenn wir uns mehrere Anlagen ansehen, dann weisen diese unterschiedliche Materialien, Fließgeschwindigkeiten, Drehzahlen und vieles mehr auf. Die Daten sind somit nicht 1:1 vergleichbar. Darin liegt für uns eine Herausforderung: zu schauen, ob die Erkenntnisse aus dem Machine-LearningSystem dann auch übertragbar sind. Die Alternative wäre, dass man in den sauren Apfel beißen und das System für jede Anlage neu trainieren muss. Das wissen wir noch nicht.
zek: Lassen Sie uns zum zweiten wichtigen Punkt des Forschungsprojekts kommen: der Entwicklung eines „virtuellen Sensors“. Zu diesem Zweck werden Sensoren für die Durchflussmessung angebracht. Setzen Sie dabei auf eine ultraschallbasierte Variante?
Busboom: Ja, zum einen auf eine ultraschallbasierte Sensorik, und zum anderen auf eine differenzdruckbasierte.
zek: Man braucht also die Messdaten dieser Sensoren, um den „virtuellen Sensor“ zu entwickeln?
Busboom: Genau. Wir wollen im Rahmen einer typischen Machine-LearningAnwendung das System so trainieren, dass man aus anderen, vorliegenden Messdaten den Durchfluss ableiten kann. Dafür braucht es vorher vertrauenswürdige Messdaten. Hat man einmal einen sauberen, aufgeräumten Datenbestand, kann das eigentliche Machine Learning beginnen.
zek: Inwiefern bietet das Kraftwerk Valeira ein ideales Forschungsfeld?
Busboom: Erstens – aus ganz pragmatischer Sicht – weil es eine bestehende Kooperation gibt, die uns ermöglicht, auf die Daten zuzugreifen. Zweites gibt es drei mehr oder weniger idente Turbinen, wodurch die Betriebszustände ganz gut vergleichbar sind. Und Drittens hat man hier bereits Kavitationseffekte festgestellt.
zek: Wie könnten am Ende die Resultate des Forschungsprojekts aussehen?
Busboom: Es könnte gegebenenfalls daraus ein System resultieren, das ein Betreiber einfach installieren kann und das eine belastbare Aussage über die kumulative Schädigung durch Kavitation trifft. Daraus könnte sich eine Betriebsstrategie ableiten lassen.
zek: Geht es da um wirtschaftliche Strategien?
Busboom: Im Grunde ja. Wenn man etwa online messen kann, in welchem

Belastbare Daten aus der Durchflussmessung stellen die Grundlage für die Forschung dar. Dabei setzen die Forscher auf ultraschall- und differenzdruckbasierte Messsensorik.
Betriebsbereich die Kavitationsschäden am Turbinenlaufrad auftreten, kann man die Turbine bei Bedarf durchaus aggressiver fahren – also bis zum kritischen Punkt, an dem Kavitation beginnt. Und möglicherweise geht es sogar einen Schritt weiter. Angenommen, der Strompreis an den Spotmärkten ist gerade extrem hoch, dann könnte ein Betreiber die Maschine sogar temporär in den Kavitationsbereich bringen und eine gewisse Schädigung in Kauf nehmen, solange sich dies angesichts des hohen Strompreises wirtschaftlich vertreten ließe.
zek: Sehen Sie noch weitere Nutzungsoptionen möglicher Forschungsergebnisse?
Busboom: Ein anderer Aspekt wäre, perspektivisch Wartungsmaßnahmen zu optimieren. Etwa diese hinauszuzögern, weil der Grad der Schädigung noch relativ gering ist – oder aus anderen Gründen etwa auch vorzuziehen. Man könnte damit genau im Bilde sein, was bei der nächsten Revision zu erwarten ist, was natürlich die Bereitstellung von Material und anderen Dingen erheblich vereinfachen würde. Letztlich zielt es auf Optimierungen der Betriebsführung und der Wartungsstrategie.
zek: Wann rechnen Sie mit den ersten Ergebnissen?
Busboom: Derzeit befinden wir uns noch im ersten Viertel der Projektlaufzeit. Das Forschungsprojekt endet im Frühling 2028, dann werden alle Ergebnisse auf dem Tisch liegen. zek: Vielen Dank für das Gespräch.

Prof. Dr. Axel Busboom Hochschule München / Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen
Fachgebiete:
• KI und maschinelles Lernen in Engineering, Produktion und Instandhaltung
• Digitale Zwillinge: physik - und datengetriebene Modellierung industrieller Prozesse
• Regelung und Optimierung industrieller Prozesse
• Semantische Interoperarbilität mit OPC UA
• Machine Vision für industrielle Anwendungen












Im slowakischen Moson, in dem ein Kleinwasserkraftwerk Wasser aus der Donau nutzt, werden in die Jahre gekommene Winkelgetriebe-Turbinen durch eine bahnbrechende Lösung ersetzt: die ersten StreamDiver mit Leitapparat-Regulierung. Die beiden wassergeschmierten, ölfreien Turbinen bilden eine InPipe-Lösung, die mit geringem baulichen Aufwand in das bestehende Krafthaus integriert werden konnten – umweltfreundlich, effizient und kompakt. Dank der verstellbaren Leitschaufeln kann nun
die Anlage flexibel auf variierende Betriebsbedingungen reagieren und erzielt so eine signifikant höhere Jahreserzeugung. In Zusammenarbeit mit Sintaksa übernimmt Voith auch die gesamte elektrische Integration.
Technische Daten
Turbinentyp: 2 x SD-13,1
Leistung: 443 kW je Unit
Fallhöhe: 5 m
Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die StreamDiver Lösung.
