

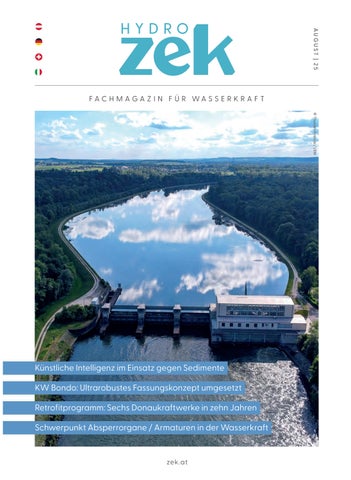




Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen Sedimente
KW Bondo: Ultrarobustes Fassungskonzept umgesetzt
Retrofitprogramm: Sechs Donaukraftwerke in zehn Jahren

Schwerpunkt Absperrorgane / Armaturen in der Wasserkraft zek.at






Mag. Roland Gruber Herausgeber | rg@zek.at

Als eine der ältesten und zugleich verlässlichsten Konstanten unserer Energieversorgung eilte der Wasserkraft bis dato nicht unbedingt der Ruf einer „durchdigitalisierten Technologie“ voraus. Eher das Gegenteil war der Fall. Doch hinter den Kulissen tut sich einiges: Angesichts der wachsenden Komplexität – bedingt durch Betriebsvorgaben, Umwelteinflüsse und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen – ist der Innovationsdruck sukzessive gewachsen. Die Branche hat reagiert – und wenig überraschend setzen immer mehr Wasserkraftunternehmen auf die Künstliche Intelligenz, kurz: KI, als technologische Triebkraft. Aktuelle Beispiele gibt es genug: So arbeiten beispielsweise Voith und das DLR an einem KI-gestützten Optimierungstool, das den Entwicklungsprozess von Turbinen durch automatisierte Simulationsläufe und maschinelles Lernen drastisch verkürzt. Marktbegleiter Andritz setzt auf eine Kooperation mit dem Software Competence Center Hagenberg: Hier wird am Projekt AIPRA gearbeitet, in dem hydraulische Designs durch KI automatisch angepasst, Testdaten ausgewertet und sogar 2D-Konstruktionszeichnungen in funktionale 3D-Modelle überführt werden sollen. KI wird also zum digitalen Entwicklungspartner, der den gesamten F&E-Prozess hinweg begleitet. Ein weiteres interessantes Beispiel liefert der österreichische Wasserkraftspezialist Global Hydro, der generell schon länger den Fokus auf digitale Anwendungen richtet. Mit dem neuen System Hydrox SediSense haben die Oberösterreicher mithilfe von KI ein völlig neuartiges Tool entwickelt, das erstmals eine präzise Detektion von schädlichen Sedimentpartikeln an den kritischen Turbinenbauteilen ermöglicht, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Details dazu finden Sie auf den Seiten 56-59 in dieser Ausgabe. In der Juni-Ausgabe haben wir unter anderem auf das EU-Projekt ReHydro Bezug genommen. Dabei werden unter anderem neue Wege erprobt, wie sich Kavitation durch Big Data und maschinelles Lernen besser klassifizieren lässt – mit dem Ziel, die Effizienz ganzer Kraftwerksstandorte digital und kontinuierlich zu überwachen. All diese Beispiele sind längst keine Zukunftsvisionen, sondern gelebte Realität in der Wasserkraft. Und sie zeigen: Wer heute am Wasserkraftmarkt bestehen will, braucht neben ausgereifter, robuster Technik mittlerweile auch lernende Systeme und KI. Die Branchenunternehmen sehen sich wenig überraschend einem globalen Effizienzdruck ausgesetzt, der neue Partnerschaften, aber auch neue Technologien erzwingt. KI wird damit nicht nur zur technischen Option, sondern vielmehr zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Denn schließlich geht es auch darum, dass der Einsatz intelligenter Systeme darüber entscheidet, wer Entwicklungen schneller zur Marktreife bringt, wer Wartungskosten reduziert – und wer den steigenden regulatorischen und ökologischen Anforderungen gerecht wird. In einem Markt, der bedingt durch Energiewende, Klimawandel und volatile Preise einer hoch dynamischen Entwicklung unterliegt, wird KI zum entscheidenden strategischen Vorteil. Welche Anwendungen möglich werden und welche Perspektiven sich schon in naher Zukunft damit eröffnen, wird uns bald vor Augen geführt werden. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.
Ihr
Mag. Roland Gruber





Reliability beyond tomorrow.









PROJEKTE
24 Robustes Fassungskonzept macht Kraftwerks-Comeback möglich Kraftwerk Bondo
08 Interessantes & Wissenswertes Kurznachrichten
09 Impressum
ZUR SACHE
20 Die Tücken mit dem Treibstoff Wasser – richtige Auslegung lohnt sich Kolumne Pelikan
PROJEKTE
21 Tiroler Wasserkraftallrounder bringt Kraftwerk in Ruanda in Schuss Kraftwerk Gihira
30 Sechs Donaukraftwerke in zehn Jahren – Revisonsprojekt fertig ODK-Kraftwerke
B RANCHE
34 Der Wasserkraftplaner steht an der Spitze der Pyramide Firmenjubiläum-Interview
PROJEKTE
38 Modernisierung am Tedori Gorge: Leuchtturmprojekt in Japan Kraftwerk Shirayama
TECHNIK
41 Bei der Generatorwahl endet die Wirtschaftlichkeit nicht beim Preis Return-of-Invest
PROJEKTE
44 Tiroler Energietechnikspezialist etabliert sich als Komplettanbieter Trinkwasserkraftwerke
48 Erneuertes Wehr bei München überzeugt auf ganzer Linie Wehranlage Großhesselohe
52 Inselkraftwerke in Guyana überzeugen mit GUGLER-Technik Kraftwerke Moco Moco & Kumu




TECHNIK
56 Sedimente mithilfe von KI präzise detektieren
Weltneuheit Sedimenterkennung
PROJEKTE
60 Tiroler Rohrspezialist hat die richtigen Lösungen parat Rohrtechnik-Projekte
SCHWERPUNKT
63 Sanierung der Absperrorgane für Comeback von PSKW Happurg Schwerpunkt Verschlussorgane
66 Zahnstangenantrieb zum Verfahren von Schütztafeln Schwerpunkt Verschlussorgane
69 Kompetenzbeweis auf hochalpiner Baustelle am Grimselpass Schwerpunkt Verschlussorgane
73 Hochleistungs-Armaturen für neues PSKW Kühtai 2 Schwerpunkt Verschlussorgane

AR-Vorsitzender Markus Achleitner und CTO Alexander Kirchner nehmen den Spatenstich für das neue KW Traunfall gemeinsam mit den Lehrlingen Leon Pojer, Marlene Hufnagl und Sandra Krainz vor. (v.l.)

Turbine, Generator und Kugelschieber von Maschinengruppe 2 im Repower-Kraftwerk Klosters wurden umfassend modernisiert.

Meilenstein für das Erweiterungsprojekt Kühtai: Unlängst erreichte die 334 Meter lange und 800 Tonnen schwere TBM den Durchbruch im Sulztal.
SPATENSTICH FÜR NEUBAU DES KRAFTWERKS TRAUNFALL
Am 23. Juni erfolgte der offizielle Spatenstich für den Neubau des Laufwasserkraftwerks Traunfall. „Mit dem Kraftwerksprojekt Traunfall stärken wir die Versorgungssicherheit und setzen einen weiteren wichtigen Schritt für eine nachhaltige Energiezukunft“, sagte Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Der Neubau ersetzt die bestehenden Anlagen Gschröff, Siebenbrunn und das aktuelle KW Traunfall, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die Errichtung der bestehenden Anlagen geht bis ins Jahr 1888 zurück. Die lange Lebensdauer zeigt, dass über mehrere Generationen hinweg Energie erzeugt werden kann. „Durch die vorhandene Fallhöhe, die Erhöhung der Wirkungsgrade und der optimierten Nutzung des Wasserdargebots kann die jährliche Stromerzeugung um rund 80 Prozent auf 125 GWh gesteigert werden“, erklärt Energie AG-CTO Alexander Kirchner. Die Bauzeit beträgt drei Jahre, der Probebetrieb des Kraftwerks Traunfall ist für das Jahr 2028 geplant.
TEILERNEUERUNG DES KW KLOSTERS ABGESCHLOSSEN Repower hat die Teilerneuerung des KW Klosters erfolgreich abgeschlossen. Seit Anfang 2023 wurden ca. 3 Mio. CHF in die Anlage investiert. Damit ist das Kraftwerk langfristig für einen sicheren und effizienten Betrieb gerüstet. Im Rahmen eines kompletten Retrofits an Turbine, Kugelschieber und Generator wurde die Maschinengruppe 2 des Kraftwerks umfassend modernisiert. In einer 2. Phase erfolgte die vollständige Erneuerung der gesamten Sekundärtechnik, die zur Steuerung und Überwachung der Anlage dient. Die Arbeiten wurden notwendig, nachdem es zu einem Kurzschluss im Generator gekommen war. Nun konnte der Schaden behoben und die Betriebssicherheit der Anlage erheblich gesteigert werden. Das KW Klosters ist die erste Stufe der Prättigauer Kraftwerkskaskade mit dem Davosersee als Winterspeicher. Die jährliche Stromproduktion in Klosters beläuft sich auf rund 27 GWh.
KÜHTAI: TBM ERREICHT ERSTES ETAPPENZIEL
Einer der wesentlichen Bestandteile des Erweiterungsprojekts Kühtai ist der insgesamt 25,5 km lange Beileitungsstollen, über den Wasser in den neuen Speicher Kühtai geleitet werden wird. Dafür wurden im April 2022 die Arbeiten begonnen und kürzlich eine wichtige Wegmarke erreicht: Nach einer zurückgelegten Strecke von 18 km erfolgte der Durchbruch im Sulztal. „Damit ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein für die Versorgung unseres Kraftwerks im Kühtai sichergestellt“, freut sich Projektleiter Klaus Feistmantl. Nach einer gründlichen Inspektion und dem Wechsel des Bohrkopfs geht es für die Tunnelbohrmaschine gleich weiter Richtung Stubaital. „Bis zum Ziel im Stubaital sind noch 5,3 km vorzutreiben. Wir rechnen damit, spätestens im Frühjahr 2026 diese Verbindung hergestellt zu haben“, so Feistmantl. Gleichzeitig zum Vortrieb der TBM wird auf dem letzten Teilstück des Beileitungsstollens im Sprengvortrieb gearbeitet. Diese Arbeiten werden noch im heurigen Jahr abgeschlossen.

Der Yarlung Tsangpo ist in Indien als Brahmaputra bekannt. Er soll das geplante chinesische Mega-Kraftwerk in Nyingchi speisen.
BAU VON MAMMUT-KRAFTWERK IN TIBET GESTARTET
Am 19. Juli 2025 leitete Chinas Ministerpräsident Li Qiang die feierliche Spatenstich-Zeremonie für das neue Yarlung Tsangpo Wasserkraftprojekt in Nyingchi, Tibet. Der symbolträchtige Akt markierte den offiziellen Baustart eines Mega Damms, der aus fünf kaskadierenden Kraftwerken bestehen und die künftig weltgrößte Wasserkraftanlage mit etwa 300 Mrd. kWh Jahresleistung sein wird – mehr als das Dreifache des Drei-Schluchten Staudamms. Das Projekt kostet rund 167 Mrd. USD und soll vornehmlich Strom für zentrale Regionen Chinas liefern, während zugleich ein Teil der tibetischen Nachfrage gedeckt wird. China bezeichnet das Vorhaben als „Projekt des Jahrhunderts“ und legt nach eigenen Angaben großen Wert auf ökologische Unbedenklichkeit – trotz Protesten und diplomatischer Besorgnis aus Indien und Bangladesch, die mögliche Auswirkungen auf den Brahmaputra Fluss und lokale Ökosysteme sehen. Die chinesische Regierung beteuert, der Staudamm werde keine negativen Folgen für die Nachbarländer haben.


Mehr als eine Fischaufstiegshilfe: Im Stauraum und in der Unterwasserstrecke finden sich mehr Schotterbänke als vor dem Kraftwerksbau.
GRÖSSTE FISCHWANDERHILFE AN DER SALZACH IN BETRIEB
Am 17. Juni ging das erste Schott am Einstieg zum neuen Umgehungsgewässer beim Kraftwerk Stegenwald hoch und das Wasser konnte langsam seinen Weg durch das neu gestaltete Flussbett finden. Über eine Strecke von rund 500 m wird Salzburgs größte Fischwanderhilfe mit ihren Uferbereichen neuen Naturraum für Tiere und Pflanzen schaffen. Dafür haben die Projektpartner VERBUND und Salzburg AG das alte Salzachbett innerhalb weniger Monate in eine neue Fischwanderhilfe umgestaltet. Auf einem 50 m breiten Korridor schlängelt sich das naturnahe Gewässer entlang des Kraftwerks. Den Jahreszeiten angepasst schwanken die Abflüsse dynamisch zwischen 2.000 bis 5.000 l/s. Der mäandrierende Verlauf mit unterschiedlichen Strukturen, Fließgeschwindigkeiten und maximalen Wassertiefen von 1,1 bis 1,4 Metern ermöglicht es allen Fischarten der Salzach, am Kraftwerk Stegenwald vorbei zu schwimmen und dabei einen Höhenunterschied von rund 9 Metern zu überwinden oder dort für eine gewisse Zeit zu verweilen.

IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. zek-Verlag · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · T. +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Mag. Roland Grube · rg@zek.at · +43 664 115 05 70 | Redaktio: Mag. Andreas Pointinger · ap@zek.at · T. +43 664 22 82 323 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · T. +43 664 240 67 74 | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt 5450 Werfen · P.b.b. „03Z035382 M“ · Grundlegende Richtlinien | zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich. | Abopreis Österreich: € 78,00 · Ausland: € 89,00 · inklusive Mehrwertsteuer | zek HYDRO erscheint 6x im Jahr Auflage: 8.000 Stück · ISSN: 2791-4089 · 23. Jahrgang.


KRAFTWERK HAMMER IST WIEDER AM NETZ
Nach zwölf Monaten Stillstand ist das Kleinwasserkraftwerk Hammer an der Fecht in Munster (F) seit Frühling dieses Jahres wieder in Betrieb. Grund für die außerplanmäßige Pause des ADEV-Kraftwerks war ein Schaden an der Gleitringdichtung, deren Ersatz einen Umbau der Turbine erforderte. Im Zuge der Sanierung wurden auch das Turbinenlager erneuert und der Generator revidiert. Die volle Leistungsfähigkeit der erneuerten Anlage wird sich erst ab Herbst zeigen, da die Fecht in den Sommermonaten erfahrungsgemäß wenig Wasser führt. Das Kraftwerk Hammer nutzt eine Ausbauwassermenge von 4,2 m3/s. Die Ökostromanlage befindet sich am Ende eines 684 Meter langen Oberwasserkanals, der im Ersten Weltkrieg zerstört und danach wieder neu errichtet worden war. Der Unterwasserkanal dagegen stammt noch original aus dem Jahr 1832. Der Maschinensatz wurde im Zuge des Umbaus im Jahr 2013 komplett erneuert. Neben dem Kraftwerk Hammer hatte die ADEV 2009 zwei weitere stillgelegte Wasserkraftwerke an der Fecht erworben und Schritt für Schritt wieder in Stand in gesetzt.
Alperia setzt die Überwachung der im Sommer 2024 entdeckten Fledermauskolonie im Wasserkraftwerk Töll fort. Ein Jahr nach der Erstentdeckung bestätigen die Daten der Forschenden erneut die ökologische Relevanz der Kolonie: Es handelt sich um eine Population der Kleinen Hufeisennase, einer geschützten Art. Die Kolonie hat sich in den unterirdischen Räumen angesiedelt, die direkt mit dem Maschinenraum verbunden sind. Dank der Abwärme der Generatoren herrschen dort im Sommer optimale Bedingungen – ideal als Wochenstube, also als Ort, an dem die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen und betreuen. Am 1. Juli 2025 konnten bei einem nächtlichen Einsatz mit Infrarotkameras 330 erwachsene Exemplare sowie 45 Neugeborene identifiziert werden. Dabei wurde ein Eingang entdeckt, den die Fledermäuse zwischen dem angrenzenden Wald und den Innenräumen des Kraftwerks nutzen. Die stabile Präsenz der Fledermäuse im KW Töll ist ökologisch wertvoll und zeigt zudem beispielhaft, wie Technologie und Natur im Gleichgewicht koexistieren können.
Energieverteilung
Wasserversorgung
Wasserkraftanlagen
Inselanlagen
Mittelspannungsanlagen
Niederspannungsanlagen
Automatisierungen
Regelungen
Schutztechnik
Planung / Konstruktion
Wasserkraftanlagen
Haus interne Fertigung von:
Hochdruck-Turbinen
Niederdruck-Turbinen
Inselanlagen
Anlagen Revitalisierung
Service & Montage
Ihr zuverlässiger Partner für die elektromechanische Kraftwerkausrüstung



Die neue Fischaufstiegshilfe beim Wasserkraftwerk Bannwil an der Aare aus der Vogelperspektive.
NEUER FISCHAUFSTIEG BANNWIL IST IN BETRIEB
Die BKW hat beim Wasserkraftwerk Bannwil nach rund drei Jahren Bauzeit einen neuen Fischpass in Betrieb genommen – ein bedeutender Schritt zur Wiederherstellung der Fischgängigkeit in der Aare und zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bis 2030. Beim neuen Fischpass in Bannwil handelt es sich um ein komplexes Bauwerk – es bietet zwei getrennte Einstiege im Unterwasserbereich: einen nahe der Turbinenausläufe für schwimmstarke Arten wie Lachs und Forelle sowie einen weiter entfernten für schwimmschwächere Fische, etwa Jungfische. Die Einstiege münden in einen gemeinsamen Kanal, der über eine technische Aufstiegstreppe in ein naturnah gestaltetes Gerinne führt – mit einem Ausstieg oberhalb des Kraftwerks. Mit dem neuen Fischpass stärkt die BKW die Fischwanderung in der Aare.

LH Mario Kunasek (2.v.r.) überreichte den Vertretern der E-Werk Gleinstätten GmbH mit weiteren Ehrengästen das steirische Landeswappen.
Der 28. Juni 2025 ist ein besonderer Tag in der Firmengeschichte der E-Werk Gleinstätten GmbH: Zur 130-Jahr-Feier und dem Spatenstich für das neue Wasserkraftwerk stellte sich auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek ein und überbrachte persönlich das Landeswappen, das das E-Werk Gleinstätten ab sofort führen darf. Als im ausgehenden 19. Jahrhundert die Elektrifizierung durch den Bau von Wasserkraftwerken immer mehr Fahrt aufnahm, enstand in Gleinstätten ein lokales E-Werk, um die steigende Nachfrage nach elektrischer Energie zu decken. In den 130 Jahren seit der Gründung durch Edmund Freiherr von Huldenfeld und durch die Entwicklung unter neuen Besitzern ist der Betrieb um das ursprüngliche Kleinkraftwerk stetig gewachsen – und ist heute immer noch ein wichtiger regionaler Stromversorger.

Erfahren Sie mehr über unsere Serviceleistung

Das neuartige Fischleitsystem am Tunnel-Wasserkraftwerk in Connecticut soll als Modell für zukünftige ökologische Lösungen dienen.

Das 2013 stillgelegte und im Verfall begriffene Wasserkraftwerk Lietha in Grüsch wird etappenweise von Repower bis 2026 rückgebaut.

PILOTPROJEKT VON FISHHEART IN DEN USA
Das finnische Unternehmen Fishheart Ltd. startet sein erstes großflächiges Pilotprojekt in Nordamerika. Am Tunnel-Wasserkraftwerk in Connecticut wird ein neuartiges Fischleitsystem getestet, das den lokalen Fischarten den sicheren Aufstieg ermöglicht. Das System besteht aus einer schwimmenden Einheit unterhalb des Wehrs und einer Rohrleitung über das Kraftwerk. Es nutzt das Siphonprinzip, wodurch es weniger baulichen Aufwand erfordert als herkömmliche Fischpässe und kosteneffizienter einsetzbar ist. Die Testphase läuft über zwei bis drei Jahre. Bei Erfolg ist eine dauerhafte Installation am nahegelegenen Stevenson-Kraftwerk geplant. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit US-Behörden wie NOAA und dem U.S. Fish and Wildlife Service durchgeführt.
RÜCKBAU DES EHEMALIGEN KRAFTWERKS IN GRÜSCH Über ein Jahrhundert lang leistete das Kraftwerk Lietha in Grüsch einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung im Vorderprättigau. Kürzlich begann der Rückbau der Anlage. Damit endet ein bedeutendes Kapitel Industriegeschichte im Prättigau. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks Taschinas im Jahr 2011 verlor die Stromproduktion in der Anlage Lietha an Bedeutung. 2013 stellte Repower den Betrieb vollständig ein. Seither verfallen die baulichen Anlagen zunehmend. Aus sicherheits-, umwelt- und konzessionsrechtlichen Gründen ist der Rückbau der teilweise einsturzgefährdeten Infrastruktur notwendig geworden. Der Rückbau umfasst sämtliche baulichen Komponenten der ehemaligen Hoch- und Niederdruckanlagen. Dazu zählen die Wasserfassungen, die Freispiegelleitung sowie die Druckleitungen.




Offizielle Einweihung der Fischaufstiegshilfe Oberpeiching: Naturnah gestaltete Fischaufstiegshilfen verbessern die Bedingungen für Wasserlebewesen im Bereich des unteren Lechs deutlich.
OBERPEICHING:
Die neue Fischaufstiegshilfe am Wasserkraftwerk Oberpeiching ist vor kurzem offiziell in Betrieb gegangen. Sie stellt die Durchgängigkeit für Fische am Lech in diesem Abschnitt wieder her. Damit verbessern sich die Bedingungen für die Wasserlebewesen in diesem Bereich des Flusses deutlich. Die Fischaufstiegshilfe stärkt die ökologische Funktion der Wasserkraftwerke entlang des unteren Lechs und ist Baustein zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die Baukosten belaufen sich auf rund 4,5 Mio. Euro. Diese trägt die RheinMain-Donau GmbH (RMD) als Kraftwerkseigentümerin. Die Betriebsführung des Kraftwerks liegt bei der LEW. Sie hat als Projektleiterin die Anlage konzipiert und umgesetzt. Die Fischaufstiegshilfe ist rd. 420 m lang. Sie überbrückt eine Höhendifferenz von 8,6 m. Die Anlage besteht aus drei funktional aufeinander abgestimmten Abschnitten. Die Fische steigen dabei entgegen der Flussrichtung vom Unterwasser zum Oberwasser auf. Unterhalb des Kraftwerks beginnt die Anlage mit einem technischen Einstiegsbauwerk. Daran schließt sich ein ca. 150 m langes, naturnah gestaltetes Umgehungsgewässer an, das an einen Bachlauf erinnert. Es dient als strukturreicher Lebensraum für Fische und andere Wasserorganismen. Rund 150 m weiter oberhalb des Kraftwerks liegt das Ausstiegsbauwerk. Hier ist der Übergang ins Flussbett. Die Sohle ist durchgängig rau gestaltet und mit natürlichem Kies- und Steinmaterial verfüllt. Damit finden Muscheln, Schnecken, Insektenlarven oder Krebse geeignete Bedingungen, um sich dort anzusiedeln. Im Verlauf der Anlage gibt es außerdem Kieslaichplätze. Entlang der Böschungen wurden Reptilienhabitate angelegt. Die Anlage in Oberpeiching ist nach Feldheim die zweite Fischaufstiegshilfe, die an den von LEW betriebenen Lechkraftwerken zwischen Ellgau und der Lechmündung in Betrieb geht. Der Baubeginn für die Anlage in Rain ist für Herbst 2025 vorgesehen. Sie soll kommendes Jahr in Betrieb gehen.

Projektleiter Andreas Dengg (l.) und Vorstandsdirektor Alexander Speckle informierten im Rahmen eines Pressegesprächs über die Vollständigkeitserklärung der Behörde.
PSKW VERSETZ: BEHÖRDE ERKLÄRT VOLLSTÄNDIGKEIT
Im März hat TIWAG das aktualisierte Projekt Pumpspeicher Versetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Kürzlich hat die Behörde die Vollständigkeit der Einreichunterlagen bestätigt. Seit 14. Juli 2025 liegen diese nun für neun Wochen öffentlich auf. Jede und jeder kann in dieser Zeit eine Stellungnahme dazu abgeben. Begleitend wird TIWAG UVP-Beratungen für Bürger/innen in den Standortgemeinden anbieten. In den vergangenen Monaten haben die 50 neutralen GutachterInnen die Einreichunterlagen auf Vollständigkeit geprüft, die jetzt bestätigt wurde. Der neue Pumpspeicher Versetz mit dem Speicher Platzertal ist das Herzstück der Erweiterung Kaunertal und ist so konzipiert, dass er mit seiner Leistung und Speicherkapazität durchgängig rund 160 Stunden lang volle Energie liefern kann. Pumpspeicher sind die wirtschaftlichste, großtechnische Möglichkeit, große Mengen an Energie über einen längeren Zeitraum zu speichern und bei

Wasserkraft | Turbinen | Systeme
16. & 17. September | TU Graz

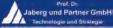



Das Triebwasser für das im Pfänderstock geplante Kraftwerk Lochau würde am Westufer in den Bodensee eingeleitet werden.
Die Vorarlberger Grünen drängen auf die Realisierung des seit langem geplanten Wasserkraftwerks in der Gemeinde Lochau am Westufer des Bodensees, berichtete orf.at Ende Juli. Mit dem Projekt, das im Bergmassiv des Pfänderstocks geplant ist, könnte das größte verbleibende Wasserkraftpotenzial in Vorarlberg nutzbar gemacht werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz plädierte Grünen-Klubobmann Daniel Zadra für eine rasche Projektumsetzung, um die Versorgung des Bundeslands sicherzustellen. Die Planungen sehen vor, die Anlage als unterirdisches Laufwasserkraftwerk zur errichten. Das Regelarbeitsvermögen wird mit 125 GWh beziffert, umgerechnet entspricht dies dem Strombedarf von über 30.000 Haushalten.

Die beiden eigenen Kaplan-Turbinen der Papierfabrik Sappi.
Anfang Juli fand in der Papierfabrik Sappi im steirischen Gratkorn eine kleine Feierlichkeit anlässlich des 100 Jahre Jubiläums des betriebseigenen Wasserkraftwerks statt, berichtete meinbezirk.at. In einem kleinen Festakt hoben Geschäftsführer Peter Putz und der Leiter für Wasseraufbereitung und Umweltschutz Oliver Bürger die Bedeutung des Wasserkraftwerkes hervor. Bei der Inbetriebnahme im Jahr 1925 waren die beiden damals auf eine Engpassleistung von jeweils 2,57 MW ausgelegten Kaplan-Turbinen die leistungsstärksten Maschinen ihrer Bauart – weltweit. Es wird kolportiert, dass Viktor Kaplan persönlich bei der Inbetriebnahme anwesend war. Nach diversen Umbauten und Modernisierungen erzeugen die beiden Ka-








Salzachkraftwerk Urstein der Salzburg AG
SALZBURG AG PLANT UMBAU BEIM KRAFTWERK URSTEIN
Einem Bericht der Salzburger Nachrichten vom 25. Juli zufolge plant die Salzburg AG beim Salzachkraftwerk Urstein Umbauten, die zur Optimierung des Geschiebe- und Sedimentmanagements am Standort beitragen sollen. Dazu sollen im Oberwasserbereich insgesamt sieben Buhnen errichtet werden, die eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit in der Flussmitte bewirken. Zusätzlich werden durch die Buhnen ökologische Rückzugs- und Lebensräume geschaffen, die an der stark begradigten Salzach rar sind. Die Maßnahmen sind laut Salzburg AG präventiv, um dem prognostizierten steigenden Geschiebetrieb in der Zukunft entgegenzuwirken. Darüber hinaus ersparen sich die Betreiber durch die Umbauarbeiten zukünftige Baggereinsätze zur Sedimententfernung, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind.

Voith Hydro ist einer der weltweit führenden Anbieter moderner Wasserkraftwerke zur Gewinnung erneuerbarer Energie.
In einem zukunftsweisenden Kooperationsprojekt bündeln Voith Hydro und das DLR-Institut für Antriebstechnik ihr Knowhow, um den Auslegungsprozess von Wasserturbinen durch den Einsatz fortschrittlicher, KI-gestützter Optimierungsmethoden zu verbessern. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Entwicklungsprozess von Wasserturbinen mithilfe intelligenter Optimierungsverfahren grundlegend zu verbessern. Dafür etablieren die Ingenieure und Ingenieurinnen ein multidisziplinäres Optimierungssystem, das die Effizienz der Entwicklung signifikant steigert und gleichzeitig das physikalische Verständnis komplexer Strömungsvorgänge vertieft. Kern des Projekts ist das vom DLR entwickelte Optimierungstool AutoOpti, das speziell für automatisierte, interdisziplinäre Entwurfsprozesse konzipiert wurde.





UMWELTMASSNAHMEN BEI KW RUPPERSWIL-AUENSTEIN
PLANUNGEN FÜR NEUES PSKW IN DER STEIERMARK
Über den Zwischenstand bei der Umsetzung eines Ökologieprojekts der Schweizer Bundesbahnen (SBB) berichtete der SRF im Juli. Seit dem Vorjahr laufen beim Kraftwerk Rupperswil-Auenstein, das rund 10 Prozent des gesamten Schweizer Bahnstrombedarfs erzeugt, die Arbeiten für die Errichtung eines rund 800 m langen, naturnah gestalteten Auenbachs, der das bestehende Umgehungsgewässer mit einem Seitenarm der Aare verbindet. Zusätzlich werden ein Wildtiereinstieg am Flussufer, Fischruhebuchten und diverse Strukturierungsmaßnahmen im Gewässer umgesetzt. In Summe investiert die SBB rund 5 Mio. Franken in die Umweltmaßnahmen, die 2026 abgeschlossen sein werden. Die Realisierung des Ökologieprojekts ist an die Konzessionsverlängerung der Anlage gekoppelt, die der SBB im Jahr 2022 erteilt wurde.
Hydro half.qxp_Layout 1 24/06/2025 12:54 Page 1





Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung vom 24. Juli plant VERBUND die Errichtung eines neuen Pumpspeicherkraftwerks in der Steiermark. Dabei würde der Salza-Stausee, der sich auf den Gebieten der Gemeinden Bad Mitterndorf und Mitterberg-St. Martin befindet, als Unterbecken genutzt werden. Am Bergereck auf 1.500 m Seehöhe ist die Errichtung des oberen Speicherbeckens vorgesehen, die komplette elektromechanische Technik soll in einer unterirdischen Kaverne installiert werden. Das Leistungsvermögen der Anlage soll bis zu 480 MW betragen. Grundsätzlich ist die Anlage als Batterie geplant, die sowohl Strom erzeugen, als auch überschüssige Energie aus Wind- und Photovoltaik zwischenspeichern kann. Aktuell befindet sich das Vorhaben in einer frühen Phase, an eine mögliche Umsetzung wird erst in einigen Jahren zu denken sein.








EWR WILL KRAFTWERKSKETTE PLANSEE ERNEUERN
Ende Juli berichtete meinbezirk.at über ein Vorhaben des Elektrizitätswerk Reutte (EWR), das eine umfassende Modernisierung der Kraftwerkskette Plansee vorsieht. Für die geplanten Optimierungen, deren Umsetzung im Laufe der kommenden zehn Jahre geschehen soll, sieht das EWR eine Investition von ca. 70 Mio. Euro vor. Das Projekt beinhaltet technische und ökologische Maßnahmen entlang mehrerer Anlagen vom Rotlech bis nach Pflach. Nachdrücklich begrüßt wird das Revitaliserungsprojekt von der Industriellen Vereinigung (IV) Tirol: „Das vorgestellte Projekt zur Optimierung der Kraftwerkskette Plansee ist ein Musterbeispiel dafür, wie bestehende Infrastruktur intelligent, nachhaltig und leistungsfähiger weiterentwickelt werden kann – nicht nur für das Außerfern, sondern für ganz Tirol“, so IV Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer.
GROSSAUFTRAG FÜR ANDRITZ IN MOSAMBIK
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), Mosambiks führendes Wasserkraft-Energieunternehmen, hat ANDRITZ mit der Sanierung des Kraftwerks Cahora Bassa beauftragt. Cahora Bassa ist das größte Wasserkraftwerk in Mosambik und eines der größten in Afrika. Das 2.075-MW-Kraftwerk liefert mehr als die Hälfte des Stroms in Mosambik und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer. Cahora Bassa ist nicht nur eine Energieanlage, sondern auch ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes. ANDRITZ wird fünf neue, hochmoderne 480 MVA-Generatoren, fünf neue FrancisTurbinenlaufräder, Steuer- und Schutzsysteme sowie hydromechanische Strukturen liefern. Der Auftragsumfang umfasst Konstruktion, Engineering, Fertigung sowie Montage, Tests und Inbetriebnahme am Projektstandort.

• 10x leichter als Beton
• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen
• Optimale hydraulische Eigenschaften
• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit
• Einfache Verlegung in jedem Gelände
• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering
• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)
• Entwickelt für Generationen
Pipes designed for generations
www.amiblu.com/de

16. – 17. Oktober 2025 / Schloss Luberegg

Mehr Infos unter kleinwasserkraft.at/jahrestagung-2025



24.-25. SEPTEMBER 2025 | FORUM LANDQUART, SCHWEIZ https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.de/







Diese Schwelle in der Landquart würde durch das Projekt zwischen Küblis und der Rheinmündung fischdurchgängig gestaltet werden.
KONZESSION FÜR PROJEKT CHLUS ERTEILT
Anfang Juni wurde einem Bericht von baulatt.ch zufolge dem Energiekonzern Repower die wasserrechtliche Konzession für den Bau eines neuen Wasserkraftwerks an der Landquart im Prättigau im Kanton Graubünden erteilt. Für die Umsetzung braucht es noch die Projektgenehmigung von den Behörden. Das Projekt Chlus soll zwischen Küblis und dem Rhein als Ergänzung der bestehenden Kraftwerkskaskade Klosters/ Schlappin – Küblis entstehen. Dabei soll das turbinierte Wasser des bestehenden Kraftwerks Küblis in einem neuen, 16 km langen Druckstollen von Küblis nach Trimmis geleitet und dort weiterverwendet werden, statt es wie bisher in die Landquart zurück zu leiten – das würde auch zu wesentlichen ökologischen Verbesserungen führen. Mit einer installierten Leistung von rund 62 MW und einer voraussichtlichen Jahresproduktion von ca. 237 GWh gilt das Vorhaben als Projekt von nationaler Bedeutung. Für die Bauzeit sind rund fünf Jahre veranschlagt, mit der Umsetzung könnte aber erst frühestens 2027 begonnen werden.

Durch KI-Anwendung erstelltes Bild eines Wasserkraftwerks
GOOGLE SETZT BEI KI AUCH AUF WASSERKRAFT
Um den enormen Strombedarf wegen der immer höheren Verbreitung von KI abzudecken, setzt Google verstärkt auf die Nutzung von Wasserkraft. Mitte Juli berichtete heise.de über einen Rahmenvertrag, den Google mit Brookfield Asset Management und Brookfield Renewable über 3.000 MW Erzeugungskapazität aus Wasserkraftwerken abgeschlossen hat. Um den Energiebedarf für KI-Anwendungen zu decken, sind zusätzliche Serveranlagen mit extrem hohen Rechenleistungen notwendig. Der dementsprechende Strombedarf soll in den USA bis zum Jahr 2027 äußerst stark ansteigen. Davon zeugt auch die Tatsache, dass Google den Bau von drei neuen Atomkraftwerken mit jeweils 600 MW Leistungskapazität in den USA in Auftrag gegeben hat. Für die umweltfreundliche Wasserkraftnutzung hingegen werden keine neue Erzeugungsanlagen gebaut, der benötigte Strom wird von bestehenden Kraftwerken produziert. Allerdings überlegen die Betreiber der Wasserkraftwerke aufgrund der Abnahmegarantie durch Google, diese zu modernisieren bzw. aufzurüsten.
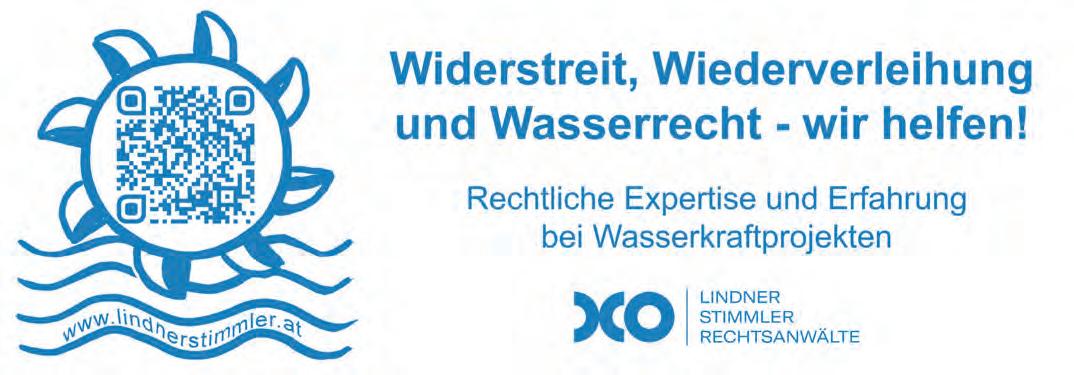
Es stimmt schon: Die drei wetterabhängigen Erneuerbaren Sonne, Wind und Wasser bekommen ihren „Treibstoff“ von der Natur geschenkt – übrigens eine Erinnerung daran, wie wertvoll unsere Erde ist und dass wir aus eigenem Interesse eine Schützensverpflichtung haben. Und noch etwas der Ordnung halber: Auch Wasser- ebenso wie Windenergie ist Sonnenenergie – eben indirekt.
Aber zurück zum Wasser: jeder Wasserkraftbetreiber kennt die leidvolle Erfahrung eines trockenen Jahres und die Freuden eines nassen Jahres – jedenfalls dann, wenn sich dieses nicht in Hochwässern ausdrückt. Wir nennen es die Hydraulizität, die schon 20-30% über oder unter dem Mittelwert schwanken kann. Schon die Bibel sprach von den sieben trockenen und nassen Jahren. Ganz falsch ist das sicher nicht.
Augenmerk auf die Hydrologie ist essentiell Neben den jährlichen Schwankungen gibt es aber auch eine längerfristige Entwicklung – vielleicht ein Trend, für dessen Beurteilung wir langjährige Beobachtungsreihen brauchen. Ich meine damit schon 20-30 Jahre. Für eine Technologie, die damit das Ende ihrer Lebenszeit schon erreicht hat, ist es weniger wichtig, aber ein Wasserkraftwerk „lebt“ eben sehr viel länger. Somit ist es schon in der Planungsphase mehr als wichtig, der Hydrologie größte Aufmerksamkeit zu widmen, anstatt viele Jahre später nutzlose Reue über eine schlampige Entscheidung hinsichtlich des Ausbaudurchflusses zu üben. Schauen Sie also ihrem Planer auf die Finger.
Und dann kommt der „Ausbaugrad“ eines Wasserkraftwerkes ins Spiel. Fachlich einwandfrei sollte die Entscheidung über den Ausbaudurchfluss das Ergebnis eines Optimierungsvorganges sein, der drei oder vielleicht auch vier Varianten einer Kosten-Nutzenanalyse unterzieht. Die Steigerung des Nutzens (Erzeugung) einer Anlage ist mit steigendem Ausbaudurchfluss stark degressiv. Die Entwicklung

der Kosten kann von leicht degressiv bis progressiv schwanken. Insbesondere die Kostenanalyse für verschiedene Varianten ist wirklich viel Arbeit und erfreut sich deshalb leider viel zu geringer Akzeptanz und wird daher oft auf die leichte Schulter genommen.
Je höher der Ausbaudurchfluss desto stärker der Einfluss der hydrologischen Schwankungen auf die jährliche Erzeugung. Ist also ein Kraftwerk auf einen sehr niedrigen Abfluss ausgelegt – so machten es unsere Vorfahren, die nur den Eigenbedarf abdecken wollten – fallen Abflussschwankungen kaum ins Gewicht. Allerdings geht auch ein großer Teil des Abflusses ungenutzt über die Wehranlage. Auch nicht gut. Deshalb die Notwenigkeit einer Optimierung, die genau jenen Wert ergibt, bei dem die erzeugte Kilowattstunde „am billigsten“ ist.
Theoretische Volllaststunden haben Aussagekraft Noch einen „Test“ möchte ich Ihnen mitgeben: Nehmen wir an, Sie wollen ein Kraftwerk kaufen und Sie wissen nichts über die Hydrologie des genutzten Gewässers, aber Sie kennen ein mittleres Jahresarbeitsvermögen und auch die Ausbauleistung des Kraftwerks. Wenn Sie die Jahresarbeit durch die Ausbauleistung dividieren – kWh/kW – erhalten sie die sogenannten „theoretischen Vollaststunden“. Ein sehr aufschlussreicher Wert. Liegt dieser zwischen 4000 und 5000, dann können Sie dem Geschäft etwas beruhigter nähertreten. Sind es nur 3000, würde ich die Finger davon lassen. Sind es 6000 oder mehr, dann steckt noch erhebliches Potential in dem Standort, das beispielsweise mit dem Einbau einer größeren Turbine aktiviert werden könnte. Die Kosten dafür könnten aber rasch „davonlaufen“.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer und Herbst und viel Freude mit der Wasserkraft.
Ihr Pelikan

Die Wirtschaftlichkeit eines Wasserkraftwerks hängt in hohem Maß vom Ausbaugrad ab. Experte Prof. Bernhard Pelikan rät daher dringend, diesen Punkt nicht aus dem Auge zu verlieren.

Im Herbst 2024 hat der Tiroler Kleinwasserkraftspezialist Geppert Hydro GmbH bei der Modernisierung des Kraftwerks Gihira seine Revitalisierungskompetenz in Ruanda unter Beweis gestellt. Der Auftrag fokussierte auf die grundlegende Sanierung zweier Francis-Turbinen, denen das sedimenthaltige Wasser aus dem Sebeya-Fluss stark zugesetzt hatte. Das RefurbishmentProgramm beinhaltete die Neuanfertigung von Maschinenkomponenten wie Laufrädern und Leitapparaten, aber auch die Komponenten für die kinematischen Leitapparatverstellung, die auf Kundenwunsch beibehalten wurde. Sämtliche wasserberührten Komponenten wurden mit Wolframcarbid beschichtet, um die Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß zu erhöhen. Zudem wurde das elektro- und leittechnische Equipment auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Trotz fehlender Zeichnungen und Dokumentationen vorausgegangener Sanierungen und der technischen Komplexität konnte die Revision innerhalb kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt werden.
Die Tiroler Wasserkraftallrounder der Geppert Hydro GmbH haben im Herbst des Vorjahres ihr jüngstes Revitalisierungsprojekt in Afrika erfolgreich abgeschlossen. Der Auftrag drehte sich um die maschinen- und regelungstechnische Modernisierung des Kraftwerks Gihira, das im Westen des Landes direkt an der Grenze zum Nachbarland Demokratische Republik Kongo Strom erzeugt. Der erste Kontakt zwischen Geppert Hydro und den Betreibern fand 2023 statt. Nach mehreren Abstimmungen und technischer Evaluierungen vor Ort erfolgte die Projektumsetzung schließlich im Herbst 2024.
Alte Technik am Ende
Beim Kraftwerk Gihira handelt es sich um ein klassisches Ausleitungskraftwerk, dessen Triebwasser aus dem Fluss Sebeya entnommen wird und durch eine stählerne, ca. 900 m lange Druckrohrleitung DN1200 zur Stromproduktion ins Maschinengebäude in der Nähe der Stadt Gisenyi gelangt. Die beiden
Francis-Turbinen nutzen eine Nettofallhöhe von 63,5 m und wurden für jeweils 1.600 l/s Ausbauwassermenge konzipiert,


Die hohe Sedimentfracht des Triebwassers hatte an den jahrezehntealten Maschinen deutliche Spuren hinterlassen.
womit diese unter Volllast 920 kW Engpassleistung erzielen. Über einen nahegelegenen Transformator wird der vom Kraftwerk erzeugte Strom hochgespannt und zur Gänze ins öffentliche Mittelspannungsnetz eingespeist. Der wesentliche Grund für den Sanierungsauftrag war laut Geppert Hydro-Projektleiter Jakob Kapeller der äußerst schlechte Zustand der beiden horizontalachsigen Francis-Turbinen, die seit 1984 für die Stromproduktion im Kraftwerk Gihira genutzt worden sind. Die Modernisierung der Anlage betraf neben der Revision der hydraulischen Maschinen auch die Erneuerung der elektro- und regelungstechnischen Ausrüstung. Dieser Projektabschnitt wurde von der Schwestergesellschaft Geppert Electric d.o.o., die im kroatischen Split ansässig ist, umgesetzt. Geppert Electric sorgte für die Anpassung der Turbinensteuerung, die Integration einer Fernwartungseinheit sowie allgemeine leittechnische Modernisierungen.
Komponenten von Grund auf neu gefertigt
Projektleiter Jakob Kapeller betont die herausfordernde Ausgangssituation, die sich bei der ersten Inspektion der Anlage darstellte: „Zentrale Teile der Maschinen, wie die Laufräder oder die Leitschaufeln, waren aufgrund von abrasivem Verschleiß, der auf das stark sandhaltige Wasser vor Ort rückzuführen ist, nur mehr rudimentär vorhanden. Was das Projekt zusätzlich erschwerte, waren nur unvollständige oder nicht mehr verlässliche Originaldokumente und Zeichnungen von den Maschinen. Zudem waren in der Vergangenheit von zwei


Die Maschinen wurden einer Komplettsanierung unterzogen.
verschiedenen Firmen Teilmodernisierungen durchgeführt worden, die ebenfalls nicht vollständig dokumentiert worden sind.“ Es galt also, ganz von vorne anzufangen. Um eine präzise Neukonstruktion zu ermöglichen, wurde von den Geppert Hydro-Fachkräften eine vollständige 3D-Vermessung aller relevanten Bauteile vor Ort durchgeführt. Dazu wurden die Maschinen vollständig demontiert, die innenliegenden Bauteile vermessen und im Anschluss wieder zusammengebaut. Diese aufwändig durchgeführten Maßaufnahmen bildeten schließlich das Grundgerüst für die exakte Rekonstruktion der Turbinenkomponenten durch die Tiroler.
Die Neuanfertigungen und Sanierungen umfassten die Laufräder, die Turbinendeckel, die Leitapparate samt Verstelleinrichtungen, die Labyrinth-Dichtungen, die Saugbögen und die turbinenseitigen Gleitlager. Der Projektleiter weist darauf hin, dass die Revision nicht auf eine Leistungssteigerung abzielte, sondern die optimale Erneuerung der verschlissenen Bauteile im Visier hatte: „Um eine möglichst lange Laufzeit sowie die Betriebssicherheit der Anlage zu gewährleisten, wurden die wasserberührten Teile der Turbinen, wie Laufräder, Leitschaufeln und Turbinendeckel, mit einer zusätzlichen Wolframcarbidschicht überzogen. Obwohl Schutzbeschichtungen einen etwas geringeren Wirkungsgrad bewirken können, haben die Tests bei der Wiederinbetriebnahme gezeigt, dass die ursprüngliche Leistung der Maschinen erhalten geblieben ist.“

An den wasserberührten Teilen wie Laufrädern und Leitschaufeln wurde eine zusätzliche Schutzbeschichtung aus Wolframcarbid aufgetragen. Komponenten nach der werksseitigen Erneuerung durch Geppert Hydro.
Kundenwunsch erfüllt
Eine weitere Herausforderung technischer Natur stellte Jakob Kapeller zufolge der spezifische Kundenwunsch dar, die bestehende Kinematik zur Verstellung des Leitapparats zu erhalten. Das erforderte eine individuelle Neukonstruktion aller zugehörigen Bauteile des Verstellmechanismus, um die Kompatibilität mit der vorhandenen Mechanik sicherzustellen. „Besonders anspruchsvoll war dabei die Tatsache, dass vor Ort keine Möglichkeiten für größere Anpassungsarbeiten bestanden. Unsere Konstrukteure entwickelten daher eine Lösung, bei der alle erforderlichen Einstellungen und Justierungen mithilfe einfacher Handwerkzeuge direkt am Einsatzort durchgeführt werden konnten – ohne aufwendiges Nacharbeiten oder Spezialausrüstung. Diese Herangehensweise ermöglichte eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme trotz der infrastrukturellen Einschränkungen und hat wesentlich zum Projekterfolg beigetragen“, so Jakob Kapeller. Unberührt von den durchgeführten Maßnahmen blieben die Spiralenkörper der Turbinen, die im unteren Teil fix einbetoniert sind. Auch an den beiden direkt gekoppelten Synchron-Generatoren mit jeweils 1.125 kVA Nennscheinleistung, die von den Turbinen mit 750 U/min angetrieben werden, waren keine Revisionsarbeiten notwendig.
Referenzprojekt erfolgreich beendet
Die umfassend revisionierten bzw. erneuerten Turbinenkomponenten wurden im Herbst des Vorjahres auf dem

Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Maschinen wurden wieder voll hergestellt.

Wasserweg vom slowenischen Hafen in Koper über die Straße von Gibraltar, vorbei am Horn von Afrika, zum Hafen nach Mombasa in Kenia geschickt, die restliche Strecke nach Ruanda ging es mit dem Lkw. Vor Ort durchgeführt wurde die exakt vorbereitete und geplante Montage von den Geppert-Fachkräften innerhalb weniger Wochen im Oktober 2024. Jakob Kapeller zeigt sich mit dem Ergebnis des Erneuerungsprojekts sehr zufrieden: „Trotz der schwierigen Ausgangslage mit den fehlenden Dokumentationen, des veralteten Anlagenzustands und der technischen
Komplexität konnte das Projekt erfolgreich und termingerecht abgeschlossen werden. Die modernisierte Anlage kann nun wieder über viele Jahre hinweg zuverlässig Strom erzeugen – ein sehr schönes Beispiel für nachhaltige Wasserkraftnutzung durch eine gezielte Revitalisierung von Geppert Hydro.“ Abschließend betont der Projektleiter, dass der afrikanische Markt weiterhin ein strategisch wichtiges Entwicklungsfeld für die Tiroler bleiben wird. Aktuell ist ein weiteres Kleinwasserkraftprojekt im Süden des Kontinents in Eswatini (vormals Swasiland) in der Umsetzung.


Die neue Wasserfassung des Kraftwerks Bondo wurde so robust gebaut, dass sie künftigen Murgängen und Lawinen widerstehen kann.
Knapp acht Jahre lang war das Wasserkraftwerk Bondo im Schweizer Bergell nach dem verheerenden Bergsturz vom August 2017 stillgestanden. Durch die gewaltigen Murgänge war die Wasserfassung Prä zur Gänze verschüttet worden, die Wasserzufuhr war zum Kraftwerk dauerhaft abgeschnitten. Eine Wiederinbetriebnahme sollte sich letztlich auf Basis einer grundlegenden Neukonzeption des Fassungsbauwerks realisieren lassen. Um auch dem Risiko zukünftiger Naturgefahren gewachsen zu sein, hat der Betreiber ewz - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich nun eine hochrobuste, an die extremen Standortgegebenheiten angepasste Fassung entwickelt. Baulich wurde sie unter äußerst herausfordernden Bedingungen umgesetzt – und dies mit Erfolg. Seit Anfang Mai dieses Jahres produziert das Kraftwerk wieder sauberen Strom, im Regeljahr rund 18 Gigawattstunden.
Am Vormittag des 23. August 2017 brachen rund drei Millionen Kubikmeter Gestein aus der Nordflanke des Piz Cengalo und stürzten ins Graubündner Bondasca-Tal. Wie man aus der späteren Rekonstruktion der Ereignisse feststellte, trafen die Schutt- und Geröllmassen auf ihrem Weg in die Tiefe auf einen kleinen darunterliegenden Gletscher, dessen Eis unter dem Druck des Gesteinsmaterials zermalmt wurde und blitzschnell schmolz. Die daraus entstehende Masse aus Eis, Schlamm, Schutt und Geröll bildete eine gewaltige Mure, die sich in der Folge ihren Weg entlang der Bondasca talwärts bahnte. Bis zu 100 Meter breit wälzte sich der Schuttstrom durch das enge Gebirgstal. Die Folgen für das 200-Einwohner-Dorf Bondo blieben nur deshalb im überschaubaren Rahmen, weil man nach einem ersten, kleineren Bergsturz im Jahr 2011 zu diesem Zweck ein Auffangbecken im Flusstal gebaut hatte, das sich in dieser Situation bewähren sollte. Weniger glimpflich verlief die Naturkatastrophe allerdings für das Kraftwerk Bondo, dessen Wasserfassung Prä auf rund 1.100 m Seehöhe meterhoch von der Mure verschüttet wurde. Das Kraftwerk war außer Betrieb. „Es herrschte damals Ausnahmezustand. Und wir waren entsprechend unsicher, wie es weitergehen konnte. Klar war nur, dass
das Kraftwerk ohne Triebwasser stillstehen musste – und wir warten mussten, bis wir uns einen Überblick über den Zustand der Wasserfassung verschaffen konnten“, erzählt der Leiter der Kraftwerke Bergell, Andres Fasciati. Dass sich das noch über Jahre hinziehen würde, konnte er nicht ahnen.
Was tun mit der verschütteten Fassung?
Was jedoch sehr bald offensichtlich war: Sowohl das Krafthaus in Bondo mit der elektromechanischen und steuerungstechnischen Einrichtung als auch der gesamte Kraftabstieg, bestehend aus dem 700 Meter langen Druckstollen und der Druckrohrleitung, waren von den Verwüstungen der Mure zur Gänze verschont und völlig intakt geblieben. Das Problem war nur die Wasserfassung. Aber wie man selbige wiederherstellen könnte, darüber standen zunächst noch große Fragezeichen. Schließlich blieb das Bondasca-Tal aus sicherheitsrelevanten Überlegungen gesperrt. Zu instabil die angehäuften Schuttmassen. Ein erster wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Zugänglichkeit zum Standort der Wasserfassung erfolgte 2021 mit der Inbetriebnahme einer neuen Brücke, die von der Gemeinde errichtet worden war. „2022 konnten erstmalig
spezialisierte Ingenieurteams mit der Untersuchung und Sondierung des alten Fassungsstandorts beginnen. Was sich dabei sehr schnell offenbarte: Eine provisorische Instandsetzung war aufgrund der geologischen Risken völlig ausgeschlossen. Es brauchte ein umfassendes Neukonzept“, erklärt Andres Fasciati. Ein solches sollte das Bündner Ingenieurbüro Deplazes liefern, das zuvor schon mit der Ausarbeitung von möglichen Varianten für die Freilegung und Wiederinbetriebnahme der Fassung sowie danach mit der Entwicklung eines Vorprojekts für eine neue Fassungsanlage betraut wurde. Doch ein völliger Neubau der Fassung stellte verständlicher Weise auch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Für das ewz als Betreiber eine schwierige Abwägung. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Strompreise relativ tief, sodass keineswegs davon auszugehen war, dass die Stadt Zürich, in deren Eigentum die ewz steht, einer hohen Investition zustimmen würde. Die Wirtschaftlichkeit stand an der Kippe. Umso vorteilhafter erwies es sich letztlich für das Projekt, dass Anfang 2023 das Thema Stromknappheit im Raum stand. Vor diesem Hintergrund gab es von politischer Seite schließlich grünes Licht für das Neubauprojekt“, erinnert sich der Leiter der Kraftwerke Bergell. Ein Ausführungsprojekt und anschließende Ausschreibungen konnten umgehend in Auftrag gegeben werden.
Eine Anlage, die Muren widerstehen kann Für die neue Wasserfassung sollte ein vollkommen neu entwickeltes Konzept zur Anwendung kommen, das zwei zentrale Zielsetzungen verfolgt: Erstens sollte maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Murgängen, Hochwasserereignissen oder Lawinen erreicht werden. Und zweitens sollte die Anlage so gebaut werden, dass sie im Fall einer erneuten teilweisen Zerstörung relativ einfach wiederhergestellt werden kann. Um dies zu erreichen, planten die Verantwortlichen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Deplazes eine flach und kompakt ausgeführte Konstruktion mit bis zu 60 Zentimeter starken Stahlbetonwänden und Decken, die im Wesentlichen aus einem Tiroler Rechen mit einem spülbaren Kiesfang und einem anschließenden gedeckten Coanda-Rechen mit einem ebenfalls gedeckten Auslaufkanal besteht. Die funktionellen Komponenten sind zum größten Teil unterirdisch untergebracht. Errichtet werden sollte das ganze System auf den Fundamentresten der alten Anlage, deren Betonstrukturen als teilweise intakt befunden worden waren. Im oberen Bereich wurde ein völlig neuer Einlauftrichter konzipiert. Im Inneren des Fassungsbauwerks sollte ein innova-


Die alte Wasserfassung war nach den massiven Murgängen von 2017 meterhoch verschüttet. 2022 begannen erste Sondierungsmaßnahmen.
tives, dreistufiges Sedimentmanagement verwirklicht werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Spülkammern mit integrierten, vollautomatisierten Spülleitungen geplant. Diese sorgen für einen effizienten und kontinuierlichen Sandaustrag. Im Anschluss – und das ist durchaus eine weitere Besonderheit der Anlage – wurde ein geschütztes, unterirdisches Coanda-System geplant, das vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal geliefert werden sollte. Damit werden am Ende auch sehr effektiv die Sandkörner > 0.6 mm sowie das Geschwemmsel abgeschieden und landen im Auslaufkanal, von wo sie zurück in die Bondasca gespült werden. Der verbliebene Feinsand wird im bereits bestehenden, rund 30 m langen Entsander, welcher in einer Felskaverne erstellt wurde, ausgeschieden. Der Entsander bildet somit die vierte Stufe des Sedimentsmanagements der Fassungsanlage Prä. Da mit einer teilweisen Eindeckung des Flusslaufs unterhalb der Fassung gerechnet werden muss, musste der bestehende Spülkanal des Entsanders durch ein 96 m langes Bohrloch durch den Fels ersetzt werden. Dieses leitet das Spülwasser des im Sandfang eingebauten Sandabzugsrohrs der Firma Wild Metal rund 150 m unterhalb der Fassung in die Bondasca.
Mure sorgt für massive Verzögerung
Im Juli 2023 fuhren erstmalig wieder Bagger in Prä auf, die Umsetzung des Bauvorhabens konnte beginnen. In der Folge waren die Arbeiten generell geprägt von den geologischen Unsicherheiten, schwierigen Witterungsverhältnissen und hohem Zeitdruck. Doch erneut war es ein massiver Murgang, der den Kraftwerksbetreibern und dem beauftragten Bauunternehmen


heftiges Kopfzerbrechen bereiten sollte. Eine weitere Naturkatastrophe mit gravierenden Folgen: „Die Arbeiten verliefen zunächst planmäßig bis zum August 2023. Gerade als wir den ersten Magerbeton setzen wollten, überraschte uns eine gewaltige Mure, die das gesamte Baufeld verschüttete und bereits errichtete Strukturen teils erheblich beschädigte. Die Schäden waren massiv und warfen das Projekt um Monate zurück“, erinnert sich der Leiter für den Bereich bauliche Kraftwerksinstandhaltung Graubünden, Peter Jörimann, der das Bauprojekt verantwortlich leitete. Wie Jörimann betont, seien bis Dezember 2023 sämtliche Kapazitäten auf die Instandsetzung konzentriert gewesen – das bedeutete vor allem die mühsame Entfernung der Schuttmassen und die Wiederherstellung der provisorischen Bachumleitung, bei welcher das Wasser der Bondasca in zwei großen Rohren unter der Baustelle hindurch geleitet wurde. Erst Ende Januar 2024 konnten die eigentlichen Bauarbeiten unter günstigen Witterungsbedingungen – mit ungewöhnlich wenig Schnee – wieder aufgenommen werden. Dass die Baustelle gegen Naturereignisse versichert war, erwies sich als entscheidend: Zwar gestalteten sich die Verhandlungen mit der Versicherung zäh, doch die Auszahlung war für den Weiterbau unverzichtbar.

Bauen unter massivem Gefahrenpotenzial
Ein zentrales Element des gesamten Projekts bildete das Hochrisikomanagement bei den Bauarbeiten an der neuen Wasserfassung Prä, das alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellte. Die Baustelle lag tief eingeschnitten in einem engen Tal, unmittelbar in einem Bereich mit akuter Gefährdung durch Murgänge, Hochwasser und instabile Schuttmassen. Um die Sicherheit der Arbeiter in diesem exponierten Umfeld zu gewährleisten, wurde ein umfassendes Alarmsystem installiert, das auf bestehende Infrastrukturen der Gemeinde und des Kantons aufbaute. Pegelradar- und geologische Messsysteme – teils bis zu zwei Kilometer flussaufwärts – lieferten Echtzeitdaten zur Wasserführung und potenziellen Gefahrenlagen. „Sobald kritische Werte erreicht wurden, löste eine weithin hörbare Sirene aus – und innerhalb von zwei Minuten mussten alle Arbeiter ihre Position verlassen. Fluchtwege wurden im Vorfeld definiert und mit Notleitern gesichert. Für Maschinenführer galt: Bagger sofort stehen lassen, raus aus dem Gefahrenbereich. Die Einsatzfähigkeit des Systems wurde regelmäßig geübt, ergänzt durch tägliche Lagebeurteilungen eines externen Sicherheitsexperten, der bei erhöhter Lawinen- oder Niederschlagsgefahr die



Arbeiten kurzfristig stoppte“, erläutert Andres Fasciati die zentralen Elemente des Sicherheitsmanagements. Ein SMS-Warnsystem hielt das Baustellenteam über aktuelle Gefahren- und Einsatzlagen auf dem Laufenden – insgesamt führten die Vorsichtsmaßnahmen zu rund 20 bis 25 Ausfalltagen, die jedoch konsequent zur Risikovermeidung genutzt wurden. Nicht zuletzt aufgrund dieses Maßnahmenpakets kann Andres Fasciati höchst positiv resümieren: „Wir sind glücklich, dass trotz der einen oder anderen Alarmsituation nichts Ernstes auf der Baustelle passiert ist.“
Ausgeklügeltes Sedimentmanagement im Untergrund Bereits beim alten Wasserkraftwerk zeigte sich, dass nicht unerhebliche Sandmengen ins Stollensystem gelangt waren und letztlich zu erhöhtem Verschleiß an den Turbinenlaufrädern geführt hatten. Um diesem Problem langfristig zu begegnen, wurde das Sedimentmanagement in der neuen Ausführung grundlegend auf neue Beine gestellt: Die Anlage verfügt heute über mehrere Spülkammern, wobei die erste als Kiesfang unterhalb des Tirolwehrs liegt, die zweite als Sandfang unterhalb des Coanda-Rechens und die dritte außerhalb der Fassung im Berg.
Diese Entsanderkammer war bereits vorhanden und wurde nun durch ein Spülsystem nach dem HSR-Prinzip ergänzt. Dadurch erfolgt die Spülung mit deutlich weniger Verlustwasser. Für die Ausleitung des Spülwassers wurde ein 90 Meter langes und 40 cm großes Loch in den Fels gebohrt.
Der integrierte Coanda-Rechen stellt dabei eine Besonderheit der neuen Fassung dar und spielt in der neuen Wasserfassung Prä eine zentrale Rolle im Sedimentmanagement. Zum Einsatz kommt dabei das innovative System „Grizzly Optimus“ des Südtiroler Stahlwasserbauspezialisten Wild Metal GmbH – ein nahezu wartungsfreies Schutzsieb, das ganz ohne Antrieb auskommt und sich durch seine hohe Betriebssicherheit und Effizienz auszeichnet. Das unterirdisch verbaute System umfasst 10 robuste Coanda-Rechen-Elemente mit einer Spaltweite von lediglich 0,6 mm. An den Feinrechen werden nicht nur feine Sedimente, sondern auch Laub, Nadeln, Holz und weiteres Geschwemmsel zuverlässig zurückgehalten. Größere Partikel werden dank des Coanda-Effekts am Eindringen gehindert und durch das Überwasser weitergespült. Der Einsatz des Grizzly Optimus macht aufwendige Rechenreiniger überflüssig und erlaubt eine kompaktere Auslegung der Sandfanganlage – ein
Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:
• Rechenreinigungsmaschinen
• Schützen & Stauklappen
• Rohrbrucheinrichtungen
• Einlaufrechen
• Komplette Wasserfassungssysteme
• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY









Der Generator aus 1958 wurde einem Retrofitprogramm unterzogen. Maschinenkonzept mit zwei gleichen Peltonturbinen auf einer Welle
klarer wirtschaftlicher Vorteil beim Bau und Betrieb. Wild Metal, mit über 700 erfolgreich ausgestatteten Wasserkraftwerken im Alpenraum, lieferte darüber hinaus das gesamte Stahlwasserbauequipment für die neue Wehranlage in Prä. „Womit uns die Firma Wild Metal vor allem auch überzeugt hat, war die Flexibilität in der Umsetzung und die wunderbare Gesprächsbasis, die ein ums andere Mal optimierte Lösungen ermöglichte“, lobt Peter Jörimann.
Retrofitprogramm für bestehenden Generator
Abseits der komplexen Bauarbeiten im Prä richtete sich der Fokus der Betreiber auch auf das elektromaschinelle Equipment in der Zentrale, das schließlich knapp acht Jahre stillgestanden hatte. „Ein derartig langer Stillstand bedeutet, dass man sich die Maschinen genau ansehen muss. Um etwa Kondensation am Generator zu vermeiden, haben wir dauerhaft für eine Beheizung des Maschinenhauses gesorgt“, erzählt Andres Fasciati und verweist darauf, dass man zur langfristigen Sicherung des
Kraftwerkstyp: Laufwasserkraftwerk
Betreiber: ewz
Standort der Fassung: Bondascatal, 1082 m ü. M.
Fassungstyp: Kombination Tiroler Wehr u. Coanda-Rechen
• Betriebswassermenge: 2,9 m³/s
• Bruttofallhöhe: 280 m
• Turbinen: Pelton
• Konfiguration: 2-düsig & 1-düsig auf 1 Welle
Installierte Nennleistung: 7 MW
Generator: synchron
Kraftabstieg: 700 m Stollen + Druckrohrleitung (Stahl)
Planung: Ingenieurbüro Deplazes
Bauliche Umsetzung: ARGE Costa & Ganzoni
Coanda & Stahlwasserbau: Wild Metal
• Coanda - Stababstand: 0.6 mm
• Jahreserzeugung: 18 GWh
• Inbetriebnahme: 1958 & 2025
Anlagenbetriebs bereits vor dem Stillstand eine Überholung des Generators geplant hatte. „Die Wicklung des bestehenden Generators stammte noch aus dem Jahr 1958, es war Zeit für ein Retrofitprogramm“, sagt Andres Fasciati. Für eine professionelle Sanierung wurde der Generator vollständig ausgebaut, neu gewickelt und mit neuen Polen versehen, während der Rotorstern erhalten blieb. Anfang Januar 2025 wurde der 20 Tonnen schwere Rotor mit millimetergenauer Präzision wieder in den Stator eingesetzt – nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein entscheidender Meilenstein des Projekts. Auch die Hauptwelle, auf der die beiden Laufräder und der zentral angeordnete Generator sitzen, wurde aufgrund von Verschleißerscheinungen komplett ersetzt. Nachdem ein Laufrad bereits vor circa zehn Jahren ausgetauscht wurde, folgte nun der Austausch des zweiten. Neben diesen Maschinenkomponenten wurden auch die drei Kugelschieber und die Einlaufrohre revisioniert, was vom eigenen Kraftwerks-Team des ewz in professioneller Weise durchgeführt wurde. Abgerundet wurden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Kraftwerks durch die Erneuerung des Korrosionsschutzes im Inneren der stählernen Druckrohrleitung.

Der Korrosionsschutz der bestehenden Druckrohrleitung wurde erneuert.
Optimierungen bringen verbesserte Performance
Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt des Modernisierungsprojekts betraf auch die teilweise Modernisierung der Steuerungssysteme, die ebenfalls von den Profis der ewz implementiert wurden. So konnten etwa die Pegelmessungen aus dem Sicherheitsmanagement, die von der Gemeinde Bondo installiert worden waren, nun in das Leitsystem integriert werden. „Wenn der Pegel steigt, dann schließen wir heute vollautomatisch unsere Wasserfassung“, so Andres Fasciati. „Die neue Steuerung ermöglicht auch automatisierte Spülvorgänge, natürlich abhängig von gewässerökologischer Unbedenklichkeit. Und außerdem einen flexiblen Betrieb zwischen Sommerflussund Winterstaukonfiguration.“
Generell zeigen sich die Projektverantwortlichen sehr zufrieden mit der Performance des „neuen“ Kleinwasserkraftwerks Bondo. „Dank der neuen Laufräder und dem neuen Generator sehen wir eine Wirkungsgradsteigerung von 2,7 bis 3 Prozent. Die zahlreichen Optimierungen haben sich also ausgezahlt“, so der Leiter der Kraftwerke Bergell.
Ein Bauprojekt mit hochalpinem Modellcharakter
Knapp 11 Millionen Franken hat das ewz in die Wiederherstellung und Modernisierung des Kraftwerks Bondo investiert. Anfang Mai konnte die Anlage trotz diverser unvorhergesehener Naturereignisse termingerecht in Betrieb genommen werden. Seitdem liefert sie wieder zuverlässig sauberen Strom für die Region südlich des Malojapasses. In Summe sind es durchschnittlich etwa 18 GWh – genug, um damit rund 7.000 Haushalte im Oberen Engadin mit grünem Strom zu versorgen. Mit der Erneuerung der Wasserfassung Prä in Bondo ist es dem ewz gelungen ein Modellprojekt umzusetzen, das exemplarisch aufzeigt, wie Wasserkraft-Infrastruktur in hochalpinen Risikozonen durch technologische Innovation, integrales Risikomanagement und ultrarobuste Bauweise langfristig gesichert werden kann. Trotz einer extrem diffizilen geologischen Ausgangslage hat man es geschafft, eine widerstandsfähige und zugleich ökonomisch wie ökologisch vertretbare Lösung zu schaffen. Die Erkenntnisse aus Bondo dürften künftig auch

anderen Projekten als Referenz dienen – besonders in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse und dem damit einhergehenden Anstieg von Naturgefahren in den Alpen. Das ewz bekräftigt mit dieser Investition sein langfristiges Engagement für die regionale Wasserkraft und setzt damit ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der erneuerbaren Stromproduktion unter zunehmend instabilen Klimabedingungen. Hinweis: Am 16. August 2025 lädt das ewz die interessierte Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür nach Bondo ein – mit Führungen durch die erneuerten Anlagen, Hintergrundgesprächen mit Fachleuten und Einblicken in das Herzstück eines modernen alpinen Wasserkraftwerks.

Die neue Wassserfassung Prä gilt heute als Musterbeispiel dafür, wie eine funktionelle Fassung auch in hochalpinen Risikozonen realisiert werden kann.

Nach den Revisionen können beim Kraftwerk Leipheim und den anderen Donaukraftwerken dank moderner Sensortechnologie Wasserstände und Durchflüsse in Echtzeit überwacht werden.
Ende 2024 wurde ein über zehn Jahre laufendes Revisionsprojekt der Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb einer Dekade wurden die sechs Wasserkraftwerke Gundelfingen, Offingen, Faimingen, Leipheim, Günzburg und Oberelchingen von der für die Betriebsführung zuständigen LEW AG auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Im Zentrum der umfangreichen Erneuerungen standen die maschinellen Revisionen der insgesamt zwölf Kaplan-Turbinen sowie die Modernisierung des regelungstechnischen Equipments. Eine wesentliche Optimierung des Kraftwerksverbunds stellt die nun vollautomatisch funktionierende Stauzielregelung an allen sechs Anlagenstandorten dar. In Summe investierte die ODK rund 22 Millionen Euro in die mustergültigen Revisionen ihrer Traditionskraftwerke.
Die sechs Laufwasserkraftwerke der ODK wurden zwischen 1960 und 1965 auf einem rund 35 Kilometer langen Abschnitt der Donau zwischen Ulm und Dillingen errichtet. Mit Ausnahme des Kraftwerks Faimingen, das auf eine Ausbauwassermenge von 240 m³/s ausgelegt wurde, nutzen die Anlagen Gundelfingen, Offingen, Leipheim, Günzburg und Oberelchingen jeweils 210 m³/s maximale Ausbauwassermenge für die saubere Stromproduktion. Bei der Errichtung der Kraftwerke, deren nutzbare Fallhöhe jeweils zwischen 5 und 6 m liegt, orientierten sich die Erbauer an einem identischen Funktionsprinzip. Alle Wehranlagen bestehen aus drei Wehrfeldern, die zur Stauhaltung mit Zugsegmenten und aufgesetzten Fischbauchklappen ausgerüstet sind. In den direkt neben den Wehranlagen angeordneten Maschinengebäuden befinden sich jeweils zwei doppeltregulierte Kaplan-Turbinen mit durchschnittlich 4,5 MW Engpassleistung in vertikalachsiger Bauweise mit direkt gekoppelten Synchron-Generatoren. Im Regeljahr erzeugt die ODK mit ihrem Anlagenverbund rund 280 GWh Ökostrom.


Anlieferung der neuen Niederspannungsverteilung
Weitreichendes Modernisierungspaket „Seit ihrem Bestehen wurden die mittlerweile über 60 Jahre alten Kraftwerke regelmäßigen Revisionen unterzogen“, erklärt Dr. Jörg Franke, der Technische Vorstand der ODK. 2014 startete schließlich ein weitreichendes Modernisierungsprojekt, bei dem die maschinelle Ausrüstung der Anlagen umfassend saniert bzw. erneuert werden sollte. Darüber hinaus wurde auch das elektro- und leittechnische Equipment der Kraftwerke auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. „Ein wichtiger Aspekt der Revisionen war zudem die Herstellung einer anlagenübergreifenden, vollautomatischen Stauzielregelung sowie die Einbindung der Anlagensteuerungen in die Zentralwarte der LEW, die für die Betriebsführung der Kraftwerke zuständig ist. Zudem wurde auch die Gebäudetechnik, wie Brandschutzanlagen oder Belüftungssysteme, erneuert.“ Jörg Franke betont, dass die Revisionen rein auf die Modernisierung der Kraftwerke abzielten: „Bei den durchgeführten Arbeiten handelte es sich nicht um Grundinstandsetzungen aufgrund von Schäden oder Baufälligkeiten. Die Kraftwerke waren schon zuvor in einem sicheren und ordentlichen Zustand, durch die umfassenden Maßnahmen wurde der moderne Stand der Technik hergestellt.“
Turbinen von Grund auf saniert Als Generalauftragnehmer für die Maschinenrevisionen an allen sechs Kraftwerken wurde die baden-württembergische Wiegert & Bähr Turbinen- und Stahlwasserbau GmbH engagiert, die ihrem Ruf als kompetenter Wasserkraftallrounder


Begutachtung von Laufradflügel und Wasserführungsschild
einmal mehr gerecht werden konnte. Der Auftrag umfasste im Wesentlichen die Revisionen der Leitapparate, der Wellenlagerungen sowie die Erneuerungen der hydraulischen Turbinenregler inklusive der Umbauten von Laufradverstellungen und neuer Hochdruckservomotoren. „Die Umfänge der durchgeführten Maßnahmen bei den jeweiligen Kraftwerken bzw. Turbinen waren jeweils etwas unterschiedlich. Grundsätzlich wurde bei allen Anlagen der hydraulische Raum entleert und die Maschinen individuell begutachtet. Nach der Inspektion wurde schließlich festgelegt, welche Maßnahmen durchgeführt werden“, so Jörg Franke. Zu den von Wiegert & Bähr umgesetzten Maßnahmen zählten die Überarbeitung der Laufradflügel und Leitschaufeln, die Inspektionen und Ausbesserungen der Laufradmäntel sowie die kompletten Anpassungen der Laufradservomotoren und der Einbau von hydraulischen Sicherheitslenkern an den Leitschaufeln. Zudem wurden die zuvor mechanisch ausgeführten Turbinenregler durch elektrohydraulische Varianten ersetzt und die Lagerungen der Maschinen überarbeitet. An den luftgekühlten Generatoren, die während der Revisionen ebenfalls auf ihre ordnungsgemäße Funktion hin überprüft wurden, waren keine Sanierungen notwendig, diese wurden lediglich einer gründlichen Reinigung unterzogen. Trotz der laufenden Sanierungen konnten die Kraftwerke fast ununterbrochen Strom produzieren – während eine Turbine revisioniert wurde, blieb die andere Maschine am Netz. Lediglich für die vorlaufenden Arbeiten zum Umbau der Elektrotechnik war jeweils eine ca. dreiwöchige Stilllegung der Anlagen notwendig.


Automatisierungsspezialisten am Zug
Den Zuschlag für die elektro- und leittechnischen Modernisierungen der Kraftwerke konnte sich der in Nordrhein-Westfalen ansässige Automatisierungsspezialist KIMA sichern. Neben der Erneuerung des regelungstechnischen Equipments, der vollständigen Neuprogrammierung der Steuerungssoftware und der Anbindung der Kraftwerke an die Zentralwarte der LEW zählte die Herstellung der nun vollautomatisch funktionierenden Stauzielregelungen und Turbinenregler an allen sechs Anlagen zum Leistungsumfang von KIMA. Eine in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel neu entwickelte übergeordnete Regelung mittels Vorhersagemodellen dient zur Vergleichmäßigung des Abflusses. Die Stauziele konnten zwar schon vor den Revisionen via Fernzugriff reguliert werden, allerdings mussten die dazu notwendigen Schritte manuell getätigt werden. Im Rahmen der Revisionsprojekte fanden außerdem innovative Feldversuche zur Notstromversorgung statt, an denen KIMA ebenfalls beteiligt war. Das von mehreren Projektpartnern und

Ausgediente Steuertafel beim Kraftwerk Oberelchingen. Im Hintergrund sieht man die Schaltschränke mit der modernen Maschinensteuerung.
Forschungseinrichtungen durchgeführte Projekt zeigte, dass mit einem inselbetriebsfähigen Wasserkraftwerk der Strombedarf kritischer Infrastrukturen bei einem großflächigen Blackout abgedeckt werden kann. Das Ziel war es, den Notstrombetrieb möglichst automatisiert und ohne zusätzlichen Personaleinsatz laufen zu lassen. Zudem konnte die Notstromversorgung per Fernsteuerung gestartet werden, ohne dass Mitarbeiter vor Ort sein mussten.
Aufwändige Projektkoordination
Der für den Bereich Elektrotechnik zuständige Christian Dellmann, Projektleiter LEW Wasserkraft GmbH, nennt die Koordination der vielen am Projekt beteiligten Unternehmen und Personen als eine zentrale Projektherausforderung: „Auch das Thema Hochwassersicherheit hatte oberste Priorität, denn während der Umbauarbeiten gab es immer wieder Hochwassersituationen. Bei diesen Ereignissen war es besonders wichtig, die Anlagen dichtzuhalten und keine Gefährdung auf-


Aktuell ist die ODK mit der Herstellung von Fischaufstiegsanlagen bei ihren Kraftwerken beschäftigt. Das Bild zeigt einen naturnah angelegten Abschnitt der Fischwanderhilfe beim Kraftwerk Gundelfingen.
kommen zu lassen – sowohl für das Personal, als auch für die elektromechanische Ausrüstung. Das Projekt fiel außerdem in die Zeit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Komplikationen. Schließlich kam auch noch der Kriegsausbruch in der Ukraine dazu, der erhebliche Auswirkungen auf die Preisentwicklung der benötigten Ausrüstung und Materialien hatte. Es ist den beteiligten Firmen und Unternehmen zu verdanken, dass das Projekt dennoch gut auf Kurs geblieben ist und trotz aller Widrigkeiten erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte.“
Revisionen machen sich bezahlt
Nach dem Projektabschluss hebt Jörg Franke die Vorteile der modernen Stauzielregelung hervor: „Die nicht einfach herzustellende automatische Stauzielregelung für alle sechs Anlagen im Verbund wurde vorbildlich umgesetzt. Da die Stauziele nicht mehr manuell, sondern vollautomatisch eingestellt werden, ist es nun möglich, dass die Maschinen in einem noch besseren Betriebspunkt gefahren werden können – somit könnten die Anlagen durchaus eine etwas erhöhte Stromausbeute generieren. Generell wurden durch die Modernisierungen ein erhöhter Bedienkomfort und weitaus mehr Möglich-
keiten zur Fernüberwachung geschaffen.“ Christian Dellmann zieht ebenfalls ein positives Resümee zum Projekt: „Es war sehr erfreulich, dass es während der zehn Jahre dauernden Umsetzung zu keinen schweren Arbeitsunfällen gekommen ist. In technischer Hinsicht konnte eine einheitliche Bedien- und Betriebsphilosophie an den Anlagen geschaffen werden, was für uns als Betriebsführer natürlich eine wichtige Thematik darstellt. Zudem stehen uns durch die digitale Technik nun wesentlich mehr Datenpunkte und Messwerte zur Verfügung. Dadurch entstanden Ansatzpunkte, um die Betriebsführung künftig möglicherweise mit Künstlicher Intelligenz zu verknüpfen.“ Neben den technischen Modernisierungen der Kraftwerksgruppe, die sich auf rund 22 Mio. Euro summierten, investiert die ODK zudem kräftig in die ökologische Verträglichkeit ihrer Kraftwerke. Nachdem beim Kraftwerk Gundelfingen bereits im Sommer 2023 eine neue Fischaufstiegsanlage in Betrieb gegangen ist, wird 2025 noch die Fischdurchgängigkeit beim Kraftwerk Faimingen hergestellt werden. Bei den anderen Donaukraftwerken werden die Fischaufstiegsanlagen in den kommenden Jahren in die Realität umgesetzt werden. Für diese sechs Bauprojekte nimmt die ODK rund 23 Mio. Euro in die Hand.


Mit der Planung von Projekten im Bereich der Energiewirtschaft hat sich das steirische Planungsbüro PI Mitterfellner GmbH in Österreich und darüber hinaus einen Namen gemacht. Heuer feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Bestandsjubiläum und blickt dabei auf eine spannende Firmenhistorie zurück. Mehr als 1.500 erfolgreiche Projekte für mehr als 500 Kunden vor allem in den Bereichen Wasserkraft, aber auch Aquakultur und Photovoltaik zeugen von Know-how, Weitblick und einem durchwegs positiven Mindset. Im Interview mit zek HYDRO nimmt Firmengründer und Geschäftsführer DI Helmut Mitterfellner nicht nur zu den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Wasserkraft Stellung, sondern analysiert darüber hinaus, was sich im Hinblick auf seine planerische Tätigkeit verändert hat – und erklärt, warum die Freude an der Arbeit der Schlüssel für einen guten Teamspirit und eine erfolgreiche Personalführung ist.
zek: Herr Mitterfellner, Ihr Planungsbüro feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Was hat sich für Ihre Arbeit am meisten verändert, wenn Sie an die Anfänge zurückdenken?
Mitterfellner: In erster Linie die Komplexität der Projekte – und damit auch unsere Werkzeuge. Früher reichte oft ein Flipchart. Heute nutzen wir spezielle Projektmanagement-Software, um Abläufe, Logistik und Zuteilungen zu koordinieren. Auch die Planungsdaten sind viel detaillierter geworden, etwa durch numerische Modellierung und KI-gestützte Auswertungen.
zek: Ihr Büro hat an über 1.500 Projekten mitgearbeitet – vom Wasserkraftwerk bis zur Aquakultur. Wo liegen aktuell die Schwerpunkte?
Mitterfellner: Das ist unverändert. Nach wie vor bilden die Wasserkraft, ergänzt durch Photovoltaik und Aquakultur, unseren Schwerpunktbereich. Neu hinzuge-
kommen ist das Thema „Energiegemeinschaften“, das viele Vorteile bieten kann – sowohl für den Betreiber, einen guten Preis für seinen Strom zu bekommen, als auch für den Abnehmer, der in der Regel einen deutlich günstigeren Preis bekommt, als ihn große Stromkonzerne anbieten. Unserer Erfahrung nach können Energiegemeinschaften zu einer echten Win-Win-Situation führen. Besonders vorteilhaft sind sie, wenn darin neben Photovoltaik auch Kleinwasserkraftwerke inkludiert sind. Damit kann der Betreiber Strom stabil einspeisen, und das Ganze unterliegt keiner hohen Volatilität. Mit den geplanten Reformen soll der bislang noch kritisierte bürokratische Aufwand nun auch rückgebaut werden. zek: Wie sehen Sie generell die Rolle der Kleinwasserkraft in der Energiewende?
Mitterfellner: Vorrangig muss man festhalten, dass Kleinwasserkraftwerke zuverlässig Grundlast liefern. Wenn ich
mir unsere Photovoltaik-Anlage anschaue, die nur an rund 1.100 Stunden im Jahr Strom liefert, und dann mit unserem Wasserkraftwerk vergleiche, das im Jahr auf eine Betriebszeit von 8.760 Stunden kommt, ist eigentlich schon alles gesagt. zek: Wird das Thema Revitalisierung von Kraftwerken bedeutender?
Mitterfellner: Das Thema Revitalisierung bei Kleinkraftwerken war schon vor fünf Jahren wichtig – und ist es auch heute noch. Viele Bestandsanlagen lassen sich mit neuen Methoden und neuen Maschinen effizienter machen. Aber das heißt nicht, dass es keine interessanten Neuprojekte mehr gibt. Gerade RED III hat durch die Stärkung des öffentlichen Interesses für Ökostromanlagen für einen neuen Schub gesorgt. Wir arbeiten aktuell an einigen Neuprojekten.
zek: Stichwort Digitalisierung: Sie haben mit KWKW.opt® ein eigenes Software-
tool zur Optimierung von Kraftwerken entwickelt, das für viel Aufsehen in der Branche gesorgt hat: Wie wird es eingesetzt und welche Vorteile bietet es?
Mitterfellner: Wir haben mit der Entwicklung von KWKW.opt® bereits 2008 begonnen, um die Energieeffizienz von Kraftwerken zu optimieren. Ein Tool, das sich sehr bewährt hat. Nicht nur dass wir damit weit über 340 Kleinkraftwerke berechnet haben: Es ist zudem auch ein sehr gutes Prüfinstrument für behördliche Zwecke, um über die Viertelstunden-Erzeugungsdaten auf den Turbinendurchfluss und damit auch auf die erforderliche Restwasserdotation rückrechnen zu können.
zek: Hat sich das KWKW.opt® verändert, sprich kann es heute mehr als noch vor zehn, fünfzehn Jahren?
Mitterfellner: Ja, ganz klar. Im Grunde hat es sich zu einer Art „Black Box“ entwickelt. Es wird als Smart Sensor in die Anlage implementiert und kann – unabhängig vom jeweiligen Steuerungssystem – sämtliche relevanten Daten auslesen und auf einen Server transferieren. Es sammelt Betriebsdaten, analysiert Leistung und erstellt automatisierte Berichte. Damit können Betreiber etwa auf einen Blick erkennen, ob ihre Anlage wirtschaftlich läuft oder nicht. Besonders spannend sind Trendanalysen, an denen man schnell erkennt, ob sich gegebenenfalls negative Trends abzeichnen –ein wichtiger Schritt in Richtung vorausschauender Instandhaltung.
zek: Wohin soll die Reise mit dem KWKW. opt® gehen? Ist das absehbar?

Mitterfellner: Aktuell arbeiten wir daran, es zu einer Art KI-Betriebsleiter zu machen, das den Betreuer der Anlage sehr einfach und intuitiv unterstützt. Konkret soll ein Ampelsystem kommen, das ganz simpel aufgebaut ist: Steht die Ampel auf Grün, ist kein Eingreifen notwendig, steht sie auf Orange, ist ein Nachsehen vor Ort angeraten – und leuchtet Rot, dann heißt es: Anlage abstellen. Das lässt sich ganz einfach für jedes Kraftwerk nachrüsten.
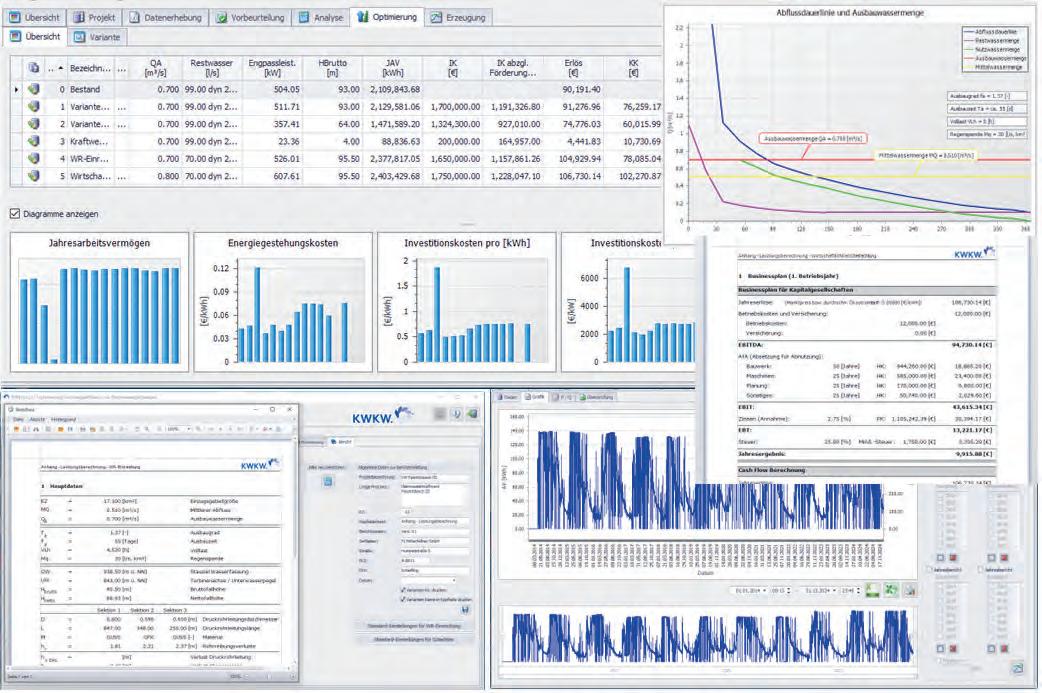
Das Software-Tool KWKW.opt® wurde vom Ingenieurbüro PI Mitterfellner GmbH über Jahre hinweg entwickelt und dient prinzipiell der Optimierung der Energieeffizienz von Wasserkraftwerken. Aktuell wird es in Richtung eines „KI-Betriebsmanagers“ ausgebaut.
zek: Ist das System für einzelne Anlagen konzipiert, oder doch eher für Betreiber von mehreren Kraftwerken?
Mitterfellner: Sowohl als auch: Gerade wenn ein Betreiber über mehrere Kraftwerke verfügt, kann er mittels KWKW. opt® das Zusammenspiel seiner Anlagen in energiewirtschaftlicher Sicht optimieren – oder auch im Hinblick auf ein Schwall-Sunk-Problem. Speziell für jene ist es interessant, deren Kraftwerke an größeren Flüssen noch nicht mit den Ober- und Unterliegern kommunizieren – sprich keine klar koordinierte übergeordnete Regelung haben.
zek: Für Aufsehen haben auch die von Euch entwickelten Wasserräder gesorgt, speziell jene aus Carbon: Habt Ihr diese Richtung weiterverfolgt?
Mitterfellner: Eigentlich nicht. Wir hatten Anfragen, eine sogar aus England, aber grundsätzlich müssen wir einräumen: Der Werkstoff Carbon ist zu teuer, als dass er sich bei dieser Anwendung wirtschaftlich darstellen lässt. Und wenn ich ein 4 Meter großes Wasserrad aus Stahl in Vorarlberg installieren möchte, zahlt es sich nicht aus, es hier schweißen zu lassen – und es vielleicht für den Transport dann noch einmal aufzutrennen. Da sind wir an dem Punkt gelangt, an dem wir sagen: Wir machen euch die Zeichnung und ihr baut das Wasserrad selbst vor Ort. Die Wasserkrafttechnologie ist
ja eine sehr alte, da kann man nicht mehr viel an Wirkungsgrad rausholen.
zek: Die Wasserkraft ist ein komplexes Feld: Wie wichtig ist es, gute Netzwerkpartner zu haben?
Mitterfellner: Extrem wichtig. Heute braucht man Ökologen, Geologen, Juristen, Statiker, Maschinenbauer, Elektrotechniker, Stahlwasserbauer und einige andere mehr. Entscheidend dabei ist: Komplexe Vorhaben lassen sich nur mit einem starken Netzwerk aus Experten umsetzen. Zum Glück können wir auf ein tolles Netzwerk zurückgreifen. Als Planer musst du die Sprache sprechen, die jeder versteht – und du selbst musst ebenfalls jeden der Spezialisten verstehen. Auch wenn das etwas abgehoben klingen sollte: Aber als Planer steht man an der Spitze einer Pyramide, die von vielen Fachleuten getragen wird.
zek: Man sollte als Planer dann zumindest Wesentliches aus all diesen Fachgebieten verstehen, oder?
Mitterfellner: Ja, denn nur so kann ich abschätzen: Arbeitet mein Partner auf diesem oder jenem Feld gut. Denn letzten Endes fällt die Summe der gesamten Arbeiten auf das Planungsbüro zurück. Als Beispiel kann ich nur die Kooperation mit den uns vertrauten Ökologen anführen, die uns sehr klar und ohne ideologische Scheuklappen jene Bandbreite abstecken, die das Gesetz erlaubt und in dem wir uns planerisch bewegen können. Das funktioniert hervorragend.

Die Entwicklung eigener Carbon-Wasserräder zeigt vor allem eines: Helmut Mitterfellner und sein Team sind fachlich sehr breit aufgestellt.

PI Mitterfellner GmbH – Planung mit Verantwortung und Erfahrung
Das Ingenieur- und Sachverständigenbüro PI Mitterfellner GmbH mit Sitz in Scheifling (Steiermark) feiert 2025 sein 20-jähriges Bestehen – und zählt heute zu den ersten Adressen, wenn es um technische, planerische oder konzessionsrechtliche Fragen rund um Wasserkraft und Energie geht. Über 1.500 Projekte in Österreich und darüber hinaus belegen eindrucksvoll die Bandbreite des Unternehmens, das sich nicht zuletzt durch Fachwissen, Engagement und Verlässlichkeit einen Namen gemacht hat.
Der Grundstein wurde früh gelegt: Nach dem Diplomstudium an der TU Graz, Berufserfahrung in Linz und ersten intensiven „Lehrjahren“ in einem steirischen Planungsteam gründete DI Helmut Mitterfellner 2005 sein eigenes Büro – zunächst noch gemeinsam geführt, später in Eigenregie. Als Standort wählte er bewusst die Gemeinde Scheifling im Bezirk Murau – strategisch ideal zwischen Graz, Salzburg, Wien und Klagenfurt gelegen. Wie sich bald zeigte, war das auch geographisch ein kluger Schachzug: Die Obersteiermark wurde in den Folgejahren zum Hotspot der Kleinwasserkraft in Österreich. Nirgendwo sonst wurden mehr Projekte realisiert – viele davon mit Beteiligung der PI Mitterfellner GmbH.
Insgesamt hat das Unternehmen über 100 Wasserkraftwerke von der Idee bis zur Inbetriebnahme begleitet – hinzu kommen zahllose Gutachten, wasserrechtliche Verfahren, Einreichungen und Teilleistungen. Die Zahlen sprechen für sich: 1.500 Projekte, über 130 GWh Ökostrom – und nach interner Statistik auch 60.000 Tassen Kaffee.
Neben der breiten Projektpalette beeindruckt auch die hochkarätige Kundenliste: Vom Verbund über die KELAG, Raiffeisen, die Steiermärkische Sparkasse, WienEnergie, die ÖBB bis zu zahlreichen regionalen Kraftwerksbetreibern und Investoren reicht das Spektrum. Für viele Kunden ist PI Mitterfellner nicht nur ein technischer Dienstleister – sondern ein langjähriger, verlässlicher Partner, oft sogar über viele Projekte hinweg.
Inhaltlich liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Wasserkraft, ergänzt um Photovoltaik, Aquakulturen, Trinkwasser- und Siedlungswasserbau. Unterstützt wird die Arbeit durch ein interdisziplinäres Team aus Bau-, Maschinenbau-, Elektrotechnik- und Softwareingenieuren sowie einem über Jahre gewachsenen Netzwerk an externen Fachleuten – von Ökologen bis Juristen.
Nicht zuletzt bringt Firmengründer DI Mitterfellner auch seine Expertise als gerichtlich beeidigter Sachverständiger ein – sowohl national als auch im Rahmen einer Personenzertifizierung auf europäischer Ebene. Auch das gehört zum Selbstverständnis des Unternehmens: fundiertes Know-how, gekoppelt mit Bodenständigkeit und Weitblick.
Die Projekte der PI Mitterfellner GmbH tragen entscheidend zur regionalen Energieautarkie, zur ökologischen Aufwertung bestehender Standorte und zur wirtschaftlichen Nutzung erneuerbarer Ressourcen bei. In einer Zeit, in der Energiefragen zunehmend auch Gesellschaftsfragen sind, bleibt das Büro aus Scheifling ein Kompetenzzentrum mit Haltung – und das wohl auch in den nächsten 20 Jahren.
zek: Ist es denn schon einmal passiert, dass Ihr ein Projekt bei den Behörden nicht durchgebracht habt?
Mitterfellner: Nein, bisher noch nicht. Das hat viel damit zu tun, dass wir im Vorfeld versuchen, maximale Transparenz herzustellen und alle Stakeholder ins Boot zu holen. Das hilft immens.
zek: Ist es schwierig, mehrere Projekte gleichzeitig abzuwickeln?
Mitterfellner: Ja, da kommt schon einiges zusammen. Für mich ist klar: Wenn man als Planer heute nicht Ordnung am Computer und Ordnung im Kopf hat, wird es schwierig.
zek: Wo stehen Sie generell, wenn es um den Meinungsstreit zwischen den Befürwortern des Wasserkraftausbaus und den strikten Bewahrern der Fließgewässer geht?
Mitterfellner: Da schlagen bei mir tatsächlich zwei Herzen in einer Brust. Natürlich bin ich ein Fan der Wasserkraft, aber als leidenschaftlicher Kajakfahrer bin ich mir sehr wohl bewusst, dass Fließstrecken ohne Kraftwerke erhalten bleiben sollten. Und ganz ehrlich: Wenn man sich manche touristisch hoch genutzten Kajak-Strecken anschaut – dann ist auch klar: Hier wird mehr Umsatz lukriert, als ein Kleinkraftwerk erwirtschaften könnte.
zek: Kommen wir zu Eurer Tätigkeit im Ausland: Ihr habt in den letzten Jahren Eure Visitenkarte in Ländern wie Rumänien, Aserbaidschan, Tadschikistan oder Papua Neuguinea abgegeben. Habt Ihr Eure internationalen Aktivitäten zuletzt weiter ausgebaut?
Mitterfellner: Eigentlich nicht. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir mit den Aufträgen aus Österreich sehr gut ausgelastet sind. Und – was auch sehr wichtig ist – wir arbeiten sehr gerne hier in der Steiermark, wo wir einfach eine sehr hohe Lebensqualität genießen. Lange

Auslandsaufenthalte sind nicht nur organisatorisch aufwendig, sondern auch nicht sehr familienfreundlich.
zek: Das heißt: Arbeit muss auch Spaß machen?
Mitterfellner: Absolut: Wir stehen ja lange im Berufsleben, da sollte die Arbeit schon Freude machen. Insofern wird dieser Punkt bei uns im Team auch großgeschrieben.
zek: Stichwort Team: Fachkräftemangel ist ja allgegenwärtig. Wie gelingt es Ihnen, Mitarbeiter langfristig zu halten?
Mitterfellner: Ich setze auf Vertrauen, Wertschätzung und Beteiligung. Jeder fährt ein Firmenauto oder nutzt das Bike-Leasing. Wir haben in den letzten Jahren unser Team um drei weitere Mit-
arbeiter aufgestockt, haben inzwischen auch einen Lehrling, der sich sehr gut schlägt. Meine Grundidee war immer: Die Firma ist für die Mitarbeiter da. Durch gezielte Aus- und Weiterbildung steigt auch der Wert jedes und jeder Einzelnen – Erfahrung ist eine wertvolle Ressource. zek: Abschließend: Gibt es ein Leitbild, das Sie als Unternehmer begleitet?
Mitterfellner: Familienfreundlichkeit, Innovationsoffenheit und Bodenständigkeit. Wir wissen, was wir können – und was nicht. Persönlich orientiere ich mich gern an der Philosophie des Stoizismus: Wahrhaftigkeit, Tugend und das Bewusstsein für das Wesentliche. Das hat mich in der Vergangenheit sehr gut begleitet. zek: Vielen Dank für das Gespräch!


Wasserkraftwerk Shirayama in Japan – die modernisierte Anlage mit offenem Triebwasserkanal und harmonischer Einbindung in die Umgebung.
Im Westen Japans, dort wo die natürlichen Kräfte des Hakusan-Nationalparks auf jahrhundertealte Ingenieurskunst treffen, wurde im Juni 2025 ein bedeutender Meilenstein für eine nachhaltige und zukunftssichere Wasserkraftnutzung erreicht. Im Einklang mit der Umwelt, dem baulichen Bestand und dem kulturellen Kontext wurde das Wasserkraftwerk Shirayama am Fluss Tedori umfassend modernisiert. Mit dem Fokus auf ökologische Verantwortung, regionale Wertschöpfung und technische Präzision haben Voith, Fuji Electric und Hokuriku Electric Power Company ein starkes Signal für eine nachhaltige Energiezukunft in der ostasiatischen Region gesetzt.
Mit Ursprung im Hakusan-Gebirge spielt der Tedori-Fluss seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle in der Energieversorgung der Region – und hat gleichzeitig die Landschaft nachhaltig geprägt. Sein hoher Sedimentgehalt, seine wechselhaften Abflussmengen und die markante Topografie stellen besondere Anforderungen an wasserbauliche Projekte. Am Standort Shirayama, eingebettet in diese anspruchsvolle Flusslandschaft, wurde ein bestehendes Kleinkraftwerk unter sorgfältiger Berücksichtigung hydrologischer, ökologischer und baulicher Gegebenheiten modernisiert. Die neue Turbine – eine vertikale semispiralförmige Kaplan – wurde in das bestehende Krafthaus integriert und bildet den Kern eines technisch wie funktional neu konzipierten Systems, das sich harmonisch in das Bestandsbauwerk einfügt.
Die Region rund um Shirayama, traditionell geprägt von Handwerk, Leichtindustrie und einem tief verwurzelten Naturbewusstsein, verfolgt mit Nachdruck die ambitionierten Klimaziele der japanischen Energiepolitik. Mit dem klaren Ziel der CO 2 -Neutralität bis 2050 stellt Hokuriku Electric Power seine Weichen für eine klimafreundliche Energiezukunft – durch innovative Technologien und die Weiterentwicklung bestehender Infrastruktur.
Umsetzung mit Fingerspitzengefühl
Die Umsetzung des Projekts Shirayama erfolgte im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation zwischen den Projektteams von Voith, Fuji Electric und dem Endkunden Hokuriku Electric Power Company. Bereits in der Planungsphase wurden die technischen, regulatorischen und kulturellen Anforderungen in regelmäßigen Abstimmungen gemeinsam analysiert und in das Projektkonzept integriert.
Im Verlauf der Entwicklung erwies sich insbesondere die Berücksichtigung marktspezifischer Anforderungen in Japan –etwa hinsichtlich Redundanzvorgaben, Umweltverträglichkeit und Fertigungstoleranzen – als komplexe Schnittstelle zwischen Konstruktion, Qualitätssicherung und Umsetzung.
„Präzision, klare Abläufe, Respekt vor Prozessen und ein gemeinsames Verständnis für technische sowie kulturübergreifende Anforderungen – Shirayama war kein Standardprojekt. Die Kombination aus begrenztem Bauraum, hohen Qualitätsansprüchen und interkultureller Abstimmung machte es zu einer anspruchsvollen, durchgehend lösungsorientierten und zugleich bereichernden Zusammenarbeit“, so Michael Grassmann, Projektleiter Voith Hydro Österreich.
Die Projektabwicklung – von der Vertragsklärung 2021 über zwei formalisierte Werksabnahmen mit Delegationen aus Japan bis zur Inbetriebnahme im Juni 2025 – war durch eine enge Taktung, detaillierte Planung und durchgängige Dokumentationspflicht geprägt. Die Montagephase wurde von einer erfahrenen Projektaufsicht aus Österreich begleitet, die als Schnittstelle zwischen Entwicklung und Ausführung vor Ort fungierte. Die physische Präsenz vor Ort ermöglichte es, technische Rückfragen unmittelbar zu klären und die Einhaltung der projektspezifischen Abläufe und Qualitätsstandards sicherzustellen.
Gesamtkonzept im Bestand – Hydraulik trifft Effizienz
Kern der technischen Erneuerung ist eine vertikale Kaplan-Turbine mit einem Laufraddurchmesser von 2,4 Metern, die exakt auf das bestehende Bauwerk abgestimmt wurde. Mit einer Nettofallhöhe von 6,3 Metern, einem Nenndurchfluss von 30 m³/s und einer installierten Leistung von 1.684 KW ist die Anlage auf eine hohe jährliche Laufzeit von rund 8.000 Betriebsstunden ausgelegt – eine Auslegung, die auf maximale Energieausbeute bei stabiler Wassermenge und zur Niveauregelung im Flusslauf abzielt.
Der direkt gekuppelte, luftgekühlte Synchrongenerator ist auf die japanische Netzfrequenz von 60 Hz abgestimmt und arbeitet mit einer Nenndrehzahl von 171,4 U/min – eine Kenngröße, die sowohl die hydromechanische Optimierung als auch die Anforderungen an Netzstabilität berücksichtigt. Die Technik ermöglicht eine gleichbleibend hohe Stromproduktion und trägt zur Stabilisierung des Wasserstands im Fluss bei.
Die Wasserfassung befindet sich rund 200 Meter oberhalb des Krafthauses und besteht aus einem kompakten Stauwehr, das den Tedori-Fluss seitlich aufstaut und in den Triebwasserweg überführt. Über einen offenen Kanal wird das Triebwasser in ein Absetzbecken geleitet, gefolgt von einer Rechenanlage zur Feinreinigung. Anschließend strömt das Wasser in das Turbineneinlaufbauwerk und wird nach Durchlauf der Maschine rund 150 Meter flussabwärts wieder in das natürliche Gewässerbett zurückgeführt. Die Einbindung in das Gelände erfolgte unter strikter Wahrung bestehender Strukturen – neue Betonarbeiten beschränkten sich auf punktuelle Anpassungen im Maschinenhaus, etwa an Generatorfundament und Turbinenkammer.
Die gesamte Anlage folgt dem Prinzip einer ressourcenschonenden Nutzung des Bestands bei gleichzeitig maximaler betriebstechnischer Effizienz. Im Zentrum steht eine kontinuierliche, stabil geführte Betriebsweise mit gleichbleibender Lastcharakteristik – ideal für die Grundlastversorgung in der Region und im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Betreibers Hokuriku Electric Power. Die komplexen hydrologischen Bedingungen des Tedori-Flusses – gekennzeichnet durch starkes Gefälle, hohe Abflussvariabilität und erheblichen Feststoffeintrag – wurden durch die Wahl der Turbinen-


Blick in das Krafthaus Shirayama während der Bauphase: Vorbereitung der Turbinensohle für die Integration der vertikalen Kaplanturbine.
technologie und die angepasste Wasserführung technisch optimal bewältigt.
Komplexe Armaturenlösung als Projektschwerpunkt Die erfolgreiche Modernisierung wäre ohne eine Reihe durchdachter Sonderlösungen im Bereich der Armaturen und Verschlussorgane nicht realisierbar gewesen. Der limitierte Bauraum im Bestand und die extremen Anforderungen an Umweltverträglichkeit machten eine differenzierte Auslegung aller sicherheitsrelevanten Komponenten notwendig. Die hydraulisch gesteuerten Leitschaufeln innerhalb des Leitapparates


der Anlage wurden dabei gezielt auf die segmentierte Turbinenbauweise abgestimmt. Trotz der beengten Verhältnisse im Maschinenhaus ermöglichen sie eine exakte Steuerung der Strömungsführung – bei gleichzeitig hoher Wartungsfreundlichkeit und Systemverfügbarkeit. Eine technische Besonderheit stellt der gezielte Einsatz sogenannter Facing Plates dar – speziell ausgeführte DeckelSchutzbleche an Ober- und Unterdeckel der Turbine. Bei Niederdruckturbinen sind sie unüblich, wurden in diesem Fall jedoch aufgrund der hohen Schwebstoffbelastung des Tedori-Flusses vorgesehen. Die erosionsgefährdeten Bereiche der Maschine sind damit dauerhaft geschützt – ein exemplarisches Beispiel dafür, wie sich standardisierte Technik flexibel und betriebssicher an herausfordernde Standortbedingungen anpassen lässt.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
• Segmentierte Bauteile:
Das Saugrohr wurde achtfach segmentiert – bestehend aus zwei Konusteilen und sechs Krümmersegmenten, um auch unter beengten Einbauverhältnissen eine exakte Montage zu gewährleisten. Der Stützschaufelring und der Pit-Liner wurden aufgrund der in Japan geltenden Transportbeschränkungen ebenfalls in mehreren Segmenten gefertigt und vor Ort passgenau montiert.
• Ölfreie Komponenten:
Die luftgefüllte Laufradnabe, das was-
sergeschmierte Führungslager und die fettfreie Wellendichtung bilden ein vollständig ölfreies System. Da biologisch abbaubare Schmierstoffe in Japan nicht zulässig sind, war diese Konfiguration nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern technisch zwingend.
• Leckageschutz mit Redundanz:
Der in die Nabe integrierte Servoantrieb verfügt über ein doppeltes Leckagekontrollsystem, das frühzeitig vor potenziellen Undichtigkeiten warnt – ein wesentlicher Baustein für den Gewässerschutz.
• Sedimentresistenz:
Facing Plates an Ober- und Unterdeckel der Turbine schützen exponierte Komponenten vor Abrasion – eine gezielte Anpassung an die hohe Sedimentfracht des Tedori-Flusses.
Die Verschlussorgane und Stellglieder fügen sich in das modulare Gesamtsystem ein und leisten ihren Beitrag zur strukturellen Integrität der Anlage. Ihre spezielle Ausführung trägt maßgeblich dazu bei, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, Wartungsaufwände zu minimieren und zugleich sämtliche sicherheitsrelevanten Anforderungen des Standorts dauerhaft zu erfüllen.
Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip
Das Projekt Shirayama zeigt in eindrucksvoller Weise, wie Nachhaltigkeit in der Kleinwasserkraft nicht allein durch den CO2-freien Betrieb, sondern auch durch


Wasserfassung des Kraftwerks Shirayama – das kompakte Stauwehr lenkt den TedoriFluss in den Triebwasserkanal. Die Einbindung ins Gelände erfolgte mit minimalem baulichem Eingriff.
ressourcenschonendes Bauen und langlebige Technik erreicht werden kann. Es wurden keine neuen Betonbauten errichtet, keine zusätzlichen Flächen versiegelt und keine ökologisch sensiblen Bereiche verändert. Die Energieeinspeisung erfolgt ins öffentliche Netz, wodurch ein direkter Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Region geleistet wird. Die Anlage ist ein sichtbarer Baustein der Dekarbonisierungsstrategie von Hokuriku Electric Power – gleichzeitig aber auch ein Symbol für die Zukunftsfähigkeit der Kleinwasserkraft im globalen Kontext. Das Wasserkraftwerk Shirayama zeigt, wie Tradition und Technik, Regionalität und Globalität sowie Nachhaltigkeit und Effizienz miteinander verbunden werden können.
Turbinentyp: Kaplan
Montageart: vertikal
• Nettofallhöhe: 6,3 m
• Durchfluss: 30 m³/s
Leistung: 1.684 kW
• Betriebsstunden/a: ca. 8000
• Laufraddurchmesser: 2,4 m

Qualitativ hochwertige Generatoren sind etwas teurer in der Anschaffung. Der Mehrpreis rechnet sich in jedem Fall aber auf lange Sicht.
Wer billig kauft, kauft teuer. Die bekannte Binsenweisheit mit der ihr innewohnenden Warnung vor der Kurzsichtigkeit bei Investitionen gilt selbstredend auch, wenn es um die Anschaffung von Maschinen und Komponenten in der Wasserkraft geht. Der gute Rat von Experten: Machen Sie sich ein Gesamtbild des Produkts über den gesamten Lebenszyklus! Wie effizient ist die Maschine, wie ausfallssicher, wie wartungsarm, wie gut vorbereitet auf künftige Anforderungen? Allein der Kaufpreis ist absolut kein Kriterium dafür, wie wirtschaftlich die gewählte Maschine ist. Ein ausgezeichnetes Beispiel bieten etwa die seit Jahrzehnten in der Wasserkraft bewährten Generatoren von Hitzinger, die zwar in der Anschaffung etwas teurer sind, sich aber bereits mittel- bis langfristig aufgrund ihrer ausgeprägten Qualitätsvorteile bezahlt machen. Wer wirtschaftlich denken und arbeiten möchte, sollte sich die Mühe machen nachzurechnen.
Gerade dort, wo grüner Strom erzeugt wird, steht auch das Thema Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit der eingesetzten Maschinen im ersten Rang. Dabei geht es nicht nur darum, dass hochwertige Anlagen einen zuverlässigen, sicheren Betrieb über viele Jahre hinweg garantieren. Sondern auch darum, dass deren Langlebigkeit die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber grüner Technologie fördert. Selbstredend steigert diese auch das Vertrauen von Investoren und Betreibern, gerade wenn effiziente Maschinen eine maximale Ausbeute aus natürlichen Energiequellen sicherstellen. Damit werden sie auch zu einem entscheidenden Faktor im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Energien. Wer heute auf nachhaltige, effiziente und qualitativ hochwertige Technik setzt, investiert nicht nur in eine saubere Zukunft, sondern auch in die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Energiesystems von morgen. Das sieht auch DI Wolfgang Stallinger, Technischer Leiter von HITZINGER Power Solutions GmbH, so, den allerdings schon länger die Frage umtreibt, warum sich viele Betreiber heute zum Teil für die günstigste Lösung mit geringerer Effizienz entscheiden: „Viele Kraft-
werksbetreiber wissen nach wie vor ganz genau, dass sich auf Dauer der Einsatz von Maschinen von hoher Qualität rechnet. Aber inzwischen gibt es auch andere, die sich nur aufgrund des Kaufpreises für eine günstigere Maschine entscheiden. Dass sie sich selbst und ihrer Anlage – auf die gesamte Anlagenlaufzeit gesehen – damit nichts Gutes tun, ist so manchem nicht bewusst.“
Wirkungsgradvergleiche nur im Detail sinnvoll
Gerade bei der Wahl eines Generators gilt es, einige Faktoren miteinzukalkulieren. Ein ganz wesentlicher ist der Blick auf den Wirkungsgrad, der natürlich entscheidend zur Wirtschaftlichkeit der Anlage beitragen kann. Bereits ein geringfügig besserer Wirkungsgrad summiert sich über die Jahre zu einem erheblich höheren Energieertrag. Bei Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren bedeutet das nicht nur eine deutlich gesteigerte Stromproduktion, sondern auch spürbar höhere Einnahmen, die den zunächst höheren Anschaffungspreis des Generators mehr als kompensieren. Die Investition amortisiert sich damit schneller, als es der reine Kaufpreis vermuten lässt.

Bei Hitzinger werden die Generatoren für den Kunden maßgeschneidert.
Aber die Frage nach dem Wirkungsgrad ist eine, bei der man als Käufer zweimal hinschauen sollte. Die Erklärung dafür liefert Wolfgang Stallinger: „Wir bei Hitzinger verstehen Wirkungsgradangaben nicht als Marketinginstrument, sondern als verbindliches Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden. Während die gültige Norm EN 60034-1 eine Toleranz von bis zu 10 % bei der Berechnung von Verlusten erlaubt – was theoretisch eine höhere Wirkungsgradangabe ermöglichen würde –, verfolgt Hitzinger bewusst einen anderen Ansatz: Statt die Verluste rechnerisch zu optimieren, werden diese zusätzlich um 10 % erhöht, um daraus einen Mindestwirkungsgrad abzuleiten, der äußerst konservativ angelegt ist.“ In der Praxis bedeutet das, dass der tatsächliche Wirkungsgrad der Hitzinger-Generatoren in aller Regel deutlich über dem angegebenen Wert liegt. Im Vergleich zu Marktbegleitern von Hitzinger die oft eine kleinere hoch ausgenützte Maschine anbieten mag der Wirkungsgrad unterschied oft nur gering ausfallen - tatsächlich bietet er aber mehr technische Robustheit und ist zumeist höher, was in einem nicht zu vernachlässigenden Mehrertrag resultiert.
Grund genug, dass Wolfgang Stallinger generell einen Nachdenkprozess in der Branche in Gang setzten möchte: „Es ist für die gesamte Wasserkraftbranche nicht von Vorteil, wenn die Angaben für die Wirkungsgrade immer weiter ausgereizt werden. Dabei wird nur der Druck auf alle Anbieter größer, hier nachzuziehen, wodurch letztlich sowohl Qualität als auch Ruf der Maschinen leiden.“ Er plädiert dafür, dass man wieder mehr über Nachhaltigkeit und Gesamteffizienz der Anlagen nachdenkt anstatt nur billig zu bauen.

Die Firma Jank verglich in einem aktuellen Projekt Wirtschaftlichkeit von Generatoren auf Basis ihrer tatsächlichen Wirkungsgrade.

Es gehört zur Firmenphilosophie der Firma Hitzinger, dass die Wirkungsgradangabe ein Leistungsversprechen ist, das zu 100 Prozent eingehalten wird – daher sind diese Angaben höchst konservativ.
Vergleichstest aus der Praxis mit eindeutigem Ergebnis
Auch wenn die Unterschiede auf dem Papier marginal erscheinen mögen, lohnt sich ein Blick auf konkrete Kalkulationen allemal. Der Wasserkraftexperte DI Siegi Jank aus Oberösterreich, selbst Turbinenbauer und höchst erfahrener Wasserkraftbetreiber, hat dazu eine aktuelle Vergleichsrechnung angestellt: „Bei der Entwicklung unserer Turbinenmodelle treiben wir einen hohen Aufwand zur Maximierung und Überprüfung der Wirkungsgrade. Das wollen wir dann natürlich nicht wieder beim Generator herschenken! Daher haben wir uns beim Projekt Hangendenstein für einen wirkungsgradoptimierten Generator von Hitzinger entschieden. Obwohl diese Variante in der Anschaffung leider die teuerste Wahl war (oder positiver formuliert: doch erhebliche Mehrkosten verursacht hat), wird sich diese Entscheidung in Zukunft rechnen: Aufgrund des höheren Wirkungsgrades von durchschnittlich 1 % zum nächstbesten Angebot können jährlich ca. 20.000 kWh mehr erzeugt werden“, rechnet Siegi Jank vor und ergänzt: „Am Prüfstand konnten die von Hitzinger versprochenen Werte auch bei der Wirkungsgradmessung problemlos nachgewiesen werden.“ Die praxisnahe Vergleichsrechnung von Siegi Jank unterstreicht, dass selbst unspektakulär scheindende Unterschiede im Wirkungsgrad erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit eines Projekts haben können.
Eine Lebenszyklus-Betrachtung sorgt für Klarheit
„Ich verstehe durchaus, wenn Betreiber von erhöhtem Kostendruck und engeren Budgetgrenzen sprechen. Aber durch eine Total-Cost-of-Ownership-Betrachtung, also eine klassische Lebenszyklus-Betrachtung, wird schnell klar, dass die meisten günstigen Maschinen teurer sind – nicht gleich, aber später“, sagt Wolfgang Stallinger. Dass Kunden manchmal einem Fehlurteil erliegen, mag zum einen daran liegen, dass ihnen der Überblick über die Qualitätsunterschiede fehlt, und zum anderen werden tatsächliche Folgekosten häufig zu optimistisch eingeschätzt. Daher ist es unabdingbar, dass langfristige Rentabilität mit Fakten und Messungen belegt werden sollte. Versprechen alleine sind zu wenig. Am Ende sollte dem Betreiber klar sein: Ungeplante Stillstände, Produktionsausfälle und Störungen schaden nicht nur dem Betriebsergebnis, manchmal schaden sie auch dem guten Ruf.

Generatoren von Hitzinger zeichnen sich dadurch aus, dass sie grundsätzlich sehr großzügig ausgelegt werden und damit hohe thermische Toleranzen mitbringen.
Großzügige Auslegung erhöht die Lebensdauer Ein zentraler Punkt, der bei all diesen Vergleichen nicht außer Acht gelassen werden sollte: Generatoren von Qualitätsherstellern wie Hitzinger sind keine Produkte von der Stange. Im Gegenteil: Bei Hitzinger werden die Generatoren am Standort Linz komplett nach den Erfordernissen der Anlage und des Kunden aufgebaut. Das beginnt bei der magnetischen Auslegung und reicht bis zum gewählten Isolationssystem. Darüber hinaus setzt man auf Materialien, die geringste Verluste aufweisen
und extrem widerstandsfähig sind. Derartig maßgeschneiderte Maschinen sind im Allgemeinen konservativer ausgelegt als Produkte aus den Standardreihen vieler anderer Hersteller. „Solcherart großzügig ausgelegte Maschinen bleiben auch bei Volllast deutlich unter der angegebenen normativen Erwärmungsklasse. Je kleiner, sparsamer und kompakter gebaut wird, desto mehr neigen die Maschinen zu Temperaturstress“, sagt Wolfgang Stallinger und verweist auf die Tatsache, dass die permanente thermische Belastung des Isolationssystems erfahrungsgemäß die Lebensdauer verkürze. Hitzinger-Generatoren sind robuster konstruiert und effizienter gekühlt, wodurch sie thermische Verluste und mechanischen Stress deutlich besser tolerieren. Hitzinger verfolgt hier die nachhaltige Philosophie, dass Wasserkraftgeneratoren mindestens 30 Jahre im Feld zuverlässig laufen müssen. .
Stärkung der Energieinfrastruktur
Kriterien wie Effizienz und Ausführungsqualität bilden nicht nur die Basis für einen langfristig sicheren und stabilen Betrieb, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit von Wasserkraftwerken. Durch ihre höhere Energieausbeute, geringeren Wartungsbedarf und längere Lebensdauer amortisieren sich die anfangs etwas höheren Investitionskosten für einen Hitzinger-Generator meist relativ schnell. Technisch ausgereifte Komponenten sorgen zum einen für eine stabile Einspeisung ins Netz und zum anderen dafür, dass die Anlage für sämtliche modernen Netzanforderungen gerüstet ist. Wer in nachhaltige und leistungsstarke Technik investiert, stärkt somit nicht nur die Rentabilität seines Projekts, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der gesamten Energieinfrastruktur.

YOU GOT THE POWER.



KOMPAKT
ZUVERLÄSSIG




UMWELTVERTRÄGLICH SICHER EFFIZIENT FLEXIBEL
Maximale Flexibilität der Ausführung und höchste Anforderungen an die Qualität sind unser weltweites Markenzeichen. Nachhaltig garantierte Leistung für erneuerbare Energien. Generatoren - konstruiert und gebaut für Generationen.

Elektro Bischofer rüstet Trinkwasserkraftwerke aus einer Hand aus. Im Bild: das TWKW Ullach im Salzburger Leogang – erfolgreich realisiert 2022.
Sauberer Strom aus dem Trinkwasser der Alpen: Trinkwasserkraftwerke stellen eine besonders umweltfreundliche Variante dar, Strom aus eigenen Ressourcen zu erzeugen. Ob in der Schweiz, in Bayern, Südtirol oder in Österreich: Überall wo das wertvolle Quellwasser ausreichend Höhenmeter überwindet, können moderne Trinkwasserturbinen installiert werden. Ein Unternehmen, das sich in diesem Sektor über die Jahre einen hervorragenden Namen gemacht hat, ist Elektro Bischofer aus Reith im Alpbachtal. Mit der Umsetzung zahlreicher Trinkwasserkraftwerke hat sich das Tiroler Familienunternehmen längst als bewährter Komplettanbieter für die elektromechanische Ausrüstung von Kleinkraftwerken etabliert. Die Referenzbeispiele aus den letzten Monaten zeigen, wie man erfolgreich Ökostrom aus dem energetischen Potenzial des Trinkwassers gewinnen kann.
Trinkwasserkraftwerke gelten zu Recht als Paradebeispiele für sinnvolle Doppelnutzung bestehender Infrastruktur. Wo Wasser aus höher gelegenen Quellfassungen in Richtung Verbraucher fließt, lässt sich oft mittels Wasserkraftturbinen auf einfache und wirtschaftliche Weise erneuerbare Energie gewinnen. Seit über 100 Jahren gibt es im Alpenraum und auch darüber hinaus Referenzbeispiele für diese Anwendung. Neben dem Aspekt, dass Trinkwasserkraftwerke zur Erreichung der energiestrategischen Ziele von Land und Bund beitragen können, sind sie dank ihrer Wirtschaftlichkeit darüber hinaus auch in der Lage, einen entscheidenden Beitrag zur langfristigen wirtschaftlichen Konsolidierung von Kommunen zu leisten. Hinzu kommt, dass durch die Vergabe von Planungs- und Bauarbeiten sowie der elektromechanischen Ausrüstung regionale Wertschöpfung generiert wird. Am Ende steht in der Regel eine klassische Win-Win-Situation.
Maßgeschneidertes Gesamtpaket aus Tirol
„Die Wirtschaftlichkeit von Trinkwasserkraftwerken ist dabei immer individuell zu bewerten, da sie von mehreren Faktoren abhängig ist – wie der Fallhöhe, der Schüttung der Quellen, aber auch vom Zustand des Rohrsystems, den Einspeisemög-
lichkeiten ins örtliche Stromnetz bzw. den Eigenverwertungsoptionen, sowie von möglichen Synergieeffekten durch Sektorkopplung etc.“, erklärt Andreas Bischofer, ein Fachmann in Sachen Trinkwasserkraftwerke, der mit seinem Unternehmen Elektro Bischofer in den letzten Jahren zahlreiche derartige Projekte umgesetzt hat. Die E-Technik-Spezialisten aus Reith im Alpbachtal bieten heute Gemeinden und natürlich auch Trinkwasserverbänden ein maßgeschneidertes Gesamtpaket von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. „Gerade bei Neubauten von Hochbehältern oder dem Tausch alter Leitungen sollte die Möglichkeit zur Turbinierung mitgedacht werden“, betont Andreas Bischofer. Denn: „Der zusätzliche Aufwand für eine Turbine ist im Verhältnis zur Gesamtinvestition gering – aber der Nutzen für die Energieversorgung und Versorgungssicherheit ist enorm.“ Ein Argument, das zusehends stärkeren Nachklang findet.
Know-how-Gewinn aus den letzten Jahrzehnten Heute vereint das Tiroler Familienunternehmen elektrotechnisches Know-how, maschinenbauliche Kompetenz und langjährige Erfahrung im Trinkwassersektor. Diese Qualitäten konnte sich das Unternehmen, das seit fast 50 Jahren erfolg-
reich tätig ist, vor allem in den letzten 35 Jahren Schritt für Schritt aneignen, wie Andreas Bischofer bestätigt: „Ursprünglich kommen wir von der elektrotechnischen Seite. In diesem Bereich haben wir von Anfang an im Wasserkraftbereich gearbeitet und so auch das elektrotechnische Know-how ausgebaut. Seit rund 35 Jahren sind wir nun auch im Maschinensektor tätig. Anfänglich haben wir kleine Insel-Anlagen ausgerüstet. Aber nach und nach auch größere Anlagen. Heute decken wir mit unserem Angebot die unteren Leistungsbereiche bis hinauf zu etwa 200 kW Leistung ab.“
Dementsprechend liefert Elektro Bischofer heute Turbinen in unterschiedlicher Ausführung, wobei die Planung, Konstruktion und natürlich das gesamte elektrotechnische Engineering aus dem eigenen Haus stammt. Was die Fertigung der Turbinen angeht, setzt man bei Bischofer auf eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Das habe sich bewährt, so der Geschäftsführer. Die Laufräder werden heute mittels Spannsysteme in formschlüssiger Bauweise gebaut. Die gefrästen Becher werden somit einzeln verschraubt. Damit das Design der Laufräder modernste Standards erfüllt, hat man im Hinblick auf die Wirkungsgradoptimierung erfolgreich mit einer deutschen Universität zusammengearbeitet.
Ein zuverlässiger Partner – auch für Sonderlösungen Grundsätzlich gelten Trinkwasserkraftwerke sowohl technisch als auch im Hinblick auf natur- und wasserschutzrelevante Fragen als eher einfach umsetzbar. Dennoch gibt es besondere Anforderungen, die bei Planung und Umsetzung im Vordergrund stehen sollten. Zum einen müssen sämtliche Maschinenteile, die mit Trinkwasser in Verbindung kommen, vollumfänglich trinkwassertauglich sein. Dem wird heute vor allem durch die Verwendung von Edelstahl Rechnung getragen. Hinzu kommt, dass die Versorgung auch dann sichergestellt werden muss, wenn die Turbine einmal nicht läuft. Zu diesem Zweck wird in modernen Trinkwasserkraftwerken stets ein Bypass-System integriert.

Die beiden Elektro Bischofer Mitarbeiter Daniel und Philipp bei der Endkontrolle zweier Schaltanlagen. Elektro Bischofer hat seine Wurzeln in der Elektro- und Steuerungstechnik.

Andreas
mit
Unternehmen
dem Kraftwerkssektor. Planung, Konstruktion, und das e-technische Engineering kommen samt und sonders aus dem Hause Elektro Bischofer.
„Wichtig ist, dass wir den Kunden aufzeigen können, wie die Gewerke mit sämtlichen Funktionalitäten in die Bestandsinfrastruktur integriert werden können. Viele können sich das nicht vorstellen“, erklärt Andreas Bischofer und betont: „Bei unseren Projekten legen wir auch besonderes Augenmerk darauf, dass mit geringstem Aufwand gebaut werden kann und die durchgängige Trinkwasserversorgung in der Bauphase gewährleistet bleibt.“
Der Tiroler verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass im Rahmen derartiger Projekte immer stärker kundenspezifische Sonderlösungen nachgefragt werden – etwa Inselbetriebsfähigkeit, die häufig auch mit Photovoltaik kombiniert wird. Dabei kann das Unternehmen aus Reith mit seinem einschlägigen Know-how punkten. Im Fokus stehen dabei stets – so Andi Bischofer – „Zuverlässigkeit und Effizienz“.
Referenzanlage in Fieberbrunn
Mit einigen in jüngster Zeit realisierten Anlagen stellte Elektro Bischofer sehr nachdrücklich die hohe Kompetenz in Sachen Trinkwasserkraftwerke unter Beweis. Anlagen, wie sie etwa in Fieberbrunn, Kirchberg, Leogang oder Bach im Lechtal realisiert wurden, zeigen eindrucksvoll, wie die TrinkwasserInfrastruktur zur nachhaltigen Energiegewinnung genutzt werden kann.

2024 ging das Trinkwasserkraftwerk Bärfeld in Fieberbrunn in Betrieb.
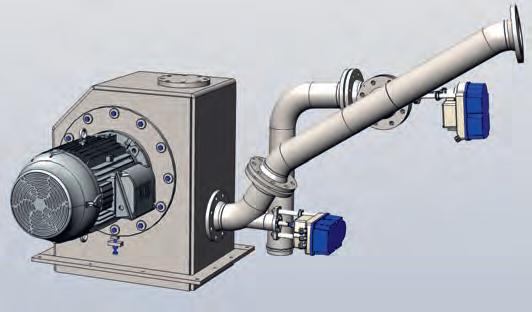
Trinkwasserkraftwerk Bärfeld in Fieberbrunn:
Engpassleistung: 11,5 kW Fallhöhe: 100 m
Ausbauwassermenge: 15 l/s Turbine: 1-düsige Peltonturbine
Inbetriebnahme: 2024 Betrieb: Netzparallelbetrieb
In Fieberbrunn beispielsweise wurde 2024 eine bestehende Unterbrecherstube aus den 1970er-Jahren baulich adaptiert und mit einer 1-düsigen, trinkwassertauglichen Peltonturbine sowie einem Bypass ausgestattet. Die Anlage nutzt das Wasser – maximal bis 15 l/s – aus den Geigerinnen- und Felixstollenquellen, das auf die rund 100 Meter tiefer situierte Trinkwasserturbine trifft. Die Anlage erreicht damit eine Jahresproduktion von durchschnittlich bis zu 90.000 kWh Ökostrom, der zur Gänze ins Netz gespeist wird. Der Bauaufwand hielt sich in engen Grenzen, zumal die Druckrohrleitung bereits vorhanden war. „Wir haben lediglich den Hochbehälter dafür baulich adaptiert“, erklärt Johann Eder von der Gemeinde Fieberbrunn. Die Technik kommt dabei komplett von Elektro Bischofer: Von der Turbine über die Steuerung bis hin zur Benutzeroberfläche auf PC und Handy läuft alles reibungslos. „Wir sind mit der Umsetzung sehr zufrieden“, bestätigt Johann Eder.
Kirchberg setzt ebenfalls auf die Kraft des Trinkwassers Schauplatzwechsel: In Kirchberg in Tirol wurde 2025 ebenfalls ein völlig neues Trinkwasserkraftwerk errichtet, indem man die bestehende Waldhofquelle nutzt. Die alte Freispiegelleitung von 1912 wurde dabei durch eine druckfeste Leitung aus PE-Rohren ersetzt. Eine 1-düsige Pelton-Turbine mit rund

Trinkwasserkraftwerk Waldhof in Kirchberg in Tirol:
Ausbauleistung: 8,5 kW Fallhöhe: 140 m
Ausbauwassermenge: 8 l/s Turbine: 1-düsige Peltonturbine
Inbetriebnahme: 2025 Betrieb: Netzparallelbetrieb
10 kW Engpassleistung nutzt nun die Fallhöhe von 150 Metern effizient aus. Trotz der niederschlagsarmen Phase der letzten Wochen ist Betriebsleiter Robert Lindner zufrieden: „Wir nutzen den Strom selbst – das spart auf Dauer bare Münze. Und die Umsetzung durch das Team von Elektro Bischofer hat sehr gut funktioniert.“ Besonders praktisch: Der Bypass kann bei Wartungen auch für Spülzwecke eingesetzt werden. Das Trinkwasserkraftwerk zeigt, wie moderne Technik und kommunale Eigenversorgung sinnvoll zusammenspielen.
Bach im Lechtal strebt Energieautarkie an
In der kleinen Tiroler Gemeinde Bach im Lechtal wurde mit zwei Trinkwasserkraftwerken ein wegweisendes Energieprojekt realisiert, das über die Gemeindegrenzen hinausstrahlt. Bereits 2015 setzte man mit dem Bau des ersten Werks, das die Rohrwaldquelle nutzt, den Grundstein – mit einer maximalen Schüttung von bis zu 35 Litern pro Sekunde und einer Fallhöhe von 530 Metern liefert die 127-kW-Anlage seither zuverlässig sauberen Strom. Im Dezember des Vorjahres folgte die Inbetriebnahme eines zweiten, kleineren Trinkwasserkraftwerks an der neu gefassten Seitenwandquelle. Obwohl sie mit durchschnittlich 6 l/s deutlich kleiner als die Rohrwaldquelle ist und sie als eiserne Trinkwasserreserve dient, wurde auch diese Quelle intelligent in das Gesamtsystem integriert. Im Zuge dieses Ausbaus wurde das bestehende Hauptkraftwerk auf Inselbetrieb umgestellt. Damit kann Bach heute das Gemeindezentrum inklusive Amtsgebäude und Kindergarten vollständig autark mit Strom versorgen – eine essenzielle Absicherung für eine Gemeinde, die in ihrer Vergangenheit im Winter schon des Öfteren vom Netz abgeschnitten war.
Die technische Umsetzung wurde dabei auch von Elektro Bischofer als Generalunternehmen übernommen. Neben der modernen Turbinen- und Steuerungstechnik wurden Sonderlösungen für die Notfallszenarien entwickelt: Sollte es zu einem Stromausfall kommen, stellt ein ausgeklügeltes System mit Bypass und automatischer Umschaltung die Wasserversorgung weiterhin sicher – ganz ohne Fremdstrom. Die beiden Gemeindegebäude wurden komplett auf Eigenstromversorgung ausgelegt, sodass sowohl Lüftung, Grundwasserwärmepumpe etc. vom Strom aus den Trinkwasserkraftwerken versorgt werden.

Die Trinkwasserkraftwerke sind in der Regel mit einem Bypass-System ausgerüstet, damit bei einem eventuellen Turbinenstillstand die Trinkwasserversorgung aufrecht erhalten werden kann. Sämtliche Teile, die mit Wasser in

Trinkwasserkraftwerk Seitenwandquelle in Bach im Lechtal: Ausbauleistung: 17 kW Fallhöhe: 308 m Ausbauwassermenge: 7 l/s Turbine: 1-düsige Peltonturbine Inbetriebnahme: 2025 Betrieb: Netzparallel- & Inselbetrieb
So kann Energieautarkie im Kleinen aussehen. Für Bürgermeister Simon Larcher steht fest: „Auf diese Weise entstehen uns keine Energiekosten. Das hätte man schon vor 30 Jahren so machen sollen – für eine kleine Gemeinde wie unsere ist das ein Meilenstein in Sachen Unabhängigkeit und Kostenersparnis.“ Dank Elektro Bischofer wurde dieses Ziel mit technischer Raffinesse, Weitblick und Kompetenz Wirklichkeit.
Trinkwasserkraftwerke haben noch Potenzial
Ob Leogang, Bach, Kirchberg oder Fieberbrunn – die maßgeschneiderten Lösungen für die hydroenergetische Nutzung des Trinkwassers gelten heute als Best-Practice-Beispiele, in denen das Unternehmen aus Reith im Alpbachtal Vielseitigkeit, Kompetenz und technische Innovationskraft bewies. Ver-
Vorteile von Trinkwasserkraftwerken
• Synergien mit bestehender Infrastruktur: Nutzung von Höhenunterschieden in Wasserleitungen spart Baukosten.
• Planbare Wassermengen: Konstante Schüttungen bieten eine verlässliche Energieproduktion.
• Höchste Wasserqualität: Edelstahlkomponenten und trinkwassertaugliche Materialien sichern langfristige Standzeiten.
Wirtschaftlichkeit: In vielen Fällen amortisiert sich die Anlage durch Eigenstromverbrauch oder Einspeisung.
• Krisensicherheit: Inselbetriebsfähige Anlagen sichern die Versorgung auch bei Stromausfällen.

1-düsige Peltonturbine im neuen TWKW Seitenwandquelle in Bach
ständlich, dass viele Gemeinden aus dem Inland, aber auch aus den Nachbarländern, heute bei den Tiroler Energietechnikspezialisten vorstellig werden, die nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Verlässlichkeit und ihrer Handschlagqualitäten einen sehr guten Ruf genießen.
In vielen Gemeinden wurden in den letzten Jahren im Zuge von Neuerschließungen und Leitungssanierungen Trinkwasserkraftwerke errichtet. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 wurden in Österreich rund etwa 152 GWh p.a. mittels Trinkwasserkraftwerken generiert. Auch wenn aktuell keine genauen Zahlen für das Gesamtpotenzial vorliegen, so gehen Experten davon aus, dass im gesamten Alpenraum noch ein erhebliches Potenzial vorliegt. Ob dieses Potenzial letztlich auch gehoben wird, hängt allerdings vom Engagement der einzelnen Gemeinden ab. Dass es sich sehr häufig auszahlt, belegen nicht zuletzt die jüngst realisierten Referenzanlagen von Elektro Bischofer.


Die lange geplante Erneuerung der Wehranlage Großhesselohe an der Isar brachte eine ganze Reihe von Verbesserungen mit sich.
Im Mai vor etwas mehr als zwei Jahren startete im Süden der bayerischen Landeshauptstadt München die Sanierung der denkmalgeschützten Großhesseloher Wehranlage, mit der die Isar bei Pullach reguliert wird. Mit der Erneuerung sorgten die Stadtwerke München GmbH (SWM) für eine optimale ökologische sowie dem Hochwasserschutz dienende Lösung. Die Modernisierung der bald 120 Jahre alten Anlage beinhaltete den Bau von drei neuen Wehrfeldern, einer Fischaufstiegsanlage sowie den Neubau des Trennwehrs zwischen Isar und Werkkanal. Technisch interessant ist die individuelle Ausführung der Wehrfelder, welche jeweils mit einer klassischen Wehrklappe, einem luftbetriebenen Wehrklappensystem sowie einer Wehrschwelle ausgeführt wurden. Die Projektumsetzung sollte sich aus mehreren Gründen als herausfordernd darstellen.
Das Großhesseloher Wehr in Pullach reguliert seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1908 die Wasserführung zwischen dem Werkkanal und der Isar und ist damit ein wichtiger Faktor für den Hochwasserschutz von München, aber auch für die Versorgung mehrerer Stadtbäche. Darüber hinaus ist die Wehranlage in energietechnischer Hinsicht relevant, denn am Werkkanal befinden sich vier Wasserkraftwerke und der Energiestandort Süd mit seiner Strom-, Fernwärme- und Kälteerzeugung. Die historisch gewachsenen Besitzverhältnisse der Anlage stellen eine Besonderheit dar: Während für den östlichen Teil des Wehrs die Stadt München zuständig ist, sind die SWM als eigenständige Gesellschaft für den westlichen Teil mit den regelbaren Wehrverschlüssen verantwortlich, mit denen die Wasserführung in Isar, Kanal und Fischaufstieg gesteuert wird.
Erneuerung der Traditionsanlage lange geplant
Die Sanierung bzw. die Erneuerung der Anlage war nicht nur wegen des fortgeschrittenen Alters der Technik schon länger
geplant, erklärt SWM-Projektleiter Lukas Mas-Zehetbauer: „Der ursprüngliche Beschluss für die Erneuerung der Wehran-



www.pfaffinger.com

Betonarbeiten am Wehrfeld 1
lage zwischen den SWM und der Stadt München war bereits 2008 getroffen worden. Ein wesentlicher Punkt der Vereinbarung bestand darin, dass durch die Umbaumaßnahmen die fischökologische Durchgängigkeit am Standort hergestellt werden sollte. An der alten Wehranlage war zwar bereits eine Fischtreppe vorhanden, diese erfüllte aber bei Weitem nicht die Anforderungen einer modernen Fischaufstiegshilfe. Ein weiteres wichtiges Thema war die Optimierung des Treibgutmanagements an der Wehranlage. Durch die Renaturierungsprojekte in den vergangenen Jahrzehnten hat die Treibgutmenge in der Isar stark zugenommen. Die Entfernung des Schwemmmaterials an der zuvor in der Flussmitte positionierten Schützenanlage stellte ein kontinuierliches Problem dar, das wir durch die Erneuerung dauerhaft in den Griff bekommen wollten.“
Für den Ersatzneubau wurde schließlich 2015 ein erstes Genehmigungsansuchen eingereicht. Es sollte sich aber herausstellen, dass die für die Bewilligung notwendigen naturschutzfachlichen Auflagen mit den vorliegenden Planungen nicht erfüllbar waren. Deswegen wurde das Projekt unter der Berücksichtigung der behördlichen Bescheide grundlegend adaptiert und 2021 schließlich erneut zur Genehmigung ein-


gereicht. Bei der Neuplanung wurde die Wehranlage mittels 3D-Simulation untersucht und hydraulisch optimiert, wobei als wesentliche Verbesserung ein kompakteres Bauwerk realisiert werden konnte. Die ursprünglich in den Planungen vorgesehene raue Rampe, bestehend aus groben Flussbausteinen der Flussmitte, wäre für die Fische schwerer auffindbar gewesen und hätte zudem einen Großteil des ökologisch wertvollen Kolks (strömungsbedingte Auswaschungen im Untergrund) überbaut. 2022 wurde die Wehranlage überraschenderweise unter Denkmalschutz gestellt, weswegen weitere planerische Anpassungen erforderlich waren. So musste eine verplombte Floßgasse, die eigentlich abgerissen werden sollte, aufgrund ihrer originalen Bausubstanz aus Stampfbeton erhalten und saniert werden. Mit der Floßgasse und dem daneben liegenden Schleusenwärterhaus blieben auch die wesentlichen landschaftsprägenden Merkmale am Standort erhalten. Auch die Sicherheit von Freizeitsportlern, die während der Sommermonate mit Schlauchbooten oder Kajaks auf der Isar unterwegs sind, wurde natürlich nicht außer Acht gelassen. Damit diese den Umstieg vor der Wehranlage nicht vergessen, wurden mehrere Warnschilder, Bojen eine Abweisschranke sowie ein Warnbalken installiert.


Montagearbeiten des luftbetriebenen Wehrklappensystems
Wehranlage mit kombinierter Technik
Für die Stauhaltung am Standort sorgt nun eine Kombination aus drei Systemen. Am linken Wehrfeld wurde eine stählerne Wehrklappe mit einem versteckt im Wehrpfeiler untergebrachten Torsionsantrieb für die Regulierung des Wasserstands installiert. An diesem Wehrfeld erfolgt auch die kontinuierliche Dotierung der Unterwasserstrecke. Beim zweiten Wehrfeld kommt eine luftbetätigte Wehrklappe zum Einsatz. Bei dem weltweit bewährten System handelt es sich um eine Kombination aus robusten Stahlpaneelen, die durch pneumatisch betätigte Luftkissen gehoben bzw. gesenkt werden. Anders als hydraulisch betriebene Wehrklappen werden die patentierten Wehrklappen über ihre gesamte Breite von den aufblasbaren Luftkissen gestützt. Dies ermöglicht einfache Fundamentanforderungen und eine kostengünstige sowie effiziente Klappenkonstruktion. Zudem müssen für das System keine Zwischenpfeiler errichtet werden, was in weiterer Folge den verfügbaren Querschnitt für die Hochwasserabfuhr erhöht und gleichzeitig Errichtungskosten reduziert. In ökologischer Hinsicht sammelt

Betonarbeiten am neuen Trennwehr zwischen Isar und Werkkanal
das System durch seine rein pneumatische Funktionsweise Pluspunkte, denn es sind keine Schmiermittel im Einsatz, die das Gewässer verunreinigen könnten. Das dritte Wehrfeld der Anlage wurde funktional am einfachsten gehalten, dieses besteht aus einer festen Wehrschwelle. Komplett neu errichtet wurde zudem das Trennwehr zwischen Isar und Werkkanal, dieses besteht aus fünf Wehrfeldern mit jeweils 5,5 m Breite. Das Stahlwasserbauequipment für das neue Bauwerk lieferte der Branchenspezialist Kochendörfer Wasserkraftanlagen in Form von drei Doppelschützen sowie zwei Einzelschützen inklusive der elektromechanischen Antriebe. Von Kochendörfer stammt auch die neue Wehrklappe inklusive Torsionsantrieb am Wehrfeld 1. Mit der Ausführung des elektro- und regelungstechnischen Equipments wurden die Automatisierungsexperten der F.EE GmbH beauftragt. Zum Leistungsumfang gehörten die Programmierung der neuen Wehrsteuerung, die Lieferung und Installation der Hardware sowie die Integration in die übergeordnete Leittechnik der SWM. Neben dem Trennwehr und einer hydraulisch betriebenen Klappe werden auch die


Die Bodenverhältnisse erforderten aufwändige Austauschbohrungen für die Baugruben. © SWM © SWM

Mit dem Ersatzbauwerk haben die SWM eine optimale ökologische, betriebliche und dem Hochwasserschutz dienende Lösung geschaffen.
Bauphase mit vielen Überraschungen
Neubau/Modernisierung für alle Wasserkraft- und Wehranlagentypen | Mit über 30 Jahren Erfahrung und 1.100 Mitarbeitenden weltweit tätig – auch als Generalunternehmer luftkissengesteuerten Wehrklappen über die eigens entwickelte F.EE-Software gesteuert. Die gesamte Anlage lässt sich sowohl vollautomatisch als auch manuell bedienen, was deren zukünftigen Betrieb deutlich erleichtert.
Revision macht sich bezahlt
Im Juli 2025 ist das Revisionsprojekt endgültig fertiggestellt, lediglich einige Restarbeiten sind noch am Laufen. Bei den Stadtwerken zieht man trotz der herausfordernden Umsetzungsphase ein positives Fazit über das Erneuerungsprojekt und betont die Vorteile, die damit erreicht wurden. Etwa die Verbesserungen bei Hochwassersituationen, durch die nun komplett überströmbar ausgeführte Wehranlage konnte die Gefahr von Verklausungen erheblich minimiert werden. In ökologischer Hinsicht stellt der Fischaufstieg die ideale Lösung für die Gegebenheiten am Standort dar. Dieser optimiert die Durchgängigkeit für die Wasserlebewesen und sorgt für die ökologische Vernetzung der Gewässersysteme Isar und Werkkanal.
Die SWM setzten bei der Umsetzung des Erneuerungsprojekts auf bewährte Unternehmen aus der Bau- und Technikbranche. Im Frühjahr 2021 wurden die Wasserbauexperten der Tractebel Hydroprojekt GmbH von der Fachabteilung der SWM für die Ausführungsplanungen mit ins Boot geholt. Zu den Leistungen von Tractebel zählte unter anderem die Tragwerksplanung, die Bauablauf- und Bauphasenplanung sowie die örtliche Bauüberwachung. Den Zuschlag für die gesamten Bauarbeiten konnte sich im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung die Unternehmensgruppe Pfaffinger sichern. Die Umsetzungsphase war von einigen Herausforderungen sowie von mehreren Überraschungen gekennzeichnet. So waren etwa die Lagerverhältnisse für ein Bauprojekt dieser Größenordnung sehr beschränkt, heißt es von Seiten der Firma Pfaffinger, die während der Betonarbeiten zwischen 20 und 25 Mann auf der Baustelle im Einsatz hatte. Für die Betonage der Bodenplatte am Trennwehr wurden 750 m³ Beton sowie rund 150 t Bewehrungsstahl verbaut. Um das Baufeld während der Betonarbeiten einigermaßen trocken zu halten, liefen bis zu 13 Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 160 m³/h gleichzeitig. Grundsätzlich war bei der Durchführung der Bauarbeiten hohe Flexibilität gefragt. Schon zu Beginn der Bauphase stellte sich heraus, dass die Spundbohlen für die Wasserhaltungsmaßnahmen wegen der geologischen Bedingungen nicht vollständig in den Boden gerammt werden konnten. Diese Situation machte ca. 2.000 Bohrmeter Bodenaustauschbohrungen notwendig, die in den Bauablauf eingeflochten werden mussten. Das Wetter meinte es auch nicht immer gut während der rund zwei Jahre andauernden Bauphase. Insgesamt drei Mal wurde die Baugrube von Hochwasserereignissen heimgesucht. Ein überraschender Fund tat sich im Juni 2023 am Grund des Flussbettes auf. Bei Abbrucharbeiten kamen Teile der Münchner Hauptsynagoge zum Vorschein, die 1938 von den Nazis zerstört worden war. Zu dem Fund, der dem Projekt internationales Medienecho verschaffte, gehörten neben vielen kunstvoll behauenen Steinen auch ein gut erhaltener Teil des Tafelschreins. Pressewirksam war zudem eine Brandanschlagserie in und um München, von der auch die Baustelle betroffen war; dabei wurde im August 2023 ein Raupenkran komplett zerstört.

F.EE GmbH Energietechnik | D-92431 Neunburg v. W. | www.fee.de/wasserkraft STEUERUNGSTECHNIK | ZERTIFIZIERUNG



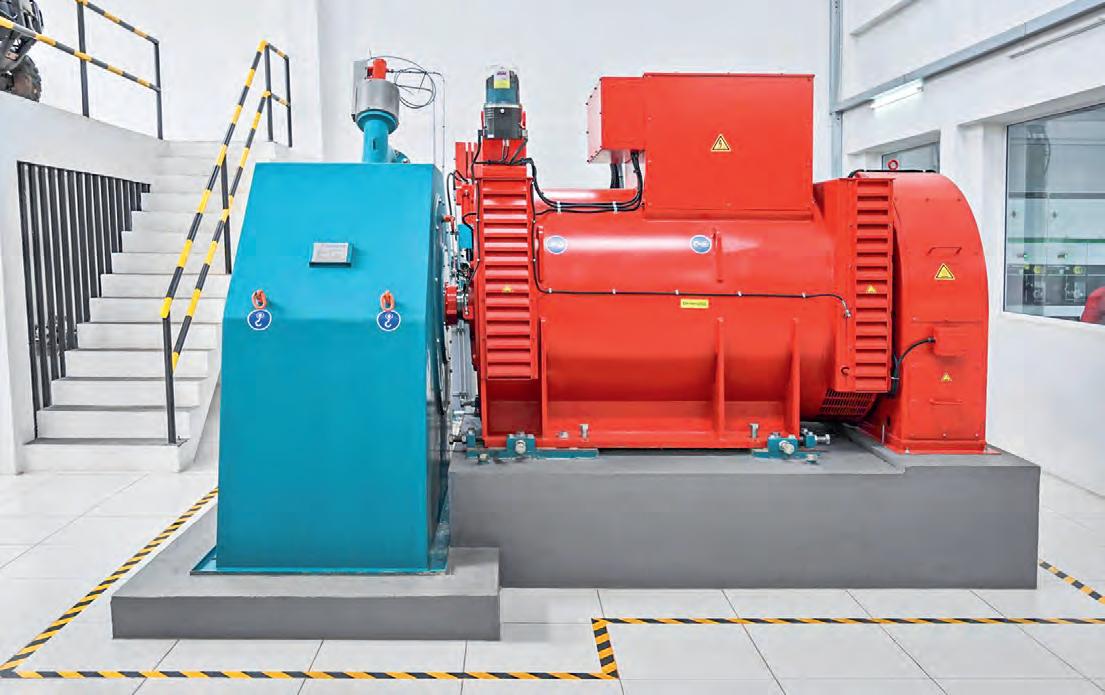
Die Pelton-Turbine des neu gebauten Kraftwerks Kumu schafft bei weit über 500 m Fallhöhe knapp 1,7 MW Engpassleistung.
Ein halbes Jahr nach der Erneuerung des Kraftwerks Moco Moco wurde im Juli 2025 im südamerikanischen Guyana die Fertigstellung des zweiten, völlig neu gebauten Wasserkraftwerks Kumu gefeiert. Komplettausgestattet wurden die zwei Anlagen der Guyana Energy Agency (GEA) von den Wasserkraftexperten der GUGLER Water Turbines GmbH. Beide Kraftwerke, die sich rund 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt befinden, stellen für die stabile Energieversorgung der abgelegenen Region eine enorme Verbesserung dar. Die Österreicher rüsteten die inselbetriebsfähigen Anlagen mit individuell maßgeschneiderten Technikpaketen aus, wobei jeweils 2-düsige Pelton-Turbinen in horizontalachsiger Bauform zum Einsatz kommen. Komplettiert werden die drei Maschinensätze durch wirkungsgradstarke Synchron-Generatoren von Marelli Motori. Von öffentlicher Seite wird das Projekt als ökologisches Referenzbeispiel gelobt, von dem eine ganze Region profitiert.
Unweit der Grenze zu Brasilien gab es in Guyana im Dezember 2024 und im Juli 2025 in energietechnischer Hinsicht Grund zur Freude. Beide Male wurden auf dem Gebiet der Kleinstadt Lethem Wasserkraftwerke eingeweiht, die als Referenzen für die umweltfreundliche Energiezukunft des südamerikanischen Landes gelten. Gerade in Upper TakutaUpper Essquibo, der größten, aber auch am wenigsten dicht besiedelten Region des Landes, die teilweise nicht an das landesweite Stromnetz angeschlossen ist, bilden die Wasserkraftwerke Moco Moco und Kumu zwei wichtige Säulen für die lokale Energieversorgung. Im Verbund mit einer kürzlich errichteten Photovoltaik-Anlage mit 1 Megawatt Peakleistung können die umweltfreundlichen Erzeugungsanlagen annähernd den Strombedarf der gesamten Region abdecken. Die Ökostromanlagen bilden eine leistungsstarke Ergänzung für die bislang in der Region dominanten Dieselaggregate und tragen somit entscheidend dazu bei, den regionalen CO2-Ausstoß zu verringern. Angaben der Islamischen Entwicklungsbank zu-
folge, die die Finanzierung der Projekte ermöglicht hat, profitieren von der Errichtung der Wasserkraftwerke über 7.500

Die Montage wurde mit vereinten Kräften durchgeführt.

Maschinengebäude des neuen Kraftwerks Kumu in Lethem
Menschen. Hinzu kommen die sozioökonomischen Effekte der Bauprojekte durch die Ankurbelung der lokalen Wirtschaft sowie die Schaffung mehrerer Dauerarbeitsplätze.
Anlagen erneuert und neu gebaut Betrieben werden die Kraftwerke von der staatlichen Guyana Energy Agency, deren CEO Mahender Sharma bei der offiziellen Inbetriebnahme des Kraftwerks Moco Moco im Dezember des Vorjahres vor allem die ökologische Verträglichkeit der Anlagen betonte. Durch die Konzeption als Ausleitungskraftwerke waren für die Errichtung wesentlich geringere Eingriffe als bei anderen Kraftwerkstypen – beispielsweise Speicheranlagen mit großem Flächenbedarf – notwendig. Einig waren sich die Gäste, darunter hochrangige Politiker und Vertreter der beteiligten Unternehmen, dass mit den Kraftwerksprojekten wichtige Schritte für die Energiestrategie des Landes gesetzt wurden, die auf den Ausbau nachhaltiger Ressourcen fokussiert. Anders als das Kraftwerk Kumu, das gänzlich neu gebaut wurde, ging das Kraftwerk Moco Moco bereits 1999 erstmals ans Netz. Die Stromproduktion sollte allerdings nur wenige Jahre dauern. Anhaltende Regenfälle lösten 2004 einen massiven Erdrutsch aus, der die Druckrohrleitung des Kraftwerks dermaßen beschädigte, dass eine Reparatur nicht möglich war – der Dauerstillstand war die Folge. Durch die Initiative der GEA konnte die von langer Hand geplante Revitalisierung des Kraftwerks, die auch eine beträchtliche Erhöhung des Leistungspotentials mit sich brachte, im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Völlig neu errichtet wurde hingegen das Kraftwerk

20 Jahre war das Kraftwerk Moco Moco stillgestanden. Seit Dezember 2024 wird in der komplett erneuerten Anlage wieder Strom erzeugt.
Kumu – wie beim Kraftwerk Moco Moco geht auch dessen Namensgebung auf das genutzte Gewässer zurück –, das sich in rund 15 Kilometer Luftlinie Entfernung befindet. Beim Kraftwerk Kumu sticht besonders die Nettofallhöhe hervor, die beachtliche 523 m beträgt und sich dementsprechend positiv auf das Leistungsvermögen der Anlage auswirkt. Im Verbund mit dem Kraftwerk Moco Moco können bei entsprechendem Wasserdargebot annähernd 2,5 MW Engpassleistung durch die Nutzung der natürlichen Ressource Wasser erreicht werden.
GUGLER schnürt Komplettpaket
Den Zuschlag als Generalauftragnehmer für die Projektumsetzung konnte sich das in Sri Lanka ansässige Unternehmen Vidullanka PLC sichern. Vidullanka ist seit Jahrzehnten vor allem auf dem heimischen Markt, aber auch in Uganda als Errichter und Betreiber von Ökostromanlagen aktiv, wobei die gesamte Palette der erneuerbaren Energieträger Sonne, Wind und Wasser abgedeckt wird. Zuständig für die elektromechanische Komplettausstattung der zwei Wasserkraftwerke in Guyana war die GUGLER Water Turbines GmbH, die eine langjährige Unternehmenspartnerschaft mit Vidullanka verbindet. „Da Südamerika für uns traditionell ein wichtiger Markt ist, war es für uns sehr erfreulich, dass wir mit dem Auftrag zum ersten Mal in Guyana aktiv werden konnten“, so der GUGLERProjektleiter Christian Poms, der vor allem die Logistik als eine zentrale Projektherausforderung nennt: „Die Abgeschiedenheit der Region gestaltete den Transport vor allem auf dem letzten Streckenabschnitt über teilweise unbefestigte Straßen

KNOWLEDGE IN OUR DNA, EXCELLENCE IN YOUR PROJECT.

Marelli Motori lieferte drei direkt mit den Laufrädern gekoppelte SychronGeneratoren mit hohen Wirkungsgraden.
etwas kompliziert.“ Inklusive der Verzögerungen durch die saisonale Regenzeit dauerte die Reise der Maschinen von Europa nach Südamerika rund zwei Monate. Damit die Montage vor Ort so schnell und unkompliziert wie möglich vorgenommen werden konnte, wurden die Maschinen in einem weit vormontierten Zustand ausgeliefert. Gleich nach den Werksabnahmen, an der auch Vertreter von Vidullanka teilnahmen, wurden die Turbinenkomponenten seefest verpackt und auf die Reise nach Südamerika geschickt. Der Einbau der Maschinen vor Ort wurde durch ein Montageteam und einem GUGLERSupervisor durchgeführt. Neben den Pelton-Turbinen und den Generatoren zählten auch die Hydraulikaggregate, die Absperrklappen, die elektrotechnische Steuer- und Schutzausrüstung, die Schaltanlagen, die Hilfsversorgungssysteme und die SCADA-Systeme zum Lieferumfang von Gugler, wobei die elektro- und regelungstechnischen Komponenten als Subauftrag von einem kroatischen Partnerunternehmen geliefert und installiert wurden.
Maschinen für Höchstleistungen
Um aus dem variierenden Wasserdargebot der beiden Flüsse ein Maximum an Effizienz zu erzeugen, setzt GEA bei beiden Kraftwerken auf individuell maßgeschneiderte Pelton-Turbinen in horizontalachsiger Bauweise. Ein wichtiger Punkt bei der Konstruktion der Turbinen war zudem deren Inselbetriebsfähigkeit, um die autarke Stromversorgung der Region abzusichern. Diese Ausführung war mit etwas erhöhtem techni-

Die Leistungsfähigkeit der Maschinen wurde bei Belastungstests sowie Wirkungsgradmessungen unter Beweis gestellt.
schem Aufwand verbunden, da die Lastspitzen im Netz durch eine äußerst kurze Reaktionszeit der Maschinen ausgeglichen werden müssen. Generell können die auf vergleichsweise geringe Durchflüsse und große Fallhöhen ausgelegten PeltonTurbinen ihre Stärken sowohl unter Volllast, als auch in einem breiten Teillastbereich ausspielen. Während beim Kraftwerk Kumu eine einzelne, auf 360 l/s und 523 m Fallhöhe ausgelegte Maschine Strom erzeugt, setzt man beim Kraftwerk Moco Moco auf eine doppelte maschinelle Lösung. Für diese Anlage wurden zwei identische Turbinen gefertigt, die auf jeweils 220 l/s Ausbauwassermenge und 207 m Fallhöhe ausgelegt sind. Aufgrund der höheren Durchflussmenge und der Kombination mit einer weitaus größeren Fallhöhe erreicht die Turbine des Kraftwerks Kumu bei vollem Zufluss 1.678 kW Engpassleistung. Auch die Leistungsfähigkeit der Kraftwerks Moco Moco ist nicht zu unterschätzen, dort erzielen die Turbinen jeweils fast 400 kW maximale Leistung. Vervollständigt werden die drei Maschinensätze durch direkt mit den Laufrädern gekoppelte Synchron-Generatoren vom italienischen Branchenexperten Marelli Motori, der aus guten Gründen als Spezialist bei der Umsetzung maßgeschneiderter und hochwertiger Lösungen im Wasserkraftbereich geschätzt wird. Das Unternehmen beruft sich auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und ist bekannt für die Fertigung zuverlässiger Maschinen, die sich durch beste Wirkungsgrade und eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit über viele Betriebsjahre hinweg auszeichnen. Für die Kraftwerke in Guyana lieferte Marelli Motori luftgekühlte
Ausbauwassermenge: 360 l/s
• Nettofallhöhe: 523 m Turbine: 2-düsige Pelton
• Turbinenachse: horizontal Ø Laufrad: 788 mm
• Engpassleistung: 1.678 kW
Hersteller: GUGLER Water Turbines GmbH
• Generator: Synchron
Nennscheinleistung: 2.035 kVA
Hersteller: Marelli Motori
Ausbauwassermenge: 2 x 220 l/s
• Nettofallhöhe: 207 m
Turbinen: 2-düsige Pelton
Turbinenachsen: horizontal Ø Laufrad: 488 mm
Engpassleistung: 2 x 393,5 kW
• Hersteller: GUGLER Water Turbines GmbH
Generatoren: Synchron
• Nennscheinleistung: 2 x 470 kVA
Hersteller: Marelli Motori

Die exakte Steuerung der PeltonDüsen erfolgt durch hydraulische Aktuatoren.
Maschinen mit Wälzlagerungen und automatischen Nachschmiereinrichtungen, die durch den Einbau von zusätzlichen Schwungrädern für die Inselbetriebsfähigkeit der Kraftwerke ausgelegt wurden.
Erwartungen übertroffen
Bei den Inbetriebnahmeprozessen der neuen Kraftwerke Ende des Vorjahres bzw. Mitte 2025 zeigte sich, dass die österreichischen Wasserkraftprofis ihrem guten Ruf erneut gerecht werden konnten. Die Leistungstests bestätigten, dass die Turbinen die vertraglich zugesicherte Effizienz sogar übertrafen. Hier machte sich die Entwicklungsarbeit von GUGLER während der letzten Jahre mit modernen Simulationsmethoden und auf dem Modellprüfstand der TU Wien bezahlt. Projektleiter Christian Poms freut sich nicht nur in technischen Belangen über das Ergebnis der zwei Referenzprojekte: „Wir sind stolz, dass wir zum ersten Mal in Guyana aktiv werden und für die Menschen vor Ort viel Gutes bewirken konnten. Grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass Guyana stark auf erneuerbare Energien setzt.“

Bei den Feierlichkeiten zur Fertigstellung des Kraftwerks Kumu lobte der als Ehrengast anwesende Premierminister Mark Phillips den wichtigen Beitrag, den die neuen Wasserkraftwerke für den regionalen Energiehaushalt leisten. Gemeinsam mit einer ebenfalls kürzlich fertiggestellten Photovoltaikanlage können in Lethem nun bis zu 3,47 Megawatt Leistung abgeru-
fen werden. Den Energiemix aus Photovoltaikanlagen, Kleinwasserkraftwerken und fossiler Erzeugung bezeichnete der Premierminister als Vorbild, das im ganzen Land in entlegenen Gebieten zur Anwendung kommen könnte. In Lethem wird die Sinnhaftigkeit des Projekts durch nüchterne Zahlen untermauert: In Summe können mit den neuen Wasserkraftwerken im Regeljahr rund 14,2 GWh Strom erzeugt werden. Das wiederum schlägt sich in einer bis zu 50-prozentigen Verringerung des benötigten Diesels nieder, womit ca. 8.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.


Sedimente im Triebwasser gelten als eine der größten unsichtbaren Gefahren für die Turbinen von Hochdruckanlagen. Um ihr Schädigungspotenzial zu minimieren, kamen bislang vorrangig Trübungssonden im Oberwasser zum Einsatz, die jedoch markante Schwächen aufweisen. Der oberösterreichische Wasserkraftspezialist Global Hydro machte sich auf die Suche nach Alternativen und wurde in der Kombination aus Körperschallsensorik und künstlicher Intelligenz fündig: Die neue Technologie, die man unter dem Namen Hydrox SediSense zur Marktreife geführt hat, ermöglicht erstmals eine präzise Detektion von schädlichen Partikeln dort, wo sie tatsächlich wirken – direkt an den kritischen Turbinenbauteilen. Die Innovation markiert eine Weltpremiere in der Wasserkraft und revolutioniert nicht nur die Art, wie Betreiber ihre Anlagen vor Abrasion schützen können, sondern eröffnet zudem neue Möglichkeiten für eine Maximierung der wirtschaftlichen Betriebsführung.
Der Klimawandel wirkt sich auf die Fließgewässer und damit auch auf die Wasserkraftnutzung aus. Starkregen und Sturzfluten nehmen ebenso zu wie ausgeprägte Trockenphasen, Gletscher schmelzen ab. Das führt dazu, dass die Sedimentbelastung im Triebwasser ansteigt, besonders in den Gebirgsregionen Europas und Asiens. Welche Auswirkungen die zum Teil mikroskopisch kleinen Partikel im Triebwasser auf die betroffenen Turbinenkomponenten haben, ist vielen Betreibern wohlbekannt: Verschleiß an den Laufrädern und anderen Turbinenbauteilen. Die Folgen: sinkende Wirkungsgrade, steigende Wartungskosten und im schlimmsten Fall ungeplante Stillstände.
„Wir sehen gerade bei Kraftwerken, die Gletscher in ihrem Einzugsgebiet haben, oder deren Triebwasser stark von sedimentbelasteten Flüssen kommt, große Herausforderungen. Aus diesem Grund haben wir uns vor einigen Jahren die Frage gestellt: Wie können wir dieser Gefahr mit unseren digitalen Lösungen

Spuren von Sedimenterosion an der Leitschaufel einer Francisturbine.

Sedimente, wie hier in einem Oberwasserkanal eines Kraftwerks in Asien, stellen eine unmittelbare Gefahr für die Turbine dar.
entgegenwirken?“, erläutert Thomas Stütz, Leiter Electrical Engineering und Software Entwicklung bei Global Hydro Energy, die Ausgangssituation. Er verweist darauf, dass man bereits seit längerem gewusst habe: Die Sedimentbelastung erfolgt nicht kontinuierlich, sondern vielmehr sporadisch. Es gelte daher, diese Peaks zu glätten, denn genau diese Phasen der extremen Spitzenbelastungen zögen die massivsten Schädigungen der Laufräder nach sich. „Aber diese Spitzen rechtzeitig zu erkennen, das war bis dato äußerst schwierig“, so der Fachmann.
Trübungsmessungen liefern suboptimale Daten Bislang setzten Betreiber vor allem auf Trübungsmessungen, um Sedimente im Oberwasser zu detektieren. Belastbare Daten waren auf diese Weise aber sehr oft nur bedingt zu generieren. Die Gründe dafür liegen vor allem darin, dass die Sonden selbst auch den widrigen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Ob das nun Algen, Luftblasen oder organische Schwebstoffe sind: All diese Einflussfaktoren können zu einem „falsch-positiven“ Messergebnis führen. Konkret heißt das: Es wird Trübung konstatiert und die Anlage gegebenenfalls abgestellt, obwohl möglicherweise kein Schädigungspotenzial vorliegt. „Diese Sonden erfassen eben nur die Wasserqualität, aber nicht das konkrete Schädigungspotenzial. Zudem sind sie oft kilometerweit von der Turbine entfernt montiert, schwer zugänglich, wartungsintensiv und störanfällig gegenüber diversen Einflüssen“, erklärt Günther Weidenholzer, Teamleiter im Bereich Data Science bei Global Hydro. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich auf die Suche nach einer Alternative zu branchenüblichen Trübungsmessungen gemacht und damit bei Global Hydro den Stein ins Rollen gebracht.
Technologie kommt aus der fossilen Industrie „Wir wollten einen anderen Weg gehen, indem wir mit unserem Ansatz das direkte Schädigungspotenzial detektieren“, sagt Günther Weidenholzer. Den Schlüssel für eine neue techno-


liert – d.h. doppelte Schallintensität bedeutet in etwa doppelte Schädigung. Und das ist in Rohrleitungen mit Gas genauso wie in solchen mit Wasser.
logische Anwendung sollte er allerdings nicht in der Wasserkraft selbst, sondern vielmehr in der fossilen Energieerzeugung finden. „In der Erdölförderung werden Körperschallanalysen im Ultraschallbereich seit Jahrzehnten genutzt, um abrasive Sandpartikel in Rohrleitungen frühzeitig zu erkennen. Diese robuste und erprobte Technologie haben wir nun für die Entwicklung von Hydrox SediSense erfolgreich für die Wasserkraft adaptiert“, so der Ingenieur. Doch wie genau funktioniert das Prinzip hinter der Technologie?
Seit den 1980er-Jahren wird über die Problematik von Sandpartikeln in Förderanlagen sowie Pipelines berichtet. Diese Partikel verursachen bei hoher Strömungsgeschwindigkeit Schäden an Rohrleitungen, insbesondere an Stellen mit Richtungsänderungen, wie etwa nach 90-Grad-Bögen oder an Hindernissen. An genau solchen Stellen kamen erstmals Körperschallsensoren zum Einsatz, um die durch Partikelkollisionen entstehenden Schallereignisse zu erfassen. Das Messprinzip beruht darauf, dass jede Partikelkollision einen Körperschallimpuls erzeugt, dessen Intensität direkt mit dem Ausmaß der mechanischen Belastung und damit der Schädigung korre-

Das Kraftwerk Luggauerbach in Dorfgastein (Österreichische Bundesforste AG) dient als Pilotanlage, die mit Hydrox SediSense überwacht wird. Auch das Hosenrohr bietet sich für die Applikation der Messsonde an.
Einfache Montage für eine kostengünstige Lösung Für eine entsprechende Anwendung dieser Technologie in der Wasserkraft können die Körperschallsensoren an exponierten Bauteilen der Turbine montiert werden. Und das – ein markanter Vorteil – im Trockenen. Die Montage erfolgt in der Regel zerstörungsfrei, ohne Bohren oder Schweißen, zumeist mittels Klebeadaptern. Eine externe Infrastruktur am Einlauf ist obsolet. „Das macht die Lösung besonders attraktiv für Hochdruckanlagen, bei denen der Einlauf oft kilometerweit entfernt liegt. Dank einfacher Integration in bestehende Systeme ist Hydrox SediSense sowohl für Neuanlagen als auch für die Nachrüstung ideal geeignet“, erklärt Günther Weidenholzer und räumt ergänzend ein: „Nur bei vertikalen, vollständig einbetonierten Peltonturbinen kann die Nachrüstung technisch anspruchsvoller sein.“ Konkret können die Sensoren etwa an der Einlaufklappe oder am Konus vor dem Ventil angebracht werden. Im Fall einer Peltonturbine an den Rohrkrümmern oder am Hosenrohr, im Fall der Francisturbine an Spiralgehäuse, Leitschaufel oder Saugrohr.
Neben der Tatsache, dass es sich bei den Körperschallsensoren um eine sehr robuste und völlig wartungsfreie Technologie handelt, bringt sie noch einen weiteren Vorteil mit sich: Sie ist äußerst kostengünstig. Branchenübliche Trübungsmessungen sind zum Teil um ein Mehrfaches teurer.
Von der klassischen Physik zur Datenanalyse Wenn Sedimente durch das Triebwasser transportiert werden, wirken sie dort am stärksten, wo das Wasser umgeleitet, beschleunigt oder auf feste Strukturen trifft – also etwa an Leitschaufeln, Einlaufbaugruppen oder im Bereich von Krümmungen und Engstellen. „Genau hier platzieren wir die Sensoren: auf den kritischen Turbinenkomponenten im Krafthaus. Sie erfassen Körperschallwellen im Ultraschallbereich, die durch den Aufprall der Sedimentpartikel entstehen. Diese Einschläge erzeugen je nach Größe, Geschwindigkeit und Härte der Partikel ein charakteristisches Schallmuster“, erklärt Weidenholzer. Und für die Auswertung dieses Schallmusters bringen die Experten von Global Hydro nun KI ins Spiel.
„Wir haben dafür KI-basierte Algorithmen entwickelt, die die üblichen Betriebsgeräusche abhängig vom aktuellen Betriebszustand abtrennen. Auf diese Weise kann ein spezielles Machine-Learning-Modell die Daten analysieren und jede Abweichung vom Normalbetrieb erkennen“, erklärt Daten-Spezi-
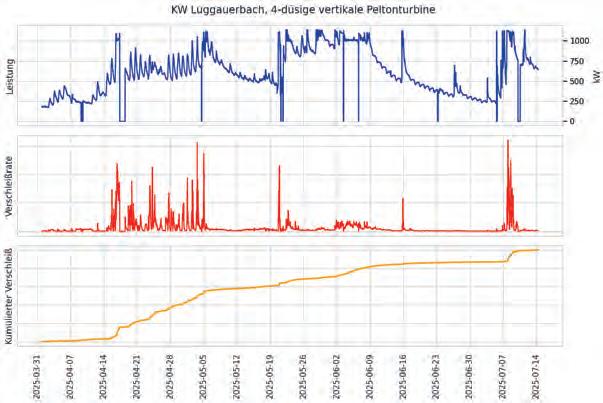
Die rote Kurve im Diagramm gibt die Verschleißrate wieder. Auswertung von Hydrox SediSense bei der 4-düsigen Peltonturbine des KW Luggauerbach.
alist Thomas Stütz. Mit anderen Worten: Relevante Einschlagsgeräusche werden intelligent vom Betriebsrauschen getrennt, woraus sich Aussagen über ein mögliches Schädigungsszenario treffen lassen.
Was hier einfach klingt, ist in der Praxis alles andere als trivial. „Eine Schwierigkeit liegt darin, dass Wasserkraftwerke prinzipiell sehr unterschiedlich und komplex sind. In der Datenanalyse besteht die Herausforderung für uns darin, die maßgeblichen Daten mithilfe von KI bestmöglich zu modellieren, um daraus belastbare Aussagen ableiten zu können“, sagt Felix Minixhofer vom Data Science Team bei Global Hydro, der zu diesem Thema gerade seine Master-Arbeit schreibt.
Für ihn liegt der Vorteil dieses Ansatzes auf der Hand: „Wir können mit unseren Tools dort messen, wo es die Turbine ‚spürt‘ und nicht irgendwo in der Wasserfassung.“
eine andere, dass man die Lastverteilung zwischen den Turbinen adaptiv optimiert: Welche Einheit verträgt Sedimente unter welcher Last besser? Unterstützung bietet hier die IEC 62364, die Richtlinien zur Bewertung von Sedimenterosion liefert. „Wirtschaftlich entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Sedimentbelastung und Wirkungsgradverlust. Das konnte unser Team unter anderem auch in Analysen für renommierte Wasserkraftbetreiber in Österreich aufzeigen“, sagt Günther Weidenholzer. Sedimente verändern die Geometrie der Laufräder, wodurch der Wirkungsgrad sinkt – und mit ihm über die Zeit auch die Erträge. Mit seinen neuen Machine-Learning-Modellen gelingt es Global Hydro, hier Transparenz zu schaffen: Sie liefern ein klares Bild über den Zustand der Turbine, etwa auch den Verschleiß von Dichtungen und den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt für Wartungsmaßnahmen.
Wechselwirkung von Sedimenterosion und Kavitation
„Dank KI-Modellen wird aus Schallinformation eine belastbare Entscheidungsgrundlage – und aus digitaler Intelligenz ein echter Betriebs- und Wettbewerbsvorteil“, sagt Günther Weidenholzer, Teamleiter im Bereich Data Science bei Global Hydro.
Betriebswirtschaftliche Vorteile dank digitaler Intelligenz
Das KI-Modell von Hydrox SediSense analysiert permanent die akustische Signatur der Turbine im Optimalbetrieb. „Jede noch so kleine Abweichung vom Normalzustand wird erkannt – etwa durch veränderte Einschlagsmuster bei erhöhter Sedimentbelastung. Unsere Data Science Experten interpretieren diese Signale mittels Machine Learning und Anomalieerkennung und können daraus entscheidende Erkenntnisse ableiten, wie: Wann treten schädliche Sedimente auf? Ab welcher Belastung ist ein Abschalten wirtschaftlich sinnvoller als weiterzufahren?“, sagt Günther Weidenholzer und ergänzt: „Auf diese Weise wird aus Schallinformation eine belastbare Entscheidungsgrundlage – und aus digitaler Intelligenz ein echter Betriebs- und Wettbewerbsvorteil.“
Die daraus abgeleiteten Rückschlüsse ermöglichen nun statt pauschal angesetzter Wartungszyklen präzise Handlungsempfehlungen: Gezielte Abschaltungen werden nur dann vorgenommen, wenn Erosionsschäden tatsächlich betriebswirtschaftlich nicht mehr tragbar sind. Als Grundlage dafür dienen die kontinuierlich weitertrainierten KI-Modelle, die in Echtzeit mit Daten vom Turbinenregler versorgt werden. So lassen sich Zustandsveränderungen früh erkennen, und diese Erkenntnisse in Echtzeit, etwa über Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, dem Betreiber zuführen. Eine Option ist, dass auf dieser Basis etwa Unterlieger frühzeitig gewarnt werden können,
Ein Punkt, an dem die Ingenieure von Global Hydro noch eifrig tüfteln, ist die Einbeziehung eines bislang unterschätzten Aspekts in der Wasserkraft: die komplexe Wechselwirkung zwischen Sedimenterosion und Kavitation – zwei Phänomene, die sich nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern im schlimmsten Fall sogar gegenseitig verstärken. Beide Prozesse erzeugen Körperschall, was zwar grundsätzlich messbar, aber von der präzisen Zuordnung her zumeist schwierig ist – insbesondere, weil sich die Schadensbilder überlagern. „Kavitation hinterlässt typischerweise feine, scharfkantige Löcher im Laufrad, Sedimente hingegen schleifen die Oberfläche wieder glatt – so entstehen Zyklen von Schädigung und scheinbarer ‚Reparatur‘, die in der Körperschallanalyse bislang nur schwer differenzierbar waren“, erklärt Lorenz Neururer, der das HydroLab leitet und als der Experte für Kavitation bei Global Hydro gilt. Besonders bedrohlich für die Turbine wird es, wenn eine ungünstige Betriebsweise mit einer hohen Sedimentfracht zusammentreffen: Dabei können Sedimente Kavitationskeime ausbilden und damit diese Art der Schädigung indirekt forcieren. Umgekehrt bieten beste-

Ein weiterer Vorteil der Körperschallsonden gegenüber den konventionell eingesetzten Trübungssonden ist, dass sie wesentlich günstiger sind.

Renommierte Kraftwerksbetreiber wie TIWAG testen schon heute die Möglichkeiten, die Hydrox SediSense eröffnet: Wie hier beim ÖWKKraftwerk Tumpen-Habichen im Tiroler Ötztal.
hende Kavitationsschäden ideale Angriffsflächen für abrasive Partikel. Diese sich gegenseitig verstärkenden Prozesse sind mit herkömmlichen Messmethoden kaum zu erfassen. Mit den neuen Ansätzen über die Körperschallmessungen gelingt es Global Hydro, hier immer mehr Transparenz in die komplexe Wechselwirkung von Erosion und Kavitation zu bringen. Das motivierte Team des oberösterreichischen Wasserkraftspezialisiten gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden und forscht weiter.
Überzeugende Resultate in Tiroler Referenzprojekt
Erste praktische Anwendungen zeigen schon jetzt eindrucksvoll, wie datenbasierte Entscheidungen schnell zu einem handfesten Mehrwert werden können. Bestes Beispiel: ein aktuelles Pilotprojekt am von der Ötztaler Wasserkraft GmbH errichteten Kraftwerk Tumpen Habichen in Tirol, dessen Betriebsführung der TIWAG obliegt. Es basiert auf langjährigen Messreihen zur Sedimentkonzentration in der Ötztaler Ache. Das Resultat war mehr als überzeugend, wie Thomas Stütz betont: „Das Modell
für diese Anwendung konnte sehr schnell trainiert werden, es benötigte eine geringere Datenbasis als angenommen. Die Verantwortlichen der TIWAG erhalten damit einen stabilen, aussagekräftigen Messwert zum Schädigungspotential, den sie in Echtzeit im HydroxConnect Portal einsehen können. Vergleiche mit der Trübungssonde zeigen das HydroxSediSense einen verlässlicheren und besseren Wert liefert.“ Dabei zeigen die Ergebnisse auch: Die Weltneuheit Hydrox SediSense ist mehr als ein Diagnoseinstrument – es wird zukünftig auch ein Schlüssel zu wirtschaftlich optimiertem Kraftwerksbetrieb.
„Hydrox SediSense erkennt potenzielle Schäden, bevor sie entstehen, und ermöglicht es Betreibern, ihre Betriebsweise dynamisch daran anzupassen. So wird aus punktuellen Maßnahmen ein ganzheitliches Schutzkonzept, das Prävention auf ein neues Niveau hebt“, sagt Heinz-Peter Knass, Geschäftsführer von Global Hydro.

Mit Hydrox SediSense erweitert Global Hydro seine Digital Solutions um ein innovatives, KI-gestütztes Messsystem zur Echtzeit-Erkennung von Sedimentverschleiß an Turbinen und setzt damit neue Maßstäbe.
Das Tool von Global Hydro markiert einen entscheidenden Fortschritt im Umgang mit sedimentbedingtem Verschleiß in der Wasserkraft – insbesondere in Hochdruckanlagen alpiner und glazial geprägter Regionen, wie sie in Europa und Asien häufig vorkommen. Gerade dort, wo hohe Sedimentfrachten und unzureichende Entsandungsinfrastruktur zusammentreffen, liefert das System belastbare Echtzeitdaten für eine vorausschauende Betriebsführung. Dank einfacher Integration ist es sowohl für Neuanlagen als auch zur Nachrüstung bestens geeignet. „Der eigentliche Paradigmenwechsel liegt im Zusammenspiel von bewährten Schutzmaßnahmen gegen Verschleiß – wie hochfesten Werkstoffen, intelligenten Beschichtungen oder strömungsoptimierten Designs – mit datenbasierter Analyse: Hydrox SediSense erkennt potenzielle Schäden, bevor sie entstehen, und ermöglicht es Betreibern, ihre Betriebsweise dynamisch daran anzupassen. So wird aus punktuellen Maßnahmen ein ganzheitliches Schutzkonzept, das Prävention auf ein neues Niveau hebt“, rückt Geschäftsführer Heinz-Peter Knass die Innovation aus dem Hause Global Hydro in einen größeren Rahmen. Für Betreiber, die auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit setzen, ist Hydrox SediSense weit mehr als ein Mess- und Analysesystem – es ist ein intelligenter Partner im Kampf gegen den unsichtbaren Feind Sediment.
Vorteile von Hydrox SediSense
• Direktmessung der Schädigung: Anders als Trübungssonden, die indirekte Kenngrößen liefern, misst Hydrox SediSense den Einfluss der kinetischen Energie der Partikel – und somit den direkten Verschleiß.
• Kostengünstige Hardware, intelligenter Algorithmus
• Die Sensorik ist preiswert, robust und einfach zu installieren. Der wahre Wert liegt in der KI-gestützten Auswertung, die individuell für jede Anlage trainiert wird.
• Einfach nachzurüsten
• Dank der Montage außerhalb des Wassers ist die Lösung perfekt für Anlagen mit schwer zugänglichen Einläufen geeignet, zudem für Kraftwerke in Gletscherregionen oder Gebieten mit starkem Geschiebeeintrag.
Gefördert durch AWS: Die Entwicklung und Markteinführung von Hydrox SediSense wurde durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) unterstützt.

Rohrschüsse DN2200 mit Epoxyd-Innenbeschichtung für die Lotschachtpanzerungen des Wasserkraftwerks Stanzertal
In ihrem über 30-jährigen Bestehen hat sich die Tiroler ALPE PIPE SYSTEMS GmbH & Co. KG einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Partner für den Trink- und Abwasserbereich sowie den Industrie- und Energiesektor erarbeitet. In Westösterreich konnte ALPE in den vergangenen Jahren sein Know-how bei einer ganzen Reihe von Projekten unter Beweis stellen. Etwa beim Bau des 2015 fertiggestellten Kraftwerks Stanzertal mit ca. 52 GWh Regelarbeitsvermögen, bei dem ALPE für die Lieferung der großformatigen Lotschachtpanzerungen und die Stollenausleitung in den Dimensionen DN2200 und DN2000 zuständig war. Darüber hinaus sind die Vertriebsprofis auch die richtigen Ansprechpartner für spezielle Lösungen im Rohrleitungsbau. Dies zeigte sich bei der Erneuerung einer Innsbrucker Trinkwasserquelle, für die individuell gefertigte Sonderformstücke geliefert wurden. Auch beim Bau des neuen Kleinwasserkraftwerks Klaus am Ellmaubach im Salzburger Pongau konnte ALPE seine Kompetenz durch die Lieferung einer passgenauen Rohrbrücke mit integrierten Be- und Entlüftungsventilen unter Beweis stellen.
Es ist zwar schon eine Weile her, aber das Wasserkraftprojekt im Tiroler Stanzertal sorgte vor einem Jahrzehnt in der Branche für beträchtliches Aufsehen. Bei dessen Realisierung stachen besonders die überaus kurzen Projektierungs-, Planungs- und Umsetzungszeiten hervor. So vergingen von den anfänglichen Konzeptionen im Jahr 2010 bis zu Inbetriebnahme der ersten Maschinen im Herbst 2014 weniger als fünf Jahre – angesichts des beträchtlichen Bauaufwands eine äußerst respektable Leistung. Auch die Eigentümerverhältnisse der Wasserkraft Stanzertal GmbH stellen eine Besonderheit dar: Dank eines findigen Geschäftsmodells konnten sich die fünf Gemeinden Flirsch, Pettneu, St. Anton, Strengen und Zams, drei Tiroler Energieversorgungsunternehmen sowie die Innsbrucker Projektentwicklungsgesellschaft INFRA an der Kraftwerksgesellschaft beteiligen.
Leistungsstarke Anlage
Grundsätzlich handelt es sich bei der Anlage Stanzertal um ein Ausleitungskraftwerk mit Stollenspeicher. Die mit einer Wehr-

Eindruck von der Rohrverlegung im Stanzertal

Im Ausleitungsstollen des Kraftwerks Stanzertal wurden die spiralgeschweißten Rohre auf massiven Betonsätteln befestigt.
klappe ausgerüstete Wasserfassung des Kraftwerks befindet sich am Gewässer Rosanna in der Gemeinde Flirsch. Von dort wird das Triebwasser über einen insgesamt 5,4 km langen Kraftabstieg, der den 4,8 km langen Einlauf- und Speicherstollen beinhaltet, zum Maschinenhaus in der Gemeinde Strengen geleitet. Die Herzstücke der Anlage bilden drei 6-düsige PeltonTurbinen, die im Verbund 13,5 MW Engpassleistung erreichen. Der erzeugte Strom wird vom Krafthaus durch ein erdverlegtes 25 kV-Kabel zum Umspannwerk Tobadill geleitet, und von dort in das öffentliche Netz eingespeist. Das abgearbeitete Triebwasser fließt über einen vollständig geschlossenen Unterwasserkanal zurück in die Rosanna.
ALPE liefert hochwertiges Rohrmaterial
Mit erheblichem baulichem Aufwand war die Herstellung des Triebwasserstollens verbunden. Zur Realisierung dieses Bauabschnitts kam eine 380 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine zum Einsatz, die sich rund 4 km durch den Untergrund im Stanzertal arbeitete. Am Ende des Stollens befindet sich das Wasserschloss der Anlage, wo der Druckstollen in einen 100 m tiefen, senkrecht abfallenden Lotschacht übergeht. Für die Lotschachtpanzerung lieferte ALPE spiralgeschweißte Stahlrohre DN2200 mit jeweils 6 m Stangenlänge, die außen rohschwarz bzw. innen mit einer Epoxydbeschichtung versehen wurden. „Dabei wurden als Besonderheit sämtliche Aussteifungen und Verpressöffnungen der Rohre, welche für die nach der Verlegung erforderlichen Betonverpressungen notwendig waren, bereits werksseitig hergestellt. Bauseits mussten lediglich die Verbindungsschweißnähte zwischen den Rohren hergestellt werden“, erklärt ALPE-Geschäftsführer Luis Kluibenschädl. Der Übergang in den Ausleitungsstollen erfolgt durch einen Rohrbogen mit 87°, der die Leitungsdimension gleichzeitig von DN2200 auf DN2000 reduziert. Dieses Sonderformstück wurde vor Ort aus Rohrsegmenten individuell gefertigt und wie die Lotschachtpanzerung einzementiert. Für die Stollenausleitung, die auf einer Länge von ca. 500 m zum Maschinengebäude führt, wurden spiralgeschweißte Stahlrohre DN2000 mit einer Länge von jeweils 12 m verwendet. Die Rohre wurden innen mit einer Epoxydbeschichtung und außen mit einer hochwertigen Polyethylenumhüllung ausgeführt. Auch bei diesem abschließenden Abschnitt des Triebwasserwegs wurden alle Rohre bereits werksseitig mit den erforderlichen Gehrungsschnitten sowie mit den Mannlöchern versehen. Luis Kluibenschädl betont, dass die Herausforderung der langen Anlieferung vom

Bei der Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung der Tiroler Mühlauer Quelle lieferte ALPE maßgeschneiderte Sonderformstücke.
Rohrhersteller nach Tirol von ALPE problemlos bewältigt werden konnte – sämtliche Rohre trafen termingerecht auf der Baustelle ein.
Herzstück der Innsbrucker Wasserversorgung revitalisiert An der Revitalisierung der Mühlauer Quelle, die zu den ältesten und bedeutendsten Trinkwasserquellen Tirols zählt und die Landeshauptstadt Innsbruck mit frischem Quellwasser versorgt, war ALPE ebenfalls beteiligt. 2022 startete das Projekt, bei dem das Versorgungssystem im Zuge von laufenden Infrastrukturverbesserungen einer grundlegenden Sanierung unterzogen wurde. Im Fokus der Sanierung stand die Zuleitung, über die das Quellwasser zunächst in einem bestehenden Trinkwasserkraftwerk zur Stromversorgung genutzt, und danach in das städtische Versorgungsnetz eingeleitet wird. Damit die doppelte Nutzung des Wassers für die Energiegewinnung und die Trinkwasserversorgung reibungslos abläuft, waren besondere technische Lösungen von ALPE gefordert, betont Luis Kluibenschädl: „Für die Hoch- und Tiefpunkte sowie für die T-Stücke und Übergänge wurden Stahlformteile verbaut, die exakt auf die örtlichen Gegebenheiten und das hydraulische Verhalten der Leitung abgestimmt werden mussten. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten wie Höhenunterschiede, enge Kurvenradien sowie der geforderten Maßgenauigkeit bei den Formteilen waren Standardformteile aus Guss nicht ausreichend.“ Stattdessen kamen geschweißte Segmentbögen mit individuellen Radien, Stahlformteile für Hoch- und Tiefpunkte mit aufgesetzten Be- und Entlüftungsventilen sowie T-Stücke mit Sonderbaulängen zum Einsatz. „Sämtliche Stahl-

Sonderformstücke

Für das neue Kleinwasserkraftwerk am Ellmaubach lieferte ALPE eine spezielle Rohrbrücke mit integrierten Be- und Entlüftungsventilen.
formteile wurden werkseitig vorgefertigt und mussten auf der Baustelle nur mehr angeschlossen werden. Weitere Verarbeitungsschritte waren nicht mehr nötig, da die Stahlformteile bereits PE-umhüllt und mit einer Zementmörtelauskleidung beschichtet waren“, so der Geschäftsführer.
Rohrbrücke nach Maß gefertigt
Die Individualfertigungskompetenz konnte ALPE beim Bau eines neuen Kleinwasserkraftwerks in der Marktgemeinde Großarl im Salzburger Pongau erneut unter Beweis stellen. Das von der Familie Andexer und der Familie Ammerer zwischen Juni und Dezember 2024 realisierte Kraftwerk Klaus am Ellmaubach nutzt eine Ausbauwassermenge von 900 l/s. Ins Maschinengebäude gelangt das Triebwasser durch eine rund 1,2 km lange
Druckrohrleitung DN700. Die Anfang des Jahres zum ersten Mal in Betrieb genommene 6-düsige Pelton-Turbine erreicht unter Volllast ca. 600 kW Engpassleistung, im Regeljahr rechnen die Betreiber mit rund 2,5 GWh Stromerzeugung. Bei der Verlegung der Druckrohrleitung stellte der Verlauf des Ellmaubachs ca. 100 m unterhalb der Wasserfassung ein natürliches Hindernis dar. Da eine Bachunterquerung aus baulichen Gründen mit zu viel Aufwand verbunden gewesen wäre, wurde schließlich eine oberirdische Variante für diesen Trassenabschnitt gewählt. Die Rohrbrücke besteht aus robusten Stahlrohren DN600 mit speziell aufgeschweißten Flanschverbindungen, die in enger Abstimmung mit dem Kraftwerksplaner konstruiert wurden. „Dank der Vorfertigung konnte nicht nur höchster Qualitätsstandard gewährleistet, sondern auch die Montagezeit auf der Baustelle erheblich reduziert werden – ein bedeutender Vorteil, insbesondere in topografisch anspruchsvollen Lagen wie im alpinen Raum“, sagt Luis Kluibenschädl, der im Anschluss auf das integrierte Be- und Entlüftungssystem an den Fixpunkten der Rohrbrücke hinweist: „Besondere Aufmerksamkeit galt der Sicherheit und der Funktionalität der Rohrleitung. Daher wurde die Konstruktion mit exakt positionierten Be- und Entlüftungsventilen DN150 ausgestattet, die Druckschwankungen im Betrieb effektiv ausgleichen und potenzielle Lufteinschlüsse im Leitungssystem verhindern.“
Die drei vorgestellten Projekte zeigen einen Querschnitt über das umfangreiche Portfolio der Stamser Rohrexperten, deren Kompetenz nicht nur in Österreich geschätzt wird. Davon zeugen eine Vielzahl von Projekten, die ALPE in den vergangenen Jahrzehnten im In- und Ausland erfolgreich umgesetzt hat. Die Kunden der Tiroler profitieren von mehr als 30 Jahren Erfahrung und schätzen das qualitativ hochwertige Rohrmaterial, die kompetente Beratung sowie den verlässlichen Service.
WIR LIEFERN ...
Stahlrohre und Formteile
Gussrohre und Formteile
Armaturen
Rohrleitungszubehör

ALPE PIPE SYSTEMS GmbH & Co. KG
Auweg 3 | 6422 Stams | Tel: +43 (0) 5263/51110-0 office@alpepipesystems.com | www.alpepipesystems.com

Kugelschieber gelten allgemein als das sicherheitstechnische Herzstück in einem Hochdruck-Wasserkraftwerk. Als primäres Sicherheitsorgan sorgen sie dafür, die anstehende Wassersäule sicher von den Maschinen zu trennen, dadurch können bei Notabschaltungen Kräfte von mehr als 400 Tonnen auf die Absperrorgane wirken. Im Fall des Pumpspeicherkraftwerks Happurg in Mittelfranken, das seit 2011 wegen Schäden im Oberbecken stillsteht, werden aktuell die Kugelschieber einem umfassenden Retrofitprogramm unterzogen. Umgesetzt wird dieses anspruchsvolle Teilprojekt vom bayerischen Stahlwasserbauspezialisten MUHR, der auch in Sachen Kugelschieber-Technik über großes Know-how und entsprechende Erfahrung verfügt.
Es geht um nicht weniger als die technische und energiewirtschaftliche Wiederauferstehung eines bayerischen Kraftwerksklassikers – des Pumpspeicherkraftwerks Happurg im Landkreis Nürnberger Land, das aktuell wiederbelebt wird. Zu diesem Zweck startete der Betreiber Uniper 2024 ein umfassendes Sanierungs- und Modernisierungsprogramm mit einem Investitionsvolumen von rund 250 Millionen Euro, das 2028 abgeschlossen sein soll. Damit kehrt die Anlage als wichtiger Baustein der Energiewende in das deutsche Stromnetz zurück Das Kraftwerk Happurg wurde 1958 nach nur vierjähriger Bauzeit in Betrieb genommen und galt lange Zeit als technisches Vorzeigeprojekt. Es war bis zu seiner Stillsetzung das größte Pumpspeicherkraftwerk in Bayern und eines der bedeutendsten seiner Art in Deutschland. Mit seinen vier Francis-Pumpturbinen ist die Anlage auf eine installierte Gesamtleistung von 160 MW ausgelegt. Das Anlagenkonzept sieht die Nutzung der Gefällstufe zwischen dem Oberbecken, einem künstlich angelegten Speichersee auf dem Deckersberg, sowie dem ebenfalls künstlich angelegten Happurger See als Unterbecken über eine Höhe von 209 Meter vor. Das Betriebskonzept entspricht der klassischen Nutzung eines alpinen Pumpspeicherkraftwerks: Bei Stromüberschuss – etwa nachts oder bei hoher Windkraft- bzw. Photovoltaikeinspeisung – wird Wasser ins Oberbecken gepumpt. Bei Spitzenbedarf wird es wieder abgelassen, um Strom zu erzeugen. Auf diese Weise dient das System der Speicherung von elektrischer Energie – eine
Qualität, die in einem zunehmend volatilen Energiemarkt von unschätzbarem Wert ist. Zudem sind Pumpspeicherkraftwerke in der Lage, innerhalb von Sekunden anzufahren und auch von Stromerzeugung auf Speichern umzuschalten.
Georisiken verursachen Kraftwerksstillstand
Seit 2011 stand das Werk jedoch still. Es wurde damals vom Betreiber vorsorglich abgestellt, da Schäden im Oberbecken festgestellt wurden. Durch Undichtigkeiten in der Beckensohle kam es zu Ausspülungen im Untergrund und in der Folge zu lokalen Sackungen der Beckensohle. Was danach sehr schnell klar war: Eine Sanierung war unumgänglich, stellte sich aber nach ersten geotechnischen Bewertungen als komplex und kostspielig heraus. Verschiedene Ansätze für die Sanierung wurden entwickelt und geprüft, und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Planung ausgearbeitet, die auf einer neuen Machbarkeitsstudie aufbaute. Als höchst positiv wird von Uniper die gute Zusammenarbeit mit den bayerischen Behörden bewertet: Vom Planfeststellungsantrag bis zum -beschluss habe es nur eineinhalb Jahre gedauert, heißt es von Seiten Unipers. Das zeige, dass Großprojekte durchaus in kurzer Zeit realisierbar seien.
Dank umfangreicher Sanierung wieder zukunftsfit
Im Juni 2024 gab Uniper schließlich bekannt: Happurg wird reaktiviert. Dabei wurde zugleich das technische Konzept zur Ertüchtigung des Oberbeckens und der Maschinentechnik
im Krafthaus präsentiert. Die Zeit des Dornröschenschlafes war endgültig vorbei. Als größter Brocken des Großprojekts gilt natürlich die Sanierung des Oberbeckens mit neuen Dichtungssystemen, mit Asphalt- und Kunststoffabdichtungen. Zudem wird die Beckensohle mittels Stopfsäulen und Geogittern massiv verstärkt. Weiters wird unter dem Oberbecken ein Kontrollgang errichtet, um in Zukunft Schäden leichter detektieren zu können. Diesem Zweck dienen auch die neuen, zahlreich angebrachten digitalen Messpunkte, die Bewegungen im Untergrund feststellen sollen. Neben den umfangreichen Bauarbeiten umfasst das Gesamtprojekt die Generalüberholung der Maschinensätze, also der Turbinen und Generatoren, außerdem ist im Paket unter anderem die Anbindung an eine moderne zentrale Leitwarte in Landshut geplant. Im Hinblick auf die Sicherheit des Kraftwerksbetriebs spielen natürlich auch die Verschlussorgane, in diesem Fall acht Kugelschieber, eine wichtige Rolle. Sie sollten ebenfalls einer umfassenden Revision unterzogen werden. Dabei setzten die Verantwortlichen auf das Know-how und die Erfahrung des international tätigen bayerischen Stahlwasserbauspezialisten MUHR.
Druck- und Dichtigkeitsprüfungen erfolgreich
Im Rahmen der Instandsetzung des Speicherwerks Happurg übernahm die Firma MUHR ein umfassendes Leistungspaket, das neben dem Projektmanagement in Sachen Kugelschieber auch die Koordination mit anderen Losen umfasste. Zum technischen Lieferumfang zählten die Demontage, der Transport, die Rehabilitierung und die Remontage von insgesamt vier Kugelschiebern für Francis-Turbinen (DN 1600), zwei Kugelschiebern für Speicherpumpen (DN 1700) sowie zwei Ringschiebern gleicher Nennweite. Darüber hinaus wurde die Absperrölversorgung von vier Systemen mit jeweils 4,5 MPa Betriebsdruck instandgesetzt. Ergänzend erfolgte die vollständige Erneuerung sämtlicher Dichtungen, Sensorik und Instrumentierung. Trotz der Tatsache, dass die ursprünglich eingebauten Absperrorgane nicht von MUHR stammten, konnte eine qualitativ hochwertige Sanierung sichergestellt werden – insbesondere dank des umfassenden Know-hows des Unternehmens in der Entwicklung und Fertigung eigener Kugelschieber. Laut MUHR stellte dabei vor allem die Dokumentation eine beson-

Lieferumfang MUHR:
• Projektmanagement inkl. Koordination mit anderen Losen
Demontage, Transport, Rehabilitierung und Remontage von: 4 Kugelschiebern für Francis-Turbinen (DN 1600)
• 2 Kugelschiebern für Speicherpumpen (DN 1700)
• 2 Ringschiebern für Speicherpumpen (DN 1700)
Rehabilitierung der Absperrölversorgung (4 Systeme à 4,5 MPa)
• Erneuerung aller Dichtungen, Sensorik, Instrumentierung
• Rehabilitierung Druckrohrleitung inkl. Korrosionsschutz
Erstellung technischer Dokumentation
• Rehabilitierung Dammtafeln Oberbecken
• Rehabilitierung Einlaufrechen & Rechentafeln
Rehabilitierung der einbetonierten Auflager & Führungen
• Rehabilitierung Hydraulikzylinder & Aggregate
• Rehabilitierung Rollschütze & Verzugsstrecke
Rehabilitierung 6 Bypass-Füllsystem, Mannlöcher, Pegelmessg.
• Neuer Portalkran f. Handling der Stahlwasserbaukomponenten
• Rehabilitierung Dammtafel und Einlaufrechen der Füllpumpe
Erneuerung Saugrohrverschlüsse
Rehab. Rollschütze an Turbinenauslauf und Pumpeneinlauf
• Erneuerung Einlaufrechen der Pumpen
Inkl. Werksprüfung, Montage, Inbetriebsetzung und Schulung
dere Herausforderung dar: Im Verlauf früherer Betriebsphasen seien teils wichtige technische Dokumentationen verloren gegangen, was die präzise Bestandsaufnahme und Planung erschwerte. Trotz allem eine Hürde, die MUHR dank langjähriger Erfahrung und systematischer Analyse souverän nehmen konnte.
Mittlerweile hat MUHR bereits einen wesentlichen Teil des Bauloses professionell und fachgerecht abgewickelt. Von den insgesamt acht Verschlussorganen wurden schon vier rehabilitiert. Dabei zeigten alle Druck- und Dichtigkeitsprüfungen
• Kraftwerkstyp: Pumpspeicherkraftwerk
• Betreiber: Uniper
Installierte Leistung: 160 MW
Turbinen: 4 Francis-Pumpturbinen
Nutzbare Fallhöhe: 209 Meter
Speichervermögen: ca. 840 – 900 MWh
Stromnetzanschluss über 110-kV-Leitung
Oberbecken: Speicher am Deckersberg (1,8 Mio. m³)
• Unterbecken: Happurger See
• Betriebszeit: 1958 – 2011


Von insgesamt 8 Verschlussorganen wurden bereits 4 rehabilitiert.
beim Werkstest, dass die Sanierungsarbeiten erfolgreich verlaufen sind. 2026 werden die grundsanierten Kugelschieber wieder im Kraftwerk Happurg remontiert. Ein wichtiger Schritt hin zur Reaktivierung des Kraftwerks.
Wichtiger Beitrag zur Energiewende
Ab 2028 soll das größte Pumpspeicherkraftwerk Bayerns wieder ans Netz. Nach dem Umbau wird die Anlage erneut in der Lage sein, 840 bis 900 MWh Strom zu speichern – das entspricht etwa dem Tagesbedarf von 250.000 Haushalten. In Kombination mit regenerativen Erzeugern wie Wind- und Solarparks wird sie damit zu einem wichtigen Instrument der Lastverlagerung und Netzstabilisierung. Klaus Engels, Direktor

Die Druck- und Dichtigkeitsprüfungen waren auf Anhieb erfolgreich.
Wasserkraft bei Uniper, erklärte dazu: „Pumpspeicherkraftwerke sind mit Abstand die bewährteste Großtechnologie zur Energiespeicherung und sind aufgrund ihrer Flexibilität eine wichtige Voraussetzung für die Integration der naturgemäß schwankenden Stromerzeugung aus Sonne und Wind. Die Revitalisierung des Pumpspeicherkraftwerks Happurg ist deshalb ein großer Beitrag zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung und damit zur Energiewende.“
Uniper verfolgt mit der Revitalisierung auch ein eigenes strategisches Ziel: Das Unternehmen will bis 2030 rund 80 % seiner Erzeugungskapazität CO2-neutral betreiben. Das modernisierte Happurg-Kraftwerk wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.


Doppelt angelenkte Schleusenwinde mit elektrischem Antrieb an einer französischen Wehranlage
Seit dem Aufkommen der industriellen Nutzung der Wasserkraft ist der Einsatz von Zahnstangenwinden sehr verbreitet. Obwohl diese Antriebsart etwas im Schatten der Hydraulikantriebe steht, ist sie immer noch aktuell und bietet in vielen Fällen sogar Vorteile, wie dieser Artikel aufzeigt.
Seit der Mensch sesshaft wurde, wuchs sein Bedarf an Wasser. Fanden sich die Siedlungen anfänglich an Flüssen und Seen, wurden schon bald entferntere Orte und Ackerflächen erschlossen. Das Wasser wurde über Kanäle bis zum Verbrauchsort geführt und dort durch Umlenkung mit Steinplatten oder Holzbrettern feinverteilt. Immer größere Schütztafeln mussten verfahren werden und der Einsatz von Zahnstangen stellte alsbald den Stand der Technik dar. Zu dieser Zeit kam dem Warentransport auf dem Wasserweg noch eine zentrale Bedeutung zu. So war an mancher Schleuse ein Regelwerk eingebaut, mit welchem die Schleusenkammer oftmals am Tag geflutet und anschließend wieder entleert werden konnte. Hunderte solcher Schleusen sind weiterhin in Betrieb, auch wenn heute viele davon vor allem noch der Freizeitnavigation dienen.
Aufbau
Der Aufbau einer Zahnstangenwinde ist sehr einfach und deswegen auch äußerst zuverlässig: Über eine Kurbel oder einen Elektromotor wird ein Getriebe angetrieben, in welchem die eingebrachte Kraft vervielfältigt wird. Je größer die zu heben-

Zahnstangenantriebe haben sich seit dem 18. Jahrhundert bewährt

Eine Schleusenwinde im Einsatz an einer Fischaufstiegsanlage.
de Last, desto größer das gewählte Untersetzungsverhältnis. Das letzte Zahnrad (Ritzel) wirkt auf die Zahnstange, welche in eine lineare Bewegung versetzt wird. Die Übertragung der Kräfte erfolgt im Getriebe rein abwälzend. Im Einsatz finden sich teilweise Antriebe mit Gewindestange und Mutter. Die Kraftübertragung geschieht in dem Fall gleitend. Was anfänglich gut funktioniert, hat jedoch einen großen Nachteil: Jegliche Verschmutzung wird mit einer schleifenden Bewegung durch die unter Last stehende Mutter bewegt. Dem kann mit Schutzrohr und Abstreifer temporär entgegengewirkt werden, auf die Dauer kommt es jedoch unweigerlich zur Abnutzung. Der Zahnstangenantrieb ist aufgrund der Abwälzbewegung hingegen extrem schmutztolerant, was eine ungleich höhere Lebensdauer ergibt.
Auslegung
Sei es bei einer Neuinstallation oder der Revision einer bestehenden Anlage – mit dem Betreiber sind vorgängig einige Punkte zu klären: die Abmessungen und das Eigengewicht der Schütztafel, die Ausführung der Seitenführungen, Niveau Ober- und Unterwasser. Führt das Gewässer viel Geschiebe? Kann die Schütztafel im Winter anfrieren? Aus dieser Diskussion ergibt sich die notwendige Hubkraft und die bauliche Ausführung.
Bei kleineren Bauwerken und „hohen“ Schütztafeln kommt ein Einfachzug mit mittiger Anordnung einer Winde zur Anwendung. Beim Doppelschütz werden zwei über eine Achse gekoppelte Winden eingesetzt. Durch die doppelte Anlenkung wird bei „breiten“ Schütztafeln das Verkanten seitliche vermieden. Der Antrieb kann auf einer Seite oder aber mittig zwischen
ROBOR AG (CH) und Feugier Environnement (FR) stellen seit über 200 Jahren Zahnstangenwinden her. Vor 10 Jahren haben die Unternehmen entschieden, ihr Wissen und Können in der Auslegung und Herstellung von Schützzügen zu bündeln und in der DACH-Region gemeinsam aufzutreten. Zusammen bieten die beiden Firmen kosteneffiziente Lösungen im Hebebereich von 0,25 bis 60 Tonnen pro Anschlagpunkt an.

Der Aufbau einer Zahnstangenwinde ist grundsätzlich einfach und zuverlässig.
den Getrieben positioniert werden.
Bei langem Hub versichert man sich zudem, dass die Zahnstange beim Senken (d.h. unter Druckbelastung) nicht ausknickt. Diese Belastung wird nach den Eulerschen Knicksätzen berechnet. Bei grenzwertigen Resultaten kann auf das nächstgrößere Modell umgestiegen werden, oder man verwendet eine verstärkte Zahnstange, welche auf ein stabiles Grundprofil aufgeschweißt ist.
Der manuelle Antrieb wird dort eingesetzt, wo Schütze nur selten verfahren werden. In gewissen Fällen kann der Antrieb auch mit einem Akkuschrauber erfolgen. In der Regel kommen jedoch elektrische Antriebe zur Anwendung, welche die ganze Palette von einfachem Verfahren vor Ort bis zu ferngesteuertem Betätigen mit Wegüberwachung ermöglichen.
Regelbetrieb
Bis vor wenigen Jahren wurden Zahnstangenantriebe nur für den Stell-, jedoch nicht für den Regelbetrieb eingesetzt. Durch eine innovative Neuauslegung des Getriebeteils ist dies nun möglich: Das Ritzel wurde im Durchmesser vergrößert und eingrifftechnisch überarbeitet, die Untersetzung aus dem Gehäuse delogiert. Schmierkartuschen sorgen für Dauerschmierung und lange Revisionsintervalle.
Durch diese Verbesserungen kann im Regelbetrieb gefahren werden. Erfordert es die Anwendung, lassen sich Verfahrge-

angelenkte Schleusenwinde mit verstärkten Zahnstangen und elektrischem

Doppelt angelenkte Schleusenwinde mit Elektroantrieb in Kanada
schwindigkeiten von bis zu 2 m/min oder Hublasten von bis zu 60 Tonnen pro Zug realisieren. Die Hublänge kann 10 Meter betragen, was durch die patentierte Zahnstangenverstärkung auch beim Schließen (Druckbelastung) im zulässigen Knickbereich liegt.
Einsatz
Durch den rein mechanischen Aufbau sind Zahnstangenantriebe in einem breiten klimatischen Umfeld einsetzbar. Sie funktionieren bei tiefen wie hohen Temperaturen zuverlässig. Ein großer Vorteil liegt zudem im ölfreien Betrieb. Das Risiko einer Gewässerverschmutzung durch ein Leck ist von Anfang an ausgeschlossen. Der Wegfall von Druckerzeuger, Regel-

Einfach angelenkte Schleusenwinde mit elektrischem Antrieb in Mali
technik, Verrohrung usw. bringt einerseits Einsparungen bei der Beschaffung, andererseits beim geringeren Aufwand im Unterhalt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Schützantriebe mit Zahnstangen folgende Vorteile bieten: Komplett ölfrei, langlebig, unempfindlich gegen Temperatur und Verschmutzung, kostengünstig in Beschaffung und Betrieb, regeltauglich.
Dieser Beitrag wurde vom ROBOR AG-Geschäftsführer Stephan Lüthi verfasst.


Einfädeln des 30 Tonnen schweren Klappentellers in die aufrecht stehende Gehäusehälfte der ADAMS-Drosselklappe in der Kaverne am Grimselpass
Die Staumauererneuerung am Grimselpass zählt zu den größten und komplexesten Kraftwerksprojekten der Schweiz in jüngster Zeit. Im Frühling dieses Jahres konnte der Ersatz der 80 Jahre alten Spitallamm-Staumauer abgeschlossen werden. Realisiert wurde das Bauvorhaben von zahlreichen namhaften Branchenunternehmen, die ihre Kompetenz unter hochalpinen Bedingungen im Herz der Schweizer Alpen unter Beweis stellten. Darunter auch die Bilfinger Industrial Services GmbH, die im Herbst 2024 im Auftrag der Adams Schweiz AG eine 120 Tonnen schwere Drosselklappe montierte sowie die selbst gefertigte Anschlusspanzerung installierte. Ein Auftrag, der unter schwierigen logistischen Bedingungen und bei engem Zeitfenster erfolgreich abgewickelt werden konnte.
Als ein Taktgeber der eidgenössischen Energiewende treiben die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) am Grimselpass zentrale Infrastrukturprojekte für die Schweizer Energieversorgung voran. Im Frühjahr dieses Jahres wurde das Bauprojekt für den Ersatz der über 80 Jahre alten Spitallamm-Staumauer am Grimselsee abgeschlossen, eines der bedeutendsten alpinen Hochbauprojekte der Schweiz. Die doppelt gekrümmte Bogenmauer mit einer Höhe von 113 m wurde talseitig neben der alten
Staumauer errichtet und fasst rund 94 Mio. m3 Wasser. Die alte Mauer bleibt als Zeitzeugnis erhalten, jedoch dauerhaft überflutet. Der Ersatz der alten Spitallamm-Staumauer am Grimselpass bringt aufgrund der modernen technischen Standards mehr Sicherheit. Zudem wird durch ein leicht erhöhtes Stauvolumen die Nutzung der Wasserkraft effizienter. Die moderne Infrastruktur sichert langfristig den Betrieb, stärkt die regionale Wirtschaft und unterstützt die Schweizer Energiestrategie.

Optimale Abstimmung mit Betonierarbeiten
Im Hinblick auf eine sichere Absperrfunktion, aber auch um die Triebwasserzufuhr zuverlässig zu steuern, wurde eine neue ADAMS-Drosselklappe der Dimension DN3900 sowie der Druckstufe PN16 installiert. Für den Einbau des 120 Tonnen schweren Bauteils zeichnete mit Bilfinger ein Unternehmen verantwortlich, das seit über 70 Jahren in der Wasserkraft tätig ist und über dementsprechend exzellentes Know-how verfügt. Ebenso im Lieferumfang des international tätigen Industriedienstleister: die komplette Anschlusspanzerung, die von Bilfinger konstruiert, gefertigt, geliefert und montiert wurde. Bereits im August 2024 begann man mit der Anlieferung der rund 20 Meter langen oberwasserseitigen Anschlusspanzerung, bestehend aus mehreren vorgefertigten Rohrschüssen mit 3,9 Metern Durchmesser. „Aufgrund fehlender Lagerflächen mussten die Bauteile im Tal zwischengelagert und anschließend just in time zur Baustelle geliefert werden. Dabei war höchste Eile beim Manipulieren und Umladen der tonnenschweren Rohrschüsse gefragt, da die Betonierarbeiten an der neuen Grimsel Staumauer noch voll im Gange waren und dafür unterbrochen werden mussten“, erzählt Alexander Prener, Projektleiter bei Bilfinger.
Nicht alltägliche Herausforderungen im Gebirge
Eine weitere, nicht alltägliche Herausforderung stellte die Zufahrt zur Baustelle dar. Hinzu kamen beengte Platzverhältnisse und eine fehlende Kraninfrastruktur in der Drosselklappenkammer, was in Summe die Durchführung erheblich erschwerte. „Aufgrund der eingeschränkten Dimensionen des Stollensystems musste die Anschlusspanzerung in kleinere Rohrschüsse aufgeteilt werden, die von unserem Team
dann vor Ort verschweißt wurden“, erinnert sich Projektleiter Alexander Prenner.
Zum millimetergenauen Positionieren der Rohre wurde von Bilfinger ein speziell konzipierter hydraulisch verstellbarer Schienenwagen eingesetzt. Die Montage erfolgte auf einer Rampe, wobei das Verschweißen und anschließende Verschieben der Rohre bei lediglich einem halben Meter Außenfreiraum höchste Präzision erforderte.
Dass bei einer hochalpinen Baustelle auch mit widrigsten Witterungsverhältnissen zu rechnen ist, sollte sich im Projektverlauf bestätigen. „Wir hatten Mitte September letzten Jahres einen plötzlichen Wintereinbruch, was zu einer temporären Sperre des Grimselpasses führte. Das zog zwar eine Verzögerung nach sich, es ist unserem Team aber trotzdem gelungen, die Panzerung termingerecht innerhalb eines Monats fertigzustellen und an den Kunden zum Betonieren zu übergeben“, erzählt der Projektleiter.
Ausrichtung des Klappentellers – eine Präzisionsarbeit
Im Anschluss an den Einbau der Anschlusspanzerung folgte die Montage der ADAMS-Drosselklappe DN3900. Die in Einzelteilen zerlegte Armatur wurde über einen engen Zufahrtsweg angeliefert. Bei den größten Komponenten waren auf jeder Seite nur wenige Millimeter Platz zur Stollenwand. Für die Anlieferung brauchte es daher durchaus Fingerspitzengefühl, ein gutes Auge und Geduld. Wie die Projektleiter von Bilfinger berichten, wurde die Kaverne im Zuge der Montageplanung mit Laserscans vermessen. Auf diese Weise war es möglich, den Vorort-Zusammenbau der ADAMS-Drosselklappe mit Hilfe eines Mobilkranes zu simulieren. Was sich letztlich auch bezahlt machen sollte.
„Der Zusammenbau der ADAMS-Drosselklappe erfolgte aufrechtstehend direkt vor dem Flanschrohr, wobei das über 30 Tonnen schwere Klappenteller mit einer Toleranz von nur wenigen Hundertstel Millimetern ausgerichtet werden musste, um Drehlagerung und Dichtungen korrekt einsetzen zu können“, erklärt Alexander Prenner. Hierfür kam ein in den Werkstätten von Bilfinger entwickelter, hydraulisch verstellbarer Montagetisch zum Einsatz – maßgeschneidert für die eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten. Die fertig montierte Klappe wurde anschließend hydraulisch auf ihrem Fundament Richtung oberwasserseitigem Anschlussflansch verschoben und veschraubt.
Bilfinger Industrial Services
Mit ihrem Hauptsitz in Linz und neun weiteren Standorten in Österreich sowie dem benachbarten Ausland zählt die Bilfinger Industrial Services GmbH zu den größten heimischen Industriedienstleistern. Das Portfolio deckt von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterungen und deren Generalrevisionen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Im Wasserkraftsektor hat sich Bilfinger bei einer Vielzahl von Projekten im In- und Ausland seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf als zuverlässiger Partner erarbeitet. In der jüngeren Vergangenheit konnten die Spezialisten ihre Kompetenz beim Handling von großformatigen Verschlussorganen bei mehreren Großwasserkraftanlagen in der Schweiz und in Österreich unter Beweis stellen.

Zufahrt nur mehr über das Stollensystem Im hochalpinen Gelände, wie es beim auf über 2.100 m ü.M. liegenden Grimselpass der Fall ist, bestimmte der Wetterverlauf das tägliche Baugeschehen. Und so markierte der 4. Dezember 2024 jenes Datum, an dem keine Rückführung des Mobilkrans sowie der Baustelleninfrastruktur mehr gewährleistet war. „Dieser Umstand bedeutet für uns, dass jeder Montageschritt exakt geplant und durchgeführt werden musste. Jeder Fehler hätte zu massiven Verzögerungen führen können“, sagt Alexander Prenner. Während der letzten Bauwochen war die Zufahrt zur Kaverne überhaupt nur noch über das unterirdische Stollensystem möglich. Trotz dieser extremen Bedingun-
gen konnte Bilfinger alle Komponenten fristgerecht montieren und die Baustelle im vereinbarten Zeitraum dem zufriedenen Kunden übergeben.
Am 20. Juni 2025 wurde die neue Spitallamm-Staumauer am Grimselsee feierlich eingeweiht, was passender Weise mit dem 100 Jahr Jubiläum der Kraftwerke Oberhasli zusammenfiel. Das spektakuläre Hochbauprojekt der KWO steht exemplarisch für die erfolgreiche Intention, Klimaschutz, Versorgungssicherheit und alpinen Naturschutz in Einklang zu bringen. In einer Zeit wachsender Stromnachfrage gewinnen solche Speicherprojekte zunehmend an strategischer Bedeutung.



Die neuen Absperrklappen der VAG Group wurden speziell für die hohen Anforderungen im Wasserkraftsektor entwickelt.
Ein bedeutender Meilenstein für eine nachhaltige Energieversorgung Europas ist erreicht: Im Rahmen des österreichischen Großprojekts Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2 der TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) werden erstmals die neu entwickelten Absperrklappen vom Typ VAG EKN® S des in Mannheim/Deutschland beheimateten Armaturenkonzerns VAG Group verbaut. Die speziell für Hochleistungsanwendungen in der Wasserkraft konzipierten Absperr- und Sicherheitsarmaturen setzen neue Maßstäbe in Technik, Sicherheit und Effizienz – und werden künftig in einem der höchstgelegenen Pumpspeicherkraftwerke Europas ihre Stärken ausspielen.
In den Tiroler Alpen entsteht auf über 2.000 Höhenmetern der neue Speichersee Kühtai. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der beeindruckende Steinschüttdamm ein Speichervolumen von etwa 31 Millionen Kubikmetern bieten – das entspricht ungefähr der Hälfte des Volumens des benachbarten Finstertal-Speichers. Das neue Kraftwerk Kühtai 2, das in einer unterirdischen Felskammer errichtet wird, soll im Herbst 2026 den Betrieb aufnehmen und gemeinsam mit dem bestehenden Werk als reversibles Pumpspeicherkraftwerk fungieren.
Zentraler Bestandteil dieser Anlage: Zwei EKN® S Absperrklappen von VAG – jeweils DN 4000 PN 15, mit hochpräziser Technik ausgestattet. Die erste Absperrklappe wurde im Februar 2025 installiert, die zweite folgte im Mai 2025. Eine davon dient als Trennklappe, die andere als Sicherheitsklappe, ausgelegt für einen sicheren Notschluss im Rohrbruchfall bei einem Durchfluss von 190 m³/s.
Maßgeschneiderte Power für Wasserkraft
Die VAG EKN® S Absperrklappe ist eine komplette Neuentwicklung auf Basis der bewährten VAG EKN® H1200 Absperrklappe – jedoch gezielt auf die extremen Anforderungen in Wasserkraftwerken angepasst. Das „S“ steht dabei für Spezial und Speed: Sie ist für außergewöhnlich hohe Strömungs-
geschwindigkeiten bei minimalen Druckverlusten konstruiert – bis zu zehnmal höher als in herkömmlichen Wasserleitungssystemen – und bietet zugleich maßgeschneiderte Lösungen für Sonderanwendungen wie in Turbineneinläufen von Wasserkraftwerken.

Schlussetappe des Schwertransports über die Serpentinenstraße


Auch bei extremen Betriebsbedingungen sorgen die VAG EKN® S Absperrklappen für eine sichere, präzise und wartungsfreundliche Absperrung.
Mit Nennweiten von DN 800 bis DN 5000 und Druckstufen bis PN 25 deckt die VAG EKN® S Absperrklappe ein breites Anwendungsspektrum ab. Zu den zentralen Konstruktionsmerkmalen zählen:
• Gehäuse als geschmiedeter Walzring aus Stahl mit maximaler Steifigkeit
• Super-optimiertes Sitz- und Klappenscheibendesign – mit um bis zu 70 % reduzierten Zeta-Werten gegenüber dem bewährten EKN H1200 Klappendesign
• Neuartige Klappenscheibe-Wellen -Verbindung für maximale Betriebssicherheit
• Austauschbare Spindeldichtung unter vollem Betriebsdruck
• Optimierte Lager mit Schmiernuten und Schmutzabstreifer
• Reduzierte Druckverluste – ideal für hohe Durchflüsse (z. B. bei 90m³/s Normaldurchflussmenge und 12 bar Druck am Standort Kühtai)
• Selbsttätiges Öffnen mittels VAG HYsec Hydraulikantrieben bei Fehlbedienung im Pumpbetrieb
Beitrag zur Energiewende
Mit dem Projekt Kühtai 2 leistet die TIWAG einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende – und die VAG Group ist mit ihrer hochmodernen Klappentechnologie ein zentraler Teil davon.

Die VAG EKN® S Absperrklappe sorgt für eine sichere, präzise und wartungsfreundliche Absperrung auch bei extremen Betriebsbedingungen. Ihr Einsatz im hochalpinen Umfeld unterstreicht eindrucksvoll die Innovationskraft und technische Exzellenz von VAG.
„Mit der EKN S setzen wir neue Standards für Armaturen in der Wasserkraft. Sie ist unsere Antwort auf die steigenden Anforderungen moderner Pumpspeicherwerke und ein echtes HighPerformance-Produkt für die Energiewende“, so Entwicklungsleiter Matthias Weber.
Die VAG Group blickt mit Stolz auf das Projekt Kühtai und freut sich auf die weiteren Schritte – nicht zuletzt, weil dieses Projekt ein klares Zeichen für technologische Innovation und nachhaltige Energiezukunft setzt.

Bei den VAG EKN® S Absperrklappen handelt es sich um komplette Neuentwicklungen auf der Basis von bewährter Technik.
VAG EKN® S Absperrklappe

Entwickelt für den Einsatz in Staudämmen und Wasserkraftwerken
• Doppeltexzentrische Absperrkalppe in Sonderausführung mit gerigen Betätigungsmomenten
• Speziell entwickelt als Turbineneinlaufarmatur für hohe Fließgeschwindigkeiten
• Individuelle stahlgeschweißte Ausführung mit durchflussoptimierter Klappenscheibe und strömungsoptimiertem Gehäusesitz
• Extrem langlebiges und korrosionsoptimiertes Design





Die Energiebranche braucht smarte Lösungen. Unsere Messtechnik für Füllstand und Druck optimiert Prozesse, steigert die Rentabilität und sichert eine ressourcenschonende Energieversorgung. Für eine Zukunft mit weniger Emissionen und mehr Effizienz. Mit präziser Messtechnik ist erneuerbare Energie nachhaltig und wirtschaftlich rentabel. Alles wird möglich. Mit VEGA.



