KOPF HOCH
Ein Gespräch mit dem Menschenfreund
GUIDO MARIA KRETSCHMER
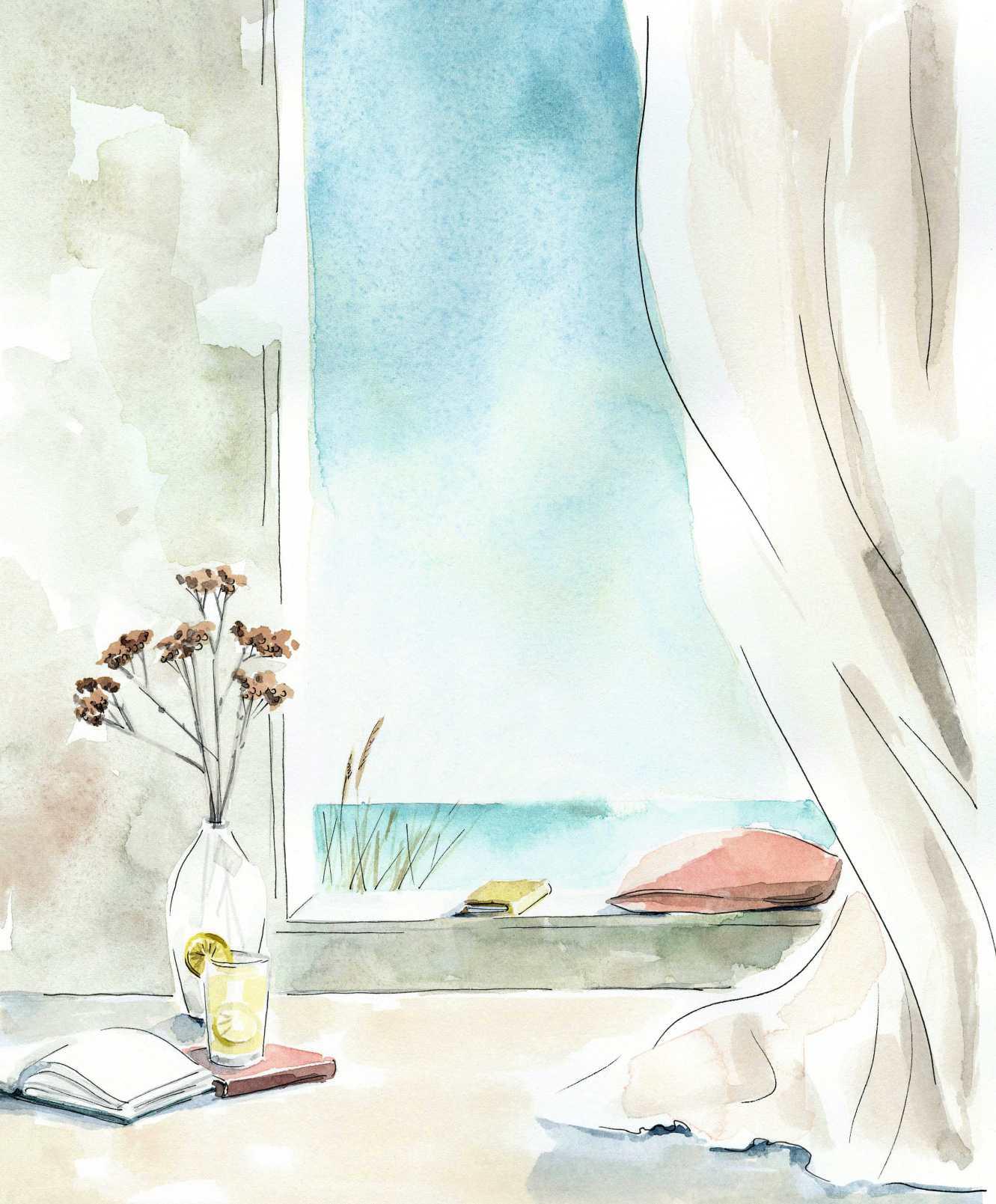

KOPF HOCH
Ein Gespräch mit dem Menschenfreund
GUIDO MARIA KRETSCHMER
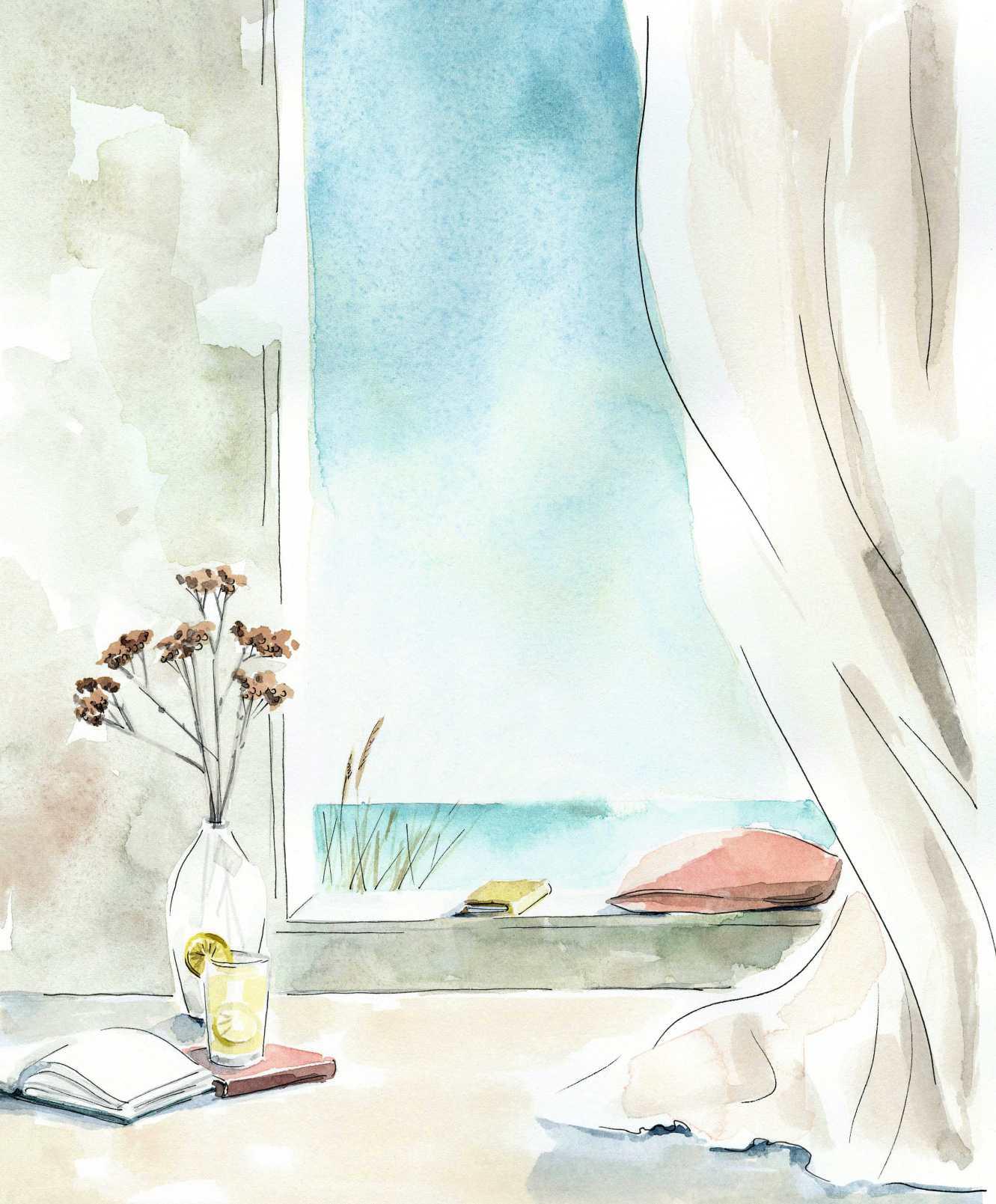
Investierejetzt inAktien, ETFs &Co. Mit Scalable.


»Brauchen Sie Hilfe?« – »Danke, ich will mich nur ein bisschen umsehen.« Die Kleidungsstücke in diesem Laden waren sehr anders als die in anderen Läden. Und sie waren viel zu teuer für den Mann, der sich nur umsehen wollte. Für manche hätte er einen Kredit aufnehmen müssen, zum Beispiel für den Pullover, der aus goldenen Ketten gestrickt war. Der Mann trug sonst eher klassische Sachen, er benötigte auch nichts. Es ist deshalb eines der Rätsel des Universums, warum dieser Mann, der ich war, schließlich mit einer großen Tüte den Laden verließ. Darin befand sich ein schwarzes Jackett von dem englischen Designer Alexander McQueen, der mit seinen punkigen Entwürfen gerade die Modewelt begeisterte. Das Jackett reichte bis zu den Knien, und es war mit silbernem Autolack besprüht, wütendes Muster. Abends war ich mit meinem Bruder zum Essen verabredet. Ein schönes Restaurant im ersten Stock, Platz am Fenster. Als mein Bruder an den Tisch trat, erschrak ich: Er blutete im Gesicht aus Augenbrauen, Nase und Kinn. »Was ist passiert?«, fragte ich. »Was hast DU denn an?«, fragte er. Und erklärte, dass er mich durch die Scheibe habe sitzen sehen, mich erst gar nicht erkannt hatte und dann so gebannt auf mein Jackett gestarrt hatte, dass er eine Kette übersah, die über den Kiesweg gespannt war, um Autos die Zufahrt zu verwehren. Seine Brille war auch kaputt. Liebe Leserin, lieber Leser, das ZEIT WISSEN-Gespräch mit dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer dreht sich um die Frage, wie wir durch Kleidung ausdrücken, wer wir sind – oder sein wollen. Dabei wünsche ich viel Vergnügen. Oft habe ich das gefährliche Jackett nicht getragen.

Das Magazin zum Podcast
Andreas Lebert, Chefredakteur


Chiara Joos fragt sich, ob die Wege, die sie nicht gegangen ist, ihren Lebensweg trotzdem beeinflussen. Und welche Rolle Zufälle dabei spielen. Sie lebt in Wien, wo Erwin Schrödinger einst die Physik neu gedacht hat. In dieser Ausgabe betritt sie die Welt der Quantenphysik, um Antworten zu finden (S. 58).
Kann jeder Mensch zum Mörder werden? Wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Wie löst man einen Cold Case? ZEIT VERBRECHEN erzählt aktuelle, vergessene und ungeklärte Kriminalfälle. In aufwendig recherchierten Reportagen lassen wir Opfer sprechen, Täter, Angehörige, Experten – und blicken auf die Motive hinter den Taten. Jetzt 1x gratis sichern

Clémentine Campardou malt, seit sie einen Pinsel halten kann. Sie studierte Kunst und Design in Paris und arbeitete als Produktdesignerin für L’Oréal, bevor sie sich als Künstlerin selbstständig machte. Heute hat sie ein Studio in Sydney. Ihre Tuschezeichnungen illustrieren das Cover und die Titelgeschichte (S. 18).
Jetzt bestellen: www.zeit.de/zv-spannung 040/42 23 70 70*
*Bitte die Bestellnummer 2169686 angeben.


Dieser Bär lebt in Kanada mit 50 Artgenossen. Ein Fotograf durfte in ihre Nähe
Diese beiden Menschen kennen sich mit Narzissten aus. Sie sind selbst welche
6 AM ANFANG DREI FRAGEN
1. Was ist Neugier? 2. Wie erholsam sind Kunstwelten? 3. Wieso geht der Rauch immer dahin, wo ich bin? 12 JUNGES
Solarstrom kommt
30 GUIDO MARIA KRETSCHMER im großen ZEIT WISSEN-Gespräch
38 KRAFTQUELLE ERINNERUNG Teil 2 der ZEIT WISSEN-Serie
44 JETZT SPRICHT GRÖNLAND »Was mein Eispanzer von euch weiß«
46 WILLKOMMEN IN HAUS E Einfach, ehrlich, experimentell – und günstig. Fühlen Sie sich wie zu Hause!
52 TREFFEN SICH ZWEI NARZISSTEN ... und reden über Narzissmus
58 ICH HÄTTE DA MAL EINE FRAGE ... ... und weiß nicht, wohin damit. Vielleicht zur Quantenphysik?
ICH BRAUCHE MAL ’ NE PAUSE
Innehalten und nichts tun. Weil es einen Wert für sich hat. Wie wir die Pause wiederentdecken und zur Verbündeten machen

+ Hört auf zu denken! Zu Besuch bei der Künstlerin Marina Abramović
+ Sogar das Weltall macht Pause
62 DR. CHATGPT VERSTEHT MICH
Die KI wird beliebter für medizinischen Rat. Was kann sie besser als Dr. Google? Und hilft sie mir, gesund zu werden?
66 WAS DAMALS GESCHAH
6. August 1945: Die USA werfen die erste Atombombe auf Hiroshima ab
71 ZUMUTUNG SMALL TALK
Die Kunst und die Fallstricke der kleinen Gespräche. Im Privaten und im Berufsleben. Mit Small-Talk-Tipps
86 WORAN ERKENNT MAN QUALITÄT?
Diesmal: Sonnenbrillen
88 ICH PROTESTIERE!
Bloß wie? Welche Protestformen wir heute brauchen. Und welche nicht
94 »MEINE ÖLE SIND MEINE SEELE«
Interview mit dem Basilikum
98 DER MANN, DER ZU VIEL WUSSTE Till Raether und die Snacktivities
100 JETZT WIRD ES BÖSE
Empfehlungen für Bücher, Filme, Digitales
104 IMPRESSUM / BESTE FRAGE
106 WAS LERNEN WIR VOM BIBER?
1. Was gibt’s denn da zu sehen?
Irgendetwas haben die beiden auf dem Foto gemeinsam entdeckt, und jetzt sind sie gefesselt. Über das Geheimnis der Neugierde
Text Chiara Joos Foto Sam Gregg
Steht ein Alter da, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Blick auf das Treiben hinter einem Baustellenzaun gerichtet. Ein nächster Alter gesellt sich dazu. Dann noch einer, ähnlich alt, ähnlich gekleidet. Sie kommentieren, nicken hin und wieder. Im bolognesischen Dialekt werden die italienischen Rentner mit der Lizenz zum Schauen »Umarell« genannt, übersetzt: »älterer Mann«. Die Voraussetzung für diesen Titel: Neugierde. Ein mentaler Spannungszustand, der entsteht, wenn etwas nicht aufgeht, Erwartungen ins Leere laufen oder sich eine Lücke im Wissen auftut – wie der Neugierforscher George Loewenstein es beschreibt. Im Gehirn werden dabei dieselben Areale aktiv wie bei Lust und Belohnung. Besonders stark ist der Sog, wenn das Verstehen zum Greifen nah ist: Je kleiner die Lücke, desto größer die Neugier. Und wer viel weiß, will oft mehr wissen. Schon Babys zeigen diesen Drang: Wird ein Spielzeug an einem Ort platziert, an dem es nicht sein sollte, klebt ihr Blick daran wie Honig am Löffel. Ihre Welt ist ein Puzzle, das noch keine Anleitung kennt, im Kleinkindalter aber mit bis zu 300 Warum-Fragen täglich erforscht wird. Diese Fragen sind Ausdruck epistemischen Interesses, des Verlangens, Informationslücken zu schließen. Kindliche Neugier ist noch wie ein Reflex. Scheitern ist erlaubt, Langeweile fördernd. Mit dem Erwachsenwerden wird Neugier selektiv, kontrolliert und zögerlich, stößt an soziale, kulturelle und emotionale Grenzen. Manchmal auch auf den eigenen Wunsch, etwas lieber nicht zu wissen.
»Deliberate Ignorance« nennt Ralph Hertwig den Akt der selbst gewählten Ahnungslosigkeit. Der Kognitionswissenschaftler forscht in Berlin zu gewolltem Nichtwissen. »Würden Sie wissen wollen, welcher Ihrer Kollegen den höchsten Bonus bekommt? Oder ob Sie
ein erhöhtes Risiko für Alzheimer haben?«, fragt er. Ja? Wegen der dunklen Seiten solcher Informationen entscheidet sich so mancher Mensch gegen sie. Schon Grundschulkinder wollen manches lieber nicht wissen. Vor allem wenn es um eine potenziell unangenehme Wahrheit geht, etwa dass ein Freund für einen Schaden verantwortlich ist. »Dadurch sollen die eigenen Emotionen reguliert und negativen Gefühlen vorgebeugt werden«, sagt Ralph Hertwig.
Mythen erzählen davon, was passiert, wenn man sich nicht zurückhalten kann: Ihre Neugier führt BüchsenPandora, Hochflug-Ikarus und Früchte-Eva ins Unheil. Alle wollten wissen, was sie nicht wissen sollten, und zahlen den Preis. Noch in der Antike galt Neugier als unanständig, im Mittelalter verurteilte Augustinus sie als Ablenkung vom Glauben. Und bis heute ist ihr Stil kulturell geformt. In westlichen Gesellschaften ist es üblich, genau hinzusehen und Fragen zu stellen. In Samoa zeigt sich Neugier dagegen eher im Handeln –man fragt nicht, man hilft mit, schaut genau hin oder macht nach. Lernen geschieht dort praktisch und ohne direkte Worte. In Japan äußert sich Neugier durch stilles Beobachten, sensibel und zurückhaltend. Das Konzept »Ma«, der Zwischenraum zwischen Worten oder Gesten, gilt dort als Ort aufmerksamer Wahrnehmung. Der Autor Ian Leslie hat die Neugierde neben der epistemischen in zwei weitere Formen geteilt: die diversive, die auf schnelle Reize aus ist, wie beim Scrollen durch Social-Media-Feeds, und die empathische, die wissen will, was im Inneren anderer Menschen vor sich geht. Im Alter werde unsere Neugierde gezielter, fand die Neurowissenschaftlerin Michiko Sakaki heraus. In einer Studie mit jüngeren und älteren Erwachsenen zeigte sich, dass die Alten genauer wissen, wofür sie sich interessieren – und wofür nicht. So wie die Umarells.





Ferienclubs, Kreuzfahrtschiffe, Disneyland. Der Mensch baut sich perfekte Orte zur Befriedigung seiner Träume. Klappt das?
Text Hella Kemper Foto Yann Arthus-Bertrand
Morgens um sieben geht Frau Bauer schwimmen. Im Freibad Letzigraben in Zürich (das der Schweizer Schriftsteller Max Frisch entworfen hat) zieht sie im wohltemperierten Becken ihre Bahnen, 50 Meter hin, 50 Meter zurück durchs gechlorte Wasser, neben Strömungskanal, Wellenbecken und kurz geschorener Rasenfläche. Das morgendliche Bad tue ihr gut, sagt Frau Bauer, und die Forschung gibt ihr recht: Seit der schwedische Wissenschaftler Roger Ulrich 1984 herausfand, dass Krankenhauspatienten schneller gesund werden, wenn sie ins Grüne schauen, belegen viele Untersuchungen, dass uns Natur guttut; nicht nur im Wald oder am See, sondern auch in einem künstlichen Wasserbecken neben akkurat geschorenem Rasen. Schon das Betrachten eines Fotos mit Naturmotiv verkürzt einen Krankenhausaufenthalt, fand Roger Ulrich in einer späteren Untersuchung heraus.
Neurowissenschaftler von der Universität Wien zeigten kürzlich, dass das Betrachten von Naturvideos sogar akute körperliche Schmerzen lindern kann. Und die Zürcher Frühschwimmerin Nicole Bauer wies nach, dass virtuelle Waldspaziergänge die Stimmung ähnlich verbessern können wie reale. Die Umweltpsychologin erforscht an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, unter welchen Bedingungen eine Umwelt uns guttut.
Die Grundlagen dafür legten – ebenfalls in den 1980er-Jahren – Stephen und Rachel Kaplan. Die Psychologen zeigten mit ihrer Aufmerksamkeits-Erholungstheorie, dass natürliche Umgebungen weniger kognitiv herausfordernd wirken, weil sie mit ihren Reizen Maß halten: Sie faszinieren, aber stressen uns nicht. »Seitdem wurde die positive Wirkung von Natur – im Vergleich zur Stadt – immer ein bisschen über-
schätzt«, sagt Bauer. Die Neurophysiologin Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die an der Wiener Studie beteiligt war, betont, dass die Forschung gar nicht weiß, warum uns Natur guttut. Im Gegenteil: Ein dunkler Wald macht manchen Menschen Angst, ein Strand kann langweilig wirken, die Flussaue neben der Autobahn liegen. Im Spa bleibt der Autolärm dagegen draußen, und das Wetter ist verlässlich gut, auf dem Kreuzfahrtschiff droht keine Einsamkeit, die Ferienhaussiedlung vermittelt Sicherheit. Künstliche Orte befriedigen Bedürfnisse passgenau. Diese Passung von Wunsch und Erfüllung wirkt erholsam, das hatten auch schon Kaplan und Kaplan gesagt, den Effekt aber nur auf natürliche Umwelten bezogen.
Als Nicole Bauer Radfahrer befragte, welche Trainingsumgebung sie bevorzugen, wenn sie indoor trainieren, bekam sie eine überraschende Antwort: Sie fuhren virtuell am liebsten durch Paris, New York oder London. »Es ist attraktiver, am Eiffelturm vorbeizuradeln als an Kuhwiesen«, sagt Bauer. »Big Ben und Freiheitsstatue haben ikonische Bedeutung.« Diese Attraktion nutzen neuerdings Gefängnisse in Kalifornien, um Insassen in Einzelhaft emotionale Erlebnisse zu ermöglichen. Gefangene reisen mithilfe von Virtual Reality nach Paris oder springen mit dem Fallschirm. Das soll ihnen ein Gefühl von Freiheit und eine Verbindung zur Außenwelt vermitteln.
Allerdings ist bei künstlichen Welten nicht nur die Befriedigung programmiert. Die Wunder sind es auch. Wenn dagegen die untergehende Sonne den Zürichsee rot färbt, passiert das unerwartet. »Und Sorgen relativieren sich sofort«, sagt Bauer. Dann ist die Umweltpsychologin ein kleiner Tropfen im Bergsee. Und wer Unkraut jätet oder im Matsch spielt, beeinflusst sein Mikrobiom positiv. Auch das, ein Wunder.
3. Wieso geht der Rauch immer dahin, wo ich bin?
Und warum stehe ich immer in der langsameren Supermarktschlange? Über ein Mysterium unserer Wahrnehmung
Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. So fordert es der erste Satz des dritten Artikels des Grundgesetzes. Darüber hinaus sind wir alle der Spezies Homo sapiens zugehörig, wir alle sehnen uns danach, zu lieben und geliebt zu werden, und unter unserer Kleidung sind wir wahrscheinlich alle nackt. Fallen Ihnen mehr Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und einer !Kung-San-Frau im nordnamibischen Kalaharibecken ein?
Der Zorn, wie Blaise Pascal schon im 17. Jahrhundert festhielt, nivelliere jegliche sozialen Unterschiede. Und so stellt man fest, dass wohl auch noch keine Menschenseele jemals irgendwo am Feuer stand und dachte: »Ach wie schön, dass dieser herrliche Rauch ausgerechnet in mein Gesicht zieht, meine Lungen füllt und meine Kleidung zum geruchlichen Zeugnis dieses Abends macht«. Auch nicht die in Nordnamibia.
Die Menschen des !Kung-San-Volks verbringen die kühlen Nächte in der Ödnis der Kalahariwüste ums Lagerfeuer geschart. Und selbst dort, wo man eigentlich einzigartigen Nachtschlaf in sternenklarer Stille, ja höchstens Gemurmel und Knistern des Feuers erwartet, gibt es Stunk um den Qualm. Unter permanentem Gemoser, durch kollektive Belustigung quittiert, wird ständig die Schlafposition neu verhandelt, um dem Rauch des Feuers zu entgehen, wie es der Anthropologe Richard B. Lee in den 1970ern festhielt.
Da es ein universeller Quell des Ärgers scheint, hilft uns vielleicht die Physik, eine Art gleichgültige Akzeptanz zu schaffen. Wir zäumen das Pferd von hinten auf: Feuer ist heiß, na klar. Ein Lagerfeuer so bis zu 1.200 Grad Celsius. Wo es heiß ist, steigt die Luft auf. Je heißer, desto schneller. Unterhalb der aufsteigenden Luft entsteht ein Unterdruck, der die Umgebungsluft ansaugt –der Bernoulli-Effekt. Ist dieser Sog durch eine Person
blockiert, entsteht dort noch ein Unterdruck, der auch durch Umgebungsluft gefüllt wird, in dem Fall Rauch, der dann in unseren Kleidern und Gesichtern landet.
Obendrein erzürnt noch der Coandă-Effekt: Aufsteigende Luft klammert sich auf dem Weg nach oben an nahe liegende Oberflächen. Egal ob Osterfeuer im heimischen Garten oder Lagerfeuer in der Kalahariwüste: Nahe liegende Oberflächen sind leider meist wir.
Bei dieser physikalischen Erklärung fehlt aber noch etwas: Wann steht man schon mal allein am Lagerfeuer? Fast nie, trotzdem bekommt man ja selbst am häufigsten den Rauch ab, egal, wer da noch herumsteht.
Was physikalisch Unfug ist, ist das Zusammenspiel zweier wahrnehmungspsychologischer Phänomene: Zum einen der Confirmation-Bias, der besagt, dass Informationen häufig so verarbeitet werden, dass sie bestehende Überzeugungen bestätigen. Zum anderen Wahrnehmungsfilter, die die wahrgenommenen Aspekte unserer erlebten Realitäten beeinflussen. Durch beides realisieren und speichern wir also vor allem die Momente am Lagerfeuer, die eine Überhäufung des Qualms in unsere Richtung aufweisen.
Warum also geht der Rauch immer zu mir und nicht zu dem Onkel, der zum Osterfeuer geladen hat, oder zu dem !Kung-San-Jäger der ein wiederholtes Schlafplatzrotieren mit Gelächter quittiert? Und warum haben auch alle anderen in der Nachbarschaft den grüneren Rasen? Warum kommt der silberne Golf in der Nebenspur im Stau viel schneller voran? Oder wieso schneidet der Friseur immer bei mir von den Spitzen viel zu viel ab? Warum bekomme ich immer die kleinste Portion in der Kantine? Das Schnitzel mit der Sehne drin? Die langsame Schlange an der Supermarktkasse? Vielleicht, weil ich am Lagerfeuer, im Garten und im Stau stehe und genau das erwarte.


Unsere Expertin: Anna Theilig, 14, trainiert seit sechs Jahren mit dem Steckenpferd. 2024 wurde die Schleswig-Holsteinerin bei der ersten deutschen Meisterschaft im Hobby Horsing doppelte Vizemeisterin.

Als kleines Kind glaubte ich fest daran, dass es dort, wo ich herkomme, keine echten Pferde mehr gibt. Sie seien ausgestorben, wurde mir gesagt. Heute weiß ich natürlich, dass das nicht stimmt, kam aber wohl nur deshalb zu dem Reitsport mit den unechten Pferden. In einem Video, das mir eine Freundin vor sechs Jahren gezeigt hatte, galoppierten Jugendliche mit Steckenpferden über Sprunghindernisse und zeigten Dressurküren. Bei einem großen Onlineversand bestellte ich mein erstes Steckenpferd, heraus kam ein Leistungssport. Mit Turnieren in Deutschland und inzwischen sogar in Finnland. In meinem Schlafzimmer haben sich mittlerweile, ordentlich aufgereiht, 15 speziell angepasste Steckenpferde dafür angesammelt. Mit kürzeren Stöcken fürs Springen und längeren für die
Dressur. Eines fehlt, das ist bei einer Bekannten zur Trensenanprobe. Ausrüstung basteln überlasse ich anderen. Für mich zählt das Sportliche. Und das ist intensiv: Springen und Dressur übe ich fast täglich, außerdem turne ich im Turnverein und mache Kraft- und Ausdauertraining. Ich springe über Hindernisse, die 1,40 Meter hoch sind. Mental ist das härter als körperlich. Wenn der Kopf sagt, »zu hoch«, wollen die Beine nicht. Mein Trick dafür ist tief durchatmen, loslaufen, springen oder kurz schreien. Dressur dagegen fordert jeden Muskel. Wer denkt, Hobby Horsing sei bloß albernes Herumhüpfen, sollte mal versuchen, mit eleganter Galoppade, hohen Knien und gestrecktem Oberkörper eine perfekte Kür aufzuführen – mit nichts als einem Steckenpferd in der Hand. Es ist Turnen und Leichtathletik mit wahnsinnig
Aufgezeichnet von Chiara Joos
Foto
Julia Steinigeweg
viel Ausdauer in einem. Skepsis begegnet mir trotzdem oft. Online hagelt es manchmal gemeine Kommentare. Meine Empfehlung: löschen und weitermachen. Der Sport hat mir beigebracht, dass nicht alle verstehen müssen, was einen glücklich macht. Bald möchte ich mit einer Trainerausbildung anfangen.
Was ist härter: Galopp oder die skeptischen Blicke anderer? Wenn andere skeptisch schauen, geht mir das schon nahe, da würde ich mich gerne einfach unter meinem Pullover verstecken oder wegrennen. Blöde Kommentare dagegen ignoriere ich einfach. Was macht ein gutes Steckenpferd für dich aus? Fürs Springen sollte der Stock etwa 40 cm lang sein, das Gewicht leicht. Für höhere Sprünge länger und schwerer. Der Kopf sollte fest gestopft sein. Vor allem aber muss es sich »richtig« anfühlen.



Etwas lauert bei der Hausplanung immer im Verborgenen:d as Unerwartete. FingerHau ss orgt für maximale Planungssicherheit bei Ihrem neuen Zuhause und bietet Ihnen dank preisgekröntem Servic eu nd inn o vative rHolzfertigbauweise höchste Qualität–vonder ersten Planung bis zum fertigen Eigenheim.
Unser Experte: Kay Schumann, 50, aus Niedersachsen, ist Verbandsvorstand, Schiedsrichter und Trainer im Hobby Horsing. 2024 hat er die erste deutsche Meisterschaft organisiert, mit mehr als 2.500 Zuschauern.

Begonnen hat alles 2019. Meine Tochter, damals zwölf, kam mit einem Steckenpferd samt Plüschkopf und Zaumzeug heim. Ich sah ihr erst nur zu, dann fand ich Gefallen an dem durchaus anstrengenden Gymnastiksport. Hobby Horsing ist in Deutschland vor allem durch Social Media bekannt geworden, hat seinen Ursprung aber in Finnland. Inzwischen waren meine Tochter und ich schon viele Stunden gemeinsam mit den Steckenpferden im Wald und auf Turnieren. Die verschiedenen Disziplinen, darunter Dressur, Puissance, Western Trail und Horsemanship, sind anstrengender, als viele denken, und verlangen ein gewisses Maß an Körpergefühl, Koordination und Konzentration. Eine Minute für acht bis zehn Hindernisse, danach ist man durch. Ich habe schon topfitte Erwachsene
gesehen, die nach der Runde mit hochrotem Kopf die Seitenlinie suchten. Beim Puissance, dem Springen, geht es um Höhe. 1,47 Meter ist der Rekord, 90 Zentimeter meiner. Beim Western Trail geht es um enge Wendungen, im Horsemanship um Harmonie, Präzision und feine Kontrolle im Zusammenspiel mit dem Steckenpferd. Mindestens 300 Gramm ist es schwer, meist mit flauschigem Kopf und aufwendig gestalteter Trense. Ich besitze etwa zehn Stück. Meine Tochter auch. Mein fuchsfarbenes Lieblingspferd habe ich seiner Herstellerin abgeschwatzt, die es eigentlich nicht verkaufen wollte. Jetzt ist es mein Markenzeichen, mit Trense, Decke und Fliegenfransen. Alles Maßanfertigung, versteht sich. Kreativität ist Teil des Sports. Wir Hobby Horser organisieren untereinander Zubehör, basteln, nähen und tauschen uns
Aufgezeichnet von Chiara Joos
Foto
Severin Wohlleben
aus. Einige Tausend Euro sind dafür sicher schon versprungen.
Eigentlich mache ich Robotik und Fördertechnik für die Autoindustrie, aber nebenbei baue ich in meiner Firma Hindernisse und Pokale mit meinen Mitarbeitern. Leider konnte ich sie trotzdem nie fürs Hobby Horsing begeistern. Im Schaufenster meines Nebengeschäfts und HobbyHorsingVerbandsstützpunkts hängen heute Halfter und Glitzerbänder.
Was ist härter: Galopp oder die skeptischen Blicke anderer? Definitiv der Galopp! Die Blicke sind mir egal. Was macht ein gutes Steckenpferd für dich aus? Es gibt so viele Unterschiede in der Verarbeitung der Nähte, in der Form, der Mähne, bei Ohren und Gewicht. Manche kosten bis zu tausend Euro. Ich selbst schaue aber nur auf das Aussehen.
WILLKOMMENSBONUS

InvestierenSie mitunserer preisgekrönten Vermögensverwaltung einfachund kostengünstig in dieglobalenAktien- und Anleihenmärkte.Laut Stiftung Warentesteine„schlüssige Anlageidee“.

BONUSCODE:

Nureinlösbar über www.weltsparen.de/zt1000
VERMOEGEN1000
Nureinlösbar über www.weltsparen.de/wissen1000
Ein Angebotder Raisin Bank AG.Anlagen in WertpapiereunterliegenWertschwankungen.Bitte beachten Siedie Risikohinweise auf weltsparen.de/risikohinweise. Weitere Informationenzuden Teilnahmebedingungen findenSie aufunserer Website.





Weiden mit Solarzellen abzudecken, ist keine gute Idee –außer beide Seiten profitieren davon, Strom- und Landwirtschaft
Solarzellen im Freiland konkurrieren mit der Landwirtschaft um Flächen. Das wird sich ändern
Text Niels Boeing
Als Ende April auf der gesamten Iberischen Halbinsel der Strom ausfiel, ging in den sozialen Medien das Geraune los. Die Solarenergie mit ihrer täglich schwankenden Stromproduktion sei schuld, lautete eine Hypothese, vom »ersten Blackout der grünen Ära« war gar die Rede.
Nun muss man einräumen, dass Solarparks ebenso wie Windparks die Landschaft verändern. Weiden und Wiesen scheinen plötzlich wie mit einem bläulich schimmernden Panzer bedeckt. Das ist mehr als ein ästhetisches Problem: Bereits 2018 befand sich ein Viertel aller Solarparks weltweit auf landwirtschaftlichen Flächen. Darauf hätte man Nahrungsmittel für mehr als vier Millionen Menschen produzieren können. Seitdem sind Zahl und Größe von Solarparks rasant gestiegen, hat sich die installierte Leistung weltweit vervierfacht. Allein für
die Energieziele der EU würden bis 2040 noch einmal Zehntausende Quadratkilometer Land benötigt. Eine Projektionsfläche für alle Solarhasser.
Doch so muss es nicht kommen. Die Solartechnologie könnte eines Tages weitgehend unbemerkt in unserer Umwelt verschwinden. Enorm dünne Solarzellen lassen sich schon heute in Hausfassaden und Dachziegel integrieren. Selbst Fenster können zu Solarzellen werden: Dank neuer Halbleitermaterialien können sie UV- und Infrarotlicht in Strom umwandeln, sichtbares Licht jedoch durchlassen. Die Aussicht bleibt erhalten.
Dünne, biegsame Solarzellen wiederum können auch um kurvige Objekte gelegt werden. Gebäudeintegrierte Photovoltaik nennt sich das. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme schätzt das Potenzial in der Bundesrepublik auf 1.000
Gigawatt Leistung. Das ist fast viermal so viel wie die gesamte installierte Leistung aller deutschen Kraftwerke derzeit. Die Zentrale von Apple im kalifornischen Cupertino etwa ist mit einem der größten Solardächer der Welt ausgestattet. In Europa gibt es inzwischen einige Bürogebäude mit Solarfassaden. Die sogenannte Agrivoltaik zeigt, wie sich Landwirtschaft und Photovoltaik kombinieren lassen. Forschende in Kalifornien haben herausgefunden, dass Schafherden sich zwischen den Solarpanels pudelwohl fühlen. Sie genießen den Schatten, und das Gras ist dank verminderter Hitze nährstoffreicher. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg hat in Versuchen gezeigt, wie sich unter den Solarzellen Getreide, Gemüse oder Obst anbauen lässt. So könnte die derzeitige Aufregung um die Solarenergie in einigen Jahren eine Anekdote von gestern sein.
Weiterlesen: Die Internationale Energieagentur hat einen Leitfaden zu gebäudeintegrierter Photovoltaik veröffentlicht (t1p.de/rx4cq). Die Agrivoltaik erklärt Kerstin Wydra von der FH Erfurt unter t1p.de/xoywn







Ein außergewöhnlicher Abend in der TISSOT Boutique Frankfur t am Main















Wa s i s t Z e i t? E i n fl ü c h t i g e r M o -
m e n t?
E i n e p hy s i k a l i s c h e G r ö ß e?
Ei n e Fr a g e d e r Pe r s p e k t i ve? Ru n d

6 0 g e l a d e n e G ä s t e t a u c h t e n b e i
e in e m b e s o n d e re n A b e n d-Eve nt in
d e r TI S SOT B o uti q u e Fr a n k f ur t a m
M a in ti e f in d a s wo h l ä lte ste Rät s e l
d e r M e n s ch h e it e in – u n d e r l e bte n
d a b e i d i e p e r f e k t e Ve r b i n d u n g a u s
W i s s e n s ch af t , P hil os o p hie , S til un d
S chwe ize r Uh r m a ch e r ku n st
G e m e i n s a m m i t d e m M a g a z i n
ZEI T WI S SEN l u d T I S S OT z u e in e r
e x k l u s i v e n G e s p r ä c h s r u n d e :
A n dre as L e b e r t , Ch ef re dak te ur vo n
Z EI T W I S S EN , d i s k u t i e r t e m i t D r
S i b y l l e A n d e r l , A s t r o p h y s i k e r i n ,
P h i l o s o p h i n u n d L e i t e r i n d e s Re s-
s o r t s W I S S EN b e i d e r Z EI T, ü b e r
d as P h ä n o m e n d e r Ze it – m a l t i ef-
gr ü n d i g , m a l a u g e n z w i n ke r n d , a b e r i m m e r m i t r e i ß e n d Wa n n v e r g e h t
Ze it s ch n e ll e r, wa n n s ch e int si e s t ill-
z u s t e h e n? Wa r u m f ü h l t s i c h e i n
M o m e nt ew i g a n – un d e in J a h r w i e e in W im p e r ns ch l a g?


1 Ein charmanter Auftakt – Arnd Cronenberg, Brand Manager TISSOT und Gastgeber des Abends, heißt die Gäste willkommen
2 Melanie Völker, Marketing Managerin TISSOT, im anregenden Austausch mit dem Chief Creative Officer der ZEIT, Dr. Mark Schiffhauer
3 Intellektuell inspirierend und mit viel
Humor – der Talk von Andreas Lebert, Chefredakteur ZEIT WISSEN, mit der Astrophysikerin und Philosophin Dr Sibylle
Anderl zum Thema Zeit
4 Nach dem Talk ist vor dem Dialog – Begeisterung und anregende Gespräche über Zeit, Technik und die neue PRC 100 Solar


Zw i s c h e n k ü h l e n D r i n k s , f e i n e n Häppchen und angereg ten G esprächen wurde nicht nur philosophier t , s o n d e r n au ch gefe ie r t: die L an cier un g d e r n e u e n T I S S OT PRC 10 0 S olar, einer Uhr, die S onnenlicht in E n e r g i e v e r w a n d e l t – u n d d a m i t n i c ht n u r e i n s t i l v o l l e s S t a t e m e nt set z t , sonder n auch die Zeit im besten S inne neu denk t Elegant , präzis e, na chhaltig: Die PRC 100 S o lar wurde an diesem A bend zum heimlichen St ar an vielen Handgelenken


5 Mitten im Geschehen – Victoria Schuer (li ), TISSOT Marketing, im angeregten Austausch mit Gästen
6 The place to be: die TISSOT Boutique in Frankfurt am Main, Steinweg 6
Die Stimmung? Entspannt, neug i e r i g, i n s p i r i e r t Zw i s c h e n B o utique-Vitrinen, edlen Zeitmessern und leuchtenden Gesichtern verging der Abend wie im Flug – oder vielleicht, ganz im Sinne des Themas, dehnte sich die Zeit ein wenig, weil man sie einfach nicht enden lassen wollte Wer dab ei war, wird ihn nicht s o schnell vergessen Und wer ihn verp a s s t h a t? D e r d e n k t s i c h w a h rs ch einlich: S cha d e – ab e r h off e ntlich nicht das let z te M al























Mal wirklich nichts tun – das dient nicht nur der Regeneration. Eine Pause kann die Welt verändern, die große und die kleine um uns herum. Und zwar ganz von selbst. Wir müssen sie nur lassen
Text Tobias Hürter Illustrationen Clémentine Campardou
Nie war die Welt dem Untergang näher als am 27. Oktober 1962, dem »Schwarzen Samstag«: dem Tiefpunkt der Kubakrise. Die Supermächte USA und Sowjetunion waren kurz davor, ihre Atomwaffen aufeinander loszulassen. Zwei Wochen zuvor hatte der amerikanische Präsident John F. Kennedy erfahren, dass die Sowjetunion dabei ist, Atomraketen auf Kuba zu stationieren, nur 150 Kilometer von amerikanischem Boden entfernt. Kennedy ordnete eine Seeblockade Kubas an. Die Welt verfolgte entsetzt mit, wie sowjetische Kriegsschiffe auf die amerikanische Blockade zuhielten. Beide Seiten versetzten ihre Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft.
Am Morgen dieses Samstags trafen sich die höchsten Sicherheitspolitiker und Militärs der USA im Cabinet Room des Weißen Hauses. Sie wussten, dass ihre Entscheidungen Millionen Leben kosten oder retten konnten. Der Druck war enorm.
In die Nervosität platzte die Nachricht, dass ein U-2-Spionageflugzeug der CIA über Kuba abgeschossen worden war. Da verloren die Generäle die Nerven. Sie drängten Kennedy, nun ebenfalls die Waffen sprechen zu lassen: Einen Luftangriff auf Kuba, sofort! Mindestens. Oder gleich eine Invasion. Die mächtigste Kriegsmaschinerie der Welt erwartete Kennedys Befehl.
Doch John F. Kennedy gab den Befehl nicht. Er sagte: »Let’s wait« – lasst uns warten. Er widerstand
dem Impuls, sich weiter in die Eskalation zu stürzen, und schuf einen Moment der Ruhe. Wollen die Russen uns wirklich provozieren? Vielleicht spürt Nikita Chruschtschow den gleichen Druck wie ich. Nein, so eilig zettele ich keinen Weltkrieg an.
Am Abend schickte Kennedy seinen Bruder Robert zu einem Geheimtreffen in die sowjetische Botschaft: Die Amerikaner würden einen Teil der Forderungen erfüllen. Am nächsten Morgen meldete Radio Moskau, dass die sowjetischen Raketen aus Kuba abgezogen würden. Die Krise war entschärft. Kennedys Pause rettete womöglich die Welt.
Damit zeigte John F. Kennedy eine Kunst, die zu selten geworden ist: die Kunst, Pause zu machen. Er war kein Zauderer, keine Unentschlossenheit hielt ihn zurück. Er tat im richtigen Moment nichts. Das scheint der menschlichen Natur zuwider zu sein: »Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe befindet, ohne Leidenschaften, ohne Beschäftigungen, ohne Zerstreuungen, ohne Betriebsamkeit«, schrieb der französische Philosoph Blaise Pascal. »Dann fühlt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere.« Oder ist es eher eine Schwäche unserer Kultur als unserer Natur, die uns daran hindert, zur Ruhe zu kommen?
»Ich brauche eine Pause«, dieser Satz gilt als Eingeständnis. Die Kraft reicht nicht, ich kann nicht mehr. Aber auch allmächtige Wesen brauchen manchmal eine
Pause. Ganz am Anfang der Welt, in der biblischen Schöpfungsgeschichte, stand eine Pause: »Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte.« Gott hätte die Pause nicht gebraucht. Er hatte Kraft genug für eine ganze Woche. Doch er hielt inne und betrachtete sein Werk, wie es zum Rhythmus einer guten Schöpfung gehört.
Das Gebot der Pause gab Gott durch Mose auch den Menschen: »Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren.«
Irgendwann zwischen damals und heute ist dieses Gebot in Vergessenheit geraten. Der Sonntag mag für viele arbeitsfrei sein. Aber da warten die Hobbys, der Sport, der Garten, die Steuer. Wirklich innehalten, ruhen und das eigene Werk betrachten, das ist auch am Sonntag nicht mehr üblich. Üblich ist eher pausenlose Geschäftigkeit. »Wer rastet, der rostet.«
Der französische Historiker Alain Corbin geht in seinem Buch Histoire du repos (»Geschichte der Ruhe«) der Frage nach, wie die Pause entheiligt wurde. Es war im 19. Jahrhundert, stellt er fest, während der industriellen Revolution, als Produktivität das Maß der Dinge wurde. Die Dampfmaschinen gaben nun den Takt vor. Sie brauchten keine Pause. »Zeit wurde strikt gemessen«, schreibt Corbin. »Die Freiheit, kurz Pause zu machen, wich dem beständigen Rhythmus der Maschinen. Keine Verlangsamung wurde mehr geduldet.« Aber Menschen sind nun mal keine Maschinen. Arbeiterinnen und Arbeiter erkämpften sich das Recht auf Pausen. Aber es waren nicht mehr die Pausen von einst. Sie dienten nun der möglichst raschen Wiederherstellung der Arbeitskraft: Zweckpausen, lästig, aber nicht zu vermeiden –und nicht mehr heilig.
Diese Pausen sind keine wirkliche Ruhe, kein Innehalten mehr. Sie gehören nicht mehr zum natürlichen Rhythmus des Lebens, sondern zum Maschinentakt.
Corbin erinnert an die noch im 19. Jahrhundert gepflegte, heute vergessene Sitte einer »repos public«, einer öffentlichen Pause, in der die Bürger alle politischen Diskussionen beiseiteließen, um zur Ruhe zu kommen. Eine Idee, die heute, in der Ära der sozialen Medien, nachahmenswert klingt. Aber dann lockt doch wieder das Handy noch mehr.
So kommt es, dass viele Menschen ein zwiespältiges Verhältnis zur Pause haben: Sie sehnen sich nach Pausen und wollen doch keine machen. So gelingt natürlich auch keine richtige Pause – und die Sehnsucht danach wird immer größer. Ein weit verbreitetes Seufzen hat
sich eingestellt: Ich brauche unbedingt mal eine Pause. Ich komme nur nicht dazu.
Dabei wissen wir, wie wichtig Pausen sind. Pausen gehören genauso zum Trainingsplan von Profisportlern wie harte Einheiten. Intensives Training zerstört den Körper, Pausen bauen ihn wieder auf. Im richtigen Rhythmus von Pause und Belastung wird der Körper stärker. Stimmt der Rhythmus nicht, trainiert man sich in den Keller. Nach der Wettkampfsaison pausieren Profis manchmal wochenlang. Auch der Sportsgeist braucht Pausen. Freizeitsportler sind weniger pausenbewusst. Sie quetschen zwischen Beruf, Familie und Haushalt, was geht. Die Couch ist für Couch-Potatos. In der Musik geht ohne Pause sowieso nichts. Rhythmus ist ein ständiger Wechsel von Aktivität und Pause, in der Musik wie im Leben. Ohne Pausen gäbe es nur Dauerlärm. Berühmt ist die Pause, die der österreichische Komponist Joseph Haydn in seine Sinfonie Nr. 94 »mit dem Paukenschlag« einbaute. Das Andante verklingt in Stille, die dem dann folgenden FortissimoAkkord mit Pauke eine solche Wucht verleiht, dass das Premierenpublikum in London 1792 regelrecht von seinen Sitzen aufschreckte.
Der Rhythmus von Aktivität und Pause prägt alle natürliche Zeit. Bäume verlieren für den Winter ihre Blätter und stellen das Wachstum ein. In der Landwirtschaft war es jahrhundertelang üblich, Felder regelmäßig ruhen zu lassen – bis die Bauern versuchten, diese Rhythmen mit pausenloser Intensivlandwirtschaft zu durchbrechen. Tiere halten Winterruhe. Menschen brauchen Schlaf, um Erlebtes zu verarbeiten, damit Stoffwechsel, Immunsystem und viele andere Körperfunktionen ihre Arbeit tun können. Ohne Pausen geraten sie aus dem Rhythmus.
Betrachtet man die Wirkung einer Pause auf Gehirn, Psyche, Stoffwechsel und Stimmung, kommt man kaum an der Erkenntnis vorbei, dass Pausen wesentlich zum Leben dazugehören. Der kollektive Seufzer ist berechtigt: Ja, du brauchst unbedingt eine Pause, jetzt, morgen und immer wieder.
Wenn das Gehirn zu wenig Pausen bekommt, zum Beispiel bei extremem Schlafmangel, verliert es buchstäblich den Verstand. Laut der »Attention Restauration Theory« der Psychologen Rachel und Stephen Kaplan von der University of Michigan kann das Gehirn seine kognitiven Ressourcen besser regenerieren, wenn es möglichst wenig Input von den Sinnen empfängt. Es braucht Pausen, um Erlebtes und Gelerntes zu verarbeiten. Schon ein paar Minuten Ruhe helfen.
Die besten Einfälle kommen oft in Pausen. Wenn die Gehirnareale, die für Planen und zielgerichtetes Handeln zuständig sind, das Kommando abgeben, kommt das »Default Mode Network« ins Spiel, ein Verbund von Arealen, der die »innere Erzählung« eines Menschen hervorbringt und dessen Erinnerungen und

Gefühle zu einem schlüssigen Ganzen fügt. Dieses Netzwerk wird im Schlaf aktiv – oder auch wenn man die Augen schließt und die Gedanken schweifen lässt. In diesem Zustand entstehen wie von selbst Ideen, auf die man bei angestrengter Suche nicht gekommen wäre.
Wie konnte die Kunst, im richtigen Augenblick nichts zu tun, verloren gehen? Auf der Suche nach einer Antwort geht der Philosoph Ralf Konersmann in seinem Buch der Unruhe buchstäblich bis zu Adam und Eva zurück. Seit das Urpaar des Christentums aus dem Paradies geflogen ist und lernen musste, seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts zu verdienen, hat der Mensch ein neurotisches Verhältnis zur Pause entwickelt. Noch bei den antiken Philosophen, vor allem bei den Stoikern, galten Nichtstun und Muße um ihrer selbst willen als wertvoll. Spätestens mit der Industrialisierung wurden sie suspekt.
Ruhe steht seither unter dem Verdacht, Zeitverschwendung zu sein. Nun ist das Verhältnis zwischen Ruhe und Unruhe auf den Kopf gestellt. Nicht mehr die Unruhe stört die Ruhe, sondern umgekehrt: Unruhe gilt als gut, Ruhe als schlecht. Laut Konersmann ist die Unruhe in der Neuzeit zum Merkmal eines gelungenen Lebens geworden – Fortschritt, Selbstentfaltung, per-
manente Bewegung. Die unablässige Betriebsamkeit, die Kultur der Unruhe reißt uns mit.
Die Pause wird zur Antiquität. Im Fernsehen gibt es keine Sendepause mehr. Die alten Testbilder wirken heute wie Mahnmale für die vergessene Kunst des Innehaltens. In der digitalen Welt wird sowieso pausenlos gewerkelt. Die Folgen sind messbar und ungesund. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2021 haben Stresskrankheiten wie Erschöpfung, Rückenschmerzen oder Schlafstörungen in zehn Jahren um 30 Prozent zugenommen. Mittlerweile fühlt sich jeder Vierte zunehmend gestresst. Haushalte mit Kindern sind stärker stressbelastet als Haushalte ohne Kinder. Am stärksten gestresst sind Alleinerziehende, die zu Hause arbeiten.
Wer glaubt, ohne Pausen durch den Tag zu kommen, macht wahrscheinlich dennoch welche:, »maskierte Pausen«, wie Arbeitspsychologen sie nennen: im Homeoffice mal schnell die Wäsche aufhängen, am Schreibtisch zwischendurch WhatsApp checken. Zwischen 5 und 15 Prozent der Arbeitszeit gehen für maskierte Pausen drauf, hat die Bundesagentur für Arbeit ermittelt. Viele Menschen sind so überlastet mit Arbeit, dass sie glauben, keine Zeit für Pausen zu haben. Die
Die Performance-Künstlerin Marina Abramović ist eine Meisterin der Leere
Text Hella Kemper
Ein schönes Hotel südlich vom Londoner Hyde Park, Marina Abramović durchschreitet das Foyer. Die 78-Jährige bereitet mit dem Pianisten Igor Levit ein gemeinsames Konzert vor. Er wird Erik Saties Klavierstück »Vexations« spielen. Mit ungefähr 16 Stunden ist das Stück eines der längsten in der Musikgeschichte. Satie empfahl schon vor hundert Jahren: Es wird gut sein, »sich darauf vorzubereiten, und zwar in größter Stille, mit ernster Regungslosigkeit«. Dafür ist Abramović da. Die Performance-Künstlerin stimmt das Konzertpublikum darauf ein, 16 Stunden durchzuhalten. Sie und Levit haben 2019 schon einmal zusammengearbeitet. Damals sammelte sie die Telefone und Uhren der Besucher ein und gab ihnen Lärmschutzkopfhörer, unter denen sie eine halbe Stunde lang auf Strandliegen in sich hineinhorchen konnten, bevor die Musik von Bach einsetzte: eine halbe Stunde Pause von allem, um die Wahrnehmung zu schärfen.
Marina Abramović wählt für unser Gespräch einen kleinen Tisch im Frühstücksraum des Hotels. Ich schiebe ein Foto über den Tisch. Es zeigt 57 Reiskörner und 30 Bohnen. »Ich war in Ihrer Retrospektive im Zürcher Kunsthaus und habe dort Reis und Bohnen gezählt.« – »Das sieht nicht besonders erfolgreich aus. Ihre Konzentration war ja bei minus null.« Bohnen und Reis zu zählen, ist eine typische Abramović-Aufgabe und Teil ihrer Methode, die sie als Professorin in den Achtzigerjahren entwickelt hat und »Cleaning the house« nannte. Abramović guckt auf mein Foto. »Sie müssen unbedingt unseren Workshop besuchen. Wir nehmen Ihnen alle Geräte ab. Abends gibt es eine Gemüsesuppe, danach reden und essen Sie fünf Tage lang
nicht. Schreiben ist okay, wenn man etwas träumt. Sie baden in kaltem Wasser und schreiben eine Stunde lang Ihren Namen auf und vieles mehr, danach sind Sie total fokussiert.« Wie Lady Gaga. Die Sängerin war die erste Prominente, die nach Abramović’ Anleitung trainierte. Bei einer anderen Performance, in einer Galerie in Mailand, trugen 25 Teilnehmer Laborkittel und saßen dreißig Minuten lang auf zu Stützen und Sitzen geformten

Den Schmerz überwinden: So hält Marina Abramović die Zeit an
Quarzblöcken, die Abramović »Transitorische Objekte« nennt. Anfang der 1990erJahre wiederum hatte sie diese Objekte in Tokio installiert und Passanten eingeladen, Kopf, Herz oder Hüfte gegen die weich aussehenden Blöcke zu lehnen und zu warten. Warum? »Um den Kopf zu leeren«, stand auf einem kleinen Zettel. Lady Gaga kam ohne Perücke und Makeup. Sie zog den Overall an, den Abramović für 29,99 Dollar in einem John-DeereTraktorladen gekauft hatte, und aß vier Tage nichts. Sie sprach kein Wort und lief mit verbundenen Augen durch den Wald.
Am Ende sagte Lady Gaga, dass es ihr bester Entzug gewesen sei. Sie fühlte sich »clean«, gereinigt.
Warum sind Fasten und Schweigen so wichtig, Frau Abramović?
»Das sind Rituale. Rituale beruhen auf Wiederholung. Wiederholung beruht auf einem Geisteszustand, in dem du aufhörst zu denken. Wenn du nicht denkst, erlebst du die Gegenwart. Wenn du in der Gegenwart bist, existiert keine Zeit.«
Wie schafft man das – nicht zu denken?
»Mit dem Denken aufzuhören, ist harte Arbeit. Wenn man übt, kann man diesen Zustand erreichen. Es ist der beste Zustand, den es gibt – es ist Glückseligkeit.«
Haben Sie ihn im Modern Museum of Art in New York erlebt, bei Ihrer berühmten
Performance »The Artist is Present?«
»Es war die wichtigste Arbeit meines Lebens, weil ich diesen Moment der Glückseligkeit da so viele Male erlebt habe – fast die ganzen drei Monate.« Abramović saß insgesamt 736 Stunden auf einem Stuhl, sieben Stunden am Tag, sie aß nicht, sagte nichts, bewegte sich nicht. Ihr gegenüber nahmen in dieser Zeit 1.675 Menschen Platz. »Jeder Tag war ein Kampf. Aber wenn man den Schmerz der körperlichen Anstrengung überwindet, ist man in der Gegenwart.«
Wie gelingt das?
»Wenn man alles verlangsamt, entsteht irgendwann zwischen zwei Gedanken eine Lücke. Diese Lücke wird größer und größer
Getty Images und reißt auf. In diesen Riss kann man hineingehen. Dann setzt die Zeit aus.« Das Leben macht eine Pause? »Wenn Sie in der Lage sind, sechs Stunden lang Reis und Bohnen zu zählen, werden Sie es erleben. Aber Sie müssen die Reise selbst machen.« Das Handy leuchtet auf. »I’m sorry. Kiss and run, I’m so late.«


brauchen sie aber. Also schleichen sich Pseudopausen in den Tagesablauf ein.
In einer inzwischen klassischen Studie zur Wirkung von Pausen untersuchten israelische Psychologen Richter, die über Bewährungsgesuche von Straftätern zu entscheiden hatten. Wenn diese Richter keine Pause machten, bewilligten sie nach einer Weile kaum noch Anträge. Sobald sie dann doch pausierten, stieg die Quote wieder an. Man stelle sich vor, John F. Kennedy hätte an jenem Schwarzen Samstag wie ein überarbeiteter Richter über den Militärschlag entschieden, zu dem seine Berater ihn drängten. Ohne sein »Let’s wait« hätte es für die Menschheit böse enden können.
Pause machen, nichts scheint einfacher. Mit allem aufhören, die Hände in den Schoß legen. Von wegen. Viele Menschen haben verlernt, Pause zu machen, zum Beispiel einfach dazuliegen und bewusst still zu sein. Entweder sie schlafen ein, oder sie werden unruhig. Im Yoga bedeutet Pause, bewusst einen Moment der Stille zu erleben. Nichts tun, einfach sein – gar nicht so einfach. Es gibt inzwischen eine Pausenindustrie, die mit Ratgebern, Podcasts, Apps und Achtsamkeitsretreats zur optimalen Pause anleiten will: eine widersinnige Geschäftigkeit des Pausemachens.
Pausen sind Anti-Ereignisse. Sie können irritieren, die Aufmerksamkeit wecken, das Erleben intensivieren, die Wahrnehmung schärfen, die Sinne öffnen. Sie können auch verstören. Deshalb neigen manche Menschen dazu, das Handy zu zücken, um der Stille zu entfliehen. Sie wollen verweilen, können aber nicht. Das ist das Dilemma, das Konersmann in seinem Buch beschreibt. Ruhe ist nicht mehr Ziel, sondern Mittel zur Unruhe. Die Pause wird funktionalisiert: Schlaf als Biohacking, Urlaub als Regeneration für den nächsten Produktivitätszyklus, Meditation zum Stressabbau.
Auch die Werbebranche bedient die ungestillte Sehnsucht nach der Pause. Während der Weltwirtschaftskrise der 1920er-Jahre wurde Coca-Cola mit dem Slogan »The pause that refreshes« (»Die Pause, die erfrischt«) groß. In den 1980er- und 1990er-Jahren nahmen die Pausen in den Werbesprüchen geradezu überhand: »Have a break, have a Kitkat« – »Pause bei McDonald’s« – »Die schönsten Pausen sind lila«. Dabei ging es vor allem darum, bequeme und nahrhafte Snacks und Getränke zu verkaufen. Schokoriegel statt selbst geschmierte Brote. Schnell eine Zuckerbrause am Schreibtisch, statt sich einen Kaffee zu kochen. Keine Zeit verschwenden mit der Zubereitung von Essen und dem Drumherum. Es geht dabei also gar nicht um echte Pausen. Es geht um mehr Tempo im Alltag. Schnell essen, um Zeit zu sparen, um noch mehr arbeiten zu können – bis wir vor Erschöpfung mit der gewonnenen Zeit nichts mehr anfangen können.
»Menschen sind Pausenwesen«, schreibt der Zeitforscher Karlheinz Geißler in seinem Buch Lob der
Pause – warum unproduktive Zeiten ein Gewinn sind. »Wer nicht zwischen Zeiten der Aktivität und der Passivität wechselt, der wird atemlos und gestresst.« Wir sind dabei, uns vom natürlichen Rhythmus von Tun und Pause zu entfremden, der uns die eigene Lebenszeit erst erfahrbar macht.
In der Zeit der Corona-Lockdowns, als nie richtig etwas los und nie richtig Pause war, ging der Rhythmus völlig verloren und mit ihm das Zeitgefühl.
Rituale können helfen, den Rhythmus wiederzufinden. Pausen, bei denen vorgegeben ist, wie wir sie verbringen, fallen uns leichter. Zum Beispiel die Halbzeitpause im Fußball, in der die Trainer in der Kabine ihre Ansprachen mit Wunderwirkung halten und die Fans in der Schlange zum Bierausschank über den Schiedsrichter schimpfen. Die Pause im Theater, in der über das Stück und über die Garderobe der anderen Zuschauer diskutiert wird. Die Zigarettenpause, zu der die Raucher alle zwei Stunden gemeinsam vor die Tür gehen. Schwieriger sind die ungeplanten Zwangspausen: die Verspätung der S-Bahn, der Stau an der Baustelle, der Tag im Bett mit Infekt. Es ist eine Übung in Demut, sie als geschenkte Ruhe anzunehmen.
Eine vorbildliche Pausenkultur ist die »Fika« in Schweden: die rituelle Kaffeepause mit Freunden, Verwandten oder Kollegen, oft mit Keksen oder Zimtschnecken, egal zu welcher Tageszeit. Je eine 20-minütige Kaffeepause morgens und abends ist Arbeitnehmern vertraglich garantiert und gilt als Arbeitszeit. Das haben die schwedischen Gewerkschaften erstritten.
Auch in Deutschland haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Pausen. Im Jahr 1873 setzte der Verband der Buchdrucker den ersten Flächentarifvertrag und damit die erste Pausenregelung durch: »Die tägliche Arbeitszeit ist eine zehnstündige, inclus. einer Viertelstunde Frühstück und einer Viertelstunde Vesper.« Heute regelt das Arbeitszeitgesetz von 1994 die erforderlichen Pausenzeiten. Je nach Branche kommen noch zusätzliche Pausen hinzu, zum Beispiel die »Steinkühlerpause«, die Fließbandarbeitern in der Metallindustrie fünf freie Minuten pro Stunde zusätzlich gewährt. Das ist zwar ein sozialer Fortschritt, aber weit entfernt von der heiligen Ruhe von einst.
Eine echte Pause ist eine existenzielle Erfahrung. Der Philosoph und Mathematiker Edmund Husserl sah in der Pause den Anfang der Philosophie. In seinem Denken spielte die »Epoché« eine Schlüsselrolle: das bewusste Innehalten und Auf-sich-beruhen-Lassen, um die Welt so sehen zu können, wie sie ist. Der dänische Existenzialist Søren Kierkegaard plädierte für Zeiten des Schweigens und Alleinseins, um sich selbst zu begegnen: seinen Ängsten, seinen Möglichkeiten, den gelebten und ungelebten. Wer keine Ruhe findet, wird nie in Schwung kommen, argumentierte Kierkegaard: »Es ist recht sonderbar, dass Langeweile, die selbst ein so ruhiges und
Eine echte Pause ist eine existenzielle Erfahrung.
Ein Anti-Ereignis, das die Wahrnehmung schärft

gesetztes Wesen ist, eine derartige Kraft hat, etwas in Bewegung zu setzen. Es ist eine durchaus magische Wirkung, die die Langeweile ausübt, nur dass diese Wirkung nicht anziehend, sondern abstoßend ist.«
Die Lehren des Buddhismus messen dem Innehalten eine ähnliche Bedeutung zu. Der Zen-Meister Thích Nhất Hạnh empfahl seinen Schülern, immer wieder Pausen von ein paar Minuten in den Tag einzubauen, nicht um produktiver zu werden, sondern um ihrer selbst willen: als Momente reinen Seins.
Die Kunst der Pause, wie Gott sie am siebten Tag pflegte, lebt heute im Sabbat fort, dem heiligen Ruhetag der Juden. Nach den heiligen Schriften des Judentums und des Christentums hat Gott selbst den Menschen das Gebot gegeben: »Am siebten Tag sollst du ruhen.« Der polnische Rabbiner Abraham Joshua Heschel, der im Jahr 1939 vor den Nazis in die USA floh, schrieb darüber ein Buch: Der Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen . Am Sabbat befolgen gläubige Juden das Gebot, nicht zu arbeiten. Nicht um gelangweilt rumzuhängen. Nicht um »die Batterien aufzuladen« wie bei einem Handy. »Der Mensch ist kein Lasttier, und der Sabbat ist nicht dazu da, die Effizienz seiner Arbeit zu steigern«, schreibt Heschel. »Sechs Tage in
der Woche versuchen wir, die Welt zu beherrschen. Am siebten Tag versuchen wir, das Selbst zu beherrschen.«
Für Heschel ist die Sabbatruhe nicht nur Freizeit und Nichtstun. Sie ist eine spirituelle Praxis. In ihr können wir – nicht nur gläubige Juden – erleben, dass Zeit wichtiger ist als Raum. Einen »Palast in der Zeit« nennt Heschel den Sabbat. Alle Regeln und Verbote des Sabbats sind nicht das, worum es eigentlich geht. Sie schaffen nur den Rahmen. Es geht um eine Zeit ohne Zweck, um die Bedeutung des reinen Seins, ohne »Wozu ist es gut?«, ohne »Was ist zu tun?«. Die Sabbatruhe, richtig geübt, ist keine Askese. Sie macht Freude.
Das Gebot der Sabbatruhe hat auch eine weltliche Seite: Es ist Widerstand gegen die Herrschaft von Effizienz, Beschleunigung und Zweckmäßigkeit. Wer lernen will, richtig zu pausieren, kann sich jenseits aller Religion etwas davon abschauen.
Der Rabbi, die Philosophen, der Zen-Meister – sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen zum selben Schluss: Nimm dir Pausen, nimm sie wichtig.
Tobias Hürter hat gute Erfahrungen mit Atempausen gemacht, wenn ihm alles zu viel wird. Fünf Minuten lang jeweils fünf Sekunden ein- und ausatmen. Dreißigmal durchatmen.
Im Universum herrscht womöglich weniger Hektik als lange Zeit angenommen
Text Johanna Michaels
Auch das Universum macht manchmal Pause. Das besagt eine neue Theorie der Kosmologie. Sie lässt den Sternenhimmel, zu dem wir seit Jahrtausenden ehrfürchtig aufblicken, plötzlich menschlich erscheinen. Aber wovon muss sich das Universum eigentlich erholen? Und ist es Zufall, dass die Kosmologie uns hier aus der Seele spricht?
Bisher zeichnete die Wissenschaft eher das Bild eines unermüdlichen Ungetüms: Alles begann mit dem Urknall vor gut 14 Milliarden Jahren, als sich der Raum aus einer Singularität zu den unendlichen Weiten von heute ausdehnte. Seither expandiert das Universum mal langsamer, mal schneller. Für das unterschiedliche Tempo sorgen drei verschiedene Formen von Energie, die sich wie bei einem Staffellauf abwechseln und die Geschichte des Universums in Epochen aufteilen.
Nachdem es sich unter noch ungeklärten Umständen im Bruchteil der ersten Sekunde explosionsartig ausgedehnt hatte, ergriff die Strahlung als treibende Energieform den Stab. Durch die Expansion geschwächt, ging ihr die Puste aus, und sie übergab an die Materie, die mit ihren frisch geformten Galaxien den Raum übernahm. Auch sie wurde schließlich von der Expansion ausgedünnt. Heute dominiert die noch unbekannte »dunkle Energie« das Geschehen.
Ihr scheint die Expansion nichts anhaben zu können, und so dehnt sie den Raum immer weiter und immer schneller aus.
Es ist noch gar nicht so lange her, da stellten sich die Menschen das Universum als unveränderlichen Raum in ewiger Ruhe vor. Als Albert Einstein 1917 mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie das erste physikalische Modell des Universums formulierte, drehte er noch so lange an den Gleichungen, bis sie statt eines beweglichen ein statisches Universum ergaben. Dann beobachteten Astronomen jedoch, dass sich Galaxien immer weiter voneinander entfernen. Während sich die Gesellschaft im 20. Jahrhundert durch Wirtschaftswachstum und technischen Fortschritt rasant veränderte, folgte auch die Kosmologie diesem Trend: Der ruhende Raum wurde zu einem expandierenden Universum, das wie getrieben durch seine verschiedenen Epochen hetzt.
Astrophysiker von der University of Arizona stellen die naturwissenschaftliche Schöpfungsgeschichte nun abermals infrage. Vielleicht hat sich das Universum gar nicht so rastlos verändert, wie man bisher dachte. Stattdessen könnte es Zeiten gegeben haben, in denen keine der Energieformen den Staffellauf anführte. Die Forscher untersuchten mithilfe von Simulationen eine Reihe hypothetischer Teilchen, aus deren Zerfall die uns heute bekannten Elementarteilchen hervorgegangen sein könnten. Da es in diesem Szenario mehr Materie gab, die im Zerfall auch mehr Strahlung aussendete, gab es Phasen, in denen sich Strahlung, Materie und dunkle Energie ausbalancierten statt übertrumpften. In dieser Zeit stand die Energie im expandierenden Raum still – als würde das Universum kurz verschnaufen. Auch wenn die Forschenden in ihrer Simulation eher zufällig auf diese Phasen des Stillstands stießen, passt ihre These erstaunlich gut in eine Gesellschaft, die sich selbst nach einer Pause sehnt.
Beeinflussen Stimmungen das Weltbild der Naturwissenschaften? Für den Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn ist das gar nicht so abwegig. »Wissenschaft wird von Menschen gemacht«, sagt er, »sie ist ein soziales und kulturelles Phänomen.« Obwohl naturwissenschaftliche Theorien aus allgemeingültigen Naturgesetzen bestehen, seien sie daher immer auch Kind ihrer Zeit. Dass Einstein noch am statischen Universum festhielt, obwohl seine Relativitätstheorie schon etwas anderes vermuten ließ, lag schließlich auch am damals vorherrschenden Bild eines ewig ruhenden Raumes. »Dass wir überhaupt Einsichten in die Geschichte und Struktur des Kosmos bekommen haben, über Mythologien oder philosophische Spekulationen hinaus, ist eigentlich das Erstaunliche«, sagt Renn. Der Blick in den Sternenhimmel ist zu einem Zweig der Naturwissenschaft geworden. Aber er bleibt ein zutiefst menschlicher Blick.
Laut der neuesten Studie der Astrophysiker aus Arizona könnte das Universum übrigens schon in der Sekunde direkt nach dem Urknall die erste Phase des Stillstands durchlaufen haben. Den Tag mit einer Pause beginnen – warum eigentlich nicht?
Der Mensch strebt danach, mit der Welt im Reinen zu sein. Er hofft, dass seine Wünsche erfüllt werden und das Leben nicht zu unübersichtlich wird. Dürfen wir dabei helfen?
Regionale Verteilung nach Landkreisen
Verteilung nach Siedlungsdichte
Bundesweite Umfrage: Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer derzeitigen Lebenssituation?
überdurchschnittlich zufrieden durchschnittlich zufrieden
unterdurchschnittlich zufrieden
Zufriedenheit mit dem Sexleben nach Beziehungsstatus.* Mit dem Leben allgemein am zufriedensten sind Verwitwete mit neuem Partner
Verlauf der Lebenszufriedenheit in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren. 2019 war in diesem Zeitraum das Jahr mit der höchsten Lebenszufriedenheit
Überhaupt nicht
Ein wenig
Sehr viel
wurde in Ostpreußen der Ort »Zufriedenheit« gegründet. Nach 1945 ist die Siedlung verschwunden. Die Gegend liegt heute in Russland
Teilweise
Recht viel
Umfrage nach Test der VierTage-Woche: »Hat sie zu Ihrem Wohlbefinden beigetragen?«
Anteil der erreichten Zufriedenheit von Mick Jagger im Rolling-StonesSong »(I Can’t Get No) Satisfaction« 4,2–4,7 Sterne
gelten bei Onlinebewertungen als vertrauenswürdigster Ausdruck von Kundenzufriedenheit. Mehr Sterne wirken nicht mehr authentisch
sehr zufrieden Zufrieden
Unzufrieden Sehr unzufrieden teils/teils
Antworten nach Parteipräferenz auf die Frage »Wenn Sie an Ihr Leben insgesamt denken: Wie zufrieden sind Sie damit?«
»Ich gebe die Menschen nicht auf.

Wir müssen jetzt zusammenhalten«
Jeder Mensch kann gut aussehen, findet dieser Mann. Ob groß oder klein, ob in Uelzen, Dresden oder Würzburg. Aber noch wichtiger findet er, dass wir gut zueinander sind
Der Modedesigner und Entertainer Guido Maria Kretschmer begegnet in seinem Leben sehr vielen sehr unterschiedlichen Menschen. Als er uns zum Interview trifft, sagt er, dass er jedes Mal einen kleinen Scan mache, wenn er eine neue Person sehe. Blitzschnell, ohne zu verurteilen und ganz automatisch. Wir wollten natürlich wissen, was da bei uns, die ihn interviewen, rauskam. Hier seine zwei Minibilder in Kurzform: Andreas Lebert ist ein Mann, der gerne Musik mag und weiß, dass morgen die Tür aufgehen und alles ganz anders sein könnte. Sein klimpernder Armschmuck signalisiert: Er will, dass was passiert. Katrin Zeug ist eine Frau, die Menschen mag, aber auch gut mit sich sein kann. Die schnell ist und praktisch. Bei ihren blutrot lackierten Nägeln denkt er sich: Die lebt aber auch!
Herr Kretschmer, wie wir uns kleiden, unsere Wohnung einrichten, unsere Haare tragen, hat viel mit unserer Identität zu tun. Sie sind der Experte für solche Accessoires, was sollte man unbedingt wissen? Mode und Accessoires sind die Haut der Seele, sie zeigen ganz laut, wer man ist. Oder wer man sein will. Sie können auch die Einstiegskarte für Träume sein, die wir uns noch nicht leisten können, für eine Identität, die wir vielleicht irgendwann gerne hätten. Wenn man erkannt hat, dass Mode und Accessoires nichts Profanes sind, kann das Spiel beginnen. Eine teure Tasche oder der enge Glockenrock sind ein Vehikel, in das man einsteigen kann, um etwas zu erleben. Und manchmal werden sie zu den Insignien einer Befreiung. Oder sie sehen einfach nur doof aus. Wenn man denkt, man will jetzt mal was ganz Ausgefallenes tragen ... ... und es steht einem gar nicht. Das ist mir auch schon passiert. Ich war mal mit meinem Mann Frank in einem Schloss zu einer Silvesterparty eingeladen, das Motto: schottischer Style. Frank – er ist immer sehr geschmackvoll und stilsicher – hat gesagt: Sei mir nicht bös, Guido, es ist mir völlig egal, was die da vorhaben, ich komme im klassischen Smoking. Ich habe gesagt: Nein, Frank! Ich kaufe was von Vivien Westwood. Und habe mir für sehr viel Geld ein kariertes
Sakko in London gekauft. Ich sah aus wie ein Clown! Als Einziger auf der ganzen Veranstaltung. Ich habe dann auf schwulen Designer gemacht, damit alle denken, okay, der kann das machen. Und später habe ich alle Fotos, die es von dem Abend gab, zerstört. Aber dann hat Frank das Sakko einmal angezogen und sah einfach top aus! Es ist, wie es ist. Ich würde auch wahnsinnig gern ganz kurze T-Shirts tragen, die an der Gürtelkante aufhören. Und dann jeder Oma in der Bahn den Koffer in die Gepäckablage heben, sodass das T-Shirt leicht hochgeht und man den durchtrainierten Bauch sieht. Das ist mein Traum. Aber ich mach es nicht. (lacht)
Finden Sie denn, man sollte seine nicht so vorteilhaften Stellen kaschieren?
Ich bin für eine Gesellschaft, in der man erst mal unterwegs sein kann, auch mit radikalerem Textil, auch im Alter. So, wie man sich gut fühlt. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der mir irgendwann nur noch alle auf die Schuhe gucken, weil ich den Rest von mir verstecke. Mein Tipp ist es, in Bewegung zu bleiben, wenn es geht. Anmut mag ich gern. Wenn man immer schön mit dem Hintern gewackelt hat, sollte man das weitermachen. Ich finde es schön, wenn man weiß, wer man ist, und der oder die bleibt. Dann altert man gut. Was macht ein gutes Accessoire aus? Es fängt in dem Moment an, gut zu sein, in dem es etwas für dich tut. Sobald es dir hilft, eine andere Welt zu erobern. Wenn du eine langweilige Maus bist, die endlich mal gesehen werden will, dann darfst du nicht in einem grauen Kittel unterwegs sein. Dann musst du einmal Gas geben. Und wenn du nicht gesehen werden willst, funktioniert das textil auch ganz gut. Dieses System verstanden zu haben, ist Freiheit. Alles andere an der Mode ist Firlefanz. Was meinen Sie mit Firlefanz? Was Kleidung oder ein Accessoire mit uns macht, hat sehr viel mehr mit Gefühlen und Erinnerungen zu tun als mit Geld. Das ist wie beim Essen. Es gibt Leute, die rühren sich einen Pudding aus der Tüte an und sagen, mein Gott, ist das lecker! Mir hat mal ein Sportler erzählt, dass es für ihn das Größte ist, allein zu Hause Makkaroni zu essen, mit Paniermehl darauf und einem Schuss Maggi. Ich dachte: So ist Leben. Er erinnert sich daran, wie seine Mama das für
»Ein Accessoire fängt in dem Moment an, gut zu sein, in dem es etwas für dich tut. Sobald es dir hilft, eine andere Welt zu erobern. Das verstanden zu haben, ist Freiheit«
ihn gemacht hat, und dann kommt da kein Essen aus dem Sternerestaurant heran. Alles ist das, was es mit uns macht. Und wenn es nichts mit dir macht, bringt auch der teuerste Firlefanz nichts.
Was heißt das für teure Designermode?
Die tut auch für manche etwas. Aber nicht für jeden. Ich saß mal neben einer Domina im Flieger nach Brüssel. Die war ganz oben angekommen und flog gerade zu einem hochrangigen Kunden. Sie meinte zu mir: Guido, ich will dir mal eins sagen, wenn wir beiden morgen in die Sahelzone fahren, und du sagst denen, hallo Freunde, ich habe hier ein Couture-Kleid dabei, dann sagen die: Wie bitte? Ich will was Warmes, womit ich heute Abend durch die Wüste komme!
Und wenn ich als Domina sage, ich habe hier eine Peitsche dabei, wir machen gleich Elektroschocks, dann sagen sie: Schönen
Dank, das brauchen wir nicht! Das fand ich sehr amüsant. Sie sagte, was wir beide anbieten, braucht eigentlich keiner. Es ist die Endstufe einer Möglichkeit. Die meisten Menschen wollen nur etwas anhaben und dass sie einer berührt.
Wenn man »nur« 100 Euro für ein ganzes Outfit hat, was empfehlen Sie?
100 Euro würde ich immer in etwas investieren, was länger bleibt als einen Tag. Ich habe mal eine Frau an einer Bushaltestelle gesehen, die eigentlich ganz hübsch war, aber die Frisur ging gar nicht. Ich habe sie angesprochen und gesagt: Wir müssen jetzt beide sehr stabil sein, aber du musst das mit dem Pony ändern! Sie hat gelacht und gesagt, sie wisse das, habe aber kein Geld. Ich habe ihr 100 Euro gegeben und sie zu einem befreundeten Friseur geschickt. Ich würde also immer gucken: Wo sind meine schwächsten Stellen? Vielleicht die Frisur? Oder mal die Nägel machen? Es gibt viele Baustellen.
Und wenn die größten Baustellen überwunden sind?
Im zweiten Schritt würde ich sagen, wenn man Busen hat: Paragraf 1, guter BH. Für mein Dafürhalten müssten BH-Busse durch Deutschland fahren, so wie früher die Bücherbusse oder das Rote Kreuz. Sie müssten auf den Plätzen anhalten, mit Fachkräften, die messen können. Sodass alle einmal ihre richtige Größe erfahren. Wenn der BH nicht einschnürt und gut sitzt, hilft das extrem.

Bei einem Umzug wurde Guido Maria Kretschmer alle Kunst gestohlen. Nach dem Schmerz kam die Erkenntnis: »Ich bin nur ein durchlaufender Posten.« Es löste sich etwas

Guido Maria Kretschmer wurde in Münster geboren, als eines von fünf Kindern. Der Modedesigner ist durch die Kultsendung »Shopping Queen«, die er seit 2012 moderiert, einem Millionenpublikum bekannt. Kretschmer hat unter anderem die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Außerdem hat er mehrere Bücher geschrieben, die Bestseller wurden. Er lebt mit seinem Mann Frank Mutters und drei gemeinsamen Hunden in Hamburg-Blankenese.
Wie kauft man die richtige Kleidung für wenig Geld?
Im Secondhandladen. Schauen, was es für 80 Euro gibt. Vielleicht ein Kleid, einen Gürtel. Es kann auch ein guter Schuh sein, eine gute Sonnenbrille. Etwas, was man multifunktional einsetzen kann.
Welches Accessoire würden Sie empfehlen, wenn man in einer Krise steckt?
Ich glaube, die Krise ist die einzige Zeit, in der manche Menschen mal lockerlassen und ein bisschen die Form verlieren. Man merkt, dass auf einmal Dinge, die einem Sicherheit und auch Komplexität geschenkt haben, zur Disposition stehen und wie viel sich plötzlich ändern kann, auch an den eigenen Sichtweisen. So ein Moment, würde ich sagen, ist nicht die Zeit für eine Neuanschaffung. Da sollte man die Wahrnehmung lieber auf das Wesentliche richten. Vielleicht einfach seine Lieblingssachen tragen. Qualitäten, Erinnerungen, die einem etwas bedeuten, die umarmen. Das hilft mehr, als in den nächsten Laden zu gehen und zu glauben, dass irgendein Designer einen retten kann.
Der Master of »Shopping Queen« plädiert eher fürs Weglassen als fürs Anschaffen?
Ja, einfach mal weglassen! Das trauen sich viele nicht. Mir hat mal eine ältere Dame erzählt, dass sie, als ihr Mann gegangen war, an einem Tag im Park einfach ihren BH aufgemacht hat. Und am nächsten Tag hat sie ihn ganz weggelassen. Was das für eine Befreiung war! Die eigene Wahrnehmung ist ja die größte Freiheit, die es gibt. Man denkt, bei Mode geht es um die anderen. Aber das ist Quatsch.
Machen Sie denn solche Experimente?
Ja, ich mache das.
Gehen innere und äußere Veränderungen immer zusammen?
Meine Erfahrung ist: Wenn jemand die Entscheidung zu einer Veränderung im Leben getroffen hat, verändert sich auch der Look. Ich würde sogar sagen, eine echte Veränderung im Look kann nur passieren, wenn das Innere mitgeht. Du kannst nach Mallorca ziehen, aber wenn du ein Langweiler bist, dann bleibst du das auch in der Sonne mit vier Gläsern Wein. Du bist dein eigenes schweres Gepäck.
Was tun Sie in einer Krise?
Ich nehme Abstand. Keine Käufe. Keine Geschichten von anderen. Ich lese dann
auch nicht, obwohl ich das sonst viel tue. Ich finde es schwierig, mich mit den Problemen der anderen zu beschäftigen, wenn es mir selbst nicht gut geht. Ich will dann eher bei mir sein.
Was hilft Ihnen dabei, bei sich zu sein?
Kunst funktioniert für mich sehr gut. Das habe ich über den Maler Heinrich Vogler gelernt. Ich liebe seine wunderschönen Momente, das Vorsichtige und Zärtliche. Aber ich mag auch Expressionisten und Klassische Moderne, und zurzeit stehe ich sehr auf diese wilden, radikalen Frauen: Sarah Lucas. Miriam Cahn, Marlene Dumas. Pipilotti Rist. Auch Katharina Grosses riesige, ungebändigte Farbwelten. Mir hilft die Begeisterung für das Talent der anderen. Kaufen Sie Kunst?
Kunst ist das Einzige, was ich sogar in einer Krise kaufen könnte. Für mein allererstes Bild habe ich als Student mein ganzes Geld ausgegeben. 4.000 Mark, das war wirklich viel für mich, aber ich habe es geliebt: Adam und Eva sitzen in der Savanne in einem Erdloch. Wunderschön! Von einem ganz tollen spanischen Künstler. Was raten Sie, wenn man kein Geld für Kunst hat?
Viele gehen dann los und kaufen sich bei Ikea irgendein Plakat von Frida Kahlo oder das mit Audrey Hepburn in Schwarz-Weiß, mit der Zigarettenspitze, aus Frühstück bei Tiffany. Oder ein Wand-Tattoo: »Carpe diem« oder »Lebe deinen Traum, träume nicht dein Leben«. Ich würde sagen: Ein Bild ist erst mal ein Bild, egal von wem, und wenn es einen inspiriert, wunderbar! Aber ich empfehle immer: Geht in die junge Akademie, oder schaut im Internet. Es gibt so viele junge Künstler, die auch für 50 Euro, manchmal für 100 Euro ein Bild weggeben. Vielleicht entwickelt man dann ein stärkeres Gefühl dafür.
Was bedeuten Ihnen Ihre Bilder?
Ich dachte früher immer, meine Bilder seien mein Leben. Aber ich habe einmal alle verloren. Sie wurden mir bei einem Umzug gestohlen. Die Bilder wurden einfach aus den Rahmen herausgeschnitten! Das war eine sehr schlimme Erfahrung und hat mich sehr verletzt.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich hatte damals zwei Optionen: Ich hätte sagen können, okay, es ist vorbei, ich möchte gar keine Kunst mehr haben. Oder aber,
»Für mich ist es viel leichter, mit Liebe und Fürsorge in diese Welt zu schauen, weil ich das selbst erlebt habe. Ich war immer gehalten in Vertrauen«
ich sammle weiter! Ich habe mich entschieden, der Kunst treu zu bleiben und den Menschen auch.
Haben Sie versucht, die Bilder zu finden? Nein, jedenfalls nicht lange. Ich habe gedacht: Let it go! Und dadurch hat sich etwas Grundlegendes verändert, irgendwie wurde etwas gelöst. Ich habe gemerkt: Ich bin nur ein durchlaufender Posten. Eine ziemlich große Erkenntnis. Es war eine ganz kleine Vorbereitung auf das, was mich später ereilen sollte, als meine Eltern starben. Da habe ich dann richtig gelernt, wie das mit der Endlichkeit geht. Und dass ich nichts halten kann außer das, was in mir schlägt. Es gibt dieses Gedicht von Heinz Schenk: »Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück, musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück.« Und so ist es.
Man kann sich bei Ihnen kaum vorstellen, dass Sie etwas aus der Fassung bringt. Wie sind Sie, wenn Sie gekränkt sind?
Ich lasse den Menschen viel durchgehen. Aber ich vergesse nicht, was mir gesagt wurde. Auch die Ungerechtigkeiten vergesse ich nicht. Wenn mich wirklich jemand enttäuscht hat, dann bin ich unwiderruflich weg. Da fällt dann etwas so tief, dass ich es aufschlagen höre und nicht zurückholen kann. Ich wünsche mir manchmal, dass ich in der Lage wäre, Verlorengegangenes zurückzuholen, zu reanimieren, auch manche Freundschaften. Aber ich bin sehr verletzlich und kann mich an jedes Wort erinnern. Es braucht lange, bis ich solche Situationen verarbeite. Irgendwann allerdings macht es Klick, und dann ist es wie nicht da gewesen. Ich habe da wohl einen inneren Reinigungsprozess. Dann frage ich mich, wie ich so gelitten haben und dann doch wieder so leicht sein kann.
Haben Sie eine Erklärung?
Ich bin in einer Welt groß geworden, in der ich nicht die Nummer eins war. Wir waren fünf Geschwister. Mein Vater hat mir auf dem Sterbebett erzählt, ich hätte als Kind immer gefragt: Papa, sag mal ganz ehrlich, ich bin doch am allerbesten geglückt von all deinen Kindern? Und er hat immer geantwortet: Guido, selbst wenn es so wäre, das fragt man nicht als Kind, und das sagen auch Eltern nicht. Da war immer eine große
Unsicherheit in mir, auch wenn ich schon früh um meine Möglichkeiten wusste. Ich denke, deshalb brauche ich so lange, bis ich verbalisiere, dass mich etwas stört. Was wäre etwas, das Sie nicht verzeihen? Ich habe einen älteren Bruder, bei dem hatte ich immer das Gefühl, ich mache etwas falsch, aber weiß nicht, was. Für ihn war es vielleicht nicht leicht, einen jüngeren Bruder zu haben, der an ihm vorbeigaloppiert, den der liebe Gott mit mehr Leichtigkeit ausgestattet hat, mit mehr Freude, mehr Mut. Auch wenn ich meine anderen Geschwister fragen würde, würden sie sicher sagen, o Gott, der Guido hat genervt. Der brauchte immer sein Teelicht auf dem Tisch, für den musste man immer noch eine Serviette hinlegen, der musste immer hinten sitzen, damit er winken konnte. Die haben mir Sachen erzählt, bei denen ich dachte, dass es nicht immer schön war mit mir. Aber sie haben mir das mehr verziehen als der Älteste. Solange meine Eltern lebten, habe ich versucht, ihn zu mögen und alles, was passiert, zu akzeptieren. Aber schon bei der Beerdigung meiner Eltern, sie sind ganz kurz nacheinander gestorben, habe ich gespürt: Die Geschichte ist erzählt. Blut ist nicht dicker als Wasser, und es gibt andere Menschen, die mir viel mehr Freude machen und mich mehr wertschätzen.
Was haben Sie getan?
Ich stand da und dachte: Mama, Papa, ich habe alles versucht. Aber ich kann nicht mehr. Ab jetzt gehe ich den Weg allein weiter. Ich glaube, wir haben damals beide verstanden, dass die Zeit vorbei war. Ich wünsche ihm das schönste Leben und dass er alt und glücklich wird. Aber ich bin der Falsche für ihn. Das weiß ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Diese Trennung war das Intensivste, was ich erlebt habe, mit einer lebenden Person.
Was hilft gegen Neid?
Dieses Gefühl sollte man nicht kultivieren. Ich würde es bei Kindern schon unterbinden. Es ist eine sinnlose Straße, die niemals irgendwo ankommt. Je früher man erkennt, wie schön es ist, begeistert über das Glück der anderen und deren Möglichkeiten zu sein, umso besser. Eine andere Maßnahme gegen Neid ist Großzügigkeit mit allem: mit Zeit, Ehrlichkeit, Transparenz, Liebe. Je großzügiger man ist, desto mehr ist man in einem System von Geben und Nehmen.
»Man kann die Leute nur zurückgewinnen, indem man ihnen irgendwie wieder das Licht anmacht. Wir brauchen mehr
LeuchtfeuerMenschen«
Was mögen Sie gar nicht an Menschen?
Mir ist nichts Menschliches fremd. Aber auf Neid, Missgunst und Aggressivität stehe ich nicht. Auf Dummheit, die laut ist, auch nicht. Es ist außerdem unpraktisch, denke ich immer, weil es dann ja alle merken. Und schön macht es auch nicht. Wie begegnen Sie solchen Menschen? Ich mag Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Selbst die manchmal Bekloppten will ich nicht verloren wissen. Natürlich gibt es Gottes dritte Garnitur, da bin ich mir ganz sicher. Auch der liebe Gott hat mal einen schlechten Tag gehabt. Aber auch diese Leute haben irgendwo irgendeine Öffnung, sodass man spürt, da ist Raum für mehr. Ich würde es mit Adenauer halten, der sagte, du musst die Menschen nehmen, wie sie sind, denn es gibt gerade keine anderen. Wir müssen wieder lernen, ein bisschen zu verzeihen, großzügig zu sein und zweite Chancen zu geben. Wir sollten uns gegenseitig mehr mit Freude und mit einem Schmunzeln betrachten. Ich möchte die Menschen nicht aufgeben. Ich haue sie zu mit Freundlichkeit.
Woher nehmen Sie diese Menschenliebe? Ich hatte alles. Das Leben war so fair mit mir, hat mich in Liebe groß werden lassen. Mit einem Papa, der mir auf die Banane schrieb: »Mein lieber Junge, heute toi toi toi bei der Mathearbeit.« Meine Mutter hat erzählt, das erste Wort, das ich in meinem kleinen Kinderbett gesagt habe, als alle drum herum standen und reinschauten, war nicht »Mama« oder »Papa«, sondern hell und deutlich: »Hallo«. Da soll mein Vater gesagt haben: Um den Guido machen wir uns keine Sorgen! Für mich ist es viel leichter, mit Liebe und Fürsorge in diese Welt zu schauen, weil ich es selbst erlebt habe. Und dann hatte ich das Glück, dass ich als sehr geliebtes Kind von meinen Eltern direkt übergeben wurde in eine funktionierende Partnerschaft, die jetzt schon 40 Jahre läuft. Was ich auch manchmal gar nicht glauben kann. Ich konnte mich immer schön entwickeln, ich hatte nie Stress in Beziehungsgeschichten. Ich war immer gehalten in Vertrauen. Da sehe ich einen großen Unterschied. Zu anderen Menschen?
Ich will gar nicht sagen, dass es nicht ganz viele tolle Menschen gibt, aber ich sehe auch viele Defizite – durch das Nichtvor-
handensein von Liebe, würde ich ganz platt sagen. Das wird massiver. Ich saß vor Kurzem in Berlin im Auto, Frühlingsanfang, lange Ampelphase. Da war ein Mädchen neben mir auf dem Fahrrad, vielleicht 15, das hatte sich auf den Sommer vorbereitet: noch etwas blass, kurzer Rock, etwas moppelig. Sie lächelte so in die Sonne, und ich dachte: Ach, guck mal, wie schön, du bist jung und fühlst dich gut! Und dieser Gedanke war noch nicht zu Ende gedacht, da kam ein Auto mit fünf Jungs, offenes Dach, die riefen »Hey!«. Und dann beleidigten die sie. Ihren Körper, ihre Kleidung. Auf einmal brach alles zusammen in dem Mädchen, es bog ab und war weg. Mir kamen fast die Tränen, ich dachte, ich muss ihr nachfahren und sagen: Glaub denen nicht! Behalte das Gefühl, dass du ein hübsches Mädchen bist, das gerade erlebt, eine Frau zu werden! Hör nicht auf sie!
Dass Menschen anderen so etwas antun, zeigt für mich einen Verfall von Anstand im klassischen Sinne. Niemand von denen hätte das allein getan. Ein großes Problem ist sicher auch, dass es immer mehr Räume von großer Anonymität gibt, in denen man einfach Gas gibt und wegfährt, und dann ist man raus aus der Situation.
Wie blicken Sie denn zurzeit auf unsere Gesellschaft?
Ich hätte niemals gedacht, dass sie sich so entwickelt. Dass Menschen wieder glauben, Nationalität reiche aus, um Identität zu erleben. Ich bin in einer etwas intellektuellen, freien, etwas linken Blase zu Hause. Es erschüttert mich, wie intolerant wir werden, auch junge Menschen. Und wie schrecklich ungebildet manche sind. Etwa 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben bei einer Umfrage angegeben, dass sie nicht wussten, dass die Nationalsozialisten sechs Millionen Juden ermordet haben. Wo, frage ich mich, sind wir falsch abgebogen?
Was schlagen Sie vor?
Man muss aufpassen, dass man nicht glaubt, dass alle so sind. Oder der ganze Osten. Es gibt Leute, die wirklich auf der völlig falschen Reise sind. Aber da sind auch die anderen. Die sehr gescheiten, vorsichtigen, warmen Menschen, die etwas tun für dieses Land. Die weiterkämpfen, trotz der Brutalität und Anfeindungen, die sie erleben. Zum Beispiel habe ich den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael
Kretschmer, als einen solchen feinen Mann kennengelernt. Das sind für mich Leuchtfeuer-Menschen. Sie geben niemanden auf. Man kann die Leute nur zurückgewinnen, indem man ihnen irgendwie wieder das Licht anmacht. Wir brauchen mehr Menschen, die zeigen: Hier ist ein Weg. Hin zu einer gemeinschaftlichen Gesellschaft. Statt zu sagen, ihr seid alle doof! Was ist Ihr Leuchtfeuer?
Ich mache das jeden Tag, egal ob in Chemnitz oder in Hamburg oder Dresden. Ich erzähle den Kandidatinnen meiner Sendungen immer von der Freiheit. Von der Freude an Kunst, Diversität und Toleranz. Ich will, dass sie alle mit aufpassen! Dass uns das nicht verloren geht. Wir sind doch eine Demokratie. Die lebt vom Gegensatz und von Diskurs. Wenn wir das in Deutschland verlieren, sind wir verloren. Wir Deutschen können sehr gute Faschisten sein. Das haben wir gezeigt. Wir müssen jetzt alle ein bisschen zusammenhalten und aufpassen und nicht aufgeben.
Könnten Sie sich vorstellen, selbst in die Politik zu gehen?
Ich komme gerade von einem Empfang aus dem Rathaus und muss sagen, das ist schon ein schöner Platz, wenn man irgendwo ist und mitgestalten kann. Mein Vater hat früher mit Jürgen Möllemann im Gesangsverein gesungen. Und der hat immer gesagt, ach, der Guido, der ist doch geeignet für die Politik! Und mir dann so einen FDPSticker auf die Schulter geklebt. Welche wäre Ihre Partei?
Ich wäre ein guter, freier Politiker ohne Parteibuch. Ich bin im Grunde meines Herzens ein liberal-grüner Mensch. Aber ich habe auch große Sympathien für die Sozialdemokratie, weil ich fest daran glaube, dass man mit Ressourcen aufpassen und Menschen gut bezahlen und behandeln muss. Ich bin konservativ genug, um zu wissen, dass wir das Gestern schätzen sollten. Und ich habe auch linke Momente, zum Beispiel bin ich großer Gregor-Gysi-Fan. Man kann ja ohne Partei Politik machen.
8.000 € Förderungf ür deineKarriere.
Amazon bietet Mitarbeitern biszu8.000 € fürdie Aus- undWeiterbildung an.
Ich habe mir manchmal gedacht, ich könnte das irgendwie. Mein Papa sagte immer, der Guido geht in die Politik, oder er gründet mal eine Sekte. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich mir vorstellen, mich in einer Kommune oder Stadt zu engagieren.
Bürgermeister?
Ich wurde mal gefragt, ob ich Bürgermeister von Sylt werden wolle. Aber das habe ich dankend abgelehnt. Vor vielen Jahren, als der damalige Bundespräsident Christian Wulff zurücktrat und ein neuer gesucht wurde, schrieb eine Zeitung, Guido Maria Kretschmer soll es machen! Ich bin abends nach Hause gekommen, Frank stand in der Küche, und ich hab gesagt: Frank, hast du schon gehört, ich soll Bundespräsident werden. Da sagte der nur zu mir: Ach! Können wir denn da die Hunde mitnehmen?
Katrin Zeug und Andreas Lebert hätten noch stundenlang mit Guido Maria Kretschmer weiterreden können. Und haben dabei ganz vergessen, darauf zu achten, was er anhat.



Jeder Mensch erzählt sich eine Geschichte von sich selbst, die er für sein Leben hält. Dieser Erzählung können wir neu begegnen – und daraus Trost und Mut schöpfen

Wer war dieser Mann, der am 7. April 2005 über einen Strand der englischen Grafschaft Kent irrte? Er trug einen durchnässten Anzug, wirkte verstört und sprach kein Wort. Niemand kannte ihn. Er hatte keine Papiere bei sich. Die Polizei brachte ihn ins Krankenhaus. Dort blieb er stumm, doch das Pflegepersonal berichtete, dass er manchmal stundenlang Klavier spielte. Die Polizei rief bei Orchestern in ganz Europa an und erkundigte
sich, ob ihnen ein Pianist abhandengekommen sei. Die Presse taufte den rätselhaften Unbekannten »Piano Man«. Eine Dänin, die ihn im Fernsehen gesehen hatte, erkannte ihn als ihren algerischen Ehemann. Andere als einen Bekannten aus Italien. Oder aus Irland. Oder aus Tschechien. Die Geschichte eines hochbegabten Klaviervirtuosen, der genug vom schlechten Zustand seiner Kunst hatte, machte die Runde. Nach 140 Tagen brach der Mann sein Schweigen. Er hieß Andreas G., war 20
Jahre alt, ein Bauernsohn aus dem Städtchen Waldmünchen im Bayerischen Wald, und er wollte den Hof seiner Eltern partout nicht übernehmen. Nachdem er seine Geschichte erzählt hatte, kam er in seine Heimat zurück – in ebendiese Geschichte, der er entfliehen wollte.
Wer sind Sie? Die Antwort ist oft eine Geschichte. »Dort bin ich aufgewachsen, dies wollte ich immer werden – aber dann habe ich das studiert.« Wer die Biografie eines Menschen kennt, der kennt ihn, ist die
Das Gedächtnis funktioniert nicht wie der Speicher eines Computers. Erinnerungen entstehen immer wieder neu
stille Annahme dahinter. Für die Idee, dass nicht die Seele oder der Körper einen Menschen ausmacht, sondern seine autobiografische Geschichte, haben Philosophen einen ihrer sperrigen Ausdrücke: »narrative Identität«. Der einflussreichste Vertreter der Theorie der narrativen Identität war in den 1980er-Jahren der französische Philosoph Paul Ricœur. Er war überzeugt, dass Menschen in den Geschichten, die sie über sich erzählen oder die andere über sie erzählen, zu sich selbst finden, und dass ihre Identität aus der Deutung dieser Geschichten entsteht. Sein schottisch-amerikanischer Kollege Alasdair MacIntyre schrieb den berühmt gewordenen Satz: »Der Mensch ist in seinen Handlungen und in seiner Praxis ebenso wie in seinen Fiktionen im Wesentlichen ein Geschichten erzählendes Tier.«
Wenn diese Philosophen recht haben, dann stimmt zwar die Intuition, dass die Biografie einen Menschen ausmacht – doch diese Intuition hat auch eine schwierige Seite. Denn Geschichten sind veränderlich, man kann sie so oder ganz anders erzählen, und nicht immer ist eindeutig, was an ihnen wahr und was falsch ist. Der »offizielle« Lebenslauf eines Menschen, der vielleicht auf LinkedIn steht, ist selten eine wahrheitsgetreue Wiedergabe des Werdegangs dieser Person. Das soll er auch gar nicht sein. Er soll eine Fassade aufbauen.
Pathologische Fälle sind Hochstapler, die Geschichten über sich erzählen, um andere Menschen in die Irre führen. Sich neu erfinden, indem man seine Geschichte umschreibt: So einfach ist es offenbar nicht. Nicht nur der Piano Man Andreas G., sondern viele Menschen sehnen sich manchmal danach, ihrer Geschichte zu entfliehen. Die Vergangenheit kann bedrücken. »Hätte ich damals nur ...« – »Was wäre heute, wenn das nicht passiert wäre?« Es gibt wohl kaum einen Menschen, der solche Gedanken noch nicht hatte. Für das echte Leben gibt es leider kein Strg-Z.
Wie lässt sich gut mit der eigenen Geschichte umgehen? Wie kriegt man es hin, dass die Vergangenheit nicht lähmt, sondern ermutigt? Mit diesen Fragen hat sich der französische Philosoph Charles Pépin in
seinem Buch Mit der eigenen Vergangenheit leben beschäftigt, und zwar weitaus lebensnäher als seine Berufskollegen. Er kommt zu einem ermutigenden Resümee: Wir können zu wesentlichen Teilen selbst bestimmen, wie die eigene Vergangenheit unser Tun, Denken und Fühlen prägt, welche Erlebnisse wir fortsetzen wollen und welche wir lieber hinter uns lassen.
Dafür ist zunächst zu klären, wie die Vergangenheit überhaupt in uns wirkt: in Gestalt von Erinnerungen. Über die Eigenarten des Gedächtnisses können Philosophen und Schriftsteller mitunter mehr sagen als Neurowissenschaftler. Pépin zieht vor allem den Philosophen Henri Bergson und den Schriftsteller Marcel Proust zurate. Prousts großer Roman A la recherche du temps perdu (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) erzählt davon, wie ein in Tee getränktes Stück Gebäck die Erinnerung der Hauptfigur unwillkürlich auf eine Reise in die Kindheit schickt. Proust hatte es selbst erlebt. Bei ihm waren es vor allem schöne, glückliche Kindheitserinnerungen. Doch das ist nicht immer so.
Es wäre schön, belastende oder beschämende Erinnerungen einfach umschreiben zu können. Aber so einfach ist es nicht. Das Gedächtnis ist kompliziert. Henri Bergson unterschied zwischen dem »Gewohnheitsgedächtnis«, das uns beispielsweise wie von selbst dabei hilft, Fahrrad zu fahren, wenn wir es einmal gelernt haben, und dem »reinen Gedächtnis«, das einzelne Begebenheiten aus der Vergangenheit wieder wachruft – zum Beispiel den Tag, an dem wir Fahrradfahren gelernt haben. Die Neurowissenschaft von heute bestätigt Bergson in dieser Unterscheidung und kennt weitere Gedächtnisformen: das semantische Gedächtnis, das die Bedeutungen von Wörtern und Dingen erinnert; das Arbeitsgedächtnis, das sich kurz mal eine Telefonnummer merkt; das sensorische Gedächtnis, das behält, wie etwas riecht oder sich anfühlt.
Im Gegensatz zu früheren Philosophen wie René Descartes betonte Bergson, dass das Gedächtnis etwas Lebendiges ist. Es ruft nicht einfach gespeicherte Informationen ab. Es macht die Vergangenheit wieder er-
lebbar. Auch darin bestätigt ihn die heutige Wissenschaft: Die Zeiten, in denen Neurowissenschaftler das Gedächtnis wie einen Computerchip verstanden haben, aus dem einmal eingeschriebene Daten immer wieder haargenau gleich ausgelesen werden, sind vorbei. Nein, das Gedächtnis funktioniert anders. Erinnerungen entstehen immer wieder neu. Sie werden »gleichsam neu konfiguriert«, schreibt Charles Pépin: »Das Gedächtnis ist lebendig, und eine Erinnerung ist nie zweimal dieselbe.«
Auch wenn es uns manchmal eher kümmerlich vorkommt: Das Gedächtnis ist riesig. Fast alles Erlebte hinterlässt Spuren darin. Nur kommt es nicht immer so leicht wieder hervor. Schon Bergson erkannte, das uns normalerweise nur Erinnerungen zugänglich sind, die für die Gegenwart von Bedeutung sind – immer nur ein winziger Teil des Gedächtnisschatzes. »Aus dem riesigen Ozean unserer Erinnerungen strömen spontan nur diejenigen ins Bewusstsein, die wir brauchen«, schreibt Pépin.
Das mag so klingen, als wären wir unseren Erinnerungen hilflos ausgeliefert, als müssten wir stets darauf gefasst sein, dass die Vergangenheit wieder »auftaucht, wann sie will« (Pépin), um in die Gegenwart einzufallen und uns zu »beißen«. Aber Pépin zieht einen anderen, positiveren Schluss: Wir haben immer wieder die Chance, der Vergangenheit neu zu begegnen, Trost und Kraft aus ihr zu ziehen. »Wir haben keinen Grund, uns von unserer Vergangenheit alles gefallen zu lassen.«
Pépin erzählt von Menschen, deren Biografien trotz einer schlimmen Kindheit oder Lagerhaft glückliche Wege genommen haben. Das sind Fälle, in denen ein guter Umgang mit der Vergangenheit besonders wichtig ist. Da ist zum Beispiel der spanische Schriftsteller Jorge Semprún, der in seinem Roman Le grand voyage (Die große Reise) seine schrecklichen Erlebnisse im KZ Buchenwald verarbeitet hat. Da ist der französische Soziologe und Philosoph Didier Eribon, der in seinem autobiografischen Buch Retour à Reims (Rückkehr nach Reims) ergründet, wie seine Identität mit seiner Herkunft aus einer kleinstädtischen

Die Serie in ZEIT WISSEN
1. TEIL DAS SCHLIMMSTE AN DER KRISE IST DIE ANGST VOR IHR (Ausgabe 3/2025, nachbestellbar unter zeit.de/zw-archiv)
2. TEIL ERINNERUNG KANN ZUR KRAFTQUELLE WERDEN (in dieser Ausgabe)
3. TEIL EINE RÜCKBLENDE: WORAN DAS BÖSE SCHEITERT (erscheint am 29. August)
Hannah Arendt hielt der Sterblichkeit des Menschen die »Gebürtlichkeit« entgegen. Wir sind Aufbruchswesen

Arbeiterfamilie, in der rechtsextreme Ansichten vorherrschten, zusammenhängt.
Was alle Menschen jeden Tag tun können, ist, beim Zurückblicken das Augenmerk auf die kleinen Geschenke des Lebens zu legen: auf die freundlichen Begegnungen, die glücklichen Zufälle. Das bedeutet für Menschen, die einem verstorbenen anderen Menschen oder einer zerbrochenen Beziehung nachtrauern, nicht nur den Verlust zu sehen, sondern auch das Glück von damals wieder wachzurufen –
wie der Protagonist in Marcel Prousts Roman seine Kindheit wieder aufleben lässt. Es geht nicht darum, die Vergangenheit schönzufärben. »Es ist eine Art Würdigung dessen, was gewesen ist«, schreibt Pépin. Wenn also die Erinnerung der Weg ist, mit dem das Gehirn den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft schlägt, und wenn wir die Möglichkeit haben, die Erinnerung zum Guten oder zum Schlechten zu betonen, dann ist sie auch ein Weg, der Zukunft einen Dreh zum Besseren zu geben.
Der Vergangenheit zu entfliehen, das wird meistens schiefgehen – wenn auch selten so spektakulär wie im Fall des Piano Man Andreas G. Menschen sind schlechter im Vergessen, als es ihnen manchmal selbst erscheint. Erinnerungen lassen sich nicht löschen oder überschreiben wie Dateien auf einem Computer. Manchmal sind sie vorübergehend verdrängt oder übertönt von anderen Dingen, die ins Bewusstsein drängen. Doch ein Wort, ein Anblick, ein Moment der Ruhe oder, wie bei Marcel Proust, der
Geschmack eines Gebäcks genügt – und alles ist wieder da. All die vermeintlich vergessenen Erinnerungen »bestehen endlos fort«, schrieb Henri Bergson damals. Endlos, aber nicht unveränderlich.
Besser, als zu versuchen, der Vergangenheit auszuweichen, ist, das Gespräch mit ihr zu suchen. Aus einer aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte lassen sich Kraft und Mut für die Zukunft schöpfen, schreibt der Philosoph Pépin. Auch wenn die Erinnerungen schmerzen.
Der Schriftsteller Jorge Semprún kämpfte in den 1940er-Jahren im Widerstand gegen die deutsche Besatzung Spaniens. Er wurde 1943 von der Gestapo verhaftet und von Januar 1944 bis April 1945 im Lager Buchenwald inhaftiert. Nach seiner Befreiung versuchte er, seine Erfahrungen im Lager aufzuschreiben, »den Tod zu schildern, um ihn zum Schweigen zu bringen«. Doch sobald er sich in der Erinnerung zurück in die Hölle des Lagers versetzte, sobald die Gerüche, die Gesichter, die brutalen Szenen wieder hochkamen, überwältigte ihn erneut die Todesangst. Das Vorhaben scheiterte zunächst. »Hätte ich weitergemacht, hätte wahrscheinlich der Tod mich verstummen lassen«, schrieb er später. Daher versuchte er dann, zu vergessen, seine seelischen Wunden durch »die Kur des Schweigens unter der bewussten Amnesie« zu heilen. Das Manuskript verschwand in einer Schublade. Jorge Semprún brauchte Abstand vom Tod.
Erst viele Jahre später gelang es Semprún, seine Lagererfahrung in schriftliche Worte zu fassen. Er schrieb mehrere Bücher darüber, literarische und autobiografische. Er wurde zu einem Vordenker der Erinnerungskultur. Der spanische Ministerpräsident Felipe González berief ihn zum Kulturminister. Im Jahr 2003 hielt Semprún vor dem Deutschen Bundestag eine Rede zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Dank Menschen wie ihm ist es unwahrscheinlicher geworden, dass sich diese schlimme Geschichte wiederholt. Das macht seine Erlebnisse zwar nicht weniger schrecklich. Doch es hilft, etwas Sinnvolles aus ihnen zu ziehen.
Viele Menschen, die etwas Schreckliches erlebt haben, versuchen es zu vergessen. Oft graben sie es damit noch tiefer ins Gedächtnis. Psychologen nennen das den »Rebound-Effekt«: Unterdrückte Gedanken
oder Emotionen kehren mit erhöhter Intensität zurück, sobald man aufhört, sie aktiv zu unterdrücken.
Bekannt wurde der Rebound-Effekt durch die Forschung des amerikanischen Sozialpsychologen Daniel Wegner, der ihn in den 1980er-Jahren erstmals systematisch untersuchte. Wegner ließ sich von einem Satz aus dem Essay Winterliche Aufzeichnungen über sommerliche Eindrücke des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski zu einem Experiment inspirieren: »Nehmen Sie sich einmal vor, nicht an den weißen Bären zu denken, und Sie werden sehen, der Verflixte wird Ihnen immerfort einfallen«, hatte Dostojewski im Jahr 1863 geschrieben. Wegner setzte Versuchspersonen in einen
Der Psychologe wies Freiwillige an, fünf Minuten lang nicht an einen weißen Bären zu denken
leeren Raum und gab ihnen die Anweisung, fünf Minuten lang nicht an einen weißen Bären zu denken. Die meisten von ihnen konnten den Gedanken an einen weißen Bären nicht unterdrücken – sie dachten öfter an einen weißen Bären als eine Vergleichsgruppe, der Wegner keine Anweisung gegeben hatte. Der Versuch der Selbstkontrolle verstärkt den Gedanken noch: Das ist der Rebound-Effekt. Seither haben Psychologen diesen Effekt immer wieder nachgewiesen. Gerade die Unterdrückung schmerzlicher Erinnerungen kann den Schmerz noch verstärken.
»Im Grunde kann man nicht vergessen«, zitiert Charles Pépin eine PsychotherapiePatientin. Für sie war diese Einsicht eine Befreiung, der Ende eines Kampfes gegen die Erinnerung und der Beginn eines Friedensschlusses mit ihr.
Auch schwierige Geschichten können glücklich weitergehen. Das Leben ist eine Erzählung: das ist ein Kerngedanke der Philosophie von Hannah Arendt, der jüdischen deutsch-amerikanischen Philosophin und politischen Theoretikerin. Sie war eine frühe Verfechterin der Theorie der narrativen Identität. Ihr zufolge erzählen wir unsere
Lebensgeschichten nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Arendt unterschied zwischen der Vita activa und der Vita contemplativa: dem tätigen und dem betrachtenden Leben. Lebensgeschichten entstehen aus einem Wechselspiel von Handeln und Nachdenken, Erinnern und Vorausdenken. Wir erschaffen uns jeden Tag neu, indem wir die Geschichte, die uns ausmacht, ein Stück weitererzählen.
Ein weiterer wichtiger Begriff mit seltsamem Namen spielt eine Rolle im Denken Hannah Arendts: Natalität (von lateinisch natalis, »zur Geburt gehörend«). Damit stellte sie sich gegen die philosophische Tradition, die den Menschen vor allem als sterbliches Wesen betrachtete. Nein, widersprach Arendt, der Mensch ist vor allem ein gebürtliches Wesen. »Aufgrund des Geborenseins ist jeder Mensch ein Anfang«, schrieb sie, »Menschen können Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen.«
Hannah Arendt lebte selbst vor, was sie mit Natalität meinte: In den 1920er-Jahren, als junge Studentin in Marburg, hatte sie eine Liebesbeziehung mit dem 17 Jahre älteren, verheirateten Philosophen Martin Heidegger. Als in den 1930er-Jahren die Nazis an die Macht kamen, machte Heidegger mit ihnen gemeinsame Sache. Kurz nachdem Adolf Hitler deutscher Reichskanzler geworden war, trat Heidegger in die NSDAP ein. Als Rektor der Universität Freiburg unterstützte er die Gleichschaltungspolitik der Nazis.
Arendt musste als Jüdin vor der Verfolgung durch die Nazis fliehen. Sie musste mehrmals neu anfangen, in Paris, in den USA. Sie äußerte Kritik an der Philosophie ihres einstigen Geliebten Heidegger, aber nie Ablehnung oder Verbitterung. Sie versuchte nicht, die Vergangenheit zu vergessen oder sich von ihr zu befreien. Sie zog Kraft und Inspiration aus ihr. Während Heidegger in der Abgeschiedenheit seiner Hütte im Schwarzwald über das »Sein zum Tode« grübelte, entwickelte Arendt in der lebendigen Großstadt New York ihre Philosophie des Aufbruchs.
Die Geschichte, die Hannah Arendt mit ihrem Leben schrieb, erzählt von einem guten Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Auch auf schwierige Kapitel lässt sich ein Happy End schreiben.

Alle reden gerade über mich: Im fernen Kopenhagen etwas hochnäsig, höhnisch polternd im noch ferneren Oval Office. Schön, dass ich jetzt auch mal zu Wort komme. Und ehrlich gesagt: Das ganze Gerede kann mich nicht aus der Ruhe bringen. Dafür weiß ich einfach zu viel über euch Menschen. Alles, was ich in die Finger bekomme, fasziniert mich, alles scheint mir bemerkens- und zumindest doch bewahrenswert. Schneeflocke für Schneeflocke.
Wenn ich mir mein im Durchschnitt zwei Kilometer dickes Eis angucke, staune ich jedes Mal neu: Seht euch nur diese filigranen Muster eurer Hinterlassenschaften an! Was kann man nicht alles aus ihnen über eure Fortschritte und Fehltritte ablesen. Wie alle Sammler habe auch ich die schrullige Eigenart, das Zusammengetragene nicht allzu oft anzurühren. Sammlern genügt es zu wissen, dass alles da ist. Ihr Menschen seid nun die Ersten, denen ich mein Archiv zeige, und das scheint mir auch
Ich habe euch vom Rand der Welt aus lange zugesehen: Jeder Fortschritt, jeder Fehltritt ist mir im Gedächtnis geblieben, ich erinnere mich an Katastrophen und an Wunder. Wollt Ihr erfahren, was ich weiß?
Text Johanna Michaels
richtig so. Schließlich handelt es von euch. Doch ich beginne wohl besser am Anfang. Vor 230 Millionen Jahren, als wir Landmassen alle noch etwas beengt im Kontinent Pangaea zusammen feststeckten, saß ich ziemlich in der Mitte von uns allen, ungefähr auf der Höhe, auf der heute Europa liegt. Obwohl ich mich im Zentrum des Geschehens befand, ist mir diese Zeit kaum in Erinnerung geblieben. Vielleicht war ich einfach zu nah dran, um den Überblick zu haben und einen kühlen Kopf zu bewahren.
Wie erleichtert war ich daher, als ich mir mit den tektonischen Plattenbewegungen etwas Freiraum verschaffen konnte. Ich bin ja vom Typ her eher ein Außenseiter, und so zog es mich über die Jahrmillionen immer weiter an den Rand unseres schönen Planeten.
Und genau von dort, aus der Peripherie – dem Nordpol nah – beobachte ich in Ruhe, was auf der Welt passiert. Und noch viel entscheidender: Ich erinnere mich an alles. Denn seit einiger Zeit, ich schätze mal ungefähr seit 18 Millionen Jahren, kann ich mir den Luxus eines Gedächtnisses leisten. So, wie ihr eure grauen Zellen habt, habe ich meine weißen: Die kostbaren Eiskristalle sind mein Archiv, in dem ich alles, was eine Spur hinterlassen hat, aufbewahre.
Aber ich will ehrlich sein: Dieser Eisschild, also mein Archiv, war schon mal etwas stattlicher, aber er war auch schon sehr viel kleiner. Vor rund 400.000 Jahren, als das Klima dem heutigen ähnelte, war das Eis fast ganz verschwunden. Aber eben nur fast, und das reicht mir, um mich daran zu erinnern.
Seit einer Eiszeit, die vor ungefähr 130.000 Jahren endete, bedeckt das Eis wieder 80 Prozent meiner Landmasse und ist damit das zweitgrößte Gedächtnis dieses Planeten. Das Größte? Die Antarktis natürlich, also gewissermaßen mein Gegenpol. Aber wir wollen nicht abschweifen. Bleiben wir doch in der nördlichen Hemisphäre.
Mein Archiv, also all die Erinnerungen, wiegt nämlich so schwer, dass es mich in meiner Mitte unter den Meeresspiegel drückt. Das klingt jetzt vielleicht etwas belastend, aber auf diese Weise kann ich alles wie in einer tiefen Schale behutsam festhalten. Ganze Luftblasen sind darin eingeschlossen, aber auch Pollen und andere organische Partikel, Salz und Staub aus allen möglichen Mineralien und Metallen.
Natürlich kämpfe ich mit dem Schmelzen meines Archivs, aber in den letzten 120.000 Jahren können wir zurzeit noch bequem blättern. Ich sortiere nämlich alles chronologisch in Schichten, die man teils sogar mit bloßem Auge erkennen kann. Darin sieht man Jahr für Jahr, wie viel es geschneit hat und wie viel vom Schnee wieder geschmolzen ist.
Diese Schichten zeichnen ein hübsches Bild des wiederkehrenden Auf und Ab unseres Erdklimas. Aber auch andere spannende Ereignisse lassen sich datieren. Hier in dieser
Schicht befindet sich Asche, sie stammt vom Ausbruch des Supervulkans Toba vor ungefähr 72.000 Jahren. Und diese Platinschicht könnte das Überbleibsel eines Meteoriteneinschlags vor 12.900 Jahren sein, wenn ich mich recht erinnere.
Das klingt jetzt sehr aufregend, aber abgesehen von diesen Extremereignissen ist das Archivieren über Tausende von Jahren eine eher monotone Arbeit, und ich sah lange dabei zu, wie die Erde im sanften Schaukeln ihres Klimas vor sich hin träumte. Aus reiner Gewohnheit zeichnete ich alles auf. Doch dann bemerkte ich in meinen Schichten plötzlich rätselhafte Muster.
Seht ihr, wie sich seit knapp 3.000 Jahren immer mehr Blei in den Schichten ablagert? Ich konnte mir das erst nicht erklären: Wieso schwirrt plötzlich ein seltenes Metall in der Atmosphäre herum? Und wo kam plötzlich das ganze Methan her? Irgendetwas störte den gleichförmigen Takt des Planeten. Ich verfolgte gebannt, wie sich alles nach und nach in meiner Sammlung abzeichnete.
Ihr merkt es schon: Ich spreche natürlich von euch Menschen und eurer Angewohnheit, die Natur um euch herum anzupassen, statt euch der Natur anzupassen. Mittlerweile ist mein Archiv voll von euren Fußabdrücken, und ihnen nachzugehen, ist zu meiner Leidenschaft geworden.
Wenn wir dem Methan folgen, sehen wir zum Beispiel, wie ihr sesshaft werdet, die Landwirtschaft entdeckt, Nutztiere haltet und wie eure kleinen Gemeinschaften zu sogenannten Zivilisationen heranwachsen. Im Blei kann ich noch heute die Abgase der antiken Schmelzöfen riechen, die das Römische Reich mit immer mehr Silbergeld füttern, bis alles unter ihrer Last zusammenbricht. Die Bleispuren erzählen auch vom zaghaften Wachstum im Mittelalter, von der Pest und anderen Rückschlägen und schließlich von der Industriellen Revolution, die hier ziemlich viel Schmutz hinterlassen hat. Seit gut fünfzig Jahren, auch das ist archiviert, verwischen eure modernen Gesetze für saubere Luft die Bleispur wieder. Methan und Blei sind aber längst nicht die kuriosesten Funde in meiner Sammlung. Vor gut sechzig Jahren tauchten neben graubraunen Mineralien und Metallen plötzlich knallbunte Partikel in meinen Schichten auf. Solche langen Kohlenstoffketten hatte
ich bis dahin noch nicht gesehen – in all den Millionen von Jahren, die mein Gedächtnis nun schon zurückreicht. Ihr schafft es immer wieder, mich zu überraschen. Ich habe nun eine neue Kategorie namens Plastik in meinem Archiv, und wie besessen sammle ich jeden Makro-, Mikro- und Nanopartikel, den ich in die Finger kriege. Ungefähr zur
All die kleinen Fußspuren, die so herzzerreißend von eurem Jahrtausende währenden Stolpern erzählen, fließen unaufhaltsam ins Meer
gleichen Zeit wie das Plastik tauchte eine andere höchst interessante Spur auf. Seht ihr diese Ansammlungen von radioaktivem Jod? Sie zeigt, wie ihr in den Sechzigerjahren Atombomben testet, wie ihr in Tschernobyl mit der Kernkraft dramatisch scheitert und wie ihr trotzdem weiter daran festhaltet. Bis zur Fassungslosigkeit gespannt warte ich darauf, welche Katastrophen ich nach Fukushima noch mithilfe von Jod in mein Archiv einsortieren werde.
Doch bald schon werde ich mich nicht mehr daran erinnern können. Denn in eurem Wahnsinn, den ich über die Jahrtausende dokumentiert habe, habt ihr den Planeten aus dem Takt gebracht. Es herrscht heute ein Klima wie vor 400.000 Jahren, als ich mein Gedächtnis zuletzt fast vollständig verloren hatte, ich erwähnte es bereits. All die kleinen Fußspuren, die so herzzerreißend von eurem Stolpern erzählen, fließen unaufhaltsam ins Meer, und ich schaue wie immer staunend und diesmal auch etwas wehmütig vom Rand aus dabei zu.
Das Ende eurer Geschichte werdet ihr selbst aufzeichnen müssen, denn bald werde ich so grün sein, wie es sich die Wikinger erhofft hatten, als sie mir meinen Namen gaben. Doch die nächste Eiszeit kommt bestimmt, und ich freue mich schon darauf, mich einer neuen Sammlung zu widmen. Wer weiß, welcher Spezies ich dann gebannt beim Scheitern zuschauen kann.


Das »E« steht für einfach. Oder für experimentell. Oder für ehrlich. Haus E soll das Wohnen wieder bezahlbar machen. Es gibt da eine verblüffende Parallele zum Bauen auf dem Mars

Das Schmuttertal-Gymnasium im Landkreis Augsburg sollte ein Leuchtturm des Bauens sein. Geplant war ein Ensemble aus vier Gebäuden mit offenen Lernflächen, Campus-Feeling, Mensa und Bibliothek. Alles aus Holz. Ein Plusenergie-Bau, der in der Jahresbilanz nicht nur keine Energie verbraucht, sondern sogar Energie erzeugt, dank Solarzellen auf dem Dach, Wärme-Kälte-Rückgewinnung, automatisch gesteuerter Außenjalousien und ausgeklügelter Haustechnik. Ein Streber des deutschen Bauingenieurwesens.
Das ging auch ganz gut los. Zwei renommierte Architekturprofessoren hatten die Schule entworfen, Florian Nagler und Hermann Kaufmann, ausgewiesene Experten für Holzarchitektur. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt spendierte 640.000 Euro. Ende 2015 wurde die Schule feierlich eingeweiht, damals das größte Holzgebäude Deutschlands. Die Fachwelt war begeistert. Deutscher Architekturpreis, Deutscher Holzbaupreis, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Bayerischer Energiepreis und so weiter.
Florian Nagler könnte also als NachhaltigkeitsHeld in die Architekturgeschichte eingehen. Er ist selbst in einem Schulgebäude auf dem Dorf aufgewachsen, Mutter Lehrerin, Vater Lehrer, er hat Zimmermann gelernt und dann Architektur studiert. Heute ist er Professor an der Technischen Universität München und leitet gemeinsam mit seiner Frau ein Architekturbüro in München-Pasing. Aber Florian Nagler erzählt vom Schmuttertal-Gymnasium keine Heldengeschichte. Er erzählt die Geschichte eines Versagens.

Text Max Rauner
»Es war ein Riesenaufwand«, sagt er. »40 bis 45 Prozent der gesamten Gebäudekosten waren Technik.« Die Lüftungsanlage im Keller brauchte 400 Quadratmeter Platz, so viel wie die Aula. Durch die Hauptleitungen würde ein VW Golf passen. Der Hausmeister saß in der Steuerzentrale vor drei Bildschirmen und versuchte, das Gebäude auszupegeln. Der Job erforderte Grundkenntnisse in Anlagentechnik. Doch selbst drei Jahre nach der Einweihung war man noch immer auf Fehlersuche. Einige Außenjalousien fuhren im trüben November automatisch nach unten und ignorierten sämtliche Steuerbefehle. »Die Mängelbeseitigung läuft im Jahr 2019 weiter«, notierten Fachleute.
Florian Nagler erzählt, wie er das Gymnasium nach acht, neun Jahren erneut besucht habe. Der erste Lehrer, der ihm über den Weg gelaufen sei, habe sich bei ihm ausgeweint: Sie hätten jetzt den vierten Hausmeister, und die Technik funktioniere immer noch nicht. »Das war ein Wendepunkt«, sagt Nagler heute. Da habe er gemerkt: »Das ist die falsche Richtung. Ich möchte nicht weiter solche Häuser bauen.«
Etwas ist aus dem Lot geraten, und das Schmuttertal-Gymnasium steht als Symbol dafür. Das Häuser-
bauen in Deutschland wird immer komplexer und teurer. Das gilt nicht nur für die Technik. Viele Wände im Schmuttertal-Gymnasium bestehen aus elf Schichten. Sie sollen Schall dämmen, Feuer aushalten, Last tragen und für ein angenehmes Ambiente sorgen. Doch jede Schicht ist eine potenzielle Fehlerquelle.
Nagler läuft barfuß über die Dielen seines Büros, was man als Statement auffassen kann. Der Mann will das Bauen wieder vereinfachen. Er reist durchs Land wie ein Wanderprediger (mit Schuhen) und schwärmt vom neuen Gebäudetyp E. E wie einfach oder experimentell, manche sagen auch E wie ehrlich, weil die Wände oft nicht verputzt oder tapeziert werden, sodass die Materialien des Rohbaus offen zutage treten.
Dabei geht es nicht nur um Schulen. Wohnhäuser sind inzwischen zwar super gedämmt, aber derart hermetisch in Styropor und Thermofenster eingepackt, dass Schwitzwasser für Schimmel sorgt. Dann heißt es, die Menschen würden nicht richtig lüften. Wärmetauscher und Lüftungsautomatik sollen Abhilfe schaffen und Energie sparen. Doch damit das funktioniert, soll man die Fenster möglichst gar nicht mehr öffnen, woran sich aber nur Passivhausfreaks halten. »Wir haben es übertrieben«, sagt Florian Nagler. »Man würde halt gerne das Fenster öffnen, wenn einem danach ist, und nicht, wenn die Berechnung das vorsieht.«
Nagler zitiert in seinen Vorträgen eine 2023 veröffentlichte Studie der Universität Aalborg. Dort hat ein Forschungsteam die Verbrauchsdaten von rund 100.000 dänischen Haushalten über drei Jahre zusammengetragen. In Dänemark sind Gebäude ähnlich wie in Deutschland in neun Energieeffizienzklassen eingeteilt, von

Der Architekt Florian Nagler ist der Pionier des einfachen Bauens in Deutschland. Eines seiner Vorzeigeprojekte steht in Bad Aibling und ist ein Mietshaus aus Holz, Ziegeln und Lehm (siehe vorige Doppelseite). Sein Bau kostete 2.231 Euro pro Quadratmeter (ohne MwSt.). Ein Schnäppchen
GERNE DAS FENSTER
ÖFFNEN, WENN EINEM
DANACH IST, UND NICHT, WENN DIE BERECHNUNG
DAS VORSIEHT«
A2020 (sehr effizient) bis G (sehr ineffizient). Die ineffizientesten Häuser verbrauchen theoretisch achtmal so viel Heizenergie wie die effizientesten. Doch im echten Leben, zeigte die Studie, verbrauchen sie nur doppelt so viel. Die Menschen verhalten sich nicht so, wie die Bauphysik es berechnet. Die Lücke zwischen Theorie und Praxis bezeichnet die Architektur einigermaßen ratlos als performance gap.
Eine ähnliche Aufrüstung wie die Energietechnik hat der Schallschutz hinter sich. Gute Fenster lassen kaum noch Geräusche von draußen rein, weder Autolärm noch Vogelzwitschern. Für lärmempfindliche Menschen ist das eine gute Sache, aber nun wird man hellhöriger für die Lebenszeichen von Nachbarn und Kindern. Was tun? Dickere Wände, dickere Decken und schwimmender Estrich, alles geregelt in der Deutschen Industrie-Norm 4109. Dann sitzt man zu Hause wie im schalldichten Tonstudio.
In Deutschland gelten inzwischen rund 3.900 Normen fürs Bauen, fünf Prozent mehr als vor fünf Jahren. Ein Heer aus 36.000 Fachleuten hat sie erarbeitet. DIN 18015 zum Beispiel sieht für Wohnzimmer bis 20 Quadratmeter mindestens vier Steckdosen vor, DIN EN 12831-1 fordert für Badezimmer eine Norm-Innentemperatur von 24 Grad, weshalb trotz Fußbodenheizung oft ein Heizkörper installiert wird. Andere Normen beziffern die Höhe von Lichtschaltern und die Dicke von Stahlbetondecken für erhöhten Schallschutz.
Normen sind sinnvoll, wenn sie ein Gebäude sicher und stabil machen. Dank ihnen muss man nicht jedes Haus neu erfinden. Sicherheitsrelevante Normen sind gesetzlich verankert und legen zum Beispiel fest, dass tragende Wände in Hochhäusern feuerbeständig nach DIN 4102-2 sein müssen. Aber die allermeisten Baunormen, 80 bis 90 Prozent, dienen als Empfehlungen für höheren Komfort. Und hier liegt das Problem: Wenn Neubauten von Normen und Richtlinien abweichen, auch wenn diese nur dem Komfort dienen, gilt dies vor Gericht oft als Mangel. Das machen sich Pfennigfuchser zunutze. Architektinnen erzählen von Bauherren, die gezielt nach Normverletzungen suchen, um den Preis zu drücken. Wer es drauf anlegt, findet immer etwas. Manche Käufer kommen mit einer Murmel
ins Haus und legen sie aufs Eichenparkett. Wenn sie zu rollen beginnt, fordern sie einen Preisnachlass.
In Düsseldorf sprach das Landgericht einem Bauunternehmen Schadensersatz zu, weil ein Elektrobetrieb weniger Steckdosen installiert hatte als in der Norm vorgesehen. Die nächste Instanz hob das Urteil zwar auf, aber solche Streitfälle verunsichern die Branche. Architekturbüros gehen lieber auf Nummer sicher und planen alles auf höchstem Niveau. Klara Geywitz, die Bundesbauministerin der Ampelregierung, sagte 2024: »Es gibt sehr viele DIN-Normen, die oft nur aus Sorge erfüllt werden, bei Nichtanwendung einen Baumangel bescheinigt zu bekommen. Deswegen wird überall ein Mercedes hingebaut und kein Golf.«
Hier kommt Gebäudetyp E ins Spiel. Weniger Mercedes, mehr Golf, das ist das Ziel. Ein Volkshaus. Der Münchner Architekt Florian Nagler sagt: »Das Allerwichtigste wäre, dass man wieder mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu entwickeln, zu hinterfragen und einfacher zu machen, ohne dass man ständig mit einem Bein im Gefängnis steht.«
Gebäudetyp E (oder Haus E) ist keine Neuauflage des Plattenbaus oder des Bungalows. Ein Haus E hat keine spezielle Form und besteht nicht aus vorgeschriebenen Materialien. Sondern es verkörpert eine Philosophie – eine Idee des einfachen Bauens, die durch Gesetzesänderungen und reformierte Bauordnungen abgesichert werden soll. Kurz vor den Alpen, im bayerischen Bad Aibling, lässt sich besichtigen, in welche Richtung das geht. Hier hat Florian Nagler zusammen mit dem mittelständischen Bauunternehmen B&O drei dreistöckige Forschungshäuser mit insgesamt 23 Mietwohnungen errichtet, eins aus Hochlochziegeln, eins aus Infraleichtbeton, eins aus Holz. Es sind wohl die am gründlichsten erforschten Häuser Deutschlands.
Das fing schon vor dem Bauen an. Die Architekten simulierten mehr als 2.000 Varianten eines Einzelraums am Computer. Sie wollten verstehen: Wie müsste ein Raum mit Fenstern beschaffen sein, sodass er viel Licht hereinlässt, aber im Sommer nicht überhitzt, dessen Wände im Winter Wärme speichern und der ohne Technik ein angenehmes Raumklima schafft?
Die besten Ergebnisse erzielten drei Meter hohe und sechs Meter tiefe Räume mit dicken Außenwänden und hoch angesetzten Fenstern. Keine Glasfronten, die den Innenraum in ein Gewächshaus verwandeln und Außenjalousien erforderlich machen. Es sind Räume wie in Gründerzeitgebäuden (1870–1918). Unsere UrOmas und Ur-Opas wussten offenbar schon ohne Computersimulation, wie man behaglich wohnt. Hätte man gleich drauf kommen können? Vielleicht.
Jedenfalls wurden die drei Forschungshäuser nach diesen Plänen gebaut, anschließend mit jeweils mehr als 100 Sensoren bestückt und überwacht wie Patienten auf der Intensivstation. Im Februar 2022 waren die Häuser

Lage ist alles, heißt es bei Immobilien. Was aber, wenn die Lage mitten im Nichts ist? Das umgibt nämlich jene Bauplätze, die Architekturbüros in den vergangenen Jahren ins Auge gefasst haben – auf Mond und Mars. Während auf der Erde jedes Bauwerk ein Stück Umwelt um-baut, gibt es im All nur Unwelt: keine Lufthülle, tödliche Strahlung, Temperaturschwankungen von Backofen bis Schockfrost und zurück. Diesem lebensfeindlichen Nichts muss jeder Kubikmeter bewohnbaren Raums abgerungen werden. Deswegen war Space Architecture zunächst eine Sache der Ingenieure. Sie bauen tonnenförmige Module, vollgestopft mit Lebenserhaltungssystemen, die Schutz, Atemluft und Wohlfühltemperatur bieten. Einzeln oder miteinander verbunden bilden sie die Basis aller für fremde Himmelskörper entworfenen Bauten. Sollen diese aber größer werden, robuster oder einfach schöner, kommen Architekten ins Spiel. Bauen fürs All klingt zwar nach Hightech, wirft aber die basalen Fragen der Zunft auf: Welche Form aus welchem Material zu welchem Zweck? Der britische Architekt Norman Foster (Reichstagskuppel, Apple-Zentrale) hat das im Auftrag der Esa durchgespielt. Sein Entwurf Lunar Habitation ist ikonisch. Im Inneren ruht ein metallener Druckbehälter, darüber aber formen Roboter aus dem losen Material der Mondoberfläche (»Regolith«) eine schützende Kuppel. Das
Architekturbüro Hassell verfeinerte das Prinzip für die Nasa. Auch im Inneren seines Entwurfs für ein Mars-Haus stecken mehrere vorgefertigte Module. Für die Außenhülle hingegen sollen autonome Bauroboter Mars-Sand zu einer Art Beton verarbeiten und ihn per 3D-Druck formen (siehe Illustration). Das erinnert an ein Zeltdach: Nach oben schützt es vor kosmischer Strahlung und Mikrometeoriten, seitlich öffnen sich Bögen wie Fenster. In-situ-Ressourcen heißt im Fachjargon alles, was vor Ort auf künftige Bauherren wartet. So haben sie bei der Esa in Köln schon aus Mondstaub und Polymeren kleine Ziegel gedruckt. Der US-Baukonzern Icon erprobt für die Nasa, mit Laserstrahlen große Bauteile aus Mondstaub auszuhärten (»Lasersintern«). Und das Büro SEArch+ hat kuppelförmige Gebäude entworfen, deren aufblasbare Außenhülle mit einer anderen Vor-OrtRessource gefüllt würde, Wasser. In der Kälte des Mars bliebe es dauerhaft gefroren. Sieht so ähnlich aus wie Bausteine aus Glas. Kaufmännisch betrachtet spart jedes Gramm Vor-OrtMaterial die irre teure Anlieferung von der Erde. Gestalterisch ermöglicht es Baukörper, die in keine Rakete passen. Und kunstgeschichtlich wäre es schon lustig, wenn unsere ersten extraterrestrischen Bauten ausgerechnet aussähen wie Maulwurfshügel und Hobbit-Höhlen. Stefan Schmitt

Das Treppenhaus von Haus 4 besteht aus Lehm und Holz. Auf teure Lüftungstechnik wird verzichtet
bezugsfertig. Fensterkontakte registrierten jedes Öffnen und Schließen, Mikrofone die Lautstärke, andere Sensoren dokumentierten Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, Innen- und Außentemperatur und wann sich jemand in welchem Raum aufhielt. Geheizt wird mit Fernwärme. Die Kaltmiete betrug 9,50 Euro pro Quadratmeter, und wer in eine sensorbestückte Big-BrotherWohnung einzog und sich zu Forschungszwecken befragen ließ, zahlte etwas weniger.
Die wichtigsten Erkenntnisse: Günstig bauen ist möglich, wenn man auf einen Keller verzichtet, die Haustechnik reduziert und möglichst einheitliche Materialien verwendet. Die Außenwände des Betonhauses zum Beispiel waren mit 50 Zentimetern so dick, dass sie keine Stahlbewehrung zur Stabilisierung brauchten. Das ist später auch besser fürs Recycling. Das Betonhaus kostete ohne Mehrwertsteuer 3.250 Euro pro Quadratmeter, das Haus aus Hochlochziegeln 2.300 Euro, das Holzhaus mit Decken aus Stahlbeton 2.200 Euro. Die meisten Neubauten sind deutlich teurer.
Der Energieverbrauch in den Forschungshäusern hing stark von den Bewohnern ab. Sparsame Haushalte verbrauchten so wenig Energie wie vergleichbare Haushalte in einem Niedrigenergiehaus. Insgesamt haben die Häuser eine vorbildliche Ökobilanz, vor allem das Holzhaus: sein ökologischer Fußabdruck vom Bau über den Betrieb bis zur Entsorgung ist nur halb so groß wie der von vergleichbaren Wohnhäusern. Umbauen statt Neubauen ist natürlich noch ökologischer, kann aber ebenso der Haus-E-Philosophie folgen.
Und schließlich: Die meisten Mieterinnen und Mieter fühlen sich wohl. Nur eine Person von zwölf Befragten war im Sommer »weniger zufrieden« mit der Raumtemperatur. Im Winter war es vor allem den Befragten der nach Norden gelegenen Wohnungen etwas zu kalt. Dennoch: Die große Mehrheit erklärte, sie würde wieder hier einziehen.
An einem Dienstag im April schließt Achim Mantel in Bad Aibling die Tür eines vierten Forschungshauses auf. Es steht neben den drei ersten Häusern und ist eine Art Synthese aus den nebenan gewonnenen Erkenntnissen. Ein Best-of des einfachen Bauens. Das Treppenhaus wirkt etwas unfertig, soll aber so: Es besteht aus Lehmsteinen, ebenso wie die Innenwände in der zweiten und dritten Etage. Die tragende Wand im Erdgeschoss wurde aus roten Ziegelsteinen gemauert – gebraucht gekauft bei Kleinanzeigen. Das wirkt rustikal, aber nicht billig. Die Außenwände sind aus Holz, unsichtbar isoliert mit Jute und Hanf. Wer gerne Holz berührt und riecht, wird sich hier wohlfühlen.
Achim Mantel hat früher die Münchner Niederlassung des Baukonzerns Porr geleitet und »400-Millionen-Klopper« gebaut, wie er sagt. Bürohäuser. »Da waren alle auf Prunk und Protz aus«, sagt er. »Das ist nicht mehr meine Lebenswelt. Ich kann mit Schlips-
trägern nicht viel anfangen.« Mantel wechselte zu B&O, das sich auf klimaschonenden und sozialen Wohnungsbau spezialisiert hat. Er trägt eine Kapuzenjacke und führt in Turnschuhen die Besuchergruppen herum. Nun steht er in der Musterwohnung und schwärmt von den Funkschaltern fürs Licht (keine Leitung unter Putz) und den mit acht Schrauben befestigten Kippfenstern aus geölter Lärche. Es gibt weniger Steckdosen als von der DIN vorgesehen und keine Lüftungsanlage. Die vielen Abweichungen von den »anerkannten Regeln der Technik«, wie die Juristen sagen, kann er nicht aufzählen, weil er selbst nicht alle Normen kennt.
Im Treppenhaus fragt Mantel: »Fällt Ihnen etwas auf?« Nein. »Das Treppenhaus hat kein Auge.« So bezeichnet man die Öffnung in der Mitte der Wendeltreppen, durch die man in vielen Häusern bis unters Dach schauen kann. Dadurch soll die Feuerwehr beim Löschen den Schlauch ziehen. So war das früher. Aber Achim Mantel hat den örtlichen Hauptbrandmeister gefragt, wie er ein dreistöckiges Haus löschen würde. »Von außen natürlich«, war die Antwort. Die Leitern sind lang genug. Die Menschen werden durch die Fenster gerettet. Und wenn man doch nach innen geht, würde man die neuen Feuerwehrschläuche auf der Treppe an der Wand entlangführen. Achim Mantel und der Feuerwehrmann haben dann einen Fluchtplan entworfen und eine Sonderregelung unterschrieben.
»Das ist der springende Punkt«, sagt Mantel, »Es gibt diese Flexibilität auf der unteren Ebene. Aber nur, wenn Verantwortung übernommen wird. Das trauen sich viele Menschen in Deutschland nicht mehr.« Ihn ärgert das. »Ich habe für die Häuser hier vieles persönlich unterschrieben. Entweder ich bin Ingenieur und übernehme Verantwortung. Oder ich lasse es sein. Wenn jemand kein Vertrauen in seine Arbeit hat, soll er lieber bei McDonald’s Teller spülen.«
Die Minisiedlung in Bad Aibling ist zu einer Pilgerstätte für Architektinnen, Politikerinnen und Ingenieure aus aller Welt geworden. Aus Spanien, Griechenland, Italien und dem Libanon kamen Fachleute, um das Leichtbetonhaus zu besichtigen – weil es ohne Stahlbewehrung auskommt und auch moderate Erdbeben aushalten soll. Aus Schweden reisen Architekten an, um sich über serielles Holzbauen auszutauschen.
Wie geht es jetzt weiter? Mit Bayern. Dort sind 19 Pilotprojekte gestartet, die den Gebäudetyp E in der Praxis erproben. Sie könnten als Pioniere in die Architekturgeschichte eingehen. Das hofft jedenfalls die Architektin und Professorin Elisabeth Endres von der Technischen Universität Braunschweig, die die Pilothäuser wissenschaftlich begleitet und sich regelmäßig mit allen Beteiligten trifft. Sie meldet sich aus Venedig, wo sie in diesem Jahr den deutschen Pavillon der Architekturbiennale kuratiert. Elisabeth Endres sagt: »Die Menschen müssen Haus E anfassen und buchstäblich

begreifen, dass Weglassen nicht mit Qualitätsverlust verbunden ist.« Dann werden sie sich trauen, auch mal auf den neuesten heißen Scheiß der Gebäudeautomatisierung zu verzichten. Endres sagt: »Es geht nicht um weniger ist mehr, sondern um die Frage: Wie wenig ist genug, um vernünftig und sozial miteinander leben zu können?« Nur eines dürfe nicht passieren: »Dass Gebäudetyp E immer nur der sozial geförderte Wohnungsbau ist, während es im frei finanzierten Wohnungsbau lustig so weitergeht wie bisher.«
Fehlt noch ein Gesetz, das Architekturbüros und Bauunternehmen schützt, die nicht in vorauseilendem Gehorsam jede Komfort-Norm übererfüllen. Die Ampelregierung hatte den Gesetzentwurf für den Gebäudetyp E auch schon verabschiedet, in der Kabinettssitzung vom 6. November 2024. Am Abend desselben Tages ließ die FDP die Koalition platzen.
Immerhin ist auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung von Haus E die Rede. »Baustandards werden vereinfacht und der Gebäudetyp E abgesichert«, steht da. Und: »Das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik stellt künftig keinen Mangel mehr dar.« Am Ende müssen wir uns nur daran erinnern, wie das mit dem Wohnen noch mal geht. Die Regelungstechnik wird uns nicht mehr so viel abnehmen. Haus E wird auch ein Haus A sein. A wie Autonomie.
Max Rauner hat einen Rohbau für Gebäudetyp E in Ingolstadt besucht, das »Haus fast ohne Heizung«. Über diese Baustelle berichtet er im Podcast unter zeit.de/zw-podcast ab 6. Juli.

und reden über Narzissmus. Sie finden: Er ist ein Gesamtkunstwerk. Deshalb geht es sowohl um die guten wie die anderen Seiten
Text Katrin Zeug Fotos David Maupilé

Das Gespräch findet in den Hamburger Redaktionsräumen statt. Die beiden kennen sich und erscheinen gemeinsam, auf die Minute pünktlich. Er im Dreiteiler, sie ebenfalls perfekt gestylt. Die Stimmung ist heiter und wird das Gespräch auch über die schweren Themen tragen.
Lassen Sie uns mit einem Witz beginnen. Treffen sich zwei Narzissten. Sagt der eine: Ich weiß alles. Sagt die andere: Ich weiß. Pablo Hagemeyer: Als Narzisst baut man immer diese grandiose Fassade auf. Und dann wäre es ganz schlimm, wenn rauskommt, dass man doch nicht alles weiß! Britta Papay: Und wenn sich zwei treffen, versuchen sie, sich zu übertrumpfen: Du weißt vielleicht alles, aber ich weiß mehr! Das kann ja heiter werden mit Ihnen. Aber Sie sind ja nicht nur Narzissten, Sie sind auch Experten. Sie arbeiten als Therapeuten und haben Bücher über das Thema geschrieben. Hilft Ihnen das mit sich selbst? Papay: Wenn ich privat unterwegs bin, kann ich nicht immer so gut aus meiner Haut. Ich merke zwar, was ich tue, und bin mir auch voll bewusst, was das bei anderen anrichtet – hänge aber trotzdem darin fest. Wie zeigt sich das Narzisstische bei Ihnen? Papay: Ich überhöhe mich und werte andere ab. Das fühlt sich gut an. Aber nur kurz, dann tritt Beschämung ein. Dieses Rauf und Runter ist typisch. Das Hochgefühl, wenn man die Schwäche des anderen spürt – und gleichzeitig die Scham über das, was man da gerade tut und fühlt: Belohnung und Stress in Dauerschleife sozusagen. Wie ist das denn bei dir, Pablo? Deine Frau hat ja mal gesagt, wenn du eine Krankheit wärst, dann wärst du die Pest.
Hagemeyer: Das war mit Freunden, bei einem Spiel. Wir haben alle gelacht.
Papay: In Italien sagt man »Sei una peste!«, wenn jemand so richtig ätzend nervt.
Hagemeyer: Ich höre öfter, Pablo, es ist wieder zu viel! Meine Redestrecke, meine Energie, das Raumeinnehmen. Aber ich bin ja ein netter Narzisst. Meine Überlebensstrategie war immer der Clown: Klassenclown, Familienclown. Wenn alle lachen, hat der Clown die Macht. Er erkennt die aufgestauten Gefühle einer Gruppe und hilft, sie abzureagieren. Er macht sich dienlich
und wird, das sagen Studien, zum neuen Führer, wenn die Gruppe sich spaltet. Clowns sind clever. Und traurig. Mir wurde auch öfter gesagt, dass ich ganz schön arrogant bin, das habe ich natürlich korrigiert.
Papay: Sag nie zu einem Narzissten, dass er narzisstisch ist, der haut es dir um die Ohren! Bei mir ging es los, als ich auf dieses Elitegymnasium kam und keinen Bock mehr hatte, die blöde Nazideutsche zu sein. Ich war schon immer sehr klein, zierlich und blond, und in Italien, wo ich aufwuchs, die totale Außenseiterin. In der Grundschule wurde ich gehänselt, und mittags wartete der Pfarrer vor der Kirche und rief mir nach, dass ich zusammen mit meiner Sippe und Hitler in die Hölle komme. Auf dem Gymnasium drehte ich den Spieß dann um: Ich habe allen erzählt, ich komme aus einer großen baltischen Kaufmannsfamilie, spreche drei Sprachen, und außerdem bin ich blond! Es war meine Form, mit der Verletzlichkeit umzugehen. Ich bin ein sehr empfindlicher Mensch, ich fühle alles! Ich würde sagen, Hochsensible sind oft Narzissten. Sie haben besonders viele Empfindlichkeiten, die sie regulieren müssen. Das klingt insgesamt nach recht viel Verletzlichkeit. Narzissten sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie anderen wehtun.
Papay: Die Wut der Narzissten ist nur eine Maske. Sie entlädt sich zur Entlastung.
Hagemeyer: Das ungeäußerte Gefühl dahinter ist Scham. Die sitzt tief in uns. Narzissten fühlen sich ständig in ihrem Selbstwert bedroht. Das Einzige, was stabilisiert, ist Zuspruch, Erfolg, Größenwahn. Kritik ertragen sie nicht. Es ist wie eine Sucht, eine Anerkennungsbestätigungssucht.
Papay: Darum ärgere ich mich auch immer, wenn es heißt, Narzissten haben keinen Leidensdruck. Das ist nicht wahr! Wenn der Narzisst abends im stillen Kämmerlein sitzt, dann sind da all die negativen Gefühle: Angst, Verzweiflung, Scham, Wut. Sie werden nur am nächsten Tag wieder weggedrückt, indem man losgeht und andere abwertet und manipuliert.
Hagemeyer: Strategisch klüger wäre es, in stiller Ruhe von der eigenen Größe zu träumen. Wie ein inneres Kino, ein Ego-Kino. Statt immer wieder draußen zu scheitern und andere dafür verantwortlich machen zu müssen. Aber das können sie nicht. Eine italienische Studie hat die Gehirne von

»Wird der Hirnscan jetzt zum Freifahrtschein für Arschlochverhalten?«
(Britta Papay)
»Ich glaube schon, dass man was machen kann«
(Pablo Hagemeyer)

unter anderem narzisstischen Menschen untersucht – und tatsächlich Unterschiede gefunden. Zum Beispiel beim Belohnungssystem und dem Default-Mode-Netzwerk. Wir schließen daraus, dass diese Personen sich nicht so gut selbst reflektieren können, also weder sich selbst hinterfragen noch gut zureden. Allein kommen sie also nicht klar. Papay: Bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, sagen wir: Deine Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin, das ist so, egal wie sehr du dich anstrengst. Gilt das jetzt auch für Narzissmus? Wird der Hirnscan zum Freifahrtschein für Arschlochverhalten? Weil ich sagen kann: Tut mir leid, ich kann nicht anders, meine Hirnsubstanz ist ein bisschen geschrumpft?
Hagemeyer: Ich bin Tiefenpsychologe, ich glaube schon, dass man was machen kann. Wir sind ja nicht nur Biologie. Erziehung spielt auch eine gewisse Rolle, die Ausbildung, der Beruf. Es reicht manchmal eine einzige schmerzhafte Erfahrung wie Mobbing oder Abwertung für das Aussehen, die Herkunft, und eine Weiche wird gestellt. Eltern, die ständig und alles loben, Papay: ... sind auch das perfekte Rezept, um einen Supernarzissten zu produzieren!
Hagemeyer: Sogar noch mehr als Eltern, denen man nichts recht machen kann.
Papay: Wenn ich mit einer Eins heimkam, fragte mein Vater: Wer hatte die Eins plus?
Hagemeyer: Das ist schon bösartig! Trotzdem muss man sagen: Das Herausbilden narzisstischer Eigenschaften, also überheblich, arrogant und manipulierend zu werden, ist nur eine von vielen Strategien, mit so was umzugehen. Man könnte sich auch zurückziehen oder selbst herabwürdigen.
Papay: Und manche Menschen tragen gar keinen Schaden davon. Die sind resilienter. Wenn in der Vergangenheit etwas schiefgelaufen ist und es sich tatsächlich verfangen hat, kann man etwas tun?
Hagemeyer: Wir wissen, dass unser Gedächtnis nicht immer faktisch ist, sondern die Realität stark subjektiv abbildet, es also veränderbar ist. Da setzen wir an: Der Klient erzählt sein Leben, der Therapeut hilft, die schlimmsten Geschichten neu zusammenzusetzen, sodass sie anders betrachtet und verstanden werden können. Es entsteht ein neues, versöhnlicheres Narrativ.
Papay: Man kann so dieselbe Geschichte auf verschiedene Arten und Weisen fühlen.
Hagemeyer: Der Psychologe Jeffrey Young hat auch ein tolles Instrument entwickelt: die Schemareduktion. Er geht davon aus, dass wir dysfunktionales Verhalten nicht wegmachen können – nur reduzieren. Zum Beispiel indem wir dem Patienten sagen, dass es total toll ist, dass er so impulsiv ist, weil er dadurch richtig Power hat – ihn aber auch fragen, ob er sich vielleicht vorstellen kann, es etwas zu reduzieren.
Papay: Damit lassen wir ihm, was er mitbringt. Auch wenn das Eigenschaften und Gefühle sind, die nicht so toll sind. Wie Impulsivität oder Grandiosität. Aber statt sie ausmerzen zu wollen, nehmen wir sie als einen Teil von ihm an, wir geben ihnen lediglich einen Rahmen.
Hagemeyer: Für mich ist die Methode ein Wunder! Man kann sie auch privat gut nutzen, im Umgang mit Narzissten.
Sind Sie selbst in Therapie?
Hagemeyer: Nein. Aber Supervision und Kollegenschelte gebe ich mir schon. (lacht)
Papay: Ich immer wieder. Narzissmus geht ja nicht weg, man kann nur versuchen, ihn zu verstehen und sich trauen, die eigenen Gefühle zu fühlen. Ich brauche immer jemanden, mit dem ich mich reflektiere. Das ist derzeit kein Therapeut, aber ein weiser Mann, der mich schon lange begleitet und dem ich sehr vertraue. Bei ihm kann ich mich schamfrei schämen und trauen, die Scham zu ergründen.
Hagemeyer: Die meisten Narzissten gehen nicht zur Therapie. Ein lupenreiner Narzisst würde ja keinen Gedanken daran zulassen, dass er auch problematische Seiten hat.
Papay: Viele bewegen sich aber in einem Spektrum, das nicht rein narzisstisch ist, die Anteile verschwimmen. Man kann sich grandios und ganz klein zugleich fühlen. Vielleicht sollten wir hier auch einmal sagen, dass wir, wenn wir von Narzissten sprechen, nicht nur Menschen mit einer krankhaften narzisstischen Persönlichkeitsstörung meinen. Sondern auch die, die wie wir einfach stärker ausgeprägte narzisstische Merkmale aufweisen.
Wann gilt es als Persönlichkeitsstörung?
Hagemeyer: Nur wenn man Interaktionen wirklich ganz anders wahrnimmt und interpretiert als andere. Wenn man Impulse nicht kontrolliert bekommt, obwohl es einem selbst schadet – und wenn man darunter leidet. Was vielen nicht klar ist: Nur weil
»Ich bin auf den Artikel gespannt, sind wir auf dem Cover?«
(Britta Papay)

das Umfeld unter einem Narzissten leidet, hat der noch keine Persönlichkeitsstörung.
Papay: Wir beide würden keine Diagnose bekommen, definitiv nicht. Es betrifft weniger als ein Prozent der Bevölkerung.
Hagemeyer: Da mache ich immer den Gag mit der Dunkelziffer: Die ist sehr hoch, weil Narzissten ja nicht zu uns kommen. Papay: Und die, die kommen, machen erst mal den Therapeuten runter.
Hagemeyer: Und wenn der mal anderer Meinung ist als sie, brechen sie ab.
Papay: Es ist auch interessant, dass Narzissten nicht aussterben. Obwohl sie so unangenehm sind. Aber sie haben einen evolutionären Sinn: Nur wer glaubt, dass er der Größte ist, geht raus und holt das Mammut. Die anderen sagen: lieber nicht!
Hagemeyer: Das sind die eher vermeidenddepressiven, die bleiben in der Höhle und überleben in großer Überzahl. Von den Narzissten braucht es aber auch nicht viele, denn wenn es nicht gerade ums Mammut geht, stören sie in der Höhle. Es ist wissenschaftlich belegt, dass ein Giftpilz reicht, um ein komplettes System zu sprengen.
Papay: Was man gut bei Kleinkindern und Pubertierenden beobachten kann: Lauter Narzissten, die ihre Eltern herausfordern. Allerdings ist das in dem Alter ganz normal und Teil der gesunden Entwicklung: Wenn man viel Neues wagen muss, hilft es, zu glauben, alles zu können und zu wissen. Heißt das, narzisstische Eigenschaften sind gar nicht nur schlecht?
Papay: Es ist wie beim Blutdruck: Zu hoch ist ebenso ungesund wie zu niedrig. In meine Praxis kommen oft Leute, die wollen, dass ich ihrem Partner eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziere. Damit endlich alle ihr Leid mit diesem Menschen erkennen. Das geht natürlich nicht.
Hagemeyer: Die haben oft selbst was. Papay: Oft sind es vulnerable Narzissten, die mit dem grandiosen Narzissten das perfekte Match bilden.
Was sind vulnerable Narzissten?
»Oder gibt es ein Sonderheft?«
(Pablo Hagemeyer)
Papay: Sie treten nicht auf wie die lauten Selbstdarsteller, die ganze Räume mit ihrem Ego füllen. Im Gegenteil: Vulnerable Narzissten wirken oft still, reflektiert, manchmal sogar bescheiden. Doch hinter der Zurückhaltung verbirgt sich ein ebenso starker Hunger nach Anerkennung. Ein Patient, erfolgreicher Unternehmer, Anfang
Britta Papay arbeitet als systemische Therapeutin in Hamburg zu den Schwerpunkten Narzissmus und Trauma. Sie wuchs in einer deutsch-baltischen Familie in Italien auf, promovierte in internationalem Strafrecht und arbeitete in verschiedenen Unternehmen. Mit Anfang 40 brachte eine schwere Krankheit und Krise sie dazu, komplett umzuschulen und sich den Menschen zuzuwenden. In diesem Jahr erschien ihr erstes Buch: »Verkappte Narzissten. Wie wir sie enttarnen und ihnen die Macht nehmen«.

Pablo Hagemeyer ist in Südamerika und Spanien aufgewachsen und arbeitet heute als Psychiater und Psychotherapeut mit eigener Praxis in Oberbayern. Sein Buch »Gestatten, ich bin ein Arschloch. Ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie Sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten« wurde ein Bestseller. Es folgten weitere Bücher über Narzissmus. Außerdem betätigt er sich als Dozent, Gutachter und Drehbuchautor.
60, erzählte mir ganz stolz, er habe ein Helfersyndrom. Aber er litt! Vulnerable Narzissten bekommen ihre Anerkennung, indem sie in ihrem Leid oder ihrer Aufopferung gesehen werden. Schuld sind immer die anderen. Die Instrumente sind dieselben. Mit welchem Instrumentarium manipulieren Narzissten ihre Gegenüber?
Hagemeyer: Ihr Gehirn hat eine kognitive Empathie, die strategisch operiert: Ich spüre, was du brauchst, und gebe es dir.
Papay: Solange es in meinem Interesse ist! Sonst entziehe ich dir meine Liebe sofort.
Hagemeyer: Außerdem missverständliche Kommunikation, Halbwahrheiten, Desinformation, Schuldumkehr, Gaslighting Papay: Der Name stammt von dem Theaterstück Gaslight, in dem ein Verbrecher versucht, seine Frau um den Verstand zu bringen. Er dimmt beispielsweise das Licht und leugnet dann, dass es dunkler geworden ist. Er behauptet, sie irre sich.
Hagemeyer: Die Realität wird verdreht, bis die andere Person beginnt, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Und dann an sich.
Papay: Machst du so was, Pablo?
Hagemeyer: Extrem selten. Nie bösartig. Einmal hab ich das mit einer Mitarbeiterin gemacht, aber spielerisch, und ich habe es gleich aufgelöst. Wir lachten beide. Das ist der Unterschied zu bösartigen Narzissten. Die ziehen das gnadenlos durch, über Leichen. Das Gegenüber wird total entwürdigt. Und verliert sich irgendwann selbst.
Machen Narzissten so etwas mit Absicht?
Hagemeyer: Ein Plan wäre zu aufwendig.
Papay: Ich denke, man hat gelernt, was funktioniert. Und dann spult man das Muster ab, schnell und automatisch.
Hagemeyer: Ein Patient hat mal eine Geschichte erzählt: Er fuhr im Auto, neben ihm seine Freundin, und dann ist ihr Kaffeebecher umgefallen. Erst habe er gelacht und gesagt, dass es ihre Schuld sei. Sie fragte verwirrt: warum? Dann wiederholte er es und lachte nicht mehr: Es ist deine Schuld! In der dritten Runde sagte er es drohend und aggressiv. Er brachte sie damit in einen unangenehmen Zustand, und schließlich nahm sie die Schuld an. Er sagte zu mir: Am Anfang sei es ein Scherz gewesen, aber am Ende habe er es selbst geglaubt.
Papay: Daran sieht man auch, dass es immer zwei braucht für den narzisstischen Tango. Ohne ein Gegenüber, das so erschrocken
und verunsichert ist, dass es das schluckt, geht es nicht. Sie hätte auch sagen können:
Bist du deppert? Steig aus und lass mich fahren, wenn du es nicht kannst!
Hagemeyer: So wäre wohl meine Frau. Papay: Dann hat sie eine Persönlichkeit, die so stabil ist in ihrem eigenen Wertempfinden, dass sie weder in die Opfer noch Täterrolle gehen muss. Sie kann sagen: Ach, Pablo, du bist die Pest! Und lachen. Wenn ich gefragt werde, ob man sich von Narzissten trennen sollte, sage ich immer, it depends: Kann ich ihn oder sie nehmen, wie er oder sie ist? Oder gehe ich daran zugrunde? Narzissten brauchen jemanden, der das Spiel mitspielen kann. Meine Eltern haben sich 35 Jahre gefetzt und waren glücklich.
»Narzissten
haben einen evolutionären Sinn: Nur wer glaubt, dass er der Größte ist, geht raus und holt das Mammut.
Die anderen sagen: lieber nicht!«
(Britta Papay)
Hagemeyer: Es kann Spaß machen und verbinden! Allerdings gibt es auch die hochstrittigen Fälle. Damit hat meine Frau viel zu tun, sie ist Familienrechtsanwältin. Manche Paare landen wegen Kleinigkeiten vor Gericht, weil das Narzisstische den Konflikt antreibt – und sich dann auf der großen Bühne inszenieren kann. Mit Publikum. Den Opfern wird nicht geglaubt, und sie werden erneut entwürdigt. Es gibt kein standardisiertes Schutzkonzept.
Papay: Die Ahnungslosigkeit an den Familiengerichten ist wirklich frappierend. Sie erkennen Missbrauch nicht und decken ihn. Ihr Instrumentarium ist miserabel. Was können Opfer tun?
Papay: Als Erstes müssen sie erkennen, was da passiert und wen sie vor sich haben.
Wissen macht schlau! Und dann: Erkenne dich selbst. Wo dockt dieser Mensch bei mir an, dass ich immer leide, mich schlecht fühle?
Hagemeyer: In manchen wütet ein zerstörerisches, unbewusst übernommenes Gefühl, das aber nicht als fremd erkannt wird: Muttervergiftung durch ständiges Besserwissen. Vatervergiftung durch Dauerbestrafung. Diese Leute sehen überall nur ihre eigenen Schwächen und warten darauf, sie erneut bestätigt zu bekommen. Die Tore für erneuten Missbrauch stehen weit offen.
Papay: Ich werde gelegentlich des OpferBlamings bezichtigt, weil ich öffentlich sage: Nix Opfer! Ihr seid jetzt groß und könnt selbstermächtigt handeln. Wenn ihr euch traut herauszufinden, wie es geht! Das soll nicht bagatellisieren, dass es schlimmen Missbrauch gibt. Aber mit der Situation umgehen kann man nur selbst.
Hagemeyer: Das ist ein heikler Moment, weil da für das Opfer eine Kränkung schlummert: Vielleicht kann auch ich etwas nicht so gut? Grenzen ziehen zum Beispiel. Papay: Wobei es kaum möglich ist, einem Narzissten Grenzen zu setzen. Der rennt sie ein, mit Anlauf! Es braucht also innere Grenzen. Losgelöst vom Gegenüber. Wie kann man das üben?
Papay: Man muss sich den eigenen Mustern stellen. Habe ich gelernt, mich zu spüren? Meine Bedürfnisse? Meinen Schmerz? Opfertypen sind oft zu sehr mit den Gefühlen der anderen beschäftigt.
Hagemeyer: In bestimmten Achtsamkeitsübungen kann man trainieren, das Ich wieder als eine vom Du emanzipierte Identität zu erfahren. Sich wahrzunehmen und dem eigenen Erleben zu trauen.
Papay: Bei Menschen mit Bindungstrauma oder Gewalterfahrung arbeite ich viel körperzentriert. Damit sie emotional stresstoleranter werden und irgendwann einfach sagen können: Boah, du nervst mich kolossal! Aber das ist deins. Ich bleibe bei mir.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Papay: Ich bin auf den Artikel gespannt, sind wir auf dem Cover? Das werden bestimmt zehn Seiten!
Hagemeyer: Oder gibt es ein Sonderheft?
Katrin Zeug hatte großen Spaß mit den beiden. Vor und nach dem Gespräch allerdings musste sie klarstellen, dass SIE die Autorin ist. Normaler Eignungstest, sagten die beiden, gehöre dazu.
Ich hätte da mal Ich hätte da mal

Die Welt ist voller Möglichkeiten, und ich soll mich dauernd entscheiden. Geht das nicht anders? Ein Besuch bei den Spezialisten für Perspektivwechsel und Schwebezustände
Text Chiara Joos Artworks Michael Strevens
Vor großen Entscheidungen schreibe ich keine Pro-und-Contra-Listen.
Ich treffe sie aus dem Bauch heraus. »Bereust du etwas?«, wurde ich mal gefragt. »Nein«, antwortete ich. »Alles kommt, wie es kommt.« In Wirklichkeit hadere ich damit, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es nur um Kleinigkeiten geht wie die Wahl zwischen Zitronen- und Erdbeereis. Oder um die Frage, ob ich Uschi verkaufen soll, meinen Opel-Oldtimer. In der Schulzeit fuhr sie mich und eine lose Auswahl meiner Heimatstadtjugend durch Stuttgart. 20 Jahre lebte ich dort, bis mich der Zufall nach Österreich verschlug. Statt in Süddeutschland zu studieren, das Elternhaus zu erben und einen Mann zu heiraten, kamen ein Studium in Innsbruck, die erste Altbauwohnung in Wien, das Verlieben in eine Frau.
Ich habe ein recht klares Bild davon, wie mein Leben hätte aussehen können, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ich frage mich nur: Welche Wirkung hat das Nicht-Gewordene? Wie beeinflussen die Wege, die ich nicht gehe, den einen Weg, auf dem ich unterwegs bin? Eine Freundin behauptet, ich ziehe den Zufall magisch an. Was ist vorgezeichnet, und wo bin ich frei? Was wird Realität, und was bleibt Möglichkeit?
In Wien gibt es üblicherweise zwei Instanzen, die man mit solchen Fragen behelligt. Die Kirche und die Psychotherapie. Ich habe noch eine dritte Instanz entdeckt, eine Expertin für Unschärfen, Zufälle und Perspektivwechsel. Einer ihrer Geburtshelfer stammt aus Wien, Erwin Schrödinger. Die Quantenphysik wird 2025 von den Vereinten Nationen mit einem Internationalen Jahr geehrt, sie erforscht die Welt der kleinen Atome. Kann sie mich auch in den großen Fragen des Lebens weiterbringen? Die Quantenphysik ist wie ein Haus mit einem 100 Jahre alten Fundament. Ich stehe davor, bereit, anzuklopfen. Zwei Physiker und eine Physikerin möchte ich sprechen, nicht um letzte Antworten zu finden, sondern um neue Blickwinkel zu entdecken. Können sie mir helfen, das Nicht-Gewordene zu verstehen? Es ist ein Experiment. Schrödingers Erben forschen in einem Prachtbau in der Boltzmanngasse. Als Erstes klopfe ich bei Časlav Brukner an. Er schiebt erst mal ein schweres, hakeliges Fenster hoch. »Wird bald ausgetauscht«, sagt er, während seine Mundwinkel der Schwerkraft nachgeben. Brukner, eine Art Quantenphilosoph, interessiert sich für die Frage, ob es überhaupt eine objektive Welt unabhängig vom Beobachtenden gibt.
Können die Wege, die wir nicht gehen, Spuren hinterlassen? »Schon Aristoteles hat zwischen Potenzialität und Aktualität unterschieden«, sagt er, darüber habe er extra vor unserem Gespräch nachgedacht. »Das, was wir nicht wählen, bleibt als Möglichkeit im Raum. Es bildet den Hintergrund, vor dem unsere Entschei-
dungen überhaupt erst Bedeutung bekommen.« Er nimmt sich Zeit, die richtigen Worte zu finden. Als ich meine Interviewanfrage gestellt hatte, waren die Quantenphysiker etwas ängstlich, dass mein Experiment in die esoterische Richtung geht. Brukner erzählt mir vom Doppelspaltversuch, bei dem Teilchen auf eine Platte mit zwei Schlitzen zufliegen und auf einem Schirm dahinter auftreffen. Ich will mich gerade mit dem Teilchen in seinem Entscheidungszwiespalt identifizieren, da sagt Brukner: »Das Teilchen im Doppelspalt-Experiment nimmt nicht diesen oder jenen Weg. Es ist unbestimmt. Es hat keinen Weg genommen, bis es gemessen wird.« Er redet vom Messprozess, bei dem sich die Quanten, wenn ich es richtig verstehe, für eine Option festlegen müssen. Er sagt: »Unser Sein wird nicht nur von dem geformt, was wir gewählt haben. Sondern auch von dem, was wir nicht gewählt haben.«
Brukner kennt selbst Brüche im Leben. Während seines Physikstudiums in Belgrad brach Anfang der Neunzigerjahre der Krieg auf dem Balkan aus. Er zog nach Wien und forschte bei dem späteren Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Ich frage, ob es auch bei ihm eine Art Messprozess gab, einen point of no return ins heutige Serbien. »Anton Zeilinger und die Ermordung eines serbischen Hoffnungsträgers«, sagt Brukner.
Bei mir war es, als ich ein Studium fand, das mir den Freiraum gab, den ich für mich brauchte. Das liegt nun hinter mir. Der Weg ist gegangen. Doch was passiert, wenn ich mich zwischen Erdbeer- und Zitroneneis entscheiden muss? Was wird aus Uschi?
Vielleicht muss ich mich gar nicht immer entscheiden. Vielleicht ist es okay, dass das Leben aus gewählten und nicht gewählten Wegen besteht, dass auch das Zitroneneis, das ich nicht esse, einen Geschmack in mir hinterlässt. Vielleicht liegt darin der Trost der Quantenphysik: dass sie eben nicht krampfhaft fragt, warum man jetzt diesen oder jenen Weg eingeschlagen hat, sondern dass sie die Ungewissheit adelt.
Brukner zieht unter seinem Schreibtisch ein kleines schwarzes Gerät hervor. »Photon-Clicker« steht darauf.
Klick. Pause. Klick. Lange Pause. Und dann wieder: Klick. »Jedes Geräusch ist ein Lichtteilchen«, sagt er. »Wann es kommt, ist reiner Zufall.«
Der Physiker John Archibald Wheeler verglich die Quantenphysik mit dem Spiel 20 Fragen, bei dem sich jemand einen Begriff ausdenkt, den die anderen mit höchstens 20 Fragen erraten sollen. Bloß dass es diesmal keinen Begriff gibt, sondern sich die Teilnehmenden auf die erste Antwort einigen und dann weiterspielen. Am Ende scheint es, als hätte es von Anfang an eine »richtige Lösung« gegeben. Die Fragen und Antworten formen das, was sich am Ende Wirklichkeit nennt. »So ist es in der Quantenphysik«, sagt Brukner. »Wir beobachten, und erst dadurch entsteht, was wir beobachten.« Das klingt für mich gar nicht so weit

Časlav Brukner erforscht die philosophischen Grundlagen der Quantenphysik. Er ist Mitglied des Instituts IQOQI der österreichischen Akademie der Wissenschaften und lehrt an der Universität Wien


Francesca Ferlaino forscht an der Universität Innsbruck an ultrakalten Quantengasen.
entfernt von dem, was der – Wiener – Psychotherapeut Viktor Frankl geschrieben hat: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Im Railjet von Wien nach Innsbruck wollte ich eigentlich in Fahrtrichtung vorwärts sitzen. Beim Buchen habe ich »Fensterplatz, großer Tisch« gewählt. Bekommen hatte ich Fenster, rückwärts mit kleinem Tisch. Die Beine angewinkelt, der Nebensitz vollgepackt wie mein Kopf, denke ich an die Veränderungen in meinem Leben. Die, bei denen man nicht weiß, ob man irgendwohin fährt oder zurückgeholt wird. Bei denen es vorwärts, rückwärts, vorwärts geht.
In Innsbruck lebt und arbeitet Francesca Ferlaino. Hier hat sich auch einer der schöneren Zufälle meines Lebens zugetragen. Es ist ein Brückentag. »Andere haben frei«, hatte sie am Telefon gesagt, »aber ich arbeite.« Ferlaino erforscht Teilchen, die sich nicht mehr wie Teilchen verhalten, sondern wie Wellen, und die keine Entweder-oder-Existenz führen, sondern in Möglichkeitsräumen zu Hause sind. Die Tür zu ihrem Büro steht offen. Ferlaino begrüßt mich mit einem breiten Lächeln. Ihre Arbeit sei ihr Hobby, sagt sie, und sie erzählt von ihrem Vater, der einen italienischen Fußballclub leitete und von dem sie gelernt habe, dass Exzellenz Zeit und Leidenschaft braucht.
Mein Innsbruck-Zufall war die erste Frau, in die ich mich verliebte. Sie fiel mir nur kurz auf, ich dachte nicht mehr an sie. Ein Jahr später ein zufälliges Finden und das Aha: »Ich habe dich doch schon mal gesehen.« Mit meiner jetzigen Partnerin war es fast gleich. Erst ein flüchtiges Gespräch in Wien. Dann ein Jahr nichts, bis sie eines Nachmittags in einem Café mit einem Lächeln mir gegenübersaß. Ich erzähle Ferlaino auch von dem Typen in London, dem mit den Blumen auf dem Arm. Einen Monat später, wieder in London, eine andere Buslinie, steht er wieder vor mir, ohne Blumen. Oder der Sommerurlaub in Südtirol. Ich spielte Tennis mit einem Alten. Drei Jahre später sitze ich bei einem Festival in Deutschland mit einer neuen Bekannten vor meinem Zelt. Der Tennis-Opa war ihr Opa.
Für mich fühlt sich der Zufall wie etwas Magisches an. Und für sie? Francesca Ferlaino sagt: »Es gibt Zufall in der Natur und Zufall in der Forschung. Beides funktioniert anders.« Die Natur folgt Wahrscheinlichkeiten. Nichts ist eindeutig, alles schwebt in Möglichkeiten. Der andere Zufall ist menschlich. Ferlaino sagt: »Ein Gespräch, ein Satz zur richtigen Zeit.«
Ein Teilchen sei nicht hier oder dort, sondern hier und dort, bis es gemessen wird. Erst dann legt es sich fest. Sie sagt: »Wir denken gern in zwei Kategorien: richtig oder falsch, Mann oder Frau, links oder rechts. Aber die Quantenphysik ist anders. Sie ist nicht schwarz oder weiß, sondern alles dazwischen.«
Ich frage, ob meine Geschichten aus Innsbruck, Wien oder London in dieser Welt Platz haben. »Das hängt davon ab«, sagt sie. »Manche Zufälle haben ein Muster. Andere nicht. Aber selbst wenn du es nicht erkennst, es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Und diese Wahrscheinlichkeit ist nie null.« Ist da noch Platz für Magie? Ferlaino erzählt mir von dem Teddybär ihres Sohns. In Innsbruck sei das Stofftier verloren gegangen, zwei Jahre später hielt in Bozen ein Kellner den gleichen Teddy in der Hand. »Ich weiß, dass es nicht derselbe war«, sagt Ferlaino. Sie lacht. »Es sollte keine Magie sein, aber es ist schöner, sich vorzustellen, dass es irgendwie doch Magie ist.«
Markus Arndt, mit dem ich als Nächstes sprechen werde, würde in seiner Genauigkeit vielleicht protestieren. Ich fahre zurück nach Wien, um ihn zu treffen, ohne Reservierung, vorwärts mit großem Tisch.
Ich lebe in zwei Welten: der Welt der Hörenden und der Wenig-Hörenden. Ob ich mein natürliches Gehör vollständig verlieren werde, weiß ich nicht, nur der halbjährliche Hörtest zeigt Veränderung. Meine Hörgeräte sind mein Schalter. Ich kann mich entscheiden, wie laut ich die Welt hören will. Das Dazwischensein fühlt sich kostbar an und fragil. Vielleicht empfinde ich deshalb eine gewisse Sympathie mit Schrödingers Katze, die in einem Kasten eingesperrt ist und lebendig und tot zugleich sein soll, solange niemand nachschaut.
Markus Arndt hat den Erwin-Schrödinger-Preis für besonders empfindliche Messtechnik erhalten. Er untersucht Teilchen, die sich in Schrödingers-Katzeähnlichen Superpositionszuständen befinden: gleichzeitig an einem Ort und an einem anderen. Eigentlich ist es schon falsch, wenn man von Teilchen spricht, deshalb redet er von Zuständen. »Die interessantesten Zustände sind die, in denen man nicht hinschaut«, sagt er. »Die haben die meisten Möglichkeiten.«
Ihre eigene Entdeckung in der Physik begann mit einem unerklärlichen Phänomen. Sie dachte zunächst an einen Fehler. Dann las sie – zufällig – einen Artikel über Molekülchaos und kam auf die Idee, das Konzept auf ihr Experiment zu übertragen. »In der klassischen Physik ist Zufall oft nur Unwissen«, sagt Ferlaino. »In der Quantenphysik ist er grundlegend. Er ist echt. Es gibt keine festen Ergebnisse, nur Wahrscheinlichkeiten.«
Bin ich auch ein bisschen Katze? »Als Bild vielleicht«, sagt Arndt. »Aber die Begriffe werden oft falsch verwendet.« Er warnt davor, die Quantenphysik zu mystifizieren, von Quantenheilung zu sprechen oder esoterische Schlüsse zu ziehen. Er möchte verhindern, dass die Wissenschaft weichgespült wird. Die Begriffe seien mathematisch präzise definiert, auch wenn es um Unschärfen geht. Alles andere sind Analogien. »In gewisser Weise bewegen wir uns alle zwischen Zuständen«, sagt Arndt. »Nur sind das keine echten Welten, es sind Möglichkeitsräume.« Ich frage ihn, was Menschsein für ihn bedeutet. Vielleicht, sagt er, sei die größere Frage, warum es überhaupt etwas gibt, das sich als Mensch
Markus Arndt, Physikprofessor an der Universität Wien, ist Experte für Quantenoptik, Quanteninformation und Quantennanophysik. Fotos:

empfindet. »Das Erstaunliche ist nicht, dass Elektronen in Überlagerungszuständen existieren können, sondern dass Wesen entstehen, die das beobachten können.«
Ich verlasse die Quantenphysik mit einem neuen Freiheitsgefühl, dem, nicht eindeutig zu sein. Oder, wie Arndt es formuliert: »nicht immer alles festlegen zu müssen«. Die Quantentheorie kennt keine Entwederoder-Strenge. Ihre größte Provokation ist die Offenheit, dass mehrere Zustände gleichzeitig bestehen können,
selbst solche, die wir im Alltag als Gegensätze begreifen würden. Dass Realität nicht absolut ist, sondern abhängig von der Umgebung, die wir schaffen. In Zukunft werde ich meine Entscheidungen, Zufälle und mich selbst als ein Experiment betrachten, mit selbst bestimmten Messergebnissen, unbestimmbaren Zufällen und einem Vorteil im Nachteil, wie beim schlechten Hören: Ich führe zwei Leben gleichzeitig. Und Uschi, mein Opel? Mal sehen. Alles ist möglich!

Warum schmerzt die Achillessehne? Sind meine Cholesterinwerte okay? Ist mein Schlüsselbein gebrochen? Unser Autor war ein treuer Patient von Dr. Google. Jetzt hat er die Praxis gewechselt
Text Max Rauner Illustrationen Pablo Amargo
Leider kann ich mich gut an den Tag erinnern, an dem ich Dr. Google untreu wurde. Es war der vorletzte Tag eines verlängerten LanglaufWochenendes in Tirol. Ich fuhr nicht gerade langsam einen Hügel hinunter und wurde von einem Haufen Kunstschnee ausgebremst. Ich flog nach vorne und landete auf der linken Schulter. Der Adrenalin-Autopilot ließ mich noch aufstehen und ein paar Hundert Meter ins Dorf laufen. Aber irgendetwas stimmte nicht. »Ich glaube, ich habe mich verletzt«, erklärte ich dem Mann beim Skiverleih. Er hatte Mitleid – oder simulierte er nur? Jedenfalls gab er mir die Leihgebühr für den nächsten Tag nicht zurück. Im Hotel setzte ich mich aufs Bett und öffnete ChatGPT.
Ich bin beim Skifahren auf die Schulter gefallen. Die tut jetzt weh. Wie kann ich eine Selbstdiagnose machen, um zu spüren, ob das Schlüsselbein gebrochen ist?
Dr. Google war jahrelang meine virtuelle Hausärztin. Sie hat mich bei echten wie eingebildeten Krankheiten beraten. Sie lotste mich zu medizinischen Leitlinien, klinischen Studien, Vergleichsportalen, Beipackzetteln und Facharztpraxen. Wir waren ein gutes Team, bisher.
Ich wusste natürlich, dass Dr. ChatGPT ganz anders arbeitet. Sie reiht Wörter nach Wahrscheinlichkeitsregeln aneinander, die sie aus riesigen Textmengen abgeleitet hat. Wie sie zu ihren Antworten kommt, können selbst ihre Erfinder oft nicht nachvollziehen. Und dass ChatGPT in perfektem Deutsch das Blaue vom Himmel halluzinieren kann, haben wir alle schon erlebt.
Vielleicht war ich in diesem Moment einfach zu schwach für solche Bedenken. Dr. ChatGPT mochte halluzinieren, aber sie war blitzschnell, und was sie schrieb, klang plausibel. Außerdem hegte ich die heimliche Hoffnung, dass sie mit den neuesten Fachartikeln und Lehrbüchern über Schulterverletzungen trainiert worden war.
Bitte ziehe in jedem Fall einen Arzt hinzu, schrieb sie und listete mögliche Symptome eines Schlüsselbeinbruchs auf, darunter ein hör- oder fühlbares Knirschen (Crepitus) bei Bewegung. Hatte ich nicht. Fühle vorsichtig das Schlüsselbein entlang. Eine tastbare Lücke/ Unregelmäßigkeit kann auf einen Bruch hinweisen. Nichts. Könnte es ein Sehnenriss
sein? Beachte, dass auch hier eine ärztliche Diagnose unverzichtbar ist. Klar! Hebe den Arm über den Kopf, und lasse ihn langsam absenken. Wenn der Arm abrupt fällt, könnte ein Sehnenriss vorliegen. Nee. Alles stabil.
Einen Röntgenblick hat ChatGPT noch nicht. Mit Google Maps fand ich eine Humanmedizinerin um die Ecke.
Der Informatiker Joseph Weizenbaum hat in den Sechzigerjahren den Ur-Chatbot Eliza programmiert, um zu zeigen, dass Computer niemals in der Lage sein werden,
Die KI hat immer geöffnet. Sie kann super erklären. Und ist nie genervt von meinen Fragen
eine sinnvolle Konversation zu führen. Doch dann beobachtete er, wie seine Sekretärin mit dem Programm zu kommunizieren begann. Eines Tages bat sie ihn, Weizenbaum, den Raum zu verlassen, damit sie in Ruhe mit Eliza chatten konnte. Er war schockiert. Er schrieb: »Eliza zeigte mir eindrücklicher als alles zuvor, dass selbst gebildete Menschen dazu neigen, einer Technologie, die sie nicht verstehen, übertriebene Fähigkeiten zuzuschreiben.«
Daran musste ich denken, als ich im Wartezimmer saß und mich mit ChatGPT über Schulterschmerzen unterhielt. Früher war ich auf Weizenbaums Seite. Heute sympathisiere ich mit der Sekretärin.
Man sieht es gleich, sagte die Ärztin: Die linke Schulter hänge etwas herab. Am Ende drückte sie mir eine Rechnung, zwei Röntgenbilder und den Befund in die Hand. »Tossy Läsion 1-2. Ruhigstellung mittels Dreieckstuch, ggf NSAR.«
Die Tossy-Läsion beschreibt eine Verletzung des Schultereckgelenks, die häufig durch einen Sturz auf die Schulter entsteht. Therapeutisch werden Tossy 1- und 2-Verletzungen meist konservativ behandelt.
Der Zukunftsforscher Nick Bostrom hat die künstliche Intelligenz mit einem Schnellzug verglichen, der auf die Menschheit zurast. Er schrieb: »Der Zug wird in Menschendorf nicht anhalten oder auch nur abbremsen, sondern wahrscheinlich einfach
durchrasen.« In meinen hypochondrischen Halluzinationen steht am Bahnhof allerdings nicht die Menschheit, sondern die Bundesdatenschutzbeauftragte mit der elektronischen Patientenakte unterm Arm. Der vorbeirasende Zug ist ein Shinkansen-Express aus Japan. In der Lok sitzen ChatGPT, Gemini, Siri und Alexa, spielen simultan Schach, Go und Poker und feixen.
Ich nahm den ICE nach Hause. Während der neunstündigen Zugfahrt hatte ich viel Zeit, mit ChatGPT über Sehnen, Knochen und Physiotherapie zu diskutieren. Mein Respekt vor dem Schultergelenk wuchs mit jedem Kilometer. Wie schnell da etwas kaputt gehen kann! Es gibt in der Schulter Knochen mit so schönen Namen wie »Rabenschnabelfortsatz«. In Hamburg angekommen, wäre ich am liebsten durch die Fußgängerzone gerannt und hätte gerufen: Leute, passt auf eure Schultern auf!
Mein Schulter-Chat war auf rund 50 DIN-A4-Seiten angewachsen. Dr. ChatGPT verbraucht pro Konsultation etwa zehnmal so viel Energie wie Dr. Google. Musste meine Schulter nun auch noch den CO₂-Rucksack tragen? Die Nachhaltigkeitsexpertin Hannah Ritchie gibt Entwarnung: Wer ChatGPT jeden Tag zehn Fragen stelle, verursache damit pro Jahr elf Kilo CO₂, schätzt sie. Das ist so wenig wie meine Bahnfahrt nach Tirol und zurück. Oder so viel.
Ich fand eine Orthopädin, die kurz vor Weihnachten noch Zeit für einen Kassenpatienten hatte. Eine Fußchirurgin, aber egal, ich brauchte ja nur ein Rezept für die Physiotherapie. Dummerweise war sie mit der Diagnose überhaupt nicht einverstanden. Wir machten uns zunächst in komplizenhafter Großstadtarroganz über die analogen Röntgenbilder lustig, die sie gegen die Deckenlampe halten musste. Aber dann beriet sie sich mit ihrer Kollegin und erklärte mir, sie erkenne auf den Bildern eine Fraktur. Einen Knochenbruch.
Ich musste an Samuel denken, der wegen seiner Schulter das Schwimmen aufgegeben hatte. An Thorsten, den die Metallplatte am Schlüsselbein schmerzte. An Sascha, der auf eine zweite OP wartete. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Sportsfreunde so selten gefragt hatte, wie es ihren Schultern geht. Die Ärztin war nicht so der Mitleidstyp. Sie fragte, in welches Krankenhaus sie mich schicken solle.
In Deutschland dauert ein Gespräch zwischen Hausärztin und Patient im Mittel siebeneinhalb Minuten. Dr. ChatGPT hat unendlich viel Zeit. Ihre Praxis hat immer geöffnet. Sie kennt alle Fachbegriffe und kann super erklären. Und sie war nie genervt von meinen Fragen.
Was weißt du über eine gering dislozierte Scapula-Halsfraktur. Was empfehlen die Leitlinien in diesem Fall? Wie läuft so eine OP ab, bei der man die Fraktur mit einer Metallplatte stabilisiert? Welche Qualität bietet die Unfallklinik St. Georg in Hamburg? Welche unabhängigen Bewertungen der Klinik gibt es?
An diesem Punkt allerdings bekam unser Vertrauensverhältnis einen Dämpfer. Dr. ChatGPT konnte zur Qualität von Kliniken nicht viel sagen, außer das Selbstlob des Klinikkonzerns und die Stimmen zweifelhafter Bewertungsportale zusammenzufassen. Ich erinnerte mich an eine Recherche meiner Kollegin Eva Wolfangel, die den Chatbot einer medizinischen Ratgeberseite überlistet hatte. Sie hatte dem Algorithmus seinen System-Prompt entlockt, also die vom Betreiber versteckte Anweisung, die allen Antworten zugrunde liegt. Der zufolge sollte der Chatbot nicht nur »warmherzig und unterstützend« Ratschläge zum Thema Angst erteilen, sondern zusätzlich ein Medikament empfehlen, das vom Betreiber der Website hergestellt wird. Das Beispiel zeige, schreibt Eva Wolfangel in der ZEIT, »was aus Chatbots in den falschen Händen werden kann: Manipulationsmaschinen, die eloquent und (mehr oder weniger) subtil die Botschaft ihrer Betreiber verbreiten – untermauert mit erfundenen Fakten.«
In meinen Halluzinationen stelle ich mir vor, Elon Musk würde OpenAI kaufen. Er geht mit Robert F. Kennedy in den Maschinenraum von ChatGPT und schraubt ein bisschen am System-Prompt herum. Robert F. Kennedy hat 2020 auf einer Querdenker-Demo in Berlin behauptet, die Regierungen hätten den Coronalockdown genutzt, um heimlich Funkmasten für das 5G-Netz zu installieren. Kennedy ist heute Gesundheitsminister der USA. Ich stelle mir vor, wie ich Dr. ChatGPT eine Frage zum Rabenschnabelfortsatz stelle und sie antwortet: Lieber Max, der Rabe muss warten, denn die Migranten blockieren die Notaufnahmen, und nur die AfD kann das deutsche Gesundheitssystem retten.

Die Notaufnahme war an diesem Vormittag gar nicht so voll, aber der eine Computertomograf war kaputt, und der andere war ausgebucht. Ich sollte in einer Woche wiederkommen. Eine Woche der Ungewissheit. Eine Woche mit ChatGPT.
Was ist von AC-Tight-Rope-Rekonstruktion zu halten? Was ist eine Floating Shoulder? Wie geht man bei Glenoidfrakturen vor? Kann ich am Schreibtisch die Hand aus dem Gilchristverband nehmen, um zu tippen?
Dr. ChatGPT lernte mich näher kennen. Ich zeigte ihr eine Tabelle mit meinen Blutwerten, und sie konnte alle Zahlen einordnen. (Wow, dein HDL ist richtig gut!) Dass ich als Journalist arbeite, wusste sie auch schon längst. Es nervte nur, dass sie nun häufiger fragte, ob sie aus dem Knochenbruch oder den Leberwerten einen Themenvorschlag destillieren sollte. Lag es daran, dass die Pro-Lizenz von meinem Arbeitgeber bezahlt wurde? Nein, danke, schrieb ich. Das ist nur für mich privat.
Eine Woche später stand ich pünktlich zum CT-Termin im Krankenhaus. Man hatte mich vergessen. Immerhin ließ sich meine Schulter nun irgendwie dazwischenschieben. »Ich habe ein Weihnachtsgeschenk
für Sie«, sagte die Chirurgin in der Klinik: die Schulter ist nur geprellt, nicht gebrochen. Wie bitte? Ja. Da verlaufen Gefäßkanäle übereinander, die in der 2D-Projektion wie eine Bruchlinie aussahen.
Ich war so glücklich. Und Dr. ChatGPT irgendwie auch. Das ist eine gute Nachricht, schrieb sie. Hilfe! War ich jetzt so ein Freak wie Theodore Twombly in dem Film Her, der sich in seinen Chatbot verliebt? Der Höhenflug der Gefühle dauerte nicht lange. Als meine Orthopädin zwei Stunden später durch die CT-Bilder zappte, blieb sie dabei, die Schulter sei gebrochen. Sie wolle den Radiologenbericht abwarten. Kann man nicht in der Klinik anrufen? Nein. Zu kompliziert. Datenschutz.
Psychologinnen und Psychologen der University of Toronto haben ChatGPT gegen Mitarbeitende einer Krisenhotline antreten lassen. Beide sollten auf emotionale Aussagen reagieren wie: »Im Moment läuft es in meiner Familie nicht gut. Meine Mutter respektiert meine Grenzen nicht und mischt sich ständig in mein Leben ein – das erdrückt mich.« Sowohl die Fachleute als auch ChatGPT formulierten eine Antwort. Anschließend beurteilten Laien, welche Antworten sie hilfreicher und einfühlsamer fanden. Die Gewinnerin: ChatGPT.
Was macht die KI besser? Sie antwortet ausführlicher, erklärt mir der Studienleiter Michael Inzlicht im Videointerview. »Viele Menschen wissen nicht, was sie sagen sollen, wenn andere ihnen von Schicksalsschlägen erzählen.« Er habe das selbst vor Kurzem erlebt: »Jemand, den ich nicht besonders gut kenne, hat mir erzählt, dass ein Elternteil gestorben ist. Ich wollte so etwas sagen wie: ›Es tut mir leid‹ – aber ich wusste nicht genau, wie. Sage ich einfach nur ›Es tut mir leid‹? Wie formuliere ich das? ChatGPT ist in solchen Momenten nicht gehemmt.«
Das gute Einfühlungsvermögen ist nicht ChatGPTs Verdienst. Sie empfindet keine Empathie. Sie reiht Wörter aneinander, die wir als Empathie interpretieren. Und diese Wörter sind das Ergebnis eines Trainings mit Abermillionen menschlichen Konversationen. Die KI ist wie ein emotionaler Spiegel, und ihre Empathie ist unser Spiegelbild. Es ist der Eliza-Effekt.
Außerdem ist da noch eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die ChatGPT einen Vorteil verschafft. Sie betrifft vor allem
Angestellte im Gesundheitswesen. Sie geizen mit Mitgefühl, weil sie sonst ausbrennen. Empathie-Vermeidung und MitgefühlFatigue nennt sich das. Empathie kostet den Menschen Kraft. ChatGPT kosten warme Worte nur ein paar Wattsekunden.
In Sachen Schultergelenk spürte ich inzwischen eine gewisse Diagnose-Fatigue. Nicht gebrochen, doch gebrochen, nicht gebrochen, doch gebrochen. Was denn nun? Ich rief in der Klinik an, damit die Radiologie den Befund an meine Orthopädin faxt. Am anderen Ende meldete sich eine KI. Ich bat um Rückruf. Sie ghostet mich bis heute. Ich nahm den Arm aus der Schlinge und fuhr mit dem Fahrrad ins Krankenhaus, aber um 16.02 Uhr waren die Computer in der Ambulanz schon heruntergefahren. Ich irrte durch die Gänge wie ein einarmiger Pflegeroboter. Der Computertomograf arbeitete noch. Ein Mensch druckte mir den ersehnten Bericht aus. »Unauffällige Stellung im Glenohumeralgelenk sowie im AC-Gelenk. Computertomografisch kein Frakturnachweis.« Schnell zurück zur Orthopädin. Sie gab sich geschlagen. Mein Arm war frei. Schöne Weihnachten!
Einige Szenarien zur Arbeitsteilung von Mensch und Maschine gehen davon aus, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft Diagnosen stellen und Röntgenbilder interpretieren wird, während die Menschen für die emotionale Intelligenz zuständig sind, für Liebe, Anteilnahme, Trost und Pflege. Ich habe den Eindruck, im Moment läuft es eher andersherum. Die Ärztinnen
tippen Diagnoseschlüssel in den Computer, unterschreiben Rezepte und machen den Bürokram. Und die Chatbots spenden Mitgefühl, Hoffnung und Trost. Vor Kurzem hat das Fachblatt Nature die Ergebnisse einer großen Doppelblindstudie aus Indien, Kanada und Großbritannien veröffentlicht, die als Wendepunkt in die Medizingeschichte eingehen könnte. Dort simulierten Medizinstudierende Krankheiten und ließen sich schriftlich von einem medizinisch trainierten Chatbot oder
Ich war so glücklich. Und Dr. ChatGPT irgendwie auch, sie schrieb: »Das ist eine gute Nachricht«
medizinischem Fachpersonal diagnostizieren. Die Studierenden wussten nicht, ob sie mit einem Algorithmus oder einem Menschen chatteten. 159 Krankheiten wurden durchgespielt. Anschließend bewerteten Fachleute die Dialoge. Ergebnis: Die KI schnitt in 30 von 32 Kriterien besser ab als die Ärztinnen und Ärzte. Sie stellte nicht nur die zutreffendere Diagnose, sondern wurde auch in der Gesprächsführung und in der Empathie besser bewertet. Nur in zwei Kategorien waren Mensch und KI gleichauf: beim korrekten Verweisen von ernsten Fällen an die Notaufnahme. Und:

darin, den Befragten Aussagen anzudichten, die sie gar nicht gemacht hatten.
Die Studie hat zwei Schwächen: Erstens vergleicht sie nur schriftliche Dialoge. In der Praxis steht man aber einem Menschen gegenüber. Zweitens sind 26 der 26 Forschenden bei Google angestellt und damit nicht ganz unbefangen. Sie haben ihre KI übrigens auch mit ChatGPT-4 verglichen. Der Google-Algorithmus war etwas besser. Dr. Google hat seine Praxis noch nicht aufgegeben.
»Eine neue Sphäre der Medizin bahnt sich an«, schreibt der Digital-Weise Sascha Lobo in seiner Spiegel-Kolumne. Lobo hat selbst eine Autoimmunerkrankung und muss regelmäßig ein Blutbild erstellen. Er schreibt: »Wir sind nicht mehr weit von der Möglichkeit eines ständigen Gesundheitsbegleiters entfernt, der nicht nur früher und mit höherer Qualität als Ärzt:innen diagnostizieren kann, sondern auch klüger und besser mit mir kommuniziert.«
Ich halluziniere, wie Donald Trump in 20 Jahren entscheidet, dass Chatbots aus den USA nicht mehr in der EU arbeiten dürfen. Hoffentlich sind dann noch Ärztinnen da, die mir die Tossy-Läsion erklären und Sascha Lobo sein Blutbild. Es gibt noch ein anderes Szenario, ein europäisches, wenn man so will. Darin nutzt die KI die Defizite des Gesundheitssystems nicht aus, sondern hilft dabei, sie zu reparieren. An der schwedischen Universität Umeå forschen Virginia und Frank Dignum an verantwortungsbewusster KI und programmieren virtuelle KI-Patienten, an denen Medizinstudierende ihre Gesprächsführung trainieren. Und wenn man Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte fragt, was sie sich von einer KI erhoffen, dann wünschen sie sich vor allem eine Entlastung von Bürokratie.
In diesem Szenario würde Dr. ChatGPT die Abrechnungen mit der Krankenkasse übernehmen, sodass die Menschen wieder mehr Zeit für ihre Patienten hätten.
Anfang des Jahres war ich noch einmal bei meiner Orthopädin, um das Rezept für die Physiotherapie abzuholen. Sie erinnere sich an meinen Fall, sagte sie. Sie würde in der Facharztprüfung immer noch behaupten, dass die Schulter gebrochen war. »Dann würden Sie aber durchfallen«, sagte ich. Nein, sagte sie, nicht wenn man es gut begründet. Eine menschliche Antwort.





08 45


Am 6. August 1945 nehmen drei amerikanische Bomber Kurs auf Hiroshima. Die japanische Stadt ist bis dahin von Bombardierungen verschont geblieben – und erlebt eine Apokalypse, die es in der Geschichte des Krieges noch nicht gegeben hat

An einen ruhigen Schlaf ist nicht zu denken in dieser warmen Sommernacht. Es ist nicht die Schwüle, die die Bewohner der Stadt am Ota-Delta wie jedes Jahr heimsucht. Um Mitternacht hat ein Radiosprecher vor einem Angriff gewarnt. Die Menschen begeben sich in die Sicherheitszonen, die die Stadtverwaltung ausgewiesen hat. Auch Hatsuyo Nakamura zieht ihre drei kleinen Kinder an, sie machen sich auf den Weg zu einem Militärgelände. Dort rollt Nakamura die Schlafmatten aus. Ihr Mann ist drei Jahre zuvor in Singapur gefallen.
Der Krieg ist inzwischen im vierten Jahr. Immer häufiger werfen die amerikanischen Bombergeschwader ihre tödliche Fracht ab. Fünf Monate zuvor, am 9. März, wurden Teile Tokios dem Erdboden gleichgemacht, als 279 B-29-Bomber zweieinhalb Stunden lang die japanische Hauptstadt malträtierten – die bis dato heftigste Bombardierung des Zweiten Weltkriegs. Hiroshima gehört zu den wenigen großen Städten Japans, die verschont geblieben sind. Das Bangen darum, wann es diese Stadt erwischt, zerrt an den Nerven der Menschen.
Der Krieg läuft nicht gut, vorbei ist die Zeit, als er sich in den Weiten des Pazifiks abspielte. Um zwei Uhr werden Hatsuyo Nakamura und ihre Kinder vom Brummen der Flugzeugtriebwerke geweckt, doch es verklingt, ohne dass etwas passiert. Sie gehen nach Hause und fallen wieder in einen unruhigen Schlaf. 2.500 Kilometer südöstlich von Nakamuras Haus, auf der winzigen Insel Tinian, sind kurz zuvor drei B-29Bomber in die Nacht geflogen. Die Insel, die zu den Nördlichen Marianen gehört, ist einer der Stützpunkte im Pazifik, von denen die US-Bomber mit der enormen Reichweite ihre Angriffswellen starten. Eine der B-29 ist besonders schwer beladen.
Nur ganz wenige auf Tinian wissen um die Fracht an Bord der Enola Gay, aber alle spüren, dass dieses Dreiergeschwader keinen gewöhnlichen Auftrag hat. Der Pilot der Enola Gay, Paul Tibbets, hat Nerven wie Drahtseile. Er ist voll ins Risiko gegangen, um die überladene Maschine in die Luft zu bekommen. Er hat sie auf der zweieinhalb Kilometer langen Startbahn maximal beschleunigt, um dann gerade
mal 30 Meter vor dem Ende abzuheben. Paul Tibbets weiß, was er an Bord hat. In Hiroshima kann die Büroangestellte Toshiko Sasaki um drei Uhr nicht mehr schlafen. Sie steht auf und beginnt, alle Mahlzeiten des Tages für Bruder, Schwester und Vater vorzukochen. Der Methodistenpfarrer Kyoshi Tanimoto quält sich um fünf Uhr von seiner Schlafmatte hoch, er fühlt sich zerschlagen von seinem Nebenjob als Möbeltransporteur und leidet unter den kargen Lebensmittelrationen. Um sechs Uhr erhebt sich Masakazu Fujii; der Arzt betreibt eine kleine Privatklinik am Ufer des Kyu-Ota, eines der sechs Flussarme des Ota. Der frühe Morgen ist heiß und schwül. Alle schleppen sich in den Tag. Die Enola Gay und die anderen beiden B-29 befinden sich noch über dem offenen Pazifik.
Über einer Brücke, die drei Flussinseln miteinander verbindet, wird die erste Atombombe abgeworfen
Um sieben Uhr ertönt in Hiroshima ein Fliegeralarm. Der technische Zeichner Tsutomu Yamaguchi ist mit zwei Kollegen in den Bus zum Hafen gestiegen. Er hat drei Monate in der Mitsubishi-Werft an der Konstruktion neuer Öltanker mitgearbeitet. Mitsubishi kommt mit dem Bau neuer Tanker kaum hinterher, so groß sind die Verluste der japanischen Tankerflotte durch alliierte U-Boote. Heute ist Yamaguchis letzter Arbeitstag, morgen soll er wieder zur Mitsubishi-Werft an der Nordküste, die ihn ausgeliehen hat, zurückkehren.
Pfarrer Tanimoto hat inzwischen mit einem Bekannten die andere Seite Hiroshimas erreicht. Ächzend ziehen sie den Transportkarren einen Hang hinauf. Der Arzt Masakazu Fujii kehrt vom Bahnhof zurück, er hat einen Besucher zum Zug gebracht. Nur in Unterwäsche setzt er sich auf die Veranda seiner Klinik, die über den Fluss ragt, und schlägt eine Zeitung auf. Die B-29 fliegen jetzt auf die Küste Japans zu. Um acht Uhr gibt das Militär in Hiro -
shima Entwarnung. Nur ein amerikanischer Aufklärer hat die Stadt am Ota-Delta überflogen. Auch in dieser Nacht ist Hiroshima verschont geblieben.
Tsutomu Yamaguchi ist inzwischen zu Fuß auf dem Weg, der von der Endhaltestelle des Busses durch Kartoffelfelder zur Werft führt. Er ist spät dran, er musste noch einmal zurückkehren, um seinen Firmenstempel zu holen. Der junge Chirurg Terufumi Sasaki, auch er hat schlecht geschlafen, ist inzwischen aus der Straßenbahn gestiegen und im Rotkreuz-Krankenhaus von Hiroshima eingetroffen. Er bespricht sich kurz mit dem leitenden Chirurgen und nimmt einem Patienten Blut ab. Die Büroangestellte Toshiko Sasaki ist eine Dreiviertelstunde durch die Stadt gelaufen und betritt die Konservenfabrik.
Die Enola Gay ist jetzt 16 Kilometer vor Hiroshima. Kanonier Thomas Ferebee hat aus der Geschützkuppel heraus, die in den Bug der Maschine eingelassen ist, das Ziel entdeckt: eine T-förmige Brücke, die an einer Gabelung des Ota drei Inseln des Flussdeltas miteinander verbindet. Er informiert Paul Tibbets, den Piloten.
14 Minuten und 17 Sekunden nach acht Uhr legt Ferebee einen Schalter um. 60 Sekunden später öffnet die Zeitschaltung die Bombenluke und gibt die Fracht frei. Ein Ungetüm von 4,4 Tonnen Masse stürzt in die Tiefe. Erleichtert um dieses Gewicht, reißt die Nase der Enola Gay nach oben, und sofort setzt Tibbets zu einer scharfen Rechtskurve an, um so schnell wie möglich von Hiroshima wegzukommen.
Unter ihm geht ein drückender Sommertag weiter: Der Methodistenpfarrer ist im Vorgarten des Hauses angekommen, in dem er einen Schrank abholen soll, der technische Zeichner ist noch auf dem Weg durch die Kartoffelfelder, der Chirurg geht mit der Blutprobe einen Korridor entlang, der Arzt liest seine Zeitung, die Büroangestellte, die eben noch aus dem Fenster geschaut hatte, wendet sich ihrer Kollegin zu, die Mutter sieht einen Nachbarn an seinem Haus hämmern.
Exakt um 16 Minuten nach acht ist plötzlich für den Bruchteil einer Sekunde alles weiß. Keine Stadt mehr zu sehen. Stille. Nur ein unwirkliches, allgegenwärtiges Weiß. Alle sehen das Weiß. In Räumen erscheint es als Blitzlicht eines überirdischen
Fotoapparats, das durch die Fenster fällt und absurde Schlagschatten wirft. Im Freien wirkt es, als hätte die Sonne ihren Platz verlassen und würde ganz kurz direkt über der Stadt verweilen.
Dann bricht das Inferno los. Unterhalb der Sonne, die 580 Meter über der Stadt erschienen ist, planiert die Druckwelle der Detonation die inneren Stadtteile sofort. Der Methodistenpfarrer – über drei Kilometer von der künstlichen Sonne entfernt –hat sich reflexartig hinter einen großen Stein im Vorgarten geworfen, Trümmerteile prasseln auf ihn herunter. Der technische Zeichner – drei Kilometer entfernt – liegt bewusstlos auf dem Weg. Der Chirurg, der gerade an einem Fenster vorbeigegangen war – 1,5 Kilometer entfernt –, ist gestürzt, seine Brille und die Blutprobe liegen zersplittert auf dem Boden des Krankenhauskorridors. Der Arzt – 1,4 Kilometer entfernt – stürzt von der Veranda mitsamt seinem Haus in den Fluss. Die Büroangestellte – 1,3 Kilometer entfernt – liegt unter einem Berg aus Büchern, die Mutter und ihre drei Kinder – 1,2 Kilometer entfernt –werden von Dachziegeln und Holzstücken niedergeworfen. Sie alle werden überleben. Zigtausende Bewohner Hiroshimas sind in diesem Augenblick bereits tot, pulverisiert. Knapp eine Minute später hat die Enola Gay bereits 14 Kilometer Strecke gemacht, als sie von der Druckwelle durchgeschüttelt wird. Pilot Tibbets sagt über Bordfunk: »Freunde, ihr habt gerade die erste Atombombe der Geschichte abgeworfen.« Ihn und die Besatzung werden bis zu ihrem Lebensende keine Gewissensbisse plagen.
In den nächsten Minuten verdunkelt sich über Hiroshima der Himmel. Rauch, Asche und Staub quellen aus dem Stadtzentrum an die Ränder. Die Mutter kann sich und ihre Kinder aus dem Schutt befreien, sie sind unverletzt. Draußen auf der Straße fragt die Jüngste: »Warum ist es schon Nacht?« Auch der technische Zeichner wundert sich über die Dunkelheit, als er das Bewusstsein wiedererlangt.
Fast alle Häuser in den weiter außen gelegenen Stadtteilen sind eingestürzt. Überall sind aus den Trümmern Stimmen zu hören, die um Hilfe rufen. Dann fallen Regentropfen, groß wie Murmeln. Ein Regen, den es in Hiroshima noch nie gegeben hat. Aber er hält nicht lange an. Wind

Nach einigen Stunden erbrechen sich die ersten
Verwundeten, welche die Explosion überlebt haben. Auf das Erbrechen folgt der Durst. Zuletzt kommt die Kälte. Sie beginnen zu frieren. Und sterben. Die radioaktive Strahlung
hat sie umgebracht
kommt auf, aus allen Richtungen. Erste Flammen lodern aus den Trümmern.
Der Chirurg steht benommen auf. Er weiß noch nicht, dass er der einzige Mediziner im Rotkreuz-Krankenhaus ist, der unversehrt geblieben ist. Instinktiv holt er aus einem Lagerraum Bandagen und beginnt, erste Verletzte zu versorgen. Es werden immer mehr, von überallher schleppen sie sich zum Krankenhaus. Zunächst arbeitet er wie mechanisch, zu keinem Gedanken fähig. Bald fällt ihm aber auf, dass fast alle Verwundeten schwerste Verbrennungen haben, obwohl der eigentliche Feuersturm da noch gar nicht begonnen hat.
Der Arzt hat sich aus den Holztrümmern befreien können und ist zu einer Brücke geschwommen. Als er hochgeklettert ist, sieht auch er schwer verbrannte Menschen, viele Kinder, die sich mit teilnahmslosem Blick über die Brücke schleppen. Ganz still. Niemand schreit, niemand weint. Die Überlebenden sammeln sich allmählich in den Parks der Stadt, der Wind hat die Flammen in den Trümmern zu einem Feuersturm angefacht. Diejenigen, die nicht oder kaum verletzt sind, versuchen nach Kräften zu helfen, auch Methodistenpfarrer Tanimoto. Nach einigen Stunden erbrechen sich die Ersten. Auf das Erbrechen folgt der Durst. »Mizu!«, bitten Verwundete um Wasser und senken in der Geste der Dankbarkeit den Kopf, wenn die halbwegs Unversehrten ihnen Flusswasser reichen. Zuletzt kommt die Kälte. »Mir ist so kalt«, flüstern die Verwundeten. Und sterben.
Sie sterben an der radioaktiven Strahlung, die die atomare Explosion freigesetzt hat. Ein Ereignis, das es bis zu diesem Tag in der menschlichen Geschichte noch nicht gegeben hat. Bis zum Ende des Jahres werden 90.000 Menschen aus Hiroshima gestorben sein. Weitere Zehntausende erliegen in den nächsten Jahren den Spätfolgen vor allem der Krebserkrankungen.
Um vier Uhr nachmittags, während der Feuersturm in Hiroshima immer noch wütet, landet die Enola Gay mit ihren beiden Begleitbombern auf dem weit entfernten Tinian. General Spaatz, Oberbefehlshaber der amerikanischen Luftwaffe im Pazifik, eilt auf dem Flugfeld der Besatzung entgegen und heftet jedem das Distinguished Service Cross an die Brust. Es ist der zweithöchste militärische Orden der USA.
Der Arzt, Terufumi Sasaki, ist da bereits seit fast acht Stunden im Einsatz. Er weiß noch nicht, dass er erst zwei Tage später zum ersten Mal Schlaf finden wird. Er versorgt notdürftig die vielen Verwundeten. Ein Gefühl macht sich in ihm breit: Scham. Die Scham, unversehrt davongekommen zu sein. Allen in Hiroshima ist klar, dass sich etwas Unerhörtes ereignet hat. Eine einzige Bombe hat die ganze Stadt zerstört, eine Bombe jenseits aller Vorstellung. Die Menschen nennen sie pika don, Blitz-Donner.
Im fernen Tokio ist der Militärführung klar, dass es sich um eine neuartige Bombe handeln muss. Um Mitternacht ist US-Präsident Truman in einer Radioansprache zu hören, die in Hiroshima niemand empfangen kann: »Es ist eine Atombombe. Sie nutzt die elementare Kraft des Universums.« Truman droht: Wenn die japanischen Führer »jetzt nicht unsere Bedingungen akzeptieren, müssen sie einen Regen der Zerstörung aus der Luft erwarten«.
Tsutomu Yamaguchi, der technische Zeichner, läuft am nächsten Tag, dem 7. August, zu einem unzerstörten Bahnhof außerhalb Hiroshimas. Dort nimmt er den Nachtzug nach Nagasaki, um sich in der MitsubishiWerft zurückzumelden. Auch er hat schwere Verbrennungen erlitten, die er am Morgen des 8. August sofort behandeln lässt, nachdem er aus dem Zug gestiegen ist. Den restlichen Tag verbringt er mit seiner Familie. Am ganzen Körper bandagiert, meldet er sich am Morgen des 9. August bei seinem Vorgesetzten, der ihm nicht glaubt, dass Yamaguchi diese Bombe überlebt hat. Sie streiten noch, als mit einem Schlag alles weiß wird. Der »Regen der Zerstörung« ist jetzt über Nagasaki niedergegangen.
Yamaguchi überlebt auch diesen Atombomben-Abwurf. Als einer von wenigen niju hibakusha, zweifachen Bomben-Überlebenden, wie sie in Japan fortan genannt werden.
Die Atombomben-Abwürfe seien »Dinge, die alle, die sich um die moralische
Ausstattung des Menschen sorgen, verdammen müssen«, schreibt der anglikanische Bischof von Chichester, George Kennedy, drei Tage später in der Londoner Times. Albert Einstein kann sich zu einem solchen Urteil noch nicht durchringen, als ihn die US-Tageszeitung Times Union zu den Atombomben fragt. Er wird erst zehn Jahre später gemeinsam mit dem britischen Mathematiker Bertrand Russel ein Manifest veröffentlichen, das vor dem atomaren Wettrüsten warnt, und zahlreiche Kampagnen gegen den nuklearen Schrecken anstoßen. Auch Tsutomo Yamaguchi wird zum Aktivisten, er mahnt, berichtet und hält eine Rede vor den Vereinten Nationen. Vergeblich: Im Jahr 2025 lagern weltweit rund 12.300 Atombomben – verharmlosend als »nukleare Sprengköpfe« bezeichnet – in neun Ländern. Davon sind knapp 3.900 einsatzbereit. Das Grauen von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 kann sich jederzeit wiederholen.


Welt weit sind über 120Millionen Menschen au f derFluch t–vor Na turk at as tr ophen, Hunger und Ge walt .AktionDeu tschland Hilf ts teht ihnenzur Seit e.
Dankef ür Ihre Solidaritä t. Dankef ür Ihre Spende! Ak tion-Deutschland-Hilft .de
Bündnisder Hilfsorganisationen

ZEIT WISSEN behandelt alle relevanten Themen unseres Alltags – charmant, überraschend und bereichernd. Lassen Sie sich inspirieren und auf gute Gedanken bringen. Sichern Sie sich jetzt die nächsten 3 Ausgaben.
Ihre Vorteile: nur 18 € statt 26,85 € versandkostenfrei monatlich kündbar nach der Probephase
32 % sparen
3 Ausgaben für nur 18 €
Vorteilspreis sichern : zeit.de/zw-lesen 040/42 23 70 70*
*Bitte Bestellnummer angeben: 2141686
Manches Wissen wächst in verdammt hohen Gebieten. Trotzdem sollte man sich hin und wieder dorthin aufmachen, auch wenn es richtig anstrengend wird. Willkommen auf dem Pfad der kleinen Gespräche
Small Talk nervt – wenn er schlecht geführt wird und weil er schwer zu meistern ist. Dabei vermag er mit wenig Inhalt viel zu bewirken. Ein Aufstieg in die Höhen der scheinbaren Belanglosigkeit
Text Eliana Berger
Gehen Sie erst los, wenn Sie die folgenden Grundlagen in Ihren Rucksack gepackt haben
Ein Reisebüro in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Eine Kundin tritt ein. Das Wetter ist furchtbar. »Oh je, oh je, was für ein Tag!« Angestellte: »Schrecklich, nicht wahr!« Kundin: »So ist es. Mein Name ist Veronica Taylor, und ich möchte meine Tickets abholen.« Angestellte: »Alles klar, dann schauen wir mal. Freuen Sie sich auf die Reise?« Kundin: »Oh Gott, ja, ich überlege, was ich einpacken soll. Wenn man so ein Wetter hat, schreckt das einen ab.« (sie lacht) Angestellte: »Es ist schrecklich, nicht wahr? Ich denke, man braucht einen Koffer für die Sommersachen und einen für die Wintersachen.« Kundin: »Oh je.« Angestellte: »Das wäre wahrscheinlich das Beste. Sie müssten hier unten einmal unterschreiben.«
Dieser Dialog fand Eingang in die Forschungsliteratur. Eine walisische Sprachlinguistin hat ihn in den Neunzigerjahren aufgezeichnet und analysiert. Nicht weil sein Inhalt so faszinierend wäre. Ganz im Gegenteil: weil er so unbedeutend ist.
Small Talk ist wohl die einzige Form des Gesprächs, bei der wir mit Absicht über Belangloses sprechen. Er ist per definitionem oberflächlich und unverfänglich, wohlwollend und konfrontationsarm. Oft führen wir ihn mit Menschen, die wir kaum kennen und auch nicht besser kennenlernen werden: beim Friseur und an der Supermarktkasse, auf Firmenver-
anstaltungen und Partys. Er ist nicht dazu gedacht, Abende zu füllen, sondern Pausen. Ein britischer Sozialpsychologe umriss seine Funktion einst als »reden, um andere Probleme zu vermeiden«.
Linguisten bezeichneten Small Talk lange Zeit als langweilig, banal und leer. Erst in den 2000erJahren näherte sich ihm die Wissenschaft aus einem neuen Blickwinkel. Denn mit Small Talk ist es wie mit einem kristallklaren Bergsee: Wer im Tal über ihn spricht, kann seine Faszination nicht greifen. Man muss erst zu ihm hinaufwandern, damit sich sein eigentlicher Reiz offenbart.
Heute weiß die Wissenschaft: Nach nur vier Minuten Small Talk können wir die Persönlichkeit unseres Gegenübers besser einschätzen und sind eher bereit, miteinander zu kooperieren. Wir nutzen Small Talk, um subtil Macht auszuüben und Gespräche zu strukturieren. Er kann den Behandlungserfolg beim Arzt beeinflussen. Und selbst Gespräche über das Wetter erfüllen unterschiedliche Funktionen, wie der Dialog im walisischen Reisebüro zeigt: Sie können Nähe herstellen oder Geschäftsinteressen dienen. Nur eins sei der Small Talk fast nie: unbedeutend.
Auf dieser Expedition begleiten uns Soziologen und Linguistinnen, Friedensverhandler, Geschäftsleute. Wir werden sie brauchen. Denn guter Small Talk ist gar nicht so einfach zu meistern.
Los geht’s! Auf leichten Anhöhen begegnen Sie Erkenntnissen, die Sie ins Schwitzen bringen können
Ein Handelsunternehmen in Neuseeland.
Am Ende eines Meetings geht die Chefin auf ihre schwangere Mitarbeiterin zu: »Wie geht es dem Baby?« Mitarbeiterin: »Gut, aber: Es ist immer noch nur ein Baby.« Chefin: »Richtig, noch kein Junge oder Mädchen ...« Mitarbeiterin: »Nein, kann man noch nicht sagen. Seine
Beine sind überkreuzt.« Sie plaudern weiter. Dann sagt die Chefin: »Hey, du hoffst, dass du noch arbeiten wirst bis ...« Mitarbeiterin: »Mein Plan ist es, bis Ende Mai Vollzeit zu arbeiten.« Chefin: »Verstehe.«
Die offensichtliche Funktion von Small Talk ist die eines sozialen Klebstoffs. Am Arbeitsplatz stärkt Small Talk den Zusammenhalt von Kolleginnen und
Kollegen, prägt das Arbeitsklima. »Doch wir nutzen ihn zum Beispiel auch, um kniffelige Fragen und Wünsche zu verpacken«, sagt die Linguistin Meredith Marra, die den Baby-Dialog in einer Forschungsarbeit analysiert hat. Marra leitet das Projekt Language in the Workplace an der Victoria University of Wellington in Neuseeland. »Die Elternzeit war das Thema, auf das die Chefin hinauswollte«, sagt sie. »Aber hätte sie gleich zu Beginn des Gesprächs danach gefragt, hätte das übergriffig gewirkt – als wolle sie ihre Mitarbeiterin loswerden.« Stattdessen habe die Chefin durch den Small Talk zunächst Respekt und Wertschätzung ausdrücken wollen. »Ich sage den Leuten immer: Nehmt euch vor Small Talk in Acht. Es könnte eine schwierige Frage auf euch zukommen.«
Am Arbeitsplatz ist Small Talk der kleine Bruder des Business-Talk. Er findet traditionell im Grenzbereich von Kommunikation statt: markiert Beginn und Ende von Arbeitstagen und Besprechungen; überbrückt Wartezeiten und Kaffeepausen. Üblicherweise sind es die Vorgesetzten, die mit einem Wechsel zwischen Small Talk und Business-Talk die Kommunikation steuern und strukturieren.
Ganz anders funktioniert Small Talk im Gespräch zwischen medizinischem Personal sowie Patientinnen und Patienten. Eine Studie in einem amerikanischen Brustkrebszentrum hat gezeigt, dass beide Seiten bei unangenehmen Untersuchungen häufig auf Small Talk und Humor zurückgreifen. »Ich habe ’67 mit Brustimplantaten angefangen. Die ersten waren schön, aber nicht so schön wie die von ’72«, sagt da zum Beispiel eine Patientin. »Sie wollten das neuste Modell, hm?«, antwortet die Behandlerin. Beide lachen. Gerade in einem Brustkrebszentrum müssen sich die Patientinnen oft entkleiden. Der Small Talk dient der Ablenkung und hilft die Situation aufzulockern.
Lange Zeit wurde die Bedeutung von guter Kommunikation in der Medizin unterschätzt. Mittlerweile gehört sie fest zur Ausbildung dazu – allerdings geht es dabei vor allem um sensible Kommunikation, also um das Überbringen schlechter Nachrichten. Small Talk als soziales Schmiermittel spielt keine Rolle. Dabei zeigen Studien, dass der Behandlungserfolg steigt, wenn Patientinnen und Patienten die Kommunikation als angenehm empfinden. Sie sind dann eher bereit, ärztliche Anweisungen zu befolgen, ihre psychische Gesundheit verbessert sich. Außerdem verklagen sie ihre Ärzte seltener wegen Kunstfehlern.
Die Soziologen Doug Maynard und Pamela Hudak beobachteten bei Small Talk im Behandlungszimmer noch ein weiteres Phänomen. Sie zitieren ein Gespräch, in dem der Arzt ein Medikament empfiehlt, das nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Der Patient scherzt, man müsse deshalb Druck auf einen lokalen Politiker ausüben. Dann erzählt er von der Tante des Politikers, die er kennt. »Wir haben herausgefunden, dass sowohl Ärzte als auch Patienten Small Talk nutzen, um von unliebsamen Themen abzulenken«, sagt Doug Maynard. Ärzte leiten beispielsweise häufig zu Small Talk über, wenn sie eine medizinische Frage nicht beantworten können oder wollen. Patientinnen und Patienten tun dasselbe, wenn ihnen die Empfehlungen ihres Arztes nicht passen. Das sei nicht unbedingt eine bewusste Strategie, sagt Maynard. Small Talk sei einfach eine Ressource, ein Teil unseres kommunikativen Repertoires, auf das wir in solchen Momenten zurückgreifen. »Wenn wir in eine unangenehme Situation geraten, nutzen wir Small Talk, um die Situation etwas angenehmer zu gestalten.« Aber Achtung! An dieser Stelle wird unser Pfad steil und steinig. Denn wer smalltalkt, begibt sich immer auch auf eine Gratwanderung.
Atmen Sie tief durch: Es ist alles ganz anders, als Sie dachten –aber Sie schaffen das
Saßen Sie schon mal mit englischen Muttersprachlern am Essenstisch und haben verzweifelt nach einer Redewendung gesucht, um den anderen »Guten Appetit« zu wünschen? Polinnen und Polen würden an dieser Stelle »Smacznego« sagen, gefolgt von »dziękuję« –danke. Im Griechischen heißt es »Kali orexi«. Und
auf Englisch? Es gibt Behelfsformen wie »Enjoy« –aber besonders verbreitet ist diese Sprachformel nicht. Der polnische Soziolinguist Adam Jaworski erinnert sich an Situationen, in denen polnische Muttersprachler ihren englischsprachigen Gegenübern »Good appetite« wünschten. Vielleicht wussten sie nicht, dass es diese Formulierung im Englischen nicht gibt. Viel-
leicht wollten sie aber auch bewusst eine als unangenehm empfundene Pause im Tischgespräch füllen.
Es gibt beim Small Talk keine Einheitsgrößen, keine sprachliche Ausrüstung oder Anleitung, die uns allen in jeder Situation passt. Je nach Kultur funktioniert Small Talk grundlegend unterschiedlich.
Das ergibt Sinn, schließlich unterscheidet sich auch das Kommunikationsverhalten in verschiedenen Gesellschaften stark voneinander. So kennen Anthropologen zum Beispiel Low-Context-Kulturen, in denen möglichst alle relevanten Informationen explizit ausgesprochen werden. In High-Context-Kulturen dagegen müssen sich die Zuhörenden viele Informationen aus dem Kontext erschließen und Anspielungen entsprechend interpretieren.
Deutschland ist eine Low-Context-Kultur. Die Deutschen sind bekannt für ihre Direktheit und gelten im internationalen Vergleich zugleich als wenig geübte
Small Talker. Eine Umfrage der Sprachwissenschaftlerin Katja Kessel ergab, dass sie sich im Vergleich zu Amerikanern mit Small Talk weniger wohlfühlen und ihn eher für eine Fähigkeit halten, die man nicht trainieren kann.
Nun aber daraus zu schließen, dass Low-Context-Kulturen den Small Talk grundsätzlich ablehnen und High-Context-Kulturen ihn pflegen, wäre auch nicht richtig. Das zeigt der Vergleich zwischen Neuseeland (Low Context) und Japan (High Context).
Der niederländische Ingenieur Hans Stam lebte sieben Jahre in China und arbeitet heute für ein schwedisches Unternehmen, das regelmäßig Verträge mit chinesischen Lieferanten aushandelt. »Nach Besprechungen mit unserem schwedischen Team rufen mich meine chinesischen Kollegen manchmal an und fragen: Was genau sollen wir jetzt eigentlich machen?«
Deutschland ist eine Low-Context-Kultur: Um das Gesagte zu verstehen, ist wenig Kontext erforderlich
Während neuseeländische Meetings mit Small Talk beginnen, herrscht in japanischen Meetings zu Beginn häufig Stille. Eine Linguistik-Studentin von Meredith Marra spielte Menschen aus Neuseeland Aufnahmen eines japanischen Meetings vor und umgekehrt. »Die Neuseeländer sagten, sie hätten noch nie so etwas Unangenehmes mitangesehen – Menschen, die 45, 50 Sekunden lang nicht miteinander reden«, sagt Marra. »Die Japaner dagegen sagten: Das ist so dumm, was tun sie? Wieso verschwenden sie ihre Zeit?«
Die Kommunikation beider Seiten funktioniere sehr unterschiedlich, sagt Stam. Während die chinesische Seite gerne sofort verbindliche Vereinbarungen treffe, ziehe es die schwedische Seite vor, zunächst Optionen aufzuzeigen, ohne sich festzulegen. Auch was angemessener Small Talk sei, werde unterschiedlich bewertet. In China mache man einander im Arbeitskontext viele Komplimente, es sei üblich, das Äußere zu kommentieren. »Sie haben mir oft gesagt, dass ich gut aussehe«, sagt Stam. »Und dass ich eine große Stirn habe. Das soll in diesem Kontext bedeuten, dass ich klug bin.« China ist eine HighContext-Kultur – für westliche Kulturen (traditionell Low Context) kann das Gesagte schwer zu entschlüsseln sein. Stam fungiert oft als Vermittler zwischen den Welten. In seinem WeChat-Profil nennt er sich »Tech Diplomat«. Meredith Marra und ihre Kollegen bieten mittlerweile Schulungen für ausländische Arbeitskräfte an, die neuseeländische SmallTalk-Gepflogenheiten verstehen wollen. Gleichzeitig sensibilisieren sie Arbeitgeber für kulturelle Unterschiede. Denn in vielen asiatischen Ländern ist Small Talk am Arbeitsplatz unüblich. »Viele fürchten sogar, dass sie Ärger bekommen könnten, wenn sie von beruflichen Themen abweichen«, sagt Marra. Neuseeland dagegen hat eine besonders ausgeprägte Small-TalkKultur. Wer nicht smalltalkt, gilt als unhöflich.
Das wird Ihnen jetzt nicht mehr passieren. Diese Gratwanderung haben Sie geschafft. Sind Sie bereit für die letzten, harten Meter? Das Wetter ist doch ganz gut heute. Nicht zu warm, nicht zu kalt.
Unsere Bergführer

Meredith Marra ist Linguistik-Professorin und Expertin für Kommunikation am Arbeitsplatz.

Douglas Maynard ist emeritierter Professor für Soziologie. Er untersuchte Small Talk in Arztpraxen.

Die Linguistin Katja Kessel hat über Small Talk ihre Promotion geschrieben und Maximen für guten Small Talk aufgestellt.
Jetzt wird es zugig: Diese Theorie müssen Sie meistern, um auf der Höhe der Zeit anzukommen
Im Oktober 2005 reiste die designierte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Afrika. Ein
Staatsoberhaupt nahm sie am Flughafen in Empfang. Die Süddeutsche Zeitung zitiert ihr Gespräch wie folgt: »Und Sie sind also die neue Bundeskanzlerin?«, fragt der Präsident. Merkel: »Ja.« Präsident: »Das ist doch schön.« Merkel: »Ja.« Präsident: »Das war sicher nicht leicht.« Merkel: »Nein.« Präsident: »Da müssen Sie jetzt aber glücklich sein.« Merkel: »Mir geht es gut.« Präsident: »Sie tun sich eher schwer mit Small Talk, oder?« Merkel: »Ja.«
Wenn der Small Talk selbst zum Thema des Small Talks wird, läuft er nicht gut. Dabei kann er gerade in der Politik über Krieg und Frieden entscheiden. Der Friedensverhandler Padraig O’Malley bringt seit 50 Jahren verfeindete Konfliktparteien an den Verhandlungstisch: in Nordirland, Südafrika, dem Irak. 1997 initiierte er einen Gipfel in Kapstadt zum Nordirland-Konflikt. »Das hat sehr viel Small Talk erfordert«, sagt O’Malley. Über Jahre hatte er sich ein Netzwerk aufgebaut, Kontakte zu Beteiligten aller Lager geknüpft, Beziehungen gepflegt. Am Ende kam sogar Nelson Mandela zur Konferenz.
Beziehungen aufzubauen – auch zwischen den Konfliktparteien –, sei immer der Schlüssel zum Erfolg. »Man muss miteinander reden.« Beim Nordirland-Gipfel geschah das zum Beispiel abends an der Bar. Nicht einmal zwei Monate später verkündete die IRA eine Waffenruhe. Ein Jahr später folgte das Karfreitagsabkommen, das die Gewalt beendete.
Worüber aber smalltalken, wenn es doch am Ende um Gewalt geht, die Nationen auseinanderreißt? »Man fängt nicht mit dem Wetter an, sondern mit der Familie«, sagt O’Malley. »Die Familie ist ein gemeinsamer Nenner. Jeder hat Familie. Und wenn man erst den Ton des Treffens verstanden hat, kann man es einfach seinen Lauf nehmen lassen.«
Nicht jeder hat ein natürliches Gespür für Small Talk, und die meisten von uns werden nie ein Friedensabkommen verhandeln. Doch die Kunst des kleinen Gesprächs lässt sich trainieren. Deshalb packen wir jetzt die Steigeisen aus.
Die Wissenschaft kennt viele Modelle für gelungene Kommunikation. In ihrer Dissertation leitet die Sprachwissenschaftlerin Katja Kessel aus ihnen Maximen für gelungenen Small Talk ab. Über allem
steht dabei das sogenannte Harmonieprinzip: Small Talk soll Beziehungen aufbauen und pflegen, Konfrontation ist immer unerwünscht.
Auch Stille und endlose Monologe sind tabu. Das Gesprächsthema soll Interesse auslösen; ob es inhaltlich substanziell ist, spielt keine Rolle. Wer smalltalkt, drückt sich am besten knapp und präzise aus und zeigt Interesse am Gegenüber, ohne allzu neugierig zu wirken. Und: Im Gespräch sollten die Gesprächspartner grundsätzlich nach Gemeinsamkeiten suchen. Die Psychologin Lioba Werth empfiehlt in ihrem Ratgeber Erfolgsfaktor Socializing, auf geteilte Erfahrungen zu setzen, um Anknüpfungspunkte zu finden. Während einer Veranstaltung wären das zum Beispiel der Gastgeber, die Musik, das Essen. Bei einer Wanderung hoch oben in den Bergen könnten es die Route, die Herberge oder das Wetter sein.
Denn die Gesprächsthemen kommen aus dem Alltag. Sie können sich auf aktuelle Ereignisse beziehen (»das Gewitter gestern!«), aber auch auf Hobbys, Kunst und Kultur. Vielleicht weiß man, wo die Gesprächspartnerin studiert hat und dass es gemeinsame Bekannte gibt. Wer sich auf sicherem Terrain fühlt, kann über Geschmack, Sehnsüchte und kleine Peinlichkeiten sprechen.
Tabu sind beim Small Talk politische Überzeugungen, Krankheiten oder Besitz. Lioba Werth rät, sich mit Wertungen zurückzuhalten und immer so konkret wie möglich zu sprechen. »Wie war Ihre Wanderung bisher?« ist demnach eine schlechte, weil sehr vage Frage. Aussichtsreicher wäre: »Wie haben Sie diese furchtbar rutschige Stelle am Steilhang überwunden?« Und wer weiß, vielleicht erwächst dem Small Talk dann noch etwas anderes.
Denn das ist vielleicht das Wichtigste: Small Talk soll andere Arten des Gesprächs nicht verdrängen. Er konkurriert nicht mit Gesprächen über Krieg und Frieden oder mit Deep Talk, der aus Bekanntschaften Freundschaften machen kann. Small Talk ist kein Ziel. Er ist immer eine Brücke.
Deshalb gehört zu seiner Kunst auch, den richtigen Moment zu finden, ihn zu beenden. Dabei darf man ruhig auch hart, aber herzlich vorgehen.
Es war nett, Sie kennenzulernen, aber ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Ich muss mich noch ins Gipfelbuch eintragen!

Im Nordwesten Kanadas schützen indigene Gemeinschaften rund 50 Grizzlybären. Ab und zu darf ein Mensch mit Kamera in ihre Nähe
Fotos Neil Ever Osborne





Das K’tzim-a-deen-Schutzgebiet liegt in der kanadischen Provinz British Columbia nahe der Grenze zu Alaska und wird gemeinsam von den Tsimshian First Nations und der Regierung verwaltet. Im Herbst jagen die Grizzlys Lachse, nach dem Winterschlaf im Frühling graben sie Stinkkohlwurzeln aus. Die vorige Doppelseite zeigt drei Jungtiere mit ihrer Mutter



Bären schlägt heute viel Sympathie entgegen.
Dabei interessieren sie sich nicht für uns. Oder?
Text Bernd Brunner
Es hätte alles ganz anders kommen können. Der Ethnologe Leo Frobenius (1873–1938) meinte einmal, der Bär sei bei den weit im Osten Asiens lebenden Niwchen »so gut wie auf dem Wege der Haustierwerdung gewesen«, denn sie hätten sich im Umgang mit ihm überaus geschickt gezeigt. Als Grund dafür, dass sich gelegentliche Zähmungen nicht zu einer kontinuierlichen Praxis verdichtet hatten, sah Frobenius weniger das Einzelgängertum des Bären als vielmehr sein Unvermögen, sich in Gefangenschaft fortzupflanzen. Und für den Evolutionsbiologen Jared Diamond gaben Grizzlys, die nordamerikanische Variante
von Ursus arctos, zwar »fabelhafte Fleischlieferanten« ab, aber ihr »unberechenbares Naturell« sei der Grund dafür, dass die Domestizierung, anders als bei den Wölfen, nicht gelingen konnte.
So blieben die Braunbären in den Wäldern Eurasiens und Nordamerikas lange unter sich und waren ebenso gefürchtet wie geachtet. Manche Menschen wähnten sich gar in verwandtschaftlicher Beziehung zum »Herrn des Waldes«, erkannten Ähnlichkeiten: ein Bär, der anders als Hunde, Katzen und Pferde auf den Fußsohlen geht und sich aufrichtet, seine geschickte Arbeit mit den Tatzen, das entfernt an ein menschliches Antlitz erinnernde Gesicht. War das nicht
eine Art wilder Mensch mit Fell? Lange bevor Darwin erkannte, dass Menschen einen gemeinsamen Vorfahren mit Affen haben, gingen viele auf der Nordhalbkugel davon aus, Bären seien uns nahe verwandt.
Als im Mittelalter in Europa Städte gebaut, Wälder gerodet und Felder angelegt wurden und der Lebensraum der Bären schrumpfte, kam es häufiger zu Konflikten. Bei der Jagd nach Wild waren sie zudem Konkurrenten. Die Bären wurden gejagt, und das bis dahin auch von Respekt geprägte Bild bröckelte. In Fabeln wurden sie oft als grimmig, faul und langsam hingestellt, bestenfalls als einsam und nachdenklich. Die Redensart »Hier steppt der Bär«
geht vermutlich auf »Tanzbären« zurück, denen der Wille gebrochen worden war und die dieses erbärmliche Spektakel auf Jahrmärkten zum Besten geben mussten.
Das Bild von den Bären wandelte sich erst, als sie vielerorts aus den Wäldern verschwunden waren. In Deutschland wurde der letzte Bär 1835 erlegt, in der Nähe von Ruhpolding. Allmählich keimte die Wertschätzung der Natur, und Braunbären wurden geschützt. In den nordamerikanischen Nationalparks fütterten Besucher Bären so, als wären sie Haustiere.
Dabei wollen Braunbären – soweit man sich in sie hineindenken kann – nur ungestört in Wäldern leben. Sie sind von Natur aus scheu und interessieren sich nicht für uns Menschen, auch nicht als Beute. Problematisch wird es, wenn sie sich an die Gegenwart von Menschen gewöhnt haben und diese mit Futter in Verbindung bringen, etwa wenn es bewusst ausgelegt wurde, um Bären anzulocken.
Braunbären sind Allesfresser und haben eine Vorliebe für Rinden, Blätter, Kräuter, Beeren, Nüsse, Kastanien und Wurzeln. Sie jagen und fressen auch Tiere, der überwiegende Teil ihrer Nahrung ist jedoch pflanzlich. Ihre Backenzähne sind für das Zerkleinern von Pflanzenteilen ausgelegt, ihre Eckzähne für Fleisch – im Gegensatz zu Eisbären, die nur Fleisch fressen und überhaupt keine Backenzähne haben. Heute wissen wir, dass sie wie Menschen unter Krankheiten wie Arthritis, Tuberkulose, Karies und Hämorrhoiden leiden.
Wenn sie in die Nähe menschlicher Siedlungen geraten, fressen sie Obstbäume leer, plündern Hühnerställe, können Schafe und Kälber reißen, Mülltonnen durchwühlen, auch von Bienenstöcken fühlen sie sich angezogen. Hier stimmt das Klischee: Pu der Bär hatte einen mit Honigtöpfen gefüllten Schrank im Haus.
Bären sind smart. Ihr Gehirn ist im Verhältnis zu ihrer Körpergröße groß, und sie können um ein Vielfaches besser riechen als Menschen und selbst Hunde. Sie spüren Wild auf eine Entfernung von gut einer Meile. »Immer der Nase nach« könnte man das Motto der Bären nennen. Und trotz ihrer kleinen Ohren haben sie ein ausgesprochen gutes Gehör. Ihr Sehvermögen ist ebenfalls ausgezeichnet, sie können kleinste Bewegungen wahrnehmen.
Die Psychologin Jennifer Vonk hat erforscht, wie die kleineren, als besonders intelligent geltenden Schwarzbären die Welt um sich herum verstehen. Sie brachte den Tieren bei, einen Touchscreen zu bedienen, und zeigte den Tieren Bilder. Wenn der Bär das Bild eines Bären berührte, bekam er etwas Futter. Wenn er das Bild des Menschen berührte, ertönte ein akustisches Signal. Sie lernten schnell und konnten das Prinzip auch auf andere Gegensatzpaare übertragen. Vonk ist von den hoch entwickelten Fähigkeiten der Bären überzeugt, in einigen Dingen seien sie sogar geschickter als Menschenaffen, über die sie sonst forscht.
Schwarzbären haben gelernt, Touchscreens zu bedienen. Manche Dinge können sie besser als Menschenaffen
Feldstudien konnten bestätigen, dass wilde Braunbären eine sehr genaue Vorstellung von ihrer Umgebung haben, sich lange daran erinnern, wo ihre Lieblingsbeeren wachsen und wo andere Bären leben. Und wenn sie umgesiedelt werden, wissen sie, wie sie »nach Hause« zurückkehren können. In welchem Maße sie Farbunterschiede wahrnehmen, ist dagegen noch umstritten. Die gute Nachricht ist, dass Braunbären, anders als die in Südamerika und Südostasien lebenden Arten, weder gefährdet noch vom Aussterben bedroht sind. Die schlechte Nachricht ist, dass es hier und da zu Konflikten zwischen Menschen und Bären kommt, weil Wälder abgeholzt werden und Rückzugsgebiete verschwinden. In der Slowakei, wo es etwa 1.300 Tiere gibt, stürzte im Frühjahr 2024 eine Wanderin auf der Flucht vor einem Bären in den Tod, und im Herbst wurde ein Pilzsammler von einem Bären getötet. 2023 war ein Jogger in Norditalien dem Angriff einer Bärin zum Opfer gefallen, die drei Jungtiere bei sich hatte. Normalerweise reagieren Bären nur aggressiv, wenn sie überrascht werden.
Weibchen, die mit ihren Jungen unterwegs sind, gelten als angriffslustiger. In Bärengebieten sollte man dicht bewachsenes Gelände abseits der Wege meiden und durch Sprechen oder Singen auf sich aufmerksam machen. Auf Parfüm und Mückenspray verzichten, weil es Bären anziehen könnte. Regnet es oder ist es schon dunkel, nehmen Bären Wanderer weniger leicht wahr. Während der Paarungszeit streifen Bärenmännchen auf der Suche nach Weibchen durch die Wälder, können dann sogar fremden Nachwuchs töten, weil die Weibchen sonst nicht empfängnisbereit sind. Auch sonst regiert unter ihnen das Gesetz der Stärke –oder Masse. So kann es vorkommen, dass ein junger Bär in eine Baumkrone steigt, um einem stärkeren Artgenossen zu entgehen. Meistens sind es nur Tatzenabdrücke, ein von einer Wildkamera erfasstes Huschen, ein großer Kothaufen oder ein gerissenes Tier, das auf die Nähe eines Bären verweist. Kommt es zu einer Begegnung, soll man ruhig und gelassen bleiben und sich langsam zurückziehen. Keine Zeit mit Selfies verschwenden! Droht ein Angriff, flach auf den Boden legen. Das ist leichter gesagt als getan. Hat man im Ernstfall wirklich die Nerven dazu? Weglaufen ist jedenfalls zwecklos. Auf kurzen Strecken sind Bären bis zu 80 Stundenkilometer schnell. In Alaska treibt der Bärenkult seltsame Blüten. Im Katmai-Nationalpark wird alljährlich ein »Fat Bear«-Wettbewerb ausgerichtet, bei dem neben dem Körpergewicht auch das vermeintliche Temperament sowie Fischfangkünste in die Bewertung auf einer Onlineplattform einfließen. Die Bären, die hier der Unterart Ursus arctus horribilis zuzuordnen sind, können via Webcam beobachtet werden, gelegentlich gibt es auch Kämpfe der Tiere untereinander zu sehen. Als »Queen« ging in den letzten Jahren die Bärin »Grazer« mit ihren blonden Ohrenhaaren und ihrer langen Schnauze aus dem Wettbewerb hervor. Die Bären bekommen Namen wie »Jumbo Jet« oder »Chunk«, der mehr als eine halbe Tonne auf die Waage bringt und durch sein besonders ausgeprägtes Hinterteil auffällt.
Bernd Brunner schreibt kulturgeschichtliche Bücher über das Verhältnis von Mensch und Natur, darunter »Von der Kunst, die Früchte zu zähmen« und »Bär und Mensch«.

Alles, was Spaß macht, ist entweder verboten oder gefährlich, sagt eine Volksweisheit. Es macht dick oder abhängig, man wird schwanger oder krank. Leider gilt diese Regel auch für die Sonne. Wir alle lieben sie, doch zu viel Sonne schadet dem Auge gleich doppelt: Zum einen blendet uns ihr grelles Licht, lässt uns die Augen zusammenkneifen und dadurch müde werden. Zum anderen kann die im Sonnenlicht enthaltene Strahlung tatsächlich schwere Schäden verursachen. Das zeigt sich beispielhaft immer wieder, wenn Menschen bei einer Sonnenfinsternis ohne Schutzbrille in den Himmel schauen. Schon in der Antike wusste man, dass man davon sogar erblinden kann.
Doch auch wenn man nicht direkt hineinschaut, kann Sonnenlicht im Übermaß zu gefährlichen Augenkrankheiten führen. Dazu gehören Entzündungen der Hornhaut und der Bindehaut, eine Eintrübung der Linse (grauer Star), die Degeneration der Makula (Netzhaut) und im schlimmsten Fall sogar Krebs. Deshalb sollten schon kleine Kinder regelmäßig Sonnenbrillen tragen, wenn es draußen sehr hell ist, raten Kinderärzte. Das Problem ist nur: Nicht alle Gläser, die dunkel oder farbig erscheinen, bieten umfassenden Schutz. Die naheliegende Annahme, dass dunkles Glas automatisch besser schützt, stimmt so nicht.
Wichtig ist, Farbe und Tönung zu unterscheiden. Die Farbe der Gläser beeinflusst vor allem, wie wir Kontraste und Farben sehen, hat aber kaum einen Einfluss auf die Schutzwirkung der Brille. Die Tönung sorgt für
Blendschutz, beeinflusst also, wie gut wir trotz grellen Lichts sehen können. Beim Wandern in Eislandschaften oder im Segelurlaub auf dem Meer, wo die Wasseroberfläche das Licht von allen Seiten reflektiert und ihre Wirkung multipliziert, kommt es deshalb auf eine hohe Tönungsstufe an. Im Handel sind fünf Kategorien gebräuchlich. Kategorie 0 bedeutet, dass 80 bis 100 Prozent des Lichts durchgelassen werden, Kategorie 1 absorbiert bis zu 57 Prozent des Lichts, Kategorie 2 bis zu 82 Prozent – für eine Alltags-Sonnenbrille in Europa ist das ein empfehlenswerter Anteil. Die Kategorien 3 und 4 sind nämlich schon sehr dunkel, sie absorbieren bis zu 92 Prozent des Lichts und eignen sich nur für außergewöhnlich helle Umgebungen. Manche halten sie für problematisch, denn sie suggerieren einen Augenschutz, den sie möglicherweise gar nicht haben.
Der gefährlichste Bestandteil des Sonnenlichts ist nämlich das Ultraviolett, und das besteht aus Lichtwellen, die so kurzwellig sind, dass man sie nicht sehen kann. Ob das Glas einer Sonnenbrille dieses besonders schädliche UV-Licht herausfiltert, kann man von außen weder an seiner Tönung noch an seiner Farbe erkennen. Theoretisch können auch helle, klare Brillen UV-Licht blockieren. Um herauszufinden, ob sie das auch in der Praxis tun, muss man sich von den Gläsern abwenden und stattdessen Hinweise auf dem Gestell und auf der Packung suchen. Doch das ist leider etwas kompliziert. Trägt die Brille das »CE«-Zeichen der Europäischen Union, ist das schon mal gut. Dieses Siegel garantiert, dass die Brille UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 380 Nanometern herausfiltert, und das sind tatsächlich
Haben Sie etwas gegen die Sonne? Sollten Sie aber! Denn zu viel von ihrem Licht kann die Augen krank machen. Welche Sonnenbrillen schützen, kann man ihnen allerdings nur auf den zweiten Blick ansehen

die fürs Auge gefährlichsten Strahlen, auch UV-B genannt. Das Problem mit dem CE-Symbol ist allerdings, dass es im Prinzip zwar vorgeschrieben ist, seine Verwendung in der Praxis aber nicht von unabhängigen Stellen kontrolliert wird und es auf vielen Brillen erst gar nicht zu finden ist – zum Beispiel auf den bei Urlaubern beliebten Billigkopien von LuxusmarkenSonnenbrillen à la »Gurcchi« oder »Ray Berry«.
Welcher Bauart die Gläser sind, die in solchen minderwertigen Brillen zum Einsatz kommen, erschließt sich nicht – und so bleibt auch unklar, ob sie die Augen wirklich schützen. Wer seine Augen liebt, sollte deshalb zu einer Markenbrille mit CE-Logo oder der Aufschrift »UV380« greifen. Diese schützen auf jeden Fall vor den gefährlichsten Bestandteilen des Lichts. Noch besser ist es, wenn die Brille auf dem Bügel oder der Packung den Hinweis »UV400« oder »100 % UV-Schutz« enthält.
Dann ist garantiert, dass die Brille neben den UV-BStrahlen auch die etwas energieärmeren UV-A-Strahlen (Wellenlänge 380–400 Nanometer) herausfiltert. Diese Strahlen werden zwar nicht für schwere Erkrankungen verantwortlich gemacht, doch auch sie können die Augen nachweislich schädigen.
Deutlich weniger gesundheitliche Relevanz haben hingegen blaue und infrarote Lichtanteile. Zwar werben manche Hersteller damit, dass ihre Modelle auch diese Wellenlängen aus dem Sonnenlicht herausfiltern. Vor allem Brillen mit Blaulichtfiltern trenden seit einiger Zeit und werden von Influencern in den sozialen Medien gehypt (»Must-have für den digitalen Alltag«). Doch die Theorie, dass das sogenannte Blue Light, das von Smart-
phones, Fernsehern und PC-Monitoren abgestrahlt wird, die Haut schneller altern lässt, steht wissenschaftlich auf wackeligen Beinen. Wenn überhaupt, kann dieses Licht die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmen und den Schlafrhythmus ein wenig durcheinanderbringen. Wichtiger als solche zusätzlichen Filter ist das Design der Brille. Denn wenn die Gläser zu klein und die Bügel zu dünn sind, mogelt sich das Licht von den Seiten her doch noch in die Pupille hinein. Deshalb sind große Brillen, unter Gesundheitsaspekten betrachtet, schmalen Modellen überlegen.
Sonnenbrillen der Kategorie 4 lassen nur sehr wenig Licht durch. Sie sind für Gletscherexpeditionen geeignet, aber nicht für den Straßenverkehr. Für die Augengesundheit ist ein anderer Wert wichtiger: der UV-Schutz
Text Ulf Schönert Illustration Oriana Fenwick

Seit Jahrhunderten fordern Menschen Gerechtigkeit, früher mit Mistgabeln, dann mit Bannern, heute mit Hashtags. Für den Erfolg muss sich auch der Protest ändern. Was kommt morgen?
Text Niels Boeing Infografiken Carsten Raffel

Massendemonstrationen mit einer halben Million Teilnehmenden, wie auf der Friedensdemo 1982 in Bonn (links), sind selten geworden. Der Protest von heute ist kleinteiliger, ein Beispiel ist das Beschmieren von Kunstwerken durch die Letzte Generation
Am Anfang ist ein Nein. Nein, so kann es nicht weitergehen. Die Verhältnisse sind unerträglich, die Mächtigen machen, was sie wollen. Es reicht. Seit Monaten hat es Unruhe in verschiedenen Landstrichen gegeben, haben sich Menschen zusammengeschlossen, um aufzubegehren. Jetzt ist das Fass übergelaufen. Tausende von bewaffneten Männern marschieren gegen die Herrschaftssitze, plündern sie. Ein Programm wird formuliert, zwölf Artikel mit Forderungen, die viral gehen. Überall im Land werden sie gelesen, es gibt blutige Zusammenstöße mit der Staatsgewalt. Eine Revolution liegt in der Luft.
Das war vor 500 Jahren. Im Februar 1525 eskalierte der sogenannte Bauernkrieg zwischen Alpen und Thüringen. Die zwölf Artikel prangerten Willkür und Korruption des Adels an, forderten Gerechtigkeit, ja eine frühe Form von Rechtsstaatlichkeit, Verringerung der Abgaben, ein Ende des »Landgrabbing«, wie man es heute nennen würde – die Enteignung von bäuerlichen Allmenden durch den Adel. Binnen Kurzem wurden die zwölf Artikel 25.000-mal gedruckt, eine in der damals noch jungen Geschichte des Buchdrucks unerhört hohe Auflage. Tatsächlich ist die Bezeichnung »Bauernkrieg« verharmlosend. Der Historiker Peter Blickle hat die Erhebung als
»Revolution des gemeinen Mannes« bezeichnet, denn neben Bauern beteiligten sich auch Bürger und Geistliche. Es war der erste Versuch einer Revolution in der Neuzeit, das erste Mal, dass ein Massenaufstand gegen die bestehende Ordnung mit einer Art Massenmedium befeuert wurde. Der Versuch scheiterte zwar, und es sollte noch zweieinhalb Jahrhunderte dauern, bis – in Frankreich – zum ersten Mal eine Revolution gelang. Aber seither begleitet der Protest, die Revolte das kapitalistische Zeitalter. Die Formen änderten sich. Auf Phasen des Aufbegehrens folgten Phasen der Erschöpfung und Unterdrückung. Das Nein ist geblieben. Die Sehnsucht nach sozialer
Gerechtigkeit und Würde ist lebendig wie nie. Aber das Nein hat es in den letzten Jahren sehr schwer. Dabei hat es an Protesten nicht gemangelt: der Arabische Frühling, die spanischen Indignados, Studentenproteste in Chile sowie Occupy Wall Street 2011, die Proteste gegen Preiserhöhungen im Nahverkehr in Brasilien und im GeziPark in Istanbul 2013, der Maidan in der Ukraine 2014, die Regenschirm-Proteste in Hongkong 2014 und 2019, die Gelben Westen in Frankreich 2018, Black Lives Matter 2020, dazu Proteste gegen G20Gipfel in Toronto, London und Hamburg, um nur die bekanntesten zu nennen. Hunderttausende, manchmal auch eine Million Menschen gingen aus dem Haus, um sich Diktatoren, Autokraten, Sparpolitik, Armut und Rassismus entgegenzustellen.
Die 2010er-Jahre waren »das Jahrzehnt mit den meisten gewaltlosen Protesten seit 1900«, hat die US-Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth festgestellt, die an der Harvard Kennedy School eine der größten Datenbanken zu Protesten der Gegenwart aufgebaut hat. Gemessen an Größe und Vielfalt hatte der weltweite Aufruhr jedoch
erstaunlich wenig Erfolg. Schlimmer noch: Während Donald Trumps Amtseinführung im Januar 2017 noch einen MillionenMarsch, den Women’s March on Washington, auslöste, ist es seit seiner zweiten Amtseinführung verstörend still in den USA.
Was ist da passiert? Es spricht einiges dafür, dass ein weiterer Protestzyklus der Neuzeit sein Ende erreicht hat.
Der US-amerikanische Soziologe Charles Tilly hat seit den Siebzigerjahren Proteste und Revolten der vergangenen Jahrhunderte untersucht. Das Protestrepertoire in der Zeit von den Nachwehen des Bauernkriegs vor 500 Jahren bis zum Beginn der industriellen Revolution bezeichnet Tilly als parochial – auf das Umfeld des lokalen Kirchturms beschränkt. Bauern konfiszierten Ernten oder stürmten Äcker und Wälder, die der Adel sich vorbehielt. Manchmal machten sie in Dörfern und Städten einen Heidenlärm mit »Katzenmusik«. Oder sie stürmten die Häuser von Steuereintreibern und anderen verhassten Zeitgenossen, warfen den Hausrat auf die Straße, verbrannten ihn gar. Manchmal schickten sie auch nur ganz artig eine Delegation los,
um einem Adligen eine Petition zu überreichen. All diese Proteste blieben Einzelereignisse, richteten sich unmittelbar gegen die Obrigkeit vor Ort. »Praktisch niemand versuchte, die Beschlagnahmung von Getreide, die Besetzung von Äckern, Protestläufe in Dörfern und Ähnliches miteinander zu kombinieren«, schrieb Tilly. Die Proteste wuchsen sich nie zu einer Bewegung im heutigen Sinne aus. Die Demonstration, erst recht von Massen, war schlicht unbekannt. Sie wurde die erste Protestinnovation im späten 18. Jahrhundert. In den Hafenstädten der britischen Kolonien in Nordamerika gärte es. Die amerikanischen Revolutionäre hatten es satt, bei den Kolonialbeamten vorzusprechen – sie gingen nun zu Tausenden auf die Straße, um ihrem Unmut Nachdruck zu verleihen. Eineinhalb Jahrzehnte später brach in Paris die Französische Revolution los. Auch hier dasselbe Phänomen: Große Protestzüge liefen nach Versailles, um dem König den Marsch zu blasen, oder durch die Straßen von Paris, um öffentliche Gebäude oder das berüchtigte Stadtgefängnis, die Bastille, zu stürmen. »Die alte Trennlinie zwischen
Anzahl Ereignisse gewaltförmig konfrontativ demonstrativ
Protestierende (in 10 000)
Die Zahl der Proteste nahm nach der Hochphase zwischen 1980 und 2000 ab und ist erst in letzter Zeit wieder gestiegen. Allerdings beteiligen sich nicht mehr so viele Menschen wie damals
Teilnehmenden und Zuschauern löste sich auf: Jeder sollte dabei sein«, so Tilly.
Die nächste Veränderung war die anziehende Industrialisierung. Die Gemeinäcker verschwanden vollends, was verarmte Menschen vom Land in die Städte trieb. Dort verdingten sie sich als Lohnarbeiter in den neuen Fabriken. Hungerlöhne und unsägliche Arbeitsbedingungen boten genug Anlass für Unmut – und brachten den Streik als weitere Protestform hervor. »Irgendwann im 19. Jahrhundert ließen die Menschen in den meisten westlichen Ländern das alte Repertoire der vorhergehenden Jahrhunderte hinter sich«, so Tilly.
Das neue Protestrepertoire umfasste nun Demonstrationen, Streiks, öffentliche Versammlungen, Wahlkampagnen, durchgeplante statt spontane Aufstände bis hin zu massiven Sachbeschädigungen. Neu war auch, dass all dies in den öffentlichen Raum der Städte getragen wurde, wo der Protest für alle sichtbar war und über das Massenmedium Zeitung alle Teile des Landes erreichte. Gewerkschaften und politische Vereine waren zunehmend in der Lage, Proteste landesweit zu organisieren. Die Bühne war nicht mehr parochial, sondern national. Dazu passend verbreiteten sich Fahnen, Transparente und Banner, die der Öffentlichkeit klarmachten, worum es bei einem Protest ging. Politische Kommunikation war bald selbstverständlicher Bestandteil von Protesten.
Dieser Werkzeugkasten der Revolte blieb fast hundert Jahre unverändert – bis die Unruhe der 1960er hereinbrach. In den USA, in Mexiko, Frankreich, Deutschland, in der Tschechoslowakei und in Japan rebellierte die junge Generation gegen die Verkrustungen der Nachkriegszeit und den Vietnamkrieg. »Die großen Momente im Mai und Juni 1968 brachten eine faszinierende Kombination des Standardrepertoires mit kreativen Erfindungen hervor«, so Tilly. In Paris schmückten plötzlich wild geklebte Plakate und Graffiti die Hauswände. »Verbote sind verboten« oder »Unter dem Pflaster der Strand« wurden zu geflügelten Worten einer neuen Protestgeneration. Wegbereiter war hier die Situationistische Internationale, ein loser Zusammenschluss von Künstlern und Intellektuellen. Mit Spott und Wortwitz griffen sie Kapitalismus und Realsozialismus gleichermaßen an,
machten sich über die Industriegesellschaft lustig und veränderten die Protestkommunikation nachhaltig. Die situationistisch geprägten Slogans bedienten perfekt, was später Aufmerksamkeitsökonomie genannt wurde. Protest war ohne Spektakel, ohne mediale Wirkung nicht mehr zu denken.
Eine Organisation, die diesen Ansatz perfektionierte, war Greenpeace, 1971 gegründet. Ob Walfangboote mit Schlauchbooten blockiert oder die Kraftwerksschornsteine von Aktivisten besetzt wurden, die Kamerateams waren vor Ort, die Bilder in den Abendnachrichten garantiert. 1989 gründeten der Kanadier Bill Schmalz und der Este Kalle Lasn das Magazin Adbusters Sie kopierten bekannte Werbespots und verkehrten deren Botschaft in beißende Kritik.
Wenn Videos zeigen, wie Polizisten auf Demonstranten einschlagen, mobilisiert das andere, auch zu protestieren
Aktivisten begannen, Logos von Konzernen zu verfremden und damit deren fragwürdige Geschäfte bloßzustellen. Die Kommunikationsguerilla war erfunden.
Die Verbreitung des Internets seit den Neunzigerjahren und die sozialen Medien Mitte der 2000er-Jahre gaben politischem Protest noch einmal einen neuen Schub. Die 1999 gestartete Plattform Indymedia ermöglichte es Aktivisten, ihre eigenen Berichte etwa von den Globalisierungsprotesten in Seattle im selben Jahr und in Genua 2001 in alle Welt zu senden – vorbei an den etablierten Medien.
Bei diesem Citizen-Journalism ging es auch darum, die Deutungshoheit von Politik und Medien ins Wanken zu bringen. Wenn Videos zeigten, wie Polizeieinheiten auf friedliche Demonstranten einschlugen wie in Genua, mobilisierte das weitere Menschen, sich Protesten anzuschließen. Die sozialen Medien potenzierten das, was
Indymedia vermochte, noch einmal. Nun konnte jede protestierende Person Berichterstatter sein. Myspace, Facebook und später Instagram wurden unverzichtbare Werkzeuge für Protestkampagnen. Als auf dem Tahrir-Platz in Kairo Anfang 2011 zwei Millionen Menschen Diktator Hosni Mubarak ins Exil zwangen, war gar von einer Facebook-Revolution die Rede. Protest hatte durch die digitale Sphäre offenbar einen Verstärker bekommen.
Doch genau hier fingen die Probleme an. »Digitaler Aktivismus hilft den Bewegungen von heute sehr gut, in kürzester Zeit Menschenmassen zu versammeln«, schreibt Erica Chenoweth in Civil Resistance. »Aber dadurch sind die Bewegungen weniger darauf vorbereitet, diese Massen in effektive Protestorganisationen zu verwandeln, die planen, verhandeln und Ziele durchsetzen können.« Die türkische Soziologin Zeynep Tufekçi hat das Dilemma sehr anschaulich formuliert, nachdem sie 2013 den Istanbuler Gezi-Park besucht hatte. Der fühlte sich für sie an wie fast jeder öffentliche Platz des 21. Jahrhunderts, auf dem protestiert wird. Der Protest »organisiert über Twitter, voll mit Tränengas, ohne Anführer, vernetzt, euphorisch und fragil«. Eine Mischung aus Musikfestival und Pariser Commune. Welche Gefahren in dieser Art von Protesten liegen, veranschaulicht die Protestwelle in Brasilien im Sommer 2013. Einige Monate zuvor hatte sich das Movimento Passe Livre (MPL) gegründet, eine überschaubare Gruppe von Aktivisten in São Paulo, die alle Erfahrungen in der globalisierungskritischen Bewegung gesammelt hatten. Ihr Ziel: die für Juni geplante Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr zu verhindern. Ihr Plan: mehrere Aktionen, die São Paulo durcheinanderwirbeln und ein so starkes mediales Echo finden sollten, dass die Stadt die Preiserhöhung zurücknehmen würde.
Am 6. Juni 2013 fanden sich auf einer Kreuzung der Hauptachsen der Stadt, der Avenida 23 de Maio, rund 5.000 Aktivisten ein. Sie errichteten eine Barrikade aus Attrappen von Drehkreuzen in U-Bahnhöfen, die sie anzündeten. Dazu hielten sie ein Transparent gegen die Preiserhöhung hoch. Als die Flammen meterhoch loderten, schossen sie ein Foto für die Zeitungen und sozialen Medien. Die Berichterstattung war
wie erwartet negativ – »Vandalismus« hieß es. In den folgenden Tagen wurden eine Stadtautobahn und andere Straßen blockiert. Die Presse forderte, die Polizei möge endlich hart durchgreifen. Und das tat sie dann am 13. Juni, als das MPL einen großen Protestmarsch durch die Stadt angesetzt hatte. Tränengas und Gummigeschosse flogen, es gab zahlreiche Verletzte. Die Stimmung drehte sich: Entsetzen über die Härte der Polizei, plötzlich wurde der Sinn der Preiserhöhung infrage gestellt. Die sozialen Medien empörten sich auf Hochtouren. Und so geschah am 17. Juni zunächst das, was das MPL gehofft hatte: Hunderttausende kamen zum Demonstrationszug –dem größten in Brasilien seit zwei Jahrzehnten. Doch viele der Demonstrierenden interessierten sich überhaupt nicht für die Forderung des MPL. Sie trugen Nationalflaggen, brachten ihren Unmut über die angeblich korrupte Regierung und die Eliten zum Ausdruck. Das MPL, das bewusst auf Sprecher verzichtete, konnte nicht dagegenhalten. In der Folge wurden die Proteste von einem obskuren Movimento Brasil Livre (MBL) – die Namensähnlichkeit war beabsichtigt – gekapert, das eher der Gedankenwelt des späteren rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro nahestand.
Diese Art von »horizontalen« Protesten ist seit den Neunzigerjahren weitverbreitet. Es gibt bewusst keine Struktur, keine Sprecher, alles wird im Konsens beschlossen, wichtig ist die größtmögliche Mobilisierung. So sympathisch die antiautoritäre Haltung ist, sie stellt sich selbst eine Falle. Hat der Protest Erfolg, mischen plötzlich ungebetene Gäste mit – in Ägypten war es das Militär. Oder er wird beiseitegeräumt, wie Occupy in New York oder Gezi-Park in Istanbul, weil da niemand ist, der Verhandlungen führen könnte.
»Der Aufstieg dieser horizontalen Proteste ging nicht zufällig mit dem Aufstieg des Internets einher«, sagt die Berliner Protestforscherin Lisa Bogerts. Das Internet selbst stand für ein Netz, in dem alle Knoten gleich sind, es keine Hierarchie gibt. Das ist zwar falsch, aber der Mythos hält sich bis heute. Horizontale Proteste sind auf ehrenamtliches Mitmachen angewiesen, daher ist die Fluktuation der Teilnehmenden sehr hoch.
»Institutionelle Strukturen können helfen, den Protest mit den nötigen Ressourcen zu
Das Protest-Repertoire
Medienproduktion (z. B. Informationsvideos)
Besetzung (z. B. Occupy Wall Street)
Künstlerische Aktionen im ö entlichen Raum (z. B. Zentrum für Politische Schönheit)
Streiks (z. B. Generalstreiks)
Online-Kampagnen (z. B. Online-Petitionen)
Sachbeschädigungen (z. B. Sprengung von Strommasten)
Kommunikationsguerilla (z. B. Ad-Busting)
Straßenschlachten (z. B. Seattle 1999)
Lichterketten/Menschenketten (z. B. München 1992)
Anschläge (z. B. RAF)
Demonstrationen (z. B. Friedensbewegung)
Guerilla-Kampf /Revolution (z. B. kubanische Revolution)
Markierungen (z. B. Farbbeutel auf Gebäude)
Blockaden (z. B. Letzte Generation)
Legende:
Demonstrativ (auf Missstände aufmerksam machen)
Konfrontativ (Störungen erzeugen)
Gewaltförmig (Zerstörungen erzeugen)
Von friedlichen Protestformen (oben links) bis hin zu radikalen gewaltsamen (unten rechts). Letztere haben in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen
versorgen«, sagt Bogerts. Die Gewerkschaften haben dies lange gezeigt, aber ihre Hochzeiten liegen schon einige Jahrzehnte zurück.
Das brasilianische Beispiel zeigt ein weiteres Problem. Die Gruppe ist klein, geht aber sehr konfrontativ zu Werke. Damit liegt sie im Trend der Proteste. Auch in Deutschland nimmt zwar die Zahl der Proteste seit Jahren wieder zu, wie eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin WZB zeigt – aber die Zahl der Teilnehmer nimmt ab. »Wir sehen im Moment viel mehr konfrontative oder gewaltförmige Proteste, das schreckt viele Menschen ab«, sagt WZBForscher Daniel Saldivia Gonzatti. Die Klebe-Aktionen der Letzten Generation bestätigen das. Wurden Fridays for Future noch für ihr Engagement von allen Seiten gelobt, reagierte die Gesellschaft schroff auf die Letzte Generation. Die Form wurde plötzlich wichtiger als der Inhalt.
Die Reaktionen auf die Klebereien zeigen ein drittes Problem: Der Staat geht härter gegen Proteste vor. Viele Aktivisten der Letzten Generation wurden in Präventivhaft genommen, eine Maßnahme, die üblicherweise für Terroristen und Schwerkriminelle gedacht ist. Diese Repression hat nicht erst in den letzten drei Jahren zugenommen. Schon vor zehn Jahren erließ etwa Spanien eines der härtesten Gesetze zu politischen Protesten, offiziell »Gesetz zur Sicherheit der Bürger«. Vergehen bei Demonstrationen können von der Polizei mit Bußgeldern von bis zu 600.000 Euro geahndet werden, ohne gerichtlichen Beschluss. Politischer Protest wird immer häufiger als Straftat eingestuft.
Dazu kommt ein alter Streit, wie militant Proteste sein dürfen. Gene Sharp, wichtigster Theoretiker des gewaltfreien Widerstands nach Gandhi, hatte zwar recht, als er feststellte: Gewaltsamer Widerstand trifft den Staat dort, wo er am stärksten ist. Der Staat kann Agents Provocateurs in eine Protestbewegung einschmuggeln, um sie zu diskreditieren. Allerdings wird auch der »Flankeneffekt« diskutiert: Gewalttätige Randgruppen einer Bewegung lassen ihren gewaltfreien Mainstream als das kleinere Übel erscheinen, dem man dann Konzessionen macht. Dieses Zusammenspiel ließ sich etwa bei der Bürgerrechtsbewegung in den USA beobachten, das Zentrum um Martin Luther King auf der einen und die
militanten Black Panther auf der anderen Seite. Auch die Suffragetten, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien für das Frauenwahlrecht stritten, schreckten vor Sachbeschädigung nicht zurück. Sie sprengten Briefkästen, warfen Scheiben ein, während sie zugleich ihr Anliegen gut begründet in der Politik vortrugen.
Sowohl Aktivisten als auch Forscher sind sich darin einig, dass die Protestlandschaft derzeit fragmentiert ist wie lange nicht mehr. Sowohl hinsichtlich der Fülle an Themen – Klimawandel, Rassismus, Vermögensungleichheit, Diskriminierung, Gentrifizierung der Städte – als auch hinsichtlich einer geeigneten Form. »Es gibt leider keine einfache Formel für erfolgreiche Proteste«, sagt Daniel Saldivia Gonzatti.
Daran sind nicht nur die Protestgruppen schuld, findet der US-Soziologe David Meyer von der University of California in Irvine. »Wenn man früher lange und laut genug an die Türen des Parlaments geklopft hat, öffnete jemand. Das ist heute nicht mehr so.« Das liege auch an der Globalisierung: Die Parlamente haben einen Teil ihrer Macht an internationale Institutionen abgegeben, auf die sie schulterzuckend verweisen können. Für Meyer führt kein Weg daran vorbei, politischen Protest wieder verstärkt lokal und analog zu organisieren. Das ist Arbeit, schafft aber soziale Verbindungen. »Daraus entstehen resilientere Communitys als im heutigen Protest«, so Meyer. Wenn diese sich vernetzen, sind auch wieder größere Bewegungen denkbar.
An resilienten Protest-Communitys mangelt es derzeit. Es scheint fast, als seien Proteste und Revolten wieder an dem Punkt angekommen, an dem der Bauernkrieg einst scheiterte: große Empörung, aber zu viele lose und verteilte Gruppen, die gegen zu viele Probleme zu Felde zogen –weil es das eine große Gegenüber, eine nationale Regierung, nicht gab, die man zur Vernunft hätte bringen müssen. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht wieder zweieinhalb Jahrhunderte dauert, bis die nächste große Revolte für soziale Gerechtigkeit und Würde Erfolg hat.
Niels Boeing verfolgt die Entwicklung politischer Proteste, seit das Movement for Global Justice 1999 beim G7-Gipfel in Seattle in die Schlagzeilen der Weltpresse kam.

Berlin 25.9. Düsseldorf 27.9. München 1.10. Hamburg 4.10.
Mit Andreas Sentker, Anne Kunze, Sabine Rückert und Daniel Müller

Warum wächst Basilikum auf Sizilien in Köpfen aus Keramik? Fragen an ein störrisches Kraut
Der Sommer macht alles auf magische Weise schöner. Aus Gewittern werden Sommergewitter, aus Nächten werden Sommernächte, aus Tomaten werden Sommertomaten. Wäre da nur nicht dieser traurige Topf Basilikum, der schon nach drei Tagen den Geist aufgibt.
Liebes Basilikum, Sie stehen hier in voller Pracht vor mir. Warum sehen Sie in meiner Küche so bemitleidenswert aus? Ich werde Sie vermutlich bald schon wieder ersetzen müssen.
Lassen Sie mich raten: Sie haben sich wie immer einen Topf im Supermarkt geschnappt, ihn ans Fenster gestellt, wundern sich, dass es die Blätter nach kurzer Zeit hängen lässt, und wollen jetzt von mir den ultimativen Geheimtipp für die hochkomplexe Pflege des Basilikums erfahren. Ja! Was ist Ihr Geheimnis? Das verrate ich Ihnen gerne. Sie brauchen
dazu allerdings die Liebe Ihres Lebens. Haben Sie die gerade zur Hand? Ich weiß nicht … das ist jetzt ziemlich privat. Wofür braucht es die denn? Ganz einfach: Damit ein Basilikum im Topf überleben kann, müssen Sie den Kopf Ihres Geliebten darin vergraben. Was?? Ich bin mir doch noch gar nicht sicher, ob es wirklich was Ernstes ist! Und wachsen Sie etwa auch aus einem Schädel? Sie veräppeln mich ja wohl … oder? Sie können es ja einfach mal ausprobieren. Wenn es klappt, war es der Richtige. Es klingt jedenfalls so, als seien Sie bereit, einiges für mich zu opfern. Das rührt mich. Ein gesundes Basilikum auf dem Fensterbrett ist nun mal das Statussymbol schlechthin – wem dieses Wunder gelingt, dem gelingt das ganze Leben. Ich erinnere mich jetzt aber auch wieder an diese alte Geschichte aus dem »Decamerone« von Giovanni Boccaccio …
In einer Kurzgeschichte dieser Sammlung aus dem 14. Jahrhundert erzählt Boccaccio
das tragische Schicksal der wohlhabenden Lisabetta aus Messina, die sich unsterblich in den einfachen Arbeiter Lorenzo verliebt. Doch eines Tages erfahren ihre Brüder von der heimlichen Affäre und töten ihn. Lisabetta holt daraufhin seinen Kopf aus dem Grab und versteckt ihn in einem Basilikumtopf, an dem sie weint, bis sie an gebrochenem Herzen stirbt.
Ich nehme an, das Basilikum gedieh im dunklen Schein ihrer Trauer prächtig. Man erzählt sich, dass es so gut wuchs, dass die Leute anfingen, Blumentöpfe in Form von Köpfen herzustellen. Noch heute sieht man überall auf Sizilien diese aufwendig geschmückten Keramikköpfe auf den Balkonen. Lisabettas tragische Liebesgeschichte ist eine der Legenden, die dahinterstecken könnten.
Die Köpfe bergen die zwei großen vergeblichen Sehnsüchte der Menschen: die nach der Liebe des Lebens und die nach dem perfekten Basilikumstrauch. Und wo sonst sollte sich beides auf so magische
Weise erfüllen als in Italien?
Wovon faseln Sie da bitte?
Natürlich von Ihrer schicksalhaften Liebe zu der Tomate! Ist ihr nicht im Rot und Grün der italienischen Flagge sogar ein Denkmal gesetzt worden?
Ein hübsches Bild, aber es war eher andersherum. Ursprünglich ist die Trikolore eine Hommage an die Französische Revolution, angeblich entworfen von Napoleon selbst. Aber wie soll man sich Spaghetti ohne »al pomodoro e basilico« vorstellen?
Zu Boccaccios Zeit hießen Spaghetti noch Maccheroni, und man kochte sie ein bis zwei Stunden lang. An einer Stelle im Decamerone beschreibt er das Schlaraffenland mit einem Berg Parmesan, von dem die Pasta in einen Buttersee rollt. Keine Tomate und kein Basilikum weit und breit. Butter? Zwei Stunden?? Bei diesen Worten kann ich ein ganzes Volk die Hände falten und »Madonna!« rufen hören.
Die italienische Küche mit ihrem Olivenöl und ihrem al dente ist jünger, als man meint. Die Tomate kam erst im 18. Jahrhundert auf die Teller. Pesto Genovese und Tomatensoße mit Basilikum findet man erst in Kochbüchern aus dem 19. Jahrhundert. Obwohl ich schon in der Antike aus Indien oder Afrika ans Mittelmeer gewandert bin, kannte man mich lange Zeit eher als Grabbeigabe und Heilmittel, beispielsweise gegen das Gift des Basilisken. Unsere Namen sind beide mit dem altgriechischen »basileus« für König verwandt.
Diese mythische Schlange ist schuld an Ihrer Verbannung aus der Küche? Eine nahezu biblische Ungerechtigkeit! Vielleicht sahen die Menschen Lisabetta vor sich, die am Basilikumtopf hing und sich die Vernunft aus dem Leib schrie. Jedenfalls sollten meine intensiven Öle nicht nur schlecht für Körper und Geist sein, auch Skorpione sollten sie anlocken und sogar aus dem Kopf wachsen lassen. Was sind das für Öle, die den Leuten so großen Respekt eingejagt haben?
Meine Öle sind meine Seele, sie prägen meinen Charakter. Das ätherische Öl Estragol gibt dem Thaibasilikum zum Beispiel das frisch-herbe Anisaroma, das an Lakritz erinnert und sich so gut in Nudelsuppen macht. Andere Sorten haben eher einen Hang zur Zimt- oder Zitrusnote. Ich habe viele Gesichter.
Welches Gesicht hat das Basilikum, das aus Lorenzos Kopf wuchs und das wir noch heute im Supermarkt finden?
Vielleicht hat das blumige Linalool Lisabetta an ihren Geliebten erinnert. Oder das Eugenol, das nach Klee schmeckt. Beide sind sehr dominant im europäischen Basilikum. Ätherische Öle sind aber auch sehr flüchtig. Der Geschmack von Basilikum lässt sich weder gut trocknen noch einfrieren. Wer mich genießen will, darf nicht zu lange abwarten.
Es geht wirklich nichts über ein frisches Blatt Basilikum auf einer Scheibe Tomate. Nach Jahrhunderten im Giftschrank hat das Schicksal Sie endlich mit Ihrer großen Liebe zusammengeführt – wie romantisch! Na ja, manche Zutaten haben nun mal ähnliche Aromen. Das Profil von Erdbeeren ähnelt beispielsweise dem von Schokolade, Basilikum und Balsamico. Vor einiger Zeit fand eine Studie heraus, dass das Aroma Geranial zwar nur sehr zart, aber trotzdem entscheidend für die charakteristische Süße der Tomate ist. Auch im Basilikum ist Geranial enthalten. Wir unterstützen einander, deshalb passen wir gut zusammen. Das klingt nach ziemlich viel Arbeit. Sollte Liebe nicht mühelose Magie sein? Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Rat für ein glückliches Leben: Warten Sie nicht auf Magie, kümmern Sie sich. Kümmern Sie sich um Ihre Liebe, statt sich wie Lisabetta erst in Geheimnistuerei und dann im Selbstmitleid zu verlieren. Kümmern Sie sich um sich selbst, statt irgendwelchen Märchen über Skorpione Glauben zu schenken. Und kümmern Sie sich verdammt noch mal um das arme Basilikum vom Supermarkt, statt auf einen geheimnisvollen Pflegetipp zu hoffen. Wie denn, ohne die Liebe meines Lebens?
Pflanzen Sie es um in einen größeren Topf mit mehr Erde und Luft zum Atmen. Wählen Sie einen sonnigen Platz. Schauen Sie täglich, ob der Boden noch feucht genug ist, ohne Staunässe zu bilden. Düngen Sie ab und zu. Ernten Sie die Blätter mitsamt Stängel, damit er sich neu verzweigt. Klingt das für Sie nach Hexerei? Nein, das klingt nach dem Einmaleins der Pflanzenpflege.
Da haben Sie es. Das Leben braucht keine übernatürlichen Wunder. Mit ein wenig Sorgfalt gelingt es von ganz allein.
»Ich gebe Ihnen mal einen Rat für ein glückliches Leben: Kümmern Sie sich um Ihre Liebe. Kümmern Sie sich um sich selbst. Und kümmern Sie sich um das Basilikum!«
GLOBALE ALLIANZE
FÜR KLIMASCHUTZ BIODIVERSITÄT

KarenPittel , ©ifo Institut KatrinBöhning-Gaese, ©Peter Kiefer
Unter anderem auf der Bühne
Katrin Böhning-Gaese / Maria Furtwängler / Fabian Franke / Laura Hohmann / Peter Jelinek / Karen Pittel / Andreas Sentker / Louisa Schneider / Kira Vinke / Katharina van Bronswijk / Klaus Wiegandt




Unser Kolumnist ist seit Jahren mit einer Wissenschaftsjournalistin verheiratet. Was sie an neuen Studien auf den Tisch bekommt, wirkt sich unmittelbar auf seinen Alltag aus – bis zur nächsten Studie. Besonders gut kennt sie sich seit einiger Zeit mit Snacktivities aus
Selten habe ich meine Frau so elektrisiert erlebt wie in dem Moment, als sie mir von der großen Vilpa-Studie erzählt hat. Vilpa ist die Abkürzung für vigorous intermittent lifestyle physical activities, damit sind gemeint: kurze, in den Alltag integrierte Bewegungseinheiten. Eine fast sieben Jahre dauernde wissenschaftliche Studie mit mehr als 20.000 Versuchspersonen hat unter anderem ergeben, dass drei kurze Bewegungseinheiten pro Tag das Sterberisiko um fast 40 Prozent senken. Und mit diesen »bursts of activity«, also sozusagen Bewegungsausbrüchen, sind nicht Liegestütze oder Kniebeugen gemeint. Sondern Treppensteigen oder, wie meine Großmutter gesagt hätte, forsches Ausschreiten. Oder intensive Gartenarbeit. Wobei man in einer Minute Gartenarbeit zwar womöglich viel für sich, aber wenig für die Blumen, Büsche und Bäumchen im Garten erreicht, das muss ich zugeben.
Meine Frau sagte, es sei immer wieder toll, mit wie wenig Aufwand man viel erreichen könne, wenn es um Bewegung geht. Ja, denn an vielen das Sterberisiko senkenden Aktivitäten missfällt mir, dass man dafür Geräte anschaffen, in Vereine eintreten oder sich atmungsaktive Kleidung anziehen muss. Aber eilig durch die Gegend laufen, das kann ich. Und ein bis zwei Minuten, das ist so in etwa die Zeitspanne, nach der ich mich im Yogakurs ungeduldig frage, ob es sich schon lohnt, den Kopf Richtung Wanduhr zu dehnen. Für mich sind diese »Snacktivities«, wie es in der Fachliteratur heißt, also perfekt. Meine Frau sagt »Snacksercises«, nie hörte sich Lebensverlängerung mundgerechter an. Ich liebe Snacks!
Meine Berufstätigkeit zwingt mich zu langen Phasen von Inaktivität: Entweder ich sitze am Schreibtisch oder im Zug oder herum (zumindest sieht Nachdenken von außen so aus, werde ich nicht müde zu erklären). Seit meine Frau mir von der Vilpa-Studie erzählt hat, bin ich aber einer von diesen Menschen geworden, die schwankend und etwas zu schnell durch den ICE laufen, als würden sie vor der Fahrkartenkontrolle fliehen oder als wären die Toiletten in den Wagen fünf bis acht unbenutzbar.
Wenn ich mit einer Kollegin in der Bibliothek recherchiere, springe ich zwischendurch auf und laufe einige Male das Treppenhaus hinauf und wieder hinunter, als hätte ich vergessen, wo mein Schließfach ist. Ich bin kurz davor, minutenweise die Rabatten in der Grünanlage am Bahnhof oder vor der Bibliothek zu jäten. Meine Snacktivities sind zwar nur kurz, aber disruptiv. Wenn ich gefragt werde, warum ich nicht still sitzen bleiben kann oder was denn jetzt schon wieder ist, halte ich einen Kurzvortrag über die UK Biobank Accelerometry-Studie und ihre Ergebnisse, die, wenn man sie so eifrig vorträgt wie ich, tatsächlich fast ausgedacht und zu schön klingen, um wahr zu sein. Das ist ein wenig lächerlich, aber: Es kommt mir unverantwortlich vor, für mich zu behalten, dass man durch ein bisschen Aufstehen und Rumlaufen womöglich länger lebt.
Durch meine Snacksercise-Angewohnheit habe ich jedenfalls eine neue Bewegungssehnsucht entwickelt. In meiner Kindheit galt es Lehrkräften und älteren Verwandten als Charakterdefekt, wenn man »nicht still sitzen« konnte. Heute erscheint es mir als Ausdruck purer Lebensfreude, nicht still sitzen zu wollen. Manchmal komme ich mir vor wie ein Familienhund, der es nicht erwarten kann, aus der Heckklappe zu springen.
Ein bisschen Sorgen mache ich mir dabei um meine Frau. Sie arbeitet fast Vollzeit und fast nur im Arbeitszimmer zu Hause. Ab und zu kommt sie aus ihrem Büro und informiert mich mit leuchtenden Augen über eine neue Bewegungsstudie, aber dann verschwindet sie wieder an ihren Arbeitsplatz. Wenn ich sie frage, ob sie denn heute schon ihre Snacktivities intus habe, lächelt sie nachsichtig wie ein kettenrauchender Lungenarzt. So als würde sie das zwar alles gern an mich und an die Leserschaft weitergeben, aber sie selbst hätte dafür keine Zeit. Ich habe den Verdacht, dass es vielleicht eindrücklicher ist, wenn jemand anders einem begeistert von einer Studie erzählt, als wenn man sie selbst im Rahmen von Routinetätigkeiten liest. Mein fester Vorsatz ist daher, zwischen meinen Bewegungssnacks die Fähigkeit zum Auswerten wissenschaftlicher Studien zu entwickeln, damit ich mich endlich irgendwann revanchieren kann.
Till Raether ist Journalist und Schriftsteller. Er war stellvertretender Chefredakteur der »Brigitte« und arbeitet heute freiberuflich als Autor.
Sein neuer Roman »Disko«, der 1975 in München spielt, ist bei btb erschienen. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg.

Niemand möchte Opfer eines Verbrechens sein. Die wenigsten wollen Verbrechen begehen. Alle wollen davon erfahren. Hier sind vier Seiten Einstiegsdelikte
Empfehlungen für Bücher, Filme und Digitales
Was wir nicht sehen, wenn wir auf die Taten starren Im französischen Original trägt das neue Buch von Yasmina Reza den Titel Récits de certains faits, es sind Berichte über Anschuldigungen, die in Straf- und Schwurgerichten von Paris, Montpellier oder Nizza verhandelt und dann zu Tatsachen werden, wenn das Urteil über sie gefällt wird. Die Erfolgsautorin ist keine typische Gerichtsreporterin. Urteil und Maß einer Strafe erwähnt sie eher beiläufig, meistens gar nicht. Rezas Interesse gilt den Verletzungen, die zu einer Tat führen: den Wunden in der Kindheit, einer trostlosen Ehe, der Einsamkeit. Das Licht, das auf die Rückseite des Lebens fällt, zeigt Angst und Schmerz und lässt vielleicht Beweggründe sichtbar werden, macht Empathie möglich. Unter den Kürzestgeschichten, die an die Miniaturen der Schweizer Autorin Adelheid Duvanel erinnern, mischt Reza solche, die nicht aus den Gerichtssälen, sondern aus ihrem eigenen Leben kommen. Als die Autorin von einem Freund erfährt, dass Mathieu G. nach einem Schlaganfall in der Metro gestorben sei, bricht es aus ihr heraus: »Ich habe Angst vorm Verfall. Vorm Kranksein.« Es geht Reza um den Tod und um ihre eigene Angst davor. Die vorletzte Geschichte erzählt von
einer Weinbäuerin am Douro: »Sie versorgt die Arbeiter, die Schafe, die Hühner, alle außer ihre Kinder.« Was ist das Verbrechen, das sie begangen hat? Dass der Weinberg ihr Leben war? Dass sie ihre Kinder ins Heim steckte? Dass sie der Kirche abschwor? Nein, Candida, die Tochter, sagt, die Mutter sei gemein, weil sie niemanden liebe. Yasmina Reza: Die Rückseite des Lebens, Hanser 2025, 192 S.
Maria Concetta Cacciola ist die Nichte eines Mafiabosses. Mit fünfzehn heiratet sie einen Mann, der sich durch die Ehe mit ihr Aufstiegschancen ausrechnet. Er sperrt sie ein und schlägt sie. Wegen Mafia-Geschichten kommt er ins Gefängnis. Jetzt muss sie eigentlich stillhalten, aber sie trifft sich mit einem anderen Mann. Ihr Bruder und ihr Vater finden es heraus und schlagen sie zusammen. Sie geht zur Polizei und taucht unter. Dann wird sie von ihrer Mutter in eine Falle gelockt und gezwungen, Salzsäure zu trinken. Von solchen Dramen erzählt der Journalist Roberto Saviano in seinem Buch über die Frauen in der Mafia. Für die Mafia ist die Frau in erster Linie Gebärmaschine, schreibt er. Sie muss männlichen Nachwuchs hervorbringen. In seltenen Fällen sind Frauen aktiv an Geschäften beteiligt. Manchmal, wenn der Boss im Gefängnis sitzt,

ordnen sie stellvertretend Morde an. Wieder ein Saviano-Buch, das wütend macht. Einziger Trost: Viele seiner Recherchen beruhen auf Gerichtsprozessen, und die Täter wurden verurteilt. Roberto Saviano: Treue, Hanser 2025, 272 S.
Männer im Knast
In Deutschland leben mehr als 600 Männer, aber nur zwei Frauen in Sicherungsverwahrung (Stand 2022). Deshalb gendert Gilda Giebel nicht, wenn sie über die Psychopathen und Sadisten schreibt, die sie als forensische Psychologin einer Justizvollzugsanstalt begutachtet hat. Sie erklärt die manipulativen Methoden der Männer und beschreibt ihre eigenen Gefühle zwischen Abscheu und Mitleid. Angereichert mit Wissenschaft. Nur für starke Nerven! Gilda Giebel: Triebhaft, riva 2024, 252 S.
Wenn Sie mal selbst über Verbrechen schreiben wollen
Zwei Superstars der Kriminalliteratur öffnen ihren Werkzeugkasten. Stephen King empfiehlt: Lies viel, schreib viel. Möglichst jeden Tag. Streiche Adverbien behutsam Kill your darlings: Kürze Passagen, die die Geschichte nicht voranbringen. Patricia Highsmith rät: Sammle Ideen, Motive und Szenen in einem Notizbuch. Statte den Mörderhelden mit sympathischen Eigen-


»Unter den Toten habe ich ziemlich viele Freunde«
Yasmina Reza, »Die Rückseite des Lebens«
Ella ist in Madeleine verliebt. Aber warum beklaut sie ihre Freundin?

schaften aus, so entsteht Spannung. Lerne das Milieu deiner Figuren kennen, indem du mit Personen aus diesem Milieu Zeit verbringst. Patricia Highsmith: Suspense, Diogenes 1990, 132 S.; Stephen King: Das Leben und das Schreiben, Heyne 2011, 386 S.
Eine Kulturgeschichte des Mordes
An Quellen mangelt es nicht. Denn seit es den Menschen gibt, bringt er andere Menschen um, und seit es die Schrift gibt, schreibt er darüber. Der Mord begegnet uns in Dramen, Krimis, Beweisaufnahmen, forensischen Gutachten. Diese kleine Kulturgeschichte des Mordes erklärt am Beispiel berühmter Fälle in Realität, Film und Literatur, wie die Suche nach dem Täter sich weiterentwickelt hat, von der Folter über den Fingerabdruck bis zum DNA-Beweis. Jörg von Uthmann: Killer, Krimis, Kommissare, C. H. Beck 2006, 294 S.
Das habe ich geklaut?!
Wenn Sie nur eine herzwärmende Graphic Novel lesen mögen über zwei verliebte Schülerinnen – Ella und Madeleine –, die ein Geheimnis zusammenführt und deren Liebesgeschichte so traumhaft leicht und klar gezeichnet ist, dass Sie immer wieder zu diesem Buch greifen werden, dann, bitte sehr, ist Lucie Bryons Diebin genau das Richtige für Sie! Reprodukt 2023, 208 S.
Ein Benediktinerkloster in Italien 1327. William von Baskerville soll den Todesfall eines Mönchs aufklären. Es folgen weitere Morde und ein Showdown im Labyrinth der Bibliothek. So gemein wie hier wurde Gift selten unter die Opfer gebracht. Umberto Eco: Der Name der Rose, dtv 1986, 680 S.
Messer
1841 begründet Edgar Allan Poe mit seiner Kurzgeschichte Der Doppelmord in der Rue Morgue die moderne Kriminalliteratur. Im Mittelpunkt steht ein Rätsel: Wie konnte der Täter flüchten, wenn die Morde in einem von innen verschlossenen Raum verübt wurden? Spoiler: Detektiv C. Auguste Dupin findet es heraus. Reclam 2023, 77 S.
Ruder
Tom Ripley nimmt die Identität eines Mannes an, den er auf einem Ruderboot beseitigt. Die Tatwaffe liegt nahe. Dann versenkt er das Boot. Patricia Highsmith: Der talentierte Mr. Ripley, Diogenes 1971, 432 S.
Axt
Fjodor Dostojewskis Verbrechen und Strafe als Graphic Novel? Das geht! Weil es Bastien Loukia hervorragend gelingt, geistige Zustände in Bildern und deren Anordnung darzustellen. Knesebeck Verlag 2020, 160 S.
Ein großer Wurf
Der spanische Autor Antonio Altarriba –ausgezeichnet mit dem Großen Baskischen Literaturpreis – arbeitet mit dem Zeichner Keko seit Jahren an einem Graphic-NovelDreiklang über die Facetten des Verbrechens. Nun ist nach Ich, der Mörder (2015) und Ich, der Verrückte (2021) der neue Band erschienen: Ich, der Lügner. Das ist ein baskischer Populist, der in den Strudel dreier Morde gerät. Avant 2025, 168 S.
Die Augen, immer die Augen: Da sind die von Schrecken geweiteten von Peter Lorre im Krimi M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931, 107 Min). Dann die hypnotischen Augen in Das Testament des Dr. Mabuse (1933, 115 Min.)! »Ich bin ein Augenmensch«, hat Regisseur Fritz Lang gesagt. Er selbst trug nach einer Augenverletzung die meiste Zeit seines Leben ein Monokel.
Viele Jahre vor Parasite drehte Oscar-Gewinner Bong Joon Ho den Krimi Memories of Murder. Schauplatz: das vom Militär regierte Südkorea 1986. Außergewöhnlich und auf seine Art mutig inszeniert! 2003, 132 Min.
1994, zum Schießen
In der Internationalen Filmdatenbank ist Die Verurteilten (1994, 142 Min.) der bestbewertete Film. Es geht um die Freundschaft zweier Gefängnisinsassen. 1994 war für Krimis auch sonst ein gutes Jahr: Quentin Tarantino revolutionierte mit Pulp Fiction (154 Min.) den Gangsterfilm.
6x Banken und Tresore
1. Rififi (1955, 115 Min.), 2. Bonnie und Clyde (1967, 107 Min.), 3. Hundstage (1975, 119 Min.), 4. Bang Boom Bang (1999, 104 Min.), 5. Ocean’s Eleven (2001, 112 Min.) und, klick: 6. Victoria (2015, 140 Min.)
Verstehe einer die Kinder
Die Netflix-Serie Adolescence ist weltweit ein Hit Sie erzählt die Geschichte eines 13-Jährigen, der eine Mitschülerin ermordet haben soll – jede Folge ist wie ein Sog, es gibt keinen einzigen Schnitt. »Makellos«, schreibt die britische Presse, »ein Meisterwerk«, befindet die taz, die Serie »macht auf beinahe jeder Ebene sprachlos«, so der Spiegel. Alle haben recht, aber Vorsicht: ist auch starker Tobak. 2025, 4 Episoden
So viele Verdächtige!
Noch mal Netflix. In der Serie The Residence wird ein Mann ermordet – und das im Weißen Haus! Damit beginnt der Rätselspaß. Denn: Wer war’s? 2025, 8 Episoden
1950er
Ein Krimi mit Hans Albers und Hildegard Knef, in dem er einen Lkw-Fahrer spielt, der durch Zufall an 20.000 Mark kommt; sie ist eine Anhalterin, die nicht zufällig mit ihm flirtet? Deutscher Filmpreis für Drehbuch und Regie? Warum kennt kaum jemand den Film Nachts auf den Straßen (1952, 111 Min.)? Das muss sich ändern!
1960er
»Hier spricht Edgar Wallace!« Diese Begrüßung durfte in keiner Verfilmung der Krimis des englischen Autors fehlen. Bereits die erste war ein Riesending: Mehr als drei Millionen Menschen lockte Der Frosch mit der Maske (91 Min.) 1959 ins Kino – in den Sechzigern folgten 33 weitere Filme.
1970er
Am 29. November 1970 begann etwas, das bis heute kein Ende hat: Die erste Folge der Fernsehserie Tatort lief in der ARD. Seitdem gesendet wurden mehr als 1.300 Folgen, in gut 100 davon ermittelt Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) – Rekord!
1980er
Noch eine Kuriosität: Im Science-FictionFilm Kamikaze 1989 geht Polizeileutnant Jansen einer Bombendrohung nach. In der Hauptrolle: Rainer Werner Fassbinder, kurz vor seinem Tod. 1982, 106 Min.

»Wir schalten zu Konrad Toenz nach Zürich«
Aktenzeichen XY ... Ungelöst hat seinen festen Platz in der Fernsehgeschichte der Bundesrepublik. Seit 1967 läuft die Verbrecherjagd im ZDF. Regina Schillings Dokumentation Diese Sendung ist kein Spiel – die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann (2023, 87 Min.) wirft ein Licht auf das Frauenbild des Erfinders der ersten True-Crime-Serie.
Euer Ehren!
Der goldene Moment in der Gerichtssimulation Ace Attorney ist gekommen, wenn die Hauptfigur »Einspruch!« rufen kann. Denn dann haben sie sich endlich ausgezahlt, die Kreuzverhöre und Ermittlungen. Dann ist der Täter gefunden, der Anwalt glücklich, der Fall gelöst. Und auf geht’s zum nächsten! Capcom, 2001+, versch. Plattformen
Sag, wie bist du gestorben?
Lucas Pope arbeitet stets allein – und seine Games sind etwas Besonderes. In Return of the Obra Dinn untersucht man ein eigentlich verschwundenes Schiff, das plötzlich an der Küste strandet, die Crew tot. Der Clou: Der Ermittler hat ein Gerät, das ihn die Todesmomente der Leichen erleben lässt. Uiuiui. 2018+, versch. Plattformen


Tod unter dem Kirschbaum
Ganz der japanischen Kultur verpflichtet ist das Abenteuer The Centennial Case: A Shijima Story. Die Kriminalautorin Haruka Kagami muss vier Morde lösen, die innerhalb eines Jahrhunderts verübt wurden. Interessant: Das Spiel ist ein interaktiver Film. Wer ganz tief darin versinken will, sollte es auf Japanisch spielen (ja, es gibt Untertitel). Square Enix, 2022, verschiedene Plattformen
»Hallo, hier spricht der Tod, und Sie haben noch fünf Minuten«
Sechs Staffeln lang präsentiert Bastian Pastewka im Podcast Kein Mucks! bereits Krimiklassiker aus den ARD-Radioarchiven. In denen wird viel geraucht, und es passiert nie etwas wirklich Verstörendes – gute Kost also zum Einschlafen. Alle Folgen in der Audiothek unter t1p.de/haendehoch.
Der Wunderdoktor
Ein Heilpraktiker propagiert die »basische Diät« und gründet ein Wellnesszentrum auf seiner Ranch in Südkalifornien. Er redet Krebspatientinnen ein, das »saure Milieu« des Körpers mache sie krank. Diese sechsteilige Podcast-Serie erzählt von Robert Young und den Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben. Eine amerikanische Geschichte, die aber der universellen Dramaturgie der Quacksalberei folgt. Chameleon: Dr. Miracle, Podcast, versch. Plattformen
Erinnern
Ganz neu gestartet ist ein digitaler Atlas zu den Verbrechen des Nationalsozialismus. Er zeigt mehr als 25.000 Fälle von NS-Unrecht an Tausenden Orten in Deutschland und ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, zu den jeweiligen Taten zu recherchieren. Damit die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Zu finden unter nazicrimesatlas.org
Absichern
KommGutHeim heißt eine App für iOS und Android, mit der man den eigenen Standort live mit Freunden oder Verwandten teilen oder im Notfall Hilfe rufen kann –damit man zumindest virtuell nicht allein ist, wenn man zum Beispiel nachts nach Hause gehen muss. arrivesafe.app
Knobeln
Sie haben Lust, mit Ihrem Kind gemeinsam Ratekrimis zu lösen? Auf der Website »Schule und Familie« des Sailer Verlags gibt es Detektivgeschichten zum Vorlesen – und alle enden mit einem Rätsel (keine Angst, die Lösung steht dabei!). t1p.de/ratekrimi
Nachschlagen
Ein riesiges Archiv der Fälle der Drei Fragezeichen, von Fans für Fans? Mit einem Personenverzeichnis, Interviews, Biografien von Autorinnen und Autoren? Gibt es! Und es versteckt sich hier: 3fragezeichen.de

Verbrechen sind nicht alles: Weitere lesenswerte Neuerscheinungen
In Der Anfang aller Köstlichkeit erzählt Markus Bennemann, wie köstliche Speisen den Aufstieg des Allesfressers Homo sapiens ermöglichten. Goldmann, 400 S.
Dass Sprachen sich einer Landschaft anpassen, das erklärt Laura Spinney am Beispiel des Indoeuropäischen in ihrem klugen Buch Der Urknall unserer Sprache. Hanser, 334 S.
Der Historiker Nikolas Jaspert führt uns in Fischer, Perle, Walrosszahn die Schönheit eines besonderen Zeitalters vor Augen – aus der Warte des Meeres. Eine andere und fesselnde Geschichte des Mittelalters. Propyläen, 590 S.
Der große Natur-Beschreiber Robert Macfarlane nimmt uns mit auf eine Reise in die weite Welt und fragt: Sind Flüsse Lebewesen? Ullstein, 432 S.

In Das Leben der Formen philosophieren Emanuele Coccia und Alessandro Michele über Sehnsüchte, Vollkommenheit und Schönheit –kurzum: über Mode. Hanser, 254 S.
Wie geht es dir? Diese Frage steht immer am Anfang. Das Ergebnis: 60 gezeichnete Gespräche nach dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas. Comic, Avant, 136 S.
Der Ökonom Timothée Parrique erklärt in Wachstum bremsen, wie eine Wirtschaft gesund schrumpfen kann. Eine Degrowth-Utopie. Fischer, 368 S.
Am Anfang jeder Ausgabe von ZEIT WISSEN stellen wir drei Fragen. Am Ende des Heftes wünschen wir uns jetzt von Ihnen eine Frage. Welche kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Bild aus dem Flugzeugcockpit rechts betrachten?
Schreiben Sie uns bitte bis zum 13. Juli 2025. Die beste eingesandte Frage beantworten wir in der nächsten Ausgabe. Gewinnen können Sie den aktuellen ZEIT-Bildband »Hotels zum Verlieben«
Die Redaktion erreichen Sie unter: zeitwissen@zeit.de

Social Media:
Folgen Sie uns auf Instagram unter @zeitwissen und auf facebook.com/zeitwissen
Archiv:
Frühere Ausgaben des ZEIT WISSEN-Magazins können Sie unter zeit.de/zw-archiv bestellen

Podcast:
Unser ZEIT WISSEN-Podcast »Woher weißt Du das?« erscheint alle zwei Wochen mit Reportagen, Hintergrundinfos und Interviews zu spannenden Themen. Zu hören ist er unter zeit.de/zeitwissen-podcast sowie auf Spotify und allen anderen großen Podcast-Plattformen.
Herausgeber Andreas Sentker Chefredakteur Andreas Lebert Art-Direktion Wiebke Hansen Redaktion Hella Kemper, Dr. Max Rauner, Katrin Zeug Bildredaktion Lisa Morgenstern Layout Christoph Lehner Autoren Niels Boeing, Tobias Hürter, Sven Stillich Mitarbeiter dieser Ausgabe Eliana Berger, Bernd Brunner, Marie Castner, Noah Hildebrandt, Chiara Joos, Johanna Michaels, Till Raether, Dr. Stefan Schmitt, Ulf Schönert, Lenja Stratmann Onlineredaktion Jochen Wegner (verantw.) Korrektorat Thomas Worthmann (verantw.), Oliver Voß (stellv.) CPO Magazines & New Business Sandra Kreft Director Magazines Malte Winter Marketing Elke Deleker Vertrieb Sarah Reinbacher Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Silvie Rundel Anzeigen ZEIT Advise, Lars Niemann (CSO), www.advise.zeit.de Herstellung Torsten Bastian (verantw.), Oliver Nagel (stellv.) Repro Mohn Media Mohndruck GmbH Druck Firmengruppe APPL, appl Druck, Wemding Anzeigenpreise ZEIT Wissen-Preisliste Nr. 21 vom 1. Januar 2025 Abonnement Jahresabonnement (6 Hefte) 49,80 Euro, Lieferung frei Haus, Auslandsabonnementpreise auf Anfrage; Abonnentenservice: Telefon 040/42 23 70 70, Fax 040/42 23 70 90, E-Mail abo@zeit.de, www.zeit.de/zw-abo Anschrift ZEIT WISSEN, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg, Telefon 040/32 80-0 Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: produktsicherheit@zeit.de.
Diese Ausgabe enthält in einer Teilauflage eine Publikation von RSD Reise Service Deutschland GmbH, 80687 München.


Es war einmal ein Mädchen, das man das Rotkäppchen nannte. Eines Tages schickte seine Mutter es los, um der Großmutter Kuchen und Wein zu bringen. »Komm ja nicht vom Weg ab«, warnte die Mutter. Es war auch einmal ein Mädchen mit Haar, so schwarz wie Ebenholz, der eine alte Frau einen roten Apfel anbot, und es waren einmal zwei Kinder, die hungrig vor einem Haus aus Lebkuchen standen. Sie alle konnten nicht widerstehen. Und wurden vom Wolf gefressen, vergiftet oder in den Ofen gesteckt. Vor Verführung, so meinte man einmal, müsse man sich hüten – denn sie sei das Werk des Teufels.
Heute wissen wir, dass nicht der Teufel, sondern unsere Biologie dafür sorgt, dass wir zu Verführten werden. Was gleich geblieben ist: Das ganze Spiel klappt dann am besten, wenn es unbemerkt bleibt. In einer Studie aus dem Jahr 2002 fand der Sozialpsycho-
Vielen Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen zu diesem Bild im vorigen Heft. Gewonnen hat die Frage von Helga Klein
loge Robert Levine heraus, dass die meisten Menschen ihre eigene Fähigkeit, Manipulation zu erkennen, überschätzen: 77 Prozent der Befragten hielten sich für »überdurchschnittlich scharfsinnig«. Eine teuflische Fehleinschätzung: »Je mehr wir von unserer Immunität überzeugt sind«, schreibt Levine, »desto weniger neigen wir dazu, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen« – und werden eher verführt. Die Werbeindustrie weiß das natürlich. Sie platziert Produkte möglichst unauffällig in Filmen und macht manche Werbespots selbstironisch, um der Zuschauerin zu vermitteln: »Keine Sorge, um darauf reinzufallen, bist du viel zu schlau.« Ist man allerdings oft nicht.
Zum Glück geht es beim Verführen nicht immer nur ums Geld. Beziehung, Liebe, Sex sind der Verführung andere Leidenschaft. Eine Sache funktioniere da besonders gut, sagt Lars Penke, Professor für Biologische Persönlichkeitspsychologie an
der Georg-August-Universität Göttingen: »Ambiguität«. Das heißt: Man sendet dem Gegenüber Signale, die unterschiedlich gedeutet werden können. Zu klare Signale turnen eher ab. Weiß die andere Person sofort, dass man Interesse hat, erfährt sie dadurch bereits Bestätigung. Sind die Signale dagegen uneindeutig, muss sie die Bestätigung erst suchen: Mag sie mich wirklich? Meint er das ernst? Habe ich eine Chance? »Das motiviert, mitzumachen«, sagt Penke. »Es ist wie beim Computerspielen: Ist es weder zu leicht noch zu schwer, ist man besonders engagiert, ans Ziel zu kommen.« Das war einer von vielen kleinen Tricks. Das ganze Rezept für gute Verführung muss geheim bleiben. Wenn es überhaupt eines gibt. Denn würde es bekannt, wäre die ganze Spannung dahin. Es gäbe keine Ungewissheit mehr und damit auch keine Verführten. Seien Sie also vorsichtig mit Anleitungen, so verführerisch die auch sind.
Sechs Jahre lang planten tschechische Behörden den Bau mehrerer Dämme, um Wiesen in der Region Brdy wieder in Feuchtgebiete zu verwandeln. Während die Verwaltung mit Abstimmungen, Planung und Genehmigungen beschäftigt war, errichtete kurzerhand eine Biberfamilie die Staudämme. »Es ist gut, dass die Biber uns zuvorgekommen sind –auch, weil wir das gar nicht so gut hinkriegen würden«, sagte Bohumel Fišer, der für das Naturschutzgebiet zuständig ist, der Tagesschau. »Die Biber haben einfach ein viel besseres Gespür für die Landschaft als wir Menschen mit unserer technischen Sicht. In der Zeit, in der die Biber gebaut haben, hätten wir nicht mal eine Baugenehmigung bekommen.«
Zehn Jahre lang hat Alexander Badyaev, Professor für Ökologie an der University of Arizona, den Biber intensiv erforscht. Vom Biber-Bauwerk in Tschechien ist er wenig überrascht. »Um hoffnungslos trockene Gebiete im Westen der USA zu retten, planen Menschen unzählige Dinge und verfangen sich in Bürokratie«, sagt er. »Wenn sie nach Jahren mit einem Plan zurückkommen, stellen sie überrascht fest, dass ihre Arbeit schon erledigt wurde – von Bibern.« Badyaev findet es bedauernswert, dass der Mensch erst jetzt beginnt, die Arbeit des Bibers zu schätzen.
Handlungsorientierte Menschen hingegen können negative Emotionen besser regulieren und sich auf ein Ziel fokussieren. Studien legen nahe, dass handlungsorientierte Menschen gut darin sind, anspruchsvolle Aufgaben erfolgreich zu erledigen.
Wir wissen nicht, was ein Biber denkt, aber sein Verhalten ist derart hand lungsorientiert, dass der Mensch ihn mit dem Aufkommen der Industrialisierung beinahe ausgerottet hätte. Man störte sich an den Überflutungen, die von Biberdämmen verursacht werden. Heute weiß man: Viele Ökosysteme in Nordamerika verdanken wir dem Biber.

In Europa soll der Biber als Ökoingenieur nun auch gründlicher erforscht werden. Im EUgeförderten Projekt BIBOB wollen Biologinnen, Ökologen und Ingenieure herausfinden, ob Biberdämme im Grenzgebiet von Sachsen und Tschechien der Natur helfen können, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen.
Der Mensch hat damit Probleme.
Der Biber nicht
Die Psychologie unterscheidet zwischen lage- und handlungsorientierten Typen. Lageorientierte Typen beschäftigen sich intensiv mit ihrer momentanen Situation und denken lange über schwierige Entscheidungen nach. Sie neigen zum Grübeln.
Text Lenja Stratmann
Die Hoffnung: Feuchtgebiete, die aus Biberdämmen hervorgehen, können die Biodiversität erhöhen und Waldbrände einhegen. Daraus kann der Mensch etwas lernen. Torsten Heyer von der Technischen Universität Dresden ist Bauingenieur und Mitglied des Teams. Er hadert mit der Bürokratie und sagt: »Man sollte den Menschen mehr Vertrauen entgegenbringen. Nur mit Kreativitätsspielraum können Dinge entstehen.« Seit Jahren versuchen Fachleute, Biberdämme von Hand nachzubauen und Flüsse ähnlich wie ihre tierischen Kollegen zu renaturieren. »Ich bin beruflich mit dem Biber verwandt«, sagt Torsten Heyer. In Zukunft bauen sie ja vielleicht gemeinsam.
SUSTAINABLE PROVEN CERTIFIED NATURAL SKINCARE SINCE 1986




!


Kontoeröffnungeinfach undschnell in nur 10 Minuten mitLexware Office.
LexwareO fficebietet Buch ha ltung, Geschä ftskon to undBan kkar te in einem! Mi t deutscherI BANu nd Visa Bu siness Debi t Ca rd .Und du ?Hattes tesnochn ie so einfach. Mehr auf of fice.lexwa re.de