20 Jahre ZEIT Geschichte: Das Heft zum Jubiläum
Geschichte
Epochen. Menschen. Ideen



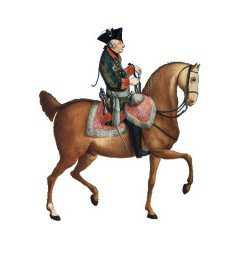
WAS WÄRE GEWESEN, WENN …?
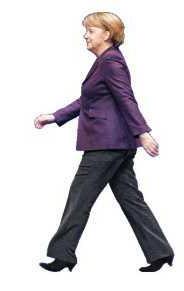
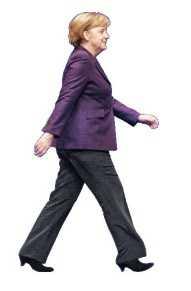
20 Wendepunkte der deutschen Geschichte –und die Frage, wie es auch hätte kommen können
6 Bücher im Schuber für 89,95 €*
WELTWEITE KONFLIKTE VERSTEHEN
nur 14,99 € pro Band

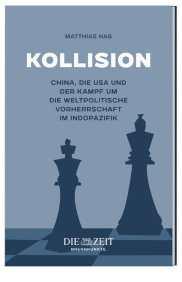

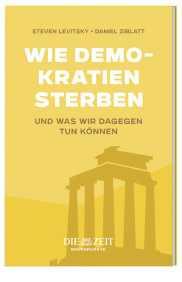
Die ZEIT-Edition »Brennpunkte« bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den drängendsten globalen Krisen unserer Zeit: Vom Erstarken des Rechtsextremismus über den Nahostkonflikt bis hin zum drohenden
Zusammenprall von China und den USA im Indopazifik – sechs herausragende Sachbücher liefern spannende und kenntnisreiche Analysen zu diesen brisanten Themen. Sie untersuchen die Ursachen der Konflikte und bieten wertvolle Lösungsperspektiven.
Die perfekte Lektüre für alle, die unsere komplexe Welt besser verstehen wollen!

* zzgl. 4,95 € Versandkosten
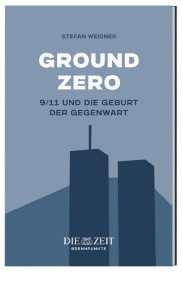
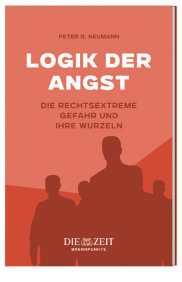
Ihre Vorteile:
Relevanz: 6 Sachbücher zu den bedeutendsten Konflikten der Gegenwart
Umfassende Analysen: Ursachen, Interessen und mögliche Lösungen
Expertise: Hochkarätige Autorinnen und Autoren
Hochwertig: 6 Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen im Schuber, nur 14,99 € pro Band

Glückstreffer
Die angebliche Lebensretterin ist aus Gold und blumenverziert. Diese Tabakdose saß genau richtig, in der Tasche Friedrichs des Großen, als der Tod geflogen kam. So heißt es jedenfalls. In der Schlacht bei Kunersdorf soll sie am 12. August 1759 eine Kugel gefangen haben, die dem Preußenkönig galt. Tatsächlich berichtet ein Augenzeuge von einem »goldene[n] Etui« des Feldherrn, das im Gefecht von einem Geschoss getroffen worden sein soll. Handelte es sich dabei wirklich um jene Tabakdose, die heute samt Kugel als Ausstellungsstück in der Schatzkammer der Burg Hohenzollern zu sehen ist? Nicht wenige Historiker hegen Zweifel.
Für die Faszinationskraft der mythenumrankten Büchse ist es unerheblich, ob die Erzählungen stimmen oder nicht – wir erliegen solchen Momenten, in denen alles auf der Kippe steht, in denen der Zufall sich aufschwingt zum Gebieter über Leben und Tod. Die Geschichte scheint sich zu verdichten auf einen einzigen entscheidenden Augenblick, der noch Jahre oder Jahrhunderte später die Nachgeborenen grübeln lässt: Was, wenn es anders gekommen wäre? Die Tabakdose ist eine Reliquie der Zufallsmacht; sie zeigt, was hätte sein können, aber nie Wirklichkeit wurde. Auch wenn – das haben Reliquien so an sich – die Wahrheit dahinter komplizierter ist. RIE
EDITORIAL

FRANK WERNER Chefredakteur
Mehr als ein Ende
Wer im Krimi zuerst auf die letzte Seite blättert, wird von seinen verblüffenden Wendungen nicht überrascht. Er liest den Roman wie einen Zieleinlauf. Ähnlich blicken wir auf die Vergangenheit. Wir betrachten die Geschichte von ihrem bekannten Ende her, und es scheint, als strebe sie auf dieses Ende zu, als sei alles Vor geschichte. Überhaupt halten wir oft nur die Geschichte für möglich, deren Ende wir kennen – obwohl es viele Enden hätte geben können.
Für die Zeitgenossen ist die Geschichte ein Buch, das noch nicht geschrieben ist. Darum hat der Historiker Thomas Nipperdey einmal gefordert, der Vergangenheit nicht die »Fülle der möglichen Zukunft« zu rauben. In diesem Sinne möchte unser Jubiläumsheft – ZEIT Geschichte feiert 20. Geburtstag – das Bewusstsein dafür schärfen, wie offen und ungewiss die Geschichte ist. Wir blicken auf 20 Schlüsselmomente, in denen die Zukunft der Deutschen auf Messers Schneide stand. Folgenreiche Beschlüsse, Attentate, bedeutende Schlachten, Schicksalsschläge: Oft schnurrt die Geschichte auf einen einzigen Augenblick zusammen, in dem sich alles entscheidet. Wir zeigen, wie es gekommen ist – und wie es auch hätte kommen können. Historiker sind Anwälte des Faktischen, mit überschaubarer Toleranz für Spekulationen. Und doch gehört kontrafaktisches Denken in ihr Metier. Wer wissen möchte, wie Adenauer die frühe Bundesrepublik prägte oder warum die Friedliche Revolution in der DDR friedlich blieb, prüft unwillkürlich die Alternativen. Seriöse Szenarien beginnen auf dem Boden historischer Realität und entschweben nicht in schöngeistige Höhen – in diesem Heft ist kein auferstandener Hitler »wieder da«, um durch Nachkriegsdeutschland zu geistern. Unsere Autorinnen und Autoren schildern reale Situationen, die so oder so hätten ausgehen können – und bei denen der tatsächliche Ausgang mitunter der überraschende war. Viel sprach dafür, dass Georg Elsers Bombe Hitler töten würde, hätte eine Verkettung von Zufällen den Diktator nicht zu lebensrettender Eile getrieben. Was wäre gewesen, wenn ...? Das Nachdenken über ungeschehene Geschichte hilft uns, die wirklichen Triebkräfte besser zu verstehen. Wie weit schränken Machtverhältnisse und Mentalitäten den Raum des Möglichen ein? Was kann der Einzelne ausrichten? Im Licht ihrer unverwirklichten Möglichkeiten erscheint uns die Geschichte nicht mehr wie ein Zieleinlauf, sondern als Produkt aus Chancen, Zufällen und Zwängen. Wer in Alternativen denkt, kann besser nachvollziehen, warum es so kam, wie es nicht kommen musste.
Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Heft mit überraschenden Einsichten – auch in die gegenwärtigen Krisen. Denn wenn die Geschichte offen ist, dann ist sie auch offen für eine bessere Zukunft.

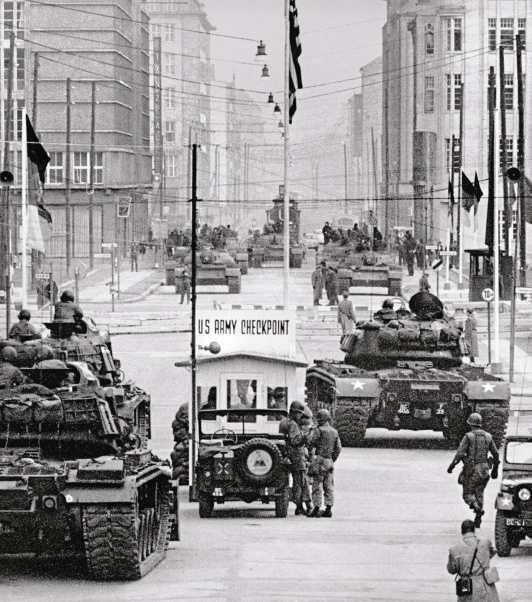
100
Konfrontation: Im geteilten Berlin stehen sich amerikanische und sowjetische Panzer (im Hintergrund) gegenüber. Die Krise im Oktober 1961 ist eine der gefährlichsten des Kalten Krieges. Was wäre geschehen, wenn sie eskaliert wäre?

94
Knapper Sieger Mit nur einer Stimme Mehrheit wird Konrad Adenauer 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Ohne ihn wäre die Bundesrepublik ein anderes Land geworden
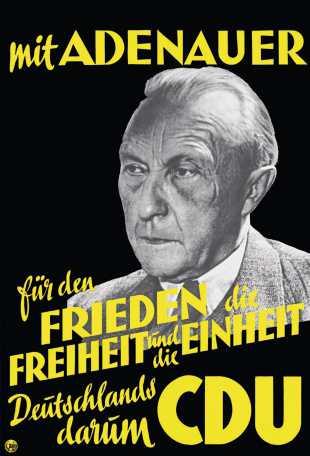


44
Im Namen des Friedens
Mit dieser Pistole feuert ein Attentäter im Mai 1866 auf Bismarck. Hätte ein erfolgreicher Mordanschlag Preußens »Bruderkrieg« gegen Österreich verhindert?
INHALT
Geschichte, wohin?
Sechs Momente der Entscheidung 6
Narben der Zeit
Über Kontinuität und Zufall in der Geschichte
Von Dan Diner 18
»Unabsehbar viele neue Möglichkeiten«
Der Historiker Richard Evans über kontrafaktisches
Denken und Alternativen zu Hitler 20
1. Vorschlag zur Güte
Hätte eine Einigung mit Luther die Spaltung der Kirche verhindert? Von Tillmann Bendikowski 26
2. Das Gemetzel hätte früher enden können
Der Frieden war im Dreißigjährigen Krieg nach elf Jahren zum Greifen nah Von Raoul Löbbert 32
3. »Mein Unglück ist, dass ich noch lebe«
Friedrich dem Großen kam ein »Mirakel« zu Hilfe.
Hat es Preußen gerettet? Von Samuel Rieth 34
4. Ein Kaiser von Volkes Gnaden
Schon 1849 hätte ein deutscher Nationalstaat entstehen können Von Ralf Zerback 40
5. Keine Durchschlagskraft
Bismarck überlebt 1866 ein Attentat – hätte sein
Tod einen Krieg abgewendet? Von Ute Planert 44
6. Das deutsche Duell
Die Schlacht bei Königgrätz entscheidet über die Zukunft Europas Von Alexander Cammann 48
7. »Eine Tragödie für die Deutschen«
Friedrich III., der Hoffnungsträger der Liberalen, ist nur 99 Tage Kaiser Von Volker Ullrich 54
8. Bei Mord Krieg?
Dem Anschlag in Sarajevo hätte 1914 kein Weltkrieg folgen müssen Von Christoph Nonn 58
9. Passage am Polarkreis
Was, wenn Lenin 1917 die Einreise nach Russland verwehrt worden wäre? Von Markus Flohr 63
10. Wie die Revolution gelungen wäre
In Deutschland war 1918/19 ein echter Umsturz möglich – der Sozialist Hugo Haase entwarf das Szenario dafür Von Klaus Latzel 64
11. Retter der Republik
Friedrich Ebert starb früh. Hätte Weimar mit ihm eine Chance gehabt? Von Bernd Braun 70
12. Letzte Ausfahrt Rheinland
Im März 1936 hätte Frankreich Hitler in den Arm fallen können Von Andreas Molitor 74
13. Dann hätte es keinen Holocaust gegeben
Nur durch großes Glück entgeht Hitler 1939 dem Anschlag Georg Elsers Von Michael Wildt 80
14. Das Wunder von Dünkirchen
Die Wehrmacht lässt 1940 das Gros des britischen Heeres entkommen Von Hauke Friederichs 86
15. Kartoffelacker oder Aufbauhilfe
US-Finanzminister Morgenthau will Deutschland deindustrialisieren Von Manfred Berg 90
16. Ära ohne Adenauer
Wenn eine Stimme gefehlt hätte: Welchen Weg wäre die Bundesrepublik gegangen? Von Norbert Frei 94
17. Showdown der Supermächte
1961 hätte sich am Checkpoint Charlie beinahe der Dritte Weltkrieg entzündet Von Andreas Etges 100
18. »Jetzt nur keine Panik«
Ein sowjetischer Offizier bewahrt die Welt 1983 vor der Zerstörung Von Michael Thumann 106
19. Unwahrscheinliches Glück
Viele fürchten 1989 in der DDR, dass der Staat den friedlichen Protest mit Gewalt erstickt Von Franka Maubach 108
20. Grenze offen, Grenze dicht
Zwei Perspektiven auf den September 2015: Was, wenn Angela Merkel die Flüchtlinge nicht ins Land gelassen hätte?
Von Heinrich Wefing und Andreas Rödder 114 Bücher / Bildnachweise / Impressum 120
TITEL: Adolf Hitler, 1937; Friedrich der Große, 18. Jahrhundert; Angela Merkel, 2007 (Montage)
Tage der Angst
Im Oktober 1962 steht die Welt an der Schwelle eines Atomkriegs. Die Sowjetunion hat atomar bestückbare Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert, die USA reagieren mit einer Seeblockade der Insel. Erst nach knapp zwei Wochen wird die Krise diplomatisch entschärft, die Welt atmet auf. Das Bild entstand im November: Ein amerikanischer Aufklärer überfliegt den Zerstörer »USS Barry«, der einen sowjetischen Frachter aus der Sperrzone um Kuba eskortiert
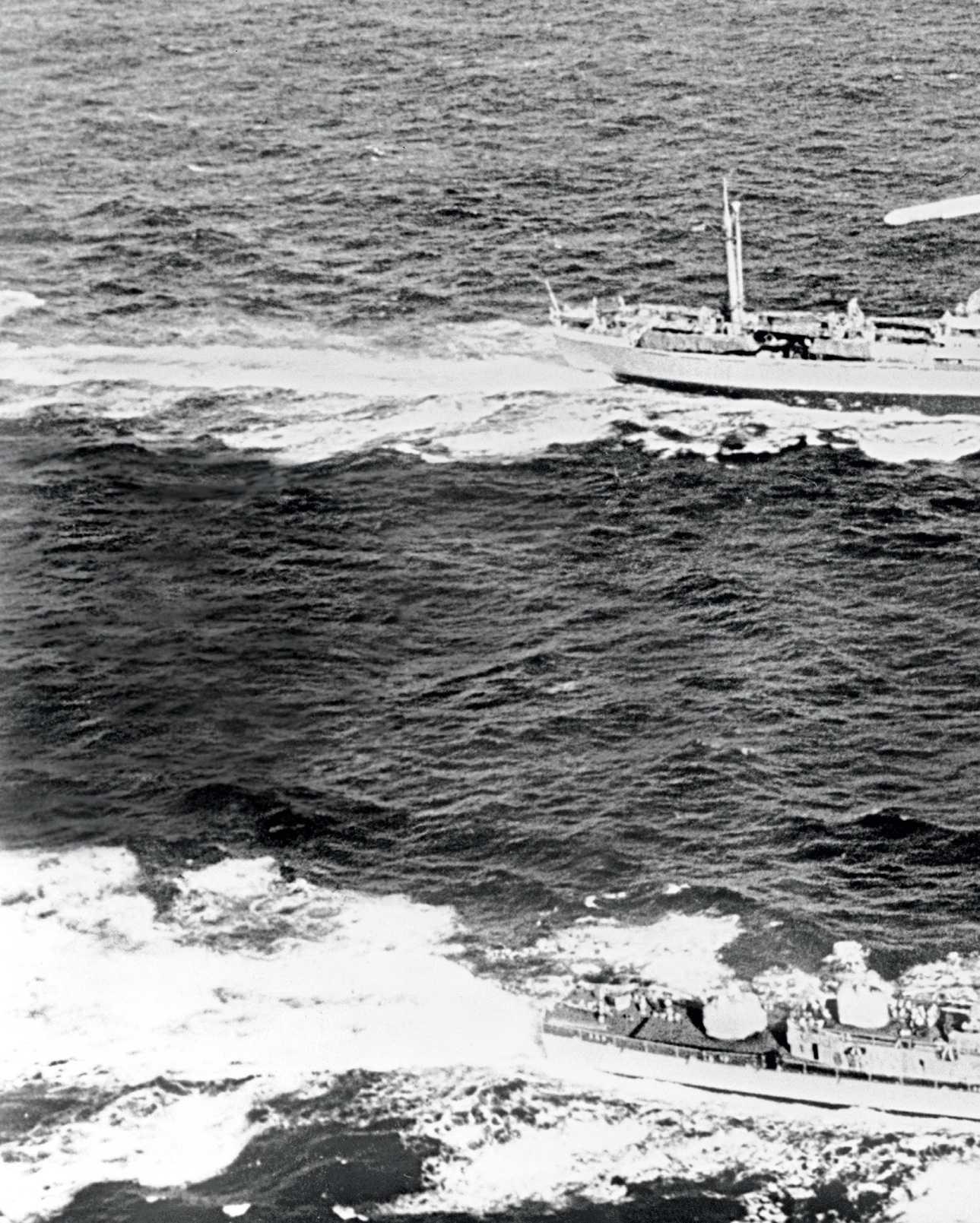

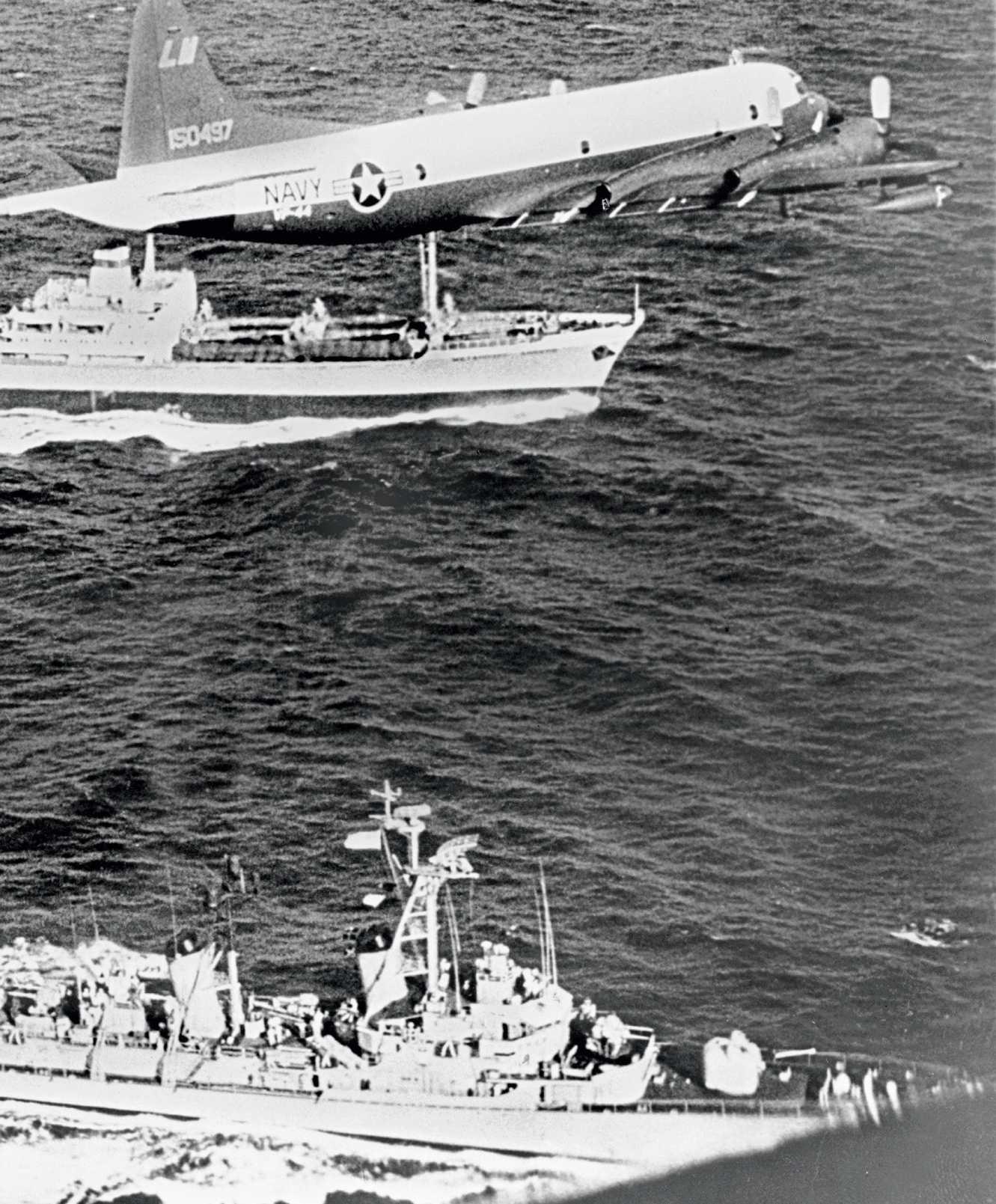
Geschichte, wohin?
Wenn der Kurs noch nicht bestimmt ist: Sechs Momente, in denen die Zukunft gemacht wird
Gorbis Handreichung
Am 15. Juli 1990 reisen der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher (l.) und Kanzler Helmut Kohl (r.) in den Kaukasus auf die Datscha des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow. In rustikaler Atmosphäre sprechen die Politiker über die Bedingungen der Wiedervereinigung.
Gorbatschow schwankt noch in der Frage, ob Deutschland Teil der Nato werden darf.
Am Ende des Treffens steht fest, dass die Bundesrepublik souverän über ihre Bündniszugehörigkeit entscheiden darf. Genscher und Kohl haben die günstige Gelegenheit genutzt –einige Jahre später schließt sich das Zeitfenster, in dem Moskau zu solchen Zugeständnissen bereit war






Die Hoffnung stirbt zuerst
Mitglieder der Ehrengarde der Knesset tragen am 6. November 1995 Izchak Rabin zu Grabe, der zwei Tage zuvor einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Israels Ministerpräsident war unter religiösen Hardlinern verhasst, weil er im Konflikt mit den Palästinensern einer Zweistaatenlösung zugestimmt und PLO-Chef Jassir Arafat die Hand zum Friedensabkommen gereicht hatte. Auf Rabin folgt als Ministerpräsident bald Benjamin Netanjahu, der den Siedlungsbau im Westjordanland forciert. Wie sähe der Nahe Osten heute aus, hätte Rabin sein Friedenswerk fortsetzen können?



Verwundetes Amerika
Am 11. September 2001 fliegen islamistische Terroristen mit gekaperten Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Center in New York. Um 9.59 Uhr schauen die Menschen entsetzt zu und flüchten, als der Südturm einstürzt. Wenige Tage nach den Anschlägen verkündet US-Präsident George W. Bush den »Krieg gegen den Terror«. Die USA entscheiden sich, nicht nur die Terroristen von Al-Kaida zu bekämpfen, sondern das Völkerrecht auszuhebeln und 2003 in den Irak einzumarschieren. Das hat die Welt verändert –und die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten beschädigt
War der Westen zu schwach?
Am 1. März 2014 fahren russische Truppen ohne Hoheitsabzeichen auf der ukrainischen Halbinsel Krim auf. Ein Soldat postiert sich vor einem ukrainischen Stützpunkt bei Sewastopol, dem Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Später annektiert Russland die Krim und lässt auch Gebiete in der Ostukraine besetzen. Der Westen reagiert halbherzig mit dosierten Sanktionen gegen Politiker, Banken und Unternehmen. Nichts, was Wladimir Putin als echte Gegenwehr aufgefasst haben dürfte. Hat der Westen damals eine Chance vertan, den Diktator zu stoppen?
2022 lässt Putin seine Truppen in die gesamte Ukraine einmarschieren



Schlechte Karten
für Demokraten
Der designierte US-Präsident Donald Trump steigt am 20. Januar 2025, dem Tag seiner Amtseinführung, mit der künftigen First Lady die Stufen zum Weißen Haus empor. Oben warten der abgewählte Joe Biden und dessen Frau Jill. Schon kurz nach der Inauguration beginnt Trump seinen Angriff auf die Demokratie. Und die Frage kommt auf, ob der greise Joe Biden mitverantwortlich ist für den Aufstieg des Zerstörers. Wäre die Präsidentschaftswahl anders ausgegangen, wenn er seine Kandidatur früher aufgegeben und es den Demokraten ermöglicht hätte, bei landesweiten Vorwahlen einen jüngeren Bewerber, eine andere Kandidatin zu küren?



Narben der
Musste es so kommen, wie es gekommen ist? Die Frage stellt sich meist bei besonders dramatischen Ereignissen, die ins kollektive Gedächtnis eingehen. Wie Narben der Zeit kerben sich diese Wendepunkte ins Bewusstsein, als Zäsuren, die sinngebend zwischen »davor« und »danach« unterscheiden.
Nicht erst in der Rückschau, bereits von den Zeitgenossen werden solche Ereignisse als Einschnitte empfunden. Ihre Wirkung ist unmittelbar: Schlagartig verändern sich die Umstände des Daseins. In der jüngeren Geschichte gilt dies etwa für den 9. November 1989, den Mauerfall. Untrüglich war das Empfinden des Epochenbruchs –das Gefühl erlebter Kontingenz.
Kontinuität und Kontingenz, feste Strukturen und plötzliche, unerwartete Wendungen, gehören bei aller Gegenläufigkeit zusammen. Beides formt die Geschichte. Und beides hilft uns, die Frage zu beantworten, ob es kommen musste, wie es kam.
Dafür müssen wir den Blick auf Alternativen zum realen Geschehen richten, auf die Anfänge eines womöglich anderen Ausgangs der Geschichte. Welches Gewicht haben Tendenzen, die in der Vergangenheit zwar angelegt waren, sich aber nicht erfüllten? Solche kontrafaktischen Fragen gehören zum Handwerkszeug der etablierten Geschichtsschreibung. Sie eröffnen ein Erkenntnisfeld, das Anteile des
ZEIT Z EIT
Möglichen, des Wahrscheinlichen und des Wirklichen enthält – und das sich abgrenzt von kontrafaktischen Erzählungen, die der realen Geschichte eine gänzlich andere Wendung geben wollen und die damit zum Genre der Literatur gehören. Nur wer das Mögliche und Wahrscheinliche in der Vergangenheit auslotet, kann die gewordene Geschichte überhaupt bewerten: Ist sie Zufall? Oder historische Notwendigkeit?
Exemplarisch lässt sich dies an zwei Ereignis-Ikonen aus der jüngeren deutschen Geschichte zeigen, die unter Historikern für endlose Kontroversen gesorgt haben: der Machtübertragung auf Adolf Hitler am 30. Januar 1933 und dem Attentat auf den Diktator am 20. Juli 1944. In beiden Fällen kristallisiert die Geschichte in einer einzigen, alles verändernden Entscheidung, beladen mit dem ganzen Gewicht des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts.
War Hitler eine gleichsam notwendige Konsequenz deutscher Geschichte? Dann hätte er nicht unrecht gehabt, als er behauptete: »Ihr habt mich gefunden!« Oder war die Machtübertragung am 30. Januar 1933 eher den obwaltenden Umständen geschuldet? In welchem Verhältnis stehen Kontinuität und Kontingenz? Was war Struktur, was Zufall?
Mit Struktur ist ein in sich verstrebtes politisches Netzwerk gemeint, das kalkulierbare Prozeduren und damit verlässliche Kontinuität produziert. Struktur folgt dem
Modus der Wiederholung und erlaubt es, erfahrene Gewissheiten aus Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft zu projizieren. Strukturen sind also von langer Dauer und reichen weit über den Zeitpunkt des eingetretenen Geschehens zurück.
Die Weimarer Republik war mit überaus schwachen Strukturen gestartet. Dazu gehört eine tiefe Erschütterung des kollektiven Selbstgefühls, ausgelöst durch die Niederlage im Weltkrieg. Folgenreich ist die bereits im September 1918 beginnende Parlamentarisierung des Reiches, eine erste Phase des Regimewechsels, gefolgt von der relativ unbeabsichtigten Ausrufung der Republik. Vielleicht hätte sich die Bewahrung der Monarchie, wenn auch nicht mit diesem Kaiser, als Stabilitätsanker erwiesen. Tatsächlich erhält ein plebiszitär gewählter Reichspräsident potenziell die höchste exekutive Macht: Er kann mit Notverordnungen regieren lassen, sollte der Reichstag nicht aus sich heraus zu einer Regierungsbildung in der Lage sein. Im Frühjahr 1930 tritt dieser Fall ein.
Von nun an übernimmt die Kontingenz das Ruder. Personifiziert wird sie durch den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und die ihn umgebende Kamarilla. In einer undurchsichtigen Gemengelage umgehen Kabalen und Intrigen die prozeduralen Vorgaben der Verfassung, und es dräut die Gefahr eines Bürgerkrieges, den es um jeden Preis zu verhindern gilt. In diesem Chaos aus Machenschaften
Über Kontinuität und Zufall – und warum es lohnt, nach alternativen Geschichtsverläufen zu fragen VON
DAN DINER
und zunehmend personenabhängiger Politik erweist sich der direkte Zugang zum Reichspräsidenten als entscheidender Faktor. Er führt über Oskar von Hindenburg, den, wie es ironisch hieß, »in der Verfassung nicht vorgesehenen« Sohn des Reichspräsidenten.
Hindenburg erliegt den Einflüsterungen Franz von Papens, verwirft seine bisherige Ablehnung Hitlers und ernennt den NSDAP-Chef zum Reichskanzler – in der Annahme, dieser werde eine parlamentarische Regierung bilden und ihn von der Last der Verantwortung erlösen, weitere Präsidialkabinette zu berufen. Der sozialdemokratische Vorwärts hat sich noch am 27. Januar 1933 die ironische Frage erlaubt: »Herrenreiter Papen« oder »Faschingskanzler Hitler«? Das, was alsbald kommen wird, haben die Zeitgenossen nicht erwartet.
Und der 20. Juli 1944? Wie viel Struktur und wie viel Kontingenz ist dem fehlgeschlagenen Attentat auf Hitler beigegeben? Scheiterte der Anschlag an einer Reihe technischer Zufälle, oder war das Misslingen gleichsam vorgeprägt durch die Struktur der »Führer«-Gefolgschaft, die den Widerstand der wenigen mutigen Militärs behinderte?
Versuche und Pläne, Hitler zu beseitigen, gab es etliche, vornehmlich von Angehörigen der Wehrmacht. Die meisten Vorhaben scheiterten nicht zuletzt an den chronisch erratischen Tagesplanungen
Hitlers, die ständig kurzfristigen Veränderungen unterworfen waren. Ein weiteres, womöglich entscheidendes Kriterium für die Erfolglosigkeit war der Umstand, dass die prospektiven Attentäter mit ihrem Tode rechnen mussten und nur die Wenigsten bereit gewesen sein dürften, sich selbst in die Luft zu sprengen. Bei allem Drang zum Handeln ist bei den Militärs eine gewisse Zögerlichkeit zu erkennen, die zurückging auf eine kapillare Tiefen-
20. Juli 1944: Zu viel für einen Attentäter
wirkung des Eides auf den »Führer«. Was den Widerstandskämpfern jedenfalls zu fehlen schien, war die Eindeutigkeit des »Fanatischen« – eine Haltung, die ihren Gegnern nicht abging. Dies vergrößerte die jedem Attentatsplan inhärente Möglichkeit des Scheiterns.
So war das Handeln der Verschwörer, vor allem der Attentäter des 20. Juli 1944, von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten geprägt, angefangen bei der körperlichen Konstitution Claus Schenk Graf von Stauffenbergs: Mit nur noch drei Fingern an nur noch einer Hand schaffte er es in der gebotenen Eile lediglich, einen der beiden Sprengsätze zu schärfen, was die Wucht der Explosion deutlich minderte. Der schwere
Eichentisch, an den er die Tasche mit dem Sprengsatz gelehnt hatte, dämmte die Detonation zusätzlich und schützte den über die Tischplatte gebeugten Hitler.
Nach dem Anschlag musste Stauffenberg wegen seines Führungsauftrages bei der »Operation Walküre« eiligst nach Berlin fliegen. Sein Leben konnte, durfte er nicht einsetzen. Er war sowohl beim Attentat in der ostpreußischen »Wolfsschanze« als auch beim Staatsstreich in Berlin unabkömmlich. Für eine Person war dies zu viel. Die beiden Orte und Handlungen waren über eine komplexe Logistik miteinander verbunden – ein offenes Einfallstor für Zufälle und unvorhersehbare Entwicklungen. Auch das erhöhte die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns.
Es war nicht die von Hitler zitierte »Vorsehung«, die ihn 1933 ins Amt kommen und die ihn 1944 das Attentat überleben ließ. Aber es wäre umgekehrt auch zu einfach, diese beiden Schlüsselereignisse der deutschen Geschichte auf Umstände und Zufälle zu reduzieren. Es kam nicht, wie es kommen musste, aber die tieferliegenden Strukturen wirkten eher in die eine als in die andere Richtung; sie beförderten Hitlers Machtübernahme, und sie erschwerten den Versuch, den Diktator zu töten.

DAN DINER lehrte Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem
»Unabsehbar viele neue Möglichkeiten«
Der britische Historiker Richard Evans erklärt, was uns die kontrafaktische Geschichte lehrt, warum wir die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen oft überschätzen – und welche Alternativen es zu Hitler gab
ZEIT Geschichte: Herr Evans, was wäre gewesen, wenn es in Ihrem Heimatland 2016 beim Brexit-Referendum eine Mehrheit für den Verbleib Großbritanniens in der EU gegeben hätte?
Richard Evans: Die Kampagne für den Austritt aus der EU hatte zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Schwung. Es ist schwer vorstellbar, dass selbst ein knapper Sieg für »Remain« sie noch hätte aufhalten können. Wahrscheinlich hätte die »Leave«-Seite dann für eine zweite Abstimmung gekämpft, um das Ergebnis zu revidieren. Grundsätzlich sollte das Referendum nur beratenden Charakter haben. Premierminister David Cameron hätte die knappe Mehrheit für den Brexit 2016 also auch ignorieren können.
ZEIT Geschichte: Was wieder zu der Frage führt, was dann geschehen wäre ...
Evans: Das ist das Problem: Sobald man von der realen Zeitachse abweicht, kann alles Mögliche geschehen. Aus einer einzigen Entscheidung wie dem Brexit-Referendum, die anders getroffen wird, ergeben sich unabsehbar viele neue Möglichkeiten. Man kann also bestenfalls von Wahrscheinlichkeiten sprechen.
ZEIT Geschichte: Gehört Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht zum Handwerkszeug der Historiker? Wer die Brexit-Folgen beurteilen will, fragt doch unweigerlich, wie die britische Wirtschaft sich bei einem Verbleib in der EU wohl entwickelt hätte.
Evans: Das stimmt, aber wer die ökonomischen Auswirkungen des Brexit untersucht, muss Ereignisse berücksichtigen, die wir nicht hätten vorhersehen können. Zum Beispiel die Wahl Trumps zum US-Präsidenten und seine Importzölle, die weltweit für große Turbulenzen sorgen. Oder Putins Überfall auf die Ukraine, der ebenfalls erhebliche wirtschaftliche Folgen für Europa hatte.
ZEIT Geschichte: Ist die Was-wäre-gewesen-wenn-Frage also nur Spekulation? Oder kann kontrafaktisches Denken auch seriöse Wissenschaft sein?
Evans: Die Grenzen sind fließend. Man sollte zumindest von Entscheidungssituationen ausgehen, vor denen die Zeitgenossen standen, und nicht fragen, was passiert wäre, wenn Hitler einen Autounfall gehabt hätte. Aber ein Großteil der kontrafaktischen Geschichte entspringt dem Wunschdenken konservativer Historiker.

ZEIT Geschichte: Das müssen Sie erklären.
Evans: Linke Geschichtswissenschaftler neigen eher zu der Auffassung, dass die Geschichte sich ohnehin in ihre Richtung bewegt, auf eine bessere Welt hin. Warum also darüber spekulieren, was sonst hätte passieren können? Konservative dagegen haben in ihrer Zeit schon immer viel Beklagenswertes gefunden. Sie denken eher: Wären die Dinge anders gelaufen, wären wir jetzt in einer besseren Lage, und trösten sich mit der Vorstellung, was hätte passieren können. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Frage, was geschehen wäre, wenn Großbritannien und Deutschland im Zweiten Weltkrieg früh einen Separatfrieden geschlossen hätten.
ZEIT Geschichte: Was wäre dann passiert?
Evans: Konservative britische Historiker haben spekuliert, dass das British Empire vielleicht erhalten geblieben und der Wohlfahrtsstaat nicht eingeführt worden wäre. Viele solcher Szenarien laufen auf eine Art konservative Utopie hinaus. In Wien habe ich einmal mit Peter von Hohenberg gesprochen, dem Enkel des Erzherzogs Franz Ferdinand. Ich fragte ihn: Was wäre Ihrer Meinung nach geschehen, wenn Ihr Großvater nicht 1914 in Sarajevo ermordet worden wäre? Er sagte: Dann hätte es keinen Ersten Weltkrieg gegeben und somit später auch keinen Hitler und keinen Holocaust. Alles wäre in Ordnung gewesen, nur weil Franz Ferdinand am Leben geblieben wäre und seine Pläne zur Reform der Habsburgermonarchie hätte umsetzen können. Aber man kann unmöglich wissen, ob Franz Ferdinand nicht eine Woche später unter einen Bus geraten wäre.
ZEIT Geschichte: Liegt Konservativen das kontrafaktische Denken auch deshalb näher, weil sie dem Handeln einzelner Persönlichkeiten größeres Gewicht beimessen, während Progressive eher die Macht gesellschaftlicher Strukturen betonen?
Evans: Ja, die kontrafaktische Geschichte neigt dazu, sich auf die »großen Männer« zu konzentrieren, auf Politik- und Militärgeschichte. Nur sehr wenige kontrafaktische Szenarien befassen sich mit größeren gesellschaftlichen Prozessen.
ZEIT Geschichte: Welchen Nutzen hat also die kontrafaktische Geschichte?
Evans: Wenn man die Überlegungen weiterdenkt, die sich Akteure machten, als sie Entscheidungen trafen, wird deutlich, über welche Handlungsspielräume sie verfügten – und wie klein diese oftmals waren. Als zum Beispiel die britische Regierung 1914 vor der Wahl stand, in den Ersten Weltkrieg einzutreten, war sie tief gespalten. Auch Pazifisten gehörten der Regierung an. Die Kabinettsmitglieder spekulierten darüber, was passieren würde, wenn Großbritannien sich heraushielte. Tatsächlich war der öffentliche Druck, in den Krieg einzutreten, aber einfach zu groß, als dass sie ihm hätten widerstehen können.
ZEIT Geschichte: Der Spielraum Einzelner wird überschätzt?
Evans: Ja, oft gehen kontrafaktische Szenarien davon aus, dass die Handelnden einen völlig freien Willen haben. Tatsächlich wird diese Entscheidungsfreiheit durch viele Faktoren eingeschränkt.
Karl Marx hat es einmal so gesagt: »Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken,
nicht unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.«
ZEIT Geschichte: Laut Niall Ferguson sind diese Umstände heute für Historiker übermächtig geworden: Viele würden ähnlich wie Marx deterministische Geschichtsbilder zeichnen, in denen das Handeln Einzelner oder der Zufall keine Rolle mehr spielen. Hat der prominente Verfechter der kontrafaktischen Geschichte da nicht recht? Neigen wir nicht alle dazu, nur die Geschichte für möglich zu halten, die auch geschehen ist?
Evans: Das Problem ist: Seine kontrafaktischen Szenarien sind viel deterministischer als die übliche Geschichtsschreibung.
ZEIT Geschichte: Inwiefern?
Evans: Ferguson behauptet zum Beispiel, eine einzige historische Veränderung – sagen wir, der Nichteintritt Großbritanniens in den Krieg 1914 – hätte unweigerlich eine ganze Reihe von Ereignissen zur Folge gehabt. Deutschland hätte wahrscheinlich gesiegt, in diesem Fall hätte es keinen Hitler und keinen Holocaust gegeben. Und Großbritannien hätte sich nicht durch zwei Weltkriege finanziell ruiniert und deshalb sein Empire bewahrt. Er zeigt angeblich unvermeidliche Konsequenzen, starre Kausalketten, die viele andere Faktoren, die ins Spiel hätten kommen können, außer Acht lassen.
ZEIT Geschichte: Ist es sinnvoll, solche Szenarien auf die für die Zeitgenossen überschaubare Zukunft zu begrenzen?
Evans: Auf jeden Fall. Nützlich ist kontrafaktisches Denken nur dann, wenn es zeigen kann, welche unmittelbaren Alternativen es in einer Situation gegeben hätte, ohne in die ferne Zukunft zu schweifen. Wir können zum Beispiel fragen: Was wäre in Deutschland geschehen, wenn Hitler 1933 nicht an die Macht gekommen wäre? Welche anderen Möglichkeiten gab es am 30. Januar 1933?
ZEIT Geschichte: Und?
Evans: Höchstwahrscheinlich hätte es eine Militärdiktatur gegeben. Dagegen führt die Vorstellung, die Weimarer Republik hätte noch gerettet werden können, in die Irre. Die Demokratie war zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengebrochen; der Reichstag war schon ausgeschaltet, er hatte seit März 1930 immer seltener getagt. Die einzige Partei in der Weimarer Republik, die fast durchgehend bis zum November 1932 Stimmen gewann, war die KPD. Aber ich glaube nicht, dass für die Kommunisten eine Chance bestand, an die Macht zu kommen. Die Entscheidungsgewalt war längst auf den Reichspräsidenten, auf Paul von Hindenburg und seine Entourage, übergegangen. Deshalb gab es nicht viele echte Alternativen zu Hitler. Gerade das ins Bewusstsein zu bringen, kann kontrafaktische Geschichte leisten.
ZEIT Geschichte: Die Historiker Wolfram Pyta und Rainer Orth haben gezeigt, wie ein Reichskanzler Hitler womöglich hätte verhindert werden können: durch eine breite Querfront General Kurt von Schleichers unter Einbindung von Gregor Strasser, dem zweiten Mann der NSDAP, als Vizekanzler. Eine realistische Option?
Evans: Ich denke nicht. Das zentrale Merkmal der NS-Bewegung war das Führerprinzip. Die Nationalsozialisten konnten keiner
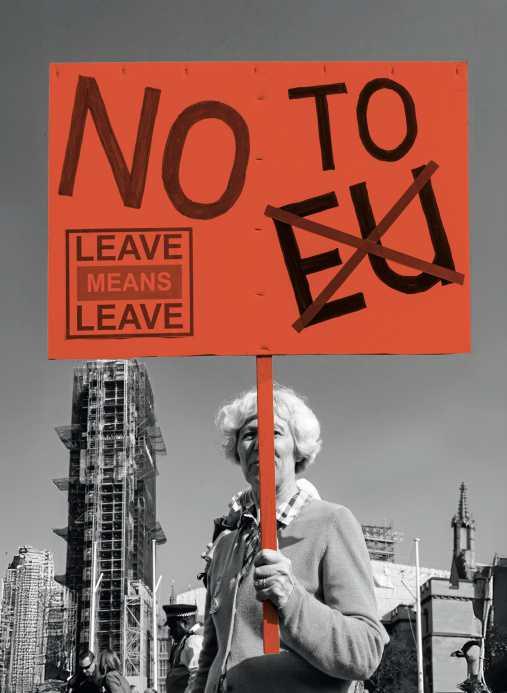
JA ZUR EU: Was, wenn die Briten (anders als diese Demonstrantin in London fordert) den Brexit verhindert hätten?
Koalition beitreten, die Hitler als »Führer« ausklammert oder die NSDAP zum Juniorpartner erklärt, das hätte nicht funktioniert. Außerdem konnte Hindenburg Schleicher überhaupt nicht leiden. Auch solche persönlichen Motive haben eine Rolle gespielt.
ZEIT Geschichte: Hindenburg mochte auch Hitler nicht sonderlich und sperrte sich lange gegen ihn. Was wäre geschehen, wenn Hindenburg sich treu geblieben wäre und den »böhmischen Gefreiten« nicht zum Reichskanzler ernannt hätte?
Evans: Das ist schwer zu sagen. Die Reichswehr hatte nur 100.000 Soldaten, begrenzt durch den Versailler Vertrag. Dagegen gab es zwei Millionen SA-Männer. Deren Gewalt auf den Straßen war massiv. Zudem hatten die bürgerlichen Parteien fast ihre gesamte Wählerschaft an die Nationalsozialisten verloren. Unter den damaligen Bedingungen versuchten Hindenburg und Franz von Papen, einer konservativen, reaktionären Regierung durch die Unterstützung der Bevölkerung Legitimation zu verleihen. Und die einzige Quelle für diese Unterstützung war die NSDAP. Man
glaubte, Hitler einhegen und manipulieren zu können. Das war bekanntlich einer der größten Irrtümer der Geschichte.
ZEIT Geschichte: Und was wäre gewesen, wenn die SPD über ihren Schatten gesprungen wäre und sich 1933 dem Aufruf der KPD zum Generalstreik angeschlossen hätte? Hätte sich Hitler durch eine vereinte Linke noch verhindern lassen?
Evans: Ein Generalstreik ist eine mächtige Waffe. Auf diese Weise wurde 1920 der Kapp-Putsch verhindert. Aber damals herrschte Vollbeschäftigung – 1932 lag die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Ein Generalstreik war damit praktisch undurchführbar geworden: Wer streikte, wäre einfach durch jemanden ersetzt worden, der Arbeit suchte. Außerdem wollte auch die KPD die Weimarer Demokratie zerstören, sie glaubte an ein Sowjetdeutschland nach Stalins Vorbild. Und militärisch waren weder die KPD noch die SPD vorbereitet. Man muss nur schauen, was ein Jahr später, im Februar 1934, in Österreich geschah
ZEIT Geschichte: Dort wagten Sozialdemokraten einen Aufstand gegen den autoritären Ständestaat.
Evans: Die Linke war in Österreich relativ gut bewaffnet, trotzdem wurde sie von der Armee in wenigen Tagen zerschlagen. Letztlich ist schon die Vorstellung, es hätte in Weimar überhaupt zu einer vereinten Linken kommen können, linkes Wunschdenken. Auch wenn es kleine Gruppen in der KPD und der SPD gab, die für eine Zusammenarbeit plädierten: Die Gräben waren viel zu tief. Die KPD hatte der SPD nicht verziehen, dass deren Regierungstruppen 1919 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet hatten. Für die Kommunisten waren die Sozialdemokraten »Sozialfaschisten«, die auf der Seite des kapitalistischen Systems standen.
ZEIT Geschichte: Mindestens ebenso viele Gedankenspiele wie um den 30. Januar 1933 kreisen um den 20. Juli 1944, den Tag des Stauffenberg-Attentats. Was wäre geschehen, wenn Hitler diesen Anschlag nicht überlebt hätte?
Evans: Wäre er getötet worden, hätte der Krieg sicherlich früher enden können, denn die meisten Deutschen identifizierten sich immer noch vor allem mit Hitler. Er war es, der die Deutschen antrieb, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Doch nur sehr wenige hohe Wehrmachtoffiziere unterstützten den Umsturz. Die Waffen-SS war im Juli 1944 durchaus stark und gut bewaffnet –vielleicht wäre ein Bürgerkrieg zwischen SS und Wehrmacht ausgebrochen.
ZEIT Geschichte: Nicht wenige Wehrmachtgeneräle warteten ab, wie sich der Putschversuch in Berlin entwickelt, um am Ende auf der richtigen Seite zu stehen. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass der Walküre-Plan hätte erfolgreich sein können?
Evans: Man muss sich fragen: Was hätte Erfolg bedeutet? Die Verschwörer wollten den Krieg mit einem Friedensabkommen beenden. Aber das war eine Illusion, weil die Alliierten sich schon auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands verständigt hatten. Ich glaube, viele der Verschwörer erkannten schon lange vor dem 20. Juli 1944, dass sie ihre Ziele unter keinen Umständen erreichen konnten. Was sie taten, war eine Art Ehrenrettung Deutschlands.
ZEIT Geschichte: Die Geschichte des 20. Juli hängt von vielen Zufällen ab. Neigen wir dazu, die Zufälligkeit von Ereignissen zu unterschätzen, weil alles einen Sinn haben muss?
Evans: Der Zufall spielt gewiss eine erhebliche Rolle in der Geschichte. Aber ich bleibe dabei, man muss immer auch das Gesamtbild betrachten, die größeren Zusammenhänge, die die Möglichkeiten einschränken.
ZEIT Geschichte: Trotzdem finden viele Historiker die kontrafaktische Geschichte faszinierend. Wann haben Intellektuelle damit begonnen, nicht nur die gewordene, sondern auch die mögliche Geschichte zu beschreiben?
Evans: Dieses Denken lässt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Es gibt einige wunderbare französische Bücher darüber, was passiert wäre, wenn Napoleon 1815 die Schlacht von Waterloo gewonnen hätte. Und in den Napoleon-Apokryphen von Louis Geoffroy aus dem Jahr 1836 erobert der französische Feldherr sogar die ganze Welt und unterwirft alle Muslime

SIR RICHARD EVANS lehrte Geschichte der Neuzeit an der Universität Cambridge und ist Autor des Buches »Veränderte Vergangenheiten. Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte«
dem Christentum – ein Wunschdenken von ungeheurem Ausmaß. Richtig in Mode kam das kontrafaktische Denken aber besonders gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vor allem im Vereinigten Königreich. Die Treiber waren auch dieses Mal die Konservativen, die unter anderem mit der Machtübernahme von Premierminister Tony Blair nicht einverstanden waren.
ZEIT Geschichte: Und die meist auch Euroskeptiker waren, später Befürworter des Brexit. Hat die kontrafaktische Geschichte auch eine politische Agenda?
Evans: In Großbritannien durchaus. Nehmen wir Andrew Roberts. Ein sehr guter Historiker, aber ein schrecklicher Romanautor. Er hat ein furchtbares Werk kontrafaktischer Fiktion geschrieben, Das Aachen Memorandum, in dem der Held Horatio heißt, nach Horatio Nelson, dem britischen Admiral, der 1805 die Schlacht von Trafalgar gewann. Dieser Horatio führt eine Rebellion gegen eine EU an, die sehr an Nazideutschland erinnert. In dieselbe Kerbe schlagen viele – reale oder erfundene – Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Eine ganze Reihe britischer Autoren hat den, wie sie es sehen, Kampf um die Befreiung von der EU in Analogie zum Kampf gegen das nationalsozialistisch beherrschte Europa dargestellt. So trägt ein euroskeptisches Buch des konservativen Parlamentariers William Cash den Untertitel The Battle for Britain. Die in einigen Romanen und Filmen ge
feierte Vorstellung, dass Großbritannien in den frühen 1940erJahren allein gegen Europa stand, hat aus meiner Sicht zur euroskeptischen Stimmung beigetragen; auf der Grundlage falscher Annahmen. Insbesondere wird die Bedeutung der Sowjetunion für den Sieg über die Nationalsozialisten ignoriert.
ZEIT Geschichte: Lesen Sie Romane wie den Bestseller Vaterland von Robert Harris, in dem die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und Europa schon viele Jahre beherrschen?
Evans: Ich mag Robert Harris, er kennt sich mit Geschichte aus und kann gut erzählen. Als Unterhaltungslektüre würde ich Vaterland empfehlen. Aber als Historiker muss ich sagen: Sein Roman basiert auf einem Missverständnis. Denn Hitler hätte seine Eroberungsfeldzüge nicht einfach eingestellt. Anders als im Roman hätte das selbst ernannte Großdeutsche Reich nie einen Punkt des Stillstands erreicht. Hitler wollte permanenten Krieg, ohne zeitliche und räumliche Grenzen. 1930 sprach er vor Parteimitgliedern vom Ziel der »Weltherrschaft«. Als Rassist und Eugeniker glaubte Hitler, dass eine »Rasse« im Überlebenskampf nur stark bleiben könne, wenn sie ständig gegen andere »Rassen« kämpfe. Außerdem: Deutschland hätte den Zweiten Weltkrieg unter keinen Umständen gewinnen können.
ZEIT Geschichte: Warum kreisen überhaupt so viele kontrafaktische Erzählungen um den Nationalsozialismus – und warum vor allem in Großbritannien? Sind wir Deutschen zu ernsthaft für dieses Genre?
Evans: Vielleicht liegt es an der angloamerikanischen Leichtigkeit, dass die allermeisten Titel in Großbritannien und den USA erschienen sind. Gerade wenn es um die NSZeit geht, ist es für die Deutschen natürlich schwerer, in Alternativen zur Geschichte zu denken, da ist die Befangenheit viel größer. Der Nationalsozialismus steht so sehr im Mittelpunkt, weil die negative Faszination für Hitler immer noch ungebrochen ist. Hitler war der dämonischste Diktator, der zerstörerischste Rassist, der aggressivste Militarist, den es je gab; für viele ist er eine Art Verkörperung des Bösen. Deshalb wird es immer Menschen geben, die sich gerade mit Blick auf ihn fragen, wie es auch hätte kommen können.
ZEIT Geschichte: Wenn Sie gegenwärtig die Nachrichten verfolgen: Denken Sie manchmal, die reale Welt sei falsch abgebogen und wir leben nun in einer kontrafaktischen Zeit?
Evans: Unsere Welt ist kontrafaktisch in der Weise, dass wir mit Lügen und Fiktionen aller Art überschüttet werden. Putin und Trump wollen gar nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Insofern steckt die Wahrheit selbst in der Krise. Ich habe jahrelang die Holocaustleugnung erforscht, die auf Manipulation und Fälschung von Belegen beruht. Diese Lügen lassen sich durch Beweise leicht entkräften. Heute im Zeitalter der sozialen Medien liegt das Problem allerdings darin, dass die Menschen solchen Wahrheitsbeweisen weniger Bedeutung beimessen als früher und zum Teil an »alternative Wahrheiten« glauben. Deswegen ist es umso wichtiger, Lügen als das zu entlarven, was sie sind.
Das Gespräch führten Samuel Rieth und Frank Werner


Erdbeben Myanmar
EinschweresErdbebenhat Südost asienerschüt tert .AktionDeutschland Hilf tleistet Nothilfe –mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Notunterkünf ten undmedizinischer Versorgung.
Helfen Sieden Menschen jetz t– mitIhrer Spende! Ak tion-Deutschland-Hilft .de
Bündnis derHilfsorganisationen
1.WENDE PUNK T
Vorschlag zur Güte
Der Reformator Martin Luther erschüttert die deutsche Glaubenswelt. Auf dem Reichstag zu Worms kommt es 1521 zur Konfrontation mit Kaiser Karl V. Hätte der Herrscher die Spaltung der Christenheit noch verhindern können?
VON TILLMANN BENDIKOWSKI
Vielleicht war dem jungen Kaiser die Idee zu diesem klugen Schachzug in einer schlaflosen Nacht gekommen. Womöglich hatte er auch eine göttliche Eingebung gehabt. Jedenfalls ging er am 18. April 1521 außergewöhnlich optimistisch, geradezu gut gelaunt in das Treffen mit Martin Luther am Bischofshof in Worms. Bei ihrer Begegnung am Vortag hatte das Reichsoberhaupt den Theologie-Professor aus Wittenberg als klug, redegewandt und taktisch versiert erlebt. Offensichtlich hatte es keinen Zweck, sich heute mit ihm vor den versammelten Reichsständen auf eine Debatte über Sinn und Unsinn seiner Schriften einzulassen. Deshalb setzte Karl auf einen überraschenden Vorstoß, eine Wende, die mit den Erwartungen brechen würde. Rom hatte Luther vor drei Monaten zum Ketzer erklärt, und der Kaiser sollte die Reichsacht über ihn verhängen, ihn für vogelfrei erklären. Doch würde ein verfolgter, ein toter Martin Luther die aufgewühlte Stimmung im Reich wirklich beruhigen? Der Kaiser hatte da seine Zweifel.



EINIGUNG ODER ESKALATION?
Vor dem Kaiser soll Luther seine Lehren widerrufen. Auch die Reichsstände haben sich im Bischofshof in Worms versammelt. Das Gemälde entstand (wie die Werke auf den folgenden Seiten) im 19. Jahrhundert
Sie seien doch beide Mitglieder der einen heiligen Kirche, so begann Karl V. das Treffen – was angesichts der Exkommunikation Luthers äußerst nachsichtig formuliert war, aber an dieser Ungenauigkeit störte sich das Publikum in diesem Moment offensichtlich nicht. Und als gute Christen, sagte der Herrscher, sei ihnen doch gleichermaßen an dem Wort Gottes gelegen, »das das allerhohste ding im himmel und auf erden sei«, wie der Professor es gestern selbst formuliert hatte. Als Kaiser wolle er deshalb mit dem Menschen Luther nachsichtig sein. Auch deshalb habe er ihm die erbetene zusätzliche Frist bis heute gewährt, um seine Irrlehren zu widerrufen.
Was wäre gewesen, wenn der Kaiser einen Kompromiss angeboten hätte?
Doch wenn er sich dazu weiterhin nicht in der Lage sehe, wolle Karl ihm einen weitgehenden Vorschlag unterbreiten: Luther solle unter dem Schirm des Kaisers an einer Reform der Kirche mitarbeiten, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen und auch – das liege ihm als Reichsoberhaupt besonders am Herzen –, um den Frieden in Europa zu bewahren.
Der Kaiser hatte diesen Vorstoß nicht mit seinen Beratern abgestimmt, mit deren Widerstand er rechnen musste, aber dafür – in Worms waren die Wege kurz – Kontakt zum einflussreichen sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen aufgenommen. An dessen Urteil war dem 21-jährigen Monarchen stets viel gelegen. Weil Friedrich bekanntlich gewillt war, »seinen« Luther gegen die Verfolgung durch die Kurie in Schutz zu nehmen, konnte eine Lösung nur mit ihm gelingen. Und tatsächlich: Friedrich war von der Idee des Kaisers angetan und ließ seinerseits Luther ausrichten, er möge an diesem Nachmittag dem unerwarteten Vorschlag unbedingt zustimmen. Nun ließ sich Martin Luther bekanntlich ungerne vorschreiben, was er sagen und wie er sich zu verhalten habe. Aber in diesem Fall erwies er sich nicht als theologischer Sturkopf, sondern ging erstaunlich folgsam auf die diplomatische Offerte ein: Dem Wunsch des Kaisers folgend, aber auch weiterhin –die Bemerkung konnte er sich nicht verkneifen –voller Demut »gefangen im gewissen an dem wort gottes«, wolle er freudig seinen Beitrag zur Erneuerung der Kirche leisten. Das Raunen bei den ver-
sammelten Ständen zeugte gleichermaßen von Überraschung und Zufriedenheit mit diesem Übereinkommen. Nur die Vertreter der Kurie, so berichteten einige Anwesende, seien erkennbar blass geworden. Was im Grunde alle Teilnehmer des Reichstags ahnten: Der Kaiser spielte bewusst auf Zeit und hoffte auf eine allgemeine Beruhigung der reformatorischen Gemüter, während Martin Luther selbst vermutlich gar nicht daran dachte, irgendwelche Kompromisse einzugehen, auch wenn er sie in diesem Augenblick demütig in Aussicht stellte. Doch einen Versuch, da waren sich alle einig, war es allemal wert.
Hätte der Reichstag zu Worms – auf dem sich der Konflikt zwischen dem Kaiser und Luther unversöhnlich zuspitzte und in dessen Folge der Wittenberger Theologe für »vogelfrei« erklärt wurde – tatsächlich so wie hier geschildert verlaufen können? Wäre eine solche Wende hin zu einem Kompromiss denkbar gewesen? Und hätte es dann womöglich die Reformation nie gegeben?
Viel, so scheint es, stand 1521 in Worms auf dem Spiel. Lustvoll ließe sich spekulieren: Wenn es wegen der Glaubensdifferenzen keine Spaltung der Christen gegeben hätte, wäre die Geschichte in Deutschland und Europa womöglich deutlich friedlicher verlaufen. Es hätte keine Glaubenskonflikte und -kriege zwischen den deutschen Kleinstaaten gegeben, vielleicht wären auch katholische und protestantische Reiche wie Frankreich und Schweden nicht aufeinander losgegangen. England hätte nicht den Weg in die Anglikanische Kirche antreten können: Möglicherweise hätte das die Insel langfristig enger an das europäische Festland gebunden. Womöglich wären ohne Reformation auch weniger Glaubensflüchtlinge nach Nordamerika gesegelt. Würde der christliche Fundamentalismus dann heute Mentalität und Politik der USA so stark prägen?
Doch es ist wohl vor allem Wunschdenken, dass die Geschichte weniger blutig verlaufen wäre – ohne Bauernkrieg, die Verfolgung der Täuferbewegung, den Dreißigjährigen Krieg. Die sozialen Verwerfungen, die ebenso hinter diesen Konflikten standen wie die Machtpolitik der deutschen und europäischen Monarchen, hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ähnlich ausufernden Kämpfen geführt.
Vielleicht wäre ohne die Glaubensspaltung sogar alles noch schlimmer gekommen. Denn sie war auch eine lange, wenngleich quälende Übung im Aushalten von Gegensätzen. 1555 wurde im Augsburger Religionsfrieden erstmals das unbefristete Nebenein-
ander von zwei Varianten des christlichen Glaubens innerhalb eines politischen Systems festgeschrieben. Dabei machte der Grundsatz cuius regio, eius religio den Glauben der Menschen zwar zu einer Sache des Landesherrn. Zugleich ermöglichte diese Vereinbarung den Untertanen aber, das Land samt Familie und Eigentum zu verlassen. Das war die rechtliche Grundlage für Glaubensflüchtlinge innerhalb Deutschlands. Sie sollte fortan die politische Kultur prägen: In diesem Land gehörten solche Flüchtlinge nun dazu, und die Debatten über ihre Rechte und ihre mögliche Aufnahme waren ein steter Impuls, über Toleranz und Religionsfrieden nachzudenken. Die dauerhafte Herrschaft nur einer Kirche – sei sie römisch, römisch-reformiert oder rein protestantisch – hätte den Umgang mit Andersgläubigen womöglich noch verschlimmert und Deutschland zu einem religiös totalitären Land gemacht.
Wie plausibel solche Szenarien einer alternativen Zukunft sind, hängt in hohem Maße von der Vorgeschichte des Reichstags in Worms ab. Was war bereits vor der Zusammenkunft geschehen und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden? Es zeigt sich schnell, wie begrenzt die Handlungsspielräume der Beteiligten im April 1521 waren. Dies lag zum einen am Aufstieg Martin Luthers in den vier vorangegangenen Jahren: Er war in dieser Zeit zu einer bekannten theologischen und politischen Größe geworden. Keineswegs reiste ein »kleines Mönchlein« nach Worms, sondern ein selbstbewusster Professor und Bestsellerautor avant la lettre. Er beeindruckte ein breites Publikum mit seinen stupenden Kenntnissen und seinem rhetorischen Talent, überdies legte er ein ungewöhnliches Geschick für das richtige Marketing an den Tag. Luther hatte das Land aufgewühlt, eine begeisterte Anhängerschaft gefunden – und mächtig gegen Rom ausgeteilt. Da waren zunächst die großen Schriften, nach seinen 95 Thesen früh sein Sermon von dem Ablaß und Gnade, der 1518 erschienen war. Diese Kritik am Ablasshandel Roms wurde binnen zwei Jahren 25-mal nachgedruckt und erreichte eine Auflage von etwa 60.000 Exemplaren. Allein das bezeugt, dass Luther den Nerv der Zeit getroffen hatte. 1520 bestritt er in seiner Abhandlung An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung die Autorität des Papstes über die weltlichen Obrigkeiten. Und er forderte die Unabhängigkeit des deutschen Kaisertums vom Papst sowie die Errichtung einer von Rom unabhängigen Kirche.
Im selben Jahr folgten die grandiose Abrechnung Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und schließlich seine berühmteste reformatorische Flugschrift Von der Freiheit eines Christenmenschen. Im Grunde war damit das Papsttum in seiner derzeitigen Gestalt – aber eigentlich auch in jeder vorstellbaren reformierten Form – für ihn längst undenkbar geworden und die Lossagung von der römischen Kirche bereits in Gang gekommen.
Und auch vor demonstrativen Gesten hatte Luther nicht zurückgeschreckt. Im November 1520 waren seine Werke in Köln und Mainz öffentlich verbrannt worden, auf Veranlassung des päpstlichen Nuntius Hieronymus Aleander. Daraufhin ließ Luther selbst einen Scheiterhaufen errichten: Vor einem der Stadttore Wittenbergs wurde ein reformatorisches Feuer entzündet, in dem mehrere Ausgaben des kanonischen Rechts, eine Handschrift scholastischer Beichtpraxis sowie Traktate von Luther-Gegnern landeten. Dann warf Luther persönlich einen Druck der gegen ihn verhängten Bannandrohungsbulle in die Flammen. Ob er dabei wirklich die folgenden

Worte gesagt hat, bleibt offen, zuzutrauen wären sie ihm auf jeden Fall: »Weil du die Wahrheit Gottes verderbt hast, verderbe dich heute der Herr. Hinein damit ins Feuer.«
Kein Wunder, dass im Vatikan niemand so verhasst war wie Luther – vielleicht vom Teufel persönlich abgesehen, aber für manche waren die beiden identisch. Erwartungsgemäß war ein Ketzerprozess gegen ihn eröffnet worden. Und da ein Widerruf für den Kompromisslosen aus Wittenberg nicht infrage
FANAL GEGEN ROM Vor den Mauern Wittenbergs verbrennt Luther Ende 1520 die Androhung des Papstes, ihn aus der Kirche auszustoßen. Ein Mitstreiter trägt schon die nächste Schrift zu den Flammen, vielleicht eine Ausgabe des kanonischen Rechts
WEITERLESEN
Tillmann Bendikowski:
»Der deutsche Glaubenskrieg.
Martin Luther, der Papst und die Folgen«
C. Bertelsmann Verlag, München 2016
kam, wurde er entsprechend der päpstlichen Drohung im Januar 1521 offiziell zum Ketzer erklärt.
Doch der Rückhalt in seiner Heimat hatte weiter Bestand. Das zeigte auch Luthers Reise zum Reichstag in Worms. Je weiter er Richtung Rhein kam, desto freundlicher fiel der Empfang aus. So kam ihm der Rektor der Erfurter Universität samt imposantem Gefolge vor der Stadt entgegen. Zwischendurch erhielt Luther sogar die Möglichkeit, eine seiner berühmten Predigten zu halten – ganz so, als sei er kein von Rom verurteilter Ketzer, sondern ein sehnsüchtig erwarteter Gottesmann, dem die Gemeinde immer schon einmal lauschen wollte. Endgültig zum öffentlichen Ereignis wurde schließlich Luthers Ankunft in Worms. Etwa 2.000 Menschen sollen auf den Straßen gewesen sein, um den Reformator zu begrüßen oder ihn zumindest einmal leibhaftig zu sehen. Entsprechend nervös waren die Vertreter der römischen Kirche. So schrieb der päpstliche Nuntius Aleander kurz vor dem Reichstag nach Rom: »Die Deutschen haben allen Respekt verloren und lachen über die Exkommunikation; die Mönche wollen nicht von den Kanzeln gegen Luther predigen.« Unzählige Christen hätten sogar aufgehört zu beichten, und täglich »regnet es lutherische Schriften in deutscher und lateinischer Sprache«. Das Land befinde sich in hellem Aufruhr, die allermeisten Menschen
Ein Mord würde das Problem nicht lösen. Dafür sind Luthers Ideen zu populär
hätten sich auf die Seite der reformatorischen Kritiker geschlagen: »Neun Zehntel erheben das Feldgeschrei ›Luther‹, und für das übrige Zehntel, falls ihm Luther gleichgültig ist, lautet die Losung wenigstens ›Tod dem römischen Hof‹.«
In dieser Situation hatte Karl V. im Grunde drei Optionen, wenngleich wir nicht wissen, ob er und seine Berater die Varianten tatsächlich ernsthaft durchgespielt haben. Die erste war der Versuch, mit Luther zu einer nachhaltigen Verständigung zu kommen. Aber letztlich dürfte dies ausgeschlossen gewesen sein: Zu viel Kritik hatten er und andere Reformatoren vorgetragen, zu viele Hoffnungen auf Wandel und letztlich Befreiung von der kirchlichen Knechtschaft kursierten bereits im Volk. Auch Lu
ther hätte diese Erwartungen gar nicht mehr einfangen können. Das musste er Jahre später leidvoll erfahren, als er den Furor des Bauernkrieges weder verhindern noch mit Worten stoppen konnte, weil auch er machtlos war gegen die feurige Rhetorik eines Thomas Müntzer und das wilde Aufbegehren der unterdrückten Menschen.
Zudem wäre Luther zu einem »Deal« mit Kaiser und Kurie wohl gar nicht fähig gewesen. Schließlich residierte in Rom immer noch Papst Leo X. Dessen Tod im Dezember 1521 kam völlig überraschend; zur Zeit des Reichstags mussten Vertreter von kirchlicher und weltlicher Macht davon ausgehen, dass sein Pontifikat noch lange andauern werde.
Alle wussten nur zu gut, dass dieser Papst vor allem danach strebte, sein irdisches Leben durch Heiterkeit, Scherz und Musik zu verschönern – die reformatorische Kritik an der römischen Kirche hatte er nie verstanden. Auch das tiefreligiöse Auftreten Luthers erschloss sich Leo X. nicht, und für die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen der RomKritik fehlte es ihm vermutlich schlicht an Fantasie. Im Grunde agierte dieser Papst dermaßen unter Luthers theologischmoralischem Niveau, dass jedes Gespräch zwischen den beiden sinnlos gewesen wäre – da mochte der Kaiser so wohlwollend assistieren, wie er wollte.
Wenn also keine Verständigung möglich schien, warum dann – die zweite Option – Martin Luther nicht einfach ermorden lassen? Das Töten angeblicher Ketzer war eine lang eingeübte römische Tradition (der sich später auch Protestanten gern bedienten). Aus Sicht vieler Parteigänger der Kurie hätte man dem reformatorischen Treiben ohnehin längst mit Gewalt ein Ende setzen müssen. Aber auch dafür war es im April 1521 im Grunde schon zu spät. Ohnehin brachte das Töten eines theologischen Abweichlers die Dinge für Rom nicht unbedingt wieder in Ordnung. Das hatte der Fall Jan Hus gezeigt. Der böhmische Theologe war 1415 in Konstanz verbrannt worden, aber die »Hussiten« und die Ideen des Reformators verschwanden deshalb nicht. Es gibt keinen vernünftigen Grund, anzunehmen, dass es bei einer Hinrichtung Luthers ein Jahrhundert später anders gelaufen wäre: Revolutionäre Ideen sind immer schwerer aus der Welt zu schaffen als die Menschen, die sie prominent vertreten. Ganz in diesem Sinne wurde vom großen Humanisten und Kirchenkritiker Ulrich von Hutten der Ausspruch kolportiert: »Wenn Luther tausendmal tot wäre, es würden hundert neue Luther entstehen.«

Ein gewaltsamer Tod Luthers im Jahr 1521 hätte eine Reformation also nicht mehr verhindert. Womöglich wäre ihr Verlauf ein anderer gewesen, aber die reformatorische Bewegung war nicht mehr zu stoppen. Sie profitierte auch von der territorialen deutschen Kleinteiligkeit, denn gerade diese ermöglichte vielen politisch und religiös Verfolgten Schutz und bot abweichenden Meinungen eine Heimat.
Tatsächlich entschied sich Karl V. auf dem Wormser Reichstag dazu, die Reichsacht über Martin Luther zu verhängen – auch wenn er zugleich dafür sorgte, dass dem Reformator nicht unmittelbar Gewalt angetan wurde. Der Rest ist Geschichte: Als die Reichsacht wirksam wurde, befand sich der fortan »vogelfreie« Reformator bereits unter dem Schutz des Kurfürsten von Sachsen auf der Wartburg. Auch während der kommenden Monate blieb er Mittelpunkt des Wittenberger Reformkreises und durch seine Schriften im ganzen Land präsent. Vor allem übersetzte er nun das Neue Testament. Unwiderruflich veränderte er so die Glaubenswelt der Deutschen, weil zumindest die Protestanten einen Zugang zur Heiligen Schrift in ihrer Muttersprache erhielten.
Wäre der Reichstag anders verlaufen, hätte es wohl die Flucht auf die Wartburg und damit auch Luthers Bibelübersetzung nicht gegeben. Das wäre nicht nur ein Verlust für die Geschichte der Frömmigkeit gewesen, sondern für die gesamte Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur. Überdies wäre die deutsche Geschichte womöglich um eines ihrer größten Zitate gebracht worden. »Solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist«, soll Martin Luther am 18. April 1521 vor Kaiser und Reichsständen gesagt haben, »kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helf mir. Amen.« Was wäre der Protestantismus – und letztlich unsere politische Kultur bis in die Gegenwart – ohne dieses Plädoyer für die Macht des Gewissens? So gesehen war es ein Glücksfall, dass der junge Karl V. damals nachts nicht die Idee hatte, dem Reformator einen verwegenen Plan zur Verständigung vorzuschlagen.

TILLMANN BENDIKOWSKI ist Historiker und Journalist. Er lebt in Hamburg
STIMME DER UNZUFRIEDENEN
Auf Luthers Weg zum Wormser Reichstag versammeln sich die Menschen, um ihn zu sehen und zu bejubeln. Viele teilen seine Kritik an der Kirche
UNSCHULDIGE OPFER
Truppen des Kaisers und der Katholischen Liga morden, plündern und vergewaltigen 1631 in Magdeburg. Auf diesem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert stürzen sich verzweifelte Frauen in die Elbe, um ihren Peinigern zu entgehen
WENDE PUNK T
2.
Das Gemetzel hätte früher enden können
1629 ist der Frieden zum Greifen nah. Aber Kaiser Ferdinand II. heizt den Konflikt neu an, der als Dreißigjähriger Krieg in die Geschichte eingehen wird VON RAOUL LÖBBERT
Ins Gedächtnis der Deutschen brannte er sich ein als Urkatastrophe vor den Katastrophen des 20. Jahrhunderts: der Dreißigjährige Krieg. Millionen Menschen fielen den Kämpfen, Plünderungen, dem Hunger und der Pest zum Opfer. Am Ende war nicht nur das Land verwüstet, wie Andreas Gryphius es in seinem Gedicht Tränen des Vaterlands beschreibt: »Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod, / Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth / Das auch der Seelen Schatz / so vielen abgezwungen.« Es war ein deutsches Trauma. Deshalb drängt sich die Frage auf: Hätte es nicht auch anders kommen können? Kürzer, weniger brutal? Tatsächlich gab es einen Moment, einen Tag – den 6. März 1629 –, an dem der Krieg vielleicht hätte gestoppt werden können.
Seit Kriegsbeginn, seit dem Zweiten Prager Fenstersturz im Mai 1618, der ultimativen Kampfansage der protestantischen Stände Böhmens an die katholischen Habsburger, war bereits mehr als ein Jahrzehnt vergangen. In dieser Zeit erlebten die Protestanten Niederlage um Niederlage. Doch wuchs sich die Rebellion an der Peripherie des Habsburgerreichs zum reichsweiten Religions- und Hegemonialkrieg aus, in den auch der Dänenkönig Christian IV. verwickelt war. Aber auch diese letzte pro-
testantische Hoffnung wurde bald zunichtegemacht: Am 27. August 1626 nutzte der katholische Generalissimus Johann Tserclaes von Tilly in der Schlacht bei Lutter am Barenberge einen Fehler Christians aus und schlug diesen vernichtend.
Tilly war Militär, kein Politiker. Dafür hatte Ferdinand II., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, einen anderen: den Kriegsunternehmer Albrecht von Wallenstein. Der erkannte die Chance, die sich aus der Niederlage Christians ergab. »Dardurch«, schreibt Wallenstein dem Kaiser in Wien, »werden Sie ihn und seine Nachkommen devinciren [an sich binden], daß er mehr E.M. [Eurer Majestät] wegen der empfangenen Wohlthat, als seinen Conföderirten, welche ihn auf’s Eis geführt haben, vertrauen und Dero Confident allezeit verbleiben wird.« Kurz: Christian soll vom Feind zum Freund werden.
Die Friedensbedingungen sind tatsächlich milde. Doch dann begeht Ferdinand II. am 6. März 1629 mit dem sogenannten Restitutionsedikt einen verhängnisvollen Fehler. Dazu muss man wissen: Ferdinand ist ein strenggläubiger Katholik. Zudem wird er in Wien von seinem jesuitischen Beichtvater Wilhelm Lamormaini bearbeitet, nach dem Sieg bei Lutter am Barenberge kompromisslose Härte zu zeigen. Nur so könne die Gegenreformation im Heiligen Römischen Reich siegen.
Wallenstein und der spanische Zweig der Habsburger halten dagegen und beschwören Ferdinand, auf die Protestanten zuzugehen. Doch der entscheidet sich anders: Mit dem Restitutionsedikt vom 6. März 1629 will der Kaiser die protestantischen Stände zwingen, die kirchlichen Besitztümer zurückzugeben, die sie im Zuge der Reformation enteignet hatten. Das ist mehr als 70 Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 praktisch unmöglich und politisch fatal.
Das Edikt treibt die Protestanten zurück auf die Barrikaden und liefert einem anderen gekrönten Haupt den Anlass zur Intervention: Gustav Adolf von Schweden. Politisch wie militärisch ist Schweden stark. Nun will es auch Großmacht werden und den Glaubensbrüdern zu Hilfe eilen. Am 4. Juli 1630 landet Gustav Adolf mit seinem Heer auf Usedom. Der Krieg, der beendet schien, taumelt so der nächsten Eskalation entgegen.
Am Ende vernichtet er alles, auch den Erlöser aus dem Norden. Gustav Adolf fällt 1632 in der Schlacht bei Lützen. Er hinterlässt eine kopflose Truppe. Noch Jahre zieht sie plündernd durchs Land, nicht anders als die katholischen Heere.
Das Restitutionsedikt war eine Entscheidung gegen die politische Klugheit. Ferdinand wollte keine Verständigung. Als

selbst ernanntes Werkzeug Gottes strebte er nach dem endgültigen Sieg. Was wäre gewesen, wenn der Kaiser mehr auf Ausgleich bedacht gewesen wäre? Wenn er es bei einem milden Frieden belassen und auf das Restitutionsedikt verzichtet hätte?
Statt 30 Jahren Krieg wäre es ohne das Edikt vermutlich bei elf Jahren geblieben. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler jedenfalls urteilt in seinem Standardwerk über den Dreißigjährigen Krieg, im Frühjahr 1629 habe Ferdinand »die bis dahin wohl größte Chance vertan, den Krieg in allen seinen Ausprägungen zu beenden«.
Die Schlacht bei Lützen im November 1632 – der Showdown zwischen Wallenstein und Gustav Adolf – hätte dann nie stattgefunden. Ebenso wenig die »Magdeburger Bluthochzeit« im Mai 1631, in deren Folge die Truppen Tillys die Stadt derart gründlich zerstörten, dass deren Einwohnerzahl erst im 19. Jahrhundert wieder Vorkriegsniveau erreichte. Tausende Menschen, die 1631 tot die Elbe heruntertrieben, wären ohne das Edikt womöglich am Leben geblieben.
Vor allem aber hätte es wohl die zweite Hälfte des Dreißigjährigen Krieges nie gegeben, die für Zivilisten besonders mörderisch war. Denn statt den Krieg auf dem Schlachtfeld auszutragen, verlagerten sich die Söldner immer mehr darauf, die Bevöl-
kerung auszuplündern. Raub und Gewalt ebneten Hungersnöten und Seuchen den Weg, katapultierten die Opferzahlen in grausige Höhen.
Große Teile der deutschen Lande wären nicht verwüstet oder gar entvölkert worden. Württemberg etwa hätte nicht gut drei Viertel seiner Einwohner verloren, hätten kaiserliche Truppen das Herzogtum nicht zwischen 1634 und 1638 verheert. Auch das besonders schwer heimgesuchte Mecklenburg wäre glimpflicher davongekommen. Ein Drittel der Bauernstellen war dort 1640 noch besetzt, ein gutes Jahrzehnt später nur noch ein Achtel.
Außerdem wäre der Konflikt, hätte es 1629 einen dauerhaften Frieden gegeben, stärker auf die Akteure im Heiligen Römischen Reich beschränkt geblieben, statt immer neue auswärtige Mächte in seinen Strudel zu ziehen. Doch genau an diesem Punkt entstehen Zweifel.
Hätte es den Krieg nicht gegeben, den wir heute aus den Geschichtsbüchern kennen, wüssten wir vielleicht von einem anderen. Denn selbst wenn der Religionsstreit befriedet worden wäre – es ging damals um mehr. Um Macht und Einfluss in Europa. Dafür waren die Herrscher zur Eskalation bereit.
So passte der Krieg 1629 in Gustav Adolfs Kalkül. Schweden wollte in den Jahren nach dem Prager Fenstersturz seine
Vormachtstellung an der Ostsee ausbauen. Irrationaler Militarismus verband sich im Falle des Schwedenkönigs mit Gier und einem religiösen Fanatismus, der dem der anderen Seite ziemlich ähnlich war. Es war eine explosive Mischung.
Auch Frankreich mischte sich schließlich nicht um des Glaubens willen in den Dreißigjährigen Krieg ein, sondern aus politischem Kalkül. Seine Machthaber fürchteten eine Einkreisung durch die Habsburger. Denn das Adelsgeschlecht stellte nicht nur den römisch-deutschen Kaiser, sondern beherrschte neben Spanien auch große Gebiete in Flandern und im Burgund. Das katholische Frankreich unterstützte daher im Krieg vor allem die Protestanten, weil sie ebenfalls Gegner Habsburgs waren, und schickte von etwa 1631 an lebensrettende Finanzhilfen, später auch eigene Truppen.
Früher oder später wäre die Rivalität zwischen Franzosen und Habsburgern womöglich durch einen anderen Anlass eskaliert. Wahrscheinlich wäre es in der Parallelwelt ohne Restitutionsedikt, aber mit fortgesetzter dynastischer Machtpolitik, nicht viel friedlicher zugegangen.

LÖBBERT ist Kulturredakteur bei ZEIT ONLINE

»Mein Unglück ist, WENDE PUNK T 3. dass ich noch lebe«

Ein Wunder rettet Friedrich den Großen 1762 im Siebenjährigen Krieg angeblich vor dem sicheren Untergang: der Tod der russischen Zarin Elisabeth. Was, wenn das »Mirakel des Hauses Brandenburg« ausgeblieben wäre?
VON SAMUEL RIETH
IN WELCHE RICHTUNG SOLL ES GEHEN?
Wie hätte sich Preußen entwickelt, wenn Friedrichs Widersacherin nicht gestorben wäre? Hier ist der König zu Pferde zu sehen, nach einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert
Das Wunder ereignet sich in der Stunde höchster Not. »Als die Nacht am schwärzesten war«, schreibt der britische Historiker Thomas Carlyle, da geschieht es: »Das Schicksal sendet ihm einen wunderbaren Morgenstern.« Ihm, dem unbeugsamen König, Friedrich dem Großen. Allein steht der Herrscher gegen eine Welt von Feinden – ein preußischer David, umzingelt von mehreren Goliaths. Seit Jahren bestürmen ihn die Heere Russlands und Habsburgs, Frankreichs, des Heiligen Römischen Reiches und Schwedens. Alles steht auf dem Spiel, sein Leben, die Zukunft Brandenburg-Preußens und Europas. Lange hält Friedrich stand gegen die Übermacht. Schließlich aber drängt sie ihn doch an den Rand des Abgrunds. Im Januar 1762 gibt es keine Hoffnung mehr, unausweichlich scheint sein Untergang.
Da trifft die frohe Botschaft aus Sankt Petersburg ein, die alles ändert: Zarin Elisabeth ist gestorben. Am Tod von Friedrichs Widersacherin zerbricht die Koalition seiner Feinde, und Preußen obsiegt. Vom »Mirakel des Hauses Brandenburg« wird man sprechen: Friedrichs Bestehen im Siebenjährigen Krieg ist in den Augen vieler Zeitgenossen und Nachgeborener so wundersam, dass ein Eingriff höherer Mächte zu vermuten ist. »Der liebe Gott [ließ] die Kaiserin Elisabeth sterben«, ist sich einer von Friedrichs Offizieren sicher. Anderthalb Jahrhunderte später schreibt Thomas Mann über den Sieg des bewunderten »Beauftragten des Schicksals«: »Der Spruch des Fatums hatte gegen alle Wahrscheinlichkeit für ihn entschieden.«
was wäre, wenn Elisabeth nicht gestorben wäre, genau zur rechten Zeit? Kontrafaktische Szenarien helfen dabei, das Wunder einer Prüfung zu unterziehen.
Friedrichs Fehler lässt das Bündnis seiner Feinde wachsen
Diese Erzählung von der Wunderrettung ist eine Grundzutat des Mythos um Friedrich II. von Brandenburg-Preußen, der besonders im 19. Jahrhundert erstarkt und den Monarchen zum deutschen Heldenkönig verklärt. »Die Geschichte der Welt ist nichts als die Biographie großer Männer«, lautet damals die Überzeugung nicht nur Thomas Carlyles, der dem großen Friedrich von 1858 an sein Opus magnum widmet, eine Lebensbeschreibung in sechs Bänden. Besonders in Deutschland wird das Werk gelesen. Noch im Frühjahr 1945 trägt Joseph Goebbels dem Friedrich-Verehrer Adolf Hitler Carlyles Stelle über den Tod der Zarin vor: Vergebens hofft die NS-Führung auf ein ähnliches Mirakel.
Aber was an der Geschichte von Friedrichs unverhoffter Rettung ist Wahrheit, was nur Legende? Und
Die Vorgeschichte des angeblichen Mirakels beginnt gut zwei Jahrzehnte zuvor. Im Mai 1740 besteigt Friedrich den Thron, ein musischer Schöngeist, der gern Flöte spielt und der Philosophie frönt. Aber auch ein ruhmhungriger Kriegsherr, wie er noch im selben Jahr beweist: Im Dezember marschiert er in Schlesien ein, der reichen Provinz des benachbarten Habsburgerreiches. Der Angriff ist eine Anmaßung. Brandenburg-Preußen ist ein höchstens zweitklassiger Staat, eher ärmlich und karg, erst seit wenigen Jahrzehnten darf sein Herrscher sich König nennen. Mit dem Überfall fordert Friedrich das habsburgische Österreich und dessen Herrscherin Maria Theresia heraus, eine europäische Großmacht, die das Heilige Römische Reich dominiert. Alles beginnt mit diesem Raub Schlesiens. In zwei Kriegen gelingt es Friedrich, seine Beute zu verteidigen. 1756 aber entbrennt ein noch größerer Konflikt, mit weltumspannenden Dimensionen. Und einer für Friedrich denkbar ungünstigen Grundkonstellation, in die er sich teils selbst hineinmanövriert. Denn am Vorabend dieses Siebenjährigen Krieges schließt er überhastet einen Pakt mit Großbritannien, stößt so seinen Verbündeten Frankreich vor den Kopf und treibt ihn in die Arme seines Erzfeindes Habsburg. Maria Theresia will Schlesien zurück und das »Monster« Friedrich niederwerfen. Der eröffnet den sich anbahnenden Kampf selbst, mit einem Präventivschlag gegen das neutrale, strategisch günstig liegende Sachsen. Daraufhin erklären die Reichsstände BrandenburgPreußen wegen Landfriedensbruchs den Krieg, nach einem Aufruf des römisch-deutschen Kaisers Franz I. – Maria Theresias Ehemann.
Auch Zarin Elisabeth gehört zur Anti-FriedrichAllianz: Die Russen nehmen sein erstarkendes Reich als Rivalen um die Vormacht im Ostseeraum wahr. Und Schweden hofft, das einst verlorene Pommern zurückzuerobern. Die Briten unterstützen den Preußenkönig zwar mit Geld, konzentrieren sich aber auf ihr Ringen gegen Frankreich in den Kolonien und kämpfen auf dem europäischen Festland kaum mit eigenen Truppen.
Als Feldherr ist Friedrich kein Genie. Er gewinnt nur die Hälfte seiner Schlachten im Siebenjährigen Krieg, häufig knapp und mit viel Blut erkauft. Vor
allem seine Resilienz zeichnet ihn aus und festigt seinen Ruf, trotz Niederlagen stur weiterzukämpfen, neue Truppen auszuheben und sie todesmutig ins nächste Gefecht zu führen.
Nie ist Friedrichs Lage wohl gefährlicher als im August 1759, als die Zarin noch zweieinhalb Jahre zu leben hat. In der Schlacht bei Kunersdorf, nahe der Oder, greift er ein mehrheitlich russisches Heer an. Er schätzt das Gelände falsch ein, verliert die Schlacht und etwa 20.000 Mann. Am Abend nach diesem größten Desaster seiner Feldherrenkarriere schreibt er an seinen Etatminister: »Mein Rock ist von Schüssen durchlöchert, zwei meiner Pferde sind getötet; mein Unglück ist, dass ich noch lebe.« Die Armee fliehe, Berlin sei in Gefahr. »Dies ist ein grausames Missgeschick, ich werde es nicht überleben; die Folgen werden noch schlimmer sein als die Sache selbst.« Alles sei verloren, das Vaterland dem Untergang geweiht. Wie so oft, wenn die Lage ausweglos scheint, denkt er an Selbstmord, nicht an Kapitulation. Und wie immer ist sein Wille zum Weiterkämpfen stärker. Doch es gelingt den Gegnern nicht, seine Notlage auszunutzen und Friedrich den Todesstoß zu versetzen. Mehr noch: Statt die Hauptstadt Berlin einzunehmen, ziehen sich die Feindtruppen sogar zurück. Die Russen haben selbst hohe Verluste erlitten und meinen, sie hätten fürs Erste genug Opfer für die Allianz erbracht. »Ich verkünde Ihnen das Mirakel des Hauses Brandenburg«, schreibt Friedrich erleichtert an seinen Bruder Heinrich. Das ist der Ursprung dieser Formulierung: Ihre Bedeutung wandelt sich mit der Zeit und erstreckt sich dann auch auf den Tod der Zarin, den unerwartet glücklichen Ausgang des gesamten Krieges.
Den wohl größten Moment der Gefahr hat Friedrich also bereits überstanden, bevor im Winter 1761/62 seine angeblich schwärzeste Nacht anbricht. Dennoch ist seine Situation da erneut kritisch. In den vergangenen Monaten hat er mehrere Rückschläge erlitten. Zwei wichtige Festungen haben die Gegner eingenommen, Schweidnitz in Schlesien und Kolberg in Pommern. Noch dazu stellt Großbritannien seine Subventionen ein, bisher 3.350.000 Taler im Jahr, etwa ein Fünftel der Kriegsausgaben Preußens.
Dann stirbt am 5. Januar 1762 die Zarin, im Alter von 52 Jahren. »Des Russen und des Kosaken Konkubine« breche auf, »um sich im Reich der Toten neue Buhler zu suchen«, freut sich Friedrich, angeblich flötet er zur Feier des Tages drei Stunden lang. Doch nichts daran ist unerwartet oder unerklärlich, wie es sich für ein echtes Wunder geziemen

würde. Schon vor Kriegsbeginn war aus Sankt Petersburg bekannt, Elisabeth leide oft unter Kurzatmigkeit, spucke immer wieder Blut oder falle in Ohnmacht. Ihr Tod kam nicht überraschend.
Nun leitet ihr Ableben die Kriegswende ein. Denn der neue Zar Peter III. ist ein ebenso passionierter wie naiver Bewunderer Friedrichs. Peter schließt nicht nur Frieden mit seinem Idol, sondern auch ein Bündnis – und stellt seine Truppen an die Seite Preußens. Zwar nur wenige Monate lang, bis er gestürzt und ermordet wird. Seine Nachfolgerin Katharina II. aber nimmt den Krieg gegen Friedrich nicht wieder auf. Und der Rest der Allianz kann ohne die Russen nicht bestehen.
So endet im Februar 1763 der Siebenjährige Krieg in Europa. Der Friedensvertrag schreibt den Vorkriegszustand fest: Friedrich verliert nichts und gewinnt damit alles. Er darf Schlesien behalten und hat Preußen vor dem Untergang bewahrt, das aufsteigt zur zweiten dominanten Macht im Heiligen Römischen Reich.
GEGENSPIELERIN
Zwei Jahrzehnte lang herrscht Zarin Elisabeth über Russland. Ihr Staat bildet mit Österreich den Kern der Allianz gegen Preußen. Das Porträt entstand um 1740

FÜHRUNG VON VORN
In der besonders blutigen Schlacht bei Zorndorf trotzt Preußens Armee im August 1758 einem russischen Heer. Dieses Gemälde von 1904 zeigt, wie Friedrich angeblich mit Degen und Fahne an der Spitze seiner Truppen marschierte
Doch was, wenn die Zarin nicht gestorben wäre? Schon in all den Jahren zuvor konnte die antipreußische Koalition Friedrich nicht besiegen, ihrer Übermacht zum Trotz. Und vieles deutet darauf hin, dass dieselben Schwierigkeiten sie auch weiterhin geplagt hätten. Vor allem der Historiker Johannes Kunisch hat diese Faktoren in seinem Buch Das Mirakel des Hauses Brandenburg analysiert.
Nehmen wir also an: Elisabeth erweist sich als zäher, als viele erwarten. Nach seinen Rückschlägen bleibt Friedrich wohl in der Defensive. Doch auch seine Feinde agieren wahrscheinlich zurückhaltend. Die Österreicher und Russen schaffen es kaum, zusammen anzugreifen. In fünfeinhalb Kriegsjahren ist es ihnen nur ein einziges Mal gelungen, ihre Hauptstreitmächte zu bündeln; das war im Sommer 1761. Doch zur vereinten Attacke kam es selbst da nicht: Der russische Befehlshaber stellte sich gegen den gemeinsamen Schlachtplan, den sein Vorgänger mitbeschlossen hatte, und zog sich zurück.
Es herrschen die typischen Schwierigkeiten, wie sie in Koalitionen dieser Art eher die Regel als die Ausnahme sind: Die Verbündeten misstrauen einander, gönnen den Mitstreitern kaum einen Erfolg und verfolgen jeweils eigene Ziele. Statt ihre Kampfkraft zu potenzieren, lähmen sie sich gegenseitig.
Ihre Befehlshaber gehen häufig zaghaft vor. Die damalige Kriegsdoktrin sieht vor, große Feldschlachten eher zu vermeiden, auch weil gut ausgebildete Truppen schwer zu ersetzen sind. Der bedrängte Friedrich hingegen suchte aus Not und Neigung anfangs immer wieder den offenen Kampf, um die Heere seiner Gegner einzeln zu schlagen, und hat so das Heft des Handelns in der Hand behalten. Nun, da auch er weniger aggressiv vorgeht, würde der Krieg wohl zunehmend erstarren.
Die Russen haben ihren Oberbefehlshaber bisher in fast jedem Kriegsjahr ausgewechselt. Entweder stiften jetzt weitere Personalrochaden Unordnung, oder, vielleicht besser noch aus Friedrichs Sicht, die Zarin belässt den Grafen Alexander Borissowitsch Buturlin auf seinem Posten. Das Kommando hat er erhalten, weil er einmal der Liebhaber der Herrscherin war. Er hat keine Kampferfahrung und kann nicht einmal Karten lesen.
Geografisch vor der größten Herausforderung stehen die Russen aber aus einem anderen Grund: Sie haben den weitesten Weg zum Schlachtfeld. Mehr als 30 Prozent ihrer Streitmacht von knapp 21.000 Mann, die 1759 heranmarschierte, waren bis zur Ankunft krank, tot oder desertiert. Friedrich hingegen, der vor allem im eigenen Reich kämpft, operiert über
kürzere Distanzen, kann seine Truppen leichter verschieben und versorgen. Zudem zählt die Armee, die er von seinem Vater geerbt hat, zu den modernsten Europas. Die preußische Infanterie ist exzellent gedrillt, kann am schnellsten feuern und sich rascher umgruppieren als die meisten anderen Heere.
Dazu kommt: Friedrich ist Kommandeur und König in Personalunion. Auf dem Schlachtfeld wie in der Politik waltet er unumschränkt, kann schnelle Entscheidungen fällen, wie es die Situation verlangt. Maria Theresia und Co. hingegen führen den Krieg von fernen Thronsälen aus. Ihre Befehlshaber sind nur Bevollmächtigte, die darauf achten müssen, nicht die Gunst ihrer Herrscherin zu verlieren oder einer Hofintrige zum Opfer zu fallen.
Auch mit der Zarin wäre die Allianz also wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, Friedrich den entscheidenden Schlag zu versetzen. Dann wären bald die Zweifel an der Koalition und ihren Siegeschancen gewachsen, bei Maria Theresia im Schloss Schönbrunn nahe Wien, bei Zarin Elisabeth im neuen Winterpalast, den sie sich gerade in Sankt Petersburg hat errichten lassen, und erst recht in Versailles, denn die Franzosen büßen im Kampf gegen Großbritannien all ihre Kolonien auf dem nordamerikanischen Kontinent ein. Kriegsmüde waren Friedrichs Gegner im Winter 1761/62 ohnehin schon. Die Schulden Österreichs waren inzwischen so hoch, dass allein die Zinsen mehr als 40 Prozent der regulären Steuereinnahmen verschlangen. Maria Theresia musste bereits 20.000 Soldaten aus ihrer Armee entlassen und den Sold der verbliebenen Männer halbieren. Frankreich drohte sogar der Staatsbankrott. Auch Russland ging es finanziell nicht viel besser.
Der Tod in Sankt Petersburg beschleunigte also nur, was wahrscheinlich ohnehin geschehen wäre. So oder so hätte BrandenburgPreußen es in den Club der Großmächte geschafft. Friedrichs Staat stieg zum Konkurrenten Habsburgs im Heiligen Römischen Reich auf, das an dieser Rivalität zugrunde ging.
Was aber wäre gewesen, wenn statt der Zarin Friedrich vorzeitig gestorben wäre? Hätte das die Zerschlagung Preußens bedeutet? In der Schlacht bei Kunersdorf etwa, im Sommer 1759: Jede der Kugeln, die des Königs Rock und Ross trafen, hätte ihn mit nur wenigen Zentimetern Abweichung töten oder schwer verletzen können.
Sogar den frühen Tod
des Königs hätte Preußen wohl überlebt
Zum Sieg waren sie nicht fähig, was wäre den Alliierten also anderes übrig geblieben, als irgendwann Frieden zu schließen? Vielleicht hätten die Waffen erst nach einigen Jahren geschwiegen. Doch auch dann hätte das Friedensabkommen Schlesien wahrscheinlich in Friedrichs Hand belassen, weil er in dieser Frage zu keinem Kompromiss bereit war; auch wenn er im Gegenzug erhebliche Reparationszahlungen an Österreich und Russland hätte leisten müssen. Bei einem längeren Krieg allerdings wären die Opferzahlen höher ausgefallen als im realen Siebenjährigen Krieg, der laut Schätzungen etwa 400.000 von Friedrichs Untertanen das Leben kostete, etwa ein Zehntel der Bevölkerung.
Ebendieses kontrafaktische Szenario entspinnt der Historiker Marian Füssel in seinem Aufsatz Das Debakel des Hauses Brandenburg 1762. Ein Geschoss trifft Friedrich bei Kunersdorf; verwundet nimmt er sich nach der verlorenen Schlacht das Leben. Selbst dann, führt Füssel aus, wäre eine Vollkatastrophe für Preußen ausgeblieben. Das Kommando über Friedrichs Truppen hätte sein Bruder Heinrich übernommen, ein begabter Feldherr. Durch geschickte Manöver hätte er ein militärisches Desaster abgewendet. Vielleicht schon 1762 wäre es zu einem Verhandlungsfrieden gekommen: Preußen, geschwächt durch seines Königs Tod, muss Schlesien wieder an die Habsburger abtreten. Ein herber Verlust. Aber Preußen zu zertrümmern, es in seine einstige Bedeutungslosigkeit zurückzustürzen, das wäre den Feinden auch in diesem Fall nicht gelungen. Friedrichs früher Tod hätte den Aufstieg Preußens zur Großmacht demnach wohl verzögern, aber nicht dauerhaft verhindern können. Und noch eine Frage bleibt, wenn auch keine zur europäischen Großmachtpolitik. Wie hätte sich Friedrichs Tod ausgewirkt auf das Schicksal der Kartoffel? Bekanntlich forcierte der Preußenkönig den Anbau des Gewächses. Doch der Effekt seiner Befehle auf die Verbreitung der Kartoffel in Preußen wird allgemein überschätzt. Wäre seine Niederlage noch so katastrophal ausgefallen: Dem Siegeszug der deutschen Lieblingsknolle hätte sie wohl nichts anhaben können.

SAMUEL RIETH ist Redakteur von ZEIT Geschichte
Ein Kaiser von Volkes Gnaden
Affront in Berlin: Preußens König lehnt 1849 die Krone eines Kaisers der Deutschen ab. Und wenn er sie angenommen hätte? VON RALF ZERBACK

SOUVERÄNE ENTSCHEIDUNG
Die Lithografie aus dem Jahr 1849 zeigt, wie Friedrich Wilhelm IV. die Knöpfe seiner Uniform befragt, ob er die Kaiserwürde annehmen soll: »Soll ich? – Soll ich nich? – Soll ich?! Knöppe, ihr wollt! nu jerade nich!!«

Ein sonderbarer Mann, unstet, labil, quallig. Der soll nun also Kaiser werden. Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, der »Romantiker auf dem Thron«, wurde am 28. März 1849 vom Frankfurter Paulskirchenparlament auserkoren. Eine »Kaiserdeputation« aus 32 Parlamentariern soll dem König die deutsche Krone schmackhaft machen. Die vielleicht letzte Chance, dass der Traum von 1848 wahr wird, der Traum vom freien, geeinten, demokratischen Deutschland.
Am 2. April trifft der Trupp aus Frankfurt am Potsdamer Bahnhof in Berlin ein; begrüßt von Vertretern des preußischen Parlaments, vom Magistrat und von den Stadtverordneten. Der beißende Geruch der Reaktion liegt bereits über der Stadt, denn der König hat den Belagerungszustand verhängt: also keine Fahnen, keine Beleuchtung, kein patriotischer Sang aus Männerkehlen. Allein der Zug ist schwarzrot-gold geschmückt, und die Deputation wird mit Vivat und Hurra empfangen.
Am Abend sind die Berliner Wirtshäuser überfüllt. Man feiert Deutschlands Zukunft; noch ein Lebehoch auf die Kaiserdeputation, noch eins auf den »Deutschen Kaiser Friedrich Wilhelm«. Selbst mancher wackere Republikaner bibbert der Entscheidung entgegen, die am folgenden Tag fallen soll: Wird der König die Kaiserkrone annehmen, die Krone von Volkes Gnaden?
Guten Muts machen sich die Männer aus Frankfurt am 3. April gegen zwölf Uhr auf den Weg ins Schloss. Die Deputation wird ins zweite Obergeschoss in den reichen
Rittersaal geführt, ein Rausch aus gelbem Stuckmarmor und Weiß, Gold und Silber. Friedrich Wilhelm IV. steht in Uniform unter dem Thronhimmel, den Helm im Arm, umgeben von Prinzen, Ministern, Generälen und Hofstaat. Eduard Simson, Präsident der Paulskirche, ergreift das Wort. Die Nationalversammlung habe die »erbliche Kaiserwürde« auf den preußischen König »übertragen«. Sie habe den Beschluss gefasst, »den erwählten Kaiser [...] einzuladen, die auf Ihn gefallene Wahl [...] annehmen zu wollen«.
Dann der König. Die Botschaft habe ihn tief ergriffen. Im Beschluss der Nationalversammlung erkenne er die Stimme der Vertreter des deutschen Volkes. Er ehre ihr Vertrauen, spreche seinen Dank aus. »Aber«, und hier hebt der König die Stimme, »meine Herren, Ich würde Ihr Vertrauen nicht rechtfertigen [...], wollte Ich [...] ohne das freie Einverständnis der gekrönten Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands eine Entschließung fassen, welche für sie und die für die von ihnen regierten deutschen Stämme die entschiedensten Folgen haben muss.« Es liege daher nun an den Regierungen der deutschen Staaten, zu prüfen, »ob die Verfassung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt« und ob die ihm, Friedrich Wilhelm, zugedachten Rechte ihn in den Stand versetzten, mit starker Hand die Geschicke des Vaterlandes zu leiten.
Das ist eine Neunzig-Prozent-Absage, verpackt in Watte und Worte. Die Abgeordneten sind bei den ersten Sätzen hoffnungsfroh, dann verwirrt, schließlich er-
schüttert. Ihre Mission ist gescheitert. Die Krone soll ja vom Parlament und damit vom Volk angetragen werden, nicht von Regierungen und Fürsten, deren Zusage außerdem fraglich ist. Zwei Tage später reist die Deputation aus Berlin ab. Das große, mühsam geschmiedete Verfassungswerk – alles Makulatur?
Immerhin: 28 der 38 Regierungen der deutschen Staaten geben das Plazet, das Preußens Herrscher so wortreich verlangt hat. In einer Note vom 14. April erkennen sie die Reichsverfassung und das Kaisertum an, akzeptieren mithin ein Deutschland mit Bürgerrechten, freien Wahlen und Reichstag. Doch die meisten größeren Länder fehlen, Österreich ist ohnehin außen vor, Preußen macht selbstredend nicht mit, auch kein Bayern und kein Hannover, zunächst auch kein Sachsen und kein Württemberg. Das ist zu wenig. Am 28. April lehnt Preußens König endgültig ab.
Da geschieht etwas Unerwartetes. Das Volk greift zum Gewehr, wie einst im Frühjahr 1848, diesmal, um die Reichsverfassung zu verteidigen: im Rheinland, in Westfalen, in Sachsen, in der bayerischen Pfalz, in Baden. Die Paulskirche befeuert die Aufstände, denn am 4. Mai 1849 ruft sie mehrheitlich dazu auf, die Verfassung durchzusetzen. Nun ersetzt die Waffe das Wort, zumal sich die Nationalversammlung peu à peu auflöst. Parlamentarier werden abgezogen, der radikale Rest zieht als »Rumpfparlament« nach Stuttgart, wo württembergisches Militär die Versammlung sprengt.
Der blutige Kampf für die Reichsverfassung, er setzt sich derweil fort und vermengt sich mit republikanischem Furor. Der sächsische König flieht mit seinen Ministern aus Dresden, eine provisorische Regierung der Demokraten wird gebildet. In Kaiserslautern wird eine pfälzische Republik ausgerufen, die sich von Bayern lossagt. Doch hier wie dort knüppeln preußische Truppen das Experiment nieder.
Am längsten wird in Baden gefochten, wo selbst Soldaten für die Demokratie einstehen. Am 13. Mai flüchtet der Großherzog über den Rhein, es finden Wahlen für
eine badische verfassungsgebende Versammlung statt. Aber auch hier setzt sich preußisches Militär in Marsch und besiegt die Revolutionäre am 21. Juni bei Waghäusel zwischen Karlsruhe und Mannheim. Darauf verschanzt sich ein Häuflein von 6.000 Demokraten – Soldaten, Freischärler, Waghäusel-Kämpfer – in der Festung Rastatt und verteidigt noch einen Monat lang den Traum von der freien Republik Baden. Erst am 23. Juli strecken sie die Waffen. Nach ihrer Kapitulation erschießen die Preußen unbarmherzig etliche der republikanischen Rebellen im Festungsgraben.
Während so die Revolution ausblutet, werkelt Preußens Regierung an einem geeinten Deutschland nach monarchischem Gusto, herrschertreu und demokratenfrei. Das ist die Erfurter Union. Ein Bund der Fürsten soll es sein, selbstredend unter preußischer Leitung. Österreich soll locker angebunden werden.
Einige norddeutsche Staaten folgen dem Ruf aus Berlin, darunter Hannover und Sachsen. Als Konzept dient die Paulskirchenverfassung, aus der man alles Demokratische abgesaugt hat. Die moderaten Liberalen um Heinrich von Gagern sind inzwischen so abgekämpft, dass sie in dieser Farce mitspielen. Es wird sogar ein Unionsparlament in Erfurt installiert, zunächst »Reichstag« genannt, das im März und April 1850 tagt. Das alles sind bizarre postrevolutionäre Spasmen. Druck aus Wien und Sankt Petersburg lässt Preußen, ohnehin nur halb dabei, zurückweichen. Das Erfurter Projekt wird beerdigt.
Mit Friedrich Wilhelm an der Spitze hätte sich ein neuer konstitutioneller Nationalstaat etabliert, die innere Macht balanciert zwischen Volk und Kaiser. Die Verfassung des Deutschen Reichs sah ein modernes Wahlrecht vor, das allerdings Frauen (wie allerorten) verwehrt blieb, und ein Parlament mit üppigen Befugnissen. Freilich wurden die Minister nach konstitutioneller Manier vom Herrscher ernannt, nicht vom Reichstag gewählt.
Wie hätte sich eine solche zentraleuropäische Großmacht im internationalen Kräftespiel behauptet? Drei Gegner wären womöglich auf den Plan getreten: Österreich wegen seiner deutschen Ambitionen, Frankreich wegen seiner Sorge vor einer neuen Großmacht, Russland wegen der Angst vor einem demokratischen Nachbarn. Hätten diese drei den Schulterschluss gegen Deutschland geprobt, vom 49erReich wäre wohl wenig übrig geblieben. Allerdings war Österreich wegen innerer Händel absorbiert, zum Teil auch Frankreich. Trotzdem wäre diplomatisches Geschick des deutschen Kaisers vonnöten gewesen, um die Nachbarn zu beruhigen.
Wäre dies geglückt, wäre das 19. Jahrhundert womöglich friedlicher verlaufen; zumindest die Kriege von 1866 und 1870/71 hätten so nicht stattgefunden. Es hätte in Frankreich keine antideutsche Verbitterung ob eines verlorenen Krieges und einer verlorenen Ostprovinz gegeben –und in Deutschland hätte sich jener militärselige Hurrapatriotismus, der das Kaiserreich zwischen 1871 und 1914 prägte, vielleicht schwächer oder gar nicht etabliert. Das obrigkeitsselige Fluidum wäre abgedämpft worden, da die Einigung ja von unten erfolgt wäre.
Auch das reale Bismarckreich modernisierte sich gesellschaftlich und wirtschaftlich; und der Reichstag gewann an Gewicht. Doch hätte sich nicht Ähnliches im Reich von 1849 ereignet, nur früher, kraftvoller?
Und der Erste Weltkrieg, die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, der Beginn des dunklen Säkulums? 48er-Euphorie ist hier fehl am Platz. Denn die europaweite
Mit diesen letzten Zuckungen ist 1848 perdu, die Utopie von einem Deutschland in Freiheit und Einheit verdampft im preußischen Pulvernebel. Eine ganze Generation – und mancher Nachlebende – trauert um die verpasste Chance, die sich aufgetan hatte in jenem Augenblick, in jenen Minuten des 3. April 1849, als sich im Berliner Schloss das neue Schwarz-Rot-Gold und das alte Schwarz-Weiß gegenüberstanden. Was wäre gewesen, wenn Friedrich Wilhelm die Kaiserkrone angenommen hätte? Wie hätte sich Deutschland dann entwickelt? Wäre gar ein anderer Pfad ins 20. Jahrhundert beschritten worden, ein »westlicher«, ein »englischer« Weg, ohne autoritäre Versuchung?

HINWEGGEFEGT: Wie ein Kartenhaus wird das Werk der Frankfurter Nationalversammlung von der Großmacht Preußen und der radikal-revolutionären Linken umgepustet. Die Karikatur erschien am 21. April 1849 in der »Illustrirten Zeitung« in Leipzig
Tendenz eines überschäumenden Nationalismus wäre durch eine frühe deutsche Reichsgründung, wie demokratisch auch immer, kaum abgefedert worden. Viele Achtundvierziger hatten grelle Visionen von einer muskulösen deutschen Macht, die sich gegen andere Staaten und Völker durchsetzt. Europäischer Kolonialismus und Imperialismus als Ausgeburten dieses Nationalismus hätten deshalb wohl in jedem Fall ihren Siegeslauf angetreten.
Fraglich ist auch, ob die gegen Großbritannien gerichtete deutsche Flottenpolitik weniger aggressiv ausgefallen wäre, denn bereits im Paulskirchenparlament von 1848 kam eine regelrechte Flotteneuphorie auf. Wahrscheinlich hätten hypertrophe Nationalismen auch im Szenario eines Reiches von 1849 die Kriegshysterie geschürt.
Aber war es überhaupt wahrscheinlich, dass Preußens König das RevolutionsReich von 1849 führen wird? Durften die Deputierten hoffen, dass er die Kaiserkrone annimmt? Eher nicht.
Hätten sie einen Brief des Königs vom Dezember 1848 gekannt, sie wären bereits mit mulmigem Gefühl nach Berlin gefahren. An den Botschafter in London schrieb Friedrich Wilhelm: »Die Krone, die ein Hohenzoller nehmen dürfte [...], ist keine, die eine [...] in die revolutionäre Saat geschossene Versammlung macht, [...] sondern eine, die den Stempel Gottes trägt.« Eine Krone der Nationalversammlung mit ihrem »Ludergeruch der Revolution« sei aus »Dreck und Letten [= Ton] gebacken«. Er und seinesgleichen allein könnten eine Kaiserkrone vergeben, »wehe dem, der sich anmaßt, was ihm nicht zukommt«.
Friedrich Wilhelm IV., das zeigten schon seine vormärzlichen Fantasien, wollte kein modernes Deutschland, er hatte romantisches Heimweh nach dem Alten Reich, nach Stauferstolz und Habsburgerseligkeit. Bald nach dem 3. April 1849 ließ er seinem Zorn gegen Frankfurt freien Lauf; einmal mehr nannte er die Krone ein »Hundehalsband«, mit dem man ihn an die Revolution ketten wolle. Monarchen werden von Gott eingesetzt, nicht vom Volk, so dachte der König. In dieser Frage war der Zauderer ein Hartschädel. Sein Credo: »Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.«

RALF ZERBACK ist Historiker und Journalist. Er lebt in Frankfurt am Main
ELEGANT UND UNGENAU
Aus diesem Bündelrevolver mit Elfenbeingriff
feuert Ferdinand Cohen-Blind mehrere Schüsse auf Otto von Bismarck ab

Es war ein raues Frühjahr gewesen. In den Mittelgebirgen hielt sich der Schnee bis in den April, und auch der Mai begann frostig. Otto von Bismarck hatte gerade eine Erkältung überstanden, als er sich am Nachmittag des 7. Mai 1866, dick eingehüllt in Unterhemd, Hemd, Weste, Herrenrock und Mantel, erstmals wieder zu einer Besprechung ins Königspalais begab. Zu Hause in der Berliner Wilhelmstraße empfing die Gattin des preußischen Ministerpräsidenten und Außenministers unterdessen Gäste, mit denen man sich nach der Rückkehr des Hausherrn zu Tisch setzen wollte. Doch an diesem Montag wurde ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt.
Denn auf dem Heimweg über den Prachtboulevard Unter den Linden fielen nahe der russischen Botschaft plötzlich Schüsse. Bismarck reagierte schnell und bekam seinen Angreifer zu fassen: einen elegant gekleideten jungen Mann mit dunklen Locken, dem es im Handgemenge gelang, den Revolver noch zwei weitere Mal aus nächster Nähe abzufeuern, bevor ihn herbeieilende Polizisten überwältigten und in Gewahrsam nahmen.
Zu seiner großen Verwunderung blieb Bismarck beinahe unverletzt. Lediglich eine
Rippe schmerzte, aber er konnte »bequem nach Hause gehen«, wie er der entsetzt lauschenden Tischgesellschaft berichtete. Tatsächlich hatten ihn die ersten Kugeln nur gestreift, während drei weitere abgeprallt waren.
Dazu mochte neben der dicken Kleiderschicht auch der Umstand beigetragen haben, dass sich die schmuckvoll gearbeitete Tatwaffe eher zur Abschreckung als zum Angriff eignete. Dem belgischen Bündelrevolver mit dem Elfenbeingriff mangelte es aufgrund seiner kompakten Bauweise an Präzision. Und weil der Attentäter ihn direkt auf den Mantel gehalten hatte, entwickelte die Munition nur geringe Durchschlagskraft. Für den Leibarzt Wilhelms I., der den Ministerpräsidenten im Beisein des Königs noch am Abend untersuchte, gab es freilich keine andere Erklärung als die, »dass Gottes Hand dazwischen gewesen ist« – eine Deutung, die sich Bismarck zu eigen machte.
Den Delinquenten hatte man mittlerweile zum Verhör auf das Berliner Kriminalkommissariat gebracht, wo er in einem unbeobachteten Moment Selbstmord beging. Es handelte sich, wie die Zeitungen sogleich vermeldeten, um den 22jährigen Ferdinand CohenBlind, den Stiefsohn des Revolutionärs Karl Blind, der nach der Nie
Keine Durchschlagskraft
Im Mai 1866 scheitert ein Attentat auf Otto von Bismarck. Hätten das Glück und sein dicker Mantel ihn nicht gerettet: Wäre Preußen und Österreich dann der »Bruderkrieg« erspart geblieben? VON UTE PLANERT
derschlagung des badischen Aufstands 1848 mit seiner Familie nach London geflohen war. Die britische Hauptstadt war für die europäischen Freiheitsbewegungen ein gefragtes politisches Exil, und so standen die Blinds mit Karl Marx und dem französischen Sozialisten Louis Blanc ebenso in Verbindung wie mit ungarischen und italienischen Revolutionären.
Kein Wunder also, dass Bismarck eine internationale Verschwörung witterte und in ganz Europa nach Hintermännern suchen ließ. Vergeblich, denn Cohen-Blind war ein Einzeltäter, der seine Absichten für sich behielt. Briefe, in denen er seine Tat rechtfertigte, kamen erst nach seinem Tod bei den Angehörigen an.
Cohen-Blind war in einem Umfeld radikaldemokratischer Opposition aufgewachsen und mit 18 Jahren zum Studium nach Württemberg gegangen. Dort schrieb er sich nach einem Gastaufenthalt in Tübingen 1864 an der Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim ein. Die Professoren hielten große Stücke auf den begabten Studenten, der auch als guter Schütze bekannt war. Doch den glühenden Patrioten bewegte schon bald die Tagespolitik mehr als die Wissenschaft. Mit Sorge beobachte-
te er, wie sich nach dem gemeinsamen Krieg gegen Dänemark der Konflikt zwischen Preußen und Österreich immer weiter zuspitzte.
Vordergründig ging es um die Zukunft der Herzogtümer Schleswig und Holstein, die nach der Herauslösung aus dem dänischen Gesamtstaat seit 1864 gemeinsam von beiden deutschen Großmächten verwaltet wurden. Doch dahinter stand der Kampf um die Vorherrschaft im deutschsprachigen Mitteleuropa. Als traditionelle deutsche Kaisermacht führte Österreich zwar den Vorsitz im Deutschen Bund, aber das ökonomisch und militärisch weit dynamischere Preußen war entschlossen, die Machtfrage in seinem Sinn zu entscheiden.
Treibende Kraft hinter diesen Plänen war Otto von Bismarck, der schon als preußischer Gesandter beim Frankfurter Bundestag jeden Versuch der Donaumonarchie hintertrieben hatte, den Deutschen Bund zu einem Instrument nationaler Einigung weiterzuentwickeln. Stattdessen baute er die Führungsrolle Preußens im Deutschen Zollverein aus und sorgte dafür, dass ein Beitritt für das ökonomisch rückständige Österreich unmöglich war. Eine Auseinandersetzung zwischen den Großmächten oder zumindest die Abgrenzung
HANDGEMENGE
Der Holzschnitt zeigt, wie der Attentäter aus nächster Nähe auf den preußischen Ministerpräsidenten schießt
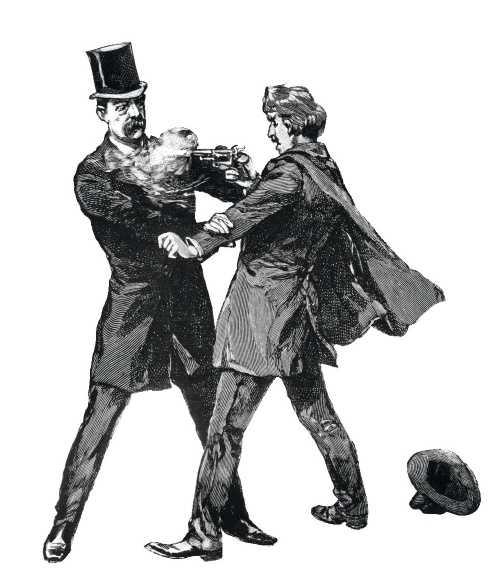
ihrer Einflusssphären schien dem ostelbischen Gutsherrn unumgänglich. Für beide war nach seiner Überzeugung kein Platz im Deutschen Bund: »Einer muss weichen oder gewichen werden.«
1862 von König Wilhelm I. im Streit mit dem Preußischen Abgeordnetenhaus um Heeresreform und Budgetfragen nach Berlin berufen, setzte Bismarck schon im ersten Regierungsjahr erhebliche Rüstungsanstrengungen durch. Machtfragen, so sein Credo, konnten nur »durch Eisen und Blut« gelöst werden. Dazu regierte er an der Verfassung vorbei und schränkte die Pressefreiheit erheblich ein, was ihm den Ruf eines »Konfliktministers« eintrug.
Immer schwieriger gestaltete sich auch das Verhältnis zu Österreich in SchleswigHolstein. Während Preußen nach dem Deutsch-Dänischen Krieg auf eine Annexion der Fürstentümer hinarbeitete, zeigte sich der Wiener Hof zunehmend geneigt, die Erbansprüche des als liberal geltenden Prinzen von Augustenburg zu unterstützen. Als der österreichische Gouverneur von Holstein im Januar 1866 eine Großdemonstration für die Regentschaft des Prinzen gestattete, sah Berlin darin einen Bruch bestehender Vereinbarungen und beauftragte das Militär, Vorbereitungen für den Kriegsfall zu treffen.
Nun ging es Schlag auf Schlag. Im März verlegten beide Mächte Truppen an ihre Grenzen. Im April schloss Bismarck unter Bruch der Bundesverfassung einen auf drei Monate befristeten Geheimvertrag mit Italien, das im Kriegsfall Österreich von Süden her angreifen und dafür Venetien erhalten sollte, das nach der italienischen Nationalstaatsgründung noch in der Habsburgermonarchie verblieben war. Die nun einsetzenden Truppenbewegungen in Italien forderten Wien zur Verstärkung seiner Armeen heraus. Am 5. Mai 1866 antwortete Preußen mit der Generalmobilmachung.
Damit war klar, dass ein »Bruderkrieg« zwischen den beiden deutschen Mächten kaum mehr zu vermeiden war. Ferdinand Cohen-Blind, der die Neuigkeiten auf ei-
ner Reise in Böhmen verfolgte, war die Vorstellung unerträglich, dass Tausende junger Männer ihr Leben für »rein egoistische Zwecke einiger weniger« verlieren sollten, wie er in einem seiner letzten Briefe schrieb. Überzeugt davon, ohne Bismarck könne der Krieg noch abgewendet werden, nahm er den nächsten Zug nach Berlin, um sich »das eigene Ich aus dem Herzen« zu reißen und »durch das Opfer zweier Leben viele zu retten«.
Wäre also alles anders gekommen, wenn Cohen-Blind sein Ziel erreicht hätte? Hätte ein durchschlagskräftigerer Revolver den »Bruderkrieg« verhindert? Wäre am Ende gar die Reichsgründung ausgefallen,
Bismarck war nicht der Einzige, der auf einen Krieg gegen Österreich setzte
wenn Bismarck nicht erkältet gewesen wäre? Angesichts der vorausgegangenen Entwicklungen war das unwahrscheinlich. Denn Bismarck war keineswegs der Einzige, der auf das finale Kräftemessen der beiden deutschen Hegemonialmächte zusteuerte. Preußens Kriegsminister Albrecht von Roon und Generalstabschef Helmuth von Moltke hatten im Kronrat längst für einen Krieg votiert. Auch der zögerliche König war nun willens, die Waffen sprechen zu lassen. Das zeitlich befristete Abkommen mit Italien setzte alle Beteiligten unter Handlungsdruck, und spätestens nach der Generalmobilmachung Anfang Mai konnte Wilhelm I. nicht mehr zurück, ohne fatale Erinnerungen an die »Schande von Olmütz« zu wecken, als Preußen 1850 auf außenpolitischen Druck hin seine Mobilmachung
zurücknehmen und sich dem Machtanspruch Österreichs beugen musste. Auch Österreich bewegte sich auf einen Krieg zu. Die innenpolitische Situation des Vielvölkerstaats war seit 1865 heillos verfahren. Kaiser Franz Joseph hatte die Verfassung außer Kraft gesetzt, und die Finanzlage war nach dem verlorenen Krieg gegen Italien desaströs. Nur durch die Vermittlung des französischen Kaisers Napoleon III., der von einem deutschen »Bruderkrieg« zu profitieren hoffte, konnte die überschuldete Donaumonarchie noch einen Kredit aufnehmen. Die hohen Zinsen förderten die Bereitschaft zu einem baldigen Krieg, denn bei einem erwarteten Sieg ließ sich die Finanzkrise mit preußischen Entschädigungszahlungen lösen.
Letzte diplomatische Initiativen und internationale Vermittlungsversuche scheiterten. Er wisse nicht, wie ein Krieg »noch mit Ehre zu vermeiden sein könnte«, schrieb Kaiser Franz Joseph vier Tage vor dem Bismarckattentat an seine Mutter. Die Monarchie vertrage jetzt »eher einen Krieg als einen langsam aufreibenden faulen Frieden«.
Auch die liberale Nationalbewegung war zunehmend bereit, für die deutsche Einheit unter preußischer Führung einen Krieg zu akzeptieren und innenpolitische Differenzen hintanzustellen. Zwar feierten Süddeutschland und Österreich Ferdinand Cohen-Blind als idealistischen »Heldenjüngling« und »zweiten Wilhelm Tell«. Doch im Norden schlug die Stimmung nach dem erfolgreichen Krieg so gründlich um, dass man Bismarck sogar den Verfassungsbruch verzieh.
Den »Bruderkrieg« hätte das Attentat nicht verhindern können. Aber wäre es erfolgreich gewesen, wäre Bismarck nicht als glorreicher Gründungskanzler des Deutschen Reiches, sondern als verhasster »Konfliktminister« und »Tyrann« in die Annalen eingegangen.

UTE PLANERT ist Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Köln









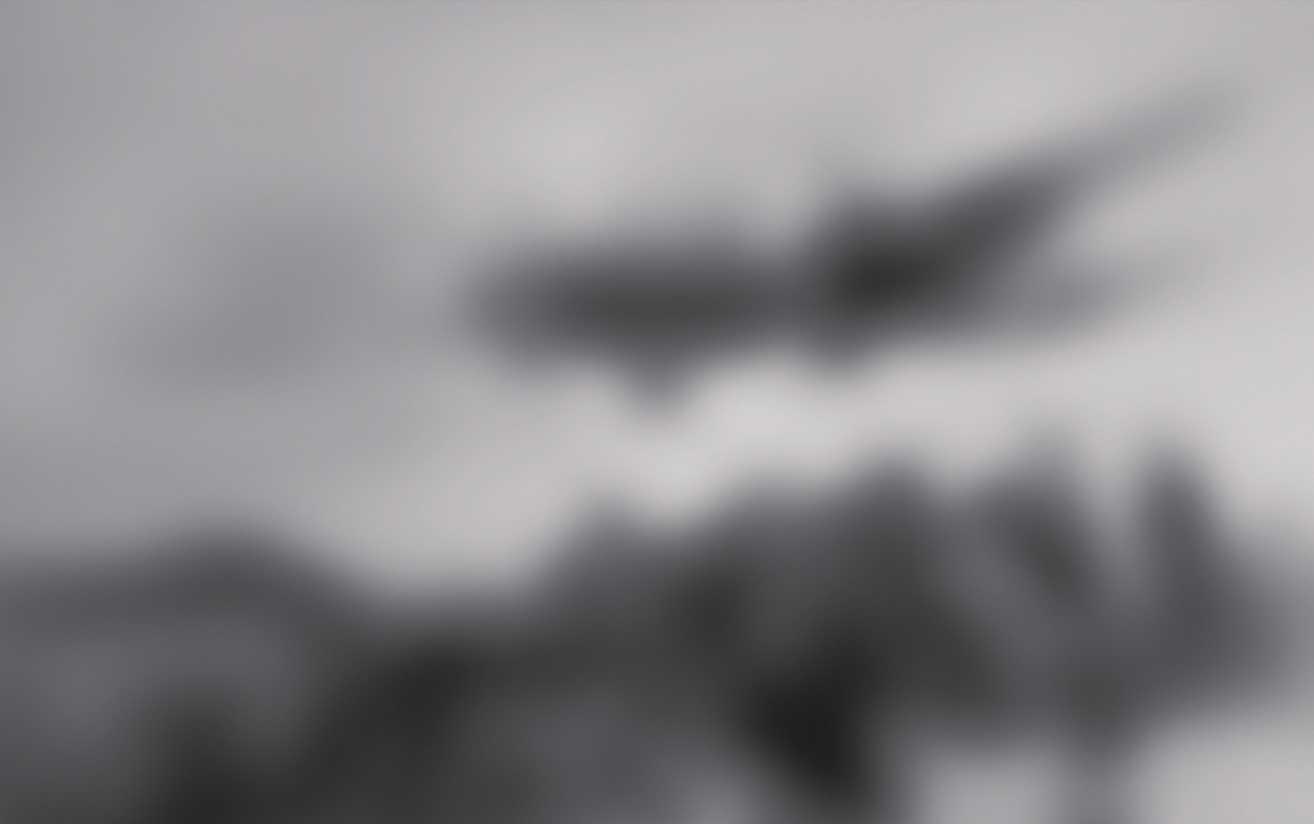

Das deutsche Duell
Bei Königgrätz drängen die Österreicher die Preußen am 3. Juli 1866 an den Rand einer Niederlage. Die Schlacht entscheidet über die Zukunft Deutschlands und Europas. Was wäre geschehen, wenn die Armee der Habsburger triumphiert hätte?
VON ALEXANDER CAMMANN
KAMPFGETÜMMEL: Mehr als 400.000 Mann ziehen bei Königgrätz in die Schlacht. Rechts reitet preußische Kavallerie zum Angriff, links unten wird ein verwundeter Österreicher weggetragen. In der Mitte thront der Preußenkönig Wilhelm im Sattel, hinter ihm sind Bismarck und mehrere Generäle zu sehen. Das Gemälde entstand um 1869



Mittags sah es schlecht aus für das Königreich Preußen. Vier Stunden lang hatten seine Soldaten den Gegner bereits vergeblich attackiert, nachdem sie das Flüsschen Bistritz überquert hatten; weit vorangekommen waren sie dabei nicht. 72 todbringende Kanonen donnerten ihnen von den Hügeln entgegen. Die moderne österreichische Artillerie mit ihren 700 Geschützen war in dieser Schlacht drückend überlegen. Ihre gezogenen Läufe ermöglichten präzises und weites Feuer. Davor im Swiepwald rannten die Österreicher des
IV. Armeekorps von allen Seiten an, hier steckten Preußens Infanteristen der 7. Division fest. Im Stab um König Wilhelm auf einem nahen Hügel wuchs zusehends die Nervosität, der Monarch selbst war der Verzweiflung nahe. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, seit vier Jahren im Amt, erlebte seine erste Schlacht live und war dafür in der Uniform eines Majors der Landwehrkavallerie erschienen, mit langem grauem Mantel und Kürassierhelm, zum Gespött der Offiziere. Generalstabschef Helmuth von Moltke, der diesen Krieg durchgeplant hatte, schnäuzte ständig in sein rotes Taschentuch, er war an diesem Tag schwer erkältet.

EHRENZEICHEN
Preußens Kronprinz erhält 1866 diesen Stern zum Großkreuz des Pour le Mérite, 1873 zusätzlich das Eichenlaub. In der Mitte ist Friedrich der Große abgebildet
Auch dem preußischen Generalleutnant Eduard von Fransecky, dem Befehlshaber der 7. Division, war der Ernst der Lage klar. Als ihm ein Melder das erwartete Eintreffen der Armee von Kronprinz Friedrich Wilhelm verkündete (dem nachmaligen 99-Tage-Kaiser von 1888), sagte er erleichtert: »Man hat’s ja in der Schule gelernt. Die Nacht oder Blücher. Wir sind hier keine Wellingtons, aber uns ist’s geradeso ums Herz.« Fransecky spielte auf das legendäre Zitat Wellingtons aus der Schlacht bei Waterloo 1815 gegen Napoleon an, als der britische Kommandeur dringend auf den Einbruch der Dunkelheit wartete oder auf das Eintreffen der preußischen Truppen General Blüchers.
Doch die Dimension des Kampfes, der nun tobte, übertraf noch die von Waterloo. Die Schlacht bei Königgrätz in Böhmen, die um acht Uhr morgens an diesem 3. Juli 1866 begonnen hatte, war eine der größten des 19. Jahrhunderts. Mehr als 400.000 Soldaten kämpften an diesem Tag; 221.000 Preußen gegen 215.000 Österreicher und Sachsen. Nach nur drei Wochen Krieg brachte die Schlacht die Entscheidung. Sie bestimmte, wie die Deutschen sich staatlich organisieren würden, und wälzte das Machtgefüge Europas um. Manche Zeitgenossen erkannten das sofort: »Casca il mondo!«, rief Giacomo Antonelli, Kardinalstaatssekretär von Papst Pius IX., als er in Rom die Nachricht vom Ausgang der Schlacht hörte: »Die Welt stürzt ein!«
Tatsächlich hatte die Armee des preußischen Kronprinzen am frühen Nachmittag die Wende geschafft, auch dank ihrer Artillerie. Die Fehler des österreichischen Oberkommandierenden, Feldzeugmeister Ludwig von Benedek, summierten sich, seine Truppen blieben, als die Preußen erfolglos angriffen, trotz ihrer überlegenen Geschütze in ihrer Defensivstellung zu passiv. Im Swiepwald wiederum verkämpften sie sich sinnlos in Gegenattacken, die ihre Kräfte banden: Insgesamt 43 Bataillone warfen sie den Preußen dort an diesem Tag vergeblich entgegen – mit furchtbaren Verlusten für die Österreicher, die im heftigen Feuer der preußischen Zündnadelgewehre aufgerieben wurden.
Wie entscheidend diese neuartige Waffe im Krieg von 1866 war, darüber streitet man bis heute. Einen Vorsprung bot sie Preußen allemal, wenn sie störungsfrei funktionierte. Denn Infanteristen konnten mit dem Zündnadelgewehr bis zu siebenmal pro Minute feuern, aus der Deckung und selbst im Liegen. Die in allen anderen europäischen Armeen noch üblichen Vorderlader schossen zwar etwas weiter, aber ermöglichten nur zwei Schuss pro Mi-
nute. Und die Schützen mussten für das umständliche Laden im Stehen die Deckung verlassen.
Die preußische Armee wurde Mitte der 1860erJahre flächendeckend mit Zündnadelgewehren ausgestattet, was ihre Feuerkraft im Krieg von 1866 dramatisch verbesserte. So lagen die Verluste schon in der Schlacht von Trautenau am 27. Juni bei 4.800 Österreichern und nur 1.300 Preußen; in der Schlacht von Nachod am selben Tag bei 5.700 Österreichern gegenüber 1.200 Preußen. Bei Podol starben am 28. Juni 500 von 3.000 kämpfenden Österreichern im Kugelhagel, die Preußen verloren nur 130 Mann. Die Unterschiede in den Verlustraten waren eklatant. Eine erfolgreiche Gegentaktik konnten die auf den traditionellen Infanterie-Stoßkampf mit Bajonett fixierten österreichischen Militärs kurzfristig nicht entwickeln.
Bei Königgrätz musste Benedek seiner Armee am Nachmittag gegen 16.30 Uhr den Rückzug hinter die Elbe befehlen. Er hatte 41.000 Tote, Vermisste, Verwundete und Gefangene zu beklagen, unter ihnen 6.000 Gefallene, die Preußen zählten 2.000 Tote. Unter dem Schutz der Kanonen der Festung Königgrätz rettete Benedek den Rest seines Heeres vor der preußischen Verfolgung und Umfassung. König Wilhelm umarmte derweil seinen Sohn und verlieh ihm noch auf dem Schlachtfeld den Orden Pour le Mérite. Im letzten Tagesbefehl um 18.30 Uhr verkündete Moltke die allgemeine Waffenruhe. Preußen hatte gesiegt.
Der Ausgang dieser kriegsentscheidenden Schlacht hatte jedoch tiefer liegende Ursachen. Da war der österreichische Feldzeugmeister Benedek, der sich vor allem in Norditalien auskannte und sich daher lange gegen die Übernahme des Oberbefehls in diesem Krieg gesträubt hatte. Kaiser Franz Joseph bestand aber darauf, weil ein Oberkommandierender aus der Habsburgerfamilie im Falle einer Niederlage gleich den Fortbestand der Monarchie gefährdet hätte.
Benedek schickte denn auch nach den ersten Rückschlägen seiner Armeen am 30. Juni ein flehendes Telegramm an den Kaiser, mit der Bitte, »um jeden Preis Frieden zu schließen«. Die Antwort kam zwei Stunden später: »Einen Frieden zu schließen unmöglich. Ich befehle – wenn unausweichlich – den Rückzug anzutreten.« Benedeks Stab wurde ausgetauscht, was während der großen Schlacht drei Tage später verhängnisvoll wirkte.
Entscheidend waren auch Österreichs Schwierigkeiten mit der riskanten Strategie Moltkes, die später unter dem geflügelten Wort »Getrennt marschieren
– vereint schlagen!« berühmt wurde. Drei preußische Armeen agierten unabhängig voneinander in Böhmen, was schnelleres Vorankommen bedeutete, auch durch die Eisenbahn. In der Schlacht sollten sie sich vereinen und den Gegner von mehreren Seiten angreifen. Die Heere waren so im Aufmarsch zwar verwundbarer, doch die Österreicher nutzten dies nicht aus. Und sie konnten nicht verhindern, dass die Armee des Kronprinzen im kritischen Moment auf das Schlachtfeld von Königgrätz marschierte.
Die Preußen hatten weitere Vorteile: Ihr Generalstab war professioneller und innovativer als die Befehlsgeber der Österreicher, und die preußischen Soldaten handelten autonomer; sie waren »Berufssoldaten, kein Schlachtvieh, das sich von Offizieren in Richtung Front treiben ließ«, wie der PreußenKenner Christopher Clark festgestellt hat.
Die preußischen Infanteristen absolvierten seit einigen Jahren eine intensive Schießausbildung, protokollierten selbstständig ihre Ergebnisse und lernten, zum Beispiel auf größere Distanzen die bogenförmige Bahn der Geschosse zu kalkulieren. Hier wirkte das preußische Schulsystem: »Ohne den außergewöhnlich hohen Bildungsgrad, sowohl im Hinblick auf das Lesen und Schreiben wie auch auf das Rechnen, wäre dieses Programm wohl zum Scheitern verurteilt gewesen«, urteilte Clark.
In der multiethnischen Armee der Österreicher hingegen gab es massive Verständigungsprobleme zwischen den vielen Nationalitäten – und wenig Begeisterung für diesen Krieg. Die finanzielle Situation in Wien tat ein Übriges: Dort hatte man sich seit vielen Jahren zu Einsparmaßnahmen beim Militär gezwungen gesehen – ganz anders als im prosperierenden Preußen der Industriellen Revolution.
Hinzu kam die europäische Mächtekonstellation Mitte der 1860er-Jahre, die Bismarck ausnutzte, um das Duell zu begrenzen. Denn Preußen musste um jeden Preis verhindern, dass eine der anderen Großmächte zugunsten Österreichs eingriff. Bismarck hatte Russland bei dessen Niederschlagung des polnischen Aufstands 1863 unterstützt – anders als die Österreicher, die den Zaren kritisiert hatten.
Dem frisch geeinten Nationalstaat Italien, der aufseiten Preußens in den Krieg eintrat, hatte Bismarck zuvor per Geheimvertrag im Siegesfall das ersehnte Venetien versprochen, das seit 1815 zu Österreich gehörte. Großbritannien war damals desinteressiert an kontinentalen Dingen. Und die Begehrlichkeiten Frankreichs unter Napoleon III., dessen Vermittlungsangebot Bismarck nach Königgrätz rasch annahm, konnte er geschickt auf Luxemburg ablenken.
Nach dem Schlachtensieg war für Bismarck politische Geschwindigkeit entscheidend, denn wer wusste schon, was die europäischen Mächte nach dem Triumph der preußischen Pickelhaube sonst unternommen hätten. Massiv drängte er seinen König zu einem milden Frieden, gegen den sich Wilhelm anfangs heftig sträubte – ein Leben lang hatte er sich von den Habsburgern degradiert gefühlt.
Am 9. Juli, sechs Tage nach der Schlacht, schrieb Bismarck an seine Frau: »Ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, dass wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Mächten, die uns hassen und neiden.« Er war auch damit erfolgreich: Die Preußen zogen nicht in Wien ein, sondern schlossen Frieden.
So endete nach wenigen Wochen der Krieg zwischen Preußen und Österreich, dessen zentrale Ursache im tief sitzenden Konflikt beider Mächte lag. Bereits mehr als ein Jahrhundert dauerte er an: Geschichtsbewusste Zeitgenossen beschworen immer wieder die Feindschaft zwischen Friedrich dem Großen und Maria Theresia. Im Kampf gegen Napoleon jedoch hatte man zueinandergefunden und seit dem vom österreichischen Staatskanzler Metternich orchestrierten Wiener Kongress 1814/15 in einer Mächteallianz Europa mitbeherrscht – über die Revolutionen von 1848 hinaus, die beide Staaten erschüttert hatten.
Metternich war es jedoch, der ungewollt einen Grundstein für den rasanten Aufstieg Preußens im 19. Jahrhundert gelegt hatte und die Habsburger schwächte. Diese bekamen auf dem Wiener Kongress die Lombardei und Venetien in Norditalien zugesprochen, was ihnen perspektivisch Nationalitätenkonflikte einbrachte. Hingegen zogen sie sich aus dem heutigen Belgien zurück: Das alte habsburgische Territorium war zu kostspielig und galt als Gefahrenherd für Konflikte mit Frankreich.
Als neuen Aufpasser gegen revolutionär-imperiale Umtriebe der Franzosen installierte Metternich an der rheinischen Grenze die Preußen: Sie erhielten die Rheinlande, die alsbald die Keimzelle der Industrialisierung in Deutschland wurden. So bekam der Agrarstaat Preußen eine starke Industrie, während die wirtschaftliche Modernisierung des Habsburgerreiches erst nach der Niederlage von 1866 einsetzte.
Die Rivalität Preußens und Österreichs im Deutschen Bund, der 1815 entstanden war, verband sich mit der nationalen Frage: Die liberale Nationalbewegung strebte nach einem geeinten Nationalstaat,
FEUERKRAFT
Das moderne Zündnadelgewehr verschafft den Truppen Preußens 1866 einen Vorteil im Gefecht

WEITERLESEN
Klaus-Jürgen Bremm: »1866. Bismarcks deutscher Krieg«
wbg/Herder Verlag, Darmstadt 2021
aber in welchen Grenzen? Sollte es für die »verspätete Nation« (so der Philosoph Helmuth Plessner) eine kleindeutsche Lösung ohne Österreich geben oder eine großdeutsche unter Einschluss der Habsburgerreiches? Bismarck forcierte eine kleindeutsche Einigungspolitik unter preußischer Führung, die den Deutschen Bund unterminierte. Dagegen lehnten sich vor allem die süddeutschen Staaten und Sachsen auf, weil sie ihre Unabhängigkeit zusehends bedroht sahen.
Hinzu kam die Religion, eine omnipräsente Konfliktlinie zwischen Nord und Süd, deren Historie 1866 ebenfalls gern heraufbeschworen wurde: Die katholischen Süddeutschen lehnten sich an das erzkatholische Haus Habsburg an, während die protestantischen Preußen verächtlich die Ultramontanen bekämpften. So war es nur konsequent, dass man in Rom nach dem preußischen Sieg die Welt zusammenstürzen sah. Die Liberalen in Deutschland hingegen machten reihenweise begeistert ihren Frieden mit dem Ministerpräsidenten, den viele im Verfassungskonflikt um die Finanzierung des preußischen Militärhaushalts eben noch vehement bekämpft hatten. Jetzt hatte dieses Militär triumphiert.
Die Folgen der Niederlage waren für die Österreicher dramatisch: Nach 800 Jahren schieden sie aus jenem Gebilde aus, das man mit groben Strichen als deutsche Nation bezeichnen könnte. »Aus Deutschland treten wir jedenfalls ganz aus, ob es verlangt wird oder nicht. Dieses halte ich nach den Erfahrungen, die wir mit unseren lieben deutschen Bundesgenossen gemacht haben, für ein Glück für Österreich«, so schrieb Kaiser Franz Joseph am 23. Juli 1866 an seine Frau Elisabeth, »Sisi«.
In der Folge des Krieges entstand 1867 der preußisch dominierte Norddeutsche Bund, eine Vorstufe des Deutschen Kaiserreichs, das die Österreicher ausklammerte. Doch noch am Tag der Königgrätzer Schlacht hatte Bismarck seine Entschlossenheit geäußert, »die alte Freundschaft mit Österreich wiederzugewinnen«, und seine Milde wirkte. Sie führte nach der Reichsgründung 1871 zu einer treuen deutsch-österreichischen Verbindung, die bis zum Ende des Ersten Weltkrieges halten sollte – der Katastrophe, in der die Monarchien der Hohenzollern und der Habsburger gemeinsam untergingen.
Was wäre geschehen, wenn die Entscheidungsschlacht bei Königgrätz anders ausgegangen wäre? Wenn etwa Österreichs Kommandeur Benedek geschickter agiert hätte? Was hätte ein Sieg über Preußen im Duell der Großmächte bedeutet?
König Wilhelm hätte wohl zugunsten seines liberaleren Sohnes Kronprinz Friedrich Wilhelm abgedankt, der Preußen vielleicht freisinniger geformt hätte. Bismarck wäre zurückgetreten und nicht zum hochverehrten Alten im Sachsenwald geworden, sondern tatsächlich zu jenem seltsamen Krautjunker auf seinem Schloss Schönhausen, als den er sich oft ironisiert hat. Ganz sicher hätte es die kleindeutsche Lösung nicht gegeben, in deren Folge es zu zwei katastrophalen Weltkriegen kam.
Österreichs Triumph hätte 1866 womöglich einen mächtigen süddeutschen Staatenbund ergeben, katholisch dominiert. Weiter nördlich wäre Mitteleuropa in Schwäche verharrt, denn das zurechtgestutzte Preußen wäre eingehegt geblieben; vielleicht hätte Frankreich auch in wenigen Jahrzehnten und ein paar kleineren kriegerischen Auseinandersetzungen die Rheingrenze für sich gewonnen.
In jedem Fall hätte es in Europa weiterhin das Konzert der Großmächte gegeben, die in jede revolutionäre, demokratische Bestrebung in einem europäischen Land eingegriffen hätten, wie schon 1848. Die Sache der Freiheit hätte sich womöglich trotzdem langsam entwickelt – allerdings nicht das nationale deutsche Sendungsbewusstsein, das die gigantischen Blutströme des 20. Jahrhunderts maßgeblich verursacht hat. Möglicherweise wäre ein frühes postnationales Herz Europas allerdings zu schwach gewesen, um den Kontinent wirklich zu befrieden.
Vielleicht aber wäre aus dem süddeutschen Staatenbund auch ein Gebilde wie eine Art Schweiz entstanden, föderalistisch und demokratisch, nur sehr viel größer. Frankfurt und Köln wären internationale Metropolen wie Paris, Wien und London geworden, Berlin hingegen wäre abgesunken zu einem preußischen Museum, arm und eher unsexy, mit nostalgisch schönen Schinkel-Bauten, die an vergangenen Ruhm erinnern. Und Preußen wäre im Jahr 2025 eine kleine, feine konstitutionelle Monarchie wie die Niederlande, vielleicht mit Polnisch als zweiter Amtssprache. Oder es hätte das Schicksal Burgunds erlitten: ein kurzzeitig mächtiges, bald verschwundenes Reich, das zwar nicht für seinen Wein, aber immerhin noch für seine Königlich Preußische Porzellan-Manufaktur bekannt ist. Ein preußischer Traum aus einer Niederlage: So schlecht klingt er ja vielleicht gar nicht.

ALEXANDER CAMMANN ist Redakteur im Feuilleton der ZEIT. Er lebt in Berlin
Keine Ausgabe mehr verpassen
ZEIT Geschichte stellt sie Ihnen in jeder Ausgabe vor: die großen Epochen, Menschen und Ideen der Weltgeschichte – anschaulich, spannend und kontrovers. Das Magazin liefert historisches Hintergrundwissen zu gegenwärtigen Themen und Debatten, denn man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Sichern Sie sich jetzt drei Ausgaben für nur 21 €, und sparen Sie 25 % gegenüber dem Einzelkauf.
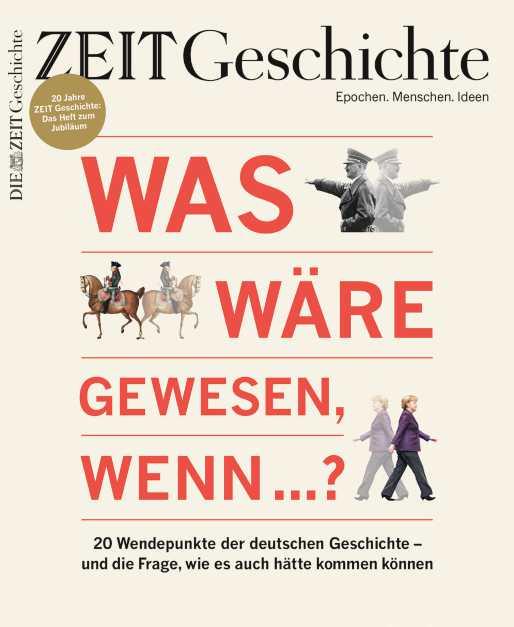
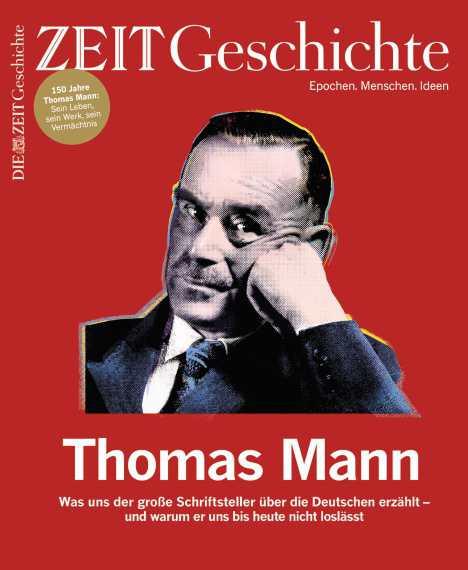

3 Hefte für nur 21 €
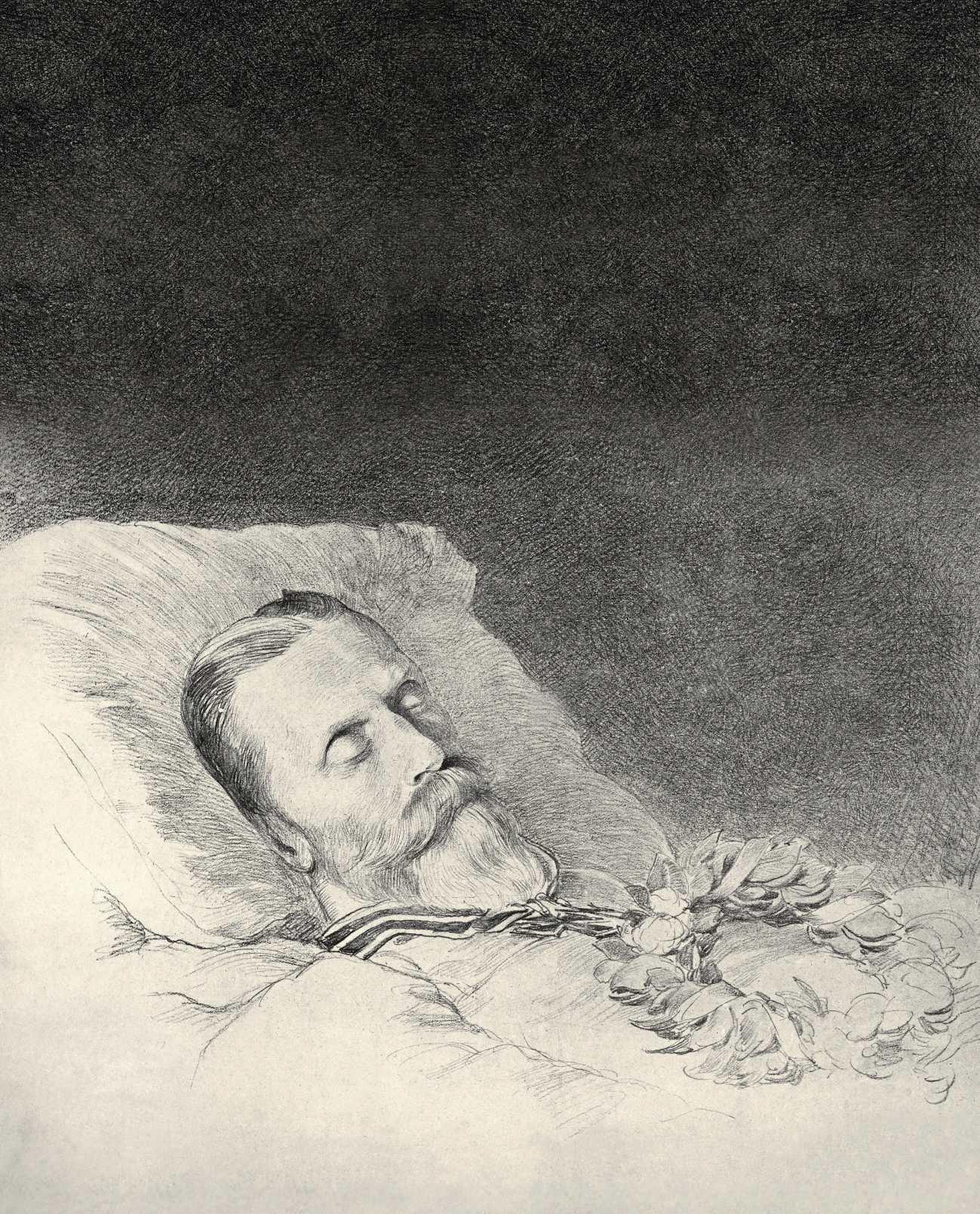
TOTENBETT: Am 16. Juni 1888, einen Tag nach dem Ableben des Kaisers, zeichnet Anton von Werner den Verstorbenen im Neuen Palais in Potsdam
»Eine Tragödie für die Deutschen«
In den 1880er-Jahren ruhen die Hoffnungen der Liberalen auf Friedrich III. Aber der Thronfolger hat Krebs und regiert nur 99 Tage. Wäre das Kaiserreich unter ihm weniger reaktionär und chauvinistisch geworden? VON VOLKER ULLRICH
Am Vormittag des 9. März 1888 erschüttert eine Nachricht die Reichshauptstadt Berlin: Kaiser Wilhelm I. ist im hohen Alter von fast 91 Jahren gestorben. »Nun saßen wir stumm und traurig beisammen«, notiert die Hofdame Baronin Hildegard von Spitzemberg. »Die Kehle war einem wie zugeschnürt, und in Gedanken zog das Lebensbild des Geschiedenen an meinem inneren Auge vorüber«. Mit dem Tod des greisen Monarchen schien sich in Preußen-Deutschland eine Zeitenwende anzubahnen. Denn sein Nachfolger, Kronprinz Friedrich Wilhelm, der als Friedrich III. den Thron bestieg, galt als ein Hoffnungsträger des Liberalismus. Anders als seinem stockkonservativen Vater wurden ihm gar Sympathien für ein parlamentarisches System nach briti-
schem Vorbild nachgesagt. Seine Ehe mit der resoluten, ihm geistig überlegenen Prinzessin Victoria, der ältesten Tochter der britischen Königin Victoria und des Prinzen Albert, hatte solche Mutmaßungen genährt.
Was den einen Hoffnung machte, war für die anderen Anlass zur Sorge. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte sich seit den Siebzigerjahren immer wieder mit der Frage beschäftigt, was geschehen würde, wenn Wilhelm I. das Zeitliche segnete. Er hatte für diesen Fall schon früh Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass bei einem Thronwechsel die anglophilen Neigungen des Kronprinzenpaares die Kreise seiner Politik stören könnten. So war seine Wende zur Kolonialpolitik Anfang der Achtzigerjahre auch innenpolitisch bedingt: Er verfolge damit »nur den Zweck, einen Keil zwischen den Kronprinzen und
England zu schieben«, äußerte sich Bismarck im September 1884. Die unerwartet lange Lebenszeit Wilhelms I., der den Reichskanzler trotz gelegentlicher Widerrede im Großen und Ganzen schalten und walten ließ, kam Bismarcks Bestrebungen entgegen. Und ein weiterer Umstand spielte dem Reichsgründer in die Hände: Friedrich III. war, als er endlich die Nachfolge antreten konnte, bereits ein todkranker Mann. Ihm sollten nur 99 Tage Regierungszeit vergönnt sein.
»Durfte nicht aus wegen andauernder Heiserkeit; muss 2 Mal tägl(ich) Emser Wasser inhalieren«, hielt der Kronprinz am 18. Februar 1887 in seinem Tagebuch fest. Mit diesem Eintrag beginnt die Geschichte seiner tödlichen Erkrankung. Im Frühjahr hatten die Ärzte eine Geschwulst im
Hals festgestellt. Sie diagnostizierten Kehlkopfkrebs und wollten sofort operieren. Doch der von ihnen hinzugezogene englische Spezialist Morell Mackenzie hielt, unterstützt von dem berühmten Berliner Professor Rudolf Virchow, die Geschwulst für gutartig. Der Disput der Mediziner verzögerte den notwendigen Eingriff, der allerdings beim damaligen Stand der Kenntnisse lebensgefährlich gewesen wäre.
Im November 1887 aber gab es keinen Zweifel mehr: Kronprinz Friedrich, der sich zur Erholung in San Remo an der Riviera aufhielt, war unheilbar an Krebs erkrankt. Die Bestürzung war groß, auch in Hofkreisen. »Wir alle waren zu sehr unter dem Eindrucke der schrecklichen Nachrichten über des Kronprinzen Befinden, um heiter sein zu können. Die Prophezeiungen der deutschen Ärzte scheinen leider nur zu rasch in Erfüllung zu gehen«, bemerkte die Baronin Spitzemberg.
Anfang Februar 1888 mussten die Ärzte eine Tracheotomie, einen Luftröhrenschnitt, vornehmen, der dem 56-jährigen Patienten die Atmung erleichterte, ihm aber endgültig die Stimme raubte. Er konnte sich nur noch durch Gesten oder beschriebene Zettel mit seinem Gefolge verständigen. Als gebrochener Mann kehrte er am 11. März 1888 nach Berlin zurück. So lag über der Inthronisation Friedrichs III. bereits der Schatten der Vergeblichkeit.
»Zu spät! Der furchtbare Gedanke verfolgt mich Tag und Nacht«, klagte Kaiserin Victoria in den Briefen an ihre Mutter, die Queen. Alles, was der neue Herrscher in der kurzen Spanne, die ihm blieb, noch tun konnte, waren einige symbolische Handlungen, etwa Ordensverleihungen an liberale Persönlichkeiten und – das immerhin ein deutliches Signal – die Entlassung des reaktionären preußischen Innenministers Robert von Puttkamer. Alle weiter gehenden Pläne scheiterten am Widerstand des Reichskanzlers. Bismarck engte den Wirkungskreis des Kaiserpaares so weit ein, dass die Kaiserin sich von einem »Wall der Opposition« umgeben fühlte.
Friedrich III. starb am 15. Juni 1888. Der letzte Eintrag in seinem Tagebuch stammt nicht mehr von ihm, sondern von der Kaiserin Friedrich, wie sie sich bald nennen wird: »Um 11. – ein halb – hörte er auf zu atmen! Ach – wie konnte so Furchtbares geschehen! Wehe mir, dass ich es überdauern muss!! – Armes Vaterland!« Alle Blicke richteten sich nun auf den ältesten Sohn, Prinz Wilhelm, der als Wilhelm II. mit nur 29 Jahren den Thron bestieg. Dessen politische Entwicklung hatte die Mutter mit zunehmender Sorge verfolgt. »Willie ist chauvinistisch und ultrapreußisch in einem Grade und mit einer Gewalt, die für mich oft sehr schmerzlich ist«, heißt es in einem Brief vom August 1880. Umso schwerer empfand Victoria die Tragik der »übersprungenen Generation«, die Unmöglichkeit, die Weichen noch in eine andere Richtung zu stellen.
Hätten die Weichen anders gestellt werden können? Wäre das Deutsche Reich, wenn Friedrich III. ohne schwere Krankheit hätte länger regieren können, zu einer fortschrittlichen, liberaleren Monarchie nach britischem Vorbild geworden? Wäre den Deutschen und Europa die aggressive Weltmachtpolitik Wilhelms II. dann erspart geblieben?
Über diese Frage ist viel gestritten worden. Schon Friedrich Nietzsche sah in dem frühen Tod Friedrichs ein nationales Unglück, weil damit »die letzte Hoffnung« auf eine freiheitliche Entwicklung in Deutschland zu Grabe getragen worden sei. Nicht wenige Historiker sind seinem Urteil gefolgt. »Das war und das bleibt eine Tragödie für die Deutschen«, kommentierte Thomas Nipperdey in seiner vielgerühmten Deutschen Geschichte 1866–1918. »Zu all dem kam nun die Person des Nachfolgers, Wilhelms II., dieses fleischgewordenen Unglücks der jüngeren deutschen Geschichte vor Hitler.«
Aber es ist zweifelhaft, ob Friedrich III., hätte er länger gelebt, viel an den bestehenden Machtstrukturen hätte ändern und die Verfassung liberaler hätte ausgestalten
können. Seit dem von Bismarck 1878/79 forcierten Übergang von der Freihandelszur Schutzzollpolitik bestimmte die Allianz von »Roggen und Stahl«, von ostelbischem Großgrundbesitz und rheinischwestfälischer Schwerindustrie, das gesellschaftspolitische Kräfteverhältnis. In engem Schulterschluss blockierten die alten Machteliten in Adel, Bürokratie und Militär, denen sich das Großbürgertum zugesellte, alle Tendenzen, die auf Liberalisierung und Parlamentsherrschaft zielten.
Zudem waren die Chancen für eine liberale Kurskorrektur nach 1883 mit dem Rechtsschwenk der Nationalliberalen und ihrem Bündnis mit den konservativen Parteien weiter gesunken. Der Substanzverlust des deutschen Liberalismus hatte sich bereits vor 1888 vollzogen. Damit waren einem Umbau des konstitutionellen Systems nach britischem Muster von vornherein Grenzen gesetzt.
Überdies gingen die Sympathien des Kronprinzen für die liberalen Ideen seiner Frau nicht so weit, dass er bereit gewesen wäre, mit den militärischen Traditionen der Hohenzollerndynastie zu brechen. »Er war hin- und hergerissen zwischen seiner grundsätzlich liberalen Einstellung und seiner Überzeugung, dass eine starke monarchische Führung auf alle Fälle bewahrt werden müsse«, bilanziert sein Biograf Frank Lorenz Müller.
Noch bedeutsamer war, dass ihn die unerwartet lange Wartezeit auf die Thronnachfolge allmählich zermürbt und in seinem politischen Gestaltungswillen gelähmt hatte. »Die Unmöglichkeit während meiner besten Mannesjahre Hand an’s Werk zu legen, hat mich [...] ganz niedergedrückt«, klagte er im Mai 1879 in einem melancholischen Brief an seine Frau. »Ich empfinde weder Interesse, noch halte ich’s der Mühe wert, für die paar Jahre, die ich noch existieren mag, mich mit Plänen der Politik zu befassen, u[nd] resigniere mich.«
Das Bewusstsein, dass seine Zeit bereits abgelaufen war, bevor sie eigentlich begonnen hatte, quälte den Kronprinzen. Seine zunehmende Resignation war symp-

ERBFOLGE: Kaiser Wilhelm I. hält im Frühsommer 1882 seinen neugeborenen Urenkel Friedrich Wilhelm auf dem Schoß. Daneben stehen die späteren Kaiser: links sein Sohn Friedrich Wilhelm, rechts sein Enkel Wilhelm
tomatisch für die Krise, in der sich der Liberalismus seit der konservativen innenpolitischen Wende von 1878/79 befand.
Als ein schwacher Mann, ohne Selbstvertrauen und politischen Elan, erschien Kronprinz Friedrich Wilhelm Gegnern und Freunden gleichermaßen, und zwar lange bevor sich die ersten Anzeichen der todbringenden Krankheit bemerkbar machten. So vertraute Friedrich von Holstein, die »graue Eminenz« im Auswärtigen Amt, im März 1884 seinem Tagebuch an: »Der Prinz hat aber in neuerer Zeit und gerade jetzt wieder Perioden von Welt
schmerz und Niedergeschlagenheit, deren Ursachen sich dahin zusammenfassen lassen, dass er sich für einen ›überwundenen Standpunkt‹ hält«.
Dass die Dominanz Bismarcks daran einen entscheidenden Anteil hatte, war dem Kronprinzen sehr wohl bewusst. Wie ein roter Faden durchzieht sein Tagebuch von der Reichsgründung 1871 an die Klage über die fast diktatorische Stellung des Reichskanzlers. »Überhaupt ist des Kanzlers Macht auf Kosten des Kaisers u[nd] der Krone stets im Zunehmen begriffen«, notierte er im Oktober 1874. Und im
März 1875 hieß es: »Auf Kosten des Ansehens, ja der Machtfülle unserer beiden Kronen schraubt er seine Bedeutung immer höher u[nd] gewöhnt das Reich wie auch die Welt, nur nach seinen Ansichten zu fragen.«
Einen offenen Konflikt mit dem Allmächtigen zu riskieren, davor scheute der Kronprinz zurück. Im Gegenteil: Im Juli 1885 lud er Bismarck ins Potsdamer Neue Palais ein und traf mit ihm eine geheime Abmachung, deren Inhalt er am Abend in seinem Tagebuch festhielt: »Dass, wenn der Wechsel einträte, ich auf ihn rechnete, um Hand in Hand mit ihm die Geschäfte fortzuführen, so dass keine Unterbrechung fühlbar würde, u[nd] wir beide nur für das Wohl des Staates handelten.« Mit anderen Worten: Bismarck erhielt die verbindliche Zusage, dass er auch unter dem Nachfolger Wilhelms I. Reichskanzler bleiben und seine Politik fortsetzen könne.
So gehört die Vorstellung, dass das Deutsche Reich unter einem länger regierenden Kaiser Friedrich III. eine grundsätzlich andere, liberale Richtung eingeschlagen hätte, ins Reich der Legenden oder Wunschvorstellungen. Allerdings wäre unter seiner Regierung wohl ein moderaterer Kurs verfolgt worden als unter dem »persönlichen Regiment« Wilhelms II. – weniger reaktionär nach innen und weniger aggressiv nach außen.
Zu spät erkannte Bismarck, welche Gefahren von dem unberechenbaren, völlig unter dem Einfluss des Militärs stehenden Prinzen Wilhelm nicht nur für seine eigene Machtstellung, sondern auch für den Frieden in Europa ausgingen. Im Mai 1888, vier Wochen vor der Thronbesteigung Wilhelms, klagte er: »Der junge Herr will den Krieg mit Russland, möchte womöglich gleich das Schwert ziehen.« Der Reichsgründer seufzte: »Wehe meinen Enkeln!«

VOLKER ULLRICH ist Historiker, Journalist und Mitherausgeber von ZEIT Geschichte
WENDE PUNK T 8.
Bei Mord Krieg?
Ende Juni 1914 erschießt ein serbischer Nationalist in Sarajevo den österreichischen Thronfolger. Sein Plan, damit einen Krieg auszulösen, geht auf.
Doch die Eskalation in der Julikrise ist keineswegs zwangsläufig
VON CHRISTOPH NONN
Der letzte Schuss traf das Ziel. Ein halbes Dutzend Attentäter und deren serbische Hintermänner hatten den Anschlag schon Monate zuvor geplant, als die Zeitungen den Besuch des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo ankündigten. Doch am 28. Juni 1914, als der Thronfolger in einer Wagenkolonne nach Sarajevo einfuhr, ging zunächst alles schief, was schiefgehen konnte.
Gegen zehn Uhr fuhr die Kolonne am ersten der Attentäter vorbei, doch der erkannte Franz Ferdinand nicht. Die Bombe behielt er bei sich. Der zweite Verschwörer hatte dasselbe Problem und musste sich erst bei einem Polizisten erkundigen, in welchem der Autos Franz Ferdinand und seine Frau Sophie saßen. Schließlich entsicherte er seine Bombe und warf sie gegen den Wagen. Doch der Thron-

DIE LETZTE FAHRT
Franz Ferdinand und seine Frau Sophie verlassen am 28. Juni 1914 das Rathaus in Sarajevo. Der offene Wagen, in dem sie wenig später ermordet werden, steht heute im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Auf Höhe der Sitzbank ist das Einschussloch zu sehen


folger sah das Geschoss kommen. Um seine neben ihm sitzende Frau zu schützen, hob er instinktiv den Arm. Die Bombe prallte daran ab und explodierte vor dem nächsten Automobil. Weil dessen Insassen dabei nur leicht verletzt wurden, setzte die Kolonne die Fahrt fort – in Richtung der übrigen Verschwörer. Der dritte Attentäter war mit einer Pistole bewaffnet. Aber er bekam Mitleid mit der Thronfolgerin und schoss nicht. Auch den vierten verließ im entscheidenden Moment der Mut. Franz Ferdinand und seine Frau erreichten unversehrt das Rathaus. Statt den Besuch abzubrechen und zurückzufahren, setzten sie nach einem kurzen Stopp die Fahrt durch die Stadt fort, zum Krankenhaus, um den Verletzten des Bombenattentats aufzusuchen.

ZUGRIFF
Nach dem Attentat führen Polizisten einen Mann ab. Das Bild zeigt, anders als lange angenommen, nicht den Schützen Gavrilo Princip, sondern einen anderen Verdächtigen
Der fünfte Attentäter, Gavrilo Princip, hatte sich nach dem Versagen seiner Mitverschwörer schon in ein Straßencafé gesetzt, als er zu seiner Überraschung die Autokolonne mit dem Thronfolger kommen sah. Keine zwei Meter von ihm entfernt hielt plötzlich der Wagen mit Franz Ferdinand und seiner Gattin, weil sich der Fahrer über die Route im Unklaren war. Princip stand auf und feuerte aus nächster Nähe. Sein erster Schuss auf den Thronfolger war schlecht gezielt: Die Kugel prallte gegen den Wagen, wurde dadurch abgelenkt und traf Sophie. Princips zweiter Schuss traf Franz Ferdinand am Hals. Während dessen Begleiter und Passanten den Attentäter packten und beinahe lynchten, verbluteten der Thronfolger und seine Frau binnen weniger Minuten.
Mit dem Mord wollten die Verschwörer der »Schwarzen Hand«, eines radikalnationalistischen serbischen Geheimbunds, nicht nur die wichtigste friedliebende Reformkraft in Wien ausschalten. Sie hofften auch darauf, die Österreicher dadurch zu aggressiven Schritten gegen Serbien provozieren zu können. Das wiederum sollte Russland, die Schutzmacht der Serben, auf den Plan rufen. Ziel war letzten Endes eine militärische Auseinandersetzung unter Beteiligung der Großmächte, in deren Verlauf Österreich-Ungarn zerschlagen werden und aus seinen Trümmern ein großserbischer Staat, Jugoslawien, entstehen würde. Diese Rechnung ging auf.
Aber was wäre gewesen, wenn Franz Ferdinand nach dem ersten missglückten Anschlag die Fahrt durch Sarajevo nicht fortgesetzt hätte? Wenn sein Wagen nicht unmittelbar vor Gavrilo Princip gehalten hätte? Oder wenn auch der fünfte Attentäter sein Ziel verfehlt hätte? Schon das Gelingen des Attentats in Sarajevo war nicht ausgemacht. Auch dass wenige Wochen nach dem gelungenen Attentat der Erste Weltkrieg begann, war nicht zwangsläufig.
Die internationale Krise, die sich aus dem Anschlag entwickelte und schließlich zum großen Krieg führte, war nicht die erste auf dem Balkan. Schon 1908/09 hatten Serbien und Russland dem Habsburgerreich gegenübergestanden, als Österreich-Ungarn Bosnien (und damit auch Sarajevo) annektierte. Wenig später, 1912/13, vertrieb dann ein Krieg der verbündeten Balkanstaaten das Osmanische Reich aus der Region. Über die Beute entbrannte zwischen den Siegern ein zweiter Waffengang. Weil Russland Serbien, Österreich-Ungarn aber Bulgarien unterstützte, drohten die Großmächte erneut in den Konflikt hineingezogen zu werden. Doch wie schon 1909 wurde durch Vermittlung Deutschlands und Großbritanniens die Gefahr eines großen Krieges gebannt. 1914 sah die Führung Österreich-Ungarns in dem Mord an Franz Ferdinand und Sophie einen geradezu willkommenen Anlass, gegen Serbien vorzugehen. Denn die größte Gefahr für den Zusammenhalt des habsburgischen Vielvölkerreichs schien von der panslawischen Bewegung auszugehen, die durch Belgrad unterstützt wurde. Schon länger hatte man in Wien auf eine günstige Gelegenheit gewartet, gegen die serbischen »Störenfriede« einzuschreiten – jetzt schien sie gekommen. Freilich musste damit gerechnet werden, dass die geplante »Strafaktion« ein Eingreifen Russlands provozieren würde.
Deshalb versuchte die Wiener Regierung, sich deutscher Unterstützung zu versichern. In der Balkankrise 1912/13 hatte Deutschland die Österrei-
cher von einem militärischen Vorgehen abgehalten. Die Berliner Politik, Konflikte durch Konferenzen und internationale Entspannung zu lösen, wurmte in Wien immer mehr. Manche zweifelten dort schon an der Zuverlässigkeit des deutschen Bündnispartners. Angesichts der offensichtlichen Verwicklung serbischer Offizieller in das Attentat von Sarajevo schien nun die Chance gekommen, Berlins Unterstützung für einen offensiven Kurs zu gewinnen. In Deutschland war das Echo auf die Anfrage aus Wien durchwachsen. Generalstabschef Helmuth von Moltke hatte bereits 1912 einen Krieg gegen Russland und Frankreich für unvermeidlich erklärt. Da Russland noch nicht sein volles militärisches Potenzial erreicht habe, drängte Moltke im Mai 1914 erneut darauf, diesen Krieg gemeinsam mit dem Verbündeten Österreich-Ungarn so bald wie möglich zu beginnen. Allerdings war das vor den Schüssen von Sarajevo. Und möglicherweise meinte der Generalstabschef es auch nicht wirklich ernst; vielleicht wollte er mit den Kassandrarufen nur einmal mehr seinen seit 1912 erhobenen Forderungen Nachdruck verleihen, das Heer stärker aufzurüsten. Jedenfalls hatten deutsche Militärs in den vorigen Jahrzehnten schon viele Male einen Präventivkrieg gegen Frankreich, Russland oder alle beide gefordert. Gekommen war es dazu bisher noch nie.
Auch 1914 rechneten sie offenbar zunächst nicht damit. Am Tag des Attentats reiste Moltke aus Berlin nach Karlsbad zur Kur, ohne sich von dort in die Verhandlungen mit den Österreichern einzuschalten. General Erich von Falkenhayn, der preußische Kriegsminister, erklärte auf eine unverbindliche Anfrage Kaiser Wilhelms II. Anfang Juli, Deutschland sei natürlich kriegsbereit. Dann fuhr auch er in Urlaub. Da der Kaiser am 6. Juli seinerseits zur alljährlichen Nordlandkreuzfahrt aufbrach, hielt allein Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg in Berlin die Stellung. Bethmann erkannte, dass von einem großen europäischen Krieg »eine Umwälzung alles Bestehenden« zu erwarten sei –eine Aussicht, die ihm als vorsichtigem Konservativen nicht behagte.
Der Reichskanzler glaubte zudem, ein Krieg könne wie bei den früheren Konfrontationen der Großmächte verhindert werden. Darin wurde er besonders durch die Erfahrung des erfolgreichen Krisenmanagements bestärkt, das Deutschland im Zusammenwirken mit Großbritannien auf dem Balkan 1908/09 und 1912/13 geglückt war. Auch hatte sich trotz des Scheiterns eines Flottenabkommens das deutschbritische Verhältnis seitdem merklich verbessert. Im ersten Halbjahr 1914 gelang mit Frankreich und
Großbritannien sogar eine Einigung über Eisenbahnkonzessionen im Osmanischen Reich. Gleichzeitig erreichten Berlin jedoch Nachrichten über britisch-russische Flottengespräche. Das nährte beim Reichskanzler die Furcht vor einer »Einkreisung« Deutschlands durch eine weit überlegene gegnerische Allianz. Österreich-Ungarn war in dieser Situation der einzige verbliebene Verbündete. Eine weitere Schwächung oder gar den Zerfall des Habsburgerreichs wollte Bethmann Hollweg deshalb auf keinen Fall riskieren: Deutschlands »eigenes Lebensinteresse« erfordere die »unversehrte Erhaltung Österreichs«. Sollte sich Wien aus Enttäuschung über Berlin vom deutsch-österreichischen Zweibund abwenden und andere Partner suchen, drohte dem Deutschen Reich sogar die völlige Isolierung. Die Österreicher erhielten deshalb wie erhofft die Zusage unbedingter Bündnistreue aus Berlin. Im Vertrauen darauf stellte Wien Belgrad am 23. Juli 1914 ein scharfes Ultimatum. Dessen erwartete Ablehnung sollte den Anlass für eine Kriegserklärung liefern.
Belgrad suchte sofort in Sankt Petersburg Rat. Im Zarenreich hatte das Militär schon insgeheim mit der Mobilisierung begonnen, während die Österreicher noch am Text des Ultimatums feilten. Russland hatte seit einem Jahrzehnt eine außenpolitische Schlappe nach der anderen einstecken müssen. Nach einer demütigenden Niederlage im Krieg gegen Japan 1905 stand auch die russische Balkanpolitik vor einem Fiasko. Durch ihr zögerndes Verhalten in den Krisen von 1908/09 und 1912/13 verlor die Regierung des Zaren praktisch sämtliche Sympathien in Rumänien und Bulgarien. Serbien war der letzte verbliebene Verbündete in der Region. Zudem stärkten in Russland auch innenpolitische Krisenszenarien im Juli 1914 die »Falken«, die zu einer kompromisslosen Haltung neigten. Die nach der Niederlage gegen Japan ausgebrochene und nur mühsam niedergeschlagene Revolution von 1905 hatte gezeigt, wie gefährdet die Herrschaft des Zaren war. Infolgedessen war die Neigung gewachsen, von inneren Missständen durch eine aggressive Außenpolitik abzulenken. Russland ermunterte Serbien deshalb, den Punkt des Ultimatums aus Wien abzulehnen, der eine Beteiligung Österreichs an der Suche nach den Urhebern des Attentats von Sarajevo in Serbien forderte. Das war freilich die entscheidende Forderung: Denn angesichts der führenden Positionen der Hintermänner des Attentats in der serbischen Armee, Polizei und Bürokratie wäre eine rein innerserbische Untersuchung eine Farce gewesen. Dass die Österreicher darauf mit einer Kriegserklärung an Serbien reagieren würden, war auch in Sankt Petersburg vorauszu-

GOLDKNÖPFE UND BLUTSPUREN
Diese Uniform trug Franz Ferdinand bei seinem Besuch in Sarajevo
WEITERLESEN
Christopher Clark: »Die Schlafwandler.
Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog« Pantheon Verlag, München 2015
sehen. Die Regierung des Zaren nahm es sehend in Kauf, auch weil sie ihren französischen Bündnispartner hinter sich wusste. Wenige Tage zuvor hatte der französische Staatspräsident Raymond Poincaré seine russischen Gesprächspartner ausdrücklich aufgefordert, gegenüber Österreich und Deutschland möglichst offensiv aufzutreten. Der französische Botschafter bekräftigte kurz darauf eigenmächtig in Sankt Petersburg die »bedingungslose« Unterstützung seines Landes im Kriegsfall.
Diese französische Ermunterung Russlands entsprach der deutschen Zusage unbedingter Bündnistreue an Österreich-Ungarn. Auf die Franzosen vertrauend, trieb das Zarenreich nach der einkalkulierten österreichischen Kriegserklärung an Serbien am 28. Juli die Eskalation der Krise mit der Ausweitung seiner militärischen Mobilmachung voran. Einen Tag später ließ die britische Regierung Bethmann Hollweg in Berlin wissen, Großbritannien werde im Kriegsfall aufseiten Russlands und Frankreichs stehen. Die daraufhin in letzter Minute unternommenen Versuche Bethmanns und Wilhelms II., durch Einwirken auf Wien und Sankt Petersburg die Eskalation noch aufzuhalten, scheiterten – nicht zuletzt am Drängen der Militärs, die ihre Aufmarschpläne möglichst rasch in die Tat umsetzen wollten, um dem Gegner zuvorzukommen.
In der Rückschau wird der Weg in den Krieg 1914 oft als eine geradlinige Eskalation dargestellt. Dies befriedigt zwar das Bedürfnis nach einer linearen Erzählung, die Ordnung in eine schwer überschaubare Vielzahl von Schauplätzen, Akteuren und oft auch gegenläufigen Entwicklungen bringt. Tatsächlich war an der Eskalation in der Julikrise aber viel Zufälliges und nichts Zwangsläufiges.
Die deutsche Politik setzte in der Krise nicht zielbewusst darauf, den großen Krieg zu entfesseln, um einen »Griff nach der Weltmacht« zu wagen, wie Anfang der Sechzigerjahre der Hamburger Historiker Fritz Fischer behauptete. Bethmann Hollweg wollte vielmehr in erster Linie das eigene Bündnis mit Österreich-Ungarn stärken und das der Gegner schwächen oder spalten.
Dass daraus ein großer europäischer Krieg entstehen könnte, kalkulierte er zwar als Möglichkeit mit ein, hielt diese aber wie Wilhelm II. für wenig wahrscheinlich. Denn Kanzler und Kaiser gingen von der falschen Annahme aus, weder Russland noch Frankreich noch Großbritannien seien bereit zum Krieg. Nicht bedenkenlose Kriegstreiberei war das Problem des deutschen Krisenmanagements 1914, sondern schlampige Geheimdienstarbeit. Wäre diese
besser gewesen, hätte Bethmann Österreich kaum die Zusage unbedingter Bündnistreue gegeben. In Sankt Petersburg war man kriegsbereiter als in Berlin angenommen, aber auch der russische Kriegseintritt war keineswegs vorherbestimmt. Während die Militärs energisch dafür plädierten, war die politische Führung vorsichtiger. Der Zar schwankte zwischen Krieg und Frieden, stoppte sogar wiederholt die Mobilmachung. Neben der Furcht vor außenund innenpolitischen Konsequenzen war es schließlich die französische Haltung, die in Sankt Petersburg das Pendel hin zur Eskalation ausschlagen ließ.
Frankreichs »Nibelungentreue« zum russischen Bündnispartner war freilich ebenso wenig sicher. Denn weder die französische Bevölkerung noch der französische Premierminister René Viviani wollten den Krieg. Was wäre geschehen, wenn Viviani sich gegen Präsident Poincaré hätte durchsetzen können und wenn der Pariser Botschafter in Sankt Petersburg nicht eigenmächtig gegen seine Anweisungen gehandelt hätte? Russland hätte Serbien den Rücken gegen die österreichischen Forderungen wohl nicht so massiv gestärkt und nicht so entschieden auf militärische Stärke statt auf Diplomatie gesetzt.
Dazu trug letzten Endes auch die britische Haltung bei. Großbritannien rief zwar wiederholt zur diplomatischen Lösung der Julikrise auf. Bis zum 29. Juli, als London Berlin vor einem britischen Kriegseintritt warnte, nutzten die Briten aber ihr beträchtliches Gewicht als Großmacht nicht, um die anderen Großmächte von einer Eskalation abzuhalten. Weder warnten sie Deutschland früher, noch signalisierten sie ihren französischen Partnern deutlich, dass diese und die mit ihnen verbündeten Russen sich nicht auf Großbritannien verlassen sollten.
Wäre das Attentat von Sarajevo im Juni 1914 nicht erfolgreich gewesen, hätte es keinen Anlass für eine Eskalation zwischen den Großmächten gegeben und folglich im Sommer 1914 auch keinen Weltkrieg. Aber dieser war auch nach dem gelungenen Attentat keineswegs unausweichlich. Das ist die eigentliche Quintessenz kontrafaktischer Überlegungen zur Julikrise. Die Verantwortlichen in Berlin, Sankt Petersburg, Paris und London hätten anders handeln können, um zu deeskalieren und den großen Krieg zu verhindern. Doch sie verspielten diese Chance. So führte die Balkankrise von 1914 in den Weltkrieg, der 1909 und 1913 noch abgewendet worden war.

CHRISTOPH NONN ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Düsseldorf
Am 15. April 1917, im dritten Jahr des Großen Krieges, erreicht eine Reisegesellschaft von 30 Menschen den Bahnhof Haparanda im Norden Schwedens. Am Grenzfluss Torneälv beginnt Finnland, das damals zum Russischen Reich gehört. Gut 3.000 Kilometer hat die Gruppe hinter sich, sechs Tage lang ist sie von der Schweiz aus unterwegs gewesen. Mit Schlitten, die von Ponys gezogen werden, legt sie die letzte Etappe über den zugefrorenen Fluss zurück. Bezahlt hat die Reise die deutsche Regierung. Einer der Passagiere heißt Wladimir Iljitsch Uljanow, Kampfname Lenin.
Die Deutschen haben den Revolutionär aus dem Exil in Zürich geholt und wollen ihn in die Heimat einschleusen, damit er Russland von innen destabilisiert und das Land bald kapituliert. Es sieht nicht gut aus für die Russen: Deutsche und österreichische Truppen haben sie fast überall geschlagen. Nach dem Sturz des Zaren ist in Petrograd im Februar 1917 eine Doppelspitze an die Macht gekommen: ein sozialistischer Arbeiter- und Soldatenrat und die bürgerliche Provisorische Regierung, geleitet von Fürst Georgi Lwow und Kriegsminister Alexander Kerenski. Sie wollen weiterkämpfen. Das will Lenin nicht.
Seit geraumer Zeit unterhält er Kontakte zur deutschen Regierung, die ihm über Mittelsmänner Geld zukommen lässt. Lange ist man sich in Berlin nicht sicher, ob es sich lohnt, Lenin und seine Bolschewiki zu protegieren. Ist er nur ein Parkbank-Demagoge? Spielt seine Fraktion in der Heimat eine Rolle? Die Mittelsleute, die Lenin persönlich kennen, sind von ihm überzeugt: Der Mann ist radikal und kann andere mitreißen.
Auch Deutschlands Kriegsgegnern ist bekannt, wer da Anfang April 1917 durch Europa rollt. Der britische Botschafter in Stockholm, Esmé Howard, grübelt, ob er den Zug stoppen kann. Auch er sieht in Lenin und den Bolschewiki eine Gefahr für die neue russische Führung unter Lwow und Kerenski, die der Entente zugesichert hat, nicht zu kapitulieren. Howard wälzt Optionen: Könnte man den Zug aufgrund einer Pockenepidemie in Deutschland an der Grenze unter Quarantäne stellen? Die
letzte Chance dafür wäre in Tornio kurz vor dem Polarkreis. Der entlegene Ort ist im Krieg zu einer der wenigen Landbrücken zwischen den Fronten geworden: Kriegsgefangene werden hier ausgetauscht, Waren verschifft und Postsendungen transportiert. Auch die Briten haben dort ein paar Leute.
Passage am Polarkreis
Hätte es ohne Lenin in Russland keine Oktoberrevolution gegeben?
VON MARKUS FLOHR

Nur in der Fiktion steigt hinter Lenin auch Stalin in Petrograd aus dem Zug
Als er in Tornio ankommt, sieht Lenin über dem Grenzhäuschen eine rote Fahne wehen. Was blüht ihm? Russische Beamte befragen die Gruppe. Auch britische Offiziere sind anwesend. Lenin gibt an, Journalist zu sein, auf der Heimreise. Eilig telegrafieren die Briten aus dem Hinterzimmer. Doch aus Stockholm kommt nichts zurück. Botschafter Howard hat nicht den Mut, eigenmächtig zu handeln. Im Gegensatz
zur deutschen Führung wollen die Briten sich in Russland heraushalten. Die britischen Grenzer lassen auch in Petrograd beim Außenminister nachfragen. Um Zeit zu gewinnen, unterzieht ein englischer Offizier Lenin einer Leibesvisitation und durchwühlt dessen Papiere und Bücher. Als auch aus Petrograd kein Einspruch kommt, gibt der Grenzer auf.
Was wäre passiert, wenn Lenin in Tornio festgehalten worden wäre? Die britische Historikerin Catherine Merridale beschreibt in ihrem Buch Lenins Zug den Ort, in dem geschmuggelt wird und man »ein oder zwei weitere Ausländer [...] nahezu spurlos« hätte verschwinden lassen können.
Lenins Schweizer Genossen Fritz Platten verwehren die Russen die Einreise. Er harrt tagelang aus und kehrt schließlich um. Es wäre wohl kein Aufschrei durchs Russische Reich gegangen, wenn auch Lenin in Tornio hätte bleiben müssen. Tatsächlich ist er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal allen Bolschewiki ein Begriff. Bekannter sind Josef Stalin, Chefredakteur der Prawda, oder Lew Kamenew, der sich für eine Einigung mit der Provisorischen Regierung ausspricht. Und nur wenige Wochen nach Lenins Einreise wird auch Leo Trotzki aus dem Exil zurückkehren, der spätere politische Rivale.
Ohne Lenins Rückkehr wäre wahrscheinlich Trotzki die Rolle des Führers der russischen Linken zugekommen. Der will alle Macht für die Räte, eine fortgesetzte Revolution. Doch er misstraut den Bolschewiki. Ein gemeinsamer Aufstand ist anfangs kaum denkbar, doch im Juli 1917 stößt Trotzki zu Lenins Partei.
Als Duo zetteln sie die Oktoberrevolution an, die letztlich zur Errichtung der Sowjetunion führt. Ohne Lenins Rückkehr wäre es dazu nicht gekommen. Die Chance, Russland eine neue, demokratische Ordnung zu geben, verstreicht im Laufe des Jahres 1917. Daran wirken auch die deutsche und die britische Regierung mit: die eine durch ihre Einmischung, die andere durch ihr Heraushalten.
MARKUS FLOHR ist Redakteur von ZEIT Geschichte
KAMPF UM
DAS SCHLOSS
Soldaten der Volksmarinedivision richten ihre Maschinengewehre am 24. Dezember 1918 im Berliner Stadtschloss auf die angreifenden Regierungstruppen. Einer der Matrosen liegt erschossen vor einem Pfeiler
W ENDE PUNK T 10.
Wie die Revolution gelungen wäre
Nach dem Ersten Weltkrieg paktiert die SPD mit der Obersten Heeresleitung – die radikaleren Sozialisten verlieren den Wettstreit um die Macht. Einer von ihnen, Hugo Haase, entwirft das Szenario eines echten Umsturzes
VON KLAUS LATZEL




»TAKTISCHER FEHLER«
Der Co-Vorsitzende der USPD, Hugo Haase, übt Kritik am Vorgehen seiner Partei.
Das Porträt zeigt ihn um das Jahr 1918
Historischen Akteuren ist ihre Zukunft unbekannt. Wollen sie Entscheidungen treffen, kommen sie nicht umhin, permanent kontrafaktische Überlegungen über deren mögliche Folgen anzustellen. Da sich Absichten und Ziele der Beteiligten aber ständig durchkreuzen, ist das Ergebnis ihrer Handlungen oft nicht vorauszusehen – schon gar nicht in revolutionären Zeiten, in denen die Ereignisse mit ungeheurer Geschwindigkeit aufeinanderfolgen und niemand weiß, was der nächste Tag oder die nächste Stunde bringt.
Als sich die Matrosen auf Schillig-Reede bei Wilhelmshaven Ende Oktober 1918 entscheiden, den Befehl zum Auslaufen zu einem sinnlosen Kampf zu verweigern, können sie nicht ahnen, dass daraus eine Revolution entstehen wird. Bis zum Hissen der roten Fahnen auf dem Berliner Reichstag, dem Brandenburger Tor und dem Roten Rathaus wird es gerade einmal zehn Tage brauchen. Arbeiter und Soldaten rufen »freie« oder »sozialistische« Republiken aus und bilden eigene Machtorgane, die Räte, die zum Signum des Umsturzes werden. Am 9. November nachmittags hat die Revolution auch die Hauptstadt erobert.
Die Arbeiterbewegung befindet sich an diesem Tag auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ihre Parteien aber, die Mehrheitssozialisten (SPD) und die Unabhängigen (USPD), sind wegen der Kriegsunterstützung der SPD tief gespalten. Auf Druck der revolutionären Massen in Berlin bilden sie dennoch am 10. November gemeinsam eine revolutionäre Regierung, den Rat der Volksbeauftragten. Er wird mit Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg (SPD) sowie Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth (USPD) paritätisch besetzt. Oberstes Revolutionsorgan ist jedoch der »Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte Groß-Berlins«, der aus je sieben SPD- und USPD-Vertretern sowie 14 Soldaten besteht. Seine Aufgabe: die Kontrolle des Rats der Volksbeauftragten.
Die Oberste Heeresleitung (OHL) mit Paul von Hindenburg und Wilhelm Groener an der Spitze befindet sich am 9. November auf dem Tiefpunkt ihrer Macht. Der Aufstand der Soldaten verschließt ihr vorerst jede Möglichkeit gegenrevolutionären Eingreifens. Kaum jemand gehorcht noch den Offizieren des kaiserlichen Militärs. Um die OHL überhaupt im Spiel zu halten, akzeptiert Groener die neue Regierung. Er sichert Ebert seine Loyalität zu, solange die Regierung für Ordnung sorge und den »Bolschewismus«, sprich: die Räte bekämpfe. Groener setzt darauf,
dass der militärische Apparat der OHL als unentbehrlich für die Umsetzung der Verpflichtungen gilt, die sich aus dem am 11. November geschlossenen Waffenstillstand mit den Westmächten ergeben: Rückführung und Demobilisierung der im Westen stehenden Truppen sowie Ablieferung von Waffen und Transportmitteln. Überdies arbeitet die OHL sofort darauf hin, sich wieder zuverlässige, und das heißt auch: bürgerkriegsfähige Truppen zu verschaffen.
Die Regierung verständigt sich schnell auf einige weitreichende Beschlüsse: allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen, baldige Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung, Meinungs- und Religionsfreiheit, Achtstundentag, Erwerbslosenfürsorge und manches mehr. Doch wie soll sie umgehen mit den Stützen der alten Herrschaft und den Profiteuren des Ersten Weltkrieges: der OHL, den hohen Beamten, dem ostpreußischen Großgrundbesitz und den Magnaten der Schwerindustrie? Hier gehen die Ansichten weit auseinander. Am brisantesten ist die Militärfrage. Die USPD sieht wie die Mehrheit der Räte in der Militärführung die größte Bedrohung für die Revolution. Darum soll deren Macht gebrochen und zivil kontrolliert werden. Die SPD-Führung um Friedrich Ebert vertraut hingegen den Loyalitätsbekundungen der OHL. Für sie geht die Gefahr primär von den Arbeiter- und Soldatenräten aus, die ihr als bolschewistische Werkzeuge der Klassendiktatur gelten. Es ist denn auch die Militärfrage, an der die Koalitionsregierung zerbricht. Binnen weniger Tage im Dezember 1918 entscheidet sich der weitere Verlauf der Revolution und womöglich auch die politische Zukunft Deutschlands: Kurz vor Weihnachten entladen sich die Spannungen in einem blutigen Gefecht mitten in Berlin. In der Folge büßt die USPD all ihre institutionelle Macht ein, die SPD regiert allein –und setzt weiter auf das Bündnis mit den alten Eliten, das die Revolution unvollendet lassen wird.
Musste es so kommen? Nein, erklärt zumindest Hugo Haase, einer der beiden USPD-Chefs und Exponent des rechten Flügels der Partei, am 1. Januar 1919 im Parteiblatt Die Freiheit. In seinem Artikel übt er scharfe Kritik – und entwirft selbst ein kontrafaktisches Szenario, wie die Revolution einen grundlegend anderen Verlauf hätte nehmen können. Für entscheidend hält er einen »schweren taktischen Fehler« wenige Tage vor der Gewalteskalation: Beim Reichsrätekongress in Berlin, auf dem sich vom 16. bis 20. Dezember die Delegierten aller Arbeiter- und Soldatenräte trafen, lehnten die Ver-

treter der USPD es ab, sich an den Wahlen zum neuen Zentralrat zu beteiligen.
Der Zentralrat sollte die Aufgaben und Rechte des obersten Revolutionsorgans, des Berliner Vollzugsrats, übernehmen. Dieser hatte auf dem Papier zwar das Recht, die Volksbeauftragten abzusetzen. De facto aber wurde er von der Regierung an die Wand gespielt. Die USPD-Delegierten forderten für den neuen Zentralrat darum ein Vetorecht gegen Gesetze der Regierung. Der Kongress lehnte dies mehrheitlich ab. Daraufhin entschied die USPDKongressfraktion – gegen Haases Willen –, die Wahlen zum Zentralrat zu boykottieren. Dessen Mitglieder wurden daher nicht wie vorgesehen drittelparitätisch (SPD, USPD, Soldaten), sondern allein aus der Vorschlagsliste der SPD gewählt.
Gleichwohl schrieb der Reichsrätekongress in Haases Augen ein Programm für eine Regierung ohne SPD. Zwar bestätigte der Kongress mit großer Mehrheit die Entscheidung für eine parlamentarische Demokratie statt für ein Rätesystem. Er fällte aber auch Beschlüsse, die die SPD-Spitze vehement ablehnte: Er erteilte der Regierung den Auftrag, unverzüglich mit der Sozialisierung des Bergbaus zu beginnen, und forderte sie auf, die militärische Kommandogewalt zu übernehmen und das stehende Heer zugunsten einer demokratischen »Volkswehr« abzuschaffen. Das war eine klare Kampfansage an die Oberste Heeresleitung.
Hätte seine Partei nicht auf ihre Sitze im Zentralrat verzichtet, so schreibt Haase in der Freiheit, hätte die USPD schon bald die Regierung ganz übernehmen und »eine völlig klare Politik treiben« können, »ohne jedes Hindernis von rechtssozialistischer Seite«. Sie »hätte sofort die alte Kommandogewalt beseitigt«, also die OHL entmachtet, und »entschlossen die Sozialisierung der dafür reifen Betriebe eingeleitet«.
Haases Zuversicht, die USPD hätte die Regierung allein übernehmen können, gründete auf den
dramatischen Ereignissen kurz vor Weihnachten, der Eskalation der Gewalt mitten in Berlin, und dem aus seiner Sicht skandalösen Zusammenwirken der SPD mit den alten Militärs.
Schon in den Wochen vor dem Rätekongress war die OHL ihrem Ziel, sich als gegenrevolutionäre Ordnungsmacht zu etablieren, ein gutes Stück näher gekommen. Am 11. November hatte der Rat der Volksbeauftragten ihr die volle Disziplinargewalt für das Feldheer bestätigt und die Soldatenräte in diesem Bereich weitgehend entmachtet. Am 10. Dezember scheiterte zwar der Versuch der OHL, mithilfe der heimkehrenden Truppen des Westheeres in Berlin die vorrevolutionären Machtverhältnisse wiederherzustellen. Die Soldaten verschwanden, kaum waren sie durchs Brandenburger Tor gezogen, im Gewühl der Großstadt. Gleichzeitig aber schien es gelungen, mit den um Berlin stationierten Gardetruppen des Generalkommandos Lequis zuverlässige Formationen neu aufzustellen. Dagegen galt die Republikanische Soldatenwehr des Berliner Stadtkommandanten Otto Wels (SPD) der OHL als unbrauchbar; die Sicherheitswehr des Polizeipräsidenten Emil Eichhorn vom linken USPD-Flügel betrachtete man wahlweise als bolschewistisch oder kriminell.
Zum roten Tuch für die OHL waren zudem die »Blaujacken« der Volksmarinedivision geworden, die sich aus revolutionären Matrosen gebildet und der Regierung als Schutztruppe zur Verfügung gestellt hatte. Sie bewachte fortan die Reichskanzlei und weitere wichtige Gebäude in Berlin. Ihr politisches Spektrum reichte von kritischer SPD-Nähe bis hin zu radikalen Teilen der USPD-Linken. Die Matrosen waren zum größten Teil im Schloss und im Marstall untergebracht.
Vertrauensleute des Generalkommandos Lequis forderten die Auflösung der Volksmarinedivision. Ihr Weiterbestehen sei »eine Herabsetzung der nach Berlin zurückkehrenden Fronttruppen«. Das preußi-
KÖPFE DER REVOLUTION
Am 16. Dezember 1918 beginnt in Berlin der Rätekongress. Auf der Regierungsbank sitzen die Mitglieder des Rates der Volksbeauftragen. Hugo Haase in der Mitte macht sich Notizen, rechts neben ihm sitzen Friedrich Ebert und Emil Barth. Links sind Otto Landsberg (4. v. l.) und Philipp Scheidemann (3. v. l.) zu sehen

SPUREN DER GEWALT
Nach den Kämpfen der Weihnachtstage 1918 betrachten die Berliner die Schäden am Schloss sche Finanzministerium, das das Vermögen der Hohenzollern verwaltete, bezichtigte die Matrosen massiver Plünderungen im Schloss (die zum größten Teil gar nicht auf das Konto der Matrosen gingen). Die Regierung verlangte von ihnen, ihre Mannschaftsstärke um zwei Drittel zu reduzieren, auf 600 Mann, und knüpfte ausstehende Lohnzahlungen an den Auszug der Matrosen aus dem Schloss.
Der Berliner Stadtkommandant Otto Wels zeigte sich in Verhandlungen mit der Volksmarinedivision stur. Am 23. Dezember eskalierte der Konflikt. Matrosen besetzten kurzzeitig die Reichskanzlei, vor der Stadtkommandantur wurde ein Matrose von den Fahrern eines Panzerautos unbekannter Herkunft erschossen. Daraufhin schleppten die Matrosen Wels und zwei Mitarbeiter als Geiseln mit in den Marstall. Zwischenzeitlich standen sich vor der Reichskanzlei Gardetruppen und Matrosen schwer bewaffnet gegenüber. Den Regierungsmitgliedern Ebert und Barth gelang es, sie wieder zum Abzug zu bewegen.
Ohne die USPD-Volksbeauftragten hinzuzuziehen, berieten daraufhin Ebert, Scheidemann und Landsberg sowie der preußische Kriegsminister Heinrich Schëuch über das weitere Vorgehen. Als spät in der Nacht aus dem Marstall die Nachricht kam, für das Leben von Wels könne nicht mehr garantiert werden, forderten die drei SPD-Männer den Kriegsminister auf, militärisch einzuschreiten. Am Morgen des 24. Dezember griffen nach einem nur zehnminütigen Ultimatum Truppen des Generalkommandos Lequis mit Artilleriegranaten die Matrosen in Schloss und Marstall an.
Der Angriff scheiterte: Herbeigeeilte bewaffnete Arbeiter, Teile der Sicherheitswehr Eichhorns und der Republikanischen Soldatenwehr unterstützten die Matrosen. Viele der vermeintlich zuverlässigen Gardesoldaten zeigten sich unwillig, gegen die sich zu Zigtausenden versammelnde Arbeiterbevölkerung vorzugehen. Ebert befahl am Mittag, die Kämpfe ein-
zustellen. 56 Gardesoldaten und elf Matrosen hatten sie das Leben gekostet. Wels wurde freigelassen, der Konflikt auf dem Verhandlungsweg beendet.
Nach diesen »Weihnachtskämpfen« rächte sich aus Haases Sicht, dass von der USPD niemand in jenem Gremium saß, dem die Kontrolle der Regierung oblag und das deren Mitglieder abberufen konnte. In seinem Artikel beschrieb er, was er auf einem Parteitag Anfang März 1919 wiederholte: Wäre die USPD im Zentralrat vertreten gewesen, hätten die drei Volksbeauftragten der SPD nach ihrer »Attacke« auf die Volksmarinedivision die Regierung verlassen müssen. Selbst die SPD-Zentralratsmitglieder hätten nach dieser skandalösen Entscheidung »keineswegs durchweg auf ihrer Seite« gestanden.
Haases Gedankenspiel lässt sich weiterspinnen, wenn man die tatsächlichen Ereignisse kurz nach den »Weihnachtskämpfen« als Grundlage nimmt. Am 27. Dezember erklärten die SPD-Volksbeauftragten im Parteiblatt Vorwärts, was sie in den Tagen zuvor abgestritten hatten: Sie selbst hatten Kriegsminister Schëuch zum Handeln aufgefordert, bevor er den Befehl zum Angriff auf die Volksmarinedivision gab. Einen Tag später fand in der Reichskanzlei eine gemeinsame Sitzung von Regierung und Zentralrat statt. Schnell spitzte sich die Auseinandersetzung auf die Befehlsfrage zu. Ebert erklärte, die Volksbeauftragten der SPD hätten »den Kriegsminister gebeten, das Erforderliche zu veranlassen, um Wels zu befreien«. Die Art und Weise der Ausführung habe jedoch bei Kriegsminister Schëuch gelegen, von dem knappen Ultimatum hätten sie nichts gewusst. Haase, Dittmann und Barth erhoben daraufhin den Vorwurf, das Militär habe eine »Blankovollmacht« erhalten.
Wie wäre die Sitzung am 28. Dezember weitergegangen, wenn die USPD zuvor den »schweren taktischen Fehler« nicht begangen, wenn sie die Wahlen zum Zentralrat nicht boykottiert hätte und in diesem höchsten Gremium nun vertreten gewesen
wäre? Wenn sie entschlossen und geschickt die Konfrontation mit der SPD gesucht hätte?
Vielleicht so: Als die Situation festgefahren scheint, ziehen die Volksbeauftragten der USPD ihr Ass aus dem Ärmel. Am Vortag haben sie Kriegsminister Schëuch gebeten, in der Sitzung als Zeuge aufzutreten. Schëuch erklärt, er habe von den SPDVolksbeauftragten nicht bloß eine Aufforderung zum Handeln erhalten: Man habe sogar gemeinsam eine regelrechte »Besprechung des militärischen Eingreifens« abgehalten. Dabei sei es keineswegs nur »um die Befreiung des Herrn Wels« gegangen, sondern »auch um die Entfernung der Matrosen aus Schloß und Marstall«. Diese Worte stammen tatsächlich von Schëuch – in Wirklichkeit aber schrieb er sie am folgenden Tag in einem Brief an Ebert.
Im Gedankenspiel bringt die Klarstellung des Kriegsministers die Wende. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Zentralrats fühlen sich von der Darstellung der SPDVolksbeauftragten getäuscht. Stück um Stück rücken sie nun von ihnen ab. Am Ende zieht sich der Zentralrat zur Beratung zurück und verkündet schließlich: Er mache von seinem Recht der Abberufung von Volksbeauftragten Gebrauch und enthebe die SPDMänner Ebert, Scheidemann und Landsberg ihres Amtes. Sie werden durch Vertreter der USPD ersetzt.
Der Schwung des Neuanfangs zeigt Wirkung. Der Rat der Volksbeauftragten leitet sofort Maßnahmen ein, um den Bergbau zu sozialisieren und das versandete Volkswehrprojekt wieder aufzunehmen. Zudem löst er die Truppenbasis der OHL im Großraum Berlin auf. Die OHL droht damit, umgehend zurückzutreten. Früher hat diese Drohung mehrfach gewirkt. Die neue Regierung aber ergreift die Gelegenheit und nimmt den Rücktritt dankend an.
Hätten dies die ersten Schritte auf dem Weg zu einer politisch, militärisch und sozial konsequent demokratisierten Republik sein können? Die Arbeiter und Soldatenräte hätten eine Politik in diesem Sinne ohne Zweifel unterstützt. Doch in Haases Szenario war offenbar der Wunsch der Vater des kontrafaktischen Gedankens. Es hätte zwei Voraussetzungen gebraucht, um es zur realistischen Handlungsgrundlage zu machen.
Erstens hätte Haase die Absichten, Möglichkeiten und Ziele seiner Gegenspieler nicht ausblenden dürfen. Die Zentralratsmehrheit hatte stets ihre Hauptaufgabe darin gesehen, die Volksbeauftragten der SPD parteiloyal zu unterstützen. USPDVertreter im Zentralrat hätten die Diskussionen auf der Sitzung
vom 28. Dezember nicht entscheidend verändern können. Ebert hatte außerdem die Reichskanzlei in seiner Hand, und er hätte diese Macht einzusetzen gewusst. Auch die Militärführung verfolgte weiter ihre Ziele. »Kaiserliche« Offiziere stellten bereits Freikorps auf. Möglicherweise stand der nächste Putsch vor der Tür.
Zweitens hätte die USPD nicht die äußerst heterogene Partei sein dürfen, die sie war. Auf ihrem linken Flügel agitierte der Spartakusbund für ein Rätesystem nach russischem Muster. Die Revolutionären Obleute, die wichtigsten Träger des Novemberumsturzes in Berlin, sympathisierten mit den Spartakisten. Deren Aktionismus verspotteten sie jedoch als »revolutionäre Gymnastik«. Auf der anderen Seite plädierten verdiente alte Sozialdemokraten wie Karl Kautsky dafür, sich wieder der SPD anzuschließen. Dazwischen agierte der Parteivorstand um Haase und Dittmann. Er wollte die USPD zusammenhalten und suchte programmatisch nach Verbindungen zwischen Rätesystem und Parlamentarismus.
In Wirklichkeit billigte der Zentralrat nach der Sitzung am 28. Dezember weitgehend das Vorgehen der SPDVolksbeauftragten vor dem Angriff auf die Volksmarinedivision. Haase, Dittmann und Barth erklärten daraufhin ihren Austritt aus der Regierung. Doch damit beging die USPD noch einmal den Fehler, den Haase in der Freiheit so scharf kritisiert hatte: Sie gab erneut ohne Not eine zentrale Machtposition auf. Haase wollte jedoch nicht riskieren, die Partei zu spalten. Der Rücktritt erfüllte eine seit Langem erhobene Forderung des linken USPDFlügels.
Eine Woche später entzündete sich an der Entlassung des USPDPolizeipräsidenten Eichhorn der Berliner Januaraufstand. Der neue SPDVolksbeauftragte Gustav Noske ließ ihn durch die Freikorps äußerst brutal niederschlagen. Die Historikerin Susanne Miller sieht darin eine »historische Zäsur, eine Wende zur Katastrophe hin«, zu den bürgerkriegsähnlichen Kämpfen in den ersten Jahren der Weimarer Republik und zur dauerhaften Spaltung der Arbeiterbewegung.
All dies hätte sich vermutlich vermeiden lassen, wären die Beschlüsse des Rätekongresses umgesetzt worden. Die kontrafaktische Betrachtung hat gezeigt, warum es dann aber doch so kam, wie es nicht kommen musste.

KLAUS LATZEL lehrt Geschichte an der Technischen Universität Braunschweig
11.WENDE PUNK T
Retter der Republik
Friedrich Ebert stabilisiert die krisengeschüttelte Weimarer Republik. 1925 stirbt der Reichspräsident überraschend mit 54 Jahren. Hätte er die erste deutsche Demokratie vor dem Untergang bewahren können? VON BERND BRAUN
In seinen 1956 erschienenen Memoiren nennt Walter Zechlin, Pressesprecher der Reichsregierung von November 1926 bis Mai 1932, vier Politiker, die der Weimarer Republik »ihr Gepräge gegeben« hätten: »Ebert, Stresemann, Hermann Müller und Brüning«. Über die Auswahl könnte man trefflich streiten. Die ersten drei aber vereint eine Eigenschaft: Sie wurden mitten aus dem Leben gerissen. Reichspräsident Friedrich Ebert starb im Februar 1925 im Alter von nur 54 Jahren, Reichsaußenminister Gustav Stresemann im Oktober 1929 mit 51, der zweimalige Reichskanzler Hermann Müller im März 1931 mit ebenfalls nur 54 Jahren. Dieser frühe Tod der drei großen Demokraten ging dem frühen Tod der Weimarer Republik auf unheilvolle Weise voraus.
Die Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten durch die Nationalversamm
lung in Weimar am 11. Februar 1919 stellte in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur dar. Der gebürtige Heidelberger war das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt in der deutschen Geschichte. Er war der erste Nichtadelige, der erste Sozialdemokrat und der erste Zivilist in dieser Funktion. Fundamental neu war auch Eberts Amtsverständnis. Nach seiner Wahl hatte er ausgeführt: »Ich will und werde als der Beauftragte des ganzen deutschen Volkes handeln, nicht als Vormann einer einzigen Partei.« Anders als Kaiser Wilhelm II., der die Sozialdemokraten als »vaterlandslose Gesellen« diffamiert und ausgegrenzt hatte, sah sich Ebert als das Staatsoberhaupt aller Deutschen. Auch in seiner Außendarstellung unterschied er sich deutlich von seinem Vorgänger: Bescheidenheit, der Verzicht auf Prunk und dröhnendes Pathos kennzeichneten seine Repräsentation wie übrigens auch diejenige seiner Ehefrau
Louise. In diese Tradition haben sich nach 1949 alle Bundespräsidenten der Bundesrepublik und ihre First Ladys gestellt. Im Unterschied zum Amt des Bundespräsidenten, das weitgehend auf repräsentative Aufgaben beschränkt ist, gilt das Amt des Reichspräsidenten der Weimarer Republik als das mächtigste der deutschen Demokratiegeschichte. Es war als Gegengewicht zum Parlament konstruiert worden und billigte dem Staatsoberhaupt weitgehende Vollmachten zu wie etwa das Recht, den Reichskanzler zu ernennen oder den Reichstag aufzulösen. Ebert nutzte seine Machtfülle, um die Demokratie zu stabilisieren, während sein Nachfolger Paul von Hindenburg sie langsam, aber stetig untergrub, anfangs noch zögernd, von 1930 an immer intensiver.
In den ersten fünf Jahren befand sich die Weimarer Republik in einer Dauerkrise, in welcher nur der Reichspräsident

kontinuierlich im Amt blieb. Bis zu Eberts Tod gaben sich in der Reichskanzlei neun Regierungschefs die Klinke in die Hand.
Zunächst amtierten drei Sozialdemokraten: Philipp Scheidemann, Gustav Bauer und Hermann Müller. Ihnen folgten die beiden Zentrumskanzler Constantin Fehrenbach und Joseph Wirth. Letzterer residierte immerhin eineinhalb Jahre (von Mai 1921 bis November 1922) in der Reichskanzlei. Der parteilose Wilhelm Cuno scheiterte an der Ruhrkrise 1923, sein Nachfolger Gustav Stresemann musste nach nur 100 Tagen wieder aus der Reichskanzlei ausziehen, da seine Koalition zerbrach. Ihm rückte der eher farblose Wilhelm Marx vom Zentrum nach, der im Januar 1925 von Hans Luther abgelöst wurde. Luther sollte Ebert die Trauerrede halten.
Mit dem Scheitern der jeweiligen Regierung war besonders der Reichspräsident gefordert, einen neuen Kandidaten zu
STANDHAFT
Im März 1923 hält Ebert in Hamm eine flammende Rede, die zum passiven Widerstand im besetzten Ruhrgebiet aufruft
finden, der bereit war, diesen Schleudersitz zu übernehmen. Kein Demokrat drängte sich danach und rüttelte am Zaun der Reichskanzlei in der Wilhelmstraße.
Die Instabilität resultierte aus der Tatsache, dass die meisten Regierungen der ersten deutschen Demokratie keine Mehrheit im Reichstag hinter sich versammeln konnten. Das zersplitterte Parteiensystem erschwerte die Regierungsbildung. Aufgrund dieser Erfahrungen fürchten die Deutschen Minderheitsregierungen bis heute. Die Weimarer Republik war zudem mit Problemen konfrontiert, wie sie keine Bundesregierung seit 1949 zu bewältigen
hatte: Putschversuche, separatistische Bestrebungen und Morde an Spitzenpolitikern sind der Bonner und Berliner Republik bisher erspart geblieben.
Das größte Problem war die Abwicklung der Weltkriegsniederlage. Das kaiserliche Deutschland hatte den Krieg 1914 begonnen und spätestens 1918 verloren, aber den Preis dafür musste die junge deutsche Demokratie bezahlen. Als die Bedingungen des Friedensvertrages im Frühjahr 1919 bekannt wurden, lehnten Reichspräsident, Reichsregierung und die große Mehrheit der Nationalversammlung eine Zustimmung ab.
Diese Haltung war zwar patriotisch und populär, aber völlig unrealistisch, da die Siegermächte ultimativ mit der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen drohten. Während der Regierungschef Philipp Scheidemann aus Protest zurücktrat, fügten sich Ebert, Scheidemanns
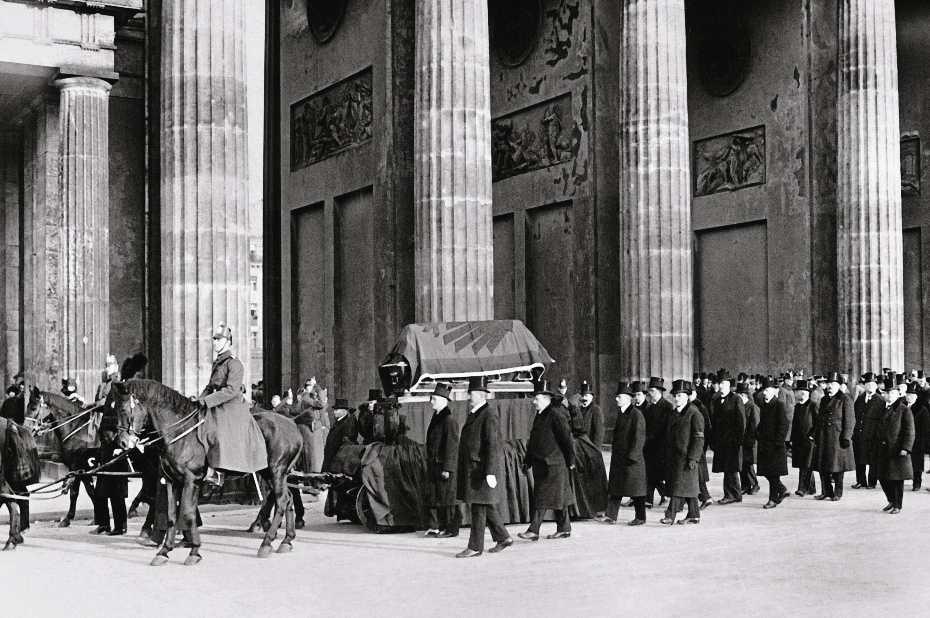
Nachfolger Gustav Bauer und eine Mehrheit der Abgeordneten in das unvermeidliche »Ja« zum Versailler Vertrag. Ebert konnte nicht so einfach wie Scheidemann das Handtuch werfen, sondern blieb im Amt, um sich den beiden Königsdisziplinen der Demokratie zu widmen: Kompromisse finden und Realpolitik betreiben. Dieser Vorgang sollte sich 1923, im Katastrophenjahr der krisengeschüttelten Weimarer Republik, wiederholen.
Den Einmarsch französischer und belgischer Truppen in das Ruhrgebiet im Januar 1923 beantwortete die Regierung mit passivem Widerstand, der anfangs auf breite Zustimmung stieß. Endlich wehrt sich Deutschland einmal gegen die Zumutungen der Franzosen, dachte eine große Mehrheit der Bevölkerung. Aber diese Politik heizte die Inflation an und trieb sie ins Gigantische. Alle Deutschen wurden auf dem Papier Milliardäre, viele verarmten dabei.
Auch hier galt es, den Hebel wieder umzulegen und den passiven Widerstand zu beenden. Friedrich Ebert und der neue Reichskanzler Gustav Stresemann betrieben Realpolitik. Dagegen begehrten die Extremen auf. Im Oktober 1923 inszenierte der KPD-Politiker Ernst Thälmann einen Umsturzversuch in Hamburg, im November Adolf Hitler und seine NSDAP in München. Ebert setzte die ganze Machtfülle seines Amtes ein, um die Republik zu retten. Die Putschversuche wurden nieder-
LETZTES GELEIT
Vier Tage nach Friedrich Eberts Tod bewegt sich am 4. März 1925 der Trauerzug durch das Brandenburger Tor in Richtung Reichstag
geschlagen, die Währungsreform gelang mit der Einführung der Rentenmark. Unterfüttert mit einem ganzen Bündel von Notverordnungen, war die Währung vom Frühjahr 1924 an wieder stabil. Damit steuerte die Weimarer Republik endlich in ruhigeres Fahrwasser.
Gerade in diese Zeit der Konsolidierung fiel eine Zäsur, deren Tragweite erst einige Jahre später voll erkennbar werden sollte: Friedrich Ebert starb im Alter von nur 54 Jahren. In den Monaten zuvor hatte ihn ein Gerichtsprozess in Magdeburg stark mitgenommen. Ebert trat dort als Nebenkläger gegen einen völkischen Journalisten auf, der ihn diffamiert hatte. Zutiefst kränkte ihn im Dezember 1924 das Urteil: Darin bescheinigte das Gericht dem Reichspräsidenten, durch seinen Eintritt in eine Streikleitung Anfang 1918 Landesverrat begangen zu haben. Statt sich in eine Klinik zu begeben, widmete sich Ebert der Vorbereitung des Berufungsprozesses. Zu spät entdeckten seine Ärzte die verschleppte Blinddarmentzündung, der er am 28. Februar 1925 erlag.
Bei der Neuwahl des Reichspräsidenten im März erreichte niemand die nötige ab-
solute Mehrheit. Für den zweiten Wahlgang verständigten sich daher die Parteien der Weimarer Koalition (SPD, DDP und das katholische Zentrum) auf einen Sammelkandidaten, den ehemaligen Reichskanzler Wilhelm Marx, der als Kandidat der politischen Mitte galt.
Das rechte Lager einigte sich auf einen »Anti-Ebert«, der in der ersten Runde nicht angetreten war: den bereits 77-jährigen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, einen Militär und Monarchisten. Der Weltkriegsheld gewann den zweiten Wahlgang knapp, was unter den Demokraten Entsetzen auslöste. Auch viele Katholiken hatten für den Protestanten gestimmt. Zudem weigerten sich die Kommunisten, Marx zu unterstützen und so einen Sieg Hindenburgs zu verhindern.
Fünf Jahre später, 1930, leitete Reichspräsident Hindenburg das Ende der parlamentarischen Demokratie ein; 1933 wurde er mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler endgültig zum Totengräber der Weimarer Republik.
Wäre die Geschichte Weimars anders verlaufen, wenn Friedrich Ebert nicht so früh gestorben wäre?
Zunächst ist gar nicht sicher, ob er –angesichts des für ihn schockierenden Magdeburger Urteils – bei der spätestens im Juni 1925 fälligen Volkswahl des Reichspräsidenten noch einmal angetreten wäre. Vermutlich hätte Ebert sich aber

doch am sozialdemokratischen Portepee packen lassen und sich um eine zweite Amtszeit beworben. In diesem Fall hätten Zentrum und DDP wohl keinen eigenen Bewerber aufgestellt, sodass Ebert mit hoher Wahrscheinlichkeit im ersten Wahlgang für eine siebenjährige Amtszeit bis Juni 1932 gewählt worden wäre.
Tatsächlich stand schon im Herbst 1922 zur Debatte, Ebert als Sammelkandidaten der Weimarer Koalition per Volkswahl zum Reichspräsidenten zu machen. Dieses Vorhaben zerschlug sich aber an der ablehnenden Haltung des DVP-Vorsitzenden Gustav Stresemann, auf dessen Kurs Zentrum und DDP einschwenkten. Als Ergebnis wurde Eberts Amtszeit vom Reichstag mit verfassungsändernder Mehrheit bis zum 30. Juni 1925 verlängert.
Der Turnus wäre 1922 günstiger gewesen als 1925, denn Ebert wäre mit Sicherheit gewählt worden. Und bei der nächsten Wahl 1929 wäre er erst 58 Jahre alt gewesen. Bei nochmaliger Kandidatur – die Anzahl der Amtszeiten des Reichspräsidenten war unbeschränkt – und Wiederwahl vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hätte diese Amtszeit bis Juni 1936 gedauert. Diese Chance wurde 1922 vertan. Was hätte der 1925 wiedergewählte Ebert anders gemacht als sein Nachfolger?
Mit Sicherheit hätte der Sozialdemokrat weiterhin die Weimarer Reichsverfassung aus tiefer Überzeugung verteidigt – und sie nicht nur notgedrungenermaßen akzep-
NEUES STAATSOBERHAUPT
Wahlkämpfer fahren im April 1925 eine riesige Büste Paul von Hindenburgs durch Berlin. Mit knappem Vorsprung wird er Reichspräsident
tiert wie Hindenburg, der zwar die Buchstaben der Verfassung einhielt, aber mit ihrem demokratischen Geist nichts anzufangen wusste.
Ein Schlüsselmoment der Weimarer Republik und der deutschen Demokratiegeschichte insgesamt war der Sturz Hermann Müllers im März 1930. Monatelang hatten Hindenburg und seine Berater zuvor gegen den sozialdemokratischen Kanzler intrigiert und den Zentrumsführer Heinrich Brüning dafür gewonnen, ein nur auf das Vertrauen des Reichspräsidenten gestütztes Präsidialkabinett zu installieren. Ein solches Schurkenstück hätte Ebert nicht inszeniert; er hätte alles getan, um die Regierung Müller im Amt zu halten.
Ebert hätte auch den Reichstag nicht vorzeitig aufgelöst, wodurch der Triumph der NSDAP bei den Wahlen am 14. September 1930 verhindert worden wäre. Die Legislaturperiode des am 20. Mai 1928 gewählten Reichstages hätte dann erst im Mai 1932 geendet. Bis dahin hätten nur zwölf Nationalsozialisten im Reichstag gesessen, die nicht einmal Fraktionsstatus besaßen, und nicht 107 wie nach der Wahl vom September 1930.
Im Zusammenspiel hätten Ebert und Hermann Müller, die beiden Zentralfiguren der Weimarer SPD, den Aufstieg der NSDAP also erschweren können. Aber hätten sie ihn verhindert?
Die NSDAP profitierte wie keine andere deutsche Partei von der Massenarbeitslosigkeit, die durch den Schwarzen Freitag im Oktober 1929 ausgelöst wurde und im Schatten der Weltwirtschaftskrise 1932 ihren Höhepunkt erreichte. Bei den preußischen Landtagswahlen im April und den Reichstagswahlen im Juli 1932 erzielten die Nationalsozialisten Erdrutschsiege.
Die Weltwirtschaftskrise hätte auch ein Reichspräsident Friedrich Ebert nicht verhindern können, allenfalls abschwächen, da es Brünings Deflationspolitik, die die Not noch verschärfte, mit ihm nicht gegeben hätte. Der Aufstieg Hitlers wäre mit einem lebenden Friedrich Ebert, noch dazu mit Müller und Stresemann an seiner Seite, der ein Abdriften seiner DVP nach rechts außen verhindert hätte, erheblich schwieriger gewesen. Aber im Juni 1932 hätte eine Reichspräsidentenwahl stattfinden müssen. Wie diese ausgegangen wäre – Friedrich Ebert gegen vermutlich Adolf Hitler – kann niemand seriös beantworten. Hier stößt auch die Fiktion an ihre Grenzen.

BERND BRAUN ist Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-EbertGedenkstätte in Heidelberg
KÖLNER GRUSS
Am 7. März 1936 ziehen deutsche Soldaten unter dem Jubel von Schaulustigen in die Rheinmetropole ein. Einige Zuschauer versuchen, für einen guten Blick an der Fassade des Hotels Ernst hochzuklettern
WENDE PUNK T 12.
Letzte Ausfahrt Rheinland
1936 lässt Hitler mit wenigen Soldaten das Rheinland besetzen. Ein militärischer Bluff. Was wäre geschehen, wenn Frankreich nicht darauf reingefallen wäre?
VON ANDREAS MOLITOR
Ganz in Weiß thront der neue erste Mann des Reiches in der Führerloge des Berliner Olympiastadions. An diesem Dienstagnachmittag, es ist der 4. August 1936, hat er sich in seine schneeweiße Sommeruniform gezwängt, zu der auch fein gearbeitete weiße Lederslipper gehören, und trägt natürlich den Orden Pour le Mérite um den Hals und das Eiserne Kreuz 1. Klasse auf der Uniformjacke. Immer wieder muss er sich den Schweiß von der Stirn tupfen; 120 Kilo Körpergewicht und das warme Sommerwetter fordern Tribut. Er lässt den Blick ins Rund schweifen –so wie er das vor Jahren schon getan hat, von seinem Präsidentensitz im Plenarsaal des Reichstags aus, um sich die Gesichter der kommunistischen Abgeordneten besser einzuprägen, für später.
Beim Weitsprung der Männer liegt der deutsche Athlet Luz Long auf Goldkurs. Doch jetzt tritt Jesse Owens, dessen großer Konkurrent, zu seinem vorletzten Sprung an. Ein mächtiger Satz des Amerikaners. Der Mann in der weißen Uniform schwenkt sein Fernglas zur Anzeigetafel: 8,06 Meter – 19 Zentimeter weiter als der Deutsche. Long kann diese Weite im letzten Versuch nicht mehr übertreffen; er gratuliert Owens, die beiden liegen sich kurz in den Armen. Wütend knallt der Schwergewichtige das Fernglas auf die Oberschenkel. »Ja, wenn er schon verliert«, schnarrt er in hartem fränkischem Tonfall zu seinem Nachbarn Joseph Goebbels, »warum muss
er den Neger denn jetzt auch noch umarmen! Das sieht ja aus, als ob ...« Goebbels flüstert ihm etwas zu, der Name »Röhm« ist zu hören. Hermann Göring verzieht angewidert das Gesicht, dann lachen beide schallend. Am Abend notiert Goebbels in sein Tagebuch: »Wir alle vermissen den Führer schmerzlich. Aber Göring macht seine Sache von Woche zu Woche besser, Respekt! Wenn er nur diese peinlichen Verkleidungen lassen würde. Heute im Stadion sah er aus wie ein zu dick gewordener Schiffssteward.«
Der neue Reichskanzler verordnet dem Reich gute Laune, zeigt sich jeden Tag im Stadion und gibt rauschende Feste für Sportler, Funktionäre, Diplomaten und Filmsternchen. Er nutzt die Spiele als Bühne, um der Welt zu zeigen, dass im Reich alles wieder in normalen Bahnen läuft – nachdem knapp fünf Monate zuvor das Unfassbare geschehen ist: Der »Führer« ist zurückgetreten.
Seit er sich Mitte März mit seiner Entourage auf den Berghof bei Berchtesgaden zurückgezogen hat, ist Adolf Hitler nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Zu groß war die Demütigung, nachdem er seine Soldaten aus dem Rheinland, wo sie wenige Tage zuvor einmarschiert waren, wieder zurückbeordern musste. Die Franzosen hatten sich die völkerrechtswidrige Provokation nicht bieten lassen und die drei vorgeschobenen deutschen Bataillone auf der linken Rheinseite bei Aachen, Trier und Saarbrücken förmlich überrannt, mit fast 50.000 Soldaten, unterstützt von Panzern, Artillerie und Flugzeugen.

Angesichts der drückenden französischen Übermacht hatte Hitler auch den rechts des Rheins stationierten deutschen Truppen den sofortigen Rückzug befohlen. Der Diktator hatte va banque gespielt –und alles verloren. Seine von ihm selbst gehegte Aura der Unfehlbarkeit war zerstört, er war dem Spott der Weltöffentlichkeit preisgegeben.
Zu dieser Niederlage ist es nie gekommen. In Wirklichkeit saß Hitler in der Ehrenloge, als Jesse Owens Gold im Weitsprung holte. Und die französischen Truppen blieben, nachdem die Wehrmacht im März 1936 im Rheinland einmarschiert war, in ihren Kasernen.
Doch es hätte anders kommen können. William L. Shirer, damals Korrespondent einer US-Nachrichtenagentur in Berlin, schrieb später in seinem berühmten Buch Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, im März 1936 habe sich »den westlichen Demokratien die letzte Chance geboten, einem aggressiven, totalitären Deutschland ohne ernsthafte Kriegsgefahr Einhalt zu gebieten, ja, die nationalsozialistische Diktatur [...] zum Sturz zu bringen«.
7. März 1936. Die Operation »Winterübung« nimmt ihren Lauf. Am frühen Morgen rückt die Wehrmacht mit 19 Infanteriebataillonen und 13 Artillerieabteilungen, insgesamt etwa 30.000 Soldaten und Hilfskräften, ins entmilitarisierte Rheinland ein. Vom Niederrhein bis zur Schweizer Grenze hinab reicht jene Zone entlang des Stroms, die bislang kein deutscher Soldat in Uniform betreten durfte. Auch das Ruhrgebiet, die industrielle Lunge des Reiches, gehört dazu, mit Kohlezechen, Stahlwerken und Rüstungsschmieden.
Zur gleichen Zeit beschwört Hitler in der Berliner Kroll-Oper, seit dem Reichstagsbrand Sitz des entmachteten Parlaments, die »geschichtliche Stunde, da in den westlichen Provinzen des Reiches deutsche Truppen soeben ihre künftigen Friedensgarnisonen beziehen«. William L. Shirer beobachtet die Reaktion der Abgeordneten im Saal. »Dieser hysterische ›parlamentarische‹ Mob erfährt erst jetzt, dass deutsche Soldaten bereits ins Rheinland einmarschieren«, schreibt er. »Ihre Hände sind zum sklavischen Salut hochgereckt, ihre Gesichter von Hysterie gezeichnet, ihre Münder weit geöffnet und schreiend, ihre vor Fanatismus brennenden Augen gerichtet auf den neuen Gott, den Messias.«
Der Handstreich markiert einen Bruch wichtiger europäischer Friedensabkommen. Der Vertrag von Versailles verbietet Deutschland jede Stationierung von Soldaten im Rheinland – sowohl links des Rheins als auch in einer 50 Kilometer breiten Zone auf der östlichen Seite, die im Norden bis vor die Tore Dortmunds, in der Mitte über Frankfurt hinaus und im Süden fast bis Stuttgart reicht. Dort darf keine Kaserne stehen, kein Panzer rollen, kein Flugzeug aufsteigen.
Vor dem Einmarsch herrscht Panik in der Reichskanzlei
Im Vertrag der Konferenz von Locarno hat Deutschland 1925 die Entmilitarisierung ausdrücklich bestätigt. Der »Rheinpakt« ist eine wichtige Versicherung vor allem für Frankreich. Noch stehen gemäß dem Versailler Vertrag französische Truppen im Rheinland, aber mit der deutschen Annahme des Young-Plans, der langfristigen Regelung der Reparationsfrage, ziehen die Franzosen ihre Soldaten bis Ende Juni 1930 vorzeitig ab.
In Köln rasseln Pferdegespanne, Lastwagen, Transportpanzer mit aufgesessenen Infanteristen und Kräder vom Stadtteil Deutz über die Hohenzollernbrücke auf die Innenstadt zu, vorneweg eine Kapelle mit Kesselpauken, Tuben und Posaunen. Mit Kind und Kegel sind die Kölner unterwegs. Jubelnd begrüßen sie die im Gleichschritt vor dem Dom vorbeimarschierenden feldgrauen Kolonnen, lassen tausendfach den rechten Arm schräg in die Höhe schnellen, streuen Blumen. Manche klettern auf Straßenbahnen, um einen besseren Blick auf die Soldaten zu erhaschen.
Gegen Mittag überschreitet die Wehrmacht in Köln, Düsseldorf und Koblenz den Rhein in Richtung Westen. Aber lediglich drei Bataillone mit jeweils nur etwa 800 Soldaten ziehen in das riesige Gebiet links des Rheins, bis nach Aachen, Trier und Saarbrücken, fast bis zur französischen Grenze.
Für Hitler zählt die Entmilitarisierung zur »Schmach von Versailles«. Seit Langem wartet er auf eine passende Gelegenheit zum Vertragsbruch. Die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Beistandsvertrags am 27. Februar 1936 in der französischen Nationalversammlung kommt ihm gerade recht. Franzosen und Sowjets sichern sich darin gegenseitige Unterstützung im Fall eines Angriffs zu. Hitler erklärt den Pakt zu einem Akt der Aggression gegen Deutschland. Das Locarno-Abkommen habe damit »seinen inneren Sinn verloren und praktisch aufgehört zu existieren«.
In den Tagen vor der Entscheidung zum Einmarsch herrscht Hektik in der Reichskanzlei. »Von allen Seiten kommen nun die Angstmeier im Gewand des Warners«, kommentiert Goebbels. »Ich mag sie gar nicht mehr anhören. Gehandelt wird ja
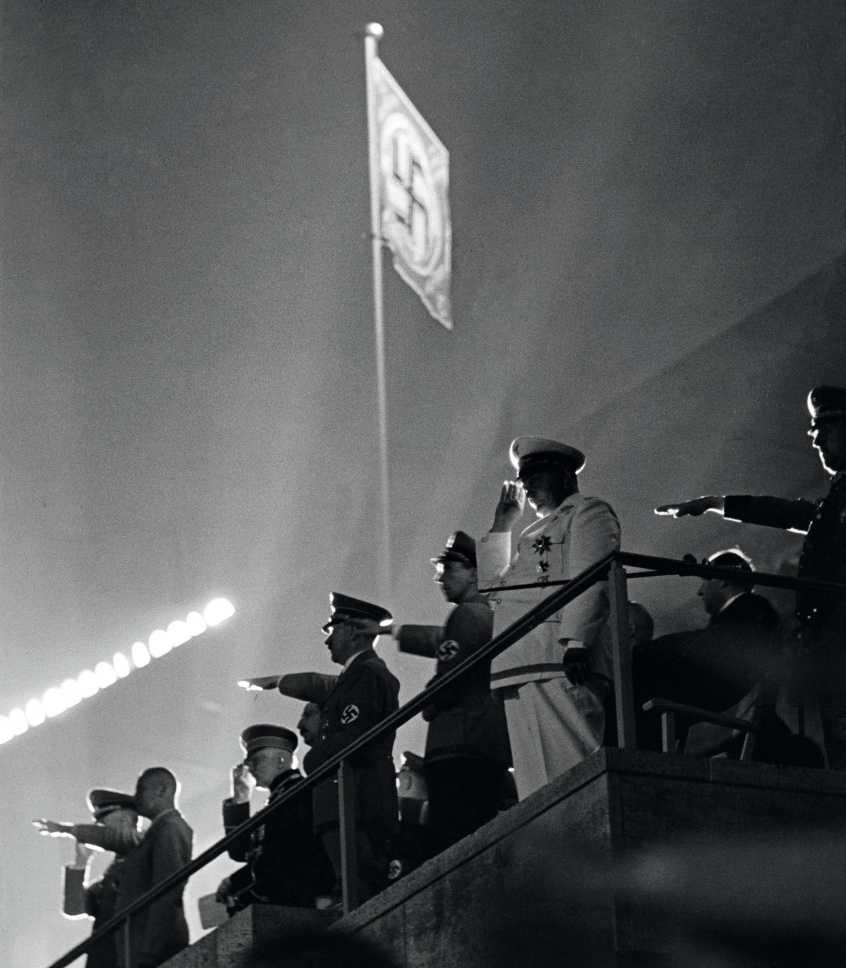
doch!« Am 2. März stellt Hitler seine Pläne den Spitzen der Wehrmacht vor, am 4. März erteilt er den Befehl zum Einmarsch.
Über alledem schwebt große Ungewissheit. Werden die Garantiemächte des Rheinpakts sich den deutschen Soldaten entgegenstellen? Seit Ende Februar weiß Hitler, dass Italien sich nicht an einer Aktion gegen Deutschland beteiligen wird. Doch was ist mit Briten und Franzosen? Bei einer allgemeinen Mobilmachung hätte Frankreich binnen weniger Tage mehr als eine Million Männer unter Waffen. Außenminister Konstantin von Neurath bestärkt Hitler in seinem Entschluss zum Einmarsch. Er verfügt über geheimdienstliche Informationen, dass
Frankreich keinen Krieg riskieren wird; das allerdings behält er für sich.
»Die 48 Stunden nach dem Einmarsch waren die aufregendsten in meinem Leben«, wird Hitler später sagen. Wären die Franzosen ins Rheinland eingerückt, dann »hätten wir uns mit Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen, denn die militärischen Kräfte, über die wir verfügten, hätten keineswegs auch nur zu einem mäßigen Widerstand ausgereicht«. Hitler befiehlt deshalb, dass sich die deutschen Soldaten bei französischer Gegenwehr wieder auf das östliche Rheinufer zurückziehen sollen. Diplomaten und hohe Beamte berichten von einem Nervenzusammenbruch des verunsicherten Diktators in den
MACHTVOLLE
INSZENIERUNG
Bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele am 16. August 1936 steht Hermann Göring in weißer Uniform neben Joseph Goebbels und Adolf Hitler auf der Ehrentribüne

KEINE ALTERNATIVE Nach der Besetzung des Rheinlands lässt das NS-Regime die Bevölkerung am 29. März 1936 in einer eigens angesetzten Reichstagswahl über das Vabanquespiel abstimmen. Auf den Wahlzetteln gibt es nur eine Antwortmöglichkeit
Stunden nach dem Einmarsch. Er habe sogar erwogen, die bereits marschierenden Truppen wieder zurückzurufen. Außenminister Neurath soll in seinem schwäbischen Tonfall kommentiert haben: »Jetzt san mir drinne und bleibat drinne.«
Hitler weiß, dass die Aktion ein großer militärischer Bluff ist. Nicht einmal 3.000 Soldaten schickt er vom Rhein aus weiter westwärts. Die drei Bataillone wären von der französischen Armee schnell überrannt worden. Zwar existieren Anweisungen der Wehrmachtführung, bei einem weiteren französischen Vormarsch auf der rechten Rheinseite Widerstand zu leisten. Doch zu mehr als hinhaltendem Rückzug mit kleinen Scharmützeln wären die deutschen Verbände auch hier kaum in der Lage. Noch ist die Wehrmacht weit von echter Kriegsbereitschaft entfernt. »Die deutsche Armee muss in vier Jahren einsatzfähig sein«, wird der Diktator im September 1936 befehlen – eine Lehre aus den Märztagen. Hitler bangt – doch es passiert nichts. Kein einziger französischer Soldat überschreitet die Grenze. In Frankreich herrscht Rat und Hilflosigkeit. Die Generalität verfügt über keinerlei Pläne für den Fall einer Besetzung des Rheinlands durch die Wehrmacht. Es fehlt eine schnelle, mobile und gut motorisierte Eingreiftruppe für regional begrenzte Konflikte. Außer
dem ist die linksliberale Übergangsregierung gelähmt von innenpolitischen Konflikten. Zwar fordert Ministerpräsident Albert Sarraut einen entschiedenen Gegenschlag, findet in seiner Regierung aber kaum Unterstützung. Generalstabschef Maurice Gamelin befürchtet bei einem Einrücken französischer Truppen starken deutschen Widerstand – eine fatale Fehleinschätzung. Frankreich will keinen Krieg gegen Deutschland, nicht wegen des Rheinlands.
Vielleicht hätten die Franzosen militärisch geantwortet, wären sie von Großbritannien unterstützt worden. Doch London winkt ab. Es gebe keinen Grund für einen Konflikt, »wenn die Deutschen wieder in ihren Vorgarten einziehen«, heißt es. Frankreich und Großbritannien belassen es bei öffentlicher Empörung und rufen den Völkerbund an, dem Deutschland nicht mehr angehört. Goebbels jubelt: »Frankreich will Völkerbundsrat befassen. Recht so! Es wird also nicht handeln.« Er wird recht behalten: Der Völkerbund kann sich nicht einmal auf Wirtschaftssanktionen gegen Deutschland einigen.
Für Hitler ist der Rest des Jahres – mit den Olympischen Spielen und dem Reichsparteitag – ein einziges Schaulaufen. Die Reichstagswahlen am 29. März, gleichzeitig eine Art Volksabstimmung über die Rheinlandbesetzung, geraten mit 98,8 Prozent Jastimmen zu einem Triumph. Mit dem gelungenen Coup steht Hitler als genialer Stratege da. Die deutsche Rüstungsbasis, das Ruhrgebiet, ist wieder unter eigener Kontrolle. Das Rheinland kann nun auch militärisch befestigt werden: Im Mai 1938 beginnt der Bau des Westwalls. »Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt«, feiert sich der Diktator eine Woche nach dem Einmarsch. Für den HitlerBiografen Ian Kershaw ist der 7. März 1936 »der Tag, an dem Hitler anfing, an seinen eigenen Mythos zu glauben«.
Das Rheinland wird zum Testfall für Hitlers kommende Tabubrüche. Er hat gezeigt, dass er mit Provokation und Aggression durchkommt. Nach dem gleichen Muster wird er 1938/39 den »Anschluss« Österreichs, den Einmarsch ins Sudetenland und die Besetzung der »RestTschechei« vollziehen. Deutschland läuft sich warm für den großen Krieg.
Die Franzosen hätten sich Hitler entgegenstellen müssen – das ist leicht gesagt, mit dem Wissen von heute. Dass Hitlers Kurs binnen weniger Jahre in den Weltkrieg und den Holocaust münden würde, ist im März 1936 keineswegs klar vorgezeichnet. Der französischen Regierung erscheint das akute Risiko eines heißen Krieges mit dem Nachbarn groß – nicht die mögliche Gefahr in der Zukunft.
Und wenn Paris seine Truppen doch in Bewegung gesetzt hätte? Wenn die Franzosen sogar über den Rhein vorgestoßen wären und Hitler komplett bloßgestellt hätten? Die Folgen wären dramatisch gewesen – vor allem für Hitler.
Stellen wir uns vor: Das Scheitern der Remilitarisierung des Rheinlands wird für Hitler zur politischen Katastrophe. Die Begeisterung für das Regime ist schon zuvor deutlich abgeebbt, vor allem wegen der immer schlechteren Versorgungslage. In der Bevölkerung gärt es, weil es oft nur Billigmargarine statt Butter gibt, das Brot durch Beimischungen immer schlechter gerät und die Wurst mit Kartoffelmehl und minderwertigem Fett gestreckt wird.
Der schmachvolle Hinauswurf aus dem Rheinland kann das NS-Regime zwar nicht zum Sturz bringen; dafür sitzt es, abgesichert durch einen funktionierenden Repressionsapparat, zu fest im Sattel. Doch ein Rücktritt Hitlers, aus Verbitterung und Enttäuschung über sein Versagen, erscheint keineswegs undenkbar – vielleicht noch befördert durch Intrigen von Akteuren aus der zweiten Reihe. Es war seine Entscheidung, sein Vabanquespiel.
wollen doch das Vabanquespiel lassen«, mahnt er Hitler kurz vor dem Überfall auf Polen. Antwort des Diktators: »Ich habe [...] immer va banque gespielt.«
Das sagt einiges. Göring hätte vermutlich regional begrenzte Kriege geführt, wäre aber wohl vor einem Feldzug gegen die Sowjetunion zurückgeschreckt.
Und der Holocaust? Nach den Novemberpogromen 1938 marschiert Göring bei der Entrechtung und Ausplünderung der deutschen Juden vorneweg. Sein Antisemitismus ist allerdings vor allem ökonomisch motiviert: Er will das Geld und die Fabriken der Juden für die Aufrüstung – und die wertvollen Gemälde für sich. Vielleicht hätte es unter Göring keinen millionenfachen Mord in Vernichtungslagern gegeben – auch wenn er in der Realität Reinhard Heydrich im Juli 1941 mit einem »Gesamtentwurf« zur Durchführung der »Endlösung« beauftragte. Möglicherweise hätte er Millionen europäischer Juden nach Madagaskar deportieren lassen – in eine Art Strafkolonie unter deutscher Aufsicht. Die Pläne waren ausgearbeitet.
Göring scheut das Risiko
eines großen Krieges
Als Nachfolger kommt eigentlich nur einer in Betracht: Hermann Göring. In der NS-Führungsriege ist er, so urteilt der Zeithistoriker Wolfram Pyta, »der Einzige, der auf der gesamten politischen Klaviatur spielen kann«. Als Chef der Luftwaffe und preußischer Ministerpräsident hat er bereits eine starke Machtposition inne. Nach der Machtübernahme hatte der jovial erscheinende Göring seinem »Führer« die dreckige Arbeit abgenommen; brutal ließ er die linke Opposition ausschalten, ohne dass Hitlers Ansehen bei den Nationalkonservativen allzu sehr ramponiert wurde. Göring ist der »Macher« des Regimes – intelligent, skrupellos, intrigant, machtgierig, zu dieser Zeit noch voller Energie – und in weiten Teilen der Bevölkerung populär.
Mit Göring an der Spitze wäre es vermutlich kein »Führerstaat« mehr gewesen, sondern ein Einparteienstaat, in dem Göring mit Goebbels und Himmler konkurriert. Auch unter einem Reichskanzler Göring hätte Deutschland massiv aufgerüstet. Seit je träumt er von einem dominanten, expansiven Deutschland, das eine Vormachtstellung in Europa einnimmt und England weltweit Paroli bieten kann – auch mit Kolonien. Göring ist kein Friedensengel, sondern ein zynischer, erpresserischer Machtmensch, der Deutschland zu alt-neuer Größe führen will. Aber anders als Hitler scheut er das Risiko eines großen Krieges. »Wir
Gab es auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg tatsächlich die »letzte Ausfahrt Rheinland«? Manche Historiker sehen die Chance vertan, Hitler auf seinem Weg in den Krieg noch zu stoppen. »Ich glaube, 1936 war wirklich die letzte Chance, durch Widerstand einen Showdown mit Hitler zu vermeiden«, analysiert Ian Kershaw. »Wenn man Hitler 1936 in die Arme gefallen wäre, wäre das möglicherweise erfolgreich gewesen.« Doch gleich im nächsten Satz fällt er sich ins Wort: »Ich spreche von einer theoretischen Möglichkeit, die in der Praxis nie bestand.«
Der frühere tschechische Präsident Miloš Zeman hat bei einer Holocaust-Konferenz in Prag vor einigen Jahren darüber nachgedacht, welche Lehren die Remilitarisierung des Rheinlands vor fast 90 Jahren für die Gegenwart bereithält. Auch er glaubt, dass es bei einem entschiedenen Einschreiten der Briten und Franzosen »keinen Holocaust und keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte«. Sein Fazit ist einfach – und schonungslos: »Terroristen lassen sich nicht mit Gesetzesänderungen bekämpfen, sondern nur mit bewaffneten Streitkräften – so wie es 1936 im Rheinland hätte geschehen müssen.«

ANDREAS MOLITOR ist freier Journalist in Berlin. Seine Biografie »Hermann Göring. Macht und Exzess« erscheint am 21. August
Dann hätte es keinen Holocaust gegeben
Akribisch bereitet Georg Elser sein Attentat vor. Aber ausgerechnet am 8. November 1939 hat Hitler es eilig. Sonst hätte er den Bombenanschlag wohl nicht überlebt VON MICHAEL WILDT 13. W ENDE PUN K T



VOR DER EXPLOSION
Im gut gefüllten Saal des Münchner Bürgerbräukellers spricht Hitler am Abend des 8. November 1939 zum Gedenken an den Putschversuch 1923. In der Säule in seinem Rücken steckt ein Sprengsatz mit Zeitzünder

AUFSTAND DES GEWISSENS
Der Tischler Georg Elser fasst im Herbst 1938 den Entschluss, Hitler zu töten, um einen Krieg zu verhindern.
Die Aufnahme zeigt ihn in den Dreißigerjahren
Mitunter bestimmen Zufälle die Weltgeschichte. Am 8. November 1939 war das Wetter über Berlin so stürmisch, dass Hitler nicht wie geplant mit dem Flugzeug von München nach Berlin zurückkehren konnte. Er musste die Bahn nehmen, was bedeutete, dass er früher als im Programm vorgesehen die jährliche Gedenkfeier zum Hitler-Ludendorff-Putsch vom November 1923 im Münchner Bürgerbräukeller verließ. Damit entging er um wenige Minuten dem Attentat von Georg Elser, das mit Sicherheit seinen Tod bedeutet hätte.
Georg Elser, 1903 in Hermaringen bei Heidenheim geboren, wuchs in Königsbronn, einem kleinen Industriedorf auf der Schwäbischen Alb, auf. Er kam aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, der seinen Bauernhof herunterwirtschaftete. Die Mutter, als uneheliches Kind geboren, hatte bis zur Heirat bei ihrem Vater und der Stiefmutter gelebt.
Georg war das erste Kind unter insgesamt sechs Geschwistern. Die Lebenswelt auf der Schwäbischen Ostalb, so schreibt sein Biograf Wolfgang Benz, war von harter Arbeit, Fleiß und Sparsamkeit, württembergischem Patriotismus und pietistischer Frömmigkeit bestimmt. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges prägte den jungen Georg Elser. Krieg war für ihn ein Grundübel, das er zutiefst verabscheute.
Als 14-Jähriger begann Elser zunächst eine Eisendreherlehre, brach diese jedoch ab und fing an, Schreiner zu lernen. Er fertigte Möbel an und war stolz auf seinen Beruf. Seit Mitte der Zwanzigerjahre arbeitete er bei verschiedenen Firmen in der Bodenseeregion. Er galt als schweigsamer, aber geselliger Mensch und hatte eine Liebesbeziehung zu Mathilde Niedermann, einer gelernten Näherin. Ein Sohn wurde 1930 geboren, doch die Beziehung zerbrach, das Kind wuchs bei den Großeltern von Mathilde auf.
Die Wirtschaftskrise zwang Elser, wieder ins Elternhaus in Königsbronn zurückzukehren. Er fand Arbeit in einer Armaturenfabrik in Heidenheim, war Mitglied im Gesangverein und verliebte sich neu. In die Attentatspläne weihte er seine Freundin nicht ein. Auch seinen Freundeskreis wollte er nicht als Mitwisser belasten.
Elser war im Holzarbeiterverband gewerkschaftlich organisiert und wählte bis 1933 die KPD. »Weil ich dachte«, so sagte er später in der Vernehmung der Gestapo aus, »das ist eine Arbeiterpartei, die sich sicher für die Arbeiter einsetzt. Mitglied dieser Partei
bin ich jedoch nie gewesen. [...] Im Jahr 1928 oder 1929 bin ich in Konstanz dem Roten Frontkämpferbund beigetreten. Ich war aber nur zahlendes Mitglied, denn eine Uniform oder irgendeinen Funktionärsposten habe ich nie innegehabt.«
Für Elser war klar, dass Hitler die Absicht hatte, Europa in einen neuen Krieg zu stürzen. Gab es eine Möglichkeit, dies zu verhindern? Im Herbst 1938 sei er zu dem Entschluss gekommen, so gab er später bei der Gestapo zu Protokoll, »dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten«.
Elser war keineswegs ein unpolitischer Mensch, aber er dachte nicht in Parteiprogrammen. Er machte sich seine eigenen Gedanken, hielt sich von den Nationalsozialisten fern und gründete seine Entscheidung zum Attentat auf persönlichen Erfahrungen und Überlegungen.
Systematisch bereitete Elser das Attentat vor. Im November 1938 inspizierte er den Bürgerbräukeller in München, weil er die jährliche Gedenkfeier, an der neben Hitler die gesamte NS-Führung teilnahm, für den Anschlag ausgewählt hatte. In der Armaturenfabrik, in der er arbeitete, wurden unter strenger Geheimhaltung Zünder für Geschosse hergestellt, und so konnte er sich dort Sprengstoffpulver und Zünderteile besorgen. Zwar endete seine Beschäftigung in der Armaturenfabrik im März 1939, aber Elser fand eine neue Stelle als Hilfsarbeiter in einem Steinbruch, wo er sich Patronen und Sprengkapseln beschaffte. Er konstruierte selbst einen Zeitzündmechanismus.
Am 5. August fuhr er nach München, wohnte in einem billigen möblierten Zimmer, besorgte sich noch weitere Teile, die er für die Bombe benötigte, und ließ sich 30 Nächte lang unentdeckt im Bürgerbräukeller einschließen, um die Säule, vor der Hitlers Rednerpult stehen würde, zu präparieren. Abends verbarg er sich in einem Abstellraum und wartete, bis das Brauhaus verschlossen wurde. Dann machte er sich beim Schein einer Taschenlampe an die Arbeit. Elser höhlte den Pfeiler so sorgfältig und umsichtig aus, dass seine Arbeit bei Tag unentdeckt blieb. Morgens, wenn der Saal wieder geöffnet wurde, verließ er den Bürgerbräukeller – bis zum nächsten Abend.
In der Nacht auf den 3. November baute er die Bombe ein, drei Nächte später den Zeitzünder. Der Zünder war auf den Abend des 8. November eingestellt. Danach fuhr Elser nach Stuttgart zu seiner Schwester Maria. Alles war bereit. Doch er traute den Vorbereitungen nicht. Er setzte sich noch nicht wie

beabsichtigt in die Schweiz ab, sondern kehrte am 7. November noch einmal nach München zurück, um nachts die Bombe zu überprüfen.
Am Vormittag des 8. November fuhr er dann mit der Bahn nach Konstanz. Doch der Zufall wollte es, dass er beim Versuch, illegal die Schweizer Grenze zu überschreiten, entdeckt und verhaftet wurde. Elser geriet sofort unter Verdacht, denn er trug ein Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes, eine Ansichtskarte vom Bürgerbräukeller und Teile des Zeitzünders bei sich. Wahrscheinlich hatte er geplant, sich gegenüber den Schweizer Behörden als Widerstandskämpfer auszuweisen.
Eigentlich wollte Hitler wegen des Krieges in Berlin bleiben und dieses Mal nicht zu der traditionellen NS-Feier nach München reisen, entschied sich aber dann doch kurzfristig, an dem Treffen teilzunehmen. Wegen der geänderten Rückfahrt begann er seine Rede eine halbe Stunde früher und hielt sie deutlich kürzer als üblich. Sieben Minuten nach 21 Uhr verließ Hitler den Saal, 13 Minuten später explodierte der Sprengkörper. Die Explosion war so stark, dass sie nicht nur das Rednerpult zerstörte, sondern die Saaldecke einstürzen ließ. Von den etwa 200 Menschen, die sich in dem Raum befanden, wurden acht getötet und 63 verletzt.
Obwohl Elser in der Haft die Tat gestand, war die NS-Führung überzeugt, dass kein einzelner Mann,
schon gar nicht ein einfacher Arbeiter, ein solches Attentat verübt haben könnte, sondern dass der britische Geheimdienst dahinterstecken müsse – eine Lesart, die sich bis in die Nachkriegszeit gehalten hat.
Georg Elser wurde ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt, wo er in strenge Isolationshaft genommen wurde. In den letzten Kriegstagen, am 9. April 1945, wurde er im Konzentrationslager Dachau ermordet.
Was wäre geschehen, wenn Elser Erfolg gehabt und er Hitler an diesem Abend des 8. November 1939 getötet hätte?
Zwei Monate zuvor, am 1. September, hatte mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. Anders als im Juli 1914 war die Stimmung in der Bevölkerung gedrückt. Der amerikanische Korrespondent William L. Shirer, der schon in den Wochen zuvor die Kriegsfurcht in der deutschen Bevölkerung bemerkt hatte, war am 3. September gerade auf dem Berliner Wilhelmplatz unterwegs, als die Lautsprecher verkündeten, dass England Deutschland den Krieg erklärt habe. Die Menschen hörten gespannt zu, notierte Shirer: »Nach Beendigung der Durchsage gab es nicht einmal ein Murmeln. Sie standen unverändert dort. Betäubt. Die Leute können es noch nicht fassen, dass Hitler sie in einen Weltkrieg geführt hat.«
Zwar besiegten die deutschen Truppen rasch die ungleich schwächer gerüstete polnische Armee, zu-
IN TRÜMMERN
Am 9. November 1939, einen Tag nach dem missglückten Anschlag, begutachten Uniformierte die eingestürzte Saaldecke des Brauhauses

UNTER DEN AUGEN DES »FÜHRERS«
Ende November 1939 wird Georg Elser in Berlin von der Gestapo verhört. Für Hitlers
Fotografen
Heinrich Hoffmann muss er sich mit Reichskriminaldirektor
Arthur Nebe über einen Bauplan beugen
mal die Sowjetunion aufgrund des Hitler-StalinPaktes Ostpolen besetzte und den polnischen Widerstand unterdrückte. Großbritannien und Frankreich unternahmen trotz ihrer Kriegserklärungen und Bündnisverpflichtungen gegenüber Polen keine ernsthaften militärischen Anstrengungen gegen Deutschland. Hitler wollte nach dem Sieg über Polen rasch Frankreich angreifen, was auf den Widerstand eines Großteils der Generalität stieß, die nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges befürchtete, damit einen Krieg nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen Großbritannien und die USA auszulösen.
Schon 1938 hatte sich um Ludwig Beck, den Chef des Generalstabes des Heeres, und Hans Oster im Amt Ausland/Abwehr eine militärische Oppositionsgruppe gebildet, die gegen Hitlers Expansionspläne agierte. Aber ausgerechnet das Münchner Abkommen vom September 1938, mit dem sich die europäischen Großmächte NS-Deutschland beug-
ten und die Tschechoslowakei zwangen, die beanspruchten sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich abzutreten, vereitelte die bereits ausgearbeiteten Pläne, Hitler und die SS-Spitze zu verhaften, falls es tatsächlich zum Ausbruch eines Krieges gekommen wäre.
Daher standen die Chancen für einen Militärputsch im Herbst 1939 eigentlich sehr gut, wenn Elsers Attentat gelungen wäre. Ludwig Beck, der im August 1938 als Generalstabschef zurückgetreten war, wurde nicht müde, Denkschrift um Denkschrift an seinen Nachfolger Franz Halder zu senden und vor einer Ausweitung des Krieges zu warnen. Halder und Walther von Brauchitsch, der Oberbefehlshaber des Heeres, waren ebenfalls überzeugt, dass ein Angriff auf Frankreich in einer Niederlage enden würde. Ebenso wie andere hohe Generäle versuchten sie, Hitler von seinem Entschluss abzubringen.
Zugleich nutzte eine zivile Gruppe um den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler, Adam von Trott zu Solz, Fabian von Schlabrendorff und andere ihre Kontakte zu britischen Politikern, um Großbritannien auf einen möglichen Umsturz in Deutschland vorzubereiten. Sie warben in London um Unterstützung. Aber immer wieder schreckten die deutschen Generäle vor definitiven Zusagen zurück, sich an einem Staatsstreich zu beteiligen, weil sie von einer hohen Zustimmung für das NS-Regime in der Bevölkerung ausgingen und einen Bürgerkrieg gegen SA und SS fürchteten.
Die Spannungen spitzten sich Ende Oktober, Anfang November 1939 zu, als am 5. November von Brauchitsch Hitler erneut von seinem Kriegsplan gegen Frankreich abzubringen versuchte und Hitler daraufhin in Wut ausbrach. Er warf den Generälen vor, nicht kämpfen zu wollen, und kündigte an, dass er den »Geist von Zossen«, dem Hauptquartier des Generalstabs südlich von Berlin, erbarmungslos ausrotten werde. Halder deutete dies so, dass Hitler die Putschpläne kenne. Er geriet in Panik, ließ alle Unterlagen, die mit den Umsturzvorbereitungen zu tun hatten, vernichten und distanzierte sich fortan von den Widerständlern.
Wäre Elsers Attentat – das die Militärs allerdings völlig überraschte – erfolgreich gewesen, so wäre mit Hitlers Tod die Voraussetzung für den geplanten Staatsstreich gegeben gewesen. Himmler und die SS waren zu Kriegsbeginn noch nicht so stark, wie sie es im Laufe des Krieges wurden, und die SA war nach dem Röhm-Putsch sowieso geschwächt. Wäre es gelungen, vor allem Hermann Göring – der als Chef
der Vierjahresplanbehörde die Kriegswirtschaft be fehligte und zu diesem Zeitpunkt nach Hitler der mächtigste NS-Politiker war – in die neue Militär regierung einzubinden, wäre eine Ausweitung des Krieges tatsächlich unwahrscheinlich und eine Ver ständigung mit Frankreich und Großbritannien möglich gewesen.
Sicher wäre die Besetzung Polens durch NSDeutschland und die Sowjetunion ein Konflikt mit den Westmächten geblieben. Aber letztlich wäre wohl ein Szenario eingetreten, in dem die West mächte sowohl der wirtschaftlichen Ausplünderung als auch der »Germanisierung« Polens, der rassisti schen und antisemitischen Bevölkerungspolitik des NS-Regimes, die auch von der Wehrmachtsführung befürwortet wurde, keinen wirksamen Widerstand entgegengesetzt hätten.
Zu einem Wiederaufleben der parlamentarischen Demokratie nach dem Modell der Weimarer Repu blik wäre es in keinem Fall gekommen. In dieser Frage waren sich die Militärs mit den Nationalsozia listen einig. Die Linke sollte ebenso unterdrückt werden, wie Juden aus der »Volksgemeinschaft« aus geschlossen bleiben sollten. Entstanden wäre ein autoritärer, nationalistischer Staat mit nur wenigen rechtsstaatlichen Garantien und bürgerlichen Frei heiten. Doch eine Ausweitung des Krieges wäre ohne Hitler wohl vermieden worden – und insbe sondere hätte es ohne ihn und mit einer entmachte ten SS die rassistische und antisemitische Radikali sierung zum systematischen Massenmord nicht ge geben. Wäre das Attentat Elsers gelungen, hätte es keinen Holocaust gegeben.
Erinnern an Georg Elser Krieg kaum jemand. Während sich zu Claus Schenk Graf von Stauffenberg und den Attentätern des 20. Juli 1944 allmählich die Buchregale füllten, dauerte es bis in die Siebzigerjahre hinein, Georg Elser wieder sichtbar werden zu lassen und seinen Widerstand zu würdigen. Zu deutlich stellte der spröde, eigensinnige Elser unter Beweis, dass man auch in Zeiten, in denen Millionen Deutsche Hitler unterstützten, als einfacher Tischler mit klarem Ver stand und festen moralischen Werten den verbreche rischen Charakter des NS-Regimes erkennen und den Entschluss zum Widerstand fassen konnte.

Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts
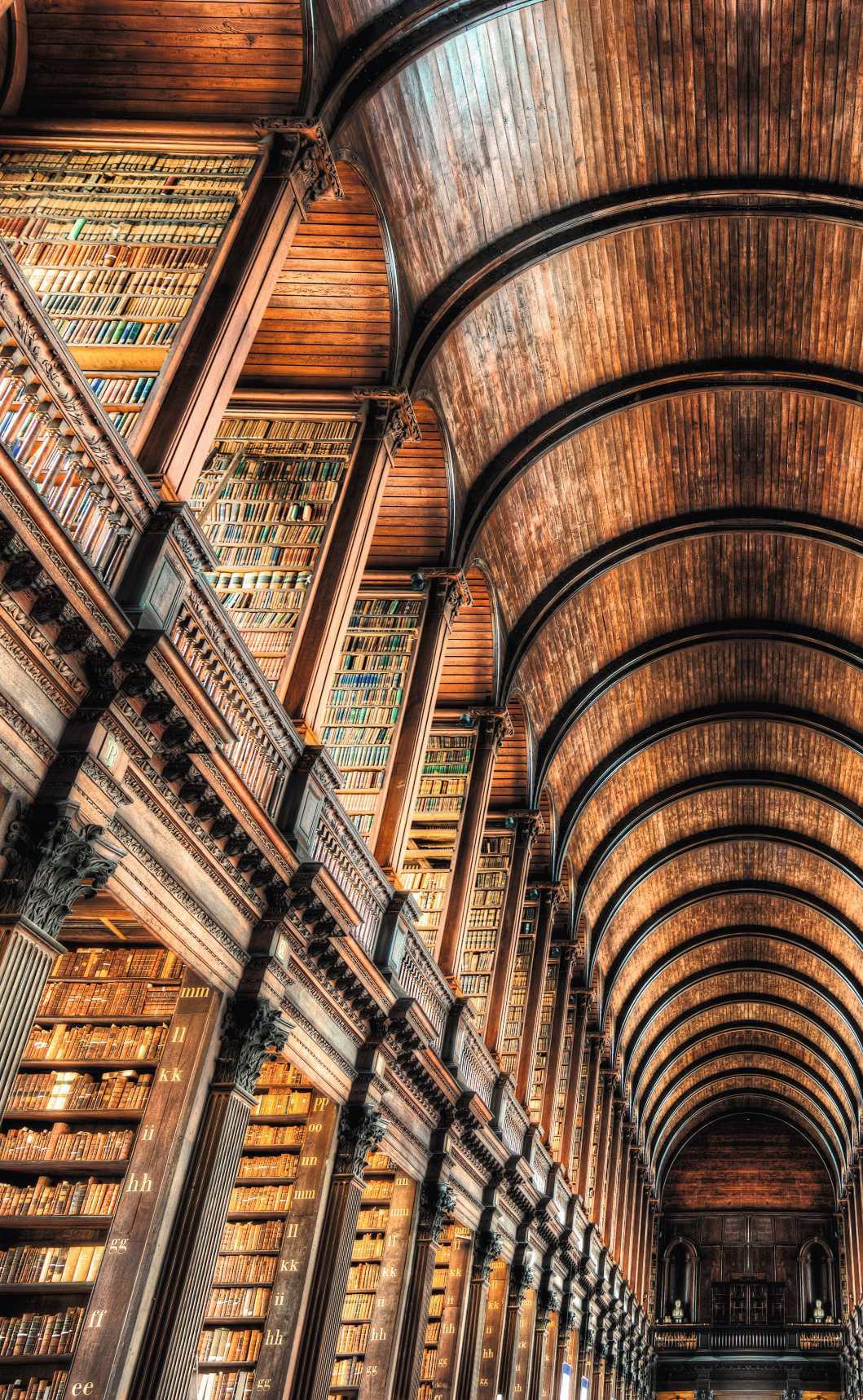
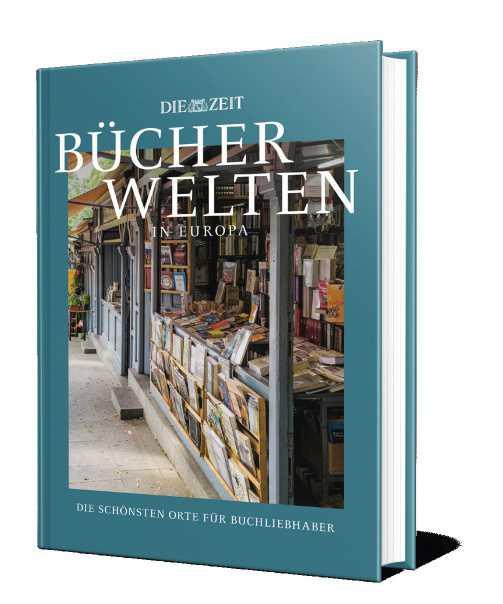
Für alle, die Bücher und Reisen lieben: Entdecken Sie die faszinierendsten Literaturorte unseres Kontinents! Von der modernen Nationalbibliothek in Athen bis zur barocken »Livraria Lello« in Porto: Unsere neue ZEIT-Edition »Bücherwelten in Europa« bringt Sie zu beeindruckenden Buchhandlungen, Bibliotheken und Literatur-Hotspots Für 39,95 € * – nur im ZEIT Shop.
EVAKUIERUNG: Vom 26. Mai bis zum 4. Juni 1940 werden fast 340.000 alliierte Soldaten aus Frankreich nach England verschifft. Hier kommen britische Truppen vermutlich in Dover an



Das Wunder von Dünkirchen
Kurz vor der französischen Kanalküste lässt Hitler
1940 überraschend die deutschen Panzer stoppen.
Das britische Expeditionskorps kann entkommen.
Was wäre geschehen, wenn England den Großteil seiner Landstreitkräfte verloren hätte?
VON HAUKE FRIEDERICHS
Für das britische Expeditionskorps scheint das Ende gekommen zu sein. Gut 350.000 alliierte Soldaten drängen sich in der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen und an den Stränden in der Nähe zusammen. Sie hoffen auf Rettung, aber die Deutschen rücken unaufhaltsam vor. Am 24. Mai 1940 sind die Panzerspitzen von General Heinz Guderian nur noch 25 Kilometer von der Stadt entfernt. Drei Tage zuvor waren sie bis zur Kanalküste vorgestoßen und hatten den britischen Soldaten den Rückzugsweg ins Landesinnere versperrt.
Zu diesem Zeitpunkt dauerte der Zweite Weltkrieg noch nicht einmal ein Jahr. Im September 1939 hatte die Wehrmacht Polen überrollt, im Frühjahr 1940 Dänemark und Norwegen besetzt. Dann, im Mai 1940, befahl Hitler den großen Schlag gegen Frankreich.
Jetzt, am 24. Mai, steht Frankreich kurz vor dem Fall, auch wenn die Deutschen noch nicht in Paris sind. Und aus Sicht der
Regierung in London könnte es noch schlimmer kommen, denn die Wehrmacht hat einen großen Teil der britischen Soldaten eingekreist, die nach Westeuropa entsandt worden waren. Großbritannien hatte Frankreich mit 390.000 Soldaten unterstützt, unter ihnen die fünf besten britischen Divisionen.
Der Untergang der Briten auf französischem Boden scheint besiegelt, aber dann wendet sich das Blatt. Hitler trifft eine Entscheidung, die als einer der schwersten militärischen Fehler der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gilt. Er stoppt den Vormarsch auf Dünkirchen.
Bislang war Hitler stets erfolgreich, wenn es darum ging, alles auf eine Karte zu setzen. 1936 hatte er Truppen in das entmilitarisierte Rheinland einmarschieren lassen und riskiert, dass Franzosen und Briten zurückschlagen würden. Im März 1938 rückten deutsche Soldaten in Österreich ein, obwohl Italiens »Duce« Mussolini dagegen war und schon Soldaten am Brenner postiert hatte. Im Oktober dessel-
ben Jahres besetzte die Wehrmacht das Sudetenland, und im März 1939 ließ Hitler die restliche Tschechoslowakei zerschlagen. All diese waghalsigen Manöver blieben für Deutschland ohne negative Konsequenzen. Auch bei der Angriffsstrategie im Westen hatte sich Hitler für das Risiko und gegen vorsichtigere Vorschläge seiner Spitzenmilitärs entschieden.
Im Frühjahr 1940 hatte die Wehrmacht mehr und mehr Truppen im Westen zusammengezogen. Wie 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs sahen die deutschen Aufmarschpläne das Vorrücken durch neutrale Staaten vor; diesmal nicht nur durch Belgien und Luxemburg, sondern auch durch die Niederlande. Zudem hatte General Erich von Manstein einen Plan entwickelt, der einen überfallartigen Vorstoß durch die Ardennen und über die Maas tief nach Frankreich ermöglichen sollte – vorbei an der Maginot-Linie, einem Befestigungsgürtel an der Grenze zu Deutschland. Bei Sedan allerdings endete die Bunkerlinie. Dorthin, so sah es Mansteins Plan vor, sollten die Panzerspitzen rasch vorrücken.
Mit schweren Gefährten sei ein solcher Vorstoß durch bergiges und bewaldetes Terrain gar nicht möglich, gaben andere Generäle zu bedenken. Doch Hitler, dem Manstein im Februar 1940 in der Reichskanzlei seine Idee vortrug, entschied sich für den Weg durch die Ardennen. Eine weitere Angriffsachse zielte durch die neutralen Nachbarstaaten Frankreichs im Nordwesten, an deren Grenze die Franzosen keine bedeutenden Verteidigungsanlagen errichtet hatten.
In den ersten Stunden des 10. Mai läuft der »Fall Gelb« an, die breite Offensive an der Westfront. Innerhalb weniger Tage bricht die Wehrmacht durch die niederländischen und belgischen Linien. In nur drei Tagen stoßen die deutschen Panzer durch die Ardennen und rücken bei Sedan an die Maas vor.
So mancher Politiker und Publizist in London hält Frankreich bereits für verloren. Doch der britische Premierminister Winston Churchill sieht das anders. Für ihn steht fest, dass die Deutschen aufgehal-

HAUDEGEN: Kriegspremier Winston Churchill inspiziert Ende Juli 1940 britische Verteidigungsstellungen im Nordosten Englands. In der Hand hält er eine amerikanische Thompson-Maschinenpistole
ten werden müssen. Er lässt das britische Expeditionskorps auf dem Festland und schickt weitere 32 Hurricane-Jäger zur Verstärkung. Die Flugzeuge sollten eigentlich den britischen Luftraum verteidigen. Die Verluste der Briten auf dem Festland sind hoch. Churchill lässt sich selbst nach Frankreich fliegen, um sich ein Bild zu machen. Die Stimmung ist düster.
Die Wehrmacht rückt so rasch durch Belgien vor, dass der britische Generalstab die Verbände nach Westen zurückzieht. In Dünkirchen drängen sich immer mehr Truppen der Alliierten, es sind bald mehr als 350.000 Mann. Nicht nur von Westen aus rücken die Verbände der Wehrmacht auf sie zu, auch aus Süden stoßen Guderians Panzer an die Kanalküste vor.
Churchill befiehlt die Evakuierung, aber die britische Marine hat dafür nicht genügend Schiffe. Trotz der dramatischen Lage bleibt Churchill bei seinem Entschluss, nicht mit Hitler zu verhandeln. Der Premier weiß, dass er die Männer über den Kanal holen muss, wenn er den Krieg fortsetzen will. Mehr als zwei Drittel der
aktiven britischen Truppen in Europa befinden sich in diesem Moment in Dünkirchen und Umgebung.
Aber Hitler, der in den vergangenen Jahren so viele riskante Entscheidungen getroffen hat, scheut plötzlich offenbar das Risiko. Er besucht am 24. Mai 1940 das Hauptquartier der Heeresgruppe A, die von Generaloberst Gerd von Rundstedt kommandiert wird. Dort lässt er sich in die Lage einführen und bestätigt den Haltebefehl Rundstedts vom Vortag, der den Angriff seiner Panzertruppe auf Dünkirchen zugunsten einer Umgruppierung verzögert hat. Hitler unterstellt Rundstedt sogar alle Panzer, die für einen direkten Angriff auf Dünkirchen bereitstünden. Der General soll entscheiden, wann dafür der richtige Moment gekommen sei.
Statt Dünkirchen anzugreifen und die dort eingeschlossenen Soldaten gefangen zu nehmen, warten die deutschen Verbände und gruppieren sich neu. General Guderian kann es nicht fassen. So nah sieht er sich vor seinem größten Sieg: Der Kessel von Dünkirchen liegt vor ihm, aber er darf
den finalen Schlag nicht führen. Weiter geht es für seine Panzer erst einmal nicht. Er bestürmt seine Vorgesetzten per Funk, die Entscheidung zu revidieren, die Chance zu nutzen, die Briten und ihre Verbündeten hart zu treffen. Aber Hitlers Entschluss steht – für zwei Tage.
Kostbare Zeit, die von der Royal Navy für die Planung der größten Rettungsaktion aller Zeiten genutzt wird. »Operation Dynamo« läuft am 26. Mai an. Mit Kriegsschiffen, aber auch mit Segeljachten, Fischkuttern und anderen zivilen Booten gelingt es den Briten, mehr als 338.000 alliierte Soldaten aus Dünkirchen herauszuholen und über den Ärmelkanal nach England zu bringen. Selbst ein altes Feuerwehrboot, das sonst auf der Themse fährt, sammelt Soldaten vom Strand ein.
Als Hitler den Haltebefehl kassiert, haben die Gegner der Deutschen sich vor Dünkirchen eingegraben. »Die in dem Sack bei Dünkirchen und Lille steckenden Engländer und Franzosen kämpfen erbittert«, schreibt Generaloberst Fedor von Bock am 28. Mai in sein Kriegstagebuch. Er hat sich über Hitlers Haltebefehl geärgert, die »Uneinheitlichkeit der Führung« kritisiert und ist darüber erzürnt, dass der Druck der deutschen Panzer, die auf Dünkirchen vorrücken, schwach bleibt. »Der Engländer« fahre weiter von Dünkirchen ab. Daran hinderten ihn auch nicht die Angriffe der deutschen Luftwaffe.
Wie es zum Haltebefehl kam, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Vielleicht hat sich Hitler auf die Zusicherung Hermann Görings verlassen. Der Chef der Luftwaffe und zweitmächtigste Mann im NSStaat hatte versprochen, dass seine Kampfflugzeuge den Kessel von Dünkirchen aus der Luft bekämpfen könnten. Tatsächlich konnten die Briten trotz der Luftschläge die allermeisten ihrer Soldaten evakuieren.
Oder hatte der Diktator mit dem Zurückhalten der Panzer versucht, Friedensverhandlungen mit der britischen Regierung zu ermöglichen? Der Haltebefehl als ein Kommunikationsmittel? Im Ersten Weltkrieg waren 880.000 britische Soldaten gefallen, zwei Millionen waren ver
wundet auf die Inseln zurückgekehrt. Dieser Aderlass hatte das Land geprägt. Kriegseinsätze auf dem Kontinent waren unpopulär. Und selbst Minister in Churchills Kriegskabinett wollten mit den Deutschen verhandeln. War der Verzicht auf einen Sturm Dünkirchens der Versuch, zu einer Verständigung zu kommen?
Ohne den Haltebefehl wäre der Zweite Weltkrieg in Europa anders verlaufen. Hätte die Wehrmacht Dünkirchen angegriffen und die britischen Soldaten gefangen genommen, hätte England nicht nur eine schwere militärische, sondern Churchill auch eine politische Niederlage einstecken müssen. Schließlich hatte der Premier sich vehement gegen das Appeasement gestellt und für ein militärisches Vorgehen gegen Deutschland ausgesprochen. Er hatte die Landesverteidigung zugunsten des Einsatzes in Frankreich geschwächt. Ob Churchill zum Rücktritt gezwungen gewesen wäre, wenn das Expeditionskorps in Dünkirchen von Guderians Panzertruppe zerschlagen worden wäre?
Churchill war erst wenige Tage im Amt. Sein Vorgänger Neville Chamberlain war am 10. Mai zurückgetreten, gehörte aber weiterhin dem Kriegskabinett an, ebenso wie Churchills parteiinterner Rivale Außenminister Lord Halifax. Innerhalb der eigenen Regierung war der Premier mit seinem Kurs der entschlossenen Unterstützung Frankreichs und der Ablehnung von Verhandlungen mit Hitler auf Gegenwehr gestoßen.
Die NSFührung hetzte gegen Churchill, während Hitler mit anderen britischen Politikern und auch mit dem früheren König Eduard VIII. – der 1936 auf den Thron verzichten musste, um eine Bürgerliche, eine zweifach geschiedene Amerikanerin, heiraten zu können – ein besseres Verhältnis pflegte.
Mit den britischen Kriegsgefangenen hätte das NSRegime ein Faustpfand in die Hand bekommen, um enormen Druck auf das Kriegskabinett in London auszuüben und Churchill zu einem Waffenstillstand zu nötigen. Vielleicht hätte der Premier sein Amt verloren und wäre durch
einen Nachfolger aus dem AppeasementLager ersetzt worden.
Tatsächlich stärkte die Rettung der eingeschlossenen Truppen die Moral der Briten, sie waren bereit, Churchill zu folgen, auch wenn ihr Land zeitweilig allein gegen das NSReich stand. Der Regierungschef stimmte die Bevölkerung darauf ein, notfalls an den Stränden, auf den Feldern und in den Städten gegen die Deutschen zu kämpfen, um eine Invasion abzuwehren. Wären seine Landsleute dazu auch bereit gewesen, wenn Frankreichs Niederlage mit dem Verlust eines Großteils der britischen Landstreitkräfte einhergegangen wäre?
Vermutlich hätte Hitler für seinen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 mehr Truppen zur Verfügung gehabt, da England als Kriegspartei ausgefallen wäre. Zumindest hätte es kein Risiko eines Zweifrontenkrieges mehr gegeben.
Die USA traten erst nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor im Dezember 1941 in den Krieg ein. Da die Regierungen in Berlin und Tokio verbündet waren, erklärte Hitler den USA den Krieg. Das enorme Rüstungspotenzial der Vereinigten Staaten hätte auch im Fall einer schweren Niederlage Großbritanniens bei Dünkirchen auf lange Sicht den Krieg entschieden, doch bei einem Ausfall des Verbündeten hätten sich die Vereinigten Staaten zunächst womöglich ganz auf den Pazifik konzentriert, um mit aller Macht Japan zu bekämpfen.
Nicht ohne Grund sprechen die Briten bis heute vom »Wunder von Dünkirchen«. Nicht nur weil Hitlers Vorgehen schwer zu erklären bleibt, sondern weil die umfassende Rettungsaktion einer der Grundpfeiler für den britischen Erfolg über Deutschland fünf Jahre später war. Bei der alliierten Landung in der Normandie am 6. Juni 1944, die das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft über Westeuropa einläutete, war auf britischer Seite so mancher DünkirchenVeteran dabei.

HAUKE FRIEDERICHS ist sicherheitspolitischer Korrespondent der ZEIT

ENGE VERTRAUTE: US-Finanzminister Henry Morgenthau jr. (r.) mit Präsident Roosevelt 1944 auf Wahlkampftour
WENDE PUNK T 15.
Kartoffelacker oder Aufbauhilfe
Nach dem Krieg soll Deutschland zerstückelt und weitgehend deindustrialisiert werden, fordert 1944 US-Finanzminister Morgenthau. Steht das Reich kurz davor, in einen Bauernstaat verwandelt zu werden? VON MANFRED BERG
An allen Fronten waren die Alliierten auf dem Vormarsch, immer klarer zeichnete sich Hitlers Niederlage ab. Doch was sollte danach mit dem besiegten Deutschland geschehen? Am 24. September 1944 berichtete die New York Times über eine Denkschrift von US-Finanzminister Henry Morgenthau jr., in der er forderte, das Deutsche Reich in mehrere Teilstaaten zu zerstückeln und weitgehend zu deindustrialisieren.
Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt sympathisierte anfangs mit Morgenthaus Vorstellungen. Mit dem britischen Premier Winston Churchill einigte er sich darauf, Deutschland »in ein Land mit vorwiegend agrarischem und ländlichem Charakter« umzuwandeln. Was wäre passiert, wenn die Alliierten diese Idee tatsächlich umgesetzt hätten?
Der Althistoriker Alexander Demandt spekulierte 1984 in seinem Traktat Ungeschehene Geschichte über einen »Histo-
riomaten für experimentelle Geschichte«, der, gefüttert mit sämtlichen Daten der Welthistorie, vielleicht einmal perfektionierte kontrafaktische Geschichtsverläufe liefern werde. Das war einige Jahre vor dem Siegeszug der künstlichen Intelligenz. Fragt man heute die KI, welche Folgen der Morgenthau-Plan gehabt hätte, erhält man Antworten, die sich in etwa so zusammenfassen lassen: Eine Deindustrialisierung Deutschlands hätte zu einer massiven wirtschaftlichen Schwächung, zu Ernährungskrisen, politischer Radikalisierung und Unruhen geführt. Die wirtschaftliche Erholung Europas hätte sich verzögert, und das Machtvakuum und die Instabilität in der Mitte des Kontinents hätten die Spannungen des Kalten Krieges verschärft.
Die Nachkriegsordnung, so das Resümee des Chatbots, wäre weniger stabil und friedlich gewesen. Aber zum Glück sei an die Stelle des Morgenthau-Plans ja der
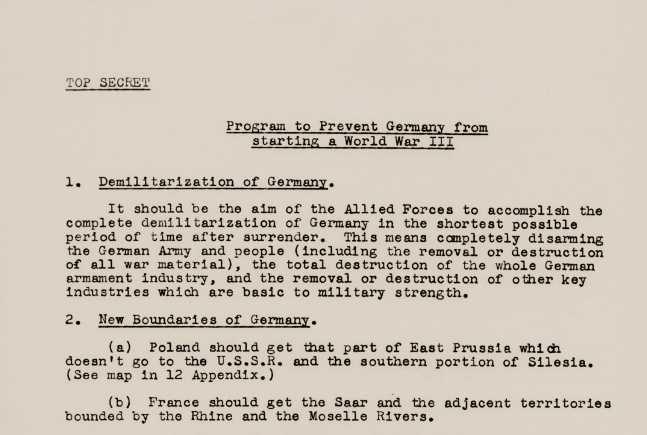
RADIKALE IDEEN Am 9. September 1944 übergibt Morgenthau dem Präsidenten sein Programm, das Deutschland davon abhalten soll, »einen Dritten Weltkrieg zu beginnen«

UNMUT DER BESIEGTEN: Jugendliche demonstrieren in Salzgitter gegen den Abbau von Industrieanlagen durch die Alliierten. Im November 1949 kommt es dort zu Streiks und Massenprotesten wegen der Demontage der Reichswerke Hermann Göring
Marshall-Plan getreten, mit dem die USA unter anderem der westdeutschen Wirtschaft wieder auf die Beine halfen.
Die KI spiegelt nur, womit sie gefüttert wurde, nämlich die kontrafaktischen Überlegungen, die Historiker zum Morgenthau-Plan angestellt haben. Und diese wiederum beruhen im Kern auf den Einwänden der zeitgenössischen Kritiker, die befürchteten, dass eine weitgehende Deindustrialisierung Deutschlands den Wiederaufbau der deutschen und der europäischen Wirtschaft unmöglich machen werde.
In den USA stieß der Morgenthau-Plan überwiegend auf scharfe Ablehnung. Wie sollten sich die Deutschen ohne eigene Industrie selbst versorgen, fragten die Kritiker, geschweige denn Reparationen für die gigantischen Verwüstungen leisten, die Hitlers Aggressionskrieg angerichtet hatte? Auf keinen Fall wollten die Amerikaner für die Ernährung und Versorgung der besiegten Feinde aufkommen müssen. Und noch war der Krieg nicht gewonnen. Die Furcht vor einem Rachefrieden, so warn-
ten die Militärs, werde nur den Widerstandswillen der Wehrmacht und der Zivilbevölkerung anfachen.
Präsident Roosevelt distanzierte sich schnell von Morgenthaus Vorstellungen, als klar wurde: Sowohl die US-Öffentlichkeit als auch die britischen und sowjetischen Verbündeten, die auf umfassenden Reparationen bestanden, lehnten eine Deindustrialisierung Deutschlands strikt ab. Er und Churchill hatten die berüchtigte Formulierung von einem Deutschland »mit vorwiegend agrarischem und ländlichem Charakter« möglicherweise gewählt, um die künftige industrielle Vormachtstellung Großbritanniens festzuschreiben, ließen sie aber schnell wieder fallen.
Für die NS-Propaganda war der Morgenthau-Plan ein gefundenes Fressen. Joseph Goebbels wütete: »Hass und Rache von wahrlich alttestamentarischem Charakter sprechen aus diesen Plänen, die von dem amerikanischen Juden Morgenthau ausgeheckt wurden.« Deutschland solle in einen »riesigen Kartoffelacker« verwandelt werden. Die Juden, tönte die Propaganda-
maschine in grotesker Verdrehung der Wirklichkeit, planten die Versklavung und Vernichtung des deutschen Volkes.
Die Durchhalteparolen der Nationalsozialisten verfingen freilich nur begrenzt. Als die US-Truppen 1944/45 den Westen des Reiches besetzten, nahmen viele Deutsche ihren Einmarsch eher mit Erleichterung hin. Gleichwohl wirkte die Propaganda nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Morgenthau-Plan in der Bundesrepublik und in der DDR zum Topos einer antisemitisch gefärbten Entlastungserzählung, der zufolge der alliierte Vernichtungswille dem des NS-Regimes kaum nachgestanden hatte.
Die jüngere Geschichtsforschung hält den Morgenthau-Plan dagegen für kaum mehr als eine Legende. Die Ideen des Finanzministers wurden vielfach falsch dargestellt, und es bestand keine realistische Chance auf eine Umsetzung. Die Vorschläge, die das Finanzministerium Anfang September 1944 erarbeitete, waren niemals offizielle US-Politik. Morgen-
thau konnte sich nicht gegen das Außenministerium und die Militärs durchsetzen, die aus pragmatischen Gründen einen raschen Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft befürworteten.
Zudem weisen die Historiker darauf hin, dass Morgenthau keineswegs die Umwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat verlangt hatte. Die umfassende Demontage der Schwer- und Rüstungsindustrie habe er vor allem gefordert, um eine erneute deutsche Aggression unmöglich zu machen. Damit hätten zugleich die Reparationsforderungen der Alliierten befriedigt werden können, indem diese die abgebauten Industrieanlagen erhielten. Morgenthau habe die Großindustrie entflechten und so die Macht der Großkapitalisten brechen wollen, die Hitler zur Macht verholfen und vom Krieg profitiert hätten.
Auch die Pläne zur territorialen Zerschlagung des Reiches dienten dem Ziel, dem deutschen Militarismus den Boden zu entziehen. Ostpreußen sollte zwischen der Sowjetunion und Polen aufgeteilt werden; Polen würde darüber hinaus Oberschlesien erhalten. Die Saar und Teile des linksrheinischen Gebiets schlug Morgenthau Frankreich zu. Das Ruhrgebiet sollte dauerhaft deindustrialisiert und unter internationale Kontrolle gestellt werden.
Politisch wollte Morgenthau das verbleibende Reichsgebiet in einen Nord- und einen Südstaat teilen, die unabhängig voneinander und föderalistisch organisiert sein sollten. Auch wenn Deutschland nicht zum Agrarland werden würde: Morgenthaus Denkschrift zielte auf eine dauerhafte wirtschaftliche, politische und militärische Schwächung, damit die Deutschen nie wieder einen Krieg entfesseln konnten. Zudem sah sie harte Strafmaßnahmen vor, wie die standrechtliche Exekution der Hauptkriegsverbrecher und Zwangsarbeit für Mitglieder der NS-Organisationen.
Wer sich gleichwohl auf die Frage einlässt, welche Folgen die Umsetzung von Morgenthaus Ideen gehabt hätte, muss sich vor zwei Fallgruben hüten. Die erste ist die Gefahr, ungewollt die NS-Parole
vom »Kartoffelacker« zu reproduzieren. Und die zweite ist die Versuchung, alternative Weltgeschichten zu konstruieren, wie sie sich in einigen Romanen finden, die den Stoff des Morgenthau-Plans weiterspinnen. So entwirft der Schriftsteller Thomas Ziegler 1984 in Die Stimmen der Nacht das Szenario eines verarmten Bauernlandes: »Werwölfe« (NS-Partisanen) leisten bewaffneten Widerstand, während nach Südamerika ausgewanderte Nationalsozialisten dort ein neues Reich schaffen und die Wiedereroberung Deutschlands und Europas planen.
Historiker dagegen können ihre kontrafaktischen Überlegungen nicht ihrer Fantasie überlassen, sondern müssen plausible Gründe anführen, warum Alternativen möglich gewesen wären und wie sie hätten aussehen können.
Für die amerikanische Deutschlandpolitik spielte der Morgenthau-Plan nach der Niederwerfung des »Dritten Reiches« keine Rolle mehr. Der Finanzminister schied kurz nach Roosevelts Tod im April 1945 aus der US-Regierung aus. Ökonomische Zwänge und der beginnende Kalte Krieg führten dazu, dass sich in der Truman-Administration die Befürworter eines schnellen Wiederaufbaus der (west)deutschen Industrie durchsetzten. In der Rückschau spricht wenig dafür, dass es dazu eine realistische Alternative gab.
Vieles deutet darauf hin, dass die zeitgenössischen Kritiker Morgenthaus recht hatten. Er plante gewiss keinen Völkermord an den Deutschen, aber eine konsequente Umsetzung seiner Vorschläge hätte höchstwahrscheinlich die Not der Nachkriegsjahre verschärft. Zudem bot Morgenthau den Besiegten keine Hoffnung und keine politische Perspektive. Auch darin unterscheidet sich die Denkschrift des USFinanzministers vom Marshall-Plan, der deshalb mit Recht als Beispiel weitsichtiger Hegemonialpolitik gilt.

MANFRED BERG lehrt Amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg
Mehr ZEIT.
Lesen Sie DIE ZEIT
4 Wochen kostenlos und freuen Sie sich über preisgekrönte Reportagen, tiefgründige Analysen und kontrastreiche Debatten –gedruckt oder digital. Jederzeit monatlich kündbar.
Angebot jetzt sichern: www.zeit.de/4-wochengratis

BLICK NACH VORN
Mit Parteichef
Kurt Schumacher wirbt die SPD bei der ersten Bundestagswahl am 14. August 1949 um Stimmen
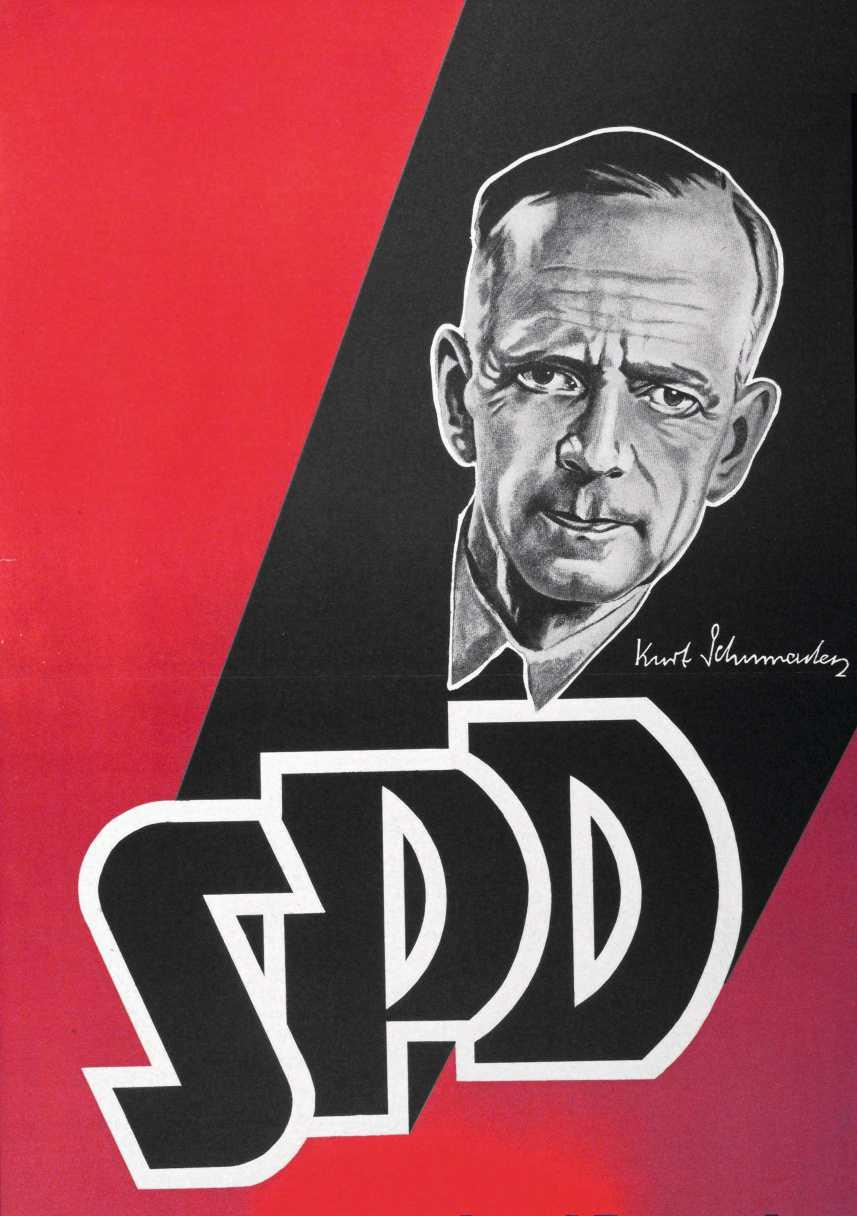
WENDE PUNK T 16.
Ära ohne
Konrad Adenauer kommt 1949 mit einer Stimme Mehrheit ins Amt – seiner eigenen.
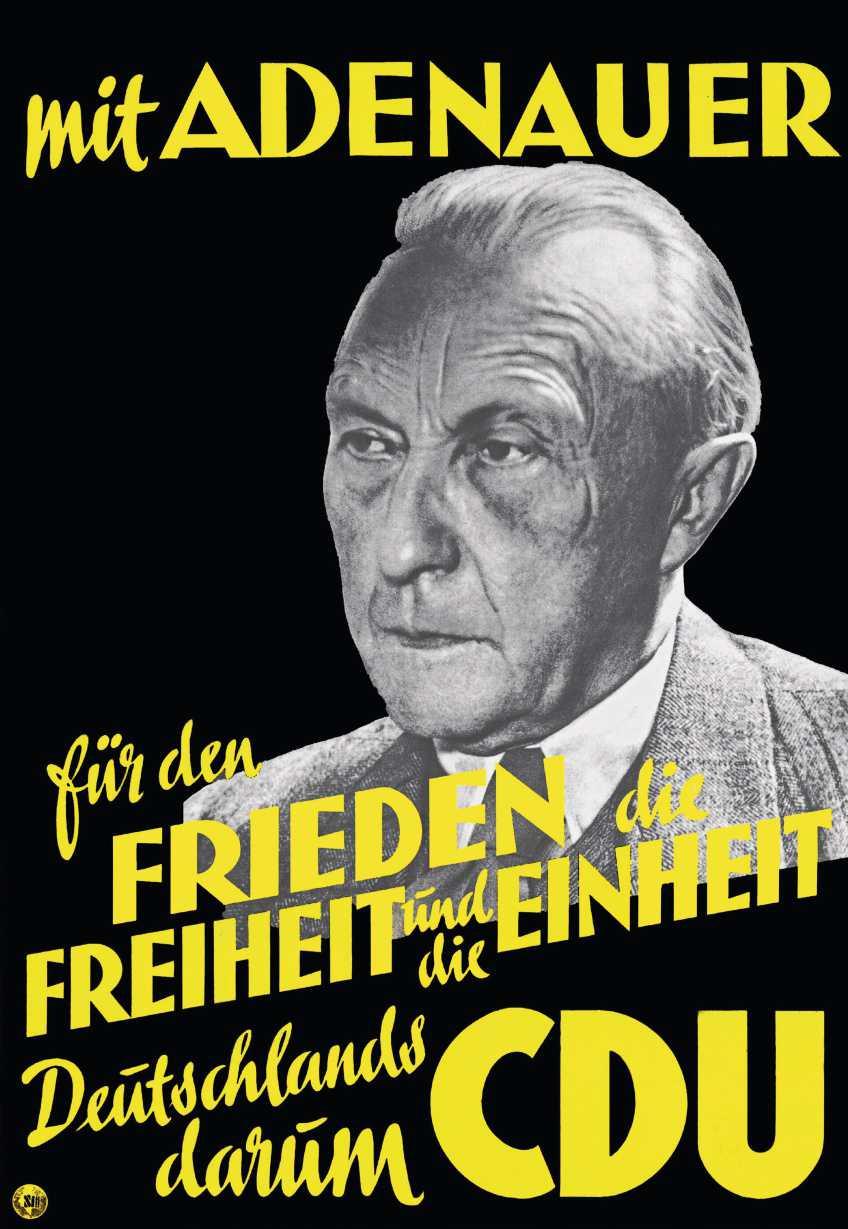
Adenauer
Welchen Weg hätte die Bundesrepublik genommen, hätte er die Kanzlerwahl verloren?
VON NORBERT FREI
SCHWARZ-GELB
Die CDU setzt zur Bundestagswahl 1949 auf Konrad Adenauer und die Farben seiner Wunschkoalition mit der FDP
LICHT AN
In der ehemaligen Pädagogischen
Akademie in Bonn konstituiert sich am 7. September 1949 der erste Deutsche Bundestag

Im Sommer 1949 waren die Namen Kurt Schumacher und Konrad Adenauer den Westdeutschen natürlich nicht mehr unbekannt. Aber anders als heute, wo selbst Kleinparteien meinen, eine Kanzlerkandidatin oder einen -kandidaten präsentieren zu müssen, kreisten die Diskussionen damals vor der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag mehr um Programme als um Personen. Ein bisschen hing das wohl auch damit zusammen, dass weder Schumachers SPD noch Adenauers CDU nur vier Jahre nach Hitler schon wieder mit einem starken Mann kommen wollte. So gab es zwar auch Plakate mit Porträts der beiden, doch nirgendwo fand sich das Etikett »Kanzlerkandidat«. Der Begriff war noch nicht Teil des politischen Vokabulars.
Für Adenauer war das ein Problem. Denn im Unterschied zu Schumacher, der die wiederbegründete Sozialdemokratie mit Charisma führte und im Falle eines Wahlsiegs Anspruch auf die Kanzlerschaft gehabt hätte, verfügte die seit 1945/46 aus lokalen Initiativen neu entstandene Union noch bei Gründung der Bundesrepublik nicht einmal über einen Bundesvorstand. Entsprechend vielstimmig gestalte-
te sich ihr Wahlkampf, in dem Adenauer als Vorsitzender der CDU in der britischen Zone nicht zuletzt Rücksicht auf die Eifersüchteleien der bayerischen Schwester CSU nehmen musste.
Höchst sinnfällig wurde das beim Wahlkampfauftakt der Unionsparteien in Heidelberg am 21. Juli 1949. Im festlichen Rahmen der romantischen Schlossruine konnte der rheinische Katholik Adenauer nur in einer Dreierrunde auftreten: für die Belange der CSU zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard, der selbst auf höhere Weihen im Bund spekulierte, und für die eher norddeutsch-protestantischen Kreise mit dem unbequemen Essener Oberbürgermeister Gustav Heinemann, mit dem Adenauer spätestens seit dessen kurzer Amtszeit als Justizminister von Nordrhein-Westfalen eine ausgesprochen kühle Parteifreundschaft pflegte.
Zu der von Lorbeer und Fanfarenbläsern umrahmten Inszenierung gehörte, dass der vormalige Präsident des Parlamentarischen Rats »buchstäblich in letzter Minute« eintraf und sich überrascht gab »von der Unruhe, die sein spätes Kommen verursacht hatte«. Sein andachtsvoller Biograf Paul Weymar hatte dafür ein paar Jahre später eine schöne Erklä-
rung parat: »Wie sich herausstellte, war er unterwegs ausgestiegen und hatte, auf einem Baumstumpf im Walde sitzend, das Konzept seiner Heidelberger Rede entworfen.« Diese zielte ganz darauf, sicht- und spürbar nahezulegen, was den Wahlplakaten nicht zu entnehmen war: nämlich wer eigentlich der Kanzlerkandidat der Union sei.
Die ersten etwa zehn Minuten von Adenauers einstündiger Rede waren in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich: Was wie eine Lektion in Staatsbürgerkunde daherkam – eine trockene Aufzählung von Fakten und Ereignissen seit der alliierten Regierungsübernahme am 5. Juni 1945 bis zur bevorstehenden Wiedererlangung wenigstens eines Teils »unserer Souveränitätsrechte« durch die Bildung einer Bundesregierung –, das war in Wirklichkeit die kaum mehr verhüllte Proklamation seines Anspruchs auf das Amt des Bundeskanzlers.
Auf diesen warte zwar eine »ungeheure Arbeit«, doch der Kanzler werde »die wichtigste Persönlichkeit sein in dem neuen Deutschland«. Das »traurige Beispiel« der Weimarer Republik, erklärte Adenauer, könne sich dank des im Grundgesetz verankerten konstruktiven Misstrauensvotums nicht wiederholen: »Die Stellung des Bundeskanzlers wird außerordentlich stark und fest sein. Er hat auch die Richtlinien der Politik der Bundesregierung zu bestimmen. Wenn Sie sich nur ganz im Fluge vorstellen, welche Aufgaben er hat, so sehen Sie, wie vielseitig diese sind.«
Für den einstigen Kölner Oberbürgermeister hing aber alles an der Außenpolitik. Der künftige Kanzler habe »mit seinen Ministern den Eintritt in die Europäische Union vorzubereiten; er hat tätig zu werden auf dem Gebiet des Marshallplanes«. Zudem werde die Bundesregierung Vertreter in das Ruhrstatut zu entsenden haben, sagte Adenauer. »Vielleicht wird auch an diese Bundesregierung eines Tages die Frage des Abschlusses eines Friedensvertrages herantreten, vielleicht auch die Frage der Stellung Deutschlands zum Atlantikpakt. Auf alle Fälle, meine Freunde, wird diese Bundesregierung sehr wichtig sein für das Verhältnis des deutschen Westens zum deutschen Osten.«
Man musste schon ziemlich tief im Wald stehen, um es zu überhören: Das war die – ganz sicher nicht auf einem Baumstumpf entstandene – To-do-Liste des künftigen Kanzlers.
Die verbleibenden drei Wochen bis zur Wahl waren geprägt von einem harten Schlagabtausch. Vor allem Adenauer und Schumacher schenkten sich nichts. So erfand der SPD-Vorsitzende den »Lüge-
nauer«, um Adenauers in Heidelberg aufgestellte Behauptung zu entkräften, die Sozialdemokraten im Parlamentarischen Rat hätten sich in der lange strittigen Frage der Finanzverfassung der Bundesrepublik nur deshalb so unbeugsam gegenüber den Besatzungsmächten geriert und sich als »nationale Partei par excellence« ausgeben können, weil ihnen durch die Briten bereits ein Nachgeben der Alliierten signalisiert worden sei.
Adenauer wiederum versuchte seinem Publikum einzubläuen, »dass der Sozialismus keinen Damm gegen den Kommunismus bildet«. Komme die SPD an die Macht, drohten Deutschland und Europa »vom kommunistischen Heidentum verschlungen zu werden«. Schumacher, der sich weder in seinem Antikommunismus noch in seiner demagogischen Wortgewalt von Adenauer übertreffen ließ, plakatierte gegen solche Angstparolen einen nicht weniger simplen Slogan: »Alle Millionäre wählen CDU-FDP. Alle übrigen Millionen Deutsche die SPD«.
Bedenkt man, dass Adenauer die Aura eines Mannes umgab, dessen Unterschrift an erster Stelle unter dem Grundgesetz prangte, so hielt sich das Ergebnis der Unionsparteien bei der ersten Bundestagswahl am 14. August 1949 doch in Grenzen: 31 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die CDU/ CSU, die SPD erreichte 29,2 Prozent. Insgesamt zogen die Unionsparteien mit 139, die Sozialdemokraten mit 131 stimmberechtigten Abgeordneten (ohne die Berliner Mandatsträger) in den nagelneuen Bonner Plenarsaal ein. Da die FDP mit 11,9 Prozent nur auf 52 stimmberechtigte Abgeordnete kam, fehlten dem von Adenauer favorisierten »bürgerlichen« Bündnis wenigstens elf Stimmen, um bei 402 Sitzen die Mehrheit zu erlangen. Angesichts dieses engen Ergebnisses und der Dimensionen der anstehenden Aufgaben lag der Gedanke nicht fern, den etliche Granden der Union, namentlich in den Ländern, jetzt teilten: Am förderlichsten für den Wiederaufbau des Landes wäre eine schwarz-rote Koalition.
Das in etwa war die Lage, mit der sich Adenauer am Morgen nach der Wahl konfrontiert sah. Dass er in seinem Bonner Wahlkreis die absolute Mehrheit geholt hatte, war ihm noch am Sonntagabend rapportiert worden. Doch das besagte wenig für die folgenden Tage, die all seine Verhandlungskünste erforderten, um die Idee einer Groko (die damals noch niemand so nannte) aus der Welt zu schaffen.
Immerhin saß der 73-Jährige, nicht zuletzt topografisch, wie die Spinne im Netz. Denn die Ent-

KANZLERSTIMME
Konrad Adenauer am 15. September 1949 bei der Kanzlerwahl im Bundestag. Seine Stimme wird die entscheidende sein
scheidung für Bonn als Bundeshauptstadt (anstelle von Frankfurt) war bereits Mitte Mai im Parlamentarischen Rat gefallen, nicht ohne sein trickreiches Zutun, vor allem aber natürlich ganz nach seinem Geschmack.
Die oft anekdotenreich ausgeschmückte Literatur über den Weg zur aufregenden Erstgeburt einer Bundesregierung konzentriert sich meist auf den 21. August, den glühend heißen ersten Sonntag nach der Wahl, als Adenauer eine handverlesene Unionsrunde in seinem Privathaus versammelte. Diesem später zur »Rhöndorfer Konferenz« stilisierten Treffen waren kaum weniger wichtige Sondierungen vorausgegangen. Zug um Zug entwand Adenauer dabei den Befürwortern einer großen Koalition die Argumente und präsentierte sich selbst als prospektiven Chef eines Dreierbündnisses aus CDU/CSU, FDP und der rechtskonservativen Deutschen Partei, die 17 Mandate errungen hatte – rechnerisch ergab das eine Mehrheit von 208 der 402 Stimmen.
Geradezu legendär wurden die Worte, mit denen er, kaum dass die Rhöndorfer Runde seinen Anspruch auf die Kanzlerschaft akzeptiert hatte, die Frage klärte, wer gewissermaßen unter ihm Bundespräsident werden sollte. Als einer der Gäste Bedenken gegen den freisinnigen Liberalen Theodor Heuss erhob, verband Adenauer seinen später viel kolportierten Hinweis auf Heuss’ fromme Ehefrau mit der Bemerkung: »Es können auch nicht beide, Kanzler und Präsident, katholisch sein.«
Am 12. September 1949 kürte die Bundesversammlung Theodor Heuss im zweiten Wahlgang zum Staatsoberhaupt. Auf dessen Vorschlag wählte der Bundestag drei Tage später Konrad Adenauer mit der erforderlichen absoluten Mehrheit seiner Mitglieder – 202 von 402 – zum Bundeskanzler. Nicht alle Abgeordneten der künftigen Koalition waren bei der Stange geblieben, und so gab es, als Parlamentspräsident Erich Köhler das denkbar knappste Ergebnis von 202 Stimmen verkündete, im Plenum höhnisches »Lachen links«. Womöglich erinnerte sich jetzt nicht nur Adenauer selbst daran, dass es, wie zwei Jahrzehnte zuvor bei seiner Wiederwahl als Oberbürgermeister in Köln, die eigene Stimme war, die ihm die Mehrheit gesichert hatte. Aber hätte er sich enthalten sollen? Und vor allem: Was wäre dann passiert?
Hätte Adenauer am 15. September 1949 die Mehrheit der Stimmen des Bundestages verfehlt, so hätte das Parlament gemäß Artikel 63 Grundgesetz aus
seiner Mitte heraus binnen 14 Tagen mit »mehr als der Hälfte seiner Mitglieder« einen Bundeskanzler wählen können. Wäre das nicht gelungen, so wäre in einem zweiten Wahlgang gewählt gewesen, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt hätte. Allerdings war der Bundespräsident zur Ernennung des Kanzlers nur verpflichtet, wenn dieser mehr als die Hälfte der Stimmen der Mitglieder des Bundestags erhalten hatte; andernfalls konnte – und kann bis heute – der Bundespräsident binnen sieben Tagen die Ernennung verweigern und den Bundestag auflösen. Weil noch ohne FünfProzentHürde gewählt worden war, gehörten dem ersten Bundestag nicht weniger als zehn Parteien und drei unabhängige Abgeordnete an. Insofern hätte die SPD nach einer im ersten Anlauf fehlgeschlagenen Kanzlerwahl natürlich versuchen können, eine Mehrheit für Schumacher zu organisieren; denkbar gewesen wären Gespräche mit dem katholischen Zentrum und der Wirtschaftlichen AufbauVereinigung, vielleicht sogar mit der Bayernpartei. Aber selbst bei einem RundumErfolg solcher Sondierungen wäre das Gegenmodell zu einer »bürgerlichen« Koalition auf lediglich 170 Stimmen gekommen.
Sehr viel wahrscheinlicher wäre es folglich gewesen, dass das ursprünglich geplante Bündnis Adenauer in einem zweiten Anlauf ins Kanzleramt gehievt hätte – es sei denn, nach dessen erster Niederlage hätten sich jene Kräfte in der Union ermannt, denen eine schwarzrote Koalition immer schon lieber gewesen wäre. Für ein Zusammengehen mit den Sozialdemokraten aber hätte Adenauer, allem Machtwillen zum Trotz, wohl nicht zur Verfügung gestanden. Ein beträchtlicher Teil seiner Parteifreunde hätte dann Ausschau nach einem Kandidaten gehalten, den eine ja fast gleich starke SPDFraktion leichter hätte akzeptieren können.
Adenauers Scheitern hätte also mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass es schon in den Anfängen der Bonner Republik eine große Koalition gegeben hätte, wie sie tatsächlich erstmals im Dezember 1966 unter Kurt Georg Kiesinger (CDU) als Kanzler und Willy Brandt (SPD) als Vizekanzler zustande kam. Von einer »Ära Adenauer«, die die ersten fast eineinhalb Jahrzehnte der zweiten deutschen Demokratie so nachdrücklich prägte, fände sich in den Geschichtsbüchern heute keine Spur. Eine zweite Chance, etwa bei der Bundestagswahl 1953, hätte der »Alte aus Rhöndorf« nicht bekommen. Er wäre heute nur noch als einer der Väter des Grundgesetzes in Erinnerung – ohne dass viele zu
sagen wüssten, worin genau sein Beitrag bestand. Denn wichtiger als alle Details waren dem Präsidenten des Parlamentarischen Rats stets die Machtoptionen gewesen, die ein Mann mit seinen Fähigkeiten aus diesem Amt abzuleiten wusste.
Welchen Kurs aber hätte die Bundesrepublik ohne Adenauer eingeschlagen? So direkt und umstandslos wie er hätte wohl kein anderer Kanzler den Weg nach Westen gesucht, sich um dauerhaften Schutz durch die USA bemüht, die Aussöhnung mit Frankreich erstrebt und die Einigung Europas vorangetrieben. Jeder andere hätte wohl sorgfältiger darauf geachtet, die Optionen einer Wiedervereinigung – etwa nach den Stalin-Noten von 1952 – auszuloten.
Gleichwohl erscheint es im Rückblick ziemlich unwahrscheinlich, dass Letzteres im Kalten Krieg zu einem neutralen, souveränen Deutschland in der Mitte Europas hätte führen können. Denn was schon in der zeitgenössischen deutschen Nabelschau oft übersehen wurde und was bei manchen AdenauerKritikern bis heute nachklingt: Aus der Sicht des Westens war die »Westbindung« buchstäblich genau das – keine Entscheidung der Bonner Politik aus völlig freien Stücken, sondern die gebotene feste Bindung der Bundesrepublik an die sicherheitspolitischen Bedürfnisse und die ökonomischen Interessen der westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs.
Das galt im Übrigen auch für die seit 1952 auf Initiative aus Paris vorbereitete und zwei Jahre später letztlich in der französischen Nationalversammlung gescheiterte Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die neben Frankreich und der Bundesrepublik auch die Beneluxstaaten und Italien umfasst hätte. Wer könnte sagen, wie sich die europäische Einigungsbewegung und die nun, zwei Generationen später, von Trump zur Disposition gestellten transatlantischen Beziehungen entwickelt hätten, wäre damals das jetzt wieder ganz ähnlich in Rede stehende Projekt gelungen?
Gedankenspiele über eine erste Bundesregierung ohne Adenauer lassen sich naturgemäß in viele Richtungen hin anstellen, nicht zuletzt mit Blick auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die unter Mitwirkung der Sozialdemokratie vermutlich noch etwas korporativer beziehungsweise fürsorglicher ausgefallen wäre als im Rheinischen Kapitalismus Konrad Adenauers und in der sozialen Marktwirtschaft seines Wirtschaftsministers Ludwig Erhard.
Wie aber hätte sich die politische Kultur der jungen Bundesrepublik unter einem Regierungschef

entwickelt, der nicht Adenauer geheißen hätte? Den autoritären, durch notorische Alleingänge geprägten Führungsstil des »Alten« hätte wohl niemand sonst aus der CDU so praktizieren können. Im Umgang mit der jüngsten Vergangenheit hingegen wäre vermutlich vieles kaum anders gelaufen als unter einem Kanzler, der schon seit 1950 mit dem Vorwurf lebte, mit Hans Globke ausgerechnet den ehemaligen Kommentator der Nürnberger Rassengesetze zu seinem engsten Mitarbeiter und 1953 sogar zum Chef des Bundeskanzleramts gemacht zu haben.
Denn abgesehen von diesem Skandalon, das für den erwiesenen NS-Gegner Adenauer zum Stigma wurde, bewegte sich die Vergangenheitspolitik des Gründungskanzlers gegenüber den vormaligen Funktionseliten der NS-Zeit in einem praktisch von einer Allparteienkoalition getragenen Rahmen. Das galt für zwei generöse Straffreiheitsgesetze und für die »Liquidation« der Entnazifizierung ebenso wie für das 131er-Gesetz zur Versorgung und Wiederverwendung der 1945 entlassenen Beamten, aber auch für das zähe Ringen mit den Alliierten um die Freilassung der einst von diesen verurteilten Kriegsund NS-Verbrecher.
An einem Punkt freilich zeigt sich auch im Umgang mit den Hypotheken des »Dritten Reiches« Adenauers besondere Durchsetzungskraft: Das 1952 mit Israel und der Conference on Jewish Material Claims Against Germany geschlossene Luxemburger Abkommen wäre angesichts der Ablehnung, die dem Gedanken einer »Wiedergutmachung« sogar im Bundeskabinett entgegenprallte, in dieser Form und Höhe wohl nicht zustande gekommen – freilich auch nicht ohne die Zustimmung der sozialdemokratischen Opposition, die der ansonsten stets zur Konfrontation bereite Kanzler dankbar annahm.

NORBERT FREI lehrte Neuere und Neueste Geschichte in Jena. Am 13. Oktober erscheint sein neues Buch »Konrad Adenauer. Kanzler nach der Katastrophe«
EINGESCHWOREN
Am 20. September wird Adenauer von Bundestagspräsident Erich Köhler vereidigt. Der Veloursvorhang im Hintergrund zeigt die Wappen der Bundesländer


Showdown der Supermächte
SCHWERES GESCHÜTZ
Am 28. Oktober 1961 stehen sich amerikanische und sowjetische Panzer (im Hintergrund) an der Sektorengrenze in der Berliner Friedrichstraße gefechtsbereit gegenüber

Die Verteidigung West-Berlins ist der Testfall für die amerikanische Glaubwürdigkeit im Kalten Krieg. Im Oktober 1961 droht die Situation zu eskalieren VON ANDREAS ETGES
Mit ernster Miene saß John F. Kennedy am 25. Juli 1961 um 22 Uhr Ostküstenzeit hinter seinem Schreibtisch im Oval Office im Weißen Haus und blickte in die Kameras. Wie häufiger in seiner Amtszeit, wenn es zu großen innen- oder außenpolitischen Krisen kam, hatte er um Sendezeit gebeten. Der US-Präsident, so kündigten ihn die drei großen Fernsehsender an, werde Vorschläge machen, wie die Vereinigten Staaten auf die Berlin-Krise reagieren sollten. In einer mehr als halbstündigen Rede bezeichnete Kennedy Berlin als »Testfall für den Mut und Willen des Westens«. Ein Angriff auf die Stadt, so warnte er seinen Gegenspieler, den sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow, wäre ein Angriff auf die freie Welt und würde Krieg bedeuten.
Als die DDR am 13. August 1961 die Grenze nach West-Berlin abriegelte und mit dem Bau der Berliner Mauer begann, schien die Kriegsgefahr vorüber, und es herrschte Erleichterung in Washington. Doch nur wenige Wochen später eskalierte die Lage in Berlin. Am 27. und 28. Oktober standen sich amerikanische und sowjetische Panzer am alliierten Kontrollpunkt Checkpoint Charlie unmittelbar gegenüber – 16 Stunden lang und so nah wie sonst nie im Kalten Krieg. Was wäre gewesen, wenn diese Situation außer Kontrolle geraten wäre? Hätte der Konflikt zum Dritten Weltkrieg führen können?
Tatsächlich schlossen beide Supermächte eine militärische Auseinandersetzung um Berlin nicht aus. Sowohl für die USA als auch für die Sowjetunion hatte die geteilte Stadt eine enorme politische und symbolische Bedeutung.
Berlin war, ebenso wie Deutschland, nach dem Krieg in vier Besatzungszonen geteilt worden. Das spätere West-Berlin wurde von den USA, Großbritannien und Frankreich verwaltet, der Ostsektor von der Sowjetunion. Als Reaktion auf die Währungsreform im Westteil der Stadt ordnete der sowjetische Diktator Josef Stalin die Blockade West-Berlins an, die am 24. Juni 1948 begann. Mit einer Luftbrücke gelang es den Amerikanern und Briten, die Westberliner mit Nahrungsmitteln, Kohle und anderen Waren und Gütern zu versorgen. Nach mehr als 300 Tagen endete die Blockade, ohne dass die Sowjetunion ihr Ziel erreicht hatte. Im Gegenteil, mit der Gründung der Bundesrepublik knapp zwei Wochen später, am 23. Mai 1949, gefolgt von der Staatsgründung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober, wurde die politische Spaltung Deutschlands für Jahrzehnte zementiert.
Aus westlicher Sicht galt Stalins Scheitern als wichtiger Erfolg der Eindämmungspolitik, die eine
weitere Expansion des sowjetischen Machtbereichs verhindern sollte. Doch durch die erste Berlin-Krise hatte die geteilte Stadt enorm an strategischer und symbolischer Bedeutung gewonnen. Sie wurde in den Worten des US-Historikers Ernest May zu »America’s Berlin«. Die Verteidigung der Freiheit West-Berlins wurde zu einem Kern der amerikanischen Glaubwürdigkeit im Kalten Krieg, die ja immer in einem doppelten Sinne zu verstehen war: in der glaubwürdigen Abschreckung der Gegenseite sowie in dem festen Vertrauen der eigenen Verbündeten, dass die Vereinigten Staaten im Ernstfall ihre volle militärische Macht zu deren Verteidigung einsetzen würden. Beides sollte 1961 auf die Probe gestellt werden.
Auslöser der zweiten Berlin-Krise war im November 1958 ein Ultimatum von Nikita Chruschtschow. Er verlangte, Berlin den Status einer entmilitarisierten Freien Stadt zu geben, und drohte mit einem separaten Friedensvertrag mit der DDR. Das hätte faktisch das Ende der Präsenz der Westalliierten und ihrer Besatzungsrechte bedeutet.
Auch für den Sowjetchef stand angesichts der immer größeren Probleme eines der engsten Verbündeten die internationale Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Das mitten in der DDR liegende WestBerlin war als Schaufenster der westlichen Konsumgesellschaft und als Propaganda- und Spionagezentrum ein Ärgernis. Noch weit problematischer: Durch das Schlupfloch West-Berlin verließen jedes Jahr Tausende DDR-Bürger ihr Land Richtung Westdeutschland, darunter viele Fachkräfte, Ingenieure und Ärzte. Das schwächte die DDR wirtschaftlich und politisch, und entsprechend erhöhte die SED-Führung den Druck auf die Sowjetunion, eine »Lösung« zu finden.
Der seit dem 20. Januar 1961 regierende Kennedy war vor einer neuen Berlin-Krise gewarnt worden. In der Hoffnung, eine persönliche Beziehung zu Chruschtschow aufzubauen und dadurch nicht nur die Lage in Berlin zu entspannen, hatte der neue US-Präsident dem sowjetischen Parteiführer ein Gipfeltreffen vorgeschlagen. Es fand am 3. und 4. Juni in Wien, der Hauptstadt des neutralen Österreichs, statt – knapp zwei Monate nachdem Kennedy aus Sicht Chruschtschows beim gescheiterten Invasionsversuch in der kubanischen Schweinebucht Schwäche gezeigt hatte. Weder in der Berlin-Frage noch bei anderen Themen fanden die Führer der beiden Supermächte Gemeinsamkeiten. Eisig wurde die Atmosphäre, als Chruschtschow seine Forderungen zu Berlin formulierte und auch vor militärischen Drohungen nicht zurückschreckte. Es könne, so meinte Kennedy, »einen kalten Winter« geben.
Seine Administration versuchte in den folgenden Wochen, den auch in der amerikanischen Presse verbreiteten Eindruck zu widerlegen, der Präsident habe sich von Chruschtschow einschüchtern lassen. Die Sorge war, dass Anzeichen von Schwäche die andere Seite zu riskanten Handlungen verleiten könnten.
Dabei ging es um weit mehr als Berlin oder Deutschland, wie der als Krisenberater hinzugezogene Dean Acheson betonte. Eindringlich warnte der ehemalige US-Außenminister in einem düsteren Bericht an Kennedy am 28. Juni vor jeder Konzession an die Sowjetunion. Alles stehe auf dem Spiel, die ganze Welt und die globale Machtposition der USA.
Kennedy entschied sich mit seiner von Fernsehen und Radio live übertragenen Ansprache an das amerikanische Volk am 25. Juli 1961 zur rhetorischen Offensive. Mehrfach betonte der Präsident das Recht der Vereinigten Staaten auf eine Präsenz in Berlin, das durch Abkommen mit der Sowjetunion immer wieder anerkannt worden sei. Bezüglich der Besatzungsrechte der Alliierten in West-Berlin, des freien Zugangs in diesen Teil der Stadt sowie der Freiheit der Westberliner war er zu keinerlei Kompromissen bereit. Eine Verletzung dieser drei »essentials« durch die Sowjetunion wäre ein Kriegsgrund, warnte der US-Präsident: »Wir können und werden nicht zulassen, dass die Kommunisten uns aus Berlin vertreiben.« In Berlin, so betonte Kennedy, gehe es um das Vertrauen der gesamten freien Welt in die westliche Führungsmacht. Wie ernst diese Worte gemeint waren, unterstrich der Präsident, indem er eine Erhöhung des Verteidigungsetats forderte und weitere Mittel für den Zivilschutz, eine Erhöhung der Truppenstärke und Einberufungen ankündigte.
Kennedys Rede wurde in der Sowjetunion mit Entsetzen aufgenommen. Gegenüber einem amerikanischen Besucher bezeichnete Chruschtschow sie als eine Art Kriegserklärung. Doch Kennedy wusste die amerikanische Öffentlichkeit hinter sich. In Meinungsumfragen sprachen sich 85 Prozent der Befragten für den Verbleib der US-Truppen in West-Berlin aus, selbst wenn dies Krieg bedeute. 67 Prozent befürworteten einen Militäreinsatz, falls die Kommunisten die Zugänge in die Stadt sperren sollten.
In den beiden deutschen Staaten wurde genau registriert, dass Kennedy von West-Berlin gesprochen hatte. Das war zuvor schon der interne Sprachgebrauch gewesen, doch aus dem Munde des USPräsidenten in einer solch wichtigen Rede wurde es als deutliches Signal gelesen: Den Amerikanern ging es nicht um ganz Berlin. Zwar hatte der ostdeutsche Partei- und Staatschef Walter Ulbricht zuvor, am

15. Juni, öffentlich erklärt: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!« Doch nachdem bereits infolge des Wiener Gipfeltreffens mehr Menschen die DDR in Richtung Westen verlassen hatten, erhöhte sich die Zahl nach der Kennedy-Rede noch einmal. Das wiederum vergrößerte den Druck auf die Regierung der DDR, die bereits angedachten Maßnahmen zur Schließung der Sektorengrenze umzusetzen.
Chruschtschow gab dem Drängen schließlich nach, und in den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begannen Angehörige der Volkspolizei, der Nationalen Volksarmee und Mitglieder von Betriebskampfgruppen mit der Abriegelung West-Berlins, indem sie Zufahrtsstraßen nach Ost-Berlin blockierten und den S- und U-Bahn-Verkehr unterbrachen. Der Bau des »antifaschistischen Schutzwalls«, wie die Berliner Mauer offiziell genannt wurde, sollte den eigenen Bürgerinnern und Bürgern den freien Zugang nach West-Berlin und damit in die Bundesrepublik dauerhaft verwehren.
So martialisch und bedrohlich diese »Lösung« wirkte – auf der anderen Seite des Atlantiks herrschte Erleichterung. »Eine Mauer«, so sagte es Kennedy einem seiner persönlichen Berater, sei »verdammt viel besser als ein Krieg«. Chruschtschow hatte keine
FROSTIGE STIMMUNG
In Wien treffen am 4. Juni 1961
US-Präsident John F. Kennedy (l.) und der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow (M.) aufeinander
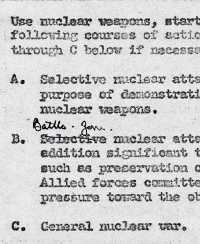
PLANSPIELE
Ein vertrauliches Papier des Militärgeheimdienstes vom 6. Oktober 1961 skizziert, wie die USA reagieren könnten, wenn Krisensituationen – wie bald darauf am Checkpoint Charlie in Berlin – eskalieren. Der letzte Eintrag lautet: »General nuclear war«
militärische Aktion gewagt, die Abschreckung hatte funktioniert, und die amerikanische Glaubwürdigkeit war wiederhergestellt.
Doch der Präsident täuschte sich, wenn er dachte, dies sei das Ende der Berlin-Krise. Denn jetzt gab es plötzlich ein Problem mit den eigenen Verbündeten. Am 16. August titelte die Bild-Zeitung in großen Buchstaben: »Der Westen tut NICHTS! Präsident Kennedy schweigt ...« In den Kommentaren war von Enttäuschung die Rede. Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt ließ den US-Präsidenten in einem wenig diplomatischen Brief wissen, dass seine »Untätigkeit« zu einer schweren Glaubwürdigkeitskrise führen könnte und nun möglicherweise die Westberliner die Stadt in Scharen verließen.
Edward R. Murrow, der Chef der United States Information Agency, der die Abriegelung der Grenze in West-Berlin erlebt hatte, berichtete ebenfalls von einer Desillusionierung der Deutschen und dem Gefühl, von den USA im Stich gelassen worden zu sein. Er plädierte ebenso wenig wie Brandt für eine militärische Antwort; stattdessen schlug er öffentlichkeitswirksame symbolische Schritte vor. Die unternahm Kennedy, indem er wenige Tage später Vizepräsident Lyndon B. Johnson und den Luftbrücken-Helden General Lucius Clay nach WestBerlin schickte, um ein Zeichen amerikanischer Solidarität zu setzen.
Die beiden Amerikaner wurden von Hunderttausenden Westberlinern bei der Fahrt durch die Stadt gefeiert. Und sie konnten am 20. August persönlich 1.500 aus dem westdeutschen Helmstedt nach Berlin beorderte US-Soldaten in der Stadt willkommen heißen. US-Diplomaten sprachen von einem »überwältigenden Erfolg«. Die Moral der Westberliner sei wiederhergestellt und von verzweifelter Stimmung keine Spur mehr.
Damit war bewiesen, dass neben der Freiheit der Westberliner der freie Zugang nach West-Berlin gewährleistet war. Doch Kennedys essential Nummer drei, die Einhaltung der Besatzungsrechte, wurde bald auf die Probe gestellt.
Mitte Oktober verlangten DDR-Grenzsoldaten plötzlich von Amerikanern in Zivil und Uniform, sich bei der Einreise in den Ostteil der Stadt auszuweisen. Das war ein Verstoß gegen geltende Abkommen. Lucius Clay, der als »persönlicher Repräsentant des Präsidenten« in West-Berlin geblieben war, ergriff schnell Gegenmaßnahmen, weil er besorgt war, dass eine amerikanische Akzeptanz dieses Regelbruchs die DDR und die Sowjetunion zu weiteren Verstößen ermuntern würde. Clay ließ im wahrsten Sinne des Wortes schweres Geschütz auffahren: US-
Panzer mit Bulldozerschaufeln übten das Einreißen von Mauern, und zehn Panzer wurden am 25. Oktober zum Checkpoint Charlie beordert.
Am Abend des 27. Oktober fuhr eine ebenso große Zahl sowjetischer Panzer auf der anderen Seite der Grenze auf, die Kanonenrohre auf die USPanzer gerichtet. Der Showdown dauerte bis zum nächsten Vormittag. Es war eine der gefährlichsten Krisen des Kalten Krieges. Schließlich entschärften amerikanische und sowjetische Unterhändler die Situation. Nachdem die sowjetischen Panzer abrückten, verließen kurz darauf auch die US-Panzer den alliierten Kontrollpunkt. Die zweite Berlin-Krise war friedlich beendet worden.
Was wäre gewesen, wenn General Clay nicht so hart reagiert hätte und die rechtswidrigen Kontrollen der DDR-Grenzer hätte durchgehen lassen? Dann, so vermuteten die Amerikaner, wären sie kurz danach erneut auf die Probe gestellt worden. Die Rechte der Westalliierten in Berlin wären zunehmend unterhöhlt worden, und schließlich, so fürchtete man, hätte es auch Versuche gegeben, die anderen beiden von Kennedy aufgestellten essentials infrage zu stellen. Wäre auch hier aus Sorge um eine Eskalation eine US-Reaktion ausgeblieben, hätte Chruschtschow doch noch das 1958 mit dem Ultimatum erstrebte Ziel erreichen können, die Westalliierten aus Berlin zu vertreiben und den Westteil der Stadt dem Staatsgebiet der DDR einzugliedern. In der Logik des Kalten Krieges hätte dies extreme Folgen haben können.
Die Lage in Berlin wurde von beiden Seiten nie isoliert betrachtet, sondern war eng mit der eigenen Position und Glaubwürdigkeit als Supermacht verknüpft. Dazu gehörte auf US-Seite die Prämisse, dass Nachgiebigkeit gegenüber einer aggressiven Macht diese nur zu weiteren Aktionen ermuntern würde, wie die gescheiterte Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler im Münchner Abkommen 1938 gezeigt hatte. Die Sowjetunion sollte an der Ausdehnung ihres Machtbereichs gehindert werden. Und die Dominotheorie der Amerikaner besagte, dass viele weitere Länder folgen könnten, wenn eines fiele. Berlin war für die USA im Sommer und Herbst 1961 der Dominostein, an dem alles hing.
Auch für die Sowjetunion war Berlin damals – zusammen mit Kuba – der entscheidende Schauplatz, auf dem Stärke demonstriert werden musste, um die aus ihrer Sicht imperialistischen Ambitionen des USgeführten Westens einzuhegen.
Für die jeweils notwendige Abschreckung verfügten beide Seiten über Atomwaffen. Was wäre geschehen, wenn die Konfrontation der Panzer am

27. Oktober außer Kontrolle geraten wäre? Wenn vielleicht eine uneindeutige Situation entstanden wäre, ein Missverständnis, das eine der beiden Seiten provoziert hätte, den ersten Schuss auszulösen?
Ein ehemals streng geheimes US-Planungspapier gibt Einblick in das damalige Denken. Das nur zwei Seiten lange Dokument datiert vom 6. Oktober 1961 – wenige Woche nach dem Mauerbau, aber vor dem Showdown der Panzer. Das darin skizzierte Krisenszenario beginnt mit von der DDR und ihrer sowjetischen Schutzmacht verfügten Zugangsbeschränkungen für den Westteil Berlins. Auf eine amerikanische Gegenreaktion folgt eine Eskalation der Gegenseite, die wiederum mit einer weiteren Eskalation beantwortet wird, bis das Ganze von einem kleinen militärischen Konflikt in den Dritten Weltkrieg mündet. Die letzten drei Wörter des Dokuments lauten: »General nuclear war«.
Aber wäre es wirklich zum Atomkrieg gekommen? Damals, so beschrieb es der Historiker John L. Gaddis, mussten sich beide Supermächte die Frage stellen, »ob Berlin es wert sei, einen Atomkrieg zu führen«. Zumindest auf dem Papier beantworteten beide Seiten die Frage mit Ja, eben weil es um viel mehr als Berlin ging. Doch wären sie wirklich so weit gegangen? Zur Beantwortung der Frage hilft ein Blick auf die Kuba-Krise ein Jahr später, die wohl
gefährlichste Zuspitzung des Kalten Krieges, für die Chruschtschow und Kennedy eine Mitverantwortung trugen. Die gegenseitige Korrespondenz, aber auch interne Dokumente sowie Tonbandaufnahmen der geheimen Krisensitzungen im Weißen Haus zeigen, dass Chruschtschow und Kennedy verzweifelt bemüht waren, einen »general nuclear war« zu verhindern. Beide fürchteten die katastrophalen Folgen eines Nuklearkriegs und wollten nicht als diejenigen in die Geschichte eingehen, die für die Zerstörung der Erde verantwortlich waren. Fest entschlossen, die Welt nie mehr so nah an den Abgrund zu bringen, bemühten sich beide nach der Beilegung der Kuba-Krise um Vertrauensbildung und schlossen im Sommer 1963 erste entspannungspolitische Abkommen. Chruschtschows Hoffnung, nach Kennedys erwarteter Wiederwahl im November 1964 mit dem US-Präsidenten noch mehrere Jahre an der Entschärfung des Kalten Krieges zu arbeiten, wurde mit den tödlichen Schüssen auf John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas beendet. Aber das ist ein anderes »Was wäre gewesen, wenn ...«.

ANDREAS ETGES ist Historiker am Amerika-Institut der Ludwig-MaximiliansUniversität München
WARMER EMPFANG
Eine Woche nach dem Bau der Mauer, am 20. August 1961, säumen Hunderttausende Westberliner die Straßen, als US-Vizepräsident Lyndon B. Johnson im offenen Wagen durch die Stadt fährt. Neben ihm lupft der Regierende Bürgermeister Willy Brandt den Hut
BÜRGERLICHER UNGEHORSAM
Trotz Verbots nehmen auch Bundeswehrsoldaten am 22. Oktober 1983 an der Kundgebung gegen den Nato-Doppelbeschluss im Bonner Hofgarten teil
WENDE PUNK T 18.
»Jetzt nur keine Panik«
Beinahe wäre 1983 ein Atomkrieg ausgebrochen. Verhindert hat ihn die Besonnenheit des sowjetischen Offiziers Stanislaw Petrow VON
MICHAEL THUMANN
Olaf Scholz war dabei und Willy Brandt, auch Heinrich Böll, Petra Kelly und Heidemarie WieczorekZeul. Die Gruppen BAP und Zupfgeigenhansel spielten groß auf. Auf den Hofgarten-Demonstrationen von 1981 bis 1983 gegen den Nato-Doppelbeschluss versammelte sich ein Teil der westdeutschen Elite. Künstler, Politikerinnen, Autoren und Musiker demonstrierten gegen die Stationierung von amerikanischen Marschflugkörpern und Raketen als Antwort auf die Mittelstreckenwaffen, die die Sowjetunion zuvor aufgestellt hatte. Sie traten für den Frieden ein und wähnten sich auf der richtigen Seite der Geschichte.
Ausgerechnet der Nato-Doppelbeschluss aber führte wenige Jahre später zum radikalsten Abrüstungsabkommen der Weltgeschichte, dem INF-Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion. Ohne die glaubwürdige Drohung des Westens, als Antwort auf die sowjetischen Raketen gegen Westeuropa selbst Raketen zu stationieren, wäre es nie zu diesem Vertrag gekommen. Diese nur scheinbar paradoxe Wendung einer Nachrüstungsentscheidung hatten die Demonstranten im Bonner Hofgarten nicht vorhergesehen.
Doch zu dieser glücklichen Pointe der Geschichte konnte es nur kommen, weil am 26. September 1983 ein Offizier der Sowjetstreitkräfte intuitiv richtig handelte.
Stanislaw Petrow war der diensthabende Kommandeur in der Raketenfrühwarnstation Serpuchow-15 gut 100 Kilometer südlich von Moskau. Dort liefen Meldungen über einen möglichen Angriff auf die Sowjetunion zusammen, die von hochmodernen Satellitenanlagen ausgingen. In dieser Septembernacht leuchtete um 0.15 Uhr die rote Warnlampe über der elektronischen Weltkarte auf und signalisierte den Start einer amerikanischen Interkontinen-

KÜHLER KOPF
Stanislaw Petrow bewahrt im September 1983 die Ruhe, als das sowjetische Frühwarnsystem einen US-Angriff mit Atomraketen meldet
talrakete. Eine Sirene heulte los, alle sprangen auf. In seiner gläsernen Befehlsstation saß Petrow wie festgefroren. Dann beugte er sich nach vorn, bellte ins Mikrofon und befahl allen, sich sofort wieder hinzusetzen. »Jetzt nur keine Panik«, habe er gedacht – so sagte er später in einem Interview. »Ich wusste, jede Sekunde, die verloren geht, raubt uns wertvolle Zeit zum Reagieren. Die militärische und politische Führung musste unverzüglich informiert werden.«
Vom Abschuss einer Rakete in den USA blieben gut 25 Minuten bis zum Einschlag in der Sowjetunion. Alles, was Petrow jetzt tun musste, war, die Telefonnummer seines Vorgesetzten zu wählen. Er zögerte und war wie gelähmt. »Ich fühlte mich wie in einer heißen Bratpfanne«, sagte er später. Das waren die entscheidenden Minuten einer Nacht, in der das Überleben Europas in der Hand eines einzigen Mannes lag. Der Atomkrieg, den die Demonstranten im Bonner Hofgarten befürchteten, an diesem kalten Septembertag 1983 hätte er ausbrechen können. Die sowjetische Führung war in dieser Zeit ohnehin hochnervös. Durch das Wettrüsten erreichte der Kalte Krieg im Herbst 1983 einen neuen Höhepunkt. An der Spitze der Sowjetunion stand der ehemalige KGBChef Juri Andropow, der den Krieg gegen Afghanistan weiterführte und Westeuropa mit SS-20-Mittelstreckenraketen bedrohte. US-Präsident Ronald Reagan nannte die Sowjetunion das »Reich des Bösen«, die Sowjets verdammten den »imperialistischen Aggressorenstaat USA«.
Das Misstrauen war riesengroß, die Angst vor einem atomaren Erstschlag der anderen Seite noch größer. Wenige Wochen zuvor hatten die Sowjets sofort reagiert, als ein fremdes Flugzeug in den sowjetischen Luftraum eingedrungen war. Abfangjäger stiegen auf und holten die Boeing 747, ein Verkehrsflugzeug der Ko-

rean Airlines auf dem Weg von New York nach Seoul, vom Himmel. Die 269 Menschen an Bord wurden Opfer der sowjetischen Paranoia.
Das sowjetische »Frühwarnsystem für Raketenangriffe«, wie es offiziell hieß, wurde in den Siebzigerjahren entwickelt, Petrow war daran beteiligt. Satelliten wurden in die Umlaufbahn gebracht. Die Kommunistische Partei hatte Eile befohlen, denn die USA waren in dieser Technik weit voraus. 1982 endlich nahm die Armee die Basis Serpuchow-15 bei Moskau in Betrieb. Eine Zwillingsanlage stand im Fernen Osten nahe Komsomolsk am Amur.
Stanislaw Petrow hätte in dieser Nacht seinen kommandierenden Vorgesetzten anrufen können. Er hätte den vom Frühwarnsystem angezeigten Abschuss einer amerikanischen Interkontinentalrakete melden können. Das hätte wahrscheinlich die sowjetische Gegenreaktion ausgelöst –den Abschuss eigener Interkontinentalraketen und die Zerstörung amerikanischer Raketensilos. Die USA hätten auf diese Nuklearraketen mit einem Gegenschlag reagiert, womöglich auch mit Raketen von Schiffen, die in der Nähe der Sowjetunion lagen. Das war die Logik der Abschreckung, die glaubwürdige Drohung, um genau dieses Szenario zu verhindern.
Die Sowjetunion hätte als Antwort darauf Westeuropa angreifen können. Wahrscheinlich hätte sie amerikanische
Basen in der Bundesrepublik Deutschland ins Visier genommen. Die USA hätten sowjetische Stützpunkte in der DDR attackiert. Die Sowjets hätten dann womöglich Bonn, Hamburg, Köln, Frankfurt und München angegriffen. Die atomare Apokalypse, deren schiere Möglichkeit die Demonstranten in den Hofgarten trieb, wäre furchtbare Wirklichkeit geworden.
Doch Stanislaw Petrow entschied sich anders. Er fasste sich, rief seinen Vorgesetzten an und meldete einen Fehlalarm. Petrow misstraute dem satellitenbasierten neuen System, das einen Start anzeigte, der sonst nirgendwo erfasst wurde. Kaum hatte er aufgelegt, meldete das Frühwarnsystem eine weitere Rakete im Anflug auf die Sowjetunion, dann eine dritte, vierte, fünfte. Petrow wusste: »Wenn ich jetzt einen Fehler mache, löse ich den Dritten Weltkrieg aus.« Er griff zum abhörsicheren Telefon, das ihn mit dem Militärkommando verband. Und sagte erneut mit leicht belegter Stimme: »Fehlalarm!«
Petrow lag richtig mit seiner Einschätzung. Erst ein halbes Jahr später konnten Raketenspezialisten feststellen, was genau geschehen war. Eine sehr seltene Konstellation von Wolken und Sonne über einem amerikanischen Raketensilo führten den sowjetischen Satelliten in die Irre. Die Spiegelung sah aus wie ein Raketenstart, der Satellit gab diese Information weiter an die Computer in der Basisstation, und die
schlugen Alarm. Das Überleben der Welt hing an einem technischen Fehler und der fachmännischen Skepsis eines außergewöhnlichen Mannes.
Nach diesem Vorfall, von dem die Welt mehr als ein Jahrzehnt lang nichts erfuhr, begann die Nato als Antwort auf die sowjetischen SS-20-Raketen Mittelstreckenflugkörper zu stationieren und bot Moskau gleichzeitig Abrüstungsgespräche an. Darauf ging die sowjetische Regierung zunächst nicht ein. Erst der 1985 ernannte Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Michail Gorbatschow, erkannte die Chance, die im Nato-Doppelbeschluss lag. Mit US-Präsident Reagan vereinbarte Gorbatschow 1987 die Verschrottung sämtlicher Mittelstreckenwaffen in Europa. Der INF-Vertrag war der erste einer ganzen Serie von Abrüstungs- und Friedensverträgen zwischen den USA und der Sowjetunion. In Europa begann eine historisch einzigartige Phase der Stabilität und des Friedens. Das Prinzip Nachrüstung und Verhandlungsangebot hatte funktioniert. Die Demonstranten im Bonner Hofgarten hatten unrecht. Aber es hatte nicht viel gefehlt, und sie hätten vielleicht doch recht behalten.

MICHAEL THUMANN ist Osteuropa-Korrespondent der ZEIT
W ENDE PUNK T 19.
Unwahrscheinliches Glück
Der 9. Oktober 1989, die Massendemonstration in Leipzig, ist ein Schlüsselmoment der Friedlichen Revolution. Es war nicht zu erwarten, dass die DDR-Führung auf Gewalt verzichtet VON


»WIR SIND DAS VOLK«
Am 9. Oktober 1989 demonstrieren in Leipzig 70.000 Menschen für Reformen in der DDR. Bilder des Massenprotests werden außer Landes geschmuggelt und gehen um die Welt

PRÜGELNDE
STAATSMACHT
Am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der Gründung der DDR, gehen in Ost-Berlin Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstranten vor
Von oben ist alles schwarz, voller Menschen. Sie fluten den Leipziger Ring, es sind kaum Transparente oder Kerzen zu erkennen, aber ein Ruf schallt, unüberhörbar und eindringlich, von den Straßen empor: »Wir sind das Volk!« Am 9. Oktober 1989 sind Aram Radomski und Siegbert Schefke, Ostberliner Oppositionelle, auf den Turm der Reformierten Kirche in Leipzig gestiegen, unerlaubt natürlich, und haben ihre Kamera auf die Szene gerichtet. Mit dem Mut der widerständigen Jugend wollen sie die Menge –70.000 Menschen werden es – von oben filmen. Die Bilder sollen in den Westen geschmuggelt und dort ausgestrahlt werden, als Zeugnis der wachsenden Unzufriedenheit in der DDR.
Minutenlang ziehen die Menschen friedlich über die Straße. Dann, plötzlich, verwackelt die Kamera die Bilder. Aus den Seitenstraßen stürmen bewaffnete Einsatzkräfte, von oben ist nicht genau zu erkennen, welche es sind, Volkspolizei, NVA, Betriebskampfgruppen. Sie treiben die Menge auseinander, kesseln kleine Gruppen ein, Schüsse fallen. Jetzt sind es Schreie der Angst, die nach oben dringen. Dann wird die Kamera ausgeschaltet. Schwarz.

Zum Glück hat es diese Meldung nie gegeben. Der Friedlichen Revolution in der DDR ist ein solches Blutbad erspart geblieben. Die Bilder der Demonstration, die Radomski und Schefke tatsächlich aufnahmen, wurden in den Nachrichten ausgestrahlt und wirkten als Signal, dass Veränderung möglich war. Und dennoch: So kontrafaktisch, wie die imaginierte Szene im Rückblick erscheinen mag, war sie nicht. Tausendfach malten Menschen sich dieses oder ein ähnliches Gewaltszenario aus, weil sie es für wahrscheinlich hielten. Wie ein Lauffeuer hatten sich vor dem 9. Oktober in der DDR Gerüchte ausgebreitet: Zusätzliche Betten würden in Leipziger Krankenhäusern aufgebaut, Blutkonserven vorgehalten. Karin Hattenbach, Angehörige der Leipziger Opposition und erst wenige Tage zuvor »zugeführt«, also festgenommen, erzählte später, dass sie das Donnern der Rufe und der Schritte der Demonstranten im Gefängnis gehört und sofort gedacht habe, jetzt würden Panzer gegen die Menge eingesetzt.
Es war also durchaus anzunehmen, dass die Demonstration gewaltsam auseinandergetrieben würde. Warum sollte es anders laufen als zwei Tage zuvor?
Am nächsten Tag sind die Bilder, die die beiden Aktivisten aufgenommen haben, in der westdeutschen Tagesschau zu sehen. Der Nachrichtensprecher bilanziert den tödlichen Abend: »Die bislang größte Montagsdemonstration in Leipzig ist durch bewaffnete Einsatzkräfte niedergeschlagen worden. Am Hauptbahnhof wurden Wasserwerfer und Panzer eingesetzt. Mehrere Demonstranten starben, viele Dutzend sind verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Der Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker, hat den gewaltsamen Einsatz gegen die vermeintlich aus dem Westen gesteuerten ›Rowdys‹ und ›Provokateure‹ verteidigt.«
Die Proteste am 7. Oktober in Berlin, als das SEDRegime sich zum 40. Republikgeburtstag gratulierte, waren brutal niedergeknüppelt worden. Nichts anderes war für Leipzig geplant.
Wenn kontrafaktisches Denken mit Dan Diner bedeutet, sich am Geländer des Geschehens vorzutasten, um in den Raum des Möglichen zu schauen, dann ist die ausgemalte Szene eine sogar wahrscheinliche Option der Vergangenheit, die auf erleichternde Weise unrealisiert geblieben ist.
Vor dem glücklichen 9. November steht also der 9. Oktober 1989 – eine Zäsur, die schließlich zum Kipppunkt in die Gewaltlosigkeit wurde. So lautet das Urteil der Geschichtswissenschaft: Ilko-Sascha Kowalczuk spricht in seiner großen Erzählung der Friedlichen Revolution von einem »Tag der Entscheidung«, Martin Sabrow von einer »Peripetie«, also einem Umschlagpunkt.
Anfang Oktober war die Zahl der Menschen, die in Leipzig nach den Friedensgebeten in der Nikolaikirche auf die Straße gingen, schnell in die Zehntausende gestiegen; der Protest wurde systembedroh-
lich. Honecker vertrat unnachgiebig eine harte Linie, noch Ende September hatte er verfügt, dass »diese feindlichen Aktionen im Keime erstickt werden« müssten. Ein Maßnahmenplan für Leipzig sah den Einsatz von Gewalt vor, Sicherheitskräfte wurden in der Stadt zusammengezogen.
Bei der Bürgerrechtsbewegung stand über allem die Angst vor einer »chinesischen Lösung«, einem Massaker, wie es sich im Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking ereignet hatte. Hier war die studentische Protestbewegung mit Panzergewalt zerschlagen worden. »China ist nicht fern!« stand auf einem Handzettel, der kurz nach dem Massaker von der Ostberliner Bürgerrechtsbewegung verteilt worden war. Mochte der »Platz des Himmlischen Friedens« auch Tausende Kilometer entfernt sein von den Straßen in Prenzlauer Berg, wo die Bürgerrechtsbewegung eines ihrer Zentren hatte: Die Gewalt in China rückte den Menschen trotzdem auf den Leib, wurde zu einer realen Gefahr vor der eigenen Haustür.
Was sind die Gründe dafür, dass ein Massaker wie am Tiananmen-Platz ausblieb, sodass wir heute von einer Friedlichen Revolution sprechen können?
Oder, andersherum gefragt: War es nicht eigentlich sehr wahrscheinlich, dass Panzer auffahren würden angesichts stets blutiger Antworten auf Aufstandsversuche im Ostblock: 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei? Und dann 1989 in China? Wäre Gewalt nicht das logische Folgeglied in dieser historischen Kette realsozialistischer Machtsicherung gewesen?
Mochten die Bilder der rollenden Panzer sich ähneln, die Zeiten hatten sich geändert. 1989 war der »Ostblock« kein geschlossener Komplex mehr, sondern eine geöffnete Einheit. Das Bündnis realsozialistischer Staaten, angeführt von der Sowjetunion, war an mehreren Stellen perforiert und an neuralgischen Punkten aufgebrochen. Auflösungserscheinungen waren nicht zuletzt in Moskau selbst zu beobachten, wo 1985 ein vergleichsweise junger Mann den Posten des Generalsekretärs der KPdSU übernahm: Michail Gorbatschow, der eine neue Offenheit und Bereitschaft zum Umbau des Staatssozialismus personifizierte. Für die Reformer aller Länder war er das Vorbild; einer, auf den sich der Protest berief.
In Polen hatte der Reformprozess schon zu Beginn des Jahrzehnts eingesetzt. 1980 streikte die oppositionelle Gewerkschaft Solidarność gegen die kommunistische Staatspartei. Im folgenden Jahr wurde das Kriegsrecht verhängt, Solidarność verboten und erst 1989 wieder zugelassen. Im Frühjahr 1989 tagte der erste »Runde Tisch«; am 4. Juni, zeit-
gleich mit dem Tiananmen-Massaker, kam es in Polen zu ersten freien Wahlen. Auch in Ungarn dynamisierte sich die Lage, nachdem der Parteiführer János Kádár 1988 abgesetzt worden war. Seit Juni 1989 wurden die Grenzanlagen zu Österreich abgebaut; ein Loch, das Flüchtlinge aus der DDR zum Transit in die Bundesrepublik nutzten.
Politisch näher als Polen und Ungarn lag dem SED-Regime das ferne China. Das Land hatte einen anderen Weg zwischen Veränderung und Dogma gewählt: Zwar reformierte die Staatspartei seit Ende der Siebzigerjahre die sozialistische Wirtschaftsordnung in Richtung Marktwirtschaft, unterband demokratische Systemopposition aber mit allen Mitteln – eine Unnachgiebigkeit, die auf die Führungsriege der SED Eindruck machte.
Im Konzert realsozialistischer Mächte verschloss sich die DDR politischen Reformen auf fast halsstarrige Weise. Für viele aus der buchstäblich alten Garde, die in der Staatspartei noch am Ruder war, bedeutete Reform »Konterrevolution«. Zudem hätte eine innere Öffnung in der besonderen Lage des geteilten Deutschlands wohl auch die Öffnung nach Westen befördert. In Anbetracht der nach oben schnellenden Ausreisezahlen, die 1988 einen Höhepunkt erreichten, war dies keine Option. Zwar intensivierten sich auf allen Ebenen die Beziehungen mit der Bundesrepublik – vom Spitzentreffen zwischen Honecker und Kohl 1987 über Wissenschaftsnetzwerke bis hin zu Städtepartnerschaften. Ideologisch aber machte man keine Zugeständnisse.
Im Gegenteil: Die DDR wurde als souveräner Staat vorgeführt, auch bei Gelegenheit des 40. Jahrestags 1989. Führende Repräsentanten gaben, vermutlich sehr bewusst, Statements ab, die glauben machen sollten, der staatgewordene Sozialismus namens DDR werde ewig bestehen. Besonders blieb im Kopf, was Kurt Hager im westdeutschen stern zu Protokoll gab, wohl auch wegen der seltsamen Metaphorik, die große Weltgeschichte mit dem kleinen Alltag verband: »Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?« Eingängige Verlautbarungen wie diese waren darauf angelegt, kolportiert zu werden.
Chinas Gewalteinsatz diente dem SED-Regime als Drohszenario. Als sich die Lage in Osteuropa zuspitzte und die Opposition im eigenen Land die gefälschten Kommunalwahlen im Mai 1989 zum Anlass für immer lauteren Protest nahm, solidarisierten sich die Spitzen der Partei auf entlarvende Weise mit den chinesischen Genossen.

APPELL AN DAS REGIME
Auf ihren Transparenten fordern die Menschen am 9. Oktober 1989 in Leipzig, keine Gewalt anzuwenden

MENETEKEL
Bürgerrechtler fürchten, es könnte auch in der DDR zu einem Massaker kommen wie am 3. und 4. Juni 1989 nahe dem Tiananmen-Platz in Peking (Bild rechts). Auf einem Handzettel (oben) warnen sie vor der Gefahr
Nach der Gewalt auf dem Tiananmen-Platz im Juni kam es zum Schulterschluss. Am 8. Juni stellte die Volkskammer sich mit einer Erklärung hinter das Vorgehen Pekings gegen die »Konterrevolutionäre«, am 10. Juni wurde es bei einem Außenministertreffen gerechtfertigt. Immer öfter war nun zu hören, der Sozialismus müsse verteidigt werden, nötigenfalls, so Margot Honecker, mit der Waffe in der Hand. Zudem reisten SED-Politiker nach China, zuletzt eine Delegation unter Egon Krenz anlässlich des am 1. Oktober fast parallel begangenen 40. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik.
Die Kontakte mit dem kommunistischen Regime in Fernost wurden sichtbar enger geknüpft. Darum spielt China in der Geschichte der Friedlichen Revolution eine wichtige, zu wenig beachtete Rolle. Vermutlich ist die Orientierung am »Bruderstaat« in Peking kein hinreichender Grund, aber doch ein Element in einem Bündel aus vielen Faktoren, die erklären, warum die Proteste in den ersten Oktobertagen zunächst ebenfalls mit aller Härte unterbunden wurden. Gewalt war im Herbst 89 eben nicht nur ein kontrafaktisches Gedankenspiel, sondern eine reale Möglichkeit, von der Gebrauch gemacht wurde.
Am 4. Oktober kulminierte die Staatsgewalt gegen Ausreisewillige am Dresdner Hauptbahnhof. Etwa 20.000 Menschen hatten sich versammelt, um
einen aus Prag nach Bayern fahrenden Zug zu kapern, in dem Botschaftsflüchtlinge saßen, denen in Dresden die Pässe abgenommen werden sollten. Die Eindringlinge randalierten, riefen »Freiheit« und »Wir wollen raus«, während die Volkspolizei sie mit einem Wasserschlauch abwehrte, wie Bilder der Staatssicherheit dokumentieren. Mehr als tausend Menschen wurden verhaftet, mit Beschimpfungen überzogen, teilweise misshandelt. Es war einer der größten staatlichen Gewaltexzesse seit dem 17. Juni 1953. Beim 40. Republikgeburtstag am 7. Oktober war das Vorgehen der Einsatzkräfte ebenfalls unmissverständlich. Unweit der repräsentativ-biederen Veranstaltung im Palast der Republik demonstrierte der untergehende Staat seine Macht, mit demselben Set von »Zuführungen«, Erniedrigungen und Misshandlungen. Die gänzlich derealisierte Sicht der Dinge – der lachende, Hände schüttelnde Erich Honecker – und die brutale Wirklichkeit der Gewalt in einem politischen System am Abgrund kamen sich in Berlin seltsam nahe.
Nach Lage der Dinge war der Gewalteinsatz also auch zwei Tage später in Leipzig das Mittel der Wahl. Wäre es so gekommen, die zahlenmäßig kleine Bürgerrechtsbewegung wäre existenziell geschwächt gewesen und das SED-Regime wohl noch etwas länger

am Leben geblieben. Vielleicht hätte sich der Protest gegen das System dann radikalisiert, vielleicht sogar von rechts. Denn neben der Bürgerrechtsbewegung, die für Demokratie oder für dritte Wege zwischen Demokratie und Sozialismus stand, hatte sich eine extrem rechte Subkultur entwickelt, die in den Achtzigerjahren immer sichtbarer wurde. Vermutlich wäre die DDR trotzdem in absehbarer Zeit untergegangen, auch weil die Ausreisewellen sich kaum noch gewaltsam eindämmen ließen, aber der Untergang wäre politisch in anderen Bahnen verlaufen.
Am Ende setzte sich nicht der Waffeneinsatz durch, sondern der Gewaltverzicht. Für diese nicht erwartbare Entwicklung – die Einsatzkräfte zogen sich zurück, statt einzuschreiten – gibt es zahlreiche Erklärungen. Sie betonen den Zufall, situative Konstellationen oder längerfristige Faktoren; vielleicht müssen sie, um das radikal Unvermutete zu erklären, auch alle zusammengedacht werden.
Eine besonders gute Pointe, die gleichwohl zu kurz greift, hebt ein kontingentes Detail hervor: Als die Leipziger Bezirksleitung sich in Ost-Berlin rückversichern wollte, wie vorzugehen sei, war der erste Befürworter der harten Linie, Erich Honecker, nicht zu erreichen. Angeblich war er mit der für den Republikgeburtstag angereisten chinesischen Delegation unterwegs. Als Egon Krenz zu spät zurückrief, hatte die Leipziger Bezirksleitung ihren Ermessensspielraum genutzt und Gewaltlosigkeit angeordnet.
Andere Erklärungen verweisen auf die schnelle Auflösung anderer Staatssozialismen. Gleichwohl gab es Länder, die auf Gewalt beharrten, man denke an Ceaușescus Rumänien. In der DDR spielte zudem eine wichtige Rolle, dass Bilder der Gewalt, auch die vom Leipziger Kirchturm, sofort im bundesdeutschen Fernsehen zu sehen gewesen wären.
Besonders hervorzuheben ist das Handeln der Bürgerrechtsbewegung und auch der weiteren Bevölkerung, das zwischen spontaner Reaktion und wohldurchdachter Strategie changierte. Schon der Handzettel mit seiner Botschaft »China ist nicht fern« belegt, wie intensiv sich die Opposition mit der Möglichkeit der Gewalt auseinandersetzte. Die Menschen hatten die Botschaft verstanden, die das SEDRegime mit seiner ostentativen China-Solidarität sendete. Allerdings antworteten sie auf die Drohungen nicht mit Rückzug, sondern integrierten den Appell zum Gewaltverzicht in ihre Protestchoreografien. »Keine Gewalt!« Das wurde gerufen und, neben Demokratie und Freiheit, auf Transparenten gefordert. Weiße Kerzen symbolisierten die Bereitschaft zum »friedlichen Dialog«. Symbole des Gewaltver-
zichts waren allgegenwärtig; eine kreative Aneignung der zeitgenössischen Friedenspropaganda des Regimes gegen das Regime.
Damit sollte der »Volkspolizei« jegliche Rechtfertigung für den Waffeneinsatz genommen werden. Vonseiten des Regimes hieß es, bei den Demonstranten handle es sich um »Konterrevolutionäre« oder »Rowdys«, vom Westen gesteuert; Gruppen, die nicht zum »Volk« gehörten. Der zentrale Slogan der Revolution war zunächst kein Aufschrei des demokratischen Demos, sondern die Forderung nach Gewaltverzicht, gelegentlich in dieser Kombination gerufen: »Wir sind keine Rowdys, wir sind das Volk!« Der Slogan fungierte als subtile Einladung an die Sicherheitskräfte, sich anzuschließen, oder mindestens als Aufforderung, nicht zu den Waffen zu greifen.
Selbst der Spruch »Wir sind ein Volk«, heute meist als Forderung nach deutscher Einheit verstanden, war zunächst ein Dialogstück in dieser Auseinandersetzung. Gesperrt gesetzt, stand er im Zentrum des »Appells zur Gewaltlosigkeit«, den die Opposition am 9. Oktober in Leipzig kursieren ließ. Er rief beide Seiten, Demonstranten wie Einsatzkräfte, zum Gewaltverzicht auf – mit diesem Hinweis: »Wir sind ein Volk!« Gewalt gegeneinander sollte durch Solidarität miteinander ersetzt werden.
Vielleicht waren Einsatzkräfte, die selbst keine Loyalität mit dem System mehr verspürten, offen für diese Appelle. Es war – neben der schieren Erschöpfung des Regimes – diese Forderung nach Gewaltverzicht, die den friedlichen Herbst 89 erklären hilft.
Das gute Ende ist aber nicht der richtige Schluss. Denn die Zäsur von 1989/90 symbolisiert eben nicht nur ein friedlich-demokratisches »Ende der Geschichte«. Gewalt begleitete Mauerfall und Einheit und prägte die Neunzigerjahre. Sie resultierte nicht zuletzt aus einem ethnischen Verständnis vom »Volk«. Antisemitische, antiziganistische, rassistische Gewalt – in Ost und West schon in den Achtzigern verbreitet –brach sich Bahn und eskalierte: nicht nur in Rostock oder Solingen, sondern in unzähligen Städten. In Osteuropa kehrte der Nationalismus zurück und mit ihm die Gewalt, wie im auseinanderbrechenden Jugoslawien. Die Friedliche Revolution leitete nicht nur den Aufbruch in die Demokratie ein, sondern auch eine Phase rechter Gewalt und eine Zeit des Nationalismus, die bis in die Gegenwart führt.

FRANKA MAUBACH lehrt Geschichte an der Universität Bielefeld
WEITERLESEN
Ilko-Sascha Kowalczuk: »Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR« C. H. Beck Verlag, München 2015
WENDE PUNK T 20.
Grenze offen, Grenze dicht

BILD MIT ANZIEHUNGSKRAFT
Angela Merkel lächelt am 10. September 2015 mit dem irakischen Flüchtling Shaker Kedida in die Kamera. Das Selfie wird zu einer Ikone der Willkommenskultur
Vor zehn Jahren machen sich immer mehr Flüchtlinge aus den Krisenregionen des Nahen und Mittleren Ostens auf den Weg in die Europäische Union. Was wäre geschehen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutschen Grenzen geschlossen hätte? Zwei Perspektiven auf den September 2015

GEWALT AM GRENZÜBERGANG
Am 16. September 2015 hindert die ungarische Polizei Flüchtlinge in Horgoš an der Einreise aus Serbien. In Deutschland ist die Furcht groß, solche Bilder könnten auch an der eigenen Grenze entstehen
Tiefe
Entfremdung
VON HEINRICH WEFING
Bei 30 Grad Hitze machen sich am Mittag des 4. September 2015 etwa 2.000 Menschen vom Keleti-Bahnhof Budapest aus, wo sie teils tagelang festgesessen haben, auf den Weg nach Deutschland. Junge Männer vor allem, aber auch Frauen und Kinder und Alte. Sie marschieren durch die Innenstadt, Richtung Autobahn, und dann über die M 1, ihr Ziel ist die österreichische Grenze. Es ist ein Marsch von historischer Bedeutung, ein Moment, in dem sich Flüchtlinge in politische Akteure verwandeln. Und ein Moment, der die europäische Geschichte in ein Vorher und ein Nachher teilt.
Am späten Nachmittag versucht eine Hundertschaft der ungarischen Polizei, den Flüchtlingstreck zu stoppen, die Menge wenigstens von der Autobahn abzudrängen. Aber die Menschen lassen sich nicht aufhalten, überrennen die Polizeiketten. Sie wollen nach Deutschland – und sie zwingen Angela Merkel dazu, am späten Abend, nach endlosen Telefonaten, nach einem Arbeitstag, der da schon 16 Stunden zählt, die vielleicht folgenreichste Entscheidung ihrer Amtszeit zu treffen. Soll sie, gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann, den Flüchtlingen, die noch in der Nacht am Grenzübergang Nickelsdorf erwartet werden, die Einreise nach Österreich und die Weiterfahrt mit Zügen nach München gestatten? Oder nicht?
Wie sich Merkel entschieden hat, steht längst in den Geschichtsbüchern. Aber was, wenn sie Hilfe abgelehnt hätte, wenn sie sich geweigert hätte, den Flüchtlingen den Weg nach Deutschland zu öffnen?
Es ist nicht leicht zu sagen, ob sich die Grenze überhaupt hätte schließen lassen in jener Nacht. Die ungarische Polizei hatte es vergeblich versucht, aber es war bestenfalls ein halbherziger Versuch. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán war
wohl nicht unglücklich, das Flüchtlingsproblem am Hauptbahnhof von Budapest loszuwerden, er ließ schließlich sogar Busse organisieren, um die Marschierenden an die österreichische Grenze zu bringen. Die österreichische Polizei hätte härter durchgreifen müssen, und die Bilder von der Grenze wären um die Welt gegangen. Hässliche Bilder: Polizeiketten gegen müde Migranten, manche nur in Flipflops, einige im Rollstuhl. Vielleicht wäre es zu Zusammenstößen gekommen, Polizeiknüppel, Tränengas, Verletzte. Womöglich Schlimmeres.
Nichts fürchtete die Kanzlerin mehr, das war später wieder und wieder aus ihrem Umfeld zu hören, als solche Bilder. Die Aufnahmen von den erbärmlichen Zuständen in dem Flüchtlingscamp in Calais, hatte Merkel einmal gesagt, könne Deutschland keine drei Tage ertragen. Wie viel verheerender hätten dann Bilder gewirkt, auf denen Flüchtlinge niedergedroschen werden, die nach Österreich und Deutschland wollen? Bilder von Blut, Verletzten, womöglich von Toten?

Merkel und der österreichische Bundeskanzler Faymann wären für das Dichtmachen der Grenze heftig attackiert worden, ihnen wäre Hartherzigkeit vorgeworfen worden, Brutalität, moralisches Versagen. Wieder und wieder hätte man Merkel ihr Wort »Wir schaffen das!« aus dem August 2015 um die Ohren gehauen, hätte sie mit Orbán verglichen oder gleich mit dem syrischen Diktator Assad. Man kann sich die Schlagzeilen ausmalen, nach oben offen auf der Empörungsskala: »Das Blut dieser Menschen klebt an Merkels Händen ...!«
HEINRICH WEFING leitet das Politik-Ressort der ZEIT
Aber, das darf man wohl annehmen, so gut wie alle Regierungen in Europa hätten sich auf Merkels Entscheidung berufen, hätten – viel früher, als es dann tatsächlich geschah – ihre Grenzen geschlossen und Migranten mit Gewalt an der Einreise ge-
Ein Wort
zu wenig
VON ANDREAS RÖDDER
Ein Wort hätte genügt. Oder auch zwei: »Ja«, oder »In Ordnung«. Stattdessen: nichts. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nichts. Und ihr Innenminister Thomas de Maizière, der nach ihrer Zustimmung fragte, Asylmigranten an der deutschen Grenze zurückzuweisen, tat nichts. Am Sonntag, dem 13. September 2015, wurde nicht entschieden. Nicht zu entscheiden, war die zentrale Entscheidung in der Migrationskrise des Jahres 2015 – mit langfristigen und tiefgreifenden Folgen für Deutschland und Europa.
Die Migrationskrise von 2015/16, während der etwa zwei Millionen Menschen in die EU gelangten, hatte sich im Sommer 2015 akut aufgebaut, vor allem im Gefolge des Bürgerkriegs in Syrien, aber auch von Kriegen und Krisen in Afghanistan, dem Irak und in verschiedenen afrikanischen Staaten. Die Flüchtlinge strebten entweder auf gefährlichen Routen über das Mittelmeer oder auf dem Landweg über den westlichen Balkan nach Europa.
Angela Merkel trat in diesen Fragen zunächst kaum in Erscheinung. In die Schlagzeilen gerät sie eher durch Zufall, als ein palästinensisches Mädchen sie bei einem »Bürgerdialog« im Juli 2015 mit seiner Angst konfrontiert, Deutschland verlassen zu müssen, und dabei in Tränen ausbricht. Dass Merkel auf das Mädchen zugeht und ihm zugleich sagt, dass nicht alle kommen und bleiben können, trägt ihr den Vorwurf der Gefühlskälte ein.
Dass Bilder eine entscheidende politische Rolle spielen, wird wenige Wochen später deutlich, als das Foto eines toten kleinen Jungen um die Welt geht, der auf dem Mittelmeer zu Tode gekommen und am Strand angespült worden ist.
Die Verlegenheiten in Europa über humanitäre Katastrophen auf den Fluchtrouten mehren sich, als am 4. September 2015 in Budapest angelangte Flüchtlinge zu Fuß nach Österreich und Deutschland aufbrechen. Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann und Angela Merkel beschließen, ihnen die Einreise ohne Grenzkontrolle zu gestatten. Es ist eine humanitäre Geste – auch wenn schon hier die Einschränkung gilt, dass eine ungarische ErstaufnahmeEinrichtung durchaus bereitstand, die Flüchtlinge aber stattdessen vor dem Bahnhof Keleti kampierten und damit eine humanitäre Krise suggerierten.
Deklariert wird die Entscheidung des 4. September als Ausnahme. Anders verhält es sich mit dem 13. September, der zum entscheidenden Datum der Krise von 2015 wird. Auch wenn Angela Merkel in ihren Erinnerungen hartnäckig auf den 4. September verweist: Er war nicht das Problem. Erst am 13. September stellte sich die Frage: Wie soll Deutschland auf Dauer mit der hohen Zahl von ankommenden Flüchtlingen umgehen?

ANDREAS RÖDDER
lehrt
Das grundlegende Problem liegt darin, dass sich deutsches Verfassungsrecht, europäische Regelungen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) dysfunktional überlagern und gegenseitig blockieren. Artikel 16a des Grundgesetzes besagt, dass der Anspruch auf Asyl nicht für Personen gilt, die aus sicheren Drittstaaten kommen – was für alle deutschen Nachbarstaaten und damit für alle Asylmigranten auf dem Landweg an den deutschen Außengrenzen gilt.
Neueste Geschichte in Mainz
Die europäische DublinVerordnung sieht ohnehin vor, dass Asylverfahren im Land der
HEINRICH WEFING
hindert. Was hätte das mit Europa gemacht, mit dem Selbstverständnis der EU, mit ihrem inneren Wertesystem?
Schwer zu sagen ist auch, was in der Nacht mit den Flüchtlingen an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich geschehen wäre, wenn sie aufgehalten worden wären. Sie hätten im Nieselregen kampieren müssen, einige hätten vermutlich versucht, sich über die grüne Grenze durchzuschlagen, über Wiesen und durch Wälder, spätestens am nächsten Morgen wären Hilfsorganisationen gekommen, Suppenküchen, erste Zelte. Womöglich bald auch Demonstranten, die gegen das harte Durchgreifen protestiert hätten.
Was es nicht gegeben hätte, wenn die Bundesregierungen in Wien und Berlin die Grenzen geschlossen hätten: die Willkommensszenen am Münchner Hauptbahnhof, klatschende Menschen, Berge von Kuscheltieren, Ersthelfer zwischen Euphorie und Erschöpfung.
Aber eben auch keine Bilder von dieser »Willkommenskultur«. Bilder, die signalisierten, Deutschland nehme Flüchtlinge auf, nicht bloß widerwillig, sondern mit offenen Armen, anfangs sogar ohne jede Kontrolle. Bilder, die wie eine Einladung wirken mussten. Und tatsächlich so wirkten.
Allein am Wochenende um den 4. September 2015 kamen geschätzt etwa 15.000 Menschen in Deutschland an, am darauffolgenden Wochenende fast 20.000 und dann bis zu 13.000 täglich, bis Jahresende etwa eine Million. Was als »Ausnahme« bezeichnet worden war, wurde zur Regel. Erst im Dezember, das musste auch das Kanzleramt später einräumen, hat der Staat die Steuerungsfähigkeit zurückgewonnen.
Hätte Merkel in jener Nacht anders entschieden, der Pfropfen wäre in der Flasche geblieben.
Das heißt auch: Es hätte wohl nicht das Gefühl des Kontrollverlustes gegeben, das viele Menschen tief verstörte, es wäre vielleicht auch nicht der Eindruck entstanden, die Migration sei die »Mutter aller Probleme«, den Rechtspopulisten bis heute bewirtschaften.
Wäre der Bundesrepublik auch der Aufstieg der AfD erspart geblieben? Wahrscheinlich nicht. Rechtspopulistische Parteien gibt es in praktisch allen Demokratien des Westens, ihr Erfolg hat zahllose Ursachen. Aber Merkels Entscheidung dürfte der AfD enorm geholfen haben. Im Sommer 2015 war Mitgründer Bernd Lucke aus der Partei ausgetreten, im Juni 2015 war die AfD nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDFPolitbarometer zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder unter die Fünfprozenthürde gesunken.

Da kam Merkels Politik der offen gehaltenen Grenzen fast wie ein »Geschenk für uns«, wie Alexander Gauland, damals Vize-Bundessprecher der AfD, heute deren Ehrenvorsitzender, einmal sagte: »Natürlich verdanken wir unseren Wiederaufstieg in erster Linie der Flüchtlingskrise.«
Bei der Bundestagswahl im September 2017, zwei Jahre nach Merkels Entscheidung, verlor die Union fast neun Prozentpunkte, kam nur noch auf 32,9 Prozent. Die AfD hingegen holte 12,6 Prozent und schaffte zum ersten Mal den Einzug in den Bundestag, gleich als drittstärkste Partei.
Am frühen Morgen des 5. September hat der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer die Bundeskanzlerin aus seinem Ferienhaus in Schamhaupten bei Ingolstadt angerufen, das haben Journalisten, auch der ZEIT, später recherchiert. Die Kanzlerin erklärte Seehofer, sie habe in Absprache mit Faymann entschieden, den Flüchtlingen aus Ungarn die Einreise nach Deutschland zu gestatten, es sei eine humanitäre Ausnahmeentscheidung gewesen. Seehofer antwortete: »Angela, das wird problematisch, wir werden den Pfropfen nicht mehr zurück in die Flasche bekommen.«
Vielleicht hätte Merkel auch bei einer Grenzschließung Zustimmung verloren, vor allem bei liberalen Wählerinnen und Wählern in der Mitte, aber deren Stimmen wären nicht zur AfD gewandert, sondern eher zu den Grünen oder zu den Linken. Die tiefe Entfremdung zwischen Merkel und den konservativeren Teilen ihrer Partei und deren Wählern hätte es kaum gegeben. Der explizite Hass auf die Kanzlerin und die »Merkel muss weg!«-Slogans (die es schon vorher gegeben hatte, die aber immer heftiger wurden) wären ihr erspart geblieben.
Und Deutschland wäre, das darf man wohl annehmen, der erste massive Polarisierungsschub erspart geblieben, der die lange konsensorientierte Gesellschaft erschütterte und der bis heute nachwirkt.
ANDREAS RÖDDER
Ersteinreise vorzunehmen sind, also faktisch nicht in Deutschland. Allerdings kennt sie das Instrument der Zuständigkeitsbestimmung: Erst muss die Zuständigkeit geprüft werden, bevor zurückgeschickt werden kann – was die Einreise voraussetzt. Hinzu kommt, dass der EGMR aus humanitären Gründen die Rücküberstellung nach Griechenland untersagt hat.
So stellt sich die Frage, ob das europäische Recht im traditionell europafreundlichen Deutschland auch dann Vorrang genießt, wenn es offenkundig nicht funktioniert – oder ob Deutschland in diesem Fall auf nationaler Ebene gegen europäische Regelungen handeln muss. Am 13. September ist jedenfalls der Einsatzbefehl einschließlich der Zurückweisungen an den Grenzen im Bundesinnenministerium vorbereitet. Um sich rückzuversichern, ruft Minister de Maizière an diesem Sonntagnachmittag mehrfach die Bundeskanzlerin an. Merkel äußert Bedenken und entscheidet nicht, ebenso wenig der zuständige Minister. Zwar werden Grenzkontrollen eingeführt, aber ohne Zurückweisungen. Das heißt: Wer Asyl sagt, kommt herein, auch aus einem sicheren Drittstaat oder Herkunftsland – und muss, wie die Praxis zeigt, kaum je wieder hinaus.
Die Ausnahme wird am 13. September zum dauerhaften Ausnahmezustand, für mehr als sechs Monate, bis zum Abkommen mit der Türkei am 18. März 2016.
Die Alternative hätte darin gelegen, zu erkennen, dass die europäische Regelung faktisch außer Kraft gesetzt und die Annahme ihrer Gültigkeit »denklogisch Unsinn« ist, wie es der parlamentarische Staatssekretär Ole Schröder formuliert. Die Konsequenz wäre gewesen, nach der humanitären Ausnahme des 4. September vom 13. September an den verfassungsmäßig vorgesehenen Zustand herzustellen und Asylbewerber an der deutschen Außengrenze zurückzuweisen.
Die Gefahr lag in den Bildern. Was passiere, wenn 500 Migranten mit Kindern im Arm auf die Grenzposten zustürmen, fragt der Innenminister an jenem Sonntagnachmittag – und die Verantwortlichen der Polizei wissen keine verbindliche Antwort. Für die Politiker ist die Frage der Bilder jedoch entscheidend, freilich nur in Deutschland, nicht an der spanischen Exklave Ceuta gegenüber Gibraltar oder auf dem Balkan.
Solche Bilder hätten in der Tat entstehen können. Was aber wäre gewesen, wenn die Bundeskanzlerin und ihr Innenminister bereit gewesen wären, sie in Kauf zu nehmen? So spekulativ die Antworten auf diese Frage bleiben müssen – drei Folgen wären wahrscheinlich gewesen.
Erstens wäre der Migrationsmagnet Deutschland, der die Krise über Monate hin verstärkte, abgestellt worden oder gar nicht erst entstanden. Stattdessen wäre jener Dominoeffekt der Zurückweisung eingetreten, den die österreichische Regierung im Februar 2016 erzeugte und der zum Ende der akuten Krise führte.
Zweitens wären der Europäischen Union erhebliche politische Verwerfungen über die Flüchtlingspolitik erspart geblieben. Da die Euro-Krise nach mehr als fünf akuten Jahren gerade abgeklungen war, hätte sich mögli-

EINREISE: Im bayerischen Freilassing sprechen Polizisten am 14. September 2015 bei neu eingeführten Grenzkontrollen mit ankommenden Flüchtlingen
cherweise sogar ein Fenster zur Reform des europäischen Grenz- und Migrationsregimes geöffnet. Dass damit auch dem Brexit das entscheidende Argument gefehlt hätte, sei nur am Rande erwähnt.
In jedem Falle aber wäre drittens die Entwicklung in Deutschland anders verlaufen, wo Migration zum großen Polarisierungsfaktor wurde. Nachdem der AfD das Thema der Euro-Krise abhandengekommen war, sahen die Umfragen im August 2015 die Partei bei drei Prozent, die Union hingegen bei 42 Prozent. Die Union war 14-mal so stark. Mit der Flüchtlingskrise gewann die AfD dann ihr neues Hauptthema. Zehn Jahre später herrschte Gleichstand. Ein Wort zu wenig.
KONTRAFAKTISCHE GESCHICHTE
Christoph Nonn, Tobias Winnerling (Hg.)
Eine andere deutsche Geschichte 1517–2017 Was wäre wenn ... Lebendig erzählen Historiker, wie die deutsche Geschichte auch hätte verlaufen können, beginnend mit der Reformation Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2017; 298 S., 56,– €
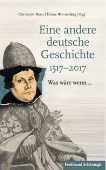
Alexander Demandt Es hätte auch anders kommen können Wendepunkte deutscher Geschichte
Die Themen reichen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, vom Krieg der Perser gegen die Griechen bis zur deutschen Wiedervereinigung Propyläen Verlag, Berlin 2010; 286 S., antiquarisch
Hans-Peter von Peschke Was wäre wenn Alternative Geschichte
Der Journalist dreht seine Szenarien literarisch weiter, in Form von Kurzgeschichten oder fiktiven Aufzeichnungen der Protagonisten Konrad Theiss Verlag, 2. Aufl., Darmstadt 2017; 254 S., antiquarisch
Niall Ferguson (Hg.) Virtuelle Geschichte
Historische Alternativen im 20. Jahrhundert
Der Sammelband betont die Entscheidungsmacht des Einzelnen und argumentiert, dass keine Ereignisfolge alternativlos ist Primus Verlag, Darmstadt 1999; 410 S., antiquarisch
Niall Ferguson Der falsche Krieg
Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert
Auf der Grundlage kontrafaktischer Überlegungen kommt der britisch-amerikanische Historiker zu der These, dass der Kriegseintritt Großbritanniens 1914 ein Fehler gewesen sei –mit katastrophalen Folgen für die Menschheit Pantheon Verlag, München 2013; 480 S., 18,– €

Ralph Giordano
Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte
Die Pläne der Nazis nach dem Endsieg Diese Schreckensvision einer vom NS-Regime beherrschten Welt basiert auf realen Konzepten und Vorhaben der Nationalsozialisten Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2000; 383 S., 12,99 €
Robert Cowley (Hg.)
Was wäre gewesen, wenn?
Wendepunkte der Weltgeschichte
Von den Assyrern bis zu Chiang Kai-shek: Dieses Buch widmet sich bedeutenden Schlachten und Befehlshabern. Der Fortsetzungsband (»Was wäre geschehen, wenn?«) enthält auch nichtmilitärische Szenarien Droemer Knaur Verlag, München 2002; 399 S., antiquarisch

Kai Brodersen (Hg.) Virtuelle Antike Wendepunkte in der Alten Geschichte Nicht nur moderne Historiker kommen hier zu Wort: Der antike Geschichtsschreiber Titus Livius spekuliert über einen Krieg Alexanders des Großen gegen Rom, Heinrich Heine dichtet über Varus’ Sieg im Teutoburger Wald Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000; 176 S., antiquarisch
ÜBER KONTRAFAKTISCHES DENKEN
Johannes Dillinger Uchronie
Ungeschehene Geschichte von der Antike bis zum Steampunk
Der Historiker entspinnt keine eigenen Szenarien, sondern beschreibt die Genese kontrafaktischen Denkens, dem er auch in Musik, Film und Mode nachspürt
Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2015; 298 S., 49,90 €
Richard J. Evans Veränderte
Vergangenheiten
Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte
Mit kritischem Blick zeichnet der britische Historiker nach, wie blühend sich das Genre seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. Anders als Niall Ferguson betont Evans vor allem die Beharrungskräfte der Geschichte
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014; 219 S., 19,99 €

Alexander Demandt Ungeschehene Geschichte
Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn ...?
Der Althistoriker hält kontrafaktisches Denken für unverzichtbar und analysiert dessen Nutzen für die Wissenschaft Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Neuausgabe, Göttingen 2011; 190 S., 25,– €
WENDEPUNKTE
Martin Sabrow u. a. (Hg.) 1989 Eine Epochenzäsur? Der Fall des Eisernen Vorhangs: Wie weit reicht seine Vorgeschichte zurück, und welche Folgen hat der Umbruch?
Der Sammelband beleuchtet Wandel und Kontinuität nicht nur in Deutschland Wallstein Verlag, Göttingen 2021; 307 S., 29,90 €
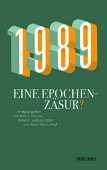
Hans-Ulrich Wehler (Hg.) Scheidewege der deutschen Geschichte
Von der Reformation bis zur Wende 1517–1989 Statt auf politischen oder militärischen Hauptakteuren liegt der Fokus hier in erster Linie auf großen gesellschaftlichen Umbrüchen
C. H. Beck Verlag, München 1995; 255 S., 9,90 €
Ian Kershaw
Wendepunkte
Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg 1940/41
Der Hitler-Biograf fragt danach, wie der deutsche Diktator, Churchill, Stalin, Roosevelt und andere den Verlauf des Krieges bestimmt haben Pantheon Verlag, München 2010; 729 S., 24,– €
Dan Diner u. a. (Hg.) Roads not Taken
Oder: Es hätte auch anders kommen können. Deutsche Zäsuren 1989–1848
Dieser Begleitband zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum beleuchtet 14 Schlüsselmomente – ausgehend von der Friedlichen Revolution in der DDR in umgekehrter Chronologie
C. H. Beck Verlag, München 2023; 287 S., 28,– €
ROMANE
Christian Kracht
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten
Was wäre, wenn Lenin 1917 in der Schweiz geblieben wäre und dort eine kommunistische Revolution entfacht hätte? Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2021; 148 S., 12,– €
Robert Harris Vaterland
Der Thriller spielt 1964 in einem von Hitler beherrschten Europa, wo sich eine mysteriöse Mordserie ereignet Wilhelm Heyne Verlag, München 2017; 431 S., 13,– €
Philip K. Dick
Das Orakel vom Berge Deutsche und Japaner haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen –und die USA unter sich aufgeteilt. Auf dieser Vorlage beruht die Fernsehserie »The Man in the High Castle« Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2014; 270 S., 9,99 €

Zusammengestellt von der Redaktion
BILDNACHWEISE
Titel [M]: ullstein bild; Wolfgang Pfauder/Stiftung Preussische Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg/bpk; Sven Simon/picture-alliance
S. 3 [M]: akg-images
S. 4/5: Vera Tammen für ZEIT Geschichte; picture-alliance/ dpa; Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh [M]; World Book Inc./mauritius images
S. 6–17 (Ausschnitte): Underwood Archives/Universal Images Group/akg-images; Roberto Pfeil/AP/picturealliance; Manoocher Deghati/ AFP/Getty Images; Robert Stolarik/Polaris/laif; Baz Ratner/Reuters; Will Oliver/ Pool/CNP/Polaris/laif
S. 18/19: Alfred Landecker Foundation [M]
S. 20–24 [M]: ullstein bild; Eric Tschaen/REA/laif; Bill Knight
S. 26–31: Von der Mülbe/Artothek; akg-images; Arne Psille/ DHM, Berlin/bpk; Medienagentur Geschichte [M]
S. 32/33: Nationalgalerie, SMB/bpk; privat [M]
S. 34–39: Wolfgang Pfauder/ Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/bpk [M]; Heritage Images/Fine Art Images/ akg-images; akg-images; privat [M]
S. 40–43: bpk [M]; Arne Psille/DHM, Berlin/bpk
S. 44–46 [M]: Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh; bpk; Universität Köln
S. 48–52: Arne Psille/DHM, Berlin/bpk; Sebastian Ahlers/ DHM, Berlin /bpk [M]; Andrea Ulke/MHM [M]; Michael Heck [M]
S. 54–57: akg-images (Ausschnitt); Rosseforp/Imagebroker/Bridgeman Images; Roswitha Hecke [M]
S. 86–89: Pen and Sword Books/UIG/akg-images; United Archives/TopFoto/SZ Photo; Arne Mayntz [M]
S. 90–93: Murray Becker/ AP Photo/picture-alliance; akg-images (Ausschnitt); SZ Photo; Tobias Schwerdt/Uni Heidelberg [M]
S. 94–99: SPD/AdsD; World Book Inc./mauritius images; HDG Bonn/ullstein bild; SZ Photo; akg-images; Niklas Diemer [M]
S. 100–105 (Ausschnitte): picture-alliance/dpa; ZUMA Press/Imago Images; Papers of John F. Kennedy, Presidential Papers, National Security Files, Countries Germany: Berlin, 10/5/6110/12/61, JFKNSF-083-004/ John F. Kennedy Presidential Library and Museum (Ausschnitt); Bernd Thiele/ullstein bild; privat [M]
S. 106/107: Nikolai Ignatiev/ Alamy/mauritius images; Heinz Wieseler/picture-alliance/dpa; Moritz Küstner [M]
S. 108–113: Chris Niedenthal; Nikolaus Becker/RobertHavemann-Gesellschaft, RHG_ Fo_NiBe_001_46; picturealliance/dpa (Ausschnitt); Robert-Havemann-Gesellschaft, EP 09; Stuart Franklin/ Magnum Photos/Agentur Focus; Fotoatelier Rietz [M]
S. 114–119: dpa/ullstein bild; Sergey Ponomarev/ The New York Times/Redux/ laif; Vera Tammen [M]; Bert Bostelmann [M]; Attila Volgyi/Polaris/ddp (Ausschnitt); Sebastian Widmann/Anadolu Agency/ Getty Images (Ausschnitt)
S. 120/121 (Ausschnitt): Frank Werner
S. 122 [M]: Granger, NYC/ ullstein bild
IMPRESSUM
Herausgeber: Christian Staas, Dr. Volker Ullrich
Berater: Prof. Dr. Norbert Frei
Chefredakteur: Frank Werner
Redaktion: Markus Flohr, Samuel Rieth, Judith Scholter
Art-Direktion: Maret Tholen
Grafik/Layout:
Dorothee Holthöfer (fr.)
Bildredaktion: Andy Heller
Korrektorat: Thomas Worthmann (Ltg.), Oliver Voß (Stv.) ZEIT Geschichte
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
Buceriusstraße, Eingang Speersort 1
20095 Hamburg
Telefon: 040 • 32 80-0
Fax: 040 • 32 71 11
E-Mail: DieZeit@zeit.de
Kontaktadresse nach EUProduktsicherheitsverordnung: produktsicherheit@zeit.de
CPO Magazines & New Business: Sandra Kreft
Director Magazines: Malte Winter
Marketing: Elke Deleker
Vertrieb: Sarah Reinbacher
Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen:
Silvie Rundel
Herstellung: Torsten Bastian (Ltg.), Oliver Nagel (Stv.)
Anzeigen: ZEIT Advise Lars Niemann (CSO) www.advise.zeit.de
Anzeigenpreise: ZEIT Geschichte-Preisliste Nr. 18 vom 1. Januar 2025
Druck: Firmengruppe APPL, appl druck, Wemding
Abonnement: Jahresabonnement (6 Hefte) 52,20 €, Lieferung frei Haus (Auslandsabonnementpreise auf Anfrage)
Abonnentenservice:
AUSSTELLUNG

Roads not Taken
Oder: Es hätte auch anders kommen können. Hätte die deutsche Geschichte an 14 Wendepunkten einen anderen Verlauf nehmen können? Beim 20. Juli 1944 kommen die Kuratoren zu dem Schluss, dass Stauffenbergs Attentat zu spät erfolgte. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin ist bis zum 11. Januar 2026 zu sehen
S. 58–62: Hans Schubert/ Heeresgeschichtliches Museum Wien; Science Source/ akg-images; akg-images; Erich Lessing/akg-images; Ulrich Lotz [M]
S. 63: Science History Images/ Alamy/mauritius images
S. 64–69: bpk; Scherl/SZ Photo; A. & E. Frankl/ullstein bild; Gircke/ullstein bild
S. 70–73: Hulton Archive/Getty Images; Scherl/SZ Photo; Bundesarchiv, Bild 146-1986107-32A; privat [M]
S. 74–79: Benno Wundshammer/bpk; Max Ehlert/ullstein bild; ullstein bild; Ringfoto Fehse, Berlin-Spandau [M]
S. 80–85: Scherl/SZ Photo; Schweizerisches Bundesarchiv, E4320B#1970/25#2*; Scherl/ SZ Photo; Heinrich Hoffmann/ Bayerische Staatsbibliothek/ bpk; Cordia Schlegelmilch [M]
Telefon: 040 • 42 23 70 70
Fax: 040 • 42 23 70 90
E-Mail: abo@zeit.de
VORSCHAU

GRIFF NACH
DER WELT
Deutschland, Großbritannien und Russland ringen in Afrika und Asien um die Vorherrschaft. Amerikanische Karikatur von 1885
Alter, neuer Imperialismus
Der Kampf um Territorien und Einflusszonen –vom 18. Jahrhundert bis zu Putin, Xi Jinping und Trump
1756 erobern die Franzosen ein britisches Fort am Ontariosee in Nordamerika; dort fechten England und Frankreich ihre Kriege inzwischen aus. Sie entsenden ihre Flotten auch in andere Weltregionen, während das zaristische Russland zum Landimperium heranwächst. Im späten 19. Jahrhundert gipfelt die Großmachtpolitik im »Hochimperialismus«: Mit modernen Schiffen dringen die europäischen Mächte in alle Erdteile vor; ein globaler Wettlauf um Land und Einfluss entbrennt, der in den Ersten Weltkrieg führt. Danach entfesseln Nazi-Deutschland und Japan einen neuen imperialen Krieg, mit dessen Ende auch das Zeitalter des Imperialismus überwunden scheint. So dachte man. Bis Putins Russland von den Grenzen der alten Sowjetunion zu träumen begann und die Ukraine überfiel. China versucht
schon länger, an Einfluss zu gewinnen und den übermächtigen Vereinigten Staaten Paroli zu bieten – die unter Trump nun ebenfalls wieder in Einflusszonen denken. Das alte Gespenst ist zurückgekehrt. Stehen wir am Beginn eines neuen Zeitalters des Imperialismus? Unser nächstes Heft beschreibt den Kampf um die Weltordnung, den damaligen wie den heutigen. Wir blicken auf die Epoche des Imperialismus zurück und fragen, was uns diese Geschichte lehrt: Erleben wir eine Neuauflage, oder hat sich das Gesicht imperialer Mächte gewandelt? Und was sind eigentlich Imperien, welche Ziele verfolgen sie – und woran scheitern sie?
ZEIT Geschichte 4/2025: Ab 18. Juli am Kiosk
Vervollständigen Sie Ihre Sammlung
Entdecken Sie große historische Figuren und bedeutende Epochen der Weltgeschichte neu. Sichern Sie sich jetzt noch die begehrten letzten Hefte aus dem ZEIT GESCHICHTE-Archiv für Ihre persönliche Sammlung.

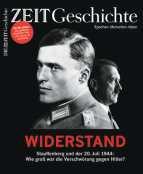
48329

45482

45115

46468

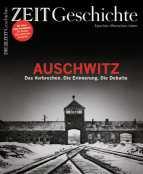

Bauernkrieg
49148


Wie Kriege enden
46318

46403
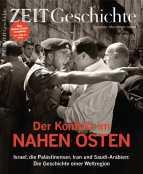

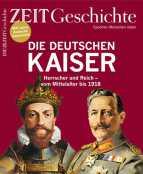

44222
MelissaMüller

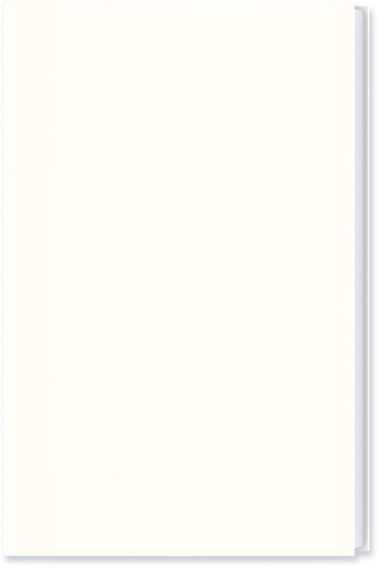
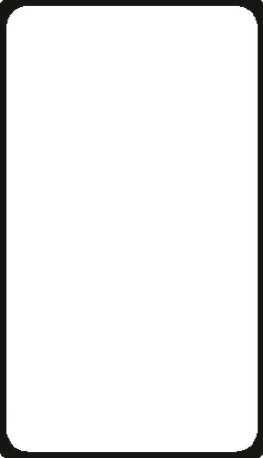

Zwei verloreneSeelen,ein Briefwechsel über Kontinente hinwegund derVersuch,ander Seitedes anderenins Lebenzurückzufinden.
Dieberührende Lebens-und Liebesgeschichte einer Klassenkameradinvon Anne Frank.
Mehr unter: diogenes.ch/melissamueller
