SCHWERPUNKT
NACHHALTIGKEIT
Wie die Politik dem Mittelstand die Transformation erschwert

SCHWERPUNKT
NACHHALTIGKEIT
Wie die Politik dem Mittelstand die Transformation erschwert
Gerda Söhngen führt eine Familienfirma – eine Aufgabe, bei der man schnell allein ist.
Sie hat deswegen einen Austauschkreis gegründet, andere suchen sich einen Coach. In den Gesprächen geht es ans Eingemachte

BU S I N E S S I N T H E F RON T.
BU S I N E S S I N T H E BAC K.



S I N E S S I T H E F RON S I E S S T E BAC K.
Der vollelektrische EQE SUV für Geschäftskunden.
EQE SUV Geschäftskunden.
Digital vernetzt und mit großzügigem Mit dem neuen SUV von Mercedes-EQ verlängern Sie Ihr Büro bequem die Und das auch bei längeren Geschäftsreisen dank einer Reichweite von bis zu 593 km 2
Digital vernetzt und mit großzügigem Raumgefühl: Mit dem neuen SUV von Mercedes-EQ verlängern Sie Ihr Büro einfach bequem auf die Straße. Und das auch bei längeren Geschäftsreisen dank einer Reichweite von bis zu 593 km (WLTP). 1, 2
Erfahren Sie mehr über das Geschäftskundenprogramm auf: mercedes-benz.de/geschaeftskunden
Erfahren Geschäftskundenprogramm auf:
EQE SUV 350+ | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 21,8–17,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km.1

EQE 350+ CO₂-Emissionen 0 g/km.1 und Reichweite VO 2017/1151/EU


1 Stromverbrauch und Reichweite werden auf der Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt.
2Im realen Fahrbetrieb können Normwerten von Vielzahl Faktoren Umwelt-
2Im realen Fahrbetrieb können Abweichungen im Vergleich zu den zertifizierten Normwerten auftreten. Die Realwerte werden von einer Vielzahl individueller Faktoren beeinflusst, z. B. individuelle Fahrweise, Umwelt- und Streckenverhältnisse.

Ein Unternehmer will weg vom Öl. Dafür bräuchte er Kohle. Aber die Banken zögern S. 38

Wir rücken zum Kern des unternehmerischen Daseins vor: Niemand nimmt einem die Verantwortung für Entscheidungen ab, aber sie lassen sich mit anderen vorbereiten. Wir zeigen, wie das gehen kann. Wir beschreiben die Transformation und wie der Staat Unternehmen den Weg in die Nachhaltigkeit erschwert. Das muss wirklich nicht sein. Und wir beleuchten, warum es Frauen oft schwer haben, nach ganz oben zu kommen. Das darf einfach nicht sein.
Viel Gewinn beim Lesen! Ihr »ZEIT für Unternehmer«-Team
An dieser Ausgabe haben unter anderem mitgearbeitet:
Katja Scherer
beobachtete für die Titelgeschichte einen Coaching-Prozess und lernte, wie wertvoll ein guter Berater ist
Marina Rosa Weigl


blickte hinter die Kulissen eines Zirkus und vergaß während der packenden Show sogar kurz, zu fotografieren


Wie gefällt Ihnen ZEIT für Unternehmer? Bitte nehmen Sie an unserer Umfrage teil: www.zeit.de/zfu-umfrage
Dieser Gründer wiederum hat zwar Geld, er vermisst aber politischen Rückenwind S. 18
Applaus bekommen diese Artisten reichlich. Und sie arbeiten hart dafür S. 44
Von Amt Creuzburg bis Wuppertal
Wo die Firmen ihren Sitz haben, die in dieser Ausgabe vorkommen
INNOVATION
Frauen melden weniger Patente an und gründen seltener als Männer. Warum? 6–11
SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT
Ein Besuch in Wuppertal, wo ein Cluster für Kreislaufwirtschaft entstehen soll.
Kann das gelingen? 12–16
Der Gründer Nils Aldag will die Wasserstoffwirtschaft ankurbeln 18–22
Ralf Pollmeier glaubt, dass Holz Plastik ersetzen kann. Nun steckt der Sägewerksbetreiber mitten in einem Konflikt 24–26
Eine Familienfirma aus Westfalen lässt im indischen Bangalore Plastik recyceln 28–30
TITELTHEMA
Chefinnen und Chefs fehlen oft Menschen, mit denen sie Probleme besprechen können. Wie sie Rat finden – und geben können 32–37
FINANZIERUNG
Erschwert die Politik die Transformation, weil sie Banken zu viele Regeln aufzwingt? 38–42
FOTOSTORY
Ein Blick hinter die Kulissen von Roncalli 44–48
ZirkusChef Bernhard Paul im Interview 49
ARBEITSWELT
Ein Mittelständler schickt neue Mitarbeiter vom Schreibtisch in die Fabrik. Warum? 50–53
EIN TAG MIT ...
... einem ungewöhnlichen Ehepaar, das ein gemeinsames Unternehmen zusammenhält 54–56
DIE ERFINDUNG MEINES LEBENS
Hansjörg und Julian Bihl haben trotz großer Widerstände mit ihrer Idee Erfolg 58
IMPRESSUM
Herausgeber: Dr. Uwe Jean Heuser Art-Direktion: Haika Hinze Redaktion: Jens Tönnesmann (verantwortlich);
Kristina Läsker (frei) Autoren: Carolyn Braun, Jennifer Garic, Leon Igel, Felix Leitmeyer, AnnKathrin Nezik, Doreen Reinhard, Navina Reus, Marcus Rohwetter, Katja Scherer, Jan Schulte Redaktionsassistenz: Andrea
Capita, Katrin Ullmann Chef vom Dienst: Dorothée Stöbener (verantwortlich), Mark Spörrle, Imke Kromer
Textchef: Dr. Christof Siemes Gestaltung: Christoph Lehner Infografik: Pia Bublies (frei) Bildredaktion:
Amélie Schneider (verantw.), Navina Reus Korrektorat: Thomas Worthmann (verantwortlich) Dokumentation:
Mirjam Zimmer (verantwortlich) Herstellung: Torsten Bastian (verantw.), Jan Menssen, Oliver Nagel
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg Geschäftsführung: Dr. Rainer Esser
Verlagsleitung Magazine: Sandra Kreft, Malte Winter (stellv.) Magazinmanagement: Stefan Wilke
Anzeigen: ZEIT Media: www.media.zeit.de Verlagsleitung Marketing und Vertrieb: Nils von der Kall
Leitung Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel
Anzeigenpreise: Sonderpreisliste Nr. 1 vom 1. 1. 2023
An- und Abmeldung Abonnement (4 Ausgaben): www.studiozx.de/events/zfu
Verlag und Redaktion: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, HelmutSchmidtHaus, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg, Telefon: 040/32 800, EMail: DieZeit@zeit.de
For your Safety
Erstklassige Produkte und Dienstleistungen – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse Sprechen Sie mit uns W ir automatisieren Sicher
Pilz GmbH & Co. KG
Telefon: 0711 3409-0
„Safety und Security gemeinsam betrachten.“
„We i l Cyberangriffe auf Maschinen die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Prozesse gefährden.“
 Sabrina Hellstern (links) hat sogar ihr Haus beliehen, um mit Claudia Sodha ein Medizintechnik-Unternehmen aufzubauen
Sabrina Hellstern (links) hat sogar ihr Haus beliehen, um mit Claudia Sodha ein Medizintechnik-Unternehmen aufzubauen
Frauen gründen seltener Firmen als Männer und melden weniger Patente an. Woran liegt das?
VON CAROLYN BRAUN
Vorbilder? Jenny Müller muss überlegen. Spontan fällt der 39-Jährigen niemand ein. Wer könnte sie inspiriert haben, Unternehmerin zu werden? Nicht aufzugeben und nach dem Scheitern der ersten Geschäftsidee mit der nächsten zu starten? Doch, da gab es vielleicht jemanden. Maria »Mimi« Kimmel. Ihre Uroma, die sie nie kennengelernt hat. Aber ihre Geschichte hat überdauert: wie sie nach dem Krieg als Geflüchtete in Bayern Wolle organisierte und an Bäuerinnen verteilte, damit die daraus die vielfach fehlende Kinderkleidung strickten, die sie dann mit Gewinn weiterverkaufte. So lange jedenfalls, bis sie aus dem Gröbsten raus war.

Müllers Uroma wurde aus der Not heraus aktiv – und nicht weil sie ein Unternehmen aufbauen oder eine Idee vermarkten wollte. Heute, fast 80 Jahre später, gründen Frauen immer noch anders: Sie tun es öfter in Teilzeit, sie setzen weniger auf Wachstum, meiden den Tech-Bereich, melden weniger Patente an, werben im Schnitt geringere Beträge von Investoren ein. Vor allem aber gründen sie schlicht viel seltener als Männer. Zwar ist der Anteil der Frauen unter all jenen, die sich haupt- oder nebenberuflich selbstständig machen, 2021 auf 42 Prozent gestiegen. Das zeigen Zahlen der KfW. Doch ein Blick ins Handelsregister zeigt, wie breit der Geschlechtergraben noch ist: Laut dem Ifo-Institut gingen vor der Pandemie noch fast 20 Prozent aller dort erfassten Firmengründungen auf Frauen zurück, 2021 nur noch 16 Prozent.
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beklagen den Mangel seit Jahren. Schon vor zehn Jahren machte sich die damalige Bundesregierung für mehr Unternehmerinnen stark, auch die regierende Ampelkoalition will laut Koalitionsvertrag Gründerinnen fördern. Im letzten Sommer veröffentlichte sie ihre Start-up-Strategie, darin enthalten: Maßnahmen zur Frauenförderung, etwa der »Zukunftsfonds«, der Investorinnen den Marktzugang erleichtern soll. Das Ganze ist nicht uneigennützig, wegen des Fachkräftemangels braucht die Volkswirtschaft verstärkt auch Frauen als Innovatorinnen in Labors und Jungunternehmen.

Warum aber sind es immer noch so wenige, was hindert die Frauen?
ZEIT für Unternehmer hat mit einigen Gründerinnen gesprochen, erfolgreichen und gescheiterten. Nicht alle wollen mit Namen auftauchen. Die größte Angst: als Frau über typische Frauenprobleme zu sprechen, deswegen als Minderleisterin abgestempelt zu werden und Investoren zu verschrecken. »Wenn ich als Frau über die Nachteile rede, die ich als Frau habe, dann verschärfe ich sie nur noch«, sagt eine der Gründerinnen. Die Wirtschaftswelt ändert sich zwar langsam, aber Regeln und Rituale sind weiter männergemacht.
Das belegen auch die Zahlen des Europäischen Patentamts (EPA). Die Behörde hat alle Patentanmeldungen analysiert, die von 1978 bis 2019 eingegangen sind. Sie vermitteln den Eindruck, dass Frauen schlicht nicht innovativ seien: Über den gesamten Zeitraum gesehen waren nur gut 13 Prozent der in europäischen Patentanmeldungen genannten Personen weiblich. Noch bitterer: Deutschland landet abgeschlagen auf Platz 32 von 34, dahinter kommen nur noch Liechtenstein und Österreich. In der Bundesrepublik liegt die Quote der Erfinderinnen bei zehn Prozent, gegenüber 30,6 Prozent in Lettland, 26,8 Prozent in Portugal und 25,8 Prozent in Kroatien. Das Deutsche Patentund Markenamt hat noch ernüchterndere Zahlen: Demnach war 2022 nur jede zwölfte Person in den Patentanmeldungen weiblich. Ein schwacher Trost: Zehn Jahre zuvor waren es nur sechs Prozent.
Das EPA weist auf strukturelle Gründe hin: Deutschland sei stark im Maschinenbau, der Branche mit der international niedrigsten Frauenquote. »Das Ranking spiegelt die unterschiedlichen Stärken der portugiesischen und der deutschen Wirtschaft und die Tatsache wider, dass in Portugal mehr Innovation im pharmazeutischen Sektor und an Universitäten stattfindet«, sagt Ilja Rudyk, Senior Economist beim EPA. Beide seien Bereiche, in denen Frauen im Vergleich stärker vertreten sind. Weitere Gründe: Frauen sind eher in Erfinderteams tätig und seltener allein. »Wenn ein Unternehmen oder eine Organisation ein Patent anmeldet, dann wird das Unternehmen als Ansprechperson für das Patent wahrscheinlich die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter
benennen«, sagt Kerstin Ettl, BWL-Professorin an der Westfälischen Hochschule, die das Projekt »Vom Labor in den Mittelstand: Westfälische Erfinderinnen« betreut. »Und dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Geschlechterverteilung in den Führungspositionen ist: Auch da sind die Frauen deutlich in der Minderheit.«
Anders formuliert es eine Naturwissenschaftlerin, die auch anonym bleiben will: »Confidence schlägt competence.« Auf Deutsch: Selbstvertrauen ist in der Forschung oft ausschlaggebender als Fachkompetenz für den Erfolg und den Namen auf der Patentanmeldung. So seien die tendenziell selbstbewussteren Männer im Vorteil.
Jenny Müller, Urenkelin und Start-upChefin, ist in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme. Denn auch wenn man Start-ups betrachtet, zeigt sich: Nur jedes fünfte ist von einer Frau initiiert (siehe Grafik S. 11). Zudem gehört Müller zur Minderheit der Erfin-
ANZEIGE
derinnen – sie hat bereits zwei Patente auf den Herstellungsprozess ihrer Produkte erteilt bekommen und ein weiteres angemeldet.
Müllers erste Idee, ein lang haltbarer Salat aus dem Obst, das Supermärkte sonst entsorgt hätten, setzte sich nicht durch. Also hat Müller mit ihrer »Frischemanufaktur« umgeschwenkt und verkauft nun erfolgreicher ein Wasser mit Obststücken und frischen Kräutern. Davon sind Supermarktketten als Abnehmer anscheinend ebenso angetan wie Konsumenten. Beim Obstsalat sei das anders gewesen; Müller meint, sie habe Fehler begangen bei Verpackung und Preis – sich aber auch schwergetan, Investoren zu finden. »Lange bekam ich nur unseriöse Angebote, man bot mir sehr wenig Geld für sehr viele Anteile am Unternehmen.« Ob das daran liegt, dass sie eine Frau ist? »Das sagt einem ja niemand ins Gesicht.«
Nach schwierigen Anfangsjahren in München rettete sie ein Investment-Angebot
der bmp Ventures AG, die die Risikokapitalfonds des Landes Sachsen-Anhalt managt. Dafür musste sie aber nach Mitteldeutschland ziehen. Also verlegte sie den Firmensitz nach Halle – und lernte hinzu. Zu Terminen mit Investoren nimmt sie heute ihren »zehn Jahre älteren, größeren und männlichen« Mitarbeiter für Einkauf und Logistik mit. Mit dieser Rückendeckung nimmt sie sich dann durchaus 80 Prozent Redeanteil.
Wenn es um Investoren geht, kann sich Sabrina Hellstern, 40, in Rage reden. Zusammen mit ihrer 59-jährigen Co-Gründerin Claudia Sodha führt sie die Hellstern Medical GmbH im baden-württembergischen Wannweil. Ihr Produkt: ein sogenanntes Exoskelett, das Chirurgen eine ermüdungsfreie Operation ermöglichen soll.
Genauer: ein robotisches System, das den Oberkörper des Operateurs ergonomisch hält, während er auf einer Art Fahrradsattel sitzt. »Sitzen im Stehen«, nennt Hellstern
Familie nunte r ne hme n: Ve r traue n Sie auf e in Te a m, das e in tiefe s Ve r ständnis für Ihr G e schäf t und die pa s se nde n Te chnologie n mitbringt und hilf t, mit te lstä ndische und Familie nunte r ne hme n be stmöglich vor C ybe ra ngrif fe n zu schüt ze n. So schaf fe n wir ge me ins a m mit Ihne n nachhaltige We r te und Ve r traue n –he ute und in Zukunf t. w w w pwc de/fa milie nunte r ne hme n
Sie den ken, I h r Fa m i l ienunter neh men sei un i nteressa nt f ür Hac ker? Genau das mac ht es i nteressa nt.
757.000
Chefinnen gab es laut der KfW im Jahr 2022 im Mittelstand. Damit lag ihr Anteil bei 19,7 Prozent
nennt man das Phänomen, dass der Frauenanteil in der Forschung von Laufbahnstufe zu Laufbahnstufe sinkt, weil für sie die Karriere-Hindernisse zunehmen. Zu Deutsch: »undichte Leitung«
das. »In der Industrie sind Exoskelette schon Standard. Am OP-Tisch stehen die Operierenden wie vor 150 Jahren.«
Von ihrem Produkt sind sie überzeugt, mit Investoren tun sich die Gründerinnen schwer. »Das Geld liegt immer noch bei den Männern, deswegen wird auch mehr in Männer investiert«, sagt Hellstern. Eine Investorin hat ihr sogar erzählt, dass sie sich dabei ertappte, selbst Männern automatisch mehr Kompetenz zuzuschreiben. Hellstern hat den Eindruck, dass ihr als Frau von Investorenseite gern Junior-Mitarbeiter – sie sagt: »gefühlt Praktikanten« – gegenübergesetzt werden, die ihr Produkt gar nicht verstehen könnten.
Hellstern und Co. arbeiten hart, 24/7 sozusagen. Mit relativ schlanken 2,9 Millionen Euro Kapital haben sie in 24 Monaten ihr Produkt zur Marktreife gebracht, auch die Zulassung als Medizinprodukt durch die EU haben sie erhalten. Längst nicht das ganze Geld kam von Investoren. »Ich habe das Auto verkauft, einen Kredit aufs Haus aufgenommen, und wir haben alle auf Gehälter verzichtet«, sagt Hellstern. Deswegen halten die Gründerinnen noch 75 Prozent der Firmenanteile. Aktuell suchen sie wieder nach Kapital, drei Millionen wollen sie einwerben, »für den Rollout des Produktes und den Vertriebsaufbau«.
Charakteristika haben wie wir selbst, eher vertrauen. Deshalb ist in Entscheidungsgremien Diversität wichtig.« Männer geben also eher Männern Jobs und Geld – und Frauen den Frauen.
Studien bestätigen das. Dana Kanze von der London Business School stellte fest, dass Gründerinnen von Risikokapitalgebern andere Fragen gestellt werden als Gründern. Frauen werden demnach eher zu Risiken befragt, Männer nach dem Potenzial ihrer Idee. Weitere Studien zeigen, dass das schon in der Kindheit beginnt: Mädchen werden eher risikoscheu erzogen, Jungs risikofreudig – und zwar nicht, weil die Eltern dieses Verhalten vorleben, sondern weil sie es fördern. Motto: Toll, wenn der Junge auf den Baum klettert, aber das Mädchen soll lieber unten bleiben.
7,6 % der Menschen, die im Jahr 2022 in veröffentlichten Patentanmeldungen des Deutschen Patent- und Markenamts genannt wurden, waren weiblich
Das dürfte nicht leicht werden, das zeigen Zahlen der KfW. 83 Prozent der VentureCapital-Deals in Deutschland entfallen auf rein männlich besetzte Gründungsteams, elf Prozent auf gemischte und nur fünf Prozent auf rein weibliche Teams – eine Verteilung, die sich in den vergangenen fünf Jahren praktisch nicht verändert hat. Beim Volumen der Deals hat sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern sogar erhöht: Von jedem Euro in Deutschland 2021 bekamen rein männlich besetzte Gründerteams 91 Cent, sieben gingen an gemischte und lediglich zwei Cent an rein weiblich geführte Start-ups. Das ist kein Zufall: »Bei den Investmentfonds gibt es einen relativ geringen Anteil an Frauen: 17 Prozent«, sagt Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. Auf Partnerebene liege er sogar bei nur sieben Prozent: »Und wir wissen aus vielen Studien, dass wir Menschen, die ähnliche
»Ditch the pitch« heißt eine Idee, die das aufbrechen soll, sinngemäß: »Lass das mit der Präsentation«. Weil Frauen systematisch schlechter abschneiden, sollten sie Geschäftsideen lieber schriftlich präsentieren. Vermutlich wäre das fairer. Denn experimentelle Studien zeigen, dass Männer mit exakt denselben Business-Ideen bei ihrem Publikum einen besseren Eindruck hinterlassen als Frauen. Kürzlich hat ein Forscherteam um die Psychologin Livia Boerner gezeigt, dass selbst in der Gründershow Die Höhle der Löwen – also vor laufender Kamera und Millionenpublikum – Männer mehr Geld von der mehrheitlich männlich besetzten Jury bekamen als Frauen.
Könnte es daran liegen, dass Frauen auf Investorensuche öfter die ganze Wahrheit sagen und Zweifel offenbaren? Jenny Müller glaubt, dass es so ist: Männliche Investoren würden aus eigener Erfahrung davon ausgehen, dass Gründer sich größer machen, als sie sind. »Da bin ich als relativ ehrliche Person dann natürlich automatisch im Nachteil«, sagt sie. Auch Claudia Sodha, die Mitgründerin von Hellstern Medical, hat eine ähnliche Lektion gelernt. Sie schloss ihr Ingenieursstudium als Jahrgangsbeste ab, arbeitete nach dem zweiten Abschluss an der Hochschule St. Gallen in Betriebswirtschaft und Informationsmanagement als Unternehmensberaterin und hatte es in ihrer Karriere lange fast nur mit Männern zu tun.
Sie sagt: »Schwäche zeigen sollte man nicht, dann ist man schnell unten durch. Dann heißt es halt: typisch Frau.«
Typisch auch, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch ein enorm weibliches Problem ist. Der Female Founders Monitor des Startup-Verbands belegt: 41 Prozent der Gründerinnen und 44 Prozent der Gründer haben Kinder. So weit, so gut verteilt. Allerdings: Für Gründerinnen mit Kindern reduziert sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit um knapp sechs Stunden. Männer opfern gerade mal eine Stunde. Wenig überraschend also, dass Frauen seltener zufrieden sind mit der Vereinbarkeit von Familie und Gründung als Männer – nur 51 gegenüber 61 Prozent.
Dabei wirkt sich eine bessere Vereinbarkeit auf die Gründerquote von Frauen aus. Das lässt sich aus Zahlen des Ifo-Instituts herleiten: In Großstädten und ostdeutschen Landkreisen – Regionen mit besserer Kinderbetreuung – gründeten Frauen mehr neue Unternehmen als im Rest des Landes.
Sodha und Hellstern sind Mütter und berichten, dass sie ihren Berufsweg nur gehen konnten, weil sie große Teile des Verdiensts in die Kinderbetreuung gesteckt hätten. »Wenn das ein Männerjob wäre, könnte man diese Ausgaben bestimmt nicht nur zu einem Bruchteil, sondern längst komplett von der Steuer absetzen, oder?«, fragt Sodha.
Vielleicht ist also die leaky pipeline nicht wirklich erstaunlich. Die undichte Leitung ist ein Bild für die Strecke zwischen beruflicher Qualifizierung bis zur erfolgreichen Innovationstätigkeit: Viele Frauen gehen unterwegs verloren. Es fällt aber auf, dass Frauen mittlerweile weniger bereit sind, sich zu ändern, um aufzuholen – lieber wollen sie das Spielfeld neu abstecken.
Martina Ponath führt das Hamburger Naturkosmetik-Start-up Future Stories, das mit seinen Pulver-zu-Gel-Produkten Abfall und Kohlenstoffdioxid vermeiden will. Sie habe bei Verhandlungen keine Nachteile bemerkt, weil sie eine Frau sei. Im Gegenteil, Investoren würden gemischte Teams immer mehr schätzen. Warum die Männer dennoch mehr Geld bekommen? »Für gute Erstgespräche braucht es Beziehungen«, sagt sie, und männliche Gründer hätten oft ein
besseres Netzwerk. Vor allem aber kennt Ponath viele Unternehmerinnen, die von sich aus weniger auf Wagniskapital und stattdessen stärker auf Nachhaltigkeit und nicht finanzielle Werte setzten. »Wenn ich schon 95 Prozent meiner Lebenszeit in ein Projekt stecke, dann soll das doch auch etwas Gutes bewirken, über den finanziellen Erfolg hinaus.«
Es ist ein Wintertag Ende 2018, als sich die Schwestern Nadine Speidel und Anne Kathrin Antic für eine Woche auf eine Berghütte in den Alpen zurückziehen. Sie diskutieren über die Zukunft ihres Unternehmens. Es heißt GlobalFlow und hat sich darauf spezialisiert, andere Firmen beim Abfallmanagement zu beraten und einzelne Mitarbeiter zu Abfallbeauftragten weiterzubilden. Eigentlich eine gefragte Dienstleistung. Aber den beiden wird klar: So wie bisher können sie ihr 2012 gegründetes Unternehmen nicht weiterführen. »Der Leidensdruck war zu hoch geworden«, erzählt Antic. »Wir waren zu abhängig von unseren Investoren, die sowohl strukturell als auch wirtschaftlich Vorstellungen hatten, die wir als Start-up nicht verwirklichen konnten.« Nach sieben Tagen in der Höhe und intensiven Gesprächen ist beiden klar: Sie werden vor ihr 20-köpfiges Team treten und den Mitarbeitern sagen, dass sie sich neue Jobs suchen müssen. Die beiden Chefinnen aber wollen an Bord bleiben und weitermachen.
Sie entwickeln eine auf sie zugeschnittene Lösung: Die Firma, das sind heute nur die beiden. Die Schwestern konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft, alle anderen Leistungen wie das grafische Design ihrer Konzepte überlassen sie externen Partnern. Frauen, sagt Anne Kathrin Antic, müssten lernen, ihre Stärken besser zu erkennen und zu nutzen. Auf die vermeintlichen Schwächen würden sie ohnehin aufmerksam gemacht. »Wenn man als Frau versucht, männlich geprägte Strukturen nachzuahmen, ist es unmöglich, etwas zu verbessern.«
Mit ihrem Modell erzielen sie inzwischen sogar so viel Umsatz wie früher, erzählt Antic. Vor allem aber brauchen sie keine Investoren mehr, die auf Wachstum drängen.
Nur die 20 Arbeitsplätze, die sind halt weg.
Frauen gründen seltener wachstumsorientierte Start-ups als Männer und bekommen noch seltener Geld von Wagnisfinanzierern
Quellen: Female Founders Monitor, KfW
alle Existenzgründungen Studienanfänger in den Wirtschaftsund Ingenieurswissenschaften (besonders gründungsrelevant) wachstumsgetriebene / innovative Start-up-Gründungen
Anzahl der Finanzierungsrunden mit Wagniskapital
Volumen der Finanzierungsrunden mit Wagniskapital
Ein Netzwerk von Unternehmern will die Industriestadt am Rand des Ruhrgebiets zum Zentrum für zirkuläres Wirtschaften umbauen. Die Erwartungen sind groß
VON LEON IGELMan könnte Carsten Gerhardt für ein bisschen größenwahnsinnig halten, wenn er von seiner Vision erzählt und wie er sie zum Leben erwecken will. Gerhardt skizziert die Zukunft in einem schmucklosen Büro in Wuppertal, das mit dem ausgetretenen Teppich eher nach Vergangenheit aussieht. Aber die Stadt hofft auf den 54-Jährigen.
Gerhardt will seine Heimatstadt und die Rhein-Ruhr-Region zu einem Zentrum für Kreislaufwirtschaft ausbauen. Wenn irgendjemand auf der Welt ein Produkt oder eine Expertin für diese neue Idee des Wirtschaftens sucht, soll er künftig an Wuppertal nicht mehr vorbeikommen. Alle sollen vom »Circular Valley« sprechen, angelehnt an das kalifornische Silicon Valley.
Moment mal. Apple, Google und die anderen Techfirmen aus der Region bei San Francisco haben die Ökonomie revolutioniert. Jetzt soll die nächste Industrie-Revolution aus Wuppertal kommen. Wuppertal?
Die Stadt im Bergischen Land besaß früher Strahlkraft über die Grenzen der Republik hinaus. Im 19. Jahrhundert trieb die Wupper Textilmühlen und Hammerwerke an, der Bayer-Konzern hat hier seine Wurzeln. Die Eröffnung der Schwebebahn 1901 verkörperte den Fortschritt, man sprach bewundernd vom »deutschen Manchester«.
Bis heute sitzen hier weltweit tätige Unternehmen wie der Kabelhersteller Coroplast oder der Staubsaugerhersteller Vorwerk. Aber die Arbeitslosenquote lag zuletzt
bei 9,7 Prozent und damit deutlich über dem Landesschnitt, dasselbe gilt für die ProKopf-Verschuldung. Der alte Glanz verblasst. Und dass so schnell eine neue Glanzzeit anbricht, könnte man bezweifeln.
Gerhardt aber ist optimistisch: Immer noch dominiert in der Rhein-Ruhr-Region das produzierende Gewerbe. Hunderte Unternehmen sitzen hier. »Wir können Industrie. Konnten sie immer schon!«, sagt er. Und das solle so bleiben. Wenn Fabriken schließen, verliere die Region schließlich neben Arbeitsplätzen auch ihre Identität.
Damit das nicht passiert, müssten die Firmen nachhaltiger agieren. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, um zur globalen Klimawende beizutragen. Das verändert die Wirtschaftswelt rasant und eröffnet Chancen. Hier setzt die zirkuläre Ökonomie an. Die Idee: Wenn es gelingt, alle Rohstoffe und Güter in einem ewigen Kreislauf zu halten, fällt kein Müll mehr an. Ob Gartenzwerg oder Plastiktüte, jedes
MProdukt würde zum Wertstoff, dem neues Leben eingehaucht würde. Es müssten kaum neue fossile Ressourcen verbraucht werden, es gäbe weniger klimaschädliche Gase. Das Resultat wäre eine grüne Wirtschaftswelt ohne Wohlstandsverluste.
In Reinform ist das eine Utopie. Aber der Weg dorthin lohnt sich. Aktuell werden weltweit gigantische Mengen an Müll produziert. Statistisch gesehen wirft jeder Deutsche mehr als 600 Kilogramm Abfall pro Jahr weg, 40 Kilo davon sind Plastikverpackungen. Obwohl sich Deutschland als Recycling-Nation versteht, verbrannte es 2021 mehr als die Hälfte der Kunststoffabfälle. Nicht alles, aber ein Teil davon ließe sich recyceln.
Damit die Quote steigt, sind neue Technologien nötig, wissenschaftliche Erkenntnisse und Strukturen. Und auch wirtschaftliche Anreize. All das soll im Circular Valley entstehen, weil dort Unternehmer auf Wissenschaftler treffen und Start-up-Gründer mit Politikern sprechen. Ein Ökosystem, das, einmal gedüngt und gegossen, aus sich selbst heraus wächst. »Wir stellen den Kontakt her«, sagt Gerhardt, »den Rest machen die Akteure.«
An einem Freitag im November ist die Historische Stadthalle von Wuppertal gut gefüllt. Der majestätische Bau von 1900 steht mit dem Stuck und den Deckengemälden für Wuppertals Geschichte. Heute aber geht es um die Zukunft. Rund 600 Unter-
Wuppertal von oben. Die Stadt galt im 19. Jahrhundert als »deutsches Manchester«. Nun hoffen die Menschen hier auf einen zweiten großen Wirtschaftsboom

nehmerinnen, Wissenschaftler und Politikerinnen sind angereist, um nach Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu suchen.
Auf der Bühne steht eine Frau, die darin eine Chance für Nordrhein-Westfalen sieht. Die vorher auf einer »Circular-EconomyTour« Unternehmen abgeklappert hat. Und die von der Wirtschaft geschätzt wird, obwohl sie eine Grüne ist: Mona Neubaur, seit 2022 Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und stellvertretende Ministerpräsidentin in NRW.
Neubaur spricht jetzt über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Despoten dieser Welt, die Herausforderungen. Wenn es da gelinge, die Kreislaufwirtschaft aus »der Anmutung von Räucherstäbchen« zu holen und zum Vorreiter in der Kreislaufindustrie zu werden, schaffe man sichere Arbeitsplätze und eine resiliente Wirtschaft. Das sei eine »wahnsinnige Chance«.
Dann erzählt Neubaur von einer Gründerin aus Kenia, die aus Ananasfasern künftig Hygieneartikel für Frauen herstellen wolle und dank des Circular Valley mit einem deutschen Unternehmen in Verbindung gekommen sei, das die passende Maschine bauen könne. Das sei »doch nicht zu fassen«!
Fragt man später nach Details, rudert eine Sprecherin zurück. Die Kooperation sei »noch nicht ganz so spruchreif, wie es anklang«. Das ist symptomatisch für das Projekt: Das Circular Valley ist bloß eine Idee, noch hat sich in der Rhein-Ruhr-Region kein Cluster für Kreislaufwirtschaft herausgebildet. Wie soll das gelingen?

Die Wirtschaftsministerin Neubaur liefert keine Antwort, auch die Unternehmer wissen es nicht. Carsten Gerhardt, der Privat mann, soll mal machen. Und der macht es: ehrenamtlich.
Mehr als acht Millionen Euro hat Gerhardt bei der öffentlichen Hand und Unternehmen eingeworben. 14 Menschen arbeiten mittlerweile für das Circular Valley, die Hälfte in Vollzeit. Gerhardt bedient sich eines Verfahrens aus der Wirtschaftswelt: des Start-up-Accelerators. Der bildet den Kern des Projekts. Zweimal im Jahr lädt Gerhardt grüne Start-ups aus der ganzen Welt nach Wuppertal ein. Die sitzen dann im alten Staubsauger-Testlabor, treffen sich
in Workshops und vernetzen sich – untereinander und mit den Unternehmen aus der Region. So soll ein Netzwerk entstehen, das von Wuppertal aus in die Welt strahlt, damit sich Firmen aus der zirkulären Ökonomie ansiedeln. Weil dort das Knowhow und die Marktführer der Kreislaufwirtschaft sitzen.
So weit die Theorie.
Praktisch läuft das Projekt erst seit zwei Jahren. Bisher haben 75 Startups bei dem dreimonatigen Accelerator mitgemacht. Den Strukturwandel hat das noch nicht bewirkt. Von den Startups wollen sich laut Gerhardt bisher gerade einmal acht bis neun dauerhaft ansiedeln. Drei Startups stammen sowieso aus der Region.

Eines von ihnen ist Plastic Fischer aus Köln, gegründet von drei Freunden. Sie beschäftigen etwa 70 Mitarbeiter in Asien, wo sie an verschiedenen Orten verzinkte Gitter in Flüsse hinablassen. Dort verfangen sich große Plastikteile, bevor sie im Meer landen
ANZEIGE
Carsten Gerhardt will in Wuppertal viel bewegen. Hier steht er auf einer alten Bahntrasse, die dank seiner Initiative zum Radweg wurde

und Fische töten könnten. Dieses Plastik sammelt das Startup. Was sich recyceln lässt, wird recycelt. Das meiste kann nur noch verbrannt werden, um Energie zu gewinnen. Denn Plastik lässt sich nicht immer wiederverwerten. Hängen verschiedene Kunststoffe aneinander, wird es schwierig. Aber was hat das mit dem Wuppertaler Circular Valley zu tun? Ganz einfach: In Wuppertal entsteht ein kleiner Teil des Mülls, den Plastic Fischer aus den Flüssen in Asien fischt. Etwa bei Knipex. Das ist einer jener Werkzeughersteller, für die Wuppertal seit der Industriellen Revolution bekannt ist. Er produziert seit 140 Jahren Zangen; in einem Museum auf dem Werksgelände kann man Lockenbrennzangen aus dem 20. Jahrhundert besichtigen oder Kugelzangen aus dem 19. Jahrhundert. Knipex erzielt 60 Prozent des Jahresumsatzes von mehr als 200 Millionen Euro im Ausland und hat dort ein gutes Image.
Wie motivier t, produk tiv und zufrieden ist Ihr Team? Genau hier für sind ausgezeichnete Führungskräf te entscheidend Mit der kostenlosen Checkliste von Personio er fahren Sie, wie Sie Führungskompetenzen schulen, wie Führungskräf te zu Kultur trägern in Ihrem Unternehmen werden und mit welchen Mit teln Sie New Work Leadership fördern Jetzt Checkliste herunterladen personio.de
Auch deswegen will das Unternehmen nachhaltiger wirtschaften. Es hat als erstes von 35 Unternehmen das Plastik-Start-up Plastic Fischer unterstützt. Kennengelernt haben sich die Firmen über das Netzwerk des Circular Valley. 40 Tonnen Plastik hat der Zangenhersteller dem Start-up schon »abgekauft«. Was nicht bedeutet, dass Knipex das recycelte Plastik aus Asien erhält, sondern dass es dessen Wiederverwertung finanziert. Die Menge entspricht ungefähr der Menge Plastik, die Knipex in den vergangenen 15 Monaten als Verpackung für seine Zangen nach Asien verschickt hat.
Sicher: Eine echte Kreislaufwirtschaft entsteht so nicht. Trotzdem ist Ralf Putsch vom Projekt überzeugt. Der 66-Jährige leitet Knipex in vierter Generation. Dank des Circular Valley würden er und andere Unternehmer sich über Kreislaufwirtschaft mehr Gedanken machen und neue Strategien entwickeln, sagt er. »Als Unternehmen wollen wir ganzheitlich etwas Sinnvolles tun. Und wer das will, muss die natürlichen Lebensgrundlagen schonen.«
Deswegen grasen auf dem Betriebsgelände heute Schafe, und es gibt Äpfel von der eigenen Streuobstwiese für die 1600 Beschäftigten. Das Unternehmen hat ausgerechnet, dass es 2021 rund 21.700 Tonnen Treibhausgase emittierte – alle Zulieferungen eingerechnet. Bis 2030 will das Unternehmen diesen Ausstoß um etwa 50 Prozent senken. Die Schmiedeanlagen versorgen mit ihrer Abwärme jetzt das Heizungssystem. Die Formen, aus denen Werkzeuge gestanzt werden, wurden optimiert, damit weniger Metallreste anfallen. Die Reste werden eingeschmolzen und wiederverwendet. Das ist wirtschaftlicher und nachhaltiger. Für seinen Einsatz hat das Unternehmen 2018 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
Die »low hanging fruits«, das, was einfach ist am Umweltschutz, hat die Firma also schon geerntet. Jetzt wird es schwieriger, etwa bei den Plastikgriffen der Zangen. Sie sind nicht nur Zierde, sie schützen die Handwerker – etwa vor Stromschlägen. Deswegen sind die Zangen so hergestellt, dass sich das Plastik keinesfalls vom Metall löst. Wie soll man beide Stoffe trennen? Und was könnte man mit dem abgenutzten Plastik anfangen?
12,6 %
beträgt in Deutschland der Anteil der Abfälle an allen Rohstoffen, die genutzt werden. Damit liegt die Bundesrepublik bei diesem wichtigen Indikator der Kreislaufwirtschaft hinter Ländern wie den Niederlanden, Frankreich und Italien auf Rang 6 in der EU. Zudem war der Anteil zuletzt leicht rückläufig Quelle: Eurostat
Doch womöglich wächst im Valley rund um Wuppertal schon die Lösung für dieses Problem von Knipex heran. Knapp 13 Kilometer östlich, das Morsbachtal hinauf nach Remscheid, bei Christian Haupts: Der Unternehmer leitet das Unternehmen Carboliq, das den »Kunststoffkreislauf schließen« will. Konkret bedeutet das: Haupts hat eine Anlage entwickelt, die altes Plastik in sein Ursprungsprodukt zurückführt – Öl.
Dafür rührt Haupts die alten Kunststoffe in heißes Öl, wodurch diese wieder flüssig werden. Das verwendete Plastik müsse nicht sortenrein sein, und hinterher könne man aus dem Öl herstellen, was man wolle – genauso Kraftstoff wie Verpackungsmaterial.
Zangen wie die von Knipex bestehen aus Metall und Plastik. Sie zu recyceln ist gar nicht so leicht
Haupts ist ein Kaufmann, der mit Fachbegriffen jongliert und seine Technologie im Stil der Sendung mit der Maus erklärt. Was der 55-Jährige nicht so gut kann, ist Marketing. Also hat er beim Accelerator von Gerhardt mitgemacht, damit sich sein Verfahren des chemischen Recyclings durchsetzt. »Wo ich vorher nur ein Mittelständler war, bin ich jetzt Teil des Circular Valley«, sagt Haupts. Das öffne Türen. Bisher produziert Carboliq mit einer Anlage rund 1000 Tonnen Recycling-Öl pro Jahr, genug für etwa 800 Tonnen Kunststoff. 2025 soll eine zweite Anlage mit zehnfacher Leistung in Betrieb gehen. Das Plastik dafür stammt aus der Region. Beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie beobachtet man Projekte wie dieses mit Neugierde, ein echtes Ökosystem sei noch nicht entstanden, heißt es. Es fehle auch an Wagniskapital, damit sich mehr innovative Firmen ansiedeln, die mit den Abfällen der Region etwas anfangen können. Immerhin hat Gerhardt schon mal bewiesen, dass er Menschen und Firmen zusammenbringen kann. 2006 gründete er einen Verein, mit dem er eine stillgelegte Bahntrasse quer durch Wuppertal zur Spaziermeile machte. Hunderte Bürger führte er damals über die verwilderten Schienen und begeisterte die Wuppertaler für seine Idee – die Stadtpolitik musste folgen. Der grüne Weg führt in Viadukten über die Dächer Wuppertals. Früher hielten die Lokomotiven den Standort am Leben, heute steht die Strecke für den Stolz der Bürger auf ihre Stadt. Und damit ist viel zu erreichen.





Al s e r s te s vo lle le k tr i s ch e s F o r d N u t z f a h r ze u g r e vo lu ti o n i e r t d e r F o r d E-Tr a n s i t d i e Kl a s s e d e r Tr a n s p o r te r. Er ko m b i n i e r t d i e b e w ä h r te n Q u ali t äte n d e s F o r d Tr a n s i t m i t e i n e r r e i n e le k tr i s ch e n Re i chw e i te vo n b i s z u 317 k m 1 u n d b i e te t e i n e m a x i m ale N u t z l a s t vo n b i s z u 1.600 k g s ow i e 4 4 Ko n f i gu r ati o n s o p ti o n e n In Ko m b in ati o n m i t F o r d Pr o – d e m n e u e n Ve r tr i e b s- u n d S e r v i ce a n ge b o t vo n F o r d – e r r e i ch e n Si e Ih r e m a x i m ale Pr o d u k ti v i t ät









G emäß Wor ld w ide Har m onis e d Light Vehicle s Te s t Pro ce dure (WLTP) Bei voll au fgeladener B at ter ie eine s Ford E-Tran sit 390 L 2 is t eine Reichweite bis zur genannten, zer tif izier ten elek tr is chen Reichweite von 317 k m – je nach vor handener Ser ien- und Bat ter ie -Konf iguration – m öglich Die tat s ächliche Reichweite kann au f gr und unter s chie dlicher Fak toren (z B Wet ter b e din gungen, Fahr ver halten, Stre ckenprof il, Fahr zeug zus tand, Alter und Zus tand der Lithium -Ionen-Bat ter ie) var iieren









Sunfire aus Dresden entwickelt und baut Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff herstellen können. Die junge Firma hat Kunden, Mitarbeiter und Kapital –ihr Gründer Nils Aldag bleibt dennoch vorsichtig VON
 Nils Aldag, 37, will den Klimawandel mit Innovationen stoppen
Nils Aldag, 37, will den Klimawandel mit Innovationen stoppen
Es ist ein Ort mit einer fossilen Vergangenheit. Die Zentrale der Firma Sunfire steht in der Gasanstaltstraße im Dresdner Westen, nur ein paar Meter entfernt vom Panometer: einem Betonkoloss, der die Stadt früher mit Erdgas versorgt hat. Heute ist der Speicher ein Industriedenkmal und Museum. Gleich daneben, in einem sanierten DDR-Bau mit angeschlossenen Werkshallen, arbeitet Nils Aldag, der Gründer von Sunfire, am Übergang in eine klimaneutrale Zukunft.
Sunfire will hier das Geschäft mit Wasserstoff groß aufziehen. Die Firma entwickelt und verkauft Elektrolyseure – chemische Anlagen, die mithilfe von Strom Wasserstoff produzieren. Wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt, spricht man von grünem Wasserstoff. Der gasförmige Energieträger soll ein Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität werden. Überschüssige Energie aus Solar-, Windund Wasserkraftanlagen könnte in grünem Wasserstoff gespeichert werden, Stahlwerke könnten damit grünen Stahl produzieren, sogar Containerschiffe damit klimaneutral fahren und Flugzeuge grüner fliegen.
Das jedenfalls ist die Hoffnung.
In diesen Zeiten spürt Aldag mehr Zuspruch denn je für sein Vorhaben. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden und wegkommen von fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, will man sich möglichst schnell vom Erdgas unabhängig machen, das lange günstig in Russland zu haben war.
Wasserstoff soll helfen: Die Ampelparteien nennen ihn in ihrem Koalitionsvertrag einen »Energieträger der Zukunft« und haben sich vorgenommen, die Produk-
tion in Deutschland zu fördern. Die Nationale Wasserstoffstrategie bescheinigt ihm eine »zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und Vollendung der Energiewende«. Bis 2030 soll die Elektrolysekapazität nach dem Willen der Ampel auf etwa zehn Gigawatt wachsen – aktuell liegt sie erheblich darunter, und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften erwartet, dass die geplanten Projekte bei Weitem nicht ausreichen.
Auf Unternehmen wie Sunfire kommt es also an. Sie sollen helfen, den Traum von der grünen Wasserstoffwirtschaft real werden zu lassen. Doch die Geschichte des Start-ups zeigt, dass dazu mehr gehört als passende Technologien, gute Mitarbeiter und investitionswillige Kunden. Es braucht eine Politik, die vieles schneller umsetzt als bisher.
Deswegen bleibt Nils Aldag vorsichtig. Obwohl Energiekonzerne wie RWE oder Stahlproduzenten wie die Salzgitter AG bereits Elektrolyseure von Sunfire nutzen. Auf dem Dresdner Gelände steht eine Werkhalle, hier ist der Kern der Technik zu besichtigen: kleine Platten, auf denen Zellen sind, um Wasser aufzuspalten. Diese werden zu einem sogenannten Stack gestapelt, viele davon ergeben ein Modul, mit viel Elektronik wird daraus eine Elektrolyseanlage. Im April hat Sunfire den weltweit größten Hochtemperatur-Elektrolyseur in einer Raffinerie in Rotterdam installiert. Gut 600 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile für Aldag, an vier Standorten in Deutschland und der Schweiz.
Die Firma hat also einen Lauf. Aber von Durchbruch sprechen? Das will Aldag nicht. »Wir erleben gerade, dass sich eine völlig neue Branche herausbildet. Da ist nicht immer alles geradlinig«, sagt er. Sunfires bisherige Erfolge sorgten eher dafür, dass er auch »die schwierigen Zeiten« durchsteht.
Aldag zu treffen kann etwas dauern. Er pendelt zwischen den Standorten umher, trifft sich mit Wasserstoffverbänden, redet mit Politikerinnen und Politikern in Berlin und Brüssel. Beim Besuch in der Dresdner Zentrale entschuldigt er sich, dass er müde aussehe, viel Arbeit. Viele Turbulenzen.
Vor allem im vergangenen Jahr hat sich das Tempo erhöht, weil viele Unternehmen jetzt alternative Energieträger ausprobieren,
um vom Gas loszukommen und ihre Klimaziele zu erfüllen. »Beim Wasserstoff fängt jetzt eine exponentielle Phase an. Diese Beschleunigung merkt man an allen Ecken und Enden«, sagt Aldag. Er bezeichnet die Lage als »eigenartig«: Die politischen Ziele seien enorm hoch, die Spielregeln für die Produktion von grünem Wasserstoff aber nicht ausreichend definiert. Anbieter wie Sunfire bauen ihre Produktion im Rekordtempo aus, Industrieunternehmen setzen auf Wasserstoff, es werden Projekte vorbereitet. Alles im Glauben daran, dass es bald losgehe, so Aldag. Doch damit alle die »angezogene Handbremse lösen«, bräuchten sie einen verlässlichen regulatorischen Rahmen, Nachfrageanreize und Unterstützung bei der Wachstumsfinanzierung. Das müsse die Politik nun liefern. »Politische Ziele allein machen noch keinen echten Markt.«
Aber Aldag kennt sich auch mit Gegenwind aus. Sunfire operierte lange in einer Nische, der Unternehmer und seine Mitstreiter wurden oft belächelt. Sie brauchten Risikobereitschaft und sehr viel Geduld. Ihre Geschichte handelt von jungen Unternehmern aus Westdeutschland, die früh an ihre Idee glaubten, Geld einsammelten und nach Ostdeutschland kamen, weil sie hier Partner fanden, um ihre Pläne umzusetzen.
Aldag wird 1986 geboren, er wächst in Hamburg auf, Vater und Großvater sind Unternehmer im Biotechnologiebereich. Das fasziniert ihn, also studiert er Betriebswirtschaftslehre. Ein Öko ist er nach eigenen Worten nicht, er besucht keine Demos, engagiert sich nicht für den Umweltschutz. Aber er ist neugierig und will wissen, wie sich der Klimawandel mit Innovationen stoppen lässt: Seine Abschlussarbeit schreibt er darüber, welche unternehmerischen Chancen erneuerbare Energien bieten.
Es ist das Jahr 2009, Aldag hat sein Studium gerade abgeschlossen, als er sich mit zwei Bekannten unterhält: Christian von Olshausen, den er aus Schulzeiten in Hamburg kennt, und Carl Berninghausen. Zusammen beschließt das Trio, Sunfire zu gründen. Die drei ticken unterschiedlich, hatten aber zur selben Zeit die Erkenntnis: Mit Strom aus Sonne und Wind allein wird
die Energiewende nicht gelingen, man muss auch Strom in Moleküle umwandeln. Olshausen ist der Techniker im Team, er ist studierter Ingenieur. Berninghausen bringt Geschäftserfahrung und Kapital mit, Aldag kann Businesspläne schreiben.
Zunächst nehmen sich die Gründer vor, Projekte zur Erzeugung von E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen, zu entwickeln. Doch auf dem Markt fehlen einsatzfähige Technologien, besonders Maschinen zur Herstellung von grünem Wasserstoff, den man für E-Fuels braucht. Also beginnen sie selbst, solche Maschinen zu entwickeln.
Im Jahr 2011 hören Aldag und seine Mitgründer von Staxera. Das Start-up aus Dresden beschäftigt zwei Dutzend Ingenieure, die an Brennstoffzellen arbeiten. Das macht Aldag und Co. neugierig. Denn während in einer Brennstoffzelle Wasserstoff und Sauerstoff reagieren, um Strom zu erzeugen, verwenden Elektrolyseure ähnliche Komponenten, um das Gegenteil zu erreichen: Sie nutzen Strom, um Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Sunfire übernimmt Staxera, die Ingenieure sind eine wichtige Verstärkung.
Und sie sind der Grund, warum Sunfire von Bremen nach Dresden zieht. »Vom Spirit passt Sachsen, weil es hier viel Begeisterung für technische Innovationen gibt«, sagt Aldag, außerdem gebe es hervorragende Forschungsinstitute, Hochschulen, Ingenieure. Er hat inzwischen drei kleine Kinder, fühlt sich in Dresden »völlig zu Hause«.

In den Jahren nach dem Umzug muss Sunfire viele Rückschläge meistern – etliche Male glauben die Gründer, dass sie scheitern könnten. Zum Beispiel als die Europäische Kommission 2018 mit der ErneuerbareEnergien-Richtlinie ein wichtiges Gesetz zur Nutzung von grünem Wasserstoff erlässt. Die Freude bei Sunfire ist zunächst groß. »Eine der wichtigsten Fragen, nämlich wie der Wasserstoff seine grüne Eigenschaft nachweisen kann, wurde darin jedoch offengelassen«, sagt Aldag. Etliche Projekte hätten sich um Jahre verzögert, die Finan-
zierung der Firma habe auf der Kippe gestanden. Erst Ende 2022 klärt sich die Lage. Immer wieder brauchen die Gründer zudem Geld, um Sunfire aufzubauen. Sie sammeln 80 Millionen Euro Fördermittel bei der EU, beim Bund und beim Land Sachsen ein. Das meiste Geld besorgen sie sich aber bei privaten Geldgebern, in Summe bereits »knapp eine Milliarde Euro«, erzählt Aldag. Über die Jahre beteiligen sich um die 25 Fonds und Einzelinvestoren, auch der US-Konzern Amazon steigt ein. »Wir müssen uns heute mit mehr Gesellschaftern abstimmen als in den Anfangsjahren, das ist aufwendiger«, sagt er. »Andererseits konnten wir durch das Kapital ein sehr wertvolles Unternehmen schaffen.« Und auch wenn er selbst nur noch einen einstelligen Anteil an seiner Firma halte, könne er als ihr Chef »noch viel Einfluss« nehmen.
Vor allem die ersten Finanzierungsrunden sind Wackelpartien. Das Interesse der Politik liegt in den 2010er-Jahren auf Solar- und Windstrom sowie Batterieautos,
»Die Erfolge, die wir erleben, sorgen dafür, dass man die schwierigen Zeiten durchsteht«Nils Aldag über die Entwicklung seines Unternehmens Sunfire
Als verlässlicher Partner unterstützen wir Unternehmen dabei, Erfolg zu schaffen, der sich nicht nur in Zahlen bemisst. Mit großer Leidenschaft, Fachwissen und der ganzen Kraft eines großen Versicherers entwickeln wir ganzheitliche Absicherungs- und Vorsorgelösungen – für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter, Sie und Ihre Kunden. Und sind für Sie da – gestern, heute und in Zukunft.



Erleben Sie Partnerschaft für den Erfolg: www.ruv.de/firmenkunden
 PARTNERSCHAFT FÜR DEN ERFOLG
PARTNERSCHAFT FÜR DEN ERFOLG
das ändert sich erst mit der Europäischen Wasserstoffstrategie 2020. Ans Aufgeben hätten die Gründer trotzdem nie gedacht, erzählt Aldag. »Uns zeichnet aus, dass wir alle hart im Nehmen und resilient sind.«
Außerdem ist da der Glauben an die Technologie. Sunfire bietet zwei verschiedene Verfahren an, die Alkali- und die Hochtemperatur-Elektrolyse. Schaltet man einzelne Anlagen zusammen, erreicht die Leistung um die 100 Megawatt – so viel wie mehrere große Windräder. 15 bis 20 der 80 Tonnen schweren Anlagen will Sunfire in den kommenden zwei Jahren ausliefern. Der Preis: etwa eine Million Euro pro Megawatt installierter Leistung. Aldag geht davon aus, dass die Preise künftig sinken werden.
Die Gründer haben erst überlegt, in Dresden eine Fabrik zu bauen, entschieden sich aber für einen anderen Weg. Seit Neuestem kooperiert Sunfire mit Vitesco, einem Autozulieferer in Westsachsen. Weil weniger Teile für Dieselmotoren gebraucht werden, will Vitesco einen Teil der Produktion um-
stellen und künftig Stacks, die Herzstücke von Elektrolyseuren, für Sunfire bauen. Außerdem hat Sunfire in Solingen einen Galvanik-Spezialisten übernommen. Er beschichtet Zellen metallisch, sie sind Kernbestandteile von alkalischen Elektrolyseuren.

Aldags größte Sorge ist also nicht die Nachfrage, das Kapital oder die Personalakquise. Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Politik. Mitte 2022 hat das Bundeswirtschaftsministerium Sunfire ermöglicht, mit der Serienfertigung ihrer Elektrolyseure zu beginnen. Das sei »ein starkes Zeichen«, lobte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck damals, »auch für den Standort Deutschland und den Standort Sachsen«.
Nun aber erschweren viele offene Fragen den Weg. Die Definition von grünem Wasserstoff sei zwar auf europäischer Ebene geklärt worden, die Umsetzung in deutsches Recht stehe aber aus, sagt Aldag. »Außerdem ist grüner Wasserstoff heute teurer als fossile Alternativen.« Am wichtigsten ist es ihm nun, dass seine Branche einen Anschub be-
kommt. »Kunden brauchen Anreize, um auf die saubere Variante umzusteigen.«
Aldag und die anderen Gründer lobbyieren deswegen oft in Berlin und Brüssel für mehr Unterstützung. Sie wünschen sich einen Beschleuniger, der ihrer Branche so zum Durchbruch verhilft wie einst das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz der Solar- und Windbranche. Unternehmer wie er schauen neidisch in die USA, wo die Politik die Wasserstoffwirtschaft mit Subventionen und Steuerrabatten für Wasserstoffproduzenten boostert. Der Unternehmer
hofft: »Wenn Politik und Industrie gemeinsam mutig voranschreiten, dann stehen die Chancen gut, dass die nächste Erfolgsstory wie die der Automobilkonzerne von einem Elektrolyse-Unternehmen wie unserem geschrieben wird.«
Ob Sunfire noch scheitern könnte? Aldag sagt, die Aussicht auf Erfolg sei nie besser gewesen; er sei überzeugt vom grünen Wasserstoff als Zukunftstechnologie. Aber ganz ausschließen will er das Scheitern nicht.
»Politische Ziele allein machen noch keinen echten Markt«Nils Aldag lobbyiert in Berlin und Brüssel für mehr Unterstützung der Wasserstoffwirtschaft


B e i d e s a u s e i n e r H a n d : U n s e r e E n t r e p r e n e u r & E n t e r p r i s e B e r a t u n g b e t r a c h t e t S i e u n d I h r U n t e r n e h m e n a l s E i n h e i t u n d g i b t A n t w o r t e n a u f Z u k u n f t sf r a g e n
Bisher brauchten Unternehmer:innen eine Privatbank und zusätzlich eine Bank für F i r m e n fi n a n z e n B e i u n s b e r ä t e i n Te a m b e i d e B e r e i c h e , m i t d e n S c h w e r p u n k t e n E n e r g i e , M o b i l i t ä t u n d D i g i t a l i s i e r u n g D a s h e i ß t , S i e m ü s s e n w e n i g e r e r k l ä r e n , b e k o m m e n m a ß g e s c h n e i d e r t e L ö s u n g e n u n d n u t z e n S y n e rg ie n M e hr er f ah r en a uf b e t hm a nn b an k - u n t er ne h me n .d e




Echt. Nachhaltig. Privat.

Ralf Pollmeier hat ein riesiges Sägewerks unternehmen aufgebaut. Nun steht sein Geschäft im Mittelpunkt eines Zielkonflikts um die Frage: Was ist nachhaltig?
Ralf Pollmeier hastet über einen metallenen Laufsteg oberhalb seiner Maschinen. Unter ihm poltert und kreischt es. Buchenstämme rumpeln über Förderanlagen und werden von einer riesigen Kreissäge in drei Meter lange Stücke zerteilt. Dann gleiten sie weiter durch Pollmeiers Sägewerk, von einer Station zur nächsten. Am Ende sind nur noch Bretter übrig.
»Hier ist alles weitgehend automatisiert«, sagt der Unternehmer. Nur wenige Menschen sind zu sehen, und wenn Pollmeier sie trifft, begrüßt er sie mit Handschlag. Er hat alles hier selbst entwickelt und aufgebaut: die Maschinen, die Sägen, das Lager. Sein Name, Pollmeier, steht in riesigen Lettern draußen an der Halle.
Hier in Aschaffenburg betreibt der 61-Jährige, der als junger Mann sein BWLStudium geschmissen hat, um in der Holzindustrie sein Glück zu versuchen, ein Laubsägewerk. Insgesamt unterhält sein Unternehmen drei davon, eines an seinem Stammsitz in der Kleinstadt Amt Creuzburg im thüringischen Wartburgkreis. Pollmeiers Werke sind wohl die modernsten und größten in ganz Europa. Obwohl Bäume schon seit Jahrhunderten zu Brettern gesägt werden, hat er aus dem Nichts ein Imperium aufgebaut: 1000 Mitarbeiter, 300 Millionen Euro Umsatz und »hochprofitabel«, wie er betont. Bloß mit Buchen.

Neuerdings kommt Pollmeier aber ins Grübeln, wenn es um seinen Rohstoff geht. Dann verschränkt er die Arme vor seinem blauen Pulli, an dem feiner Holzstaub hängt: »Bei vielen Produkten des Alltags können wir Plastik durch Holz ersetzen«, sagt er dann, »aber dazu muss die Politik es auch ermöglichen, dass dieser Rohstoff genutzt werden kann.«
Der Satz führt mitten in eine intensive Debatte um die Zukunft der Wälder: Soll man sie stilllegen, sie also nicht mehr bewirtschaften? Oder soll man auch künftig Bäume fällen, vielleicht sogar mehr als heute, um diese zu verarbeiten?
An der Antwort hängt mehr, als man denken könnte: der Klimaschutz etwa, weil Wälder sehr viel CO₂ binden. Der Umweltschutz, weil sich die Flut von Plastikmüll eindämmen ließe, wenn man mehr Dinge
VON MARCUS ROHWETTERaus Holz herstellte. Auch der Artenschutz, weil Tiere und Pflanzen am liebsten ihre Ruhe haben vor den Maschinen der Forstwirtschaft. Die vielen Wechselwirkungen machen die Sache mit dem Holz kompliziert. Und damit auch das Leben eines Unternehmers, dessen Geschäft sich im Mittelpunkt eines aktuellen Zielkonflikts befindet: Wie viel Nachhaltigkeit ist ökologisch geboten, wie viel ökonomisch vertretbar?
Wie kompliziert die Gemengelage ist, das zeigt sich am Beispiel der Buche. »Wir stoppen den Einschlag in alten, naturnahen Buchenwäldern in öffentlichem Besitz«, heißt es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Den hat auch die SPD unterschrieben, jene Partei, der Pollmeier seit mehr als vier Jahrzehnten angehört, für die er sich im Amt Creuzburg in der Kommunalpolitik engagiert und der er mehrfach große Summen gespendet hat. Das schwarz
grün regierte Bundesland Hessen – ein wichtiger Lieferant für sein Sägewerk in Aschaffenburg – praktiziert diese Stilllegung schon. In den hessischen Staatsforsten läuft bis zum Herbst ein »BuchenMoratorium«, das nun möglicherweise verlängert wird.
Auf Pollmeiers Werksgelände sieht es nicht nach Stillstand aus. Vor der Halle türmen sich Buchenstämme zu häuserblockgroßen Stapeln. Sie kommen per Schiff über den Main, per Bahn, per Lastwagen. Ein Arbeiter steuert ein baggerähnliches Greifgerät, packt einzelne Stämme und wirft sie auf ein Förderband, auf dem sie ins Innere des Sägewerks verschwinden.
Buchen sind keine Nadelhölzer, ihr Holz ist anders beschaffen, sie wachsen krummer. Deswegen sind Sägewerke auf einzelne Baumarten spezialisiert. »Fichte zu sägen ist wie Spargelschälen«, sagt Pollmeier und meint damit auch: Buchen sind anspruchs
voller. Die meisten Konkurrenten würden deswegen in der Regel erst Bestellungen von Kunden abwarten, bevor sie lossägten. Pollmeier sah darin eine Marktlücke. Er hat ein riesiges BuchenStandardsortiment auf Halde produziert. In seinem Hochregallager liegen etwa 25.000 Paletten, die er sofort verschicken kann. Durch Automatisierung und Standardisierung könne er bis zu 30 Prozent günstiger liefern als klassische Laubsägewerke, sagt der Unternehmer.
Gerade wird eine Ladung nach Mexiko vorbereitet. Für einen Kunden aus der Möbelindustrie. Buche wird oft zu Tischen, Stühlen, Fensterbänken und Treppenstufen, aber auch zu Kleiderbügeln, Bürsten und Schuhspannern verarbeitet. Heute werden allerdings viele Alltagsgegenstände aus Plastik gefertigt. Diese durch Buchenholz zu ersetzen wäre kein Problem. Das würde Müll sparen.
Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) treiben mit ihrer anwendungsbezogenen Forschung neue Lösungsstrategien für konkrete gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen voran.
Ü b e r M ö g l i c h ke i te n , d i e p ra x i s e r f a h re n e P ro fe s s o r i n n e n u n d P ro fe s s o re n a n d e n H AW h a b e n , u m a u c h i n S a c h e n N a c h h a l t i g ke i t W i r k u n g z u e r z i e l e n , b e r i c h te t P ro f D r - I n g J u l i a Ke s s l e r S i e l e h r t u n d fo r s c h t a m Fa c hb e re i c h M a s c h i n e n b a u u n d Ve r f a h re n s te c h n i k d e r H o c h s c h u l e N i e d e r r h e i n .
Nachhaltigkeit ist ein viel beachtetes Thema unserer Zeit Welche Rolle spielt der Maschinenbau für eine klimagerechte Zukunft?
Damit die Ziele Deutschlands und der EU, bis 2050 k l i m a n e u t ra l z u s e i n , e r re i c h t we rd e n kö n n e n , müssen Industrieunternehmen die CO₂-Emissionen re d u z i e re n E s we rd e n n e u e, k l i m a g e re c hte P rod u k t i o n s p ro z e s s e u n d - t e c h n o l o g i e n b e n ö t i g t , wo ra u s s i c h f ü r M a s c h i n e n - u n d A n l a g e n b a u e r neue Chancen ergeben So hat der Maschinenbau d i e M ö g l i c h ke i t , e nt s p re c h e n d e A n l a g e n z u fe r t ig e n , d i e d a z u b e i t ra g e n , d a s s U n te r n e h m e n d i e Klimaziele erreichen können



Sie lehren und forschen an einer HAW Können gerade die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zeitnah auf Herausforderungen, beispielsweise in Sachen Klimaschutz, reagieren?
HAW sind definitiv in der Lage, fle bel auf Herausforderungen, zum Beispiel den Klimaschutz, zu reagieren Sie sind sogar gefordert, sich mit aktuellen Entwicklungsaufgaben wie der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen Die Hochschule Niederrhein hat sich zum Beispiel dem Prinzip der Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung und Organisation verpflichtet. Es werden etwa vorhandene Nachhaltigkeitsaspekte innerhalb der Lehre kontinuierlich ausgebaut und Studierende interdisziplinär für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert
ir wollen im eigenen Hochschulbetrieb eine Vorbildrolle einnehmen
Wie würden Sie den Impact beschreiben, den eine HAWProfessur in Sachen Nachhaltigkeit ben kann?
H AW- P ro f e s s u re n kö n n e n e i n e n h o h e n I m p a c t a u f N a c h h a l t i g k e i t s a s p e k t e h a b e n , d a S i e e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Vo r t e i l b i e t e n : S i e s i n d e n g m i t d e r P ra x i s ve r b u n d e n D u rc h d i e s e N ä h e , i n t e n s i ve D i a l o g e o d e r a b e r i n n ova t i ve F& E- P ro j e k te ka n n e i n e n a c h h a l t i g e E ntw i c k l u n g gemeinsam vorangetrieben werden. HAW können G e st a l te r i n n e n n a c h h a l t i g e r Zu ku nf t s e i n , i n d e m Sie Impulse setzen, Innovationen entwickeln und umsetzen sowie exzellente Fachkräfte ausbilden
KA R R I E R E M I T W I R KU N G –
D I E H A W- P R O F E S S U R
A n e i n e r H o c h s c h u e f ü r A n g ewa n d te W s s e n s c h a f te n i s t e i n e P ro fe s s u r a u c h o h n e e i n e H a b i l i t a t i o n m ö g l i c h E s i s t v i e l m e h r d i e B e r u f s - u n d Le h re r f a h r u n g d i e a n d e n p ra x i s - u n d a nwe n d u n g s b e zo g e n e n H o c h s c h u l e n z ä h l t D i e Fre i h e i t e i g e n e S c hwe r p u n k te i n Fo rs c h u n g u n d Le h re z u s e t ze n , d i e Ve r k n ü p f u n g vo n T h e o r i e u n d P ra x s u n d d i e M ö g l i c h ke i t j u n g e M e n s c h e n f ü r h r Fa c h g e b i e t z u b e g e i s te r n , h a t d e H AW- P ro fe ss u r i n d e n l e t z te n J a h re n m e h r u n d m e h r z u e n e r a t t ra k t ve n K a r r e re o p t i o n f ü r Fa c h - u n d Fü h r u n g s k rä f te d e r f re i e n W i r t s c h a f t we rd e n l a s s e n M e h r I n fo s d a z u f i n d e n s i c h h i e r : www h aw- p ro fe s s u r d e
WO B E R U F Z U R B E R U F U N G W I R D –D I E H O C H S C H U L E N F Ü R A N G E WA N DT E W I S S E N S C H A F T E N N e b e n d e r p ra x i s n a h e n L e h re l e g t d e r F o k u s a n H AW h e u t e a u c h a u f F o r s c h u n g u n d Tra n s f e r G e ra d e i n t e rd i s z i p i n ä re F o r s c h u n g i s t d a b e i e i n e d e r S t ä r ke n d e r H AW A l s p ra x i s o r i e n t i e r t e B l d u n g s i n s t i t u t o n e n F o r s c h u n g s e n r i c h t u n g e n , M o t o r f ü r v i e l f ä l t i g e I n n ova t i o n e n , P a r t n e r d e r k e i n e n u n d m i t t l e re n U n t e r n e h m e n ( K M U ) u n d Tra n s f e r p l a t t f o m s n d d i e H AW a u s d e r d e u t s c h e n H o c h s c h u l a n d s c h a f t n i c h t m e h r we g z u d e n ke n
Zum Bau von Häusern taugt Buche hingegen nur bedingt, anders als Nadelholz. Zwar hat ausgerechnet Pollmeier auch eine Methode entwickelt, um aus geschälter Buche stabiles Bauholz zu machen. Aber das, so sagt er selbst, werde wohl ein Nischenprodukt bleiben. Die Hoffnung von Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, man könne künftig auf Beton verzichten und sich mit Holz sogar »aus der Klimakrise herausbauen«, dürfte die Buche nicht erfüllen.
Gegenüber Nadelhölzern hat die Buche noch einen Nachteil. Fichten sind schnurgerade und haben eher dünne Zweige. Der Großteil einer Fichte geht folglich in den Bau, und nur ein kleiner Anteil wird zu Nebenprodukten – etwa zu Brennstoff – verarbeitet. Laubbäume wie die Buche haben üppige Kronen mit vielen Ästen, die nicht zur Möbelproduktion taugen. Im Vergleich zu einer Fichte wird von einer Buche also ein viel größerer Anteil am Ende verfeuert. Und obwohl man Holz künftig stärker als bisher nutzen möchte, möchte man nicht unbedingt mehr davon verfeuern. Weil dann wieder CO₂ frei wird. Und Feinstaub.
Viele dieser Fragen spielen auch bei der Debatte um das Buchen-Moratorium in Hessen eine Rolle. Das Bundesland bezeichnet sich selbst als »Buchenland«, etwa jeder dritte Baum in seinen Wäldern ist eine Buche – mehr als in jedem anderen Bundesland. Um seine Buchenbestände nach der Trockenheit der vergangenen Jahre zu schützen, hat das Land vorübergehend ein Fällverbot ausgesprochen – für jene Buchen, die mehr als 100 Jahre alt sind und in bestimmten Schutzgebieten der staatlichen Forste liegen.
Schon um die Frage, was der Einschlagstopp wirtschaftlich bedeutet, gibt es Streit. Die Holzindustrie fürchtet »erhebliche« Folgen für ihren Nachschub, sollte das Moratorium verlängert werden. Das hessische Umweltministerium entgegnet, es handele sich nur um einen »sehr kleinen Teil der hessischen Waldfläche«, für den man eine besondere Verantwortung trage und zu dessen Schutz man europarechtlich verpflichtet sei.
Auch beim Klimaschutz ist alles nicht so einfach. Auf diesen, so schreibt das staatliche Thünen-Forschungsinstitut für Wald-
ökosysteme, habe die Stilllegung von Buchenwäldern nur einen »begrenzten Effekt«: Alte und naturnahe Wälder könnten nur noch wenig zusätzliches klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO₂) binden, weil sie kaum noch wachsen. Das hessische Umweltministerium sieht hier aber »noch einen hohen Forschungsbedarf«, weil beispielsweise über die Speicherleistung des Waldbodens erst sehr wenig bekannt sei.
Beim Naturschutz gibt es zwar kaum Uneinigkeit darüber, dass ein Einschlagstopp der biologischen Vielfalt nützt, weil vermoderndes Totholz ein idealer Lebensraum für viele Insekten, Pflanzen und Pilze ist. Den Waldbäumen selbst scheint das aber mehr oder weniger egal zu sein. Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt hat hessische Buchenwälder miteinander verglichen, um herauszufinden, wie sie mit den extremen Dürrejahren 2018 und 2019 klargekommen sind. In den stillgelegten Wäldern starben demnach tendenziell mehr junge Bäume, in den bewirtschafteten Wäldern weniger, dafür ältere Bäume. Insgesamt seien die Unterschiede aber gering gewesen.
In diese Unsicherheit hinein muss Hessen entscheiden, ob es sein Buchen-Moratorium verlängert. Mit einem Ergebnis sei »erst gegen Ende des Sommers dieses Jahres zu rechnen«, teilt das Umweltministerium mit.
Für Ralf Pollmeier ist die Sache klar. Es sei alles in allem besser, die Buche zu nutzen, als das nicht zu tun. Aber er ist ja auch befangen: Der Mann hat drei Sägewerke.
Über einen nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Holz nachzudenken lohnt sich trotzdem. Deutschland ist ein waldreiches Land, auf einem Drittel der Landfläche stehen Bäume. Und das werden künftig wohl mehr Laub- als Nadelbäume sein. Prognosen deuten darauf hin, dass sich der Anteil reiner Laubwälder zulasten der Nadel- und Mischwälder bis 2050 etwa verdoppeln dürfte. »Von Natur aus wären 75 Prozent der Waldfläche Deutschlands Buchenwälder«, schreibt das Thünen-Institut. Und wenn der Waldumbau voranschreitet – wie es auch die Bundesregierung will –, dann wird es wieder mehr Buchen geben. Was man dann mit ihnen macht, ist die große Frage der nächsten Jahre.

»Bei vielen Produkten des Alltags können wir Plastik durch Holz ersetzen«
Ralf Pollmeier, 61, SägewerksunternehmerFoto [M]: Pollmeier
Um eine nachhaltige, widerstandsfähige Zukunft zu schaf fen, muss unsere Welt elektrischer und digitaler werden. Hier erfahren Sie, warum und wie.
Der Klimawandel ist in Wir klichkeit eine energiepolitische Herausforder ung
> 80% der weltweiten CO2-Emissionen sind mit der Erzeugung und dem Verbrauch von Energie verbunden
> 80% des Energiebedarfs wird immer noch durch fossile Brennstoffe d kt ge ec
Es gibt bereits die Technologie, um bis 2050 eine Netto-Null-Welt zu er reichen. So sieht es aus:
Netze der Zukunft
60% der Gesamtenergie geht über die gesamte Lebensdauer verloren, hauptsächlich aufgr und der for tgesetzten Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung
~100% Reduktion von CO2-Emissionen
Solarenergie wird auf jedem geeigneten Dach gewonnen
Gebäude der Zukunft ~93% Reduktion von CO2-Emissionen
70% der Gebäude nutzen Wär mepumpen
Infrastruktur der Zukunft
~83% Reduktion von CO2- Emissionen
70% BEVs auf der Straße
Industrie der Zukunft ~84% Reduktion von CO2-Emissionen
70% Recyclingraten
Strom wird mit ~90% er neuerbaren Energien erzeugt
~100% digital 2x mehr Schienenverkehr, 2x weniger Luftverkehr
Die Elektrifizier ung der Industrie steigt auf 40-65 % des Endenergiebedarfs
er neuerbare
Die Stromerzeugung aus er neuerbaren Energien hat einen nahezu 100 %igen Wirkungsgrad über die gesamte Lebensdauer
D i g i t a l e I n n ova t i o n m a ch t E n e r g i e i n t e l l i ge n t M i t d e n h e u t i ge n Te ch n o l o g i e n kö n n e n w i r d a s
U n s i ch t b a r e s i ch t b a r m a ch e n , Ve r s ch w e n d u n g b e s e i t i ge n u n d d i e E ffi z i e n z s t e i ge r n

Gebäude verbrauchen mehr Energie und produzieren mehr CO2 als jeder andere Sektor.
Anteil am globalen Energieverbrauch
Anteil an globalen CO2-Emissionen

Quellen: Schneider Electric™ Sustainability Research Institute, Statista.com, IEA, Irena.org, Iottechnews.com, US Energy Infor mation Administration
se.com/de
Strategisch vorgehen
1 Definieren Sie die Klimastra tegie, um die Ambitionen Ihrer Kunden im Einklang mit der Initiative "Wissenschaftsbasier te Ziele" zu erfüllen.
• Messung der Ausgangssituation des Unter nehmens
• Erstellung eines Fahrplans für die Dekarbonisier ung
• Programm und Management str ukturieren
• Verpflichtung kommunizieren
2 Schaffung einer einzigen Infor ma tionsquelle für Energie- und Nachhaltigkeitsda ten
Digitalisieren
• Überwachung von Ressourcenverbrauch und Emissionen
• Identifizier ung von Einspar möglichkeiten
• Bericht und Benchmarking der For tschritte
















Dekarbonisieren
3 Umsetzung der Dekar bonisier ungsstra tegie
• ELEKTRIFIZIEREN des Betriebs
• VERRINGERN des Energieverbrauchs
• ERSETZEN von Energiequellen
• EINBEZIEHEN der Wer tschöpfungskette
Die führenden Unter nehmen verfolgen einen 3-stufigen Ansa tz: Lorem ipsum
Primärenergie: Die in den Rohstof fen enthaltene Energie; Endenergie: Die verbleibende Energie nach der Umwandlung und Lieferung an die Endverbrauchssektoren vor Ort; Nutzenergie: Die tatsächlichen Einheiten von Bewegung oder Wärme, die vom Verbraucher ef fektiv genutzt werden.
Eine Tochter des Familienkonzerns Melitta lässt in Indien altes Plastik recyceln und zahlt faire Löhne. Das Projekt soll der Umwelt nutzen –und das Image bei den eigenen Mitarbeitern aufpolieren
Raheema Delly führt in eine Halle mit Wellblechwänden, in der sich ein meterhoher Müllberg auftürmt. Fliegen schwirren umher, es stinkt. Hier, zwischen Chipstüten und Pappkartons und Dosen, liegt Dellys Arbeitsplatz. Wenn Lastwagen morgens den Müll bringen, den sie in Hotels oder Haushalten der südindischen Großstadt Bangalore eingesammelt haben, hockt sich die 22-Jährige an den Fuß des Müllbergs auf einen Plastikstuhl und fängt an zu sortieren: Pappe wirft sie auf einen Haufen, Plastik auf einen anderen, Blech auf einen dritten. Elf Stunden geht das so, inklusive Mittagspause. Umgerechnet 130 Euro verdient Delly pro Monat, was in ihrem Land mehr als das Doppelte des Mindestlohns bedeutet. Auch sonst hat es die junge Frau etwas besser als die meisten Müllsortierer im Land: Statt im Freien arbeitet sie unter einem Dach. Statt barfuß im Unrat zu hocken, trägt sie Schlappen. Es sind kleine Fortschritte in einem Job, den in Indien meist die Allerärmsten erledigen, Wanderarbeiter, die von Stadt zu Stadt ziehen, ohne Krankenversicherung oder Schutz vor tyrannischen Chefs.
Fair Recycled Plastic heißt das Projekt, für das Delly arbeitet. 2000 Tonnen Müll sollen im Jahr eingesammelt und – anders als bei den meisten Firmen – recycelt statt verbrannt werden, ohne die »waste picker« auszubeuten. Geschätzte 15.000 bis 20.000 Menschen verdienen in Bangalore ihr Geld mit dem Sammeln und Sortieren von Müll.
Fair Recycled Plastic will sie fair bezahlen
und die Gewinne des Projekts in die Gesundheit und Bildung der Arbeiter und ihrer Familien fließen lassen.
Was, Gewinne?
RGenau: All diese Ziele will Fair Recycled Plastic erreichen, indem es wie andere Unternehmen profitabel wirtschaftet. Die Firma ist ein sogenanntes Sozialunternehmen. Und sie ist eine Tochter des deutschen Familienunternehmens Melitta, das im westfälischen Minden sitzt, zuletzt gut 1,9 Milliarden Euro Jahresumsatz erwirtschaftete und etwa 6000 Menschen beschäftigt. Weltweit bekannt für seine Kaffeefilter, Frischhaltefolien und Staubsaugerbeutel, stellte Melitta im Jahr 2021 laut Nachhaltigkeitsbericht mehr als 60.000 Tonnen Kunststoffe und Kunststoffprodukte her. Verständlich, dass man sich da ums Recyceln kümmert.
Nur: Was verbindet Minden in Westfalen mit Bangalore in Karnataka? Wie kommt ein deutsches Familienunternehmen auf die Idee, etwa 7500 Kilometer Luftlinie entfernt Müll recyceln zu lassen?
Angefangen hat alles vor einigen Jahren in der Chefetage von Cofresco. So heißt die Tochter von Melitta, die Frischhaltefolien
Mitarbeiterinnen in Bangalore sortieren den Müll, bevor er zu Granulat verarbeitet wird
der Marke Toppits und Müllbeutel der Marke Swirl herstellt. Nach ihren Angaben nutzen europaweit etwa 70 Millionen Haushalte diese Kunststoffprodukte. Und manche bringt das zum Nachdenken: Vor einigen Jahren war die Tochter eines Cofresco-Managers in Nepal unterwegs und schickte ihrem Vater ein Foto von dem Plastikmüll, der dort herumlag. Dann fragte sie ihn, was er denn dagegen tue – als Mitarbeiter eines Unternehmens, das kilometerweise Plastikfolien herstellt. Das beschäftigte auch Oliver Strelecki, der damals der Marketingchef von Cofresco war und seit 2020 ihr Geschäftsführer ist. »Wir wollten uns wieder in die Augen schauen können«, erzählt Strelecki. »Also haben wir damals überlegt, was wir als Hersteller von Plastikprodukten gegen die weltweite Verschmutzung mit Plastik tun können.«
Diese Verschmutzung ist gewaltig: Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen Unep werden weltweit pro Minute eine Million Plastikflaschen verkauft und pro Jahr fünf Billionen Plastiktüten verwendet. Etwa die Hälfte dieser Plastikteile wird nur einmal benutzt und dann oft ein-

fach weggeworfen. So entstehen pro Jahr rund 400 Millionen Tonnen Plastikmüll.
In Summe haben sich auf der Erde über die Jahrzehnte etwa sieben Milliarden Tonnen Plastikmüll angehäuft. Denn geschätzt wurden weniger als zehn Prozent des Mülls recycelt. Ein großer Teil des Rests verschmutzt die Städte, landet in Flüssen und wird ins Meer gespült, wo jedes Jahr Hunderttausende Meeresvögel, Säugetiere und Fische daran verenden. Unep warnt: »Unser Planet erstickt am Plastik.«
Strelecki und seine Kollegen beschlossen also, etwas zu tun, und kamen ins Gespräch mit der Organisation Yunus Social Business. Die gemeinnützige GmbH sitzt in Berlin und finanziert seit 2012 weltweit Sozialunternehmen – also Firmen, die einen sozialen Geschäftszweck verfolgen, aber zugleich profitabel arbeiten sollen. Das soll sie unabhängiger von Spenden machen und das Überleben sichern. In den vergangenen zehn Jahren hat Yunus Social Business nach eigenen Angaben mehr als 2000 Sozialunternehmer unterstützt, mehr als 60 Sozialunternehmer finanziert und dabei oft mit etablierten Unternehmen wie der Anwalts-
firma Freshfields, dem Beratungsriesen BCG und dem Lebensmittelkonzern Danone zusammengearbeitet. Die Idee: Die Welt lässt sich leichter verändern, wenn man mit Unternehmen kooperiert, als wenn man gegen sie vorgeht.
Gegründet wurde Yunus Social Business von der ehemaligen BCG-Beraterin Saskia Bruysten und dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesch. Der Namenspatron wurde einst durch Kleinstkredite bekannt, mit denen er Menschen aus der Armut half. Bruysten ist außerdem Mitglied im ZEIT Green Council, den die ZEIT zum Start ihres neuen Ressorts Green im Jahr 2021 gründete. Sie sagt: »Unternehmen haben eine Art Immunsystem, das Projekte aussortiert, die sich nicht schnell genug finanziell lohnen.« Bei Melitta und Cofresco habe sie das anders erlebt, »weil dahinter eine Unternehmerfamilie steckt und dort ein Management arbeitet, das Ideen hartnäckig verfolgt, auch wenn man einen langen Atem braucht«.
Und den braucht das Unternehmen aus Minden tatsächlich. Im Jahr 2018 beschlossen Melitta und Yunus Social Business ihre
Kooperation. Melitta gründete die Tochterfirma Vishuddh Recycle. Vishuddh ist Hindi und bedeutet so viel wie »rein« oder »Reinheit«. Ausgesprochen klingt der Name wie »We should recycle«. Die Firma steht hinter Fair Recycled Plastic.
Yunus Social Business hält nach eigenen Angaben einen »golden share« an dem Unternehmen – einen marginalen Firmenanteil, der einem indes Mitsprache- und Vetorechte gewährt. So ist ausgeschlossen, dass die Melitta-Chefs doch auf die Idee kommen, Gewinne aus Bangalore nach Minden zu
kamen die Container mit den Recyclingmaschinen verspätet; monatelang ruhte die Arbeit. Erst 2022 produzierte die Anlage aus den gesammelten Abfällen erstmals Rezyklat, das tatsächlich wiederverwendet wird.
Singh wirkt wie ein Manager, nicht wie ein Sozialarbeiter. An der Müllhalle steigt er in sein SUV und quält sich durch den dichten Nachmittagsverkehr Bangalores. Er will unbedingt seine Recycling-Anlage zeigen, auch wenn die am anderen Ende der Stadt liegt. Man merkt, wie stolz er darauf ist, dass die nun endlich in Betrieb ist.
Das Problem: Nach eigenen Angaben kostet es Cofresco rund 30 Prozent mehr, das Granulat in Bangalore zu recyceln, als vergleichbare Rohstoffe am Markt einzukaufen. Entsprechend finanziert sich das Projekt bisher noch nicht selbst: Statt Gewinne zu erzielen und in soziale Projekte zu stecken, schießt Cofresco bisher Geld zu; wie viel genau, sagt das Unternehmen nicht. »Das Projekt muss sich refinanzieren«, sagt Oliver Strelecki, »und auf lange Sicht werden wir das auch schaffen.« Das ist ein hehres Ziel.
transferieren, statt damit Bildungs- und Gesundheitsprojekte zu finanzieren. Außerdem unterstützt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Versuch mit Mitteln aus einem Programm namens develoPPP. Es finanziert Projekte, bei denen »unternehmerische Chancen und entwicklungspolitischer Handlungsbedarf zusammentreffen«.
Auf die Millionen-Stadt Bangalore fiel die Wahl, weil in Indien viel Plastik über Flüsse im Meer landet. Das demokratische Land leidet unter großer Armut, Mülltrennung und Recycling sind die Ausnahme. Das berichtet Ashustosh Singh, der Chef von Fair Recycled Plastic. Er hat Gas- und Öl-Ingenieurwesen studiert und sagt: »Ich weiß sehr gut, wie aus Öl Plastik hergestellt wird – aber ich wusste lange nicht, wie wir es wieder von der Straße kriegen.«
Mit Fair Recycled Plastic will er den Menschen nahebringen, warum Recyceln wichtig ist. Weil die Corona-Pandemie das Projekt erst mal in den Stillstand zwang,
Dort, in einem Industriegebiet, wird es laut: Maschinen donnern, in meterdicken Boxen werden die Plastikflaschen gereinigt und geschmolzen. »Das funktioniert im Prinzip wie eine riesige Waschmaschine«, sagt Singh, während er die Anlage umrundet. Am Ende angekommen, greift er in einen Behälter mit grauen Körnern, so groß wie Linsen: das Granulat aus Polyethylen.
Von Bangalore aus wird das Granulat zum nächsten Hafen transportiert und dann per Seefracht nach Europa. Die Reise endet in Brodnica in Polen, wo Cofresco gut 500 Menschen beschäftigt. Hier wird das Rezyklat zu neuen Kunststoffprodukten wie Mülltüten verarbeitet, laut Strelecki stammen fünf Prozent inzwischen aus dem Projekt in Bangalore. Ein kleiner Beitrag, aber der Cofresco-Chef hat eine Vision: Auf lange Sicht sollten Müllbeutel zu hundert Prozent aus dem Granulat gefertigt werden, das aus Bangalore und vergleichbaren Projekten in anderen Städten gewonnen wird. Bangalore soll also »erst der Anfang« sein.
Allein wird Fair Recycled Plastic die Plastikflut ohnehin nicht eindämmen. Aber es könnte Nachahmer finden: Konzerne, die ebenfalls Sozialunternehmen gründen –auch wenn diese anfangs einen Verlust bedeuten und ein Erfolg nicht garantiert ist. Saskia Bruysten rät, dann ein Projekt aufzubauen, das zum Kerngeschäft und zur Strategie passt. Bei Fair Recycled Plastic sei das der Fall: Cofresco will ab 2025 nur noch recycelte oder nachwachsende Rohstoffe für Produkte und Verpackungen verwenden. Für Melitta ist das Projekt eine »Leuchtturmmaßnahme« in einem Prozess, der den ganzen Konzern nachhaltiger machen soll.
Laut Oliver Strelecki geht die Rechnung noch weiter. Fair Recycled Plastic aufzubauen bringe zwar keine zusätzlichen Kunden. Aber das Projekt bedeute den Mitarbeitern viel. »Wenn ich mal alt bin, werde ich mich an dieses Projekt erinnern«, sagt er selbst. So überzeuge es auch Bewerber, die sonst wohl kaum bei einem Plastikproduzenten anheuern würden.
»Wir wollten uns wieder in die Augen schauen können«
Oliver Strelecki, CEO der Melitta-Tochter Cofresco

Die besonderen Qualitäten eines Unternehmens sind gerade in herausfordernden Zeiten gefragt . Wenn Innova tionsk raf t und Teamgeis t Hinder niss e in Chancen ver wandeln . Dab ei unter s tü t zen wir von der HypoVereinsbank Unternehmen wie Kärcher im internationalen Geschäf t mit vorausschauendem Denken und Handeln Denn gute Par tner sorgen mit Weit sicht f ür Zuver sicht






Chefinnen und Chefs haben viele Freiheiten, tragen aber auch viel Verantwortung. Manche suchen Rat bei Profis oder ihresgleichen. Was bringt das eigentlich?
Unsere Autorin KATJA SCHERER war bei mehreren Gesprächsrunden dabei und hat zugehört
Gerda Söhngen, 34, Familienunternehmerin und Gründerin eines Nachfolgekreises
Jürgen Malz hat erst durch einen Unfall verstanden, wie groß seine Verantwortung wirklich ist. Es war 2021, Malz war seit Kurzem angestellter Geschäftsführer bei einem Mittelständler, als es zu einer Explosion in einem Bergbaubetrieb kam. Ausgelöst durch eine Maschine, in der Bauteile seiner Firma steckten. Sofort kamen Fragen auf: Wie kam es zu dem Unfall? Welche Bauteile könnten schuld sein? Bei Malz ging das Kopfkino los: »Mir wurde klar: Wenn ich in so einem Fall fahrlässig etwas falsch gemacht habe, stehe ich mit einem Fuß im Gefängnis, und mein gesamtes Privat vermögen kann weg sein.«
Später kam heraus, dass menschliches Versagen die Ursache war. Aber Jürgen Malz realisierte, dass er bislang nicht richtig verinnerlicht hatte, was Chef-Sein bedeutet. Was er juristisch beachten muss und was seine Rolle im Unternehmen ist. Geschäftsführer zu werden sei viel mehr, als die letzte Stufe auf der Karriereleiter zu erklimmen, sagt er. Es ist anders als im mittleren Management. »Plötzlich steht man an der Spitze, ist allein, und alle erwarten, dass man weiß, was zu tun ist.«
Malz gestand sich ein: Manchmal wusste er es nicht. Bei seinem Start als Chef hatte er vom Unternehmen einen »Onepager« zu den Pflichten bekommen. Eine Seite – mehr nicht. Malz spürte: Er brauchte Rat.
Aber wen sollte er fragen?
Viele Geschäftsführende kennen diese Einsamkeit an der Spitze. Kollegen auf der gleichen Ebene haben sie nicht mehr. Unterstellten Führungskräften trauen sie nicht immer. Mit Freunden oder Ehepartnern berufliche Sorgen zu besprechen hat Grenzen.
Umfragen bestätigen das: Gegenüber dem Magazin Harvard Business Review gaben 61 Prozent der befragten CEOs an, dass sie sich allein fühlen. Eine Studie der Stanford-Universität zeigt: Von etwa 200 befragten amerikanischen CEOs wünschen sich fast alle einen externen Berater zum Austausch. Doch nur ein Drittel holt sich Rat. Im deutschen Mittelstand ist das ähnlich: Nur etwa jeder sechste Unternehmer und jede dritte Unternehmerin haben einen Coach, wie die jüngste große Mittelstandsstudie von ZEIT für Unternehmer ergab.
Der Bedarf bei Vorständen und Geschäftsführern ist groß, das zeigt das Angebot. Viele Beratungen bieten extra ein »C-Level-Sparring« oder »Executive Coaching« an. Sie versprechen psychologische Kompetenz und Erfahrung. »Individuell, persönlich, diskret« lautet der typische Werbeslogan. Malz sagt, seitdem er Geschäftsführer sei, bekomme er bestimmt zehnmal so viele Angebote wie vorher als Produktionsleiter. Coaching für den Vertrieb, Coaching mit Pferden, Coaching mit Hunden, Beratung auf dem Golfplatz oder auf dem Segelschiff. Vieles klingt absurd.
Trotzdem blieb ein Angebot hängen. Im Sommer 2022 schrieb ihn ein Michael Stoermer im Karrierenetzwerk LinkedIn an, Gründer der »Top-Management-Beratung« Stoermer Consulting GbR. Die Nachricht war kurz. Ob er mal telefonieren wolle, fragte der Berater. Warum nicht, dachte Malz. »Kost’ ja nix.«

Wenige Tage später bekam er eine handschriftliche Postkarte. »Das fand ich persönlich und aufmerksam«, sagt Malz. Er unterschrieb einen Vertrag: drei Monate Strategieberatung mit wöchentlichen Treffen und festem Trainingsplan. Den genauen Preis dafür wollen weder Malz noch Stoermer verraten; so etwas ist oft Verhandlungssache. Aber auch wenn das Ganze teuer ist: Aus Malz’ Sicht ist sie das Geld wert. Davon konnte er auch seine Firma überzeugen, die ihm Stoermers Rechnungen bezahlt.
Es ist ein Tag im Winter, elf Uhr. Malz und Stoermer arbeiten seit mehr als drei Monaten zusammen. Wie immer treffen sie sich digital. Stoermer lebt in Pforzheim, Malz am Bodensee. Der Coach übernimmt die Gesprächsführung. Nach wenigen Sätzen kommt er zum Punkt: Ob die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorliegen? Noch nicht vollständig, sagt Malz. Aber die Tendenz lasse sich absehen: »Wie erwartet lief es schlechter als im Vorjahr.« Klar, ist ja auch Krise. »Dann müssen wir jetzt aktiv werden und die Holding darauf vorbereiten«, sagt Stoermer ohne Zögern. Die »Holding«: Das ist die Muttergesellschaft von Malz’ Firma. Es folgen 90 Minuten Strategietraining: Wen sollte Malz vorwarnen, dass durchwachsene Zahlen kommen? Wie sollte
er auftreten? Wie kann er zeigen, dass er aktiv gegen die Flaute vorgeht?
Stoermer ist streng. Er gibt keine Tipps, er sagt, was zu tun ist: Er sagt nicht »Sie könnten«, sondern »Sie müssen jetzt«. Ist Malz anderer Meinung, diskutieren sie das aus. Stoermer redet ohne Füllwörter oder Pausen, bam, bam, bam – so haut er Sätze raus. Der Berater hat früher als Manager gearbeitet, erst als Strategieleiter bei Galeria Kaufhof, später in Vorstandspositionen im Mittelstand. »Wenn du als Chef einen Freund haben willst, kauf dir einen Hund«, ist einer seiner Lieblingssätze. Ein anderer: »Ich will keine victim storys.« Damit meint er: Er will nicht hören, warum was nicht geht. Er will Lösungen. Stoermer stelle unbequeme Fragen, sagt Malz. Das sei anstrengend. »Aber genau das bringt mich weiter.«
Dass Malz’ Firma hier nicht genannt wird, hat einen Grund: Was in einem Coaching besprochen wird, ist ja nur für die Beteiligten bestimmt. Das Gleiche gilt, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich zum Austausch treffen. Nur selten gewähren sie Einblicke.
Ein Donnerstag im Frühling, morgens neun Uhr, Kaffeeküche der Hagener Henke
AG: Sieben Unternehmer und Unternehmerinnen plaudern und warten. Dann stürmt sie plötzlich durch die Tür: Gerda Söhngen, 34, eine lebhafte Frau mit blonden Locken. »Tut mir leid«, ruft sie. »Der Verkehr ...« Dann umarmt sie alle.
Söhngen ist Geschäftsführerin von Keil Befestigungstechnik aus Engelskirchen. Sie führt gemeinsam mit einem zweiten Geschäftsführer 30 Beschäftigte, ist aber weltweit aktiv. Keil stellt Befestigungssysteme vor allem für Fassadenplatten her. Die Technik der Firma steckt sogar in der Christusstatue in Rio de Janeiro. Söhngen hat den Betrieb in dritter Generation von den Eltern übernommen. Weil das schwierig ist und sie sich »sehr lange sehr allein« gefühlt hat, hat sie einen Nachfolgekreis mit anderen Familienunternehmern gegründet. »Dadurch kann ich mich zum ersten Mal wirklich gut austauschen«, sagt sie.
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat, um sich über Themen wie Vertrieb, interne Organisation oder Nachfolge auszutauschen. Heute tagt der Kreis bei Philipp Brüggemann, dem Nachfolger im Dach- und Fassadenbauunternehmen Henke in fünfter Generation. Der 33-Jährige hat diesen Kreis
Umhören und recherchieren
In Deutschland arbeiten mehr als 12.000 Business Coaches, jeder darf sich so nennen. Also ist eine Vorrecherche nötig: Wie ist der Lebenslauf eines Coaches? Hat die Person eine Coaching-Ausbildung gemacht und kann Erfahrungen vorweisen, die Ihnen bei Ihren Fragen helfen? Und, ganz wichtig: Wen empfehlen Ihnen Bekannte?
Kennenlernen und nachfragen Vor der Zusammenarbeit sollte es mit dem Coach ein kostenloses Vorgespräch geben zu Preis, Umfang und Vorgehensweise. Wichtig ist Ihr Bauchgefühl: Wie offen, wertschätzend und empathisch ist er oder sie? Wie seriös wirkt das Angebot? Nach dem Gespräch sollten Sie darüber schlafen und nachhaken, wenn Fragen auftauchen.
mit Söhngen aufgebaut. Auch bei ihm sind Familie und Firma kaum zu trennen. Brüggemann holt erst »Oppa« dazu, den Großvater, der das Unternehmen groß gemacht hat. Dann führt Brüggemanns Bruder, der auch Geschäftsführer ist, durch die Produktion. Die Cousine zeigt später den Vertrieb und das Marketing. Der Cousin stellt das Fitnessstudio nebenan vor, das zur Familie gehört. Gerade trainiert dort die Mutter.
Wie Vertrieb und Marketing funktionieren, erklärt Philipp Brüggemann selbst. Er spricht über die Software für das Projektmanagement und zeigt die Bilanz. »Toll«, lobt ein Teilnehmer. »Sehr inspirierend.« Er lerne viel bei den Treffen, sagt der Mann. »Gleichzeitig denkt man natürlich immer: Die anderen machen alles viel besser.« Doch Neid kommt eher nicht auf. Die Teilnehmer sind per Du, sie reden auch über Kinder oder Hobbys. Nach dem Mittagessen stehen die drängenden Dinge an: Wie ist die Gesellschafterstruktur im Unternehmen? Welches Familienmitglied hat welche Anteile? Wer hat welche Konflikte in der Familie? »Manchmal fließen bei unseren Treffen auch Tränen, je nachdem wie schwierig die Situation gerade ist«, sagt Söhngen. Dafür
Kalkulieren und bezahlen Laut der Rauen CoachingMarktanalyse 2022 liegt das durchschnittliche Honorar bei 164,65 Euro pro Stunde. Viele seriöse Coaches nehmen zwischen 100 und 200 Euro, ausgewiesene Experten schon mal bis zu 300 Euro. Es gilt: Unseriöse Angebote erkennen Sie an überzogenen Preisen und schillernden Versprechen.
Ziele festlegen und erreichen Ein Coaching ist zeitlich begrenzt und folgt Zielen, die für Sie anhand festgelegter Kriterien überprüfbar sind. Typisch sind etwa fünf bis sechs Sitzungen, bei komplexen Anliegen können bis zu zwölf Sitzungen nötig sein. Wenn Sie eine langfristige Begleitung möchten, sollten auch dafür Zwischenziele vereinbart werden. (läs)
190.000
mittelständische Unternehmer wollen ihre Firma bis Ende 2023 an einen Nachfolger abgeben (Quelle: KfW)
hat sie diesen Kreis gegründet: Er soll ein geschützter Raum sein.
Warum Söhngen selbst Rat benötigt, zeigt ein Besuch bei Keil im Oberbergischen Land. Die Unternehmerin begrüßt im Foyer. Sie trägt große Ohrringe, eine breite Silberkette und eine Jeans-Latzhose. Auf ihren Armen prangen Tattoos. Man kann sich vorstellen, wie die junge Geschäftsführerin das Familienunternehmen aufgemischt hat. Söhngen führt in einen Konferenzraum. Als Tisch dient eine Tischtennisplatte, im Büro nebenan hängt eine Hängematte. »Das hätte es früher nicht gegeben«, sagt sie. Früher heißt, als ihre Eltern noch das Sagen hatten. »Anfangs wollte ich mich anpassen, und ich hab’s versucht, wirklich«, erzählt sie, »aber es hat nicht funktioniert.«
rer dazu. Denn ihre Eltern sind bis heute Gesellschafter. Ihnen gehört der Großteil der Firma, Söhngen muss ihnen weiter Rede und Antwort stehen. »Das wollte ich dieses Mal nur zusammen mit einem Partner machen, nicht mehr zwei gegen eins.«
Als Gerda Söhngen die Firma ihrer Eltern übernahm, holte sie Christian Schmidt als Co-Geschäftsführer an Bord
Das war 2014, bei ihrem ersten Anlauf, die Firma zu übernehmen. Söhngen kam damals aus dem Studium und wurde Assistentin der Geschäftsführung – sprich: Assistentin von Mama und Papa. Das sei vom Start weg schwierig gewesen, sagt sie. Viele ihrer Ideen standen zwei gegen eins, ein Elternteam gegen die Tochter. Söhngen versuchte lange, nach den Regeln der Eltern zu spielen. Sie tauschte Sneaker gegen Pumps, versteckte die Tattoos unter dem Blazer. »Ich dachte: Meine Eltern als erfolgreiche Unternehmer wissen, wie Nachfolge geht.« Doch nach und nach merkte sie: Ihre Eltern waren sehr gute Geschäftsführer. Aber sie war anders. Sie wollte anders führen, Abläufe verändern. Nur: Wie erklärt man das als Tochter, ohne dass der Eindruck entsteht, man stelle die Arbeit der Eltern infrage? Denn das habe sie nie getan, betont Söhngen.

Im Wesentlichen funktioniere die Nachfolge gut, sagt sie. Dennoch gibt es auch kritische Themen. Kürzlich hat sie im Nachfolgekreis erfahren, dass sie Details zur Geschäftsentwicklung mit ihren Eltern bespricht, die sonst niemand mit der Familie teilt. Wie ein bestimmter Kundenbesuch oder Messeauftritt verlief zum Beispiel. Offenbar sind ihre Eltern stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere. »Und, hast du schon mit deinen Eltern darüber geredet?«, lautet eine Frage an Söhngen bei dem Unternehmertreff. Ihre Antwort: Es sei schwierig für sie. »Als Tochter möchte ich mit meinen Eltern gerne über das Unternehmen reden. Aber als Geschäftsführerin muss ich Grenzen ziehen und sagen: Über bestimmte Dinge muss ich euch als Gesellschaftern keine Auskunft geben.«
der Generation der Unternehmensnachfolger bezweifeln, dass professionelle Berater die Situation von Familienfirmen verstehen
Ein Berater vermittelte. Das Ergebnis: Die Ansichten waren zu verschieden. 2016 stieg Söhngen aus, es war schwierig für die Familie. Söhngen sagt: »Auch wenn das keiner ausspricht, enttäuscht man seine Eltern natürlich.« Sie versuchte abzuschließen und gründete ein Fitnessstudio. Doch als ihre Eltern 2019 final aus dem Unternehmen aussteigen wollten, fragte sie sich, ob sie einen zweiten Anlauf wagen sollte. Sie entschied sich dafür – mit klaren Bedingungen. Keine lange Überschneidung mit den Eltern in der Führung. Und sie holte sich mit Christian Schmidt einen Co-Geschäftsfüh-
Zuhören, mitfühlen, trösten: Bei der Beratung von Jürgen Malz spielt all das keine Rolle. Soll es auch nicht. Malz will durch den Austausch mit seinem Berater Stoermer fachlich lernen und »seine Rolle finden«. Der 53-Jährige hatte schon seine Ausbildung zum Industriemechaniker in dem Unternehmen gemacht. Er rutschte dann in eine Führungsrolle, bildete sich weiter zum Industriemeister und dann zum technischen Betriebswirt. Er wurde Produktionsleiter, jetzt ist er Chef von gut 130 Mitarbeitenden. Er sei ein hemdsärmeliger Typ, sagt Malz, trage lieber Pullover als Sakko. Geschäftsführer zu werden sei für ihn ein Ziel, aber auch eine abstrakte Vision gewesen, noch heute fühle sich das oft unwirklich an.
Ein wichtiger Teil der Beratung ist es daher, Malz immer wieder seine Rolle zu verdeutlichen: »Sie sind jetzt verantwortlich. Sie gestalten, Sie entscheiden, Sie haften.« Erst kürzlich hat Malz sich dazu durchgerungen, in seiner E-Mail-Signatur das Wort Produktionsleiter durch Geschäftsführer zu ersetzen. Er übernehme bei Meetings mehr die Gesprächsführung, sagt er. Auf Anraten seines Beraters hat er sich mit den Führungs-
kräften zu Kennenlerntreffen verabredet. »Einfach nur zum Reden, ganz ohne Grund oder Agenda«, sagt Malz und findet die Idee wohl noch immer ein wenig verrückt. »Aber es hat funktioniert: Ich habe nun einen deutlichen besseren Draht auch zu Mitarbeitenden, mit denen es vorher schwierig war.«
Damit eine Beratung so wirkt, muss es persönlich passen zwischen Ratgeber und Chef. Vor Stoermer habe er andere Coaches gehabt, erzählt Malz. Das seien nette Gespräche gewesen. Die Berater hätten Tipps gegeben, aber nie die Umsetzung eingefordert. Meistens habe er fünf Minuten vor den Terminen in den Kalender geschaut und gemerkt: »Mist, schon wieder nichts gemacht.« Stoermer würde ihm das nicht durchgehen lassen. Der sage dann: »Warum haben Sie nichts gemacht? Das ist Ihre Aufgabe. Sie sind Geschäftsführer.« Malz treibt es an, dass er den Coach nicht enttäuschen will.
Dass es zwischenmenschlich passt, ist auch für Gerda Söhngens Nachfolgekreis das Wichtigste. »Hier soll es nicht ums Ego, sondern um ehrlichen Austausch gehen«, sagt ihr Mitinitiator Brüggemann. Er und Söhngen haben die anderen sechs Teilnehmer im Alter von 28 bis 41 Jahren über Banken, Berater und ihr Netzwerk gefunden. Sie kämen aus verschiedenen Branchen, machten sich keine Konkurrenz und könnten offen über Zahlen sprechen. Fast alle leiten Produktionsfirmen, auch das helfe.
Söhngen fühlt sich in dem Kreis wohl, weil sie dort ihre Rolle nicht erklären muss. Sie sagt, sie habe das erste Mal das Gefühl, dass es Leute gibt, die sie wirklich verstehen. Die anderen wüssten, dass jedes Familientreffen eine indirekte Gesellschafterversammlung sein kann. Sie hätten auch erlebt, dass die simple Frage »Und, wie lief die Arbeit heute?« in eine Grundsatzdiskussion mit
den Eltern ausarten könne. »Klar spreche ich darüber auch mit meinem Mann«, sagt sie. »Aber ich will auch die Beziehung nicht zu sehr belasten.« Ihre Freunde sind gute Zuhörer. Aber eben keine Schicksalsgefährten.


Im Frühjahr schalten sich Jürgen Malz und Michael Stoermer wieder zusammen. Malz kommt von einer Kreuzfahrt, dort hat ihn eine E-Mail mit schlechten Nachrichten erreicht. Die Zahlen für das Geschäftsjahr sind sogar etwas schlechter ausgefallen als schon im Winter erwartet. Schritt für Schritt geht er mit dem Berater durch, was er den Mitarbeitenden sagen wird. Wie er Sparpläne vermittelt, ohne zu beunruhigen. Wie er der Muttergesellschaft die Zahlen beibringt. Für ihn sei es eine Entlastung, all das mit einem kritischen Partner zu teilen, sagt Malz. Weil er jetzt im Unternehmen aktiver und fordernder auftreten kann. Und das Gefühl hat: Er ist hier der Chef.
W ie wir digitalen Stress im Berufsleben vermeiden, zeigt die große BARMER-Studie social health@work. Neben T ipps für den Joballtag liefert sie F irmen eine solide Basis, mit der sie die neue Arbeitswelt gesund gestalten können.

Jetzt mehr erfahren: barmer.de/social-health


In fünf Aktenordnern hat Michael Menke all den Ärger der vergangenen anderthalb Jahre abgeheftet. Der Familienunternehmer aus Rheinland-Pfalz ist genervt, wenn er über sein geplantes neues Verwaltungsgebäude spricht. Gleich zweimal drohte die Finanzierung zu scheitern: einmal, weil eine Bank überraschend absprang, und einmal, weil die Regierung im weit entfernten Berlin beschloss, die Förderung für energieeffiziente Neubauten einzustellen. Menke sagt: »Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie man mit mir umgegangen ist.«
Der 57-Jährige handelt mit Öl, zuletzt erwirtschaftete seine Firma, die Erich Menke GmbH, mit Heizöl, Kraftstoffen und Schmierstoffen rund 4,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Unternehmen sitzt in Hettenleidelheim, einem Ort an der A 6 zwischen Mannheim und Kaiserslautern, bis zur deutschen Weinstraße ist es nicht weit. Wenn Menkes Gebäude irgendwann gebaut sein wird, kann er von dort auf bewaldete Hügel blicken. Ins Grüne also.
Der Weg ins Grüne im ökonomischen Sinne ist für ihn aber voller Hürden. Grund: Die Europäische Kommission tut einiges, um die Wirtschaft zur Einhaltung der Klima ziele zu motivieren. Wer nicht wegkommt von fossilen Energien etwa, soll fürs Erste nur noch schwer Geld erhalten und bald womöglich gar nicht mehr.
Menke, das blau-weiß karierte Hemd in die grüne Hose gesteckt, sagt: »Wohin genau
ich mich transformieren werde, weiß ich zwar nicht, weil mir die politischen Rahmenbedingungen in keiner Weise signalisieren, was ich in 15 Jahren verkaufen kann.«
Grundsätzlich hat der Unternehmer den Kurswechsel akzeptiert: Er will langfristig wegkommen vom Öl, das er ausliefert. Mehr noch: Er will den Wandel nutzen und umrüsten. Das Verwaltungsgebäude sei der erste Schritt, sagt Menke. In dem Gebäude will er Platz für Start-ups schaffen, gerne aus dem Bereich erneuerbare Energien. Dazu will er einen Schulungsraum einrichten, den andere Unternehmen mieten können. E-Fuels könnten ein Teil seiner Zukunft sein, vielleicht auch Wasserstoff. Und er erwägt, andere Firmen beim Brandschutz zu beraten, damit kennen sich seine Leute aus.
Menke bringt Ideen mit und den Willen, sich zu verändern. Das müsste eigentlich den vielen Finanzierern gefallen, die die Transformation wollen (siehe Grafik S. 40). Nur: So einfach ist das nicht.
Gut 6,5 Millionen Euro soll das zweistöckige Bauwerk kosten. Um das zu finanzieren, wandte Menke sich an den Firmenkundenbetreuer der Sparkasse Donnersberg, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet. »Immer gut«, wie Menke sagt. Und so war zumindest die Sparkasse angetan von dem Vorhaben. Aber es brauchte eine weitere Bank, mit der sich das Geldhaus das Risiko teilen konnte. So etwas ist nicht ungewöhnlich. Doch damit begannen die Probleme.
LDer Berater von der Sparkasse fragte bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an, es war nur ein erstes Vorfühlen, weil man häufig zusammenarbeitet. Und kassierte nach etwas Hin und Her eine Absage: Man finanziere generell keine Neukunden mehr aus dem Bereich fossile Energien, habe es geheißen, erinnert sich Menke; die LBBW will das auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. »Einzelne Geschäftsmodelle, wie insbesondere die Förderung von fossilen Brennstoffen, sind aus unserer Sicht nicht transformierbar«, teilt die Landesbank bloß ganz allgemein mit. Denn CO₂-Emissionen könnten nur konsequent reduziert werden, wenn fossile Brennstoffe ersetzt werden. Daher habe die Landesbank Neugeschäfte mit Unternehmen stark eingeschränkt, die Öl und Gas fördern. Menkes Sparkassenberater musste sich erneut auf die Suche begeben.
Welche Bank hat richtig gehandelt? Die Sparkasse oder die Landesbank? Ist die Transformation eines mittelständischen Ölhändlers möglich? Können Geldinstitute das überhaupt einschätzen? Oder sollte ein solches Unternehmen besser kein Geld mehr für langfristige Projekte bekommen?
Diese Fragen führen zurück zu einem Dezembertag im Jahr 2019. Kurz vor Weihnachten rief EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel den »Green Deal« aus. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent bis 2050 werden, so der
zu zwingen, setzt die EU auf den Finanzsektor. Was gut gemeint ist, bereitet Mittelständlern wie dem Ölhändler Menke Ärger. Sie kommen immer schwerer an Geld, selbst wenn sie grün werden wollen VON JAN SCHULTE
70 % 21 % 70 %
21 %
der Banken und Unternehmen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt werden, haben Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Unternehmens strategie verankert.
Plan. Allein um die Zwischenziele bis 2030 zu erreichen, sind nach der ersten Schätzung der Kommission jährlich 260 Milliarden Euro nötig. Der private Finanzsektor soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Seitdem hat die EU-Kommission etliche Gesetze initiiert, damit Finanzsektor und die Realwirtschaft grün werden. Es gibt eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und eine Taxonomie. Sie gibt vor, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als nachhaltig anzusehen sind – der Handel mit Öl gehört nicht dazu. Und es gibt die Offenlegungsverordnung, die Klarheit darüber schaffen soll, wie nachhaltig einzelne Finanzprodukte sind. Hinzu kommt bald das europäische Lieferkettengesetz, das strenger werden wird als das deutsche Pendant.
Ein Verbot, sein Geld in fossile Unternehmen zu stecken, gibt es zwar nicht. Aber die meisten EU-Gesetze zielen darauf ab, sichtbar zu machen, was nachhaltig ist und was nicht – und was finanziert wird. Und damit steigt der Druck. Wohl keine Bank will als das Institut wahrgenommen werden, das die schmutzigen Firmen fördert.
Als die EU-Kommission auf die Finanzbranche setzte, habe zuerst »viel Euphorie« bei den Finanzunternehmen geherrscht, sagt Christian Klein. An der Uni Kassel ist er Professor für Sustainable Finance, also für nachhaltiges Finanzwesen. Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzprodukte wie grüne Anleihen und Fonds wurden beliebter.
der Banken haben bereits eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie formuliert.
Heute wird über einige geplante Regulierungen noch heftig gestritten, andere werden teilweise schon angewandt und widersprechen sich in einigen Punkten. Die EU-Taxonomie zum Beispiel ist bisher nur für Fragen zum Klimawandel anwendbar. Eigentlich soll sie auch besagen, was im Sinne einer Kreislaufwirtschaft oder Artenvielfalt nachhaltig wäre. Doch dazu liegen lediglich Entwürfe vor. Auch ist unklar, wie sich die Offenlegungsverordnung und die EU-Taxonomie zueinander verhalten. Ist ein Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung nur nachhaltig, wenn er zu 100 Prozent in Unternehmen investiert, die die Taxonomie als nachhaltig ansieht? Oder reichen auch 80 Prozent aus, vielleicht gehen auch 40 Prozent? Und was ist eigentlich, wenn ein Fondsmanager braune Unternehmen, die auf fossile Treibstoffe setzen, transformieren möchte? Eine hohe Taxonomiequote kann er dann gar nicht haben, ist er dann nachhaltig?




Über all diese Fragen wird diskutiert, obwohl Unternehmen wie Finanzinstitute die Regeln schon anwenden müssen. »Das geht ein Stück weit auch gar nicht anders, weil der EU nicht mehr viel Zeit bleibt im Kampf gegen den Klimawandel«, sagt Klein. Erst alles perfekt durchzuregulieren und dann loszulegen würde zu lange dauern.
Doch die Firmen und die Finanzbranche verunsichert das. »Die Anfangseuphorie ist auf jeden Fall weg«, sagt der Forscher. Nachdem der Finanzbranche zuletzt häufi-
ger Greenwashing vorgeworfen wurde – also das Bewerben von Finanzprodukten als grün, die es gar nicht sind – wächst die Erkenntnis, dass die Finanzierung der Transformation schwierig wird. »Es wird vor allem auch etwas kosten«, sagt Klein. Will eine Bank einen Kredit vergeben oder ein Fonds in eine Firma investieren, wird eine Rendite erwartet. »Diese Rendite kann kleiner ausfallen als bei herkömmlichen Produkten, das nimmt vielen gerade die Motivation.«
Der Trend zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor führte zu immer mehr Ausschlusskriterien, die Banken sich für Kredite auferlegen. Viele schließen Unternehmen aus, die auf Kohle setzen. Auch wer im Ölund Gasgeschäft ist, hat es schwerer, an eine Finanzierung zu kommen. Je strenger die Ausschlusskriterien, desto fortgeschrittener und nachhaltiger ist die Bank, so die Ansicht mancher. Harte Ausschlusskriterien also könnten den Wandel abwürgen, der dringend notwendig ist. Was ist, wenn eine Firma einen guten Plan hat, aber kein Geld für die Umsetzung bekommt?
Obwohl Michael Menkes Sparkassenberater inzwischen mit der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz eine andere Bank zur Risikoteilung gefunden hat, ist der Ölhändler sauer: auf die LBBW, auf die er gezählt hatte, und auf die Energiepolitik der Bundesregierung – und auf die der gesamten EU.
Statt in seinem neuen Gebäude, sitzt er in seinem Büro aus den Siebzigerjahren, ein
Die Aufstockung ist die Antwor t auf den Bedar f nach Wohnraum in der Stadt. Wenn Nachverdichtung sich so gelungen präsentier t wie hier, war Baufritz am Werk. Denn schöner kann man gewachsene Umgebungen nicht für sich nutzen





Gleich informieren unter #AufstockungWagner auf www.baufritz.de

begrenzen/ausschließenbestimmteSektorenausschließensichbesserabsichern
brauner Holzschrank streckt sich über die eine Wand bis zur Tür, die Wände sind nur einfach verputzt und vor Jahren mal weiß gewesen, ein senkrechter Holzbalken durchschneidet den Raum. Blickt Menke aus dem Fenster, schaut er nicht auf grüne Hügel, sondern auf eine alte Abfüllanlage. »Wir machen mal wieder den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir wollen aus ganz vielen Energieträgern raus, ohne einen konkreten Plan zu haben, wie wir das auffangen können«, beschwert er sich. Es sind Sätze, die derzeit häufig fallen, von Wirtschaftsvertretern, von Politikern und von Bankern.
Menke hält an seinem Plan fest: Auf vier Seiten hat er für die Sparkasse dargelegt, wie seine Perspektive sein könnte. Für die nächsten zehn Jahre sieht er keine Probleme auf sein Geschäft zukommen. Sein Öl werde gebraucht, für die Weinhändler der Umgebung, die Landwirtschaft, für gut 6500 Kunden in der Region. Auch der Kreis Bad Dürkheim setzt auf den Händler. »Die Firma Menke hat für den Fall eines Blackouts bei uns in der Region eine große Bedeutung«, sagt Landrat HansUlrich Ihlenfeld (CDU). Sie sei für den Notfall fest eingeplant als Treibstofflieferant – und als ein Betrieb, bei dem man auch bei Stromausfall an der Zapfsäule noch Benzin bekommen könnte.
Erst für die Zeit danach wird es spannend, und darauf will Menke sich vorbereiten. »Ich benötige dieses neue Bürogebäude einfach«, sagt er. Zumal das alte aus allen

Nähten platzt. Es gibt nicht einmal einen Konferenzraum. Wenn alle etwa 30 Mitarbeiter zusammenkommen, trifft man sich in Menkes Büro, einer umgebauten LkwGarage. Dafür steht ein Holztisch mitten im Raum.
Es sind alles Gründe, die die Sparkasse Donnersberg überzeugten. Offiziell will sie sich nicht zu dem Fall äußern, auch dieses Geldhaus spricht nicht über einzelne Kundenbeziehungen. Nur so viel: Man wolle Kunden »auf dem Weg zu einer Reduzierung des CO₂Ausstoßes weiterhin kompetent begleiten«. Es ist ein Satz, den sich wohl jede Bank auf die Fahnen schreibt. So sieht es auch der Sparkassenverband. Dabei stünden sie nicht nur an der Seite der Unternehmen, die bereits »grün« sind, teilt eine Verbandssprecherin mit. »Sparkassen wollen sich auch dort engagieren, wo die ökologische Transformation erst noch gelingen muss.«
Auch die LBBW tut das. Eigentlich. »Das Erreichen von NettoNullEmissionen ist eine der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit«, sagt Jürgen Harengel, der den Bereich Unternehmenskunden verantwortet. »Als starke, regional verwurzelte Universalbank versteht es die LBBW als ihre Pflicht, genau diese Rolle einzunehmen und die Transformation von Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität aktiv zu gestalten.«
Nur halt nicht im Falle eines mittelständischen Ölhändlers.
Natürlich lässt sich argumentieren, dass die LBBW richtig gehandelt hat und die Sparkasse nicht. Ob Menke die Transformation gelingen kann, weiß er ja selbst nicht genau. Das Risiko, ihm langfristige Kredite zu geben, nimmt zu. Außerdem ist es politisch gewollt, aus dem Öl auszusteigen.
Timo Busch, Professor für BWL an der Uni Hamburg, hält es für richtig, dass die Sparkasse Donnersberg Menke Geld leihen will. Er fordert, dass die Banken den Dialog mit den Firmen verstärken. »Die klassische Sicht ist doch, dass alle braunen Unternehmen böse sind und sie kein Geld mehr bekommen sollten«, sagt Busch, der wie Christian Klein Mitglied der Wissenschaftsplattform für Sustainable Finance ist. Das sei zwar nachvollziehbar, weil sich so kein Finanzierer die Hände schmutzig mache, aber es sei dann schwerer, die Transformation zu finanzieren. »Für einen mittelständischen Ölhändler wird die Umstellung natürlich schwierig«, sagt er, »wenn der aber genau darlegen kann, wie er sich wandeln möchte, wäre es auch sinnvoll, ihn zu finanzieren.«
In Menkes Betrieb arbeiten auch die vier Söhne mit. Menke hat dem Ältesten schon geraten, über den Wechsel nachzudenken. Weil es riskant sein könnte, wenn sie alle in einem Unternehmen mit einem bald veralteten Geschäftsmodell arbeiten. Doch der Sohn habe nicht gewollt, das macht Menke ein bisschen stolz. Weil es zeigt, wie sehr die Familie an den Wandel glaubt.
Starke Geschichte. Könnte Ihre sein.
Wir erschaffen die Mindsets für gemeinsamen Erfolg – in nur 12 Wochen. Durch kollektive Verhaltensänderung kommt Ihr Unternehmen endlich nachhaltig zu besseren Ergebnissen: In kurzer Zeit durchlaufen Führungskräfte und Mitarbeiter:innen einen Perspektivwechsel und leben anschließend neues Verhalten in ihrem Business-Alltag. Schaffen Sie eine Bewegung zu Ihren unternehmerischen Zielen!

Plöt z l ich w u r den Z iele ei n fach er reicht . F ü h r u ngsk räf te und Mitarbeiter :innen wa ren ei n ent fesseltes Tea m. Und

1 Lange bevor der Zirkus seine Tournee durch Deutschland beginnt, wird im Winterquartier in Köln schon gearbeitet. In der Manufaktur fertigen die Mitarbeiter Masken, schreinern Kulissen und verschönern die Zirkuswagen
2 Seit März und noch bis in den Dezember tourt der Zirkus durch Deutschland. Ein Sonderzug transportiert die gut 80 Wagen von Stadt zu Stadt. In diesem ist die Schneiderei untergebracht. Reißt unterwegs ein Kostüm, wird es hier genäht – wenn es schnell gehen muss, sogar während der Vorstellung
3 Die Vergoldermeisterin Gesa Giersberg vergoldet und lackiert die Wagen, hier färbt sie ein Schild neu. Das Spiel mit Farben ist typisch für den Zirkus, den Bernhard Paul (siehe S. 49) 1976 gegründet hat
Circus Roncalli lockt die Menschen in eine Traumwelt. Ein Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zeigt, wie viel Liebe zum Detail und harte Arbeit dafür nötig sind


4 Sobald der Zirkus einen Spielort erreicht, bauen etwa 50 Helfer das 16 Meter hohe und 37 Meter breite Zelt auf und verlegen fünf Kilometer Stromkabel. In diesem Schaltwagen laufen sie zusammen. Sie sorgen für Licht aus Tausenden Lampen – und ermöglichen holografische Projektionen von Elefanten. Auf lebendige Tiere verzichtet der Zirkus seit 2018


5 Die Artistin Elena Minasov steigt vor ihrem Auftritt in ein besonders raffiniertes Kostüm. Mit ihrem Ehemann Viktor hat sie eine Nummer einstudiert, in der beide zahllose Male ihr Outfit wechseln – binnen Sekunden

6 Manege frei: 24 Artisten treten auf, sie stammen aus allen Erdteilen. Diese Sprung-Akrobaten kommen aus Moskau


7 Hereinspaziert! 1500 Zuschauende fasst das Zelt, in dem nichts billig wirken soll. Das hat seinen Preis: Ein Sessel auf der Balkonloge kostet rund 90 Euro, ein Platz auf einer Sitzbank im günstigsten Rang etwa ein Drittel. Das Popcorn dazu: fünf Euro
8 Aber was ist schon Geld? Als Weißclown Gensi möchte Fulgenci Mestres die Menschen von solchen Dingen ablenken und zum Lächeln bringen. Hier spielt er auf seinen Fingerflöten

9 Das Finale: Alle Akrobaten und Artisten verabschieden das Publikum aus der Welt der Träume. Für das 90-köpfige Team geht die Arbeit weiter: An jedem Spielort gibt es über mehrere Wochen zwei Shows pro Tag – dann macht sich der Zirkus wieder auf die Reise ...

Herr Paul, was macht Ihr Unternehmen?
Als Zirkus unterhalten wir Menschen mit anspruchsvoller Kunst. Aber im Unterschied zu anderen Kulturbetrieben kommen wir ohne Steuergelder aus, wir zahlen Steuern. Was ist Ihre größte Herausforderung?
Die Bürokratie.
Woran wäre Roncalli beinahe gescheitert?
An der Corona-Pandemie. Sie hat ein großes Loch in die Kasse gerissen, wir konnten zwei Jahre lang nicht auftreten. Und kürzlich, als es erst hieß, dass wir unser Zelt in Hamburg nicht wie sonst auf der Moorweide aufstellen können, weil diese Fläche für kommerzielle Betriebe inzwischen tabu ist. Eine sechswöchige Spielpause wäre für uns bedrohlich geworden. Zum Glück hat der Hamburger Senat uns eine Ausnahme gewährt, wir sind ja auch ein Kulturbetrieb.
Kommerziell sind Sie aber schon?
Wir erwirtschaften pro Jahr mehr als 20 Millionen Euro Umsatz und geben 150 Menschen Arbeit. Aber mein größtes Ziel ist nicht das Geld, sondern Kinder und Intellektuelle an denselben Stellen zum Lachen zu bringen und in Staunen zu versetzen. Das schafft sonst kein Kulturbetrieb.
Was braucht ein guter Zirkus dafür?
Er muss eine bewegende Show bieten, die einem künstlerischen Konzept folgt. Und er muss seine Mitarbeiter gut behandeln, denn monatelang umherzureisen ist zwar aufregend, aber auch anstrengend.
Wie gelingt es, rentabel zu wirtschaften?
Das ist der große Zaubertrick, dass sich das immer ausgeht – irgendwie. Ich investiere fast alle Einnahmen in das Programm und in die Ausstattung. Den Zuschauern soll der Mund offen stehen, und sie sollen sagen: Boah, wie ist das schön! Nur dann bringen
die Menschen das Geld zur Tür wieder rein, das ich zum Fenster rauswerfe. Wo machen Sie Kompromisse?
Bei mir selbst. Manchmal möchte ich eigentlich nur meine Ruhe und mit meiner Frau essen gehen – und dann arbeite ich doch weiter und muss mich um irgendetwas kümmern. Das nervt, ich bin ja schon 76. Wie meistern Sie den Generationswechsel? Ich komme aus einem Dorf in Österreich, hatte null Schilling, habe den Zirkus aufgebaut und groß gemacht. Meine drei Kinder wurden schon in den Zirkus hineingeboren. Sie haben nun Anteile am Unternehmen übernommen und müssen lernen, es zu erhalten. Das ist etwas ganz anderes. Was können Ihre Kinder besser als Sie?
Meine drei Kinder sprechen vier Sprachen fließend – das würde ich auch gerne können. Zum Glück brennen sie auch für den Zirkus und ergänzen sich gut.
Sie führen den Zirkus seit fast 50 Jahren, was hat sich am wenigsten verändert?

Ich liebe den Zirkus nach wie vor, und ohne diese Liebe wäre er nicht möglich. Und was hat sich am meisten gewandelt? Die Technik. Heute steuern wir alles per Computer und verwenden LED-Scheinwerfer, die weniger Strom verbrauchen. Vervollständigen Sie diesen Satz: Roncalli wäre nichts ohne ... die Disziplin aller Beteiligten. Wehleidige können wir nicht gebrauchen. Welche ist Ihre wichtigste Maschine?
Früher waren es die Traktoren, heute ist es der Computer. Er sagt uns, was wir zu tun haben. Wahrscheinlich werden wir auch irgendwann künstliche Intelligenz nutzen –aber so kreativ wie wir wird sie nie sein. Was begrenzt Ihr Wachstum am meisten?
Ich habe immer viel mehr Ideen als Ressourcen. Für ein Zirkusmuseum zum Beispiel. Oder ein Zirkusgebäude, in dem wir das ganze Jahr über auftreten können.
Welche Entwicklung Ihrer Firma erfüllt Sie mit der meisten Genugtuung?
Sagen Sie nicht Firma, das tut mir weh. Wir sind ein Theater! Mich erfüllen die kleinen Dinge. Einmal habe ich mich gerade als Clown geschminkt, da kam ein altes Mutterl vorbei und hat mir einen selbst gebackenen Gugelhupf geschenkt. Das ist Genugtuung. Was schätzen Sie am Unternehmertum?
Dass ich Leuten Arbeit gebe und sie sich davon kleine Wohnungen an unserem Stammsitz in Köln leisten können.
Welchen Unternehmer würden Sie gerne mal treffen?
Wenn er noch leben würde: den Trickfilmzeichner und Filmproduzenten Walt Disney. Weil er ein großer Künstler und gleichzeitig ein erfolgreicher Unternehmer war.
Die Fragen stellte Navina Reus
UNTERNEHMER-FRAGEBOGENBernhard Paul, 76, Zirkusdirektor

Wie können Teams ihr Wissen besser austauschen?
Diese Frage treibt viele Mittelständler um. Einer schickt seine Ingenieure für mehrere Monate in die Fabrik
VON JENNIFER GARIC
Lars Stephan-Büldt könnte sich jetzt umdrehen und weiterschlafen, wenn dieser Tag im Frühjahr ein normaler Arbeitstag für ihn wäre. Vor wenigen Wochen hat der 33-Jährige einen neuen Job beim Sicherheitstechnik-Spezialisten Tueg Schillings begonnen, normalerweise arbeitet er in Gleitzeit und startet bis neun Uhr. Heute klingelt sein Wecker aber schon um halb sechs – und später aufzustehen ist keine Option. Denn den Ingenieur erwartet nicht sein üblicher Job am Schreibtisch. Stattdessen steigt er in einen blauen Arbeitsoverall und fährt zum
Chemiepark in Hürth bei Köln. Dort soll er heute eine Produktionsanlage inspizieren, Messinstrumente begutachten und Abschaltanlagen prüfen.
Solche Anlagen zu prüfen, zu vermessen und ihre Sicherheit zu bescheinigen ist das Kerngeschäft von Tueg Schillings. Die Abkürzung Tueg steht für »Technische Überwachungsgesellschaft«. Das Unternehmen aus Kerpen macht einen Umsatz von fünf Millionen Euro im Jahr, die meisten Kunden stammen aus der Chemiebranche. Läuft bei ihnen etwas in der Produktion oder Ver-
arbeitung schief, kann das weitreichende Folgen für Menschen und Umwelt haben. Kontrollen gehören also zum Betriebsalltag.
Für Lars Stephan-Büldt heißt das heute: Schichtbeginn um 7 Uhr, Feierabend um 17 Uhr. Für ihn ist es ein langer Tag. Zwar arbeiten alle Ingenieure wie Handwerker 40 Stunden pro Woche, aber gerade bei großen Anlagen können schon mal Überstunden anfallen, die später ausgeglichen werden.
Trotzdem lächelt Stephan-Büldt beim Treffen auf dem Parkplatz: »Die Arbeit im Chemiepark ist wirklich etwas anderes als
Gemeinsam mit Ihnen und unseren Expert*innen diskutieren wir die drängenden Fragen zur Klimaherausforderung. Mit dabei sind u.a. Andreas Sentker, Petra Pinzler, Luke Kemp, Sara Weber und Özden Terli!


3-Grad+
Spielen wir das Climate Endgame? Die Wahrheit über die 3-Grad-Erderwärmung und welche Lösungen es gibt!
§ ?


Welche Innovationen, Strategien und Lösungen gibt es in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, um diese Erwärmung noch abzuwenden?
28. 09. 2023
14 UHR
acht Stunden Schreibtischarbeit«, sagt er, »das ist auf andere Art anstrengend.« Dann springt er am Auto schnell in seine Jeans. Der Blaumann hat Feierabend.
Als sich Stephan-Büldt für die Stelle entschied, wusste er, worauf er sich einlässt: Wer bei Tueg Schillings als Ingenieur oder Ingenieurin anfängt, wird im ersten Arbeitsjahr für sechs Monate in den Blaumann gesteckt. »Das machen wir ausnahmslos bei allen Ingenieuren und nicht nur bei Berufsanfängern«, sagt Nicolas Bennerscheid, einer von drei Geschäftsführern. Sogar die Recruiterin von Tueg Schillings sei schon in den Blaumann geschlüpft – auf eigenen Wunsch. »Für ihren Arbeitsalltag bringt das unserer Kollegin natürlich nicht so viel, aber sie wollte den Betrieb gerne rundum kennenlernen«, sagt Bennerscheid.
Auf seiner Website thematisiert der Betrieb diese »Blaumannpflicht«, auch in Bewerbungsgesprächen wird sie angesprochen. »Die Fachkräfte hier aus der Region kennen uns aber bereits und wissen, dass wir mit der Blaumann-Phase einen besonderen Weg gehen«, sagt der Geschäftsführer. Da die Praxis im Unternehmen eine entscheidende Rolle spielt, sitzt bei Einstellungen auch ein Meister aus dem Unternehmen mit am Tisch. »Ist er gegen den Bewerber, sagen wir ab«, erklärt Bennerscheid.
Aber warum leistet sich der Mittelständler diese Arbeitseinsätze, die auf den ersten Blick Personal binden, also Geld kosten? Weshalb mutet er Neueinsteigern den Einsatz im Blaumann zu und riskiert damit, mögliche Bewerber abzuschrecken – während andere Unternehmen mit möglichst flexiblen Arbeitsbedingungen um die knappen Fachkräfte werben?
Die Geschäftsführung verspricht sich davon einen besseren Wissensaustausch. Im Jahr 1990 war das Sicherheitsunternehmen als kleiner Handwerksbetrieb gestartet. Heute beschäftigt die Firma 95 Menschen, 20 Prozent sind Ingenieure, der Rest nach wie vor Handwerker. Im Alltag müssen sie gut miteinander arbeiten. Die Ingenieure planen und konzipieren, die Handwerker setzen um und warten bestehende Anlagen. Damit das reibungslos klappt, müssen beide Seiten die Welt des anderen
kennen, Probleme nachvollziehen können und Verständnis entwickeln. Dafür hat Tueg Schillings das Projekt »Expert*innen im Blaumann« im Jahr 2008 gestartet, etwa 15 Ingenieurinnen und Ingenieure haben bisher daran teilgenommen.
Axel Koch ist davon überzeugt, dass solche Arbeitseinsätze in der Produktion für Akademiker etwas bringen und nachahmenswert sind. Koch ist Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning bei München. Damit so eine Praxisphase wirklich erfolgreich sei, müsse sie gut begleitet werden, sagt er. Der Wirtschaftspsychologie-Professor berät regelmäßig Unternehmen zu Wissenstransfer. Er meint, dass Chefs oder Abteilungsleiter die Mitarbeitenden gut auf solche Praxisphasen vorbereiten müssten. Damit die Theoretiker nicht nur beim Arbeiten zugucken, sondern auch mit anpacken. Neben der praktischen Vorbereitung müssten sie dafür wissen, was auf sie zukommt und was sie daraus mitnehmen können. »Denn lernen können Menschen nur, wenn sie mit einer mindestens neutralen Haltung ohne Vorurteile rangehen.«
Bei Tueg Schillings erhalten Kollegen wie Lars Stephan-Büldt vor der Praxisphase an der unternehmenseigenen Akademie eine mehrstündige Theorie-Schulung. Diese soll in wenigen Monaten durch eine Chemieanlage im Kleinformat ergänzt werden. An dieser könnten Mitarbeiter und Kunden dann lernen, welche Technik geprüft wird und warum das wichtig ist. Da Tueg Schillings in sicherheitskritischen Bereichen tätig ist, müssen auch die Ingenieure vor dem Einsatz konkrete Wissenstests bestehen. Sonst dürfen sie viele Anlagen gar nicht betreten.
Sind die Ingenieure dann geschult, müssen sie beim Kunden auch mit anpacken. Für Stephan-Büldt hieß das beim Einsatz im Chemiepark heute, dass er gemeinsam mit dem sechsköpfigen Prüfteam die Messwerte mit der Leitstelle abgeglichen hat.
Eine Erkenntnis hat er schon nach wenigen Tagen mitgenommen: »Wenn ich jetzt eine Anlage planen würde, hätte ich eine andere Sicht darauf und würde Prüfstellen und Messeinheiten möglichst leicht zugäng-
»Die Fachkräfte hier aus der Region wissen, dass wir mit der Blaumann-Phase einen besonderen Weg gehen«
Nicolas Bennerscheid, Geschäftsführer
lich einplanen – auch wenn es aus technischer Sicht nicht unbedingt notwendig wäre.« Allein für solche Aha-Momente der Mitarbeiter lohnt sich der Einsatz für die Firma.


Doch neben den Ingenieuren sollen auch die Handwerker bei Tueg Schillings von den Arbeitseinsätzen profitieren. Weil sie anders ausgebildete und oft jüngere Menschen wie Stephan-Büldt führen und ihnen komplexe Prozesse erklären müssen. Dafür können sie im Austausch mit den Ingenieuren dann besser nachvollziehen, wie die Kollegen die Anlagen konstruieren und Prozesse planen.
Damit dieses gegenseitige Verständnis entsteht, komme es auch auf geschickt gestellte Fragen an, meint der Wirtschaftspsychologe Axel Koch. »Warum-Fragen« seien dabei meist kontraproduktiv, auch wenn sie ohne bösen Hintergedanken gestellt würden. Selbst wenn das Gegenüber wirklich nur verstehen wolle, warum eine Prüfung in einer bestimmten Reihenfolge





erfolgt, könne allein das Wort »Warum« eine Abwehrhaltung provozieren. »Die Frage nach dem Warum führt schnell zu einer defensiven Haltung, das Gegenüber versucht dann, sich zu rechtfertigen«, sagt Koch.
Besser seien Fragen wie: Seit wann macht ihr das so? Was sind eure Gedanken zu dem Thema? Welche Probleme gibt es hier? Solche Fragen regten zum Austausch ein.








Für einen erfolgreichen Wissenstransfer sei es zudem nötig, über das Gelernte nachzudenken und es zu verinnerlichen, sagt der Wissenschaftler. Er rät dazu, dass Arbeitgeber während der Praxisphasen längere Pausen für die Reflexion einplanen. Auch der Austausch mit dem Chef oder dem Abteilungsleiter könne helfen.

Bei Tueg Schillings sind für diese Reflexion Feedbackgespräche eingeplant, außerdem werden Praxisphasen gezielt durch Pausen unterbrochen. Die sechs Monate lange Feldphase wird nicht am Stück umge-
setzt. Stattdessen wechseln Ingenieure wie Lars Stephan-Büldt zwischen Schreibtisch und Anlagen hin und her.
Die Praxiseinsätze böten nicht nur Vorteile bei der Arbeit, sie verbesserten auch die Stimmung im Betrieb, sagt der Geschäftsführer Bennerscheid. Weil sich Handwerker und Ingenieure besser kennenlernen und leichter aufeinander zugehen könnten: »Wir haben nicht zwei Lager bei uns.«


Das spiegelt sich auch in den Bewertungen wider, die Beschäftigte von Tueg Schillings auf der Plattform Kununu anonym hinterlassen. Dort geben sie dem Unternehmen im Schnitt 4,1 von 5,0 Punkten. Den »Umgang miteinander« bewerten sie deutlich positiver, als es der Durchschnitt der Branche tut. »Sehr guter Teamzusammenhalt«, schreibt ein Mitarbeiter. Ein anderer lobt das »freundliche Arbeitsklima«, aber er hat auch was zu mäkeln: Die blauen Arbeitshosen sind ihm einfach zu unbequem.



Jürgen Bergmann hat einen Freizeitpark aufgebaut, dann ging er pleite. Seine Lebenspartnerin Doreen Stopporka übernahm die Leitung. Dem Betrieb tut das gut – genau wie der Beziehung VON
Froh, nicht normal zu sein: Diesen Satz hat Jürgen Bergmann sich auf seinen Pullover drucken lassen. Und dass er kein normaler Unternehmer ist, ist schon beim ersten Treffen zu merken. Wenn der 66-Jährige da steht, mit seinem weißen Rauschebart, und ein Stück geschlagenes Fichtenholz streichelt, könnte man ihn für einen Einsiedler halten. Aber Bergmann ist ein Geschäfts-
mann: Das Fichtenholz will er in dem Freizeitpark verbauen, den er in Neißeaue aufgebaut hat.
Hier, bei Görlitz, hat Bergmann vor mehr als 30 Jahren ein altes Bauernhaus gekauft – heute steht hier eine Abenteuerlandschaft voller Holzbauten, die etwa 100.000 Menschen im Jahr anlockt. »Die Geheime Welt von Turisede« heißt der Park, ein Ge-

heimnis ist er schon lange nicht mehr. Außerdem hat Bergmann ein Baumhaushotel eröffnet und betreibt eine Produktion von Holzanlagen, die weltweit exportiert werden. Riesige Piratenschiffe oder Einhörner zum Spielen, für Kinder und Erwachsene, viele würden sagen: Spielplätze. Aber Spielplatz ist für Bergmann ein Begriff, der nicht genannt werden darf. »Der hat mit dem, was

wir machen, definitiv nichts zu tun«, sagt er. Er sehe sich eher als Bauherr kleiner Welten, »in denen sich die Menschen wohlfühlen und neue Dinge erleben können«.
Das klingt alles märchenhaft. Ist es aber nicht. Wenn man Bergmann einen Tag lang begleitet, lernt man, dass er viel Lehrgeld bezahlt hat für den Erfolg. Er musste etwas lernen, das viele Gründer erst erkennen müssen: Je mehr das Unternehmen wächst, desto komplexer wird auch die Führung. Es reicht nicht aus, gute Produkte und Dienstleistungen zu haben. Man braucht auch eine funktionierende Finanzstrategie. Gute strategische Berater. Die richtige Balance zwischen Kundenansprüchen und vorhandenen Ressourcen. Und er brauchte: Doreen Stopporka. Die 47-Jährige ist mittlerweile Geschäftsführerin und seine Frau. Die Firma schmeißen beide nun zusammen, als eine Art Doppelspitze. Nur deshalb gibt es Turisede noch.
Der Tag in Neißeaue beginnt mit einem Frühstück mit einem Großteil der Mitarbeiter, 150 bis 200 sind es, je nach Saison. Es ist ein tägliches Ritual. Bergmann und Stopporka sitzen am Tischende, es riecht nach Fleischwurst und Filterkaffee. Neben den Brötchen wird auch die Arbeit verteilt. »Man setzt sich an einen Platz und wartet, bis man vorrutscht«, sagt Marie Plagge. Die 24-Jährige kümmert sich um die Veranstaltungen, die auf dem Gelände von Turisede stattfinden, und sie will wissen, ob sie Künstler für ein Bühnenprogramm einladen darf. Stopporka übernimmt: Ja, aber nur, wenn sich Unternehmen aus der Region finden, die Werbeplakate auf der Veranstaltung buchen. Das Ganze soll ja nicht nur schön werden, es muss sich auch lohnen.
Nach dem Essen teilen sich Stopporka und Bergmann auf: Sie geht an den Schreibtisch, er in den Modellbauraum. Dort schaut er sich jetzt ein Schlösschen mit mit telalterlichen Türmen an. »Schöne Arbeit«, sagt Bergmann zum Schreiner, der es gebaut hat. Aber dann gibt es Streit: Bergmann will, dass das Team einige Modelle schneller fertigbekommt. »Der Umgang ist schon mal laut«, sagt eine von ihnen später. »Aber immer herzlich, auf Augenhöhe. Kreativ eben.«
Das ist die Rollenteilung hier: Bergmann hat Visionen und entwickelt Neues, was nicht immer einfach ist. Doreen Stopporka ist die Geschäftsführerin, die alles im Griff hat. Die Diplomatin, die Kunden mit Verlässlichkeit und klaren Antworten um den Finger wickelt. Den Freizeitpark gibt es wohl nur noch, weil die beiden das Kreative und das Operative so gut verbinden.
Bergmann hat das alles aufgebaut: In seinen jungen Jahren hatte er als Holzfäller gearbeitet. Irgendwann hatte er begonnen, kleine Schnitzereien herzustellen, machte eine Ausbildung zum Holzbildhauer und besuchte Kurse an der Leipziger Kunsthochschule. Dann kamen das Jahr 1989 und die Wende. Billigwaren aus dem Westen überschwemmten den Markt, die Künstler aus der Region litten darunter.
Bergmann aber hatte einen Plan: Von kleinen Holzwerken schwenkte er auf große um. Statt zu schnitzen, griff er zur Kettensäge. Weil das Leben hier für viele Kinder trostlos war, wurden Spielplätze finanziell gefördert. Das half Bergmann. Am Tag der Währungsunion im Juli 1990 gründete er die »Künstlerische Holzgestaltung Jürgen Bergmann«. Nach und nach kaufte er die Grundstücke um den alten Bauernhof herum und fing an, Waren bis nach Ostasien zu exportieren – und im Gegenzug Besucher aus Polen herzulocken.
Doch das Geschäft wuchs ihm über den Kopf. Er steckte Geld in ein riesiges Theater, mit 43 Treppen, 23 Ebenen, 11 Brücken –das kostete viel. Er plante ein Festival namens Folklorum, das ausfallen musste – Bergmann blieb auf den Kosten sitzen. Als dann ein Zoo eine Order verschob, geriet sein Geschäft mit den Holzbauten in Schieflage, der Verlust summierte sich auf mehrere 100.000 Euro. Das waren zu viele Probleme auf einmal. Er meldete Insolvenz an, an einem Wintertag im Januar 2013.
Heute weiß Bergmann, was ihm zum Verhängnis wurde: Er zögerte, wichtigen Kunden zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen. Zukünftige Geldflüsse hätte die Firma besser planen müssen. Und er war Kunde bei einem kleinen Steuerberaterbüro ohne echte Beratung. Doch der »Absturz«, wie er ihn nennt, sei nicht vergeblich gewesen:
Entdecken Sie individuelle Architektenhäuser aus Holz und Glas!



huf-haus.com

»Wenn man ganz unten ist, eröffnen sich auch neue Perspektiven.«
Bergmann redet offen über Fehler. Über die Angst »um meine vielen Mitarbeiter, um die Firma – und davor, mich selbst finanziell nicht mehr zu erholen«. Dann hellt sich sein Gesicht wieder auf. »Aber aufgeben, niemals!«, sagt er. »Das ist mein Lebenswerk, alles, was ich liebe. Für die Region ist die Firma außerdem unheimlich wichtig.«
Tatsächlich ist die Geschichte der Firma eng mit dem lokalen Geschehen rund um Görlitz verbunden. Nach der Wende gingen hier Tausende Arbeitsplätze verloren, weil Fabriken und Gruben schließen mussten, die im Sozialismus keine Wettbewerber hatten, aber in der Marktwirtschaft der Bundesrepublik unter Druck gerieten. Immer mehr Menschen lebten von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe – und hatten kaum noch Geld für Kunst und Kultur. Viele kehrten der Region den Rücken: Zählte Görlitz 1989 etwa 75.000 Einwohner, sind es drei Jahrzehnte später rund 20.000 weniger. Bergmann aber blieb. Er gab den Menschen Arbeit und Gelegenheiten, sich abzulenken.
Und so stand 2013 nicht nur sein Unternehmen auf der Kippe – sondern eine Institution, die für die Menschen in Neißeaue mehr war als ein Arbeitgeber.
Was also tun?
Bergmann kam als Einzelkämpfer nicht mehr weiter. Doch er hatte Doreen Stopporka an seiner Seite. Sie ist Forstwirtin, arbeitete seit 1996 für Bergmann und war zum Zeitpunkt der Insolvenz seine Freundin. Sie liebte ihn, das Unternehmen, die Arbeit in der Natur und mit dem Holz. Und gab deshalb alles: Im September 2013 unterschrieb sie den Vertrag, der sie zur Geschäftsführerin machte – am Tag nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. »Es war eine belastende Zeit, aber auch eine wunderschöne Zeit«, erinnert sich Stopporka. »Alles war neu: Das Kind kam, die Firma, die ich schon so viele Jahre lang so liebte, war gerettet.«
Nun waren auch zwei Gesellschafter bereit, Geld zu investieren: das Medienunternehmen Haeswe und die Campingfirma Franceloc. Sie reden heute mit, wenn es um größere Investitionen geht. Und ganz formell zählt Stopporkas Wort nun mehr als Berg
manns. Wie ist das, den Gründer und Ehemann praktisch zu entmachten? »Unser Verhältnis ist sogar inniger geworden«, sagt Stopporka. »Wir streiten uns fast nie, mögen uns noch immer genauso gerne, obwohl wir uns den ganzen Tag über sehen.«
Offenbar hilft den beiden, was andere Beziehungen auf eine Probe stellen kann: Sie trennen nicht zwischen Firma und Familie. Ihr verglastes Büro haben sie direkt auf ihr Wohnhaus gebaut. Dort können sie über die Baumwipfel blicken. Die beiden haben sogar in einer Halle des Freizeitparks geheiratet. »Zweisamkeit zu haben, Kraft zu tanken ist schwierig, weil wir viel Arbeit haben«, sagt Bergmann. Selbst ihre Urlaubsreisen verbinden sie oft mit Geschäftsterminen.
Es ist früher Nachmittag, Stopporka und Bergmann müssen wieder arbeiten. Potenzielle Kunden sind angereist, aus Österreich, wo sie in einem Skigebiet gerne eine Spiellandschaft von Bergmann und Stopporka aufbauen würden. Bergmann und Stopporka führen die Gäste ins Restaurant des Parks, es gibt Kaffee und Kuchen, das Design des Geschirrs hat Bergmann selbst gestaltet.

Das Unternehmerpaar bietet den Kunden das Du an. Abwechselnd erzählen sie die Geschichte des Parks, von Projekten und davon, wie eine Zusammenarbeit aussähe.
Erst besuche er potenzielle Kunden, erklärt Bergmann. Dann entwickle er eine Idee und diskutiere sie mit seinem Team. Sobald ein erster Plan und eine Skizze des Modells konzipiert seien, folge ein gemeinsamer Workshop in Turisede. »Am Ende kommt ein maßstabsgerechtes Modell heraus«, verspricht Bergmann, »das setzen unsere Monteure dann bei Euch in groß um.«
Es ist auch eine Show, die das Paar aufführt, und dass die so gut funktioniert, hat zwei Gründe: Die beiden haben sie vielfach aufgeführt. Und sie sind authentisch, sie leben für Park und die Firma, die seit der Insolvenz wieder gewachsen ist: Etwa 367.000 Euro Gewinn nach Steuern machte sie laut Unternehmensregister im Jahr vor der CoronaPandemie, 2019. Im Jahr 2020 war es fast eine Viertelmillion Euro Verlust, aber schon 2021 stand wieder eine schwarze Null in der Bilanz. Wie viel Geld der Park aktuell verdient, verrät das Unternehmerpaar nicht. Nur so viel: Klammere man die schwere Zeit während der Pandemie aus, gehe es dem Unternehmen heute so gut wie nie zuvor.
Das liegt wohl auch daran, dass sich die Region langsam erholt. Zuletzt ist Görlitz wieder gewachsen, im Dezember 2022 auf etwa 57.500 Einwohner, dazu kommen Pendler aus Polen. Und so mancher, der weggezogen ist, kehrt als Tourist zurück und bringt Geld mit. Das merkt man, wenn man mit den Besuchern im Freizeitpark redet. Da ist etwa Caro BrummernHenrich, 40, die mittlerweile in Münster wohnt. Wenn sie ihre Mutter im Nachbarort von Neißeaue besucht, bringt sie die Kinder mit und geht mit ihnen in den TurisedePark. Oder Ulrike Schwarzenberg, 32, die hier immer als Kind war und die Abenteuerwelt nun ihrem Sohn Theo, 4, zeigt. Mit ihm und ihrem Mann übernachtet sie in einem der Baumhäuser, die wie Hotelzimmer ausgestattet sind.
Es ist 18 Uhr, als die Kunden wieder abreisen und die Mitarbeiter Feierabend machen. Stopporka muss noch mal zurück an den Schreibtisch. Und Bergmann bricht zu einem Kunden nach Spanien auf. Er steigt in seinen Lieferwagen, 20 Stunden wird die Fahrt wohl dauern. Für Bergmann und Stopporka hat die Arbeit oft keine Grenzen.
11. Juli 2023 | 9:00 bis 13:00 Uhr
Design Offices Eberhardhöfe
Stuttgar t
Melden Sie sich jetzt an!

Vernetzen. Austauschen. Lernen.
Diskutieren Sie mit uns über die Themen der Zukunft. – Welche politischen Rahmenbedingungen sind für Sie von Relevanz, um Innovationen zu fördern und in der Region zu bleiben? Wie gelingt es Ideen aus der Forschung zur Marktfähigkeit zu entwickeln? Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz im globalen Wettbewerb der neuen Ideen?
Diese und viele weitere aktuelle Fragen stehen im Mittelpunkt der Konferenz, zu der wir Sie herzlich nach Stuttgar t einladen.
Sprecher:innen (Auszug):


Daniel Abbou


Geschäftsführer, KI Bundesverband e.V.
zeitfuerunternehmer.de
Prof. Dr. Katharina Hölzle Institutsleiterin IAT Universität Stuttgart & Fraunhofer IAO
Prof. Dr. Helmut Krcmar Gründungsdekan, TUM Campus Heilbronn
Bettina Müller Head of Corporate Communications & Unternehmenssprecherin, Design Offices


Abonnieren Sie auch unseren ZEIT für Unternehmer Community Newsletter. Das Netzwerk für Anpacker. Für alle, die den Mittelstand pragmatisch in die neue Zeit über führen wollen.
Partner: Veranstalter:
Zur kostenfreien Registrierung einfach den QR-Code scannen! studiozx.de/events/zfubw

Die Irritation
Das geht nicht: Diesen Satz hat Hansjörg Bihl oft zu hören bekommen, als er in seinen ersten 20 Berufsjahren für ein schwäbisches Zementwerk arbeitete. »Ich war dort im Labor ziemlich unbeliebt«, erzählt der 60-Jährige. Bihl wollte: Abfall vermeiden, Material wiederverwerten, weniger Zement verwenden. Solche Ideen interessierten im letzten Jahrtausend allerdings kaum jemanden. »Und wenn’s keiner probiert, ist doch klar, dass es nicht geht«, sagt er.
Die Idee
Lange kümmerte auch kaum jemanden, wie sehr die Zementherstellung den Klimawandel verschärft. Sie verursacht zwei Prozent der deutschen und acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen – pro Jahr sind das mehr als drei Milliarden Tonnen CO₂, das Drei- bis Vierfache des weltweiten Flugverkehrs. Dass der Bau in absehbarer Zeit ganz ohne Zement auskommen wird, konnte sich auch Bihl nicht vorstellen – aber schon, dass man davon weniger verwenden kann. Dank eines mineralischen Pulvers, das er zusammen mit seinem Kollegen Michael Hermann entwickelte. Das Additiv namens Novocrete wird normalem Zement beigemischt. Es erlaubt, Straßen schneller, billiger und mit weniger CO₂-Ausstoß zu sanieren.
Die Marktlücke Dafür rollt eine Fräse an, hackt den alten Belag in Stücke und pflügt ihn um. Ein Streuwagen verteilt eine genau berechnete Menge des Novecrete-Zement-Gemischs, die Fräse fügt Wasser hinzu. Schließlich plätten Walze und Grader den Boden, bevor er hart wird. Der Clou: Der alte Belag wird nicht abgetragen und per Lkw auf der Deponie entsorgt, sondern an Ort und Stelle wiederverwendet. Das passiert bisher sehr selten: In Deutschland werden jährlich rund 130 Millionen Tonnen Baumaterial einfach entsorgt.
die Kunden Schlange gestanden hätten. Aber nein: »Die Baubranche ist unheimlich konservativ«, sagt Bihl senior. »Die haben mich gefragt: Wie lange machst du das schon? Drei Jahre? Komm mal in zehn wieder.« Am Ende dauerte es fast 20. Zentrale Erfolgsfaktoren: steigende Deponiegebühren und eine neue Verordnung in Baden-Württemberg. Sie bewirkt, dass die öffentliche Hand künftig den CO₂-Ausstoß ihrer Bauprojekte mehr berücksichtigen muss.
Der Erfolg
Zweifler und Förderer

Bihls Arbeitgeber, die Zementfirma, fand die Idee nicht so reizvoll: Warum einen Stoff vermarkten, der dafür sorgt, dass weniger Zement gebraucht wird? Also machten Bihl und Hermann sich im Jahr 2002 selbstständig. Weniger Emissionen, geringerer Rohstoffbedarf, kürzere Bauzeit, längere Haltbarkeit – man sollte meinen, dass
Hermann hat sich vor acht Jahren in den Ruhestand verabschiedet, Hansjörg Bihls Sohn Julian hat übernommen. Der 30-Jährige hat den Zeitgeist erkannt, der Umsatz stieg zuletzt jedes Jahr um die Hälfte. Dieses Jahr soll es ein Plus von 70 Prozent sein. Inzwischen arbeiten 20 Angestellte für die Bihls, ihre IBS GmbH aus Bösingen ist in 30 Ländern aktiv, Novocrete wird etwa beim Bau eines Hafens in Kamerun eingesetzt. Gerade hat die Familienfirma den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Mittelstand erhalten. Die Jury verpasste Novocrete den Spitznamen »Mondamin der Straße«. Wenn das Mineralpulver nur halb so erfolgreich wird wie das Stärkemehl, haben die Bihls ausgesorgt.
Ein Vater und ein Sohn arbeiten daran, dass beim Straßenbau weniger Zement verbraucht und das Klima geschont wird. Sie stoßen auf hartnäckige WiderständeJulian (l.) und Hansjörg Bihl entwickeln das »Mondamin der Straße«
11. Juli 2023 | 9:00 bis 13:00 Uhr
Design Offices Eberhardhöfe Stuttgar t
Melden Sie sich jetzt an!
Vernetz
Diskutieren Sie mit uns über die Rahmenbedingungen sind für Sie von Rele er Region zu bleiben? Wie gelingt es Ideen a twickeln? Und welche Rolle spielt künstlich euen Ideen?
Diese und viele weitere aktu erenz, zu der wir Sie
Sprecher:innen (Auszug):



Daniel Abbou

Geschäftsführer, KI Bundesverband e.V.
ernehmer.de
Prof. Dr. Katharina Hölzle Institutsleiterin IAT Universität Stuttgart & Fraunhofer IAO



Sie auch unseren ZEIT für Unternehmer Commun erk für Anpacker. Für alle, die den Mittelstand über führen wollen.
Hauptpreis: Ein Uhrenklassiker von Junghans »Max

Partner: Veranstalter:
4 x Füllfederhalter aus der Manufaktur Otto Hutt Schreibgeräte

Zur kostenfre rierung einfach den QR-Code scannen! studiozx.de/events/zfubw

 Prof. Dr. Helmut Krcmar Gründungsdekan, TUM Campus Heilbronn
Prof. Dr. Helmut Krcmar Gründungsdekan, TUM Campus Heilbronn













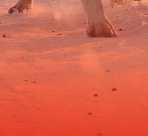














Erfolgreiche Teamführung lernt man am besten durch Extremerfahrungen. Dafür schickt Hendrik Stachnau Führungskräfte auf dünnes Eis – mit seinen Schlittenhunden. Für den Business-Coach ist ner vige Buchhaltung dabei





seinem Bürokram ist er voll in der Spur.
„Mein Traum: Führungskräfte zu Leitwölfen machen.“
Hendrik Stachnau, Mental-Coach