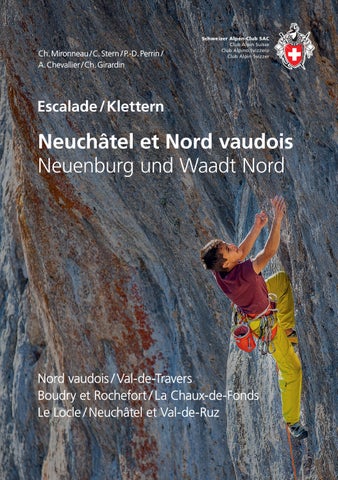15 minute read
Historique / Geschichte
Neuchâtel, un peu d’histoire… et d’humeur.
Le topo de Neuchâtel est là ! Cet ouvrage tant attendu, tant craint, follement désiré, peutêtre même indésirable est maintenant entre vos mains. Un morceau d’histoire carrément… de l’escalade neuchâteloise ! Car n’exagérons rien, si pour beaucoup l’importance de ce bouquin, avec toutes les polémiques, discussions, accords, désaccords qu’il suscite, est grande, il n’est en réalité qu’un petit chapitre de plus dans l’évolution de notre pratique.
L’escalade est une activité de passionnés, de personnes de caractère, qui fait que justement, c’est un peu plus qu’un sport et la place que l’on y accorde est parfois démesurée. Une chose est sûre : ceux qui ont découvert et défriché les sites sont des passionnés, des acharnés même, au delà du raisonnable parfois. Celles et ceux (l’escalade s’est démocratisée et féminisée depuis) qui ont fréquenté assidument tous ces sites et secteurs depuis de nombreuses années le sont également ; alors évidemment les auteurs de cet ouvrage ne pouvaient être que des passionnés…
Leur vision de l’activité, de son évolution, l’envie de partager, de protéger aussi, ont amené à vouloir pérenniser ce patrimoine grimpistique, à communiquer sur les sites de notre région, à graver dans le… papier la situation actuelle de l’escalade dans le canton. Voulaient-ils faire fi des usages locaux, laisser leurs noms dans la « légende » régionale, ajouter leur grain de sel aux discussions d’après grimpe ou ont-ils pensé que c’était le bon moment de partager avec le monde entier la beauté de nos sites ? Voulaient-ils juste un ouvrage de référence pour leur propre usage ? Allez savoir… Un peu de tout ça certainement. Mais ils l’ont fait ! Permettant au passage de clarifier un certain nombre de situations, de briser quelques non-dits, de répondre à beaucoup de craintes et probablement d’alimenter encore un peu plus la petite histoire de l’escalade dans le canton de Neuchâtel.
Histoire… Nous n’allons pas réécrire ce qui a déjà été décrit en détail et fort bien documenté dans d’autres ouvrages sur l’escalade en Suisse romande ; parlons plutôt d’un site neuchâtelois emblématique d’une époque qui a imprégné les mentalités jusqu’à nos jours : Les Lans, aujourd’hui, sanctuaire et site confidentiel. Pourquoi sanctuaire de l’escalade libre ? Parce que ce site servait de point de rendez-vous d’une bande de grimpeurs anarchistes, révoltés, rebelles et précurseurs dans les années 70 : les célèbres Taborniaux. Les restes d’une cabane au pied de la grande face témoignent d’une fréquentation assidue et de nombreuses journées et soirées à grimper, refaire le monde, faire la fête, préparer en ces lieux les futures grandes ascensions.
Les années 70 étaient le tournant du passage de l’escalade artificielle (l’artif’) à l’escalade libre un peu partout dans le monde et donc dans notre canton aussi. Les deux pratiques se côtoyaient allégrement, se mélangeaient, se superposaient parfois, avec plus ou moins de conflits, sur les mêmes itinéraires. La bande en question a repoussé les limites tant physiques que mentales pour l’escalade libre et les « séances d’entraînement » aux Lans et sur les autres sites de la région ont permis des réalisations exceptionnelles ensuite dans les Alpes et sur d’autres falaises. Comme dans toutes les bandes, il y avait des règles, des habitudes, des bizutages et pas mal de testostérone (les filles qui grimpaient à cette époque étaient plutôt rares…). Un mot d’ordre général : il faut oser pour grimper… Oser monter jusqu’au premier point placé aussi haut que
possible pour prouver son courage, faire les voies en « grosses », en solo, enchaîner les montéesdescentes, bref repousser ses propres limites pour progresser et pour impressionner les copains. Précisons que l’équipement était cher pour les moyens financiers des jeunes qui composaient cette bande. Donc… moins on mettait de spits, mieux c’était ! Et puisque ça passe comme ça pour certains, ça ira aussi pour les autres ! Quitte à ce que l’assureur doive courir en bas du talus pour éviter que le leader ne tombe au sol, ou que la raideur du pied des voies serve de crash-pad naturel au grimpeur permettant de rouler en bas en cas de chute avant le premier point !
Cet état d’esprit reste présent sur ce site encore maintenant et, pardonnez l’expression, il faut toujours avoir des couilles ou du clito pour grimper aux Lans. Et c’est bien qu’il reste encore des endroits non-aseptisés, où la grimpe est un peu plus qu’un jeu où il faut passer d’une prise à l’autre. On y trouve aussi des lignes de trad, à équiper soi-même sur friends et coinceurs. Rajouter des points dans ces voies serait offensant pour celles et ceux qui les ont déjà gravies de cette façon. Cet espace de liberté pour certains comporte trop de contraintes pour d’autres… Mais une des libertés qu’il nous reste toujours est de pouvoir choisir d’aller y grimper ou pas !
Dans le canton comme ailleurs, l’escalade a évolué, s’est démocratisée, la pratique s’est sécurisée, l’équipement est devenu meilleur marché, plus sûr, les salles sont apparues, la formation s’est professionnalisée et ne se fait plus forcément sur le tas. Les pratiques se sont diversifiées aussi, bloc, couennes, longues voies, terrain d’aventure… Certains grimpeurs se sont spécialisés dans l’une ou l’autre pratique, d’autres préfèrent toucher à tout, mais dans tous les cas le nombre de pratiquants a explosé. Avec la parution de ce guide, c’est peut-être encore un petit morceau de cet historique esprit rebelle et exclusif qui s’estompe. Spot secret ou secret de polichinelle, les sites sont maintenant répertoriés et l’escalade moderne continue d’évoluer… en essayant de ne pas oublier les précurseurs qui ont rendu notre activité possible, en essayant aussi de connaître et de respecter les usages et habitudes qui ont cours sur les falaises de la région et en essayant évidemment de garder à l’esprit qu’on a le privilège de pratiquer une activité aussi inutile que passionnante dans un milieu naturel qu’il faut respecter.
Ali Chevallier
Vaud, un peu d’histoire…
Prétendre que, dès la nuit des temps, lorsqu’une rencontre entre un rocher petit ou grand et un homme a eu lieu, le deuxième a tenté d’escalader le premier pour se protéger des attaques d’un animal sauvage ou d’un de ses congénères, échapper à la montée des eaux, au feu, ou par esprit de découverte, pour voir au loin, par plaisir aussi, n’est sûrement pas se perdre en divagations. On peut donc affirmer sans risque que l’escalade est née avec l’apparition des premiers êtres vivants sur notre planète.
Cette activité, que l’on désigna longtemps du mot fous-y-tout alpinisme, terme qui englobait les divers sports de montagne, a connu un fort développement au cours du dernier quart du 20ème siècle, s’est spécialisée, et a pris des formes diverses que l’on nomme actuellement, selon son âge : varappe (les patriarches), escalade ou grimpe, tout en précisant : sportive, aventure, plaisir ou encore, prétexte. Si les pionniers de l’escalade dans le Jura vaudois ne nous ont légué que peu de récits de leurs réalisations, les voies qu’ils ont ouvertes dans la 1ère partie du 20ème siècle parlent pour eux.
La corde de chanvre de trente mètres nouée autour de la taille, les pieds parés de chaussures à clous (les souliers militaires, souvent), avec pour points d’assurage des pitons de forgeron et des coins de bois très parcimonieusement placés, les meilleurs d’entre eux affrontaient des difficultés techniques à prendre au sérieux aujourd’hui encore. A la fin des années 1950 et au cours des années 1960 arriva dans le milieu une nouvelle génération de grimpeurs animés par un bel élan d’enthousiasme. De nouvelles falaises furent découvertes, des voies y furent tracées, des défis encore inédits s’offrirent aux grimpeurs.
Les années passèrent. Les générations de grimpeurs se succédèrent. L’équipement fixe mis en place vieillit, rouilla, disparut. Il y eut des actes de vandalisme, du vol de matériel. Dès la fin des années 1970, les pitons de forgeron et les coins de bois furent progressivement remplacés par des goujons à expansion. Dès lors, l’évolution de l’escalade s’accélère, on grimpe en chaussons, on s’entraîne à longueur d’année, bientôt les murs de grimpe intérieurs fabriqués se multiplient, le niveau moyen des escaladeurs s’élève. Les voies sont marquées, topographiées par divers éditeurs ayant des visées commerciales, sécurisées, pourvues de relais, entretenues et parfois sur-fréquentées.
Au cours de la première décade du 21ème siècle, quelques mutants, à Saint-Loup, en inaugurant sur le plan local le 9ème degré, propulsent l’escalade en terres jurassiennes vaudoises au sommet des possibilités humaines du moment.
Depuis peu de temps, la pratique du dry-tooling (grimpe sur rocher avec les outils de la cascade de glace en sus du matériel habituel d’escalade) s’est imposée dans le Jura aussi. Grâce à l’équipement de grande qualité de la majorité des voies, les accidents, eux, se font rares.
Actuellement, du pied du Jura à son sommet, de très nombreux sites, des voies de toutes difficultés, par centaines, sont proposées au choix des grimpeurs par des ouvreurs bénévoles, le plus souvent travailleurs de l’ombre. On peut tenir pour certain qu’à l’heure où les anciens se retireront, la jeunesse prendra la relève et saura, avec talent, entretenir ces terrains de jeux, en découvrir de nouveaux et les mettre en valeur en utilisant les outils, les techniques, l’ensemble des valeurs propres au milieu et à l’époque.
Et l’avenir ? Il sera probablement fait d’un subtil équilibre entre le désir bien légitime de s’adonner à de stimulantes activités de plein air, dans un cadre sauvage, en toute liberté, et la nécessité de préserver le milieu naturel dans lequel elles se déroulent.
Marcel Maurice Demont
Neuenburg – ein bisschen Geschichte und Stimmung
Der Neuenburger Kletterführer ist da! Nun liegt also dieses lang erwartete, gefürchtete, sehnlich erwünschte (oder auch nicht …) Werk vor uns. Es verkörpert geradezu ein Stück Geschichte der Kletterei in diesem Kanton. Doch übertreiben wir nicht: Wenn auch die Bedeutung dieses Büchleins – mit allen Polemiken, Diskussionen und der Zustimmung und Ablehnung, die es hervorrufen wird – für viele gross ist, ist es in Wirklichkeit nur ein weiteres kleines Kapitel in der Entwicklung unseres Hobbys.
Das Klettern wird von Leidenschaftlichen und Charakterköpfen betrieben; dies hat zur Folge, dass es zu Recht mehr als nur Sport ist und der Platz, den es einnimmt, zuweilen übertrieben gross ist. Eines ist sicher: Jene, welche die Klettergebiete entdeckt, urbar gemacht und geputzt haben, sind Passionierte, gar Versessene, manchmal jenseits jeglicher Vernunft. Jene (Männer und Frauen, das Klettern ist populärer und weiblicher geworden), die diese Gebiete seit zahlreichen Jahren eifrig besuchen, sind es ebenfalls – und genauso sind es die Autoren dieses Buchs!
Ihre Vision des Kletterns und seiner Entwicklung, der Wunsch zu teilen und auch zu schützen, hat die Autoren dazu gebracht, dieses Kletter-«Gut» nachhaltig zu sichern, die Gebiete unserer Region bekannt zu machen und die gegenwärtige Situation des Kletterns hier auf Papier zu bringen. Wollten sie lokale Gepflogenheiten in den Wind schlagen und ihre Namen in die regionalen Annalen einschreiben, ihr Salzkorn in die Après-Grimpe-Diskussionen einbringen? Oder haben sie schlicht gedacht, der Moment sei gekommen, um die Schönheit unserer Klettergärten der ganzen Welt zu verkünden? Wollten sie einfach ein Referenzwerk für den Eigengebrauch? Wer weiss – vielleicht von allem ein bisschen. So oder so: Sie haben es gemacht! Und dabei wurden nebenbei die Klärung gewisser Situationen, das Auflösen von Nicht-Ausgesprochenem, das Beantworten vieler Befürchtungen und damit das Erweitern der kleinen Klettergeschichte von Neuenburg möglich.
Geschichte … Wir wollen hier nicht wiederholen, was bereits im Detail und gut dokumentiert in anderen Werken über das Klettern in der französischen Schweiz geschrieben worden ist; lasst uns besser über ein Gebiet schreiben, das sinnbildlich für eine ganze Zeit steht und das Denken bis heute prägt: Les Lans – Kletter-Heiligtum einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft. Warum Heiligtum des Freikletterns? Weil dieses Gebiet einer Bande von anarchischen und aufständischen Kletterern und Pionieren in den 1970er Jahren als Treffpunkt diente: den berühmten Taborniaux. Die Überreste einer Hütte am Fuss der grossen Wand zeugen von einer fleissigen Frequentierung und zahlreichen Klettertagen und Abenden, an denen die Welt neu erschaffen, gefestet und der Keim zu künftigen grossen Besteigungen gelegt wurde.
Jene 70er Jahre verkörperten ein bisschen überall in der Welt den Übergang vom technischen zum freien Klettern – und so war es auch in unserem Kanton. Die beiden Stile hatten viele Berührungspunkte und vermischten und überlagerten sich manchmal mit mehr oder weniger Streitigkeiten innerhalb einer einzigen Route. Die erwähnte Bande verschob sowohl die körperlichen als auch die mentalen Grenzen im Freiklettern, und die «Trainingseinheiten» von Les Lans und anderen Gebieten der Region erlaubten später aussergewöhnliche Leistungen in den Alpen und anderen Klettergärten. Wie in allen rechten Cliquen gab es Regeln, Gewohnheiten, Mutproben und nicht zu wenig Testosteron (kletternde Mädchen und Frauen waren damals ziemlich selten …). Die Losung lautete: Zum Klettern braucht es Mut! Mut, um zum ersten, so weit oben wie möglich angebrachten
Sicherungspunkt hochzusteigen, die Routen in groben Schuhen oder solo zu machen, Auf- und Abstiege aneinanderzuhängen, kurz: seine Limiten verschieben, um weiterzukommen und die Kumpel zu beeindrucken.
Hier ist zu erwähnen, dass das Sicherungsmaterial für die finanziellen Mittel dieser Jungen teuer war. Auch deshalb: je weniger Bohrhaken, desto besser! Und da einige so durchgekommen sind, wird das auch für die anderen passen – auf die Gefahr hin, dass der Sichernde den Hang herunterrennen muss, um bei einem Sturz den Aufschlag des Vorsteigers auf dem Boden zu vermeiden; oder dass die Steilheit am Wandfuss als natürliches Crashpad dient, dass dem Kletterer bei einem Abgang vor dem ersten Haken erlaubt, den Hang hinunterzurollen …
Diese Geisteshaltung ist hier heute noch präsent: Verzeiht mir den Ausdruck – es braucht Eier, um in Les Lans zu klettern. Und es ist gut, dass es noch solche nicht «sterile» Gebiete gibt, wo das Klettern nicht nur ein Spiel ist, bei dem man sich von einem Griff zum nächsten hangelt. Hier gibt es auch Trad-Linien, die man selbst mit Friends und Klemmkeilen absichern kann. In diesen Routen Haken hinzufügen, wäre beleidigend für jene, die sie bereits ohne diese Sicherungspunkte bewältigt haben. Freiraum für die einen bringt eine Einschränkung für andere mit sich … Aber eine der Freiheiten, die wir immer haben, ist zu entscheiden, ob wir an einem bestimmten Ort klettern wollen oder nicht!
Wie überall sonst hat sich das Klettern in diesem Kanton entwickelt, ist zum Breitensport und sicherer geworden, auch das Absicherungsmaterial ist sicherer und günstiger, Kletterhallen sind entstanden, die Ausbildung wurde professionalisiert und findet nicht mehr nur draussen statt. Zudem haben sich die Disziplinen aufgefächert: Bouldern, Einseillängen- und Top-Rope-Klettern, lange Routen, Abenteuer-Gelände … Einige konzentrieren sich auf eine Spielart, andere machen alles. So oder so: Die Zahl der Ausübenden ist explodiert. Mit dem Erscheinen dieses Führers verblasst vielleicht ein weiteres kleines Stück des historischen, exklusiven Rebellengeistes. Ob geheim oder nicht: Die Klettergebiete sind jetzt erfasst. Die moderne Kletterei entwickelt sich; vergessen wir die Pioniere nicht, die unsere Aktivitäten erst ermöglichten, gleich wie wir die Gepflogenheiten der Klettergärten unserer Region kennen und bewahren sollten. Und natürlich müssen wir uns immer unseres Privilegs bewusst sein, eine ebenso überflüssige wie faszinierende Aktivität in einem natürlichen Umfeld auszuüben, das mit grösstem Respekt zu behandeln ist.
Ali Chevallier
Waadt, ein bisschen Geschichte …
Wir verlieren uns sicher nicht in Fantastereien mit der Behauptung, dass die Menschen seit Urzeiten, wenn sie auf einen kleinen oder grossen Felsen trafen, diesen zu besteigen versuchten – sei es, um sich vor den Angriffen eines wilden Tiers oder anderer Menschen zu schützen, dem Hochwasser oder Feuer zu entkommen oder aber aus einem Entdeckergeist heraus, um in die Ferne zu sehen oder schlicht zum Vergnügen. Sicher können wir also sagen, dass die Kletterei mit dem Erscheinen der ersten Lebewesen auf unserem Planeten entstanden ist.
Diese Aktivität, die lange mit dem allgemeinen Wort Alpinismus bezeichnet wurde, dem Begriff, der alle Bergsportarten umfasste, entwickelte sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts stark, spezialisierte sich und nahm verschiedene Formen an. Diese haben heute unterschiedliche Bezeichnungen und werden z. B. Sport-, Abenteuer-, Trad- oder Plaisirklettern genannt.
Die Pioniere des Kletterns im Waadtländer Jura haben uns kaum Erzählungen über ihre Leistungen hinterlassen; aber die Routen, die sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffneten, sprechen für sich. Die Besten unter ihnen gingen heute noch ernstzunehmende Schwierigkeiten an – und dies mit einem dreissig Meter langen, um die Taille gebundenen Hanfseil, Nagelschuhen (oft Militärschuhen) und als Sicherungsmaterial Schmiedehaken sowie ein paar sehr spärlich platzierten Holzkeilen. Ende der 1950er und in den 60er Jahren kam eine neue Generation von Kletterern voller Elan und Enthusiasmus in die Region. Neue Klettergärten wurden entdeckt und Routen eröffnet, die den Kletterern noch nicht da gewesene Herausforderungen boten.
Die Jahre vergingen. Generationen von Kletterern folgten aufeinander. Die vorhandenen Absicherungen veralteten, verrosteten, verschwanden. Es gab Fälle von Vandalismus und Diebstahl. Ab dem Ende der 1970er Jahre wurden geschmiedete Haken und Holzkeile allmählich durch Expansionshaken ersetzt. Von da an beschleunigte sich die Entwicklung des Kletterns, Kletterschuhe hielten Einzug, man begann, das ganze Jahr über zu trainieren, bald vervielfachten sich die Indoor-Wände, und das durchschnittliche Kletterniveau stieg. Die Routen wurden erfasst, von verschiedenen Verlagen mit kommerziellen Zielen veröffentlicht, saniert, mit Umlenkungen versehen, gewartet und waren dann manchmal plötzlich – überfüllt.
Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts katapultierten einige «Mutanten» in Saint-Loup mit der Einführung des 9. französischen Grades den Waadtländer Jura an die Spitze des damals Menschenmöglichen.
In jüngster Zeit hat sich zudem auch im Jura die Praxis des Dry-Toolings verbreitet, des Kletterns im Fels mit Eisklettergeräten zusätzlich zur üblichen Ausrüstung. Dank der hochwertigen Absicherung der meisten Routen sind heute Unfälle selten.
Heute werden den Kletterern vom Fuss des Juras bis zu seinen Anhöhen von freiwilligen Erschliessern, die meist im Schatten bleiben, sehr viele Gebiete mit Hunderten von Routen in allen Schwierigkeiten zur Verfügung gestellt.
Wir können davon ausgehen, dass die Jugend – wenn die Alten sich zurückziehen – die Verantwortung übernehmen und die Fähigkeit und das Wissen haben wird, wie man diese Spielplätze pflegt, neue entdeckt und aufwertet, indem sie die sowohl der Umwelt als auch der Zeit angepassten Werkzeuge, Techniken und Werte einsetzt.
Und die Zukunft? Wahrscheinlich wird sie aus einem feinen Gleichgewicht bestehen zwischen dem gerechtfertigten Wunsch, Outdoor-Aktivitäten in der wilden Natur in aller Freiheit auszuüben und der Notwendigkeit, die Umwelt zu erhalten, in der sie stattfinden.
Marcel Maurice Demont