
M. Volken | A. Rossel | R. Sägesser
W. Stucki | A. Mathyer
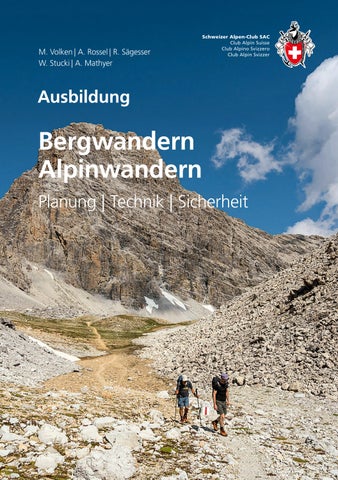

M. Volken | A. Rossel | R. Sägesser
W. Stucki | A. Mathyer
Alle Angaben in diesem Buch wurden von den Autorinnen und Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autorinnen und Autoren noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2025 Weber Verlag AG, CH-3645 Thun/Gwatt 1. Auflage 2023, 2. aktualisierte Auflage 2025
Foto Umschlag: Marco Volken Fotos und Illustrationen Inhalt: siehe Bildnachweis Konzept und Texte: Marco Volken, Anita Rossel, Rolf Sägesser, Werner Stucki, Andreas Mathyer
Weber Verlag AG Verlagsleitung SAC: Andreas Mathyer Grafisches Grundkonzept und Satz: Shana Hirschi Gestaltung Cover: Bettina Ogi Korrektorat: Esther Loosli
Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
ISBN 978-3-85902-477-9
www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch
Auslieferung EU
Brockhaus Commission GmbH Postfach 1220 D-70803 Kornwestheim info@brocom.de
M. Volken | A. Rossel | R. Sägesser W. Stucki | A. Mathyer
Planung | Technik | Sicherheit
2. Auflage
Wandern ist die beliebteste Sportaktivität. Zu diesem nicht ganz überraschenden Befund kam die Studie Sport Schweiz 2020. Gewandert wird von rund 57 Prozent der Schweizer Bevölkerung, im Schnitt an 15 Tagen pro Jahr. Tendenz steigend. Etwas überraschender dürfte sein, dass Wandern in sämtlichen Altersklassen auf Platz eins steht – die Lifetime-Sportart schlechthin. Und noch etwas aus der Studie fällt auf: Immer mehr Menschen verstehen Wandern als Sport.
Kein Wunder also, biegen sich die Regale in den Buchhandlungen unter der Last der Wanderführer. Unzählige weitere Tourenvorschläge für jede Region und jedes Bedürfnis finden sich im Internet. Zur Frage nach dem Wo gibt es also mehr als genug Antworten. Doch wie steht es mit dem Wie? Danach sucht man in den Regalen meist vergeblich. Es scheint, als bräuchte es fürs Wandern gar keine Anleitungen – «das kann man einfach». Dabei wäre eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit dem Thema durchaus angebracht. Erst recht, wenn wir nicht bloss ein bisschen «laufen gehen», sondern Wandern als Sportart betreiben, mit einer (hoffentlich gesunden) Portion Ehrgeiz und dem Wunsch, uns auch mal an längere oder schwierigere Touren zu wagen.
Die Zahlen sprechen für sich: Gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung verunfallen beim Wandern in der Schweiz jedes Jahr über 30 000 Personen, etwa 50 davon tödlich. Also nichts mit «Das kann man einfach».
Ein Buch entsteht
Gerade unter Organisationen, die in der Wanderausbildung tätig sind, zeigte sich in den letzten Jahren ein zunehmendes Bedürfnis nach einem umfassenden Lehrbuch. Und so kam es, dass sich im Herbst 2020 eine kompetente Runde einfand und den Stein ins Rollen brachte. Mit dabei waren die Alpine Rettung Schweiz, Anniviers Formation, die Beratungsstelle für Unfallverhütung, die Naturfreunde Schweiz, Pro Senectute, der Schweizer Alpen-Club, der Schweizer Bergführerverband und Schweizer Wanderwege.
Für die eigentliche Arbeit wurde eine Arbeitsgruppe aus fünf Personen gebildet – jene, die auch diese Einleitung unterschreiben. Sehr rasch merkten wir allerdings, dass die ursprüngliche Vorstellung («bestehende Unterlagen und Merkblätter auftreiben, etwas anpassen, etwas ergänzen und zu einem Buch zusammenfügen») sehr blauäugig gewesen war und dass uns deutlich mehr Arbeit erwartete. Kurz: Wir mussten ein völlig neues Buch erfinden. Manche Kapitel teilten wir uns auf, bei anderen suchten wir in Zweier- oder Dreierteams nach den richtigen Inhalten und Formulierungen. Die
Diskussionen kreisten oft um die richtige Flughöhe und Ausführlichkeit der einzelnen Kapitel, um Prioritäten, aber auch um Details bis hin zur korrekten Darstellung eines Seilknotens und der Frage, ob wir die gezackten Dinger für unter die Schuhe eher Grödel oder Spikes nennen wollten. Eine spannende Arbeit, mit vielen Sitzungen, Gesprächen und einem Berg von Mails.
Uns zur Seite stand ein Soundingboard aus Fachleuten der erwähnten Organisationen. Sie begleiteten den ganzen Prozess, vom groben Inhaltsverzeichnis bis zu den Feinheiten der einzelnen Kapitel. Ihnen verdanken wir zahlreiche wertvolle Anregungen und Korrekturen. Weitere fachliche Unterstützung erhielten wir vom Bundesamt für Sport und von Profis aus den Bereichen Umwelt, Meteorologie, Recht, Ausrüstung, Ernährung und Medizin. Das Ergebnis dieser Teamarbeit liegt hiermit vor, verdichtet zwischen zwei Buchdeckeln.
Ziele und Inhalte
Lehrbuch fürs Selbststudium, Grundlage für Ausbildungen, Leitfaden für die Planung, Nachschlagewerk – das alles möchte dieses Buch sein. Im Vordergrund steht das konkrete, praxisnahe Wissen, das uns befähigen soll, möglichst sicher unterwegs zu sein. Dabei geht es natürlich um eine Verminderung des Unfallrisikos, aber nicht nur: Denn wer sicherer unterwegs ist, kann eine Wanderung auch entspannter geniessen. Wichtig war uns zudem, keine neuen Standards oder Normen zu verkünden und keine Zeigefinger zu erheben. Da und dort mussten wir zwar ein Ausrufezeichen setzen, aber «richtig» kommt im Text doch klar häufiger vor als «falsch».
Berg- und Alpinwandern – der Titel deckt ein weites Spektrum ab. Den Schwerpunkt legten wir auf Touren im Bereich T3 bis T5 gemäss SAC-Wanderskala, auf solche Schwierigkeiten sind die Inhalte ausgerichtet.
Bei der praktischen Umsetzung dürfen wir aber nicht vergessen, dass jede Tour ihre eigenen Gesetze hat. Wird uns die Orientierung zu schaffen machen? Heikle Felspassagen? Die Ausgesetztheit? Zu überquerende Wildbäche? Das Wetter? Oder eher die Gruppengrösse? Spätestens hier kommt die Erfahrung ins Spiel, die wir uns nur im Gelände aneignen können. Zu erkennen, welcher Planungsaufwand, welches Material und welche Vorsichtsmassnahmen für eine bestimmte Tour nötig sind, gehört zu den grossen Herausforderungen beim Bergsport. Das Stichwort dazu lautet Eigenverantwortung. Und im Zweifelsfall eine Extraportion Vorsicht.
Eine gute Lektüre und viele erlebnisreiche, sorgenfreie Wanderungen wünschen Marco Volken, Anita Rossel, Rolf Sägesser, Werner Stucki und Andreas Mathyer
Für Rückmeldungen: sac@weberverlag.ch
Folgende Organisationen haben das Buchprojekt mit einem finanziellen Beitrag sowie mit ihren fachspezifischen Kenntnissen unterstützt:
Die BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung macht Menschen sicher. Als Kompetenzzentrum forscht und berät sie, damit in der Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese Aufgaben hat die BFU seit 1938 einen öffentlichen Auftrag.
Der Verband Schweizer Wanderwege setzt sich für attraktive, sichere und einheitlich signalisierte Wanderwege ein. Zu seinen Arbeiten gehören die Planung und die Qualitätssicherung der Wanderweginfrastruktur im Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA.

Die Naturfreunde Schweiz pflegen den sanften, nicht gewinnorientierten Tourismus und setzen sich für die Gemeinschaft und den Schutz der Natur ein. Der Verband bietet ein vielfältiges Angebot an Outdooraktivitäten. Das gemeinsame Naturerlebnis steht dabei im Mittelpunkt.
Der Schweizer Bergführerverband SBV vertritt die Interessen der Bergführer/innen, Wanderleiter/innen, Kletterlehrer/innen und Seilzugangsspezialist/innen und organisiert deren Aus- und Fortbildung.
Folgende Organisationen haben das Buchprojekt mit ihren fachspezifischen Kenntnissen unterstützt:
Die Alpine Rettung Schweiz ARS ist eine selbstständige, gemeinnützige Stiftung, getragen durch die Rega und den Schweizer AlpenClub SAC. In den 84 Rettungsstationen sind über 3000 ehrenamtliche Retterinnen und Retter organisiert.
Erwachsenensport Schweiz esa ist ein auf den Breiten- und Freizeitsport ausgerichtetes Sportförderprogramm des Bundes und ist zusammen mit Partnerorganisationen verantwortlich für die Qualitätsstandards bei der Ausbildung von Leiterinnen und Leitern.
Soundingboard
Das Soundingboard mit Vertreterinnen und Vertretern der Fachorganisationen hat das Autorenteam beraten und mit vielen Inputs unterstützt: Monique Walter (BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung), Sarina Buser und Harry Sonderegger (Bundesamt für Sport BASPO), Markus Ruff (Schweizer Wanderwege), Pierre Mathey (Schweizer Bergführerverband SBV), Theo Maurer (Alpine Rettung Schweiz ARS), Marco Bomio (Bergführer).
Für die inhaltlichen Beiträge danken wir:
Dr. Rahel Müller, Rechtsanwältin bei brumann müller recht, www.alpinrecht-schweiz.ch
Dr. med. Urs Hefti, Facharzt für Orthopädie/Traumatologie, Chirurg und Sportmediziner, Chefarzt der Swiss Sportclinic Bern
Urs Hirsiger, BSc, Ernährungsberater SVDE mit eigener Praxis
Martin Künzle, Fachmitarbeiter Bergsport und Umwelt beim SAC (Autor der Kapitel 1.2 und 1.4)
Tim Marklowski, Bergführer mit eidgenössischem Fachausweis (Autor des Kapitels 9.7)
Für die Mitarbeit bedanken wir uns ausdrücklich auch bei: Anita Brechbühl, Flavia Bürgi, Paul Campiche, Pietro Cattaneo, Olivia Grimm, Giovanni Kappenberger, Pascale Haegeler, Bruno Hasler, Alessandra Manni und Mauro Lüthy, Ueli Mosimann, Michael Roschi, Sarah Umbricht.

Berge gehören zum Bergwandern. Je nach persönlicher Neigung nehmen wir sie unterschiedlich wahr: als prächtige Kulissen, als liebgewonnene Erholungslandschaften, als vielfältige Natur, als herausfordernde Sportplätze, als gefährliche Orte, als traute Umgebungen. Berge sind aber auch wichtige und empfindliche Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen. Dass wir beim Wandern Rücksicht auf die Natur und deren Bewohner nehmen, versteht sich von selbst.
Mit einer durchschnittlichen Höhe von gut 1300 Meter über Meer ist die Schweiz nach Andorra das «höchste» Land Europas. In seinen Grundzügen geht das heutige Relief der Schweiz auf grossräumige Prozesse zurück, die vor rund 100 Millionen Jahren einsetzten. Die Kollision zwischen eurasischer und afrikanischer Platte war dabei die treibende Kraft und drückte das vorhandene Gestein in die Höhe – allerdings nicht gleichmässig, und nicht überall. Die Erosion nagte dann an diesen Bergen, und die Flüsse beförderten das abgetragene Material in die vorgelagerten Ebenen. So entstand, sehr stark vereinfacht, die vielfältige Topographie der Alpen und Voralpen, des Jura und des Mittellands. Alpen Mittelland
Anteil
Höchster Gipfel Dufourspitze Napf Mont Tendre
Hauptgesteine Kalk, Gneis, Granit
Molasse (u. a. Nagelfluh, Sandstein) Kalk
Die Alpen gehören, was die Geologie angeht, zu den komplexesten Gebirgen der Welt. Sie sind sozusagen in die Tiefe gebaut, mit Hauptbauelementen («Decken»), die mehrfach übereinandergestapelt und gefaltet wurden. Das erklärt auch die grosse Vielfalt an Gesteinen, die wir heute an der Oberfläche bestaunen können. Zudem weisen die Alpen einen wesentlich grösseren Höhenbereich auf als etwa der Jura. Hier finden sich unter anderem enge Täler, tiefe Schluchten, hohe Berge, Gletscher, mächtige Fels- und Eiswände und Lawinenhänge, aber auch viel Weidegelände, ungenutzter Wald und tiefe Alpenrandseen. Rund 36 Prozent der Fläche bestehen aus unproduktivem Land (d. h. Gewässer, unproduktive Vegetation, Geröll, Fels, Firn und Gletscher).
Das Mittelland ist ein langes, vom Jura und von den Alpen eingefasstes Becken. Es füllte sich während der Entstehung der Alpen mit Abtragungsmaterial, also mit Schutt, das von Flüssen abgelagert wurde. Aus diesem Schuttbecken schufen dann weitere Flüsse und eiszeitliche Gletscher jenes Mittelland, das wir heute kennen. Es ist eher hügelig als flach. Dass satte 10 Prozent der Fläche als unproduktiv gelten, liegt vor allem an den Seen.
Der Jura besteht weitgehend aus Sedimentgesteinen, die sich vor über 100 Millionen Jahren ablagerten. Als Gebirge ist er allerdings wesentlich jünger: Das heutige Massiv entstand durch Verfaltungen und Überschiebungen erst während der letzten Phase der Alpenbildung, sein Alter liegt irgendwo zwischen 2 und 10 Millionen Jahren. Wie ein lang gezogener Bogen folgt der Jura mehr oder weniger der West- und Nordwestgrenze der Schweiz und fächert sich teilweise in parallel verlaufende Bergketten auf. Als Grundgerüst dient Kalkgestein, das oft zum Vorschein kommt – in Form von hellen Graten und kleinen bis mittelgrossen Felswänden. Dazwischen breiten sich Hochplateaus und eher sanfte Täler aus. Unproduktive Flächen machen bloss 1 Prozent des Jura aus.
Wenn wir die Grossregionen nach ihrer Gebirgigkeit unterteilen, sieht der jeweilige Flächenanteil etwa wie folgt aus:
Jura
Mittelland Alpen
Flachland, Hochebenen
Hügel Berge (bis Waldgrenze) Hohe Berge
Quelle: Landschaftstypologie Schweiz, ARE / BAFU / BFS, 2011 (vereinfacht).
Das Aussehen einer Landschaft wird nicht nur vom geologischen Aufbau bestimmt. Denn an der Oberfläche wirken weiterhin viele geomorphologische Prozesse, die das Relief schrittweise verändern (und die Berge nach und nach einebnen). Viele dieser Vorgänge können wir von blossem Auge an den Landschaftsformen erkennen:
Kraft
Fliessendes Wasser
Schwerkraft
Gletscher
Frost
Chemische Verwitterung
Beispiele für typische Landschaftsformen
V-Täler, Sandbänke, Flussdeltas, Schwemmebenen
Bergsturzgebiete
U-Täler, Moränen, Findlinge, viele Seen
Schutthalden
Karstlandschaften, Höhlen, Dolinen
Einige Beispiele gefällig?
Ein U-Tal (Trogtal) erkennen wir an der ebenen Talsohle und den steilen, oft felsigen Flanken. Hier war ein riesiger Gletscher am Werk und hat das Tal aus dem Gestein herausgefräst. Die Seitentäler sind oft Hängetäler: Sie münden nicht eben ins Haupttal ein, sondern enden weiter oben mit einer abrupten Steilstufe (und oft einem Wasserfall), weil sich die kleineren Seitengletscher nicht so tief einfressen konnten.

Das V-Tal (Kerbtal) entsteht hingegen durch die Erosionskraft eines Flusses, der sich immer tiefer ins Gelände gräbt. Diese Talform kommt vor allem dort vor, wo das Gefälle ausreichend gross ist, um eine starke Flussströmung und kräftige Hochwasser zu erzeugen. Deshalb sind enge Kerbtäler typisch für alpine und voralpine Regionen.

Eine Schlucht ist ein Spezialfall des V-Tals. Das Wasser frisst sich ebenfalls immer tiefer in den Fels ein, lässt die Seitenwände allerdings nahezu senkrecht stehen (was stabiles Gestein bedingt). Wenn sie nicht durch aufwändige Bauten touristisch erschlossen sind, gehören Schluchten zu den unwegsamsten Orten im Alpenraum und lassen sich oft nur mit Canyoningtechnik besuchen.

Taminaschlucht (SG)
Dass Runsen ihre Entstehung dem Wasser verdanken, ist meist sehr deutlich zu erkennen. Regen und Schmelzwasser bilden kleine Rinnsale, manchmal auch Bäche, die das weiche Gestein zunehmend einritzen. Die Furchen dienen als Abflussrinnen, während die Rippen von der Erosion verschont bleiben und der Vegetation als relativ sichere Standorte zur Verfügung stehen.

Mont Gond (VS)
Schwemmebenen sind Landschaften mit besonders hoher Dynamik. Wir treffen sie dort an, wo ein Bach oder Fluss – meist nach einer steileren Strecke – flaches Gelände erreicht, im Gebirge also eine Hochebene. Die Fliessgeschwindigkeit nimmt markant ab, und das Wasser kann die mitgeführten Stoffe wie Gesteinsmehl ablagern. Dadurch wird die Fläche noch mehr eingeebnet. Mehrere Schwemmebenen wurden ins Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen.

Bächlital (BE)