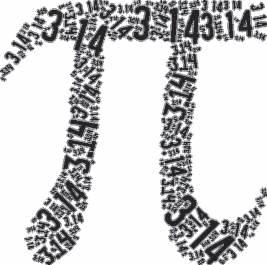5 minute read
Weg, nur weg
from Laser 2020
by TFO Bruneck
von Alexander Nitz
Der Autor des Buches „Weg, nur Weg“ ist Alexander Nitz. Er ist Gründungsmitglied des Hauses der Solidarität in Brixen und seit vielen Jahren in der Hausleitung tätig. Das Buch „Weg, nur weg“ ist in 15 Geschichten über Migration aufgeteilt, die alle von Alexander Nitz verfasst wurden und deren Handlungsorte immer real sind. Alle Geschichten haben als Ausgangspunkt einen Gast aus dem Haus der Solidarität. Die Biographien wurden zum Schutz der Protagonisten etwas abgeändert. Am 1. Oktober 2019 stellte Alexander Nitz sein neues Buch in der TFO Bruneck vor. An der Lesung nahmen insgesamt 60 Schüler*innen teil. Nitz las die Geschichte „Kleine Zigeunerziege“ vor, die von einer bettelnden Rumänin handelt. Die zentrale Frage der Erzählung ist: Gibt es die Bettlermafia wirklich? Nitz lässt Modica, die junge rumänische Protagonistin seiner Erzählung, auf die Frage antworten: „Die Bettlermafia? Was soll das sein? Ach, ich habe diese Schlagworte so satt! Du glaubst also auch an all die Gerüchte? An die organisierte Bettlerkriminalität? Nur weil ich gemeinsam mit anderen Frauche, wenn ich Glück habe. Boss mit Goldketten und Mercedes? Wo soll der bitte sein? (…) Vielleicht gibt es Bettlerbanden und Bettlerorganisationen. Ich weiß es nicht. Aber alle Bettler, die ich kenne, gehören mit Sicherheit nicht dazu.“ Betteln war früher wesentlich weiter
Advertisement
„Gibt es die Bettlermafia wirklich?“
en von Rumänien hierher fahre und arbeite? Verschwörung? Weil wir uns absprechen, wer wo bettelt, damit wir nicht wie Pilze nebeneinander sitzen? Von langer Hand geplant? Weil wir mehrere Monate arbeiten und dann wieder verschwinden? Reich werden? Weil ich 500 Euro in drei Monaten maverbreitet als heute. Alle Religionen akzeptieren es, aber viele Gemeinden sprechen heutzutage Bettelverbote aus. Die meisten Bettler und Bettlerinnen stammen aus Rumänien, Bulgarien oder auch aus Nigeria. Sie betteln, um zu überleben. Der Mythos, dass es eine Bettelmafia gibt, sei nur erfunden, so Nitz.
Wir würden jenen das Buch weiterempfehlen, die gerne mehr über das Leben von Migranten*innen wissen und verstehen wollen. Wir finden, dieses Buch beantwortet viele Fragen, und man kann sich dadurch besser in die Lage der Migranten*innen hineinversetzen.
Wer macht das Wetter?

Jede Person, die in letzter Zeit eine Zeitung durchgeblättert hat, den Fernseher angemacht hat oder einfach nur im Internet surfte, kam an einem Thema ganz sicher nicht vorbei: der Umweltverschmutzung und dem damit verbundenen Klimawandel. Verschiedene
Studien belegen, dass 10% der Weltbevölkerung für 50% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Ein armer Bauer in Afrika fährt nun mal nicht mit einem tonnenschweren SUV zur Arbeit, fliegt nicht mit einem Kerosin betriebenen Flugzeug in den
Urlaub und befriedigt seinen Konsumhunger nicht mit lauter Krempel, den er online aus China importiert. Ganz einfach aus dem Grund, weil er es sich nicht leisten kann. Für den Durchschnittsbürger in einem Industrieland sind die eben genannten
Dinge hingegen zur Normalität geworden. Es ist offenbar ein Privileg wohlhabender Länder, die
Umwelt zu verpesten. Ökologisch zu handeln ist demzufolge ein Zeichen von Schwäche. Ist
Umweltschutz also eine Frage von arm oder reich, Macht oder Ohnmacht? Einen Beleg dafür liefert der 2015 ans Licht gekommene Diesel-Skandal. Der Autobauer VW lancierte scheinbar umweltfreundliche Dieselautos auf den Markt, die mit einer betrügerischen Software ausgestattet waren. Diese Technologie erkennt, ob sich das Auto auf einem Prüfstand zur Abgaskontrolle befindet oder nicht und schaltet nur in diesem Fall Filter ein, um die Stickoxidwerte im niedrigen Normbereich zu halten. Auch wenn der VW-Konzern zu hohen Strafzahlungen verurteilt wurde und es kurze Zeit Turbulenzen am Aktienmarkt gab, hat sich das Unternehmen erstaunlich schnell erholt und fährt wieder hohe Gewinne ein. Da stellt sich die Frage: Wie weit reicht die Macht der Konzerne? Ist eine hohe Wirtschaftsleistung eine Rechtfertigung für die Zerstörung der Umwelt? Die Politik der reichen Länder mahnt ständig ein höheres Wirtschaftswachstum an. Dies sei nötig, um Arbeitsplätze zu sichern
und das Sozialsystem aufrecht zu erhalten. Sehr gerne werden Argumente gegen eine verantwortungsbewusste Umweltpolitik aus dem Pool sozialer Bedürftigkeit gefischt. Ist es ethisch vertretbar, armen Leuten das Billigfliegen oder das Fahren einer günstigen Dreckschleuder zu verbieten? Wer nicht genug Geld hat, wird wohl beim Discounter und nicht im Bioladen einkaufen dürfen? Und soll der Kohle-Industrie ein Riegel vorgeschoben werden, wenn dabei viele Arbeitsplätze abgebaut werden? Solche Gedankenspiele betreiben Wirtschaftsminister gerne, um klimaschädliche Maßnahmen zu rechtfertigen oder auch nur untätig zu sein. Ökologisch zu handeln scheint ein Zeichen von Schwäche zu sein. Wer ein altes Handy nutzt, ist nicht up to date. Wer die Kleidung vom Vorjahr trägt, ist hoffnungslos altmodisch. Wer sich keinen PS -starken Boliden leistet, fällt aus dem Statusrahmen. Wer lieber spartanisch als konsumgesteuert lebt, gerät leicht in den Ruf, ein grüner Freak zu sein. Auf solche weit verbreiteten Einstellungen hin hat die junge Schwedin Greta Thunberg mit ihren Fridays-for-future-Aktionen ein Zeichen der Stärke gesetzt und einen Sog der Begeisterung und des Engagements - nicht nur unter Jugendlichen - ausgelöst. Ihre starken Auftritte haben der Umweltbewegung vieles von ihrem „schwachen“ Image genommen und ihr eine viel größere Sichtbarkeit verliehen. Deutschland hat mit dem im Herbst verabschiedeten Klimapaket einen ersten Schritt gesetzt, womit Bahnfahren billiger und Binnenflüge teurer werden. Von Kostenwahrheit kann nach wie vor keine Rede sein. Wenn die EU Plastikstrohhalme verbietet und Italien im Juli eine Plastiksteuer einführen will, dann kann das erst der Anfang einer nachhaltigen Umweltpolitik sein. Greta Thunberg hat auf der letzten Klimakonferenz in Madrid den Ausspruch getan: „ I want you to panic“. Damit hat sie ein Machtwort gesprochen gegen die Scheinmoral der Regierenden. Wer die Macht hat, muss mehr unternehmen für Klima und Umwelt, als langfristige Klimaziele zu vereinbaren. Die Fridays-for-future- Generation appelliert für schnelles und tatkräftiges Handeln und kämpft gegen die landläufige Meinung an: „Nur weil ich mich ändere, ändert sich die Welt nicht!“ Konsumenten können sehr wohl eigenverantwortlich handeln und beispielsweise Plastikverpackungen vermeiden, wo es geht. Damit können Produzenten zum Umdenken gezwungen werden. McDonalds hat Styroporverpackungen gegen umweltfreundliche Kartonverpackungen ausgetauscht, nachdem sich Kunden abgewandt haben. Jeder Einzelne kann sein Konsumverhalten hinterfragen. Im Apfelland Südtirol kann man durchaus das regionale Angebot nutzen und weitgehend auf exotische Früchte verzichten. Und man kann jener Partei die Stimme geben, die sich Umweltschutz ins Programm schreibt. In Österreich haben es die Grünen erstmalig in die Bundesregierung geschafft. Wenn sich viele zusammentun, um ein Ziel zu erreichen, verkehrt sich die Schwäche des Einzelnen in die Stärke einer großen Gruppe. Nur so kann man der Ohnmacht gegenüber Wirtschaftslobbys wirkungsvoll begegnen, damit sich künftig ändert, wer das sprichwörtliche Wetter macht.