
6 minute read
Trends bei Woods und Hybrids
Von Holz zu Metall: diese einschneidende Veränderung an der Materialfront hat besonders beim Driver zu markanten Veränderungen geführt, während die Fairwayhölzer ihrer Zweckbestimmung gemäss weniger Potenzial dazu bieten. Hybrid-Schläger sind bereits seit langer Zeit bekannt. Das immer verbreiteter anzutreffende Semi Rough und Marketinganstrengungen der Hersteller haben die Akzeptanz dieser leicht zu schlagenden Nothelfer gefördert.
Eigentlich nicht viel grundsätzlich Neues unter der Sonne; so lautete das Fazit des letzten Beitrags mit Alain Pfister (Golf Suisse 2/09), der die Materialentwicklung bei den Eisen zum Thema hatte. Die Physik des Golf kennt längst keine Geheimnisse mehr. Was jedoch die Entwicklungen fördert oder überhaupt erst möglich macht, sind neue Materialien und Techniken der Verarbeitung, die jedoch nicht spezifisch für den Golfbereich entwickelt wurden, sondern von den Schlägerherstellern für ihre Zwecke adaptiert werden. Dass nicht nur die Bestimmungen der Regelbehörden den Verbesserungen Grenzen setzen, sondern auch die Physik, zeigt sich bei einem Vergleich zwischen Fairwayholz und Driver. Während offensichtlich bei den Drivern vor allem bezüglich der Grösse der Schlägerköpfe eine revolutionäre Entwicklung stattgefunden hat, sind die Unterschiede bei den Fairwayhölzern viel weniger augenfällig. Der Grund liegt darin, dass, je grösser der Clubhead ist, es umso schwieriger wird, den Ball vom Fairway in die Luft zu bringen.
Advertisement
Ein Holz aus Holz
Während eines Clubfitting-Kurses in den USA hat Alain Pfister noch im Jahre 1996 eigenhändig ein Holz aus einem Persimmon-Rohling gebaut. Nach der Vorgabe einer Lehre musste die Form von Hand geschliffen werden. Der Schlägerkopf verfügt über Bulge (Sidespin) und Roll (Backspin), der Plastikbezug als Trefffläche wurde ebenfalls in Handarbeit gefeilt und passgenau in die Schlagfläche eingesetzt. Ebenso wurden die Rillen von Hand eingesägt. Ein Stahlschutz an der Sohle, der auch als Gewicht diente, gehörte ebenso dazu wie eine zusätzliche Gewichtsschraube auf der Rückseite zur Schlagfläche. In einem verschliessbaren Loch unter der Sohlenplatte konnte man je nach Bedarf Blei als zusätzliches Gewicht einsetzen. Wie das Beispiel zeigt, war bereits beim «Holz aus Holz» das Wissen über die Funktionsweise eines Schlägerkopfes vorhanden. Was im Vergleich zum heutigen Stand den Unterschied ausmachte, war das Material und die Arbeitstechnik. Diese Veränderungen bewirkten, dass das Handwerk der Schlägerherstellung weit gehend durch industrielle Massenproduktion ersetzt worden ist. Die Vorstellung, dass heutzutage Hölzer von Hand nicht nur in ihre Form gebracht, sondern weiteren Arbeitsschritten unterzogen würden, ist im Zeitalter der Robotertechnik kaum nachvollziehbar.

Das Gewicht des Hartholzes bestimmte die Grösse der Schlägerköpfe. Dem reinen Persimmon-Block wurde im Laufe der Entwickling im Bereich des Sweetspots als Schutz ein auswechselbares Kunststoffteil in die Schlagfläche eingefügt. Am Ende der Entwicklung bis zum heutigen Tag steht der viel voluminösere Driver aus Titan, der dadurch träger und damit viel verzeihender wird (Beispiel links). Erst modernste Technologie machte es möglich, grossvolumige Hölzer aus stabilen und gleichzeitig leichten Komponenten um einem hohlen Kern herum zu bauen (Abbildung unten).
Metall-Revolution


Die Grösse eines Schlägerkopfes aus Persimmon, eine schwere, harte Ebenholzart, wird durch das Gewicht des Materials limitiert. Bis heute liegt das Gewicht der Schlägerköpfe konstant zwischen 197 bis 205 Gramm. Zu schwere Clubs sind nicht spielbar, daher konnten Persimmon-Driver nicht einfach grösser gemacht werden – sie hatten etwa 150 Kubikzentimeter Volumen. Das bedeutet einen sehr kleinen Sweetspotbereich: weite Schläge sind nur mit ganz präzisen Treffern möglich. Was für Puristen einer Gotteslästerung gleichkam, war die Errungenschaft, Hölzer aus Metall zu fertigen. Im Gegensatz zum Persimmonkopf, der aus einem Block besteht, weisen die neuen Konstruktionen einen Hohlkörper auf. Nur so wurde es möglich, Metall als Material zu verwenden.
Bei der ersten Big Bertha – die aus heutiger Sicht gar nicht mehr so big erschient – wurde ein leichter Stahl verwendet; später erwies sich Titanium, ein sehr leichtes und dennoch stabiles Metall, als besonders gut geeignet. Die technologischen Fortschritte in der Metallurgie und der Fertigungstechnologie, die auch erst die Massenproduktion möglich machten, liessen es zu, bei gleich bleibendem Gewicht immer grössere Schlägerköpfe zu konstruieren. Diesem steten Wachstum wurde schliesslich reglementarisch ein Riegel geschoben – heute liegt die Limite auf 460 Kubikzentimeter (Toleranz +/-10 cm3). Das bedeutet, dass die heutigen Driver-Köpfe mehr als dreimal so gross sind wie diejenigen aus Persimmon, und mehr als doppelt so viel Volumen aufweisen wie die ersten Exemplare aus Stahl gegen Ende der 80-er Jahre.
Alain Pfister, Pro in Interlaken, Clubmaker und Clubfitter, eignete sich das Metier an den renommiertesten Clubfitting-Schulen in England und den USA an und besucht weiterhin regelmässig Fortbildungskurse. Unter dem Firmennamen Par Golf AG betreibt er zusammen mit seiner Frau Karin in Unterseen, nahe des Golfplatzes von Interlaken, einen Golfshop mit angeschlossener Werkstatt. Neben zahlreichen Spitzengolfern aus dem Pround Amateurlager profitieren auch Clubspieler von den Kenntnissen und Erfahrungen des wohl am besten ausgebildeten Clubfitters in der Schweiz.

Grössere Schlägerköpfe bedeuten ein höheres Trägheitsmoment (Moment of Inertia), das heisst, der Schläger verzeiht mehr, denn bei Off-Center-Treffern entsteht weniger Seitwärtsdrall, mit der Folge, dass trotz des Fehlers die Bälle weiter und gerader fliegen. Es ist also nicht das Mehr an Länge, sondern die viel höhere Verzeih-Rate, welche die grossen Schlägerköpfe auszeichnet. Übrigens tragen die längeren Schäfte an den heutigen Drivern dazu bei, dass mit ihnen mehr Länge erreicht wird. War früher 43 Inch die Norm, so werden heute Driver mit 46 Inch langen Schäften angeboten. Als Golflehrer rät Alain Pfister dem Clubspieler von einem zu langen Schaft ab. Nur wirklich gute Golfer sind in der Lage, einen 46er-Schaft zu beherrschen. In der Regel sind diese Spieler jedoch mit einem kürzeren Schaft sogar länger. Durchschnittliche Golfer werden durch den langen Schaft verunsichert, verlieren an Tempo und «streuen» vermehrt.
Die passenden Hölzer finden
Das Angebot auf dem Markt ist gross, und dadurch wächst die Chance, das richtige Modell zu verpassen. Es gibt Fitting Center oder auch Demo-Tage, wo sich die Gelegenheit eröffnet, selber verschiedene Driver zu testen. Damit ein solcher Selbsttest nicht in eine Lotterie ausartet, empfiehlt Alain Pfister, mindestens zehn bis fünfzehn Schläge pro Testgerät auszuführen.
Was das individuelle Fitting anbelangt, so bieten die heutigen Fittingschraubsysteme grosse Vorteile; lassen sich doch so auf einfache Weise verschiedenste Schaft- und Schlägerkopfvarianten ausprobieren, wovon besonders auch die Linkshänder profitieren. Zudem kann der Schlägerkopf mit einem Handgriff auf open, square oder closed eingestellt werden.
Der Driver ist das längste und leichteste Holz im Bag, je kürzer die nachfolgenden, umso schwerer sollten diese sein. Dieses Grundgesetz fusst auf der Regel, dass beim Schwung mit jedem Holz die gleiche Fliehkraft erzeugt werden sollte. Ist das nicht der Fall, so wird der Spieler mit für ihn meist unerklärlichen Rhythmusproblemen konfrontiert, und was die Härte der Schäfte betrifft, so sind die Bezeichnungen der Hersteller oft irreführend. Besser als Gewicht des Schafts und Flex (regular, stiff etc). anzugeben, wäre es, die Frequency zu nennen. Beim Fitting wird die Schafthärte immer mit Hilfe der Messung der Frequency (Frequenz, mit der ein am Griffende eingespannter Schläger hin und her schwingt) ermittelt. Hölzer werden in verschiedenen Lofts angeboten, die Schaftlängen varieren im Gegensatz zu früher von einer Nummer zur anderen nicht mehr um einen Inch, sondern nur noch um einen halben Inch. Das hat zur Folge, dass sich die Längen der Schläge verschiedener Modelle angleichen können. Statt sich auf die Bezeichnungen Holz 3, 5 oder 7 zu verlassen, wäre es empfehlenswert, die effektiven Längen im Selbsttest zu ermitteln und die Schläger danach einzuteilen.
Für einen ab der Stange gekauften Driver kann auch ein Nachfitting lohnend sein, beispielsweise zur Kontrolle der Balance, der Schafthärte oder des Gewichts. Der Clubfitter ist auch in der Lage, einen Fehleinkauf zu korrigieren. Und wem gar der Ton seiner Geheimwaffe nicht behagt –es soll Driver geben, die diesbezüglich wirklich nerven –kann diese Beleidigung für das Ohr vom Clubfitter abstellen lassen: Zwei Gramm Head Tacking Adhesive in den Schlägerkopf träufeln, erwärmen, verteilen – und weg ist das störende Geräusch.
Hybrids
Die so genannten «Hybrids» – eine Verbindung von Eisen und Hölzern – sind leichter zu schlagen als Hölzer oder lange Eisen, weil sie einerseits kürzer sind als Hölzer und der Schlägerkopf (mit Bulge und Roll) mit mehr Gewicht in der Sohle versehen ist als bei den Eisen. Mit dem kürzeren Schaft vermindert sich die Streuung, während der tiefe Schwerpunkt einen hohen Ballflug ermöglicht, was auf den eigentlichen Zweck des Schlägers hindeutet, nämlich Schläge aus dem Semi-Rough. Genau genommen ist ein Hybrid demnach eigentlich kein Holzersatz. Oft sieht man Spieler mit drei bis vier Hybrid-Schlägern im Bag. Diese liegen meistens viel zu nahe beieinander, das heisst alle ermöglichen etwa dieselbe Länge. Vor lauter Schlägern merkt der Spieler gar nicht, wo sich eigentlich die Lücke im Set befindet. Hybrid-Schläger sollten, um Schwierigkeiten mit dem Schwungrhythmus vorzubeugen, betreffend ihrem Gewicht in das Set passen. Hybride sind schon lange auf dem Markt, nur haben sie sich nicht durchsetzen können. Seitdem Semi-Rough vermehrt auf den Plätzen zu finden ist, sind die praktischen Hybridschläger richtig bekannt geworden und werden zudem vom Marketing entsprechend in den Blickpunkt gerückt. Troubleshooter sind nämlich nicht nur diese Clubs (die man ja auch «Rescue» nennt), sondern auch die Hölzer 5, 7, 9 oder gar 11. Diese sind jedoch für Shoppers nicht besonders attraktiv. Denn, wie schon erwähnt, ihre Schlägerköpfe lassen sich, was deren Grösse betrifft, kaum verändern. Denn ein einfacher Test zeigt sofort, um was es geht: je grösser der Clubhead, desto schwieriger wird es, einen Ball vom Fairway in die Luft zu bringen – mit dem relativ kleinvolumigen Holz 5 geht das dagegen bestens.
■ Martin Schnöller
Auf zum Abschlag.



Jeder Schlag zählt
Jetzt anmelden! Unter www.golffriends.com/cornercard
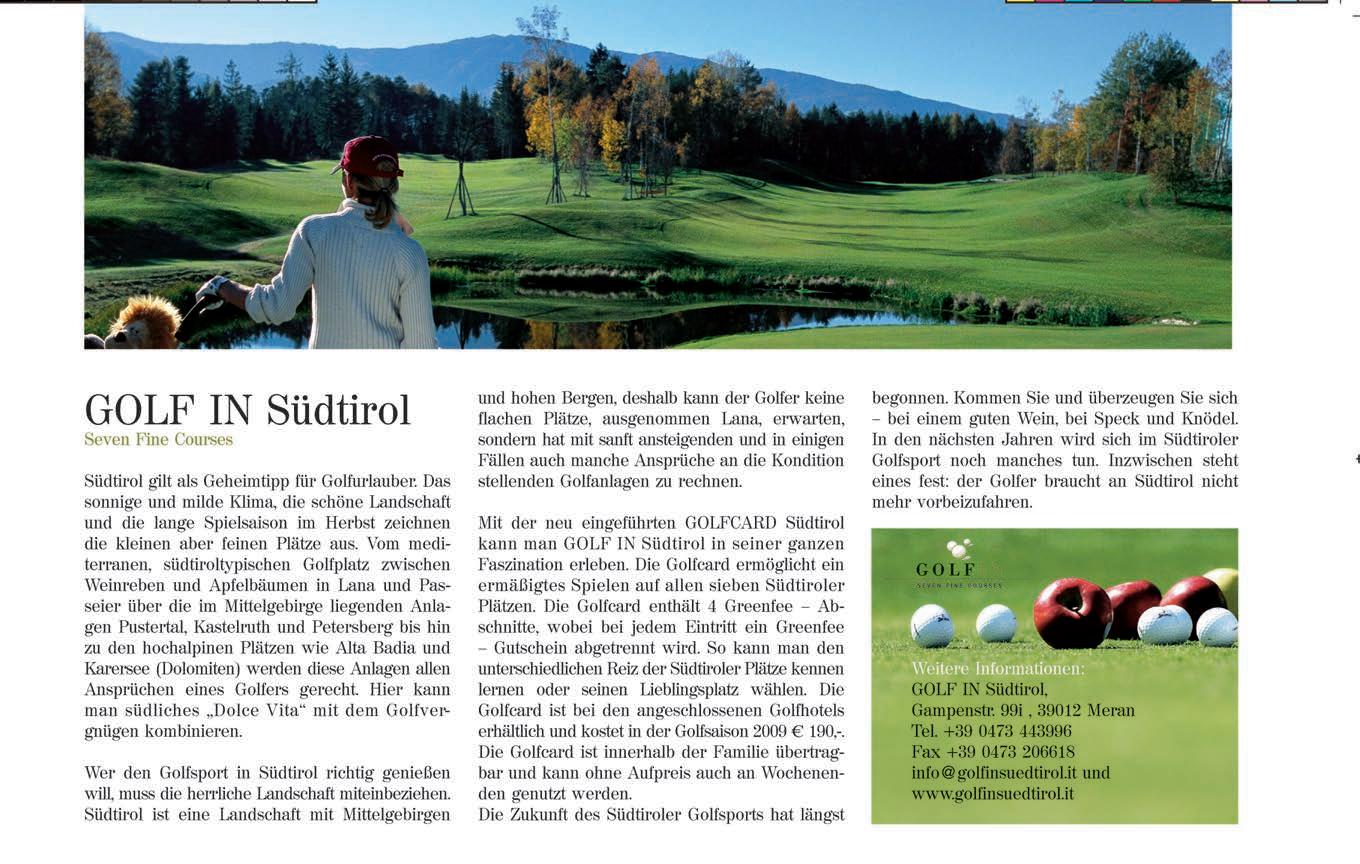



Co-Sponsoren









