




Der Audi SQ6 Sportback e-tron mit elektrischem quattro Allradantrieb

Als Swiss-Ski Mitglied profitieren Sie bei Audi von Sonderkonditionen auf zahlreichen Modellen. Jetzt entdecken:
Worauf Träume wirklich stehen
Im Sport wird viel von Träumen gesprochen. Vom grossen Traum. Vom Ziel, das alles überstrahlt. WM-Titel, Gesamtweltcupsiege, Olympia-Gold – wer das nicht kennt, hat vielleicht den Kern des Leistungssports verpasst.
Doch gehen wir tiefer. Zurück zu unserem inneren Kind, zu den «Meitschis» und «Buebe», die wir einmal waren. Dort finden wir Wünsche, die leiser sind, aber genauso hartnäckig. Langläuferin Anja Weber erzählt im Interview (Seite 57), dass sie gerne einen Backflip aus dem Stand können würde. Einfach so.
Vielleicht, weil es cool aussieht. Weil es Mut braucht. Weil es dieses besondere Gefühl gibt, wenn man den Kopf nach hinten kippt und die Welt für einen Moment kopfsteht – und man merkt: Ich habe mich getraut. Ich habe es geschafft. Ich stehe.
Vielleicht auch weil ein Backflip beeindrucken kann. Weil sie möglicherweise die einzige Langläuferin wäre, die das überhaupt kann – aus dem Stand - und sich so von anderen abheben könnte. Nicht über Laufzeiten, sondern über etwas, das keiner erwartet. Wie eine kleine olympische Goldmedaille, nur eben auf der Matte.
Andreas «Sonny» Schönbächler –Aerials-Legende – war als Kind fasziniert von Saltos, erzählt er in dieser Ausgabe. Er probierte sie im Garten, übte unermüdlich, und Jahre später führten sie ihn bis zum «Full-Doublefull-Full» – Olympiasieg. Bisher das einzige Schweizer Gold in dieser Disziplin.
Vielleicht beginnt alles mit einem Backflip.
Am «Girls Tramp Day», einem Tag in der Trampolinhalle nur für Mädchen und Frauen, habe ich selbst einen Backflip gemacht. Die Landung war schräg, etwas wacklig – kein Bilderbuchsprung, aber meiner. Und dann – Applaus. Echt, roh, von Herzen. Er traf mich so sehr, dass mir die Tränen kamen. In diesem Moment begriff ich: Applaus ist mehr als ein
Geräusch. Er ist das Zeichen, dass wir gesehen werden. Dass wir dazugehören.
Später an diesem Tag sass ich mit den Snowboard-Profis Andrina Salis und Berenice Wicki im Interview. Ein Mädchen kam, holte sich Autogramme – und streckte auch mir den Stift hin. Ich schmunzelte: «Ich bin doch kein Profi.» Sie schaute mich an und sagte: «Ist mir egal. Ich fand’s heute cool mit dir.»
Ein Satz, der bleibt.
Sie hatte mich «flippen» sehen, meinen Backflip stehen – und das reichte ihr.
Darum geht es. Wir alle sind Profis, so plump das klingt. Nicht, weil wir Medaillen sammeln. Sondern weil wir springen, ohne zu wissen, wie wir landen – ob gerade oder schräg. Weil wir uns auffangen, wenn es wackelt – manchmal reicht dafür schon ein Applaus. Und weil wahre Grösse nicht in Gold glänzt, sondern im Mut, überhaupt zu versuchen.
Dieser Winter ist ein Olympia-Winter. Für viele Athletinnen und Athleten ist es der Traum, der alles andere überstrahlt. Nicht alle Namen werden auf den Selektionslisten stehen. Haben sie deswegen weniger geschafft? Ich glaube nicht. Sie haben sich denselben Fragen gestellt, denselben Mut aufgebracht, denselben Schmerz gespürt.
Olympia ist der grösste Traum, den es im Sport zu träumen gibt. Aber Applaus, Zuspruch, Gemeinschaft – das ist das Fundament jedes grossen Traums.
In dieser Ausgabe von «Snowactive» erzählen wir Geschichten von Mut und Glanz, von Landungen, die mal gerade, mal schräg sind – und von dem Applaus, der sie alle verbindet.
Lasst uns also träumen. Von Gold. Von Backflips. Und von dem Moment, in dem wir füreinander klatschen.
Viel Freude beim Lesen – und beim «Flippen», sei es auf der Matte, auf der Piste oder einfach im Kopf.
Lia Näpflin, Chefredaktorin
Das offizielle Verbandsmagazin von Swiss-Ski, erscheint viermal pro Jahr
Ausgabe vom Oktober 2025, 60. Jahrgang
Herausgeber
Swiss-Ski
Home of Snowsports, Arastrasse 6, 3048 Worblaufen
T +41 31 950 61 11, snowactive@swiss-ski.ch
Redaktion
Lia Näpflin (lia.naepflin@swiss-ski.ch)
Roman Eberle (roman.eberle@swiss-ski.ch)
Freie Mitarbeit
Peter Birrer, Benjamin Steffen, Monique Misteli, Stephan Bögli, Philipp Schmidli, Anja Erni, Ruedi Flück
Art Direction/Layout
LS Creative GmbH
Leander Strupler, Sandro Reist
Inserate/Advertorials
Swiss-Ski
Matthias Rietschin (matthias.rietschin@swiss-ski.ch)
Thomas Huser (thomas.huser@swiss-ski.ch)
Abonnemente
Jahresabo CHF 49.-, 4 Ausgaben (inkl. MWST)
Druck
AVD Goldach AG
Übersetzungen
Syntax Übersetzungen AG
Copyright
Swiss-Ski
Nachdruck nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Redaktion gestattet.

6 Simon Ammann

26 Lenz Hächler




Noch einmal nimmt Simon Ammann Anlauf –getragen von einer Karriere, die seit fast drei Jahrzehnten vom Wind erzählt.
Bilder: Keystone-SDA



Simon Ammann startet zum 29. Mal in eine Weltcup-Saison und peilt die achte Olympia-Teilnahme an. Was treibt ihn an? Die Geschichte eines Phänomens.
Simon Ammann ist schon oft gefragt worden, wann er zurücktrete. Im Gespräch Anfang September 2025 lautet die Frage nach einer Stunde: «Haben Sie eigentlich einmal versucht aufzuhören?»
Ammann: «Eigentlich schon die längste Zeit.» Stille im Raum, wohl auch blasses Erstaunen. Ammann, für ausführliche Erklärungen bekannt und ausschweifende Schilderungen, fügt an: «Kürzer kann ich es nicht sagen.»
Er versucht schon die längste Zeit aufzuhören, eigentlich. Aber heuer startet er zum 29. Mal in eine Weltcup-Saison.
Simon Ammann ist ein Phänomen.
Dieser Meinung war die «Sonntags-Zeitung» im Winter 1997/98. Die Herleitung umfasste mehrere Sätze, die Schlussfolgerung war schlicht. Es hiess, Ammann ziehe die Sympathien auf sich, ohne dass er etwas dafür tue. Er habe etwas Sanftes, etwas unbeschreiblich Positives und Liebenswürdiges. Er strahle Freude aus und sei rührend unwissend. Und so weiter. Er habe vorzügliche Flugeigenschaften und sei in einer Welt gelandet, die ihn begehre und umjuble. Fazit: «Simon Ammann ist ein Phänomen.»
27 Jahre später ist Simon Ammann noch immer in dieser Welt. Aber ist er gelandet? Immer wieder, nie richtig.
Im September 2025 landet das Gespräch mit Ammann irgendeinmal in den Hügeln des Toggenburgs. Später redet er von «Metallica» und den «Toten Hosen». Es folgt die Erinnerung an einen finnischen Google-Mitarbeiter, der ihm sagte, ein Computer-Programmierer brauche etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze sei.
«In der harten Zeit lernst du, gut zu sein –aber wie viel Energie du davon erhältst, merkst du erst, wenn es wieder zu laufen beginnt.»
Simon Ammann
Der Skispringer Ammann brauchte etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze war. Im Winter 1991/92 stand er erstmals auf einer Sprungschanze. Er hatte wochenlang darum gebettelt, um endlich an einem Schnupperspringen auf der 30-MeterSchanze in Wildhaus teilzunehmen. So hat es die Mutter überliefert. Und als er auf dem Schanzentisch sass, «gab es kein Zurück», so sagte er es einst in der «NZZ am Sonntag».
Simon Ammann ist ein Phänomen. Um den Jahreswechsel 1997/98 nahm er an den ersten Weltcup-Wettkämpfen teil, mit 16. Im Februar 1998 startete er erstmals an Olympischen Spielen. 2002 gewann er an Olympischen Spielen erstmals zwei Goldmedaillen. Weltspitze! 2010 gewann er an Olympischen Spielen zum zweiten Mal zwei Goldmedaillen. 2014 startete er zum fünften Mal an Olympischen Spielen und sagte: «In vier Jahren springe ich nicht mehr, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit.»
Und nun nimmt er die achte Teilnahme an Olympischen Spielen ins Visier, im Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Er ist noch nicht gelandet. Womöglich wäre alles anders gekommen, wenn es damals – vor dem allerersten Sprung – ein Zurück gegeben hätte.
Warum gab es kein Zurück?
Ammann sagt: «Wenn du oben stehst, stehen eigentlich alle anderen Springer um dich rum und schauen zu dir. Du hast dich reingehangelt, alle anderen haben auch schon die Ski angeschnallt –da ist es kaum möglich zurückzugehen. Ausser, man hat wirklich mega Schiss. Wenn du um dich schaust, weisst du: Jetzt muss ich runter.»
Das Schnupperspringen gewann er, mit einer Weite von 20, 21 Metern, «und es war einfach super, ein Erlebnis. Das Ganze zu meistern, war genial. Oben bist du aufgeregt – und wenn du ausfährst, reagiert es einfach emotional. So war es schon beim ersten Sprung.»
Es ist Ammanns Leben geworden. Das Springen. Und seine Schilderungen. Wie oft hat er Journalisten in den vergangenen 20 Jahren das Skispringen zu erklären versucht, Positionen und Anläufe, Flugkurven und Fluggefühle; er redete über Erfindungen, über Bindungsstäbe und Schuhe. Und oft gingen die Journalisten danach zu Vertrauten von Ammann und fragten, was er wie gemeint habe.

Salt Lake City 2002: Mit 20 Jahren jubelt er über Doppel-Olympia-Gold –«Simi», noch ahnungslos, dass sein Name im Skispringen unauslöschlich bleibt.
Für das Leben?
Gegen die Angst?
Heute ist die Frage anders: Was ist aus der 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit geworden, mit der er 2014 den Abschied von Olympia in Aussicht stellte? Wie meinte er es? Oder: Warum ist das eine Prozent derart stark, dass es ihn vom Rücktritt abhält? Was treibt ihn an?
2018 sagte Ammann: «Für mich geht es immer darum, besser zu werden.»
2023 sagte Ammann: «Das Wettkämpferherz in mir schlägt noch immer stark.»
Und 2022, bei SRF, nach zwei ernüchternden olympischen Springen, zweimal Rang 25: «Wenn ich meinen Kindern einmal sagen kann: ‹Hey, mit 40
sprang ich noch über diese gigantische Anlage› – und ich hatte wirklich Spass… Dann ist es für mich, für das Leben einfach viel wert.»
Wofür sprang er damals: Für sich? Für Fortschritte? Für die Kinder? Für das Leben? Gegen die Angst?
Denn bei gleicher Gelegenheit im SRF-Studio sagte er: Vielleicht habe er eine Angst in sich, das Ende als Spitzensportler wirklich zu akzeptieren.
Vor dem ersten Sprung war es kaum möglich zurückzugehen – ausser, man hatte «wirklich mega Schiss». Hatte er nicht, «Schiss» vor dem ersten Sprung –hat er Angst vor dem letzten?
2022 sagte Ammann: «Ich kenne mich mittlerweile, ein Stückchen. Ich weiss einfach: Den Skispringer in eine Ecke zu stellen und zu sagen: ‹Das war’s jetzt›
– und dann kommt er wieder nach vorne, wenn man eine Anlage sieht… Vielleicht wäre es einfacher, nicht aufzuhören.» Und: Man müsse sich «ja nicht selber aufgeben, man muss es vielleicht auch ein bisschen philosophisch anschauen».
Vermutlich ahnte Ammann damals selber nicht, wie viel in all diesen Antworten steckte – und wie viel besser er sich noch kennenlernen würde. Nein, er hat sich nicht selber aufgegeben, aber er musste darum kämpfen. Das Wettkämpferherz halt. Hinter ihm liegen zwei schwierige Jahre, mit zwei Wintern ohne eine einzige Weltcup-Klassierung in den ersten 20 und mit Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten, die auch nicht viel leichter waren. Er spricht von «einem der grösseren Löcher, wo ich mich durchgefightet habe». Und dabei ging es weniger darum, alles zu vereinbaren, das Leben als Skispringer, als Ehemann und Vater dreier Kinder, als HSG-Student, als Unternehmer; und schon gar nicht ging es darum, dass er nicht mehr breitflächig begehrt und umjubelt wird. Sondern darum: sich selber zu verstehen; sich mehr zu kennen als nur ein Stückchen.
Aus dem Skispringer, der das Springen und seine Sprünge erklärte, ist ein Mensch geworden, der sein Wesen erklärt.
Verwunderung über das «frühere Ich»
Auf der Suche nach dem, was Simon Ammann antreibt, finden sich viele verschiedene Antworten, die Fortschritte, die Kinder, das Leben, die Angst – ist jede Antwort richtig?
Ammann sagt oft «vielleicht», in diesem Fall: «Das eine oder andere habe ich sicher so gebracht, um auszudrücken, was ich selber vielleicht nicht richtig auszudrücken imstande war.» Darauf: «Schlussendlich bin ich ja immer noch da.» Wieder einige Sekunden Stille im Raum, wohl auch blasses Erstaunen, diesmal von Ammann über sich selber, er atmet aus und
sagt: An der HSG sei er ja nicht nur BWL und Mikroökonomie und mathematischen Formeln begegnet – es habe auch einen Philosophiekurs gegeben, «wo wir Sachen wirklich kontrastreich anschauten und die Auseinandersetzung suchten». Er habe den Auftrag bekommen, einen Vortrag zu halten über «meine Zeit», so sagt er es, «und da versuchte ich zurückzublicken, auch auf meinen Weg in den Weltcup. Ich schaute, was für ein Mensch da sass, auf dem Weg in den Olymp, wenn ich es so sagen darf. Und manchmal hatte ich das Gefühl, es sei ein anderer Mensch, der an diese Sache heranging und an die Olympischen Spiele reiste.»
Er sei einem «früheren Ich» begegnet, als er sich in einer Dokumentation aus dem Winter 2001/02 sagen sah: «Skispringen können halt einfach nicht so viele Leute, das hat verschiedene Gründe.» Fertig. Heute staunt Ammann darüber, dass er keine Gründe lieferte, keine Erklärungen; dass er es so stehen liess.
Etwas so stehen lassen: Diese Haltung entspricht ihm nicht, dem heutigen Ich.
Ammann sagt: «Ich merkte, dass dieses Zurückschauen, dieses Auf-michSchauen der Weg ist, um das Ganze zu bewältigen.» Das Ganze? «Die Karriere, das Skisprung-Leben.» Diese Dimension sei Aussenstehenden womöglich gar nicht bewusst, und er erwarte auch gar nicht, dass sie Aussenstehenden bewusst wäre. Aber es wird verständlich, was ihn antreibt: das Bewältigen der Pionierarbeit, die seine Generation für das Schweizer Skispringen geleistet habe; das Bewältigen der ersten Olympiasiege 2002; das Bewältigen der folgenden Hochs und Tiefs; das Bewältigen der nächsten Olympiasiege 2010; das Bewältigen der Schwierigkeit, in den eigenen Spuren zu wandeln – «das war für mich viel tiefgreifender, als mir lange bewusst war». Deshalb habe er in den vergangenen Jahren die Auseinandersetzung mit sich selber und seiner Karriere vorangetrieben – «damit ich diesen Punkt finde, wo ich als Mensch nachher wieder herausgehe».

Ammann sagt, er habe eine Phase durchgemacht, die andere Spitzensportler erst nach dem Rücktritt erlebten. Für ihn muss es sich wie ein Skiwechsel während des Flugs angefühlt haben. Ohne Gewissheit, ohne Vorahnung, wie es herauskommt, Crash-Gefahr hoch – und erst noch mit der Verantwortung eines Familienvaters.
Ammann stiess an seine Grenzen, «und deshalb kam diese Auseinandersetzung mit meinem Wesen». Was ist er für ein Wesen?
Ammann glaubt, er habe «extrem viel Widerstandskraft». Er fragte sich, woher diese Kraft komme, und landete bei seiner Generation, der Generation zwischen den viel erwähnten Baby-Boomern und der Generation Z, «wir sind die zwischendrin». Und da führt das Gespräch in die Hügel des Toggenburgs, wo er letzthin mit seinem Vater im Traktor übers Feld gefahren
sei und Rundballen gepresst oder in Folien gewickelt habe, 700, 800 Ballen, «für mich so etwas wie Therapie». Er stellte wieder einmal fest, mit welcher Präzision der Vater vorgehe, «die Rundballe muss schön sein», der Vater sage: «Du musst so hinfahren, nein, so…» Dabei sah Simon Ammann, «wie brutal viel Energie wir auf den Weg mitbekommen haben von unseren Eltern», und er hoffe einfach, ein ebensolches Vorbild sein zu dürfen.
Als übersehe Ammann, dass er selber längst ein Vorbild ist, fährt er fort: Seine Generation habe zwar keine Musikband gehabt, die fast die Welt veränderte, wie die «Beatles» zum Beispiel, aber er sei doch auch einer faszinierenden Kreativität begegnet, er meint «Metallica», die «Toten Hosen» und «sogar den Techno-Stuff» –und all diese Gedanken führen ihn dazu, dass er «recht viel Ausdauer und recht viel Kreativität» mitbringe.
Ihn führten diese Ausdauer und diese Kreativität in die Weltspitze des Skispringens. Doch es ist ihm anzumerken, dass er auch anderswo gerne ausdauernd und kreativ gewesen wäre, er schwärmt von einem Besuch als Schüler im CERN in Genf, bei der Europäischen Organisation für Kernforschung. Auch mit diesem Thema möchte er sich wohl intensiv befassen. Oder mit dem Programmieren von Computern, alsdann kommt er auf einen Flug von Helsinki nach Zürich zu sprechen, auf den Google-Mitarbeiter, der neben ihm sass und sagte, ein ComputerProgrammierer brauche etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze sei.
Ammann weiss, dass es in der Forschung viele jüngere kluge Köpfe gibt –dass er wohl nirgends mehr Weltspitze werden wird. Aber er ist es im Skispringen geworden. Und vermutlich schafft er es sogar, stolz zu sein darauf, auf sich und seine Generation. Sein Instagram-Account heisst «windrider1981», und womöglich sagen diese neun Buchstaben und vier Zahlen alles aus über sein Wesen und wie er sich versteht: dieser Hinweis auf einen Jahrgang, in dem Roger Federer und Fabian Cancellara zur Welt kamen, Schweizer Top-Sportler par excellence – und eben Simon Ammann, der nicht bloss einfach mit Ski über eine Schanze springt, sondern: durch den Wind reitet.
Der «Windrider» nimmt den Winter 2025/26 als B-Kader-Mitglied in Angriff, mit dem Ziel, noch einmal an Olympischen Winterspielen teilnehmen zu dürfen, mit den Beteuerungen von ihm und Swiss-Ski-Verantwortlichen, dass er keinem Jüngeren den Platz wegnehme. Er hat im Sommer so viel trainiert, wie es ging, marschierte aber doch auch aus dem Kraftraum, wenn er merkte, dass heute nichts mehr geht. Er hat das Studium vorangetrieben, noch steht die Bachelor-Arbeit aus, er schreibt über Innovationen, «wie könnte es auch anders sein».
Er engagiert sich weiter in der Dachdeckerfirma, die er vor einigen Jahren mit einem Bruder gekauft hat, und er hat die Kranführerprüfung gemacht. Die Engagements bei den Toggenburger Bergbahnen und bei einer Sportagentur indes hat er aufgegeben; es waren Engagements, die er einst auch aufgegleist hatte für die Zeit nach der Karriere.
Er hat eine andere «Sache» gefunden, «die ich auf die Beine zu stellen versuche», so nennt er es – aber er verrät noch nicht, was diese «Sache» ist.
Und er hat als Skispringer «eine einfache Änderung gemacht», die ihm ein Gefühl gibt, «dass ich weniger den Optimismus im Voraus proklamieren muss, nein, ich kann eigentlich wirklich dran glauben, dass es mir etwas bringt». Was ist es für eine Änderung? Er erkläre es später einmal, sagt Ammann, «ich möchte warten, bis ich es auf Weltcup-Level zeigen kann».
Ja, er hat versucht zurückzutreten, schon die längste Zeit, eigentlich – aber noch gibt es kein Zurück, wie damals, vor dem ersten Sprung. Ammann sagt: «In der harten Zeit lernst du, gut zu sein – aber wie viel Energie du davon erhältst, merkst du erst, wenn es wieder zu laufen beginnt.» Und diese Energie möchte er noch einmal spüren, auch wenn es schwierig sei, an dieses Gefühl zu glauben, «wenn es dir scheisse geht».
Er muss weiter Ski springen, um mit dem Skispringen abzuschliessen. Er muss dieses Leben weiterführen, um mit diesem Leben abzuschliessen. Es ist die Aufgabe für ein Phänomen.
Simon Ammann ist schon oft gefragt worden, wann er zurücktrete.
Als er einst oben stand vor dem ersten Sprung, da schauten alle anderen Springer zu ihm. Seither springt er. Vielleicht hört er auf, wenn niemand mehr hinsieht. Oder niemand mehr fragt.
Text: Benjamin Steffen


Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass
Nur vier Auto- oder Bahnstunden von der Schweiz entfernt, lockt die Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass mit Tradition, moderner Infrastruktur und langen Saisons.
Das Tal beginnt bei der mittelalterlichen Fuggerstadt Sterzing (900 m) und reicht bis auf 2150 m. Drei Skigebiete warten: Rosskopf (2120 m), Ratschings–Jaufen (2150 m) und Ladurns (2033 m). Zusammen bieten sie 66 Pistenkilometer und moderne Bergbahnen – vereint im Wipptal Skipass. Ein Highlight ist die rote Piste Nr. 7 in Ladurns, benannt nach Weltmeister Patrick Staudacher. In Ratschings–Jaufen finden Sportler wie Geniesser ihr Glück – von sportlich-anspruchsvoll bis zum gemütlichen Cruisen. Skimovie-Rennstrecke und Funslope runden das Angebot ab.

Dank der Lage am Alpenhauptkamm gilt hier Schneegarantie: Saison von Anfang Dezember bis Mitte April. Bei Bedarf sorgen moderne Beschneiungsanlagen für perfekte Bedingungen. Dazu kommen 19 urige Hütten – das macht Skitage unvergesslich.
Nicht nur Skifahrer kommen auf ihre Kosten: Über 60 Loipenkilometer durch eindrucksvolle Hochtäler bieten nordischen Genuss, besonders die 15 km lange Loipe im Ridnauntal. Auch Winterwandern, Skitouren und Schlitteln sind beliebt. Am Rosskopf wartet die längste beleuchtete und beschneite Rodelbahn Südtirols – und Italiens.
Übernachten kann man in Sterzing, Ratschings und Gossensass – ob Hotel, Pension oder Ferienwohnung. Der Südtirol Guest Pass, der von den teilnehmenden Gastgebern ausgestellt wird, ermöglicht die unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die direkt zu den jeweiligen Skigebieten führen. Wer Stadt und Gebirge verbinden möchte, ist in Sterzing genau richtig: Einkaufsgassen, historische Architektur und alpine Umgebung ergeben eine perfekte Symbiose.
Fazit: Die Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass steht für aktiven Winterurlaub mit Kultur, Tradition und garantierter Schneesaison.
«Das Projekt wird kofinanziert von der Europäischen Union – GAP Strategieplan 2023-2027 der Autonomen Provinz Bozen – LEADER Wipptal.»
Lage
Die Skiregion Sterzings-RatschingsGossensass liegt im Norden Südtirols und beginnt gleich nach dem Brennerpass. Die drei Skigebiete sind in Ladurns, Rosskopf und Ratschings-Jaufen.
Neuheiten
Ladurns: Ride and Race Zone – neue Funslop, Funcross und Speedmessstrecke; Ratschings-Jaufen: Neues Bergrestaurant «Summit Mountain Club» an der Bergstation; Rosskopf: Die neue Funslope für Groß und Klein bietet Wellen, Steilkurven, kleine Sprünge und jede Menge Spaß!
Das öffentliche Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut. Der Südtirol Guest Pass »activeCard» wird von den teilnehmenden Gastgebern ausgestellt und ermöglicht unter anderem die unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die direkt zu den jeweiligen Skigebieten führen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vergünstigungen, unter anderem bei der Skivermietung und in Sportgeschäften.
Saisonhighlights
Alpinstadt Sterzing mit dem Weihnachtsmarkt "Sterzinger Glockenweihnacht" (original Südtiroler Christkindlmarkt): 28.11.2025. - 06.01.2026
«Early Bird» Sonnenaufgangsskifahren am Rosskopf: Jeden Freitag vom 26. Dezember 2025 bis 27. Februar 2026. Ski- und Hüttengaudi im Skigebiet Ratschings-Jaufen vom 12. Januar bis 15. Januar 2026 sowie vom 9. bis 12. März 2026 mit täglicher Live-Musik auf jeweils einer Skihütte. Lederhosen im Schnee im Skigebiet Ladurns am 21. März 2026 - mit Lederhose und Dirndl ab zum Pistenspass.
Weitere Informationen www.sterzing-ratschings.com
St. Moritz
12.12. – 14.12.
Ski Alpin F 2x Abfahrt, 1x Super-G
Davos 12.12. – 14.12.
Langlauf M/F
Teamsprint F, Sprint F, 10 km F
Arosa 16.12.
Skicross M/F
Davos 20.12.
Snowboard M/F
Alpin PSL
Engelberg 20./21.12.
Skispringen M/F
Scuol 10.01.
Snowboard M/F
Alpin PGS
Adelboden 10./11.01.
Ski Alpin M
Riesenslalom, Slalom
Laax 17.01.
Freeski M/F Slopestyle
Laax 17./18.01.
Snowboard M/F Halfpipe, Slopestyle
Wengen
16.01. – 18.01. Ski Alpin M
Super-G, Abfahrt, Slalom
Melchsee-Frutt 23./24.01.
Telemark M/F 2x Parallel-Sprint
Goms 23.01. – 25.01.
Langlauf M/F
Teamsprint F, Sprint C, 20 km C
Adelboden 10./11.01.
Veysonnaz 23./24.01. Skicross M/F
Veysonnaz 23./24.01.
Crans-Montana
30.01. – 01.02.
Ski Alpin M/F
Abfahrt F, Super-G F, Abfahrt M
Melchsee-Frutt 23./24.01.
Wengen 16.01. – 18.01.
30.01. – 01.02.
Silvaplana 27./28.03.
Freeski M/F Slopestyle, Halfpipe
Silvaplana 28./29.03.
Snowboard M/F Halfpipe, Slopestyle
Engelberg 20./21.12.
12.12. – 14.12.
Detaillierte Informationen zum Rennkalender www.swiss-ski.ch/events
Die Schwestern Flurina und Laila Bätschi fahren beide Snowboard Alpin. Sie verbindet weit mehr als ihr Sport. Konkurrenz kennen sie nicht – zumindest noch nicht.
Hinter dem Haus der Familie Bätschi auf der Lengmatta in Davos Frauenkirch lief einst ihr eigener Lift – ein «Häntschefrässer» samt Konzession: 300 Meter Piste mit drei Wellenmulden, vom Stall aus beleuchtet, vom Nachbarn mit dessen Pistenbully präpariert. Für die Eltern Corina und Peter war es ein kleiner Wintertraum, auf dem sie nachts powderten, wenn die Kinder schliefen. Für Flurina und Laila ist es der Hang, auf dem sie ihre ersten Schwünge machten – damals noch auf Ski.
Corina und Peter Bätschi lernten sich als Skilehrer kennen. Sie heiratete im weissen Skianzug, er im schwarzen – die gemeinsame Fahrt auf dem Raceboard wurde zum Symbol für ihren Zusammenhalt und ihre Leidenschaft fürs Snowboarden. Diese Leidenschaft haben sie weitergegeben – als Leiter der heimischen Snowboard-JO und an ihre Töchter.
Flurina Neva Bätschi, 22, gehört im Snowboard Alpin zum Nationalteam von Swiss-Snowboard. Sie debütierte 2022 im Weltcup, holte drei Medaillen an Juniorinnen-Weltmeisterschaften und stand Ende 2024 erstmals auf dem WeltcupPodest im Parallel-Slalom – ausgerechnet zu Hause in Davos. Laila Ursina Bätschi, 20, fährt im B-Kader im Europacup-Team. Sie gab 2023 ihr Weltcup-Debüt und fuhr letzte Saison zum ersten Mal auf ein Europacup-Podest. Als ihre Schwester beim HeimWeltcup die Ziellinie überquerte und Bronze holte, flippte Laila komplett aus.
«Es macht uns sehr glücklich zu sehen, wie sehr sie sich füreinander freuen», sagt Corina Issler Bätschi. Sie steht oft selbst am Pistenrand, als Torwartin oder Speakerin, während Peter als Torwart oder als Vizepräsident des Weltcups in Davos im Einsatz ist. Für die Familie ist es selbstverständlich, Teil des Ganzen zu sein, an Wettkämpfen mitzuhelfen –ganz egal ob die Töchter am Start stehen oder nicht.



Ihr eigener Skilift direkt hinter dem Elternhaus: An der Lengmatta in Davos Frauenkirch sind die Bätschi-Schwestern im Schnee aufgewachsen. Bild: zvg
Noch nie sind Flurina und Laila in einem Weltcup- oder Europacuprennen gegeneinander angetreten – das direkte Duell in den Finals im Parallel-Slalom bleibt also offen. Und trotzdem sind sich die Schwestern einig: Konkurrenzkampf gibt es zwischen ihnen nicht. «Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Flu als meine Konkurrentin empfunden», sagt Laila. Flurina ergänzt: «Wenn es ihr läuft und mir nicht, dann freue ich mich für sie mehr, als dass ich mich über mich selbst nerve.» Sie gesteht sogar, dass sie nervöser ist, wenn ihre Schwester fährt, als wenn sie selbst am Start steht.
Für beide bedeutet jedes Rennen: zwei Starts, zwei Chancen.
Ihre Eltern sehen diese Nähe mit Stolz. «Wir wollen unseren Töchtern mitgeben, dass eine Schwester etwas Wertvolles ist», sagt Corina Issler Bätschi, die selbst eine tiefe Verbindung zu ihrer Schwester pflegt. Dieses blinde Vertrauen, das sie haben – das sei ein Geschenk.
Ein Geschenk, das auch zehren kann. Laila erinnert sich an die Zeit, als sie verletzt zu Hause blieb und ihre Schwester vermisste – die Folgen von Covid, eine chronische Knieentzündung und eine Gehirnerschütterung setzten ihr in den letzten Jahren zu. Laila vermisste Flurina so sehr, dass sie am Bahnhof in Tränen ausbrach, als sie sie endlich abholte. «Egal wo du bist, ein Teil deiner Familie ist immer dabei», sagt Flurina über das gemeinsame Unterwegssein im selben Sport.
Früher gelernt, heute genutzt
Es ist die Jüngere der beiden, Laila, die zuerst den Weg ins Snowboard-Alpin fand. Flurina hielten die harten und steifen Schuhe zuerst noch zurück. Das Softboard wurde ihr aber irgendwann dann doch zu langsam, als immer mehr Kinder in der JO aufs Raceboard wechselten. Laila fuhr zwar zunächst noch Ski Alpin, startete ihre Ausbildung am Sportgymnasium
Davos jedoch bereits als Snowboarderin. Flurina begann dort als Eiskunstläuferin, eine Zeit lang machte sie beides: Morgens fuhr sie ein Snowboardrennen auf der Lenzerheide, am Nachmittag trat sie an den Bündner Meisterschaften im Eiskunstlauf in Chur an – im Auto schminkte sie sich noch schnell. Mit 15 fiel dann auch für sie die endgültige Entscheidung fürs Raceboard. «Uns war es einfach wichtig, dass sie polysportiv aufwachsen und vor allem ohne Leistungsdruck», sagt Peter Bätschi.
Flurina bringt das Kantengefühl vom Schlittschuhlaufen mit, Laila das Linienverständnis vom Skirennsport. Heute profitieren beide von ihrem Hintergrund und daher unterscheidet sich auch ihre Technik. Trotz Harmonie und äusserlicher Ähnlichkeit sind die Bätschi-Schwestern sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Während Laila eher die sensible und einfühlsame ist, ist Flurina die pragmatische. Und auch da wieder: «Wir ergänzen uns ganz gut», sagt Laila.
Gestritten haben sie in all den Jahren höchstens ein-, zweimal – an den Grund erinnert sich keine von beiden. Wirklich brenzlig wird es nur im kleinen gemeinsamen Bad: Wenn Flurina zu Hause ist, prallen die Gewohnheiten aufeinander. Die eine will den Spiegelschrank beim Zähneputzen offen haben, die andere zu.
Solche kleinen Konflikte tragen die Bätschis locker aus – so wie den Konkurrenzkampf, den es zwischen ihnen schlicht nicht gibt. Und auch wenn es irgendwann passiert, dass die Schwestern in den Finals gegeneinander antreten, wollen sie entspannt bleiben. «Ich würde gegen niemanden lieber verlieren als gegen meine Schwester», sagt Flurina. Und Laila nickt.
Text: Lia Näpflin

Ihr feines Kantengefühl hat Flurina Bätschi vom Eiskunstlauf– eine Eigenschaft die sie als AlpinSnowboarderin auszeichnet. Bild: Stephan Bögli

Die Nordische Kombination war in der Schweiz fast verschwunden – nun regt sich neues Leben, getragen von einer jungen Generation. Mittendrin: die Kempfs, deren Leidenschaft ungebrochen ist.

Um Kandersteg liegt Nebel, der zwischen den Hängen hindurch streift. Die Schanze braucht heute keine Bewässerung – der Himmel übernimmt. Neben dem Schanzentisch schaut Mutter Pia Alchenberger Kempf unter dem Schirm zu, während Vater Hippolyt Kempf das Startsignal gibt. Erst das Pfeifen, dann das Rauschen und zum Schluss das dumpfe Klatschen der Ski beim Aufprall – ein Klang, der im Regen versickert. Das Training ist abgesagt wegen Wind und Wetter. Doch Finn und Noé Kempf lassen sich vom Springen nicht abhalten – die Bedingungen erlauben zumindest ein paar Demonstrationssprünge.
«Der war nichts», sagt Hippolyt Kempf und stapft entschlossen zu seiner Frau hinüber. «Unten müsste es richtig tätschen» – dann wäre der Sprung weit, über 100 Meter. Bei Finn, dem Älteren der Brüder, «tätscht» es beim zweiten Versuch. Bei Noé beim dritten – ein wenig.
Nach jedem Sprung folgt Feedback vom Vater. Daran hätten sie sich längst gewöhnt, sagt Pia Alchenberger Kempf –schon seit ihrer Kindheit. Und auch die Brüder selbst betonen später, wie gerne sie von ihrem Vater lernen – obwohl er nur noch selten dabei ist. «Von mir haben sie das Poly-
sportive», sagt Pia. «Hippy hat in ihnen das Feuer für diese Disziplin entfacht.»
Zwischen Fliegen und Leiden
Die Familie Kempf lebt in Thun, doch ihr eigentliches Zuhause finden sie auf Schanze und Loipe, in ihrer Disziplin, der Nordischen Kombination – Skispringen und Langlauf, zwei Sportarten, die kaum unterschiedlicher sein könnten und doch zusammengehören. Für Hippolyt ist es ohnehin klar: «Das ist die schönste Sportart überhaupt.» Erst das Gefühl des Fliegens, später die brennenden Beine, die müden Arme, das Feuer in der Lunge – genau diese Mischung fasziniert ihn bis heute. Und sie führte ihn 1988 in Calgary zum Olympiasieg.
Kempf war nach seiner Karriere von 2003 bis 2022 in verschiedenen Funktionen für Swiss-Ski tätig – unter anderem als Disziplinenchef Nordische Kombination und Langlauf sowie als Ski-Nordisch-Direktor. Als er damals seine Arbeit als Disziplinenchef aufnahm, gab es in der Nordischen Kombination noch vier Teams über mehrere Stufen hinweg.

Heute ist die Ausgangslage eine ganz andere: Im Swiss-Ski-Kader stehen gerade einmal zwei Athleten. Einer von ihnen ist Finn Kempf, 19 Jahre alt, seit zwei Jahren im C-Kader. Ein Aufblitzen einer Disziplin, die in der Schweiz einst auf breitere Beine gestellt war. Doch diese Beine wurden gekürzt – genauso wie das Budget.
Der lange Weg ins Abseits
2006 begannen die Kürzungen. 2011 folgte der strategische Entscheid, die Nordische Kombination organisatorisch dem Skispringen anzuschliessen. Und 2022 dann der Entschluss, das verbliebene Budget für die Integration des damals einzigen Schweizer Kombinierers, Pascal Müller, ins deutsche Team zu verwenden.
Diese Entscheide lassen sich nur im Gesamtbild einordnen: Swiss-Ski stand finanziell zeitweise unter Druck, die Zahl der Athleten schrumpfte, der Nachwuchs kam nicht nach, die Resultate blieben aus. Seit der Saison 1998 gab es für die Schweiz in der Nordischen Kombination drei Weltcup-Podestplätze. Der letzte liegt inzwischen acht Jahre zurück. – bei den Frauen gab es überhaupt noch nie einen Erfolg. Der aktuelle Disziplinenchef im Skispringen und der Nordischen Kombination, Joel Bieri, fasst zusammen: «Es ist schwierig, eine Disziplin voranzutreiben, wenn kaum Athletinnen und Athleten da sind. Und Erfolge bleiben im Leistungssport nun einmal der Massstab.»
Zwei Athleten sind es jetzt – und ihre Resultate sind die letzten Ankerpunkte einer Disziplin, die in der Schweiz fast verschwunden ist. Pascal Müller, 24, aus Oberurnen und Mitglied des B-Kaders, startete bereits dreimal an einer Junioren-WM, steht seit 2022 regelmässig im Weltcup am Start und war letzten Winter an der WM in Trondheim im Einsatz. Finn Kempf vertrat die Schweiz zweimal an einer Junioren-WM, feierte im August
seine Premiere im Sommer-Grand-Prix und sorgte Anfang September für ein Ausrufezeichen im Nachwuchsbereich: den ersten Schweizer Sieg in einem Alpencup seit 14 Jahren.
Finn Kempf hat sich seinen jüngsten Erfolg mit Sommertraining in der Schweiz und mit der Ausbildung zum Leistungssportler am Schigymnasium Stams erarbeitet. Jetzt im Maturajahr kombiniert
er seit vier Jahren Schule und Sport in Österreich. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Noé seit zwei Jahren. Seit diesem Jahr trainieren sie in der gleichen Gruppe: In Stams gibt es eine für die jüngeren und eine für die älteren Nordisch-Kombinierer, rund sechs Athletinnen und Athleten pro Team.
Das Skisprungtraining absolvieren sie meist zusammen mit den Skispringern – aber nicht immer. Für Kombinierer lohnt es sich, am Vormittag Sprünge und Schnellkraft zu trainieren und am Nachmittag Ausdauer. Ausdauer und

Nach jedem Sprung folgt das Feedback von Vater Hippolyt – eine Konstante seit ihrer Kindheit.
Schnellkraft beissen einander, sie hebeln sich gegenseitig aus. Und genau da liegt der Knackpunkt der Nordischen Kombination: «Mit der Ausdauer darfst du dir die Schnellkraft nicht kaputt machen», erklärt Finn Kempf. Das brauche bestimmtes Training, begleitet von erfahrenen Trainerinnen und Trainern, die genau wüssten, was sie tun.
«Wir haben alle Sportschulen in der Schweiz abgeklappert. Die richtige Förderung eines Kombinierers war zu diesem Zeitpunkt nirgends gewährleistet», sagt Pia Alchenberger Kempf.
Also wählte die Familie 2020 Stams –jenen Ort, an dem einst schon Vater Hippolyt als junger Kombinierer zur Schule ging.
Leistungszentren als Hoffnungsträger
Seit diesem Frühling gibt es nun zwei Nationale Leistungszentren für Skispringen und Nordische Kombination: Equipe West und Team Ost. Schulischer Partner ist die Sportmittelschule Engelberg, die 2020 erstmals eine Skispringerin

Die Brüder Kempf besuchen das Schigymnasium Stams – weil es in der Schweiz vor fünf Jahren für sie persönlich keine passende Lösung gab.

aufnahm und seit der Saison 2022 auch eigene Skisprungtrainerinnen und -trainer beschäftigt. Inzwischen besucht zudem ein Kombinierer die Schule. Da es in dieser Disziplin zurzeit nur wenige Athletinnen und Athleten gibt, ist Engelberg aktuell der einzige Stützpunkt.
Inzwischen haben die Brüder ihre nassen Anzüge gegen trockene Kleidung getauscht und sitzen im Sitzungszimmer der Nordic Arena in Kandersteg. Der Regen trommelt weiter gegen die Scheiben, Finn und Noé erzählen, wie langweilig sie es finden würden, «nur» Skispringen zu machen. Und wie froh sie sind, dass ihre Mutter – einst Langlauftrainerin und heute bei Swiss-Ski für die Ausbildung im Nordisch-Bereich zuständig – ihnen auch die ganz schmalen Ski nähergebracht hat.
Skispringen und Langlauf – beides haben die Brüder Kempf in Kandersteg gelernt. Die Eröffnung der Nordic Arena 2016 kam für sie also wie gerufen: vier Schanzen in verschiedenen Grössen, umgeben von einer Loipe. Während Finn als Ältester oft alleine trainierte, bildete sich in den Jahrgängen um Noé eine kleine Gruppe. Dass die Nordische Kombination in der Schweiz überhaupt überlebt hat, ist in den letzten Jahren vor allem der Arbeit einzelner Regionalverbände und Skiclubs zu verdanken.
In der Nachwuchsförderung gibt es dabei ein ungeschriebenes Gesetz: Bis 14 Jahre bestreiten Skispringerinnen und Skispringer in der Schweiz auch die Wettkämpfe in der Nordischen Kombination. Erst danach entscheiden sie, welchen Weg sie weitergehen wollen. «So öffnen wir dem Nachwuchs beide Türen», sagt Disziplinenchef Joel Bieri.
Der Knackpunkt der Nordischen Kombination: Sprungkraft und Ausdauer beissen sich.
Türen, die sich nun auch bei SwissSki wieder öffnen. Denn seit diesem Frühling steht nach 2018 erstmals wieder ein Trainer für die Nordische Kombination


Als Zwischenlösung wechselte Pascal Müller ins deutsche Team – dort bleibt der 24-jährige B-Kader-Athlet sicher noch bis zum Ende der kommenden Saison. Bild: Nocogirls
im Einsatz: Tim Hug, dreifacher OlympiaTeilnehmer – und jener Athlet, der vor acht Jahren für den letzten Schweizer WeltcupPodestplatz gesorgt hat. Er hat das langsame Einschlafen der Nordischen Kombination in der Schweiz am eigenen Leib miterlebt. Für seine letzte Saison 2019 finanzierte Swiss-Ski auch bei ihm die Integration in ein ausländisches Team – nicht in Deutschland wie bei Pascal Müller, sondern in Norwegen.
«Wir freuen uns, dass es im Nachwuchs wieder mehr Kombiniererinnen und Kombinierer gibt. Damit wird in Zukunft auch eine breitere Förderung besser möglich sein», so Bieri.
Der 34-jährige Hug betreut um Pascal Müller, der noch mindestens ein Jahr im deutschen Team bleibt, sowie Finn und Noé Kempf eine Gruppe von insgesamt sechs Kombinierern und einer
Kombiniererin. Sie stammen alle aus der Umgebung von Kandersteg und Einsiedeln, machen teils auch eine Berufslehre und sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Das Team steht noch ganz am Anfang. «Ich hoffe, dass wir in Zukunft so viele Athletinnen und Athleten haben werden, dass es wieder mehrere Teams gibt – so wie zu Beginn meiner Zeit», sagt Hug. Und so wie es schon 20 Jahre zuvor bei Hippolyt Kempf der Fall war.
Irgendwann schweift das Gespräch der Familie zu den Ferien im letzten Sommer ab. Und wie selbstverständlich hatten sie die Skisprungausrüstung mit dabei –in Japan. Andere fahren in die Skiferien. Kempfs machen Skisprungferien. Aus Leidenschaft. Genau diese Leidenschaft ist der Grund, weshalb die Familie trotz der mageren Jahre bei Swiss-Ski immer an die Nordische Kombination geglaubt hat. «Warum sollte man den Kindern eine so schöne Sportart vorenthalten? Sie sollen das erleben können, wenn sie wollen», sagt Hippolyt Kempf.
Text: Lia Näpflin



Lenz Hächler ist vieles, nur kein nächster Marco Odermatt. Der hochgehandelte Hoffnungsträger im Skirennsport passt in keine Schublade – und genau da beginnt sein Reiz.
Nach all den Straight-Fit-Jeans des Riesenslalom-Teams sticht seine Baggy-Jeans ins Auge. Es ist Lenz Hächlers erste Pressekonferenz – und das gleich in Adelboden, vor seinem Debüt am Chuenisbärgli, Weltcup-Rennen Nummer drei für den damals 21-jährigen Zuger aus Oberwil. Während Marco Odermatt, Loïc Meillard und Co. mit sportlichen Basecaps auflaufen, manche im Hemd, sitzt Hächlers Mütze locker über den Ohren, der Swiss-Ski-Pulli ist lässig über dem Gürtel hochgekrempelt.
Hächler zieht seine Kleider nicht an, um cool zu wirken. Er trägt sie, weil er sie cool findet, erklärte er Anfang September im Gespräch für diesen Artikel in Magglingen. Als er im Frühling als Gewinner des Sporthilfe-Nachwuchspreises geehrt wird, lautet eine Frage, ob er mit seinen Baggy-Jeans mit aufgestickten Gesichtern
eine Botschaft senden wolle. Hächler winkt ab: Sie gefalle ihm einfach. Und fügt trocken hinzu: «Ich trage halt einfach keine Skinny Jeans.» Punkt.
Weil diese Art von Hosen noch längst nicht als gängiges Erkennungsmerkmal alpiner Skirennfahrer gelten, wird Lenz Hächler gerne als «der Freestyler unter den
Alpinen» bezeichnet. In der Vergangenheit wechselte er seine Haarfarbe regelmässig – platinblond, pink, Leopardenmuster, nichts war ihm zu ausgefallen. Und wenn er einmal einen Tag zum Freifahren hat, dann garantiert nicht auf der Piste. Entweder mit 100 Sachen die Rennstrecke runter oder abseits im Tiefschnee. «Mit freiem Pistenfahren kann ich wenig anfangen», sagt er. Und ab und zu zieht es ihn in den Freestyle-Park – ein Backflip gehört dort dazu.

Im Europacup viel erreicht, im Weltcup noch ohne Resultate –Lenz Hächler sieht seinen Weg erst am Anfang.


Immer wieder von Verletzungen gebremst – auch abseits der Skipiste blitzt der Draufgänger in ihm durch - dieses Mal erwischte es den Fuss.
Das Skatboarden entdeckte Hächler in der Oberstufe in der Talentklasse in Schwyz. Später, an der Sportmittelschule in Engelberg, verbrachte er unzählige Abende alleine und übte – wie Internatsleiterin Helene Moser erzählt. Als er den «Treeflip» – quasi ein Doppelsalto fürs Brett – zum ersten Mal stand, war das für ihn ein «crazy Moment». «Emotionaler als jedes Skirennen», witzelt Hächler.
Emotional war auch das Aus in Adelboden: Innenski im ersten Lauf. Lenz Hächler ist ein Innenski-Pilot – das kann er nicht abstreiten. Innenski-Fehler sind oft der Grund für seine nicht seltenen Ausfälle. Doch Hächler ist weit mehr als sein lockeres Auftreten und seine Schwäche: Er ist Junioren-WMZweiter im Super-G 2023, Juniorenweltmeister
im Slalom 2024, stand bereits achtmal im Europacup auf dem Podest (vier Siege), gewann die Riesenslalom-Wertung letzte Saison und belegte in der Europacup-Gesamtwertung Rang zwei.
All diese Erfolge zeigen sein Talent, doch genauso prägen ihn seine Herkunft, sein Charakter und sein Stil. Denn Lenz Hächler ist noch mehr und vieles zugleich: ein Stadtkind, ein Landei, ein Bergbub. Ein «Lusbueb», ein Draufgänger, ein Verletzter. Ein «Mega-Talent», das «Zuger Skijuwel», das «Ski-Supertalent» – der «nächste Marco Odermatt».
Im Frühling überschlugen sich die Schlagzeilen, gespickt mit Superlativen über den vielseitigen Allrounder. Bei Swiss-Ski längst der HächlerHype genannt.
Geschrieben wird fast immer dasselbe: eben, dass er der nächste Odermatt sei. Eigentlich eher abgeschrieben, denn dieses Interview ist sein erstes grosses Gespräch überhaupt. Viele schreiben über ihn, ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Und immer wieder taucht derselbe Vergleich mit Odermatt auf.
Doch hinter den Überschriften hört die Ähnlichkeit auf. Odermatt war beim Weltcup-Debüt zwei Jahre jünger, er war fünffacher Juniorenweltmeister und


Hächler ist für seinen Schalk bekannt –und dafür, dass er gerne Seich macht, wie er sagt.
stand im Alter von Hächlers Einstieg bereits auf einem Weltcup-Podest. Der Vergleich hinkt also. «Ich habe nicht nichts erreicht, aber ich bin noch nirgends», fasst Hächler zusammen. Und meint damit seine fünf Ausfälle in seinen fünf Weltcup-Einsätzen.
Alle wollen ihn
Stand jetzt ist Hächler im B-Kader und neu Teil der Riesenslalom-Mastery-Gruppe – gemeinsam mit Gino Caviezel, Justin Murisier, Thomas Tummler und eben Marco Odermatt. Mit Tummler und Odermatt verbindet ihn zudem der Ausrüster: Hächler wechselte in diesem Frühling von Nordica
zu Stöckli. Angebote hatte er von allen grossen Herstellern. Drei Marken testete er – und entschied sich für das Schweizer Produkt.
Zum Vertrag gehört sogar ein eigener Servicemann, etwas, das auf seiner Stufe sonst niemand hat. Hype sei Dank? Hächler zeigt sich überrascht über die Aufmerksamkeit und das Vertrauen. «Das alles ist eine Riesenchance für mich», sagt er. «Anscheinend sehen sie mein Potenzial.» Druck verspüre er keinen – auch nicht unterschwellig. Im Gegenteil: Mit Druck umzugehen zählt er zu seinen Stärken. Angst, dass der Hächler-Hype ihn ausbremsen könnte, hat er ebenfalls nicht. Vielmehr müsse er lernen, sich selbst zu bremsen – er, der Draufgänger.
Dosieren, drosseln, weniger riskieren
Risiko ist Lenz Hächlers Motor – und seine Falle. Nach Fehlern schaltet er nicht auf Sicherheit, sondern greift noch mehr an. Mal gelingt ihm damit das Spektakel, mal endet es im Aus. Zu oft will er das Maximum rausholen, obwohl es das in diesem Moment vielleicht gar nicht bräuchte. «Es fällt mir schwer, zu dosieren, weil ich immer denke, es könnte ja gehen», sagt Hächler. Er arbeite daran – und es sei bereits besser geworden.
Doch dosieren muss Hächler nicht nur auf der Piste, sondern auch mit Blick auf seine Gesundheit. Das hat er auf die harte Tour gelernt. Seit
sechs Jahren plagt ihn eine Knochenhautentzündung am Schienbein, die ihn Mitte letzter Saison sogar zwang, den Slalom komplett zu streichen – mit gerade einmal 21 Jahren. Die Belastung und der Druck auf das Schienbein waren zu gross. Im Riesenslalom und in den Speed-Disziplinen geht es besser – die ersten sechs Skitage dieser Saison absolvierte er schmerzfrei.
Umso grösser war die Freude über die schmerzfreien Kurven nach dem Bikesturz im Frühling, bei dem sich Hächler zwei Rippen brach und eine Hirnblutung erlitt. Doch sie hielt nicht lange, diese Freude: Statt wie geplant in Chile zu trainieren, verbrachte er den September alleine in Magglingen – Rehatraining. Grund: ein Bänderriss im Fuss, zugezogen beim Spikeball nach dem Skitraining. Es war nicht das erste Mal, dass er sich abseits des Skisports verletzte. Auch dort blitzt der Draufgänger durch.
Freude war für Hächler schon immer etwas Zerbrechliches. Als kleines Kind galt er nicht gerade als Sonnenschein – sein Gesicht war oft von einem «Lätsch» gezeichnet, wie er erzählt. Doch sobald er im Schnee stand, die Ski an den Füssen, hellte sich seine Miene auf, dann grinste er über beide Ohren. So wie beim «Seichmachen». In Gesprächen mit Wegbegleitern fällt immer wieder derselbe Begriff: Lusbueb. «Wer sagt das?», fragt Hächler mit einem Schmunzeln – und verrät sich damit gleich selbst. Er habe es schon immer gerne lustig gehabt, erzählt er, bevor er auf etwas Nachdruck von seinen Klingelstreichen berichtet, davon, wie er einer Lehrerin die Luft aus dem Velo liess oder einen Freund überzeugte, zusammen ein Ruderboot «auszuleihen», um in den Ferien für etwas Bewegung zu sorgen.
Wenn der Begriff «Lusbueb» fiel, blieb es nie bei diesem einen Etikett. Fast im selben Atemzug wird Lenz Hächler als extrem fleissig und clever, als aufmerksam, motiviert, immer freundlich und aufgestellt beschrieben. Als einer, der das Limit sucht, ohne egoistisch zu sein. Ein Eigenständiger, Selbstbestimmter – ein Teamplayer mit Schalk. Beschreibungen, die eher zum Vergleich passen, der ihm häufig nachgesagt wird. «Ich bewundere ihn sehr, aber ich will nicht wie Odi werden. Ich will ich sein, meinen eigenen Weg gehen.»
Und dieser Weg sieht bei Hächler anders aus: mit Baggy-Jeans statt Skinny, mit Backflips, Skateboard-Sessions bis spät in die Nacht und einer Portion Humor, die ihm niemand nehmen kann. Lenz Hächler – keine Kopie eines anderen, sondern einer, der unbeirrt seinen eigenen Abdruck im Schnee hinterlässt.
Text: Lia Näpflin

Er sucht das Limit – fleissig, clever und risikofreudig. Vergleiche mit Marco Odermatt lässt Hächler abperlen, denn er will seinen eigenen Weg gehen.





















Ein Tag nur für sie – und doch für alle wichtig: Der erste «Girls Tramp Day» bringt Mädchen und Frauen zusammen. Auf dem Trampolin entsteht, was in den Freestyle-Parks oft fehlt.
Ein Samstag im September, eine Trampolinhalle etwas ausserhalb von Bern. Es riecht nach Gummi und abgestandenem Schweiss. Die Blicke der Mädchen tasten sich durch die Runde. Zähne knabbern an Haarsträhnen, Finger zupfen am T-Shirt.
25 Mädchen und Frauen sind in den «Unik Playground» gekommen. Hier warten Matten und Trampoline, ein Airbag, Rutschbahnen und ein Skatepark auf sie. Einige sind noch keine zehn Jahre alt, andere stehen kurz vor ihrem dreissigsten Geburtstag.
Sie wollen gemeinsam Trampolin springen.
Heute ist «Girls Tramp Day». Jeannine Bitzi von Swiss-Ski, die den Event mitorganisiert, stockt mitten in der Begrüssung. Aus der Turnhalle nebenan dringt ein Lärm herüber, der die Stille im Kreis übertönt. Höflich bittet Bitzi die Frau, die am Pfosten anlehnend gebannt zuhört, ihre Jungs etwas leiser zu halten.
Es ist der erste «Girls Tramp Day» überhaupt. Der Name verrät es schon: Willkommen sind nur Mädchen und Frauen. Was im Snowboard vor zwanzig Jahren begann – Trainerinnen und Athletinnen von Swiss-Snowboard organisierten
damals erste Angebote nur für Frauen –hat im Freeski erst seit drei Jahren einen Platz. Bisher allerdings nur auf Schnee. Und das reicht nicht.
Die Hoffnung auf mehr
«Wir haben beobachtet, dass in den Freestyle-Parks nach wie vor mehr Jungs als Girls unterwegs sind», sagt Bitzi in die Runde. Die Grundlage für die Tricks wird auf dem Trampolin gelegt. «In der Luft sich sicher und wohl zu fühlen, ist entscheidend.» Genau das wird hier geübt – und dieses Gefühl, diese Bewegungen
gehen später mit in die Freestyle-Parks. Darauf setzen die Organisatorinnen ihre Hoffnung. Deshalb finden auch noch zwei weitere «Girls Tramp Days» in den Trampolinhallen in Laax und Interlaken statt.
Noch bevor das Aufwärmen startet, macht sich Saskia Münger bemerkbar, eine der weiteren Organisatorinnen. Sie weist in Richtung der Toiletten: Dort liegen Binden bereit – nicht nur für die Menstruation, sondern auch falls Blasenschwäche ein Thema sein sollte. Beiläufig schimmert darin das Motto des Tages durch: «do it anyway» – mach es einfach.

25 Mädchen und Frauen im Alter von 8 bis 29 Jahren füllen die Halle. Heute gehört das Trampolin nur ihnen.

Saskia Münger, Jeannine Bitzi und Kim Born (vlnr) arbeiten bei Swiss-Ski im Freestyle-Bereich – und sind die Köpfe hinter den «Girls Tramp Days». Bilder: Anja Erni

Es geht los. Die Gruppe macht sich bereit zum Sitzball. Auf die Jüngsten fliegen die Bälle sanft, die Älteren kriegen schon kräftigere Treffer ab, und bei den Frauen wird mit vollem Einsatz geballert. Es klatscht, es lacht, es zischt durch die Halle – ohne dass je jemand Regeln vorgibt. Jeder Wurf trifft so, wie er gemeint ist.
Die eine Hälfte übt Basissprünge. Die andere Hälfte folgt den Profis. Sie beherrschen nicht nur das Trampolin, sondern auch die Kicker im Park: Andrina Salis (20), Slopestyle- und Big-Air-Athletin im Snowboard-B-Kader, und Berenice Wicki (23), Snowboarderin und Mitglied des Halfpipe-Nationalteams.
Sie wissen, wie es sich anfühlt, die einzige Frau zu sein. Bis sie zu SwissSki kamen, standen sie in ihren Teams immer zwischen Jungs. «Das hat Gutes und Schlechtes», wird Wicki später erzählen.
Einfach drauf los
Kaum bei den Trampolinen angekommen, werden die beiden Athletinnen sofort umringt. Zwei junge Frauen wollen wissen, wie sie auf dem Snowboard eine ganze Drehung schaffen können – einen 360. Salis erklärt ihnen eine Trockenübung: Ein Klebstreifen am Boden hilft zur Orientierung: erst im Stehen, halb herum, dann ganz – langsam. Später auf dem Schnee, zunächst im Stand, dann über den Pistenrand, Schritt für Schritt bis zum Kicker.
«Aber am besten probiert ihr’s schon mal hier auf dem Trampolin.» Salis schaut den beiden zu, korrigiert mit ein, zwei Gesten, springt selbst vor. Ein kurzes Lob, ein Highfive – dann zieht sie weiter zum nächsten Trampolin.
Wicki unterstützt derweil Simona (27). Sie zögert noch, sich rücklings fallen zu lassen und danach einen Purzelbaum rückwärts zu machen – die Vorübung zum

Zuerst die Hand am Rücken und dann die Matte im Anschub: Berenice Wicki gibt Halt beim ersten Backflip.

Ein Sprung, ein Lächeln, tosender Applaus: Die Teilnehmerinnen feiern jedes kleine Stück Mut, das auf dem Trampolin gezeigt wird.
Backflip. «Geh einfach mehr in die Knie», rät Wicki. «Dann fällst du weniger weit.» Simona probiert es, wieder und wieder, bis sie sich aufrecht fallen lässt und die Drehung halbwegs gerade steht.
Der nächste Schritt: der Backflip mit Hilfestellung. Wicki zählt: drei, zwei, eins. Simona springt, Wicki gibt mit der Hand am Kreuz den nötigen Schwung – und Simona steht ihren ersten Backflip. Rund um das Trampolin wird applaudiert. Simona zieht die Schultern hoch, als wollte sie sich darin verstecken – wendet den Blick ab und lächelt verlegen.
Sie will Freeski –aber nicht allein
Selbst wenn eine Teilnehmerin für sich übt, kommt vom anderen Ende der Halle Jubel zurück. Mareen etwa. Sie hat sich bei Wicki Tipps für einen Cork 7 geholt – eine Drehung mit Schraube. Die 19-Jährige träumt vom Freeski, hat es aber bisher in kein Kader geschafft.
Drei Mal war sie schon in einem «Girls Camp» auf dem Schnee dabei. Dort hat sie Freundinnen gefunden, Gleichgesinnte. Nur: im Alltag haben die nicht immer Zeit, um mit ihr in den Park zu gehen. Allein fährt sie ungern. Dann schiessen ihr Fragen durch den Kopf: Gehöre ich überhaupt dazu, wenn ich «noch nicht so viel» kann? Kann ich mich da überhaupt blicken lassen? «Mir fehlt die Community», sagt Mareen.
Ist sie mit anderen Girls am Berg, verschwinden diese Zweifel.
Beide Gruppen sind mit den Basissprüngen durch: Strecksprünge, Drehungen, Sprünge auf dem Bauch, auf dem Rücken. Unik-Playground-Coach Aurelia Schwab strahlt – alle haben sich getraut, und mit jedem Sprung wurden sie mutiger. «Man merkt schon, dass keine Jungs dabei sind», sagt sie. In gemischten Gruppen seien es oft nur ein, zwei Mädchen. «Und die gehen dann schnell unter.»
Während die Jungs losrennen und schon vor dem Aufwärmen Backflips zeigen, zögern die Mädchen eher. «Das kann einschüchtern, und dann ist es schwierig, sie trotzdem zu motivieren, etwas Neues auszuprobieren», sagt Schwab.
Zur gleichen Zeit wollen Malea (8) und Zoé (8) Mila (9) etwas Neues beibringen – einen Flickflack vom Trampolin auf die Matte. Malea und Zoé kennen die Bewegung aus dem Geräteturnen, Mila dagegen fährt Snowboard und ist weniger mit Bodenübungen vertraut. Vorbildlich machen die beiden die Vorübungen vor, drängen nicht, sondern feuern Mila an.
Ein paar Mal staucht Mila den Kopf etwas ein, doch sie gibt nicht auf. Im richtigen Moment stützen Malea und Zoé sie, während die Coaches nur aus der Ferne zuschauen und grinsen. Dann steht Mila den Flickflack – und die drei jubeln gemeinsam. Malea und Zoé beenden den Jubel mit einem Handschlag, drücken sich kurz aneinander und klopfen sich auf den Rücken – eine Geste, die sonst eher Jungs gehört.
Begegnungen, die bleiben
Die zwei Gruppen vom Morgen haben sich längst aufgelöst. Einige rutschen die Rutschbahn hinunter, andere sind beim Skaten, manche flippen immer noch, und wieder andere liegen auf den Matten und quatschen. Die Frauen erzählen sich von Begegnungen mit den Mädchen: von jener, die einer anderen zugerufen hat «komm, versuch’s doch nochmal, du hast es fast geschafft», oder von der, die den Vortritt abgab, weil die andere schon länger am Trampolin stand und sie gerne sehen wollte, was sie gelernt hat. Auch von dem Mädchen, das meinte: «Das ist aber cool, dass du schon alt bist und auch probierst.»
Auf den Gesichtern der Frauen liegt immer wieder ein ähnlicher Ausdruck, halb gerührt, halb vergnügt. «Es ist einfach süss – und so cool. Dieses Miteinander», sagt Kim Born, die dritte Organisatorin von Swiss-Ski.
Doch langsam ist die Luft draussen, Hunger macht sich breit. Es gibt Hotdogs zum Selberbefüllen. Die einen greifen zuerst zu, die anderen stürzen sich aufs Basteln. Caps in beige, rosa oder schwarz liegen bereit, dazu Glitzersteine und drei Tuben Leim. Stein für Stein warten die Mädchen geduldig, bis der Leim die Runde gemacht hat und sie wieder an der Reihe sind. Am Ende klebt auf jedem Cap derselbe Badge: «do it anyway».
Auch Andrina Salis und Berenice Wicki sitzen beim Basteln. Jemand witzelt, mit Jungs wäre das wohl nicht möglich – sie würden längst gegeneinander antreten, herumalbern oder gar nicht erst ruhig sitzen bleiben. Bald dreht sich das Gespräch darum, wie es ist, die einzige Frau im Team zu sein. «Ich war immer irgendwie integriert, aber immer ein Einzelzimmer fand ich mit der Zeit doof», sagt Salis. Wenige Mädchen wagen sich in den Freestyle-Sport – und weil so wenige anfangen, bleiben noch weniger. «Allein in einem Team zu sein, braucht bereits Mut – und da geht es noch gar nicht um die Tricks.»
So einen Tag wie heute, nur mit «Girls» in der Trampolinhalle, hätten sie sich früher selbst gewünscht. Und doch hatte es auch Vorteile, im Jungsteam zu sein. «Die hatten ein höheres Level, und ich habe mich an ihnen orientiert. Ich bin überzeugt, dass ich auch deshalb besser wurde», sagt Wicki. «Sie haben mich gepusht – aber mir fehlte ab und zu jemand, der mich an der Hand genommen hätte.» Eine Frau.
Mutig sein. Besser werden. Miteinander. Die Worte schwirren seit Beginn durch die Halle – in Zurufen, mal liegen sie in einem Blick oder werden spürbar in Gesten. Und in der Schlussrede kehren sie wieder.
Seid mutig. Unterstützt einander.
Seid mutig.
Lasst euch Zeit.
Bildet Gruppen.
Seid mutig.
Bleibt mutig.
Es ist kurz nach acht, die Eltern stehen bereit, um ihre Töchter abzuholen. Ein, zwei stürmen noch einmal zu den Trampolinen – ein letzter Backflip.
Zurück bleiben die älteren Teilnehmerinnen. Wieder sitzen sie beisammen, wieder erzählen sie von den Begegnungen mit den Mädchen, von Worten und Gesten, die hängen geblieben sind. Und bevor das endgültige Tschüss gesagt ist, wird klar: Heute hat jede, die einen Backflip probieren wollte, ihn auch geschafft.
Text: Lia Näpflin
Zu den Snowboard-Kadern von Swiss-Ski gehören aktuell 8 Frauen und 13 Männer, dazu kommen im Sichtungskader 3 Frauen und 13 Männer. Bei den Freeskier:innen umfasst das Swiss-Ski-Kader 5 Frauen und 15 Männer, während dem Sichtungskader 4 Frauen und 22 Männer angehören. Gesamthaft machen die Frauen damit 29,7 % im Snowboard und 21,7 % im Freeski aus.
Swiss-Ski organisiert gemeinsam mit Sunrise laufend weitere Angebote in den Freestyle-Disziplinen – exklusiv für «Girls». Von Snowboard Freestyle über Freeski bis hin zu Ski- und Snowboardcross: Ziel ist es, Mädchen und Frauen auf allen Levels zu fördern und ihnen eine Community zu geben.
Alle Infos und Daten findest du hier
Bei der Förderung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses nimmt die Stiftung Passion Schneesport mit Urs Wietlisbach an der Spitze eine gleichermassen bedeutende wie vorbildhafte Rolle ein. Die Ersteigerung eines Rennhelms von Didier Cuche war der Prolog einer mittlerweile zehnjährigen Erfolgsgeschichte.
Gegensätzlicher zum derzeitigen Stimmungshoch hätte die Gemütslage innerhalb der Schneesport-Nation Schweiz im Winter 2012/13 kaum sein können. Für Swiss-Ski zeichnete sich eine sportliche Baisse ab, die letztlich in einem historisch schlechten Abschneiden gipfelte – mit Platz 7 im Nationen-Weltcup der Alpinen. Die Alarmglocken schrillten laut, entsprechend wurden bei Swiss-Ski verschiedene Neuausrichtungen vorgenommen. Im Hintergrund liefen parallel die Vorbereitungen für eine neue Form der Nachwuchsförderung, von welcher der Schweizer Schneesport seit mittlerweile zehn Jahren massgeblich profitiert. Die Rede ist von der Stiftung Passion Schneesport.
Alles begann damit, dass sich Urs Wietlisbach, der Mitgründer der Investmentfirma Partners Group, in einer Sammelaktion einen Ovo-Helm des kurz zuvor zurückgetretenen Didier Cuche ersteigerte. Er bot so viel, dass
der 21-malige Gewinner eines WeltcupRennens und dessen Individual-Sponsor Ovomaltine fanden, für diesen Betrag sei es angebracht, Wietlisbach einen Skitag mit Cuche zu schenken. Annalisa Gerber, die damals das Sponsoring bei Swiss-Ski verantwortete, begleitete die beiden auf der Piste. Sie erzählte Wietlisbach dabei von ihrem Ansinnen, zur finanziellen Unterstützung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses ein Crowdfunding lancieren zu wollen. Der Unternehmer bestärkte Gerber in ihrem Vorhaben, wies sie jedoch darauf hin, dass hierfür eine Stiftung gegründet werden sollte.
Nach monatelanger Vorarbeit war es im Januar 2015 schliesslich so weit: «Passion Schneesport», eine Stiftung zur Förderung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses, wurde der Öffentlichkeit in St. Moritz vorgestellt. Ihr erster und bis heute einziger Stiftungsratspräsident: Urs Wietlisbach. Zusammen mit Urs Lehmann, Annalisa Gerber und Claudia Bonsack trieb er die Gründung von Passion Schneesport tatkräftig und entscheidend voran. Seine Botschaft: «Ohne Unterstützung des Nachwuchses verlieren wir unsere zukünftigen
Siegerinnen und Sieger.» Aus finanziellen Gründen soll dem Schweizer Schneesport kein Talent verloren gehen. «Für viele Talente und deren Familien ist der Schneesport, ein Schweizer Kulturgut, kaum mehr finanzierbar. Deshalb bedarf es einer langfristigen und konsequenten Nachwuchsförderung», so Wietlisbach. Vom grossen persönlichen Engagement und ausgezeichneten Netzwerk des erfolgreichen Investors und Unternehmers profitiert die Stiftung beim Akquirieren neuer Gönnerinnen und Gönner seit Anbeginn stark.
Urs Lehmann, bis vor kurzem Präsident von Swiss-Ski und langjähriger Vizepräsident des Stiftungsrats, betont: «Talentförderung und sportlicher Erfolg dürfen nicht von den finanziellen Möglichkeiten einer Familie abhängen. Die Herausforderungen, mit denen viele Nachwuchssportlerinnen und -sportler konfrontiert werden, sind zahlreich und vielfältig.» Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren hilft die Stiftung, Chancengleichheit für talentierte Athletinnen und Athleten zu schaffen.
Nachdem die Dr. Heinz GrütterJundt-Stiftung vor 21 Jahren im Zuge einer millionenschweren finanziellen Zuwendung zugunsten des alpinen Skisports

ins Leben gerufen worden war, wurde die Stiftung Passion Schneesport mit dem Zweck gegründet, finanzielle Mittel zur Unterstützung von jungen Athletinnen und Athleten aus allen elf Schneesportarten, die unter dem Dach von Swiss-Ski vereinigt sind, zu generieren.
Die von der Stiftung gesprochenen Förderbeiträge gehen nicht nur an talentierte Nachwuchsathletinnen und -athleten, sondern auch an spezifische Nachwuchsprojekte. Für die Saison 2025/26 werden 900'000 Franken an 50 Athletinnen und 102 Athleten bereitgestellt (Vorjahr: 819'300 Franken), in Bezug auf spezifische Nachwuchsprojekte


Die Stiftungsratsmitglieder Michael Müller, Annalisa Gerber und Diego Züger beim diesjährigen Partnerabend von Swiss-Ski. Bild: Stephan Bögli

Passionierte Sportförderer: Urs Wietlisbach und seine Frau Simone. Bild: zVg
wurden derweil 17 Förderanträge (von insgesamt 22) im Umfang von 880'000 Franken durch den Stiftungsrat positiv bewertet. Der Geldfluss in die Stiftung wird durch Gönnerinnen und Gönner, unter ihnen viele bedeutende Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft, gewährleistet. Zum Inner Circle, der jährlich 50'000 Franken einzahlt, gehören aktuell 23 Personen, die Anzahl der Premium Gönner (Beitrag von jährlich je 15'000 Franken) liegt bei 75.
«Wir sind glücklich und stolz, zahlreiche landesweit sehr angesehene Persönlichkeiten zum Kreis unserer Gönnerinnen und Gönner zählen zu dürfen, die mit Herzblut hinter ihrem Engagement für den Schneesport-Nachwuchs stehen. Sie machen es möglich, dass die Förderbeiträge seit der Gründung
von Passion Schneesport enorm zugenommen haben», so Annalisa Gerber, Vizepräsidentin der Stiftung und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss-Ski. Gleichzeitig, so die Emmentalerin, sei es aber auch überaus wichtig, laufend neue Gönnerinnen und Gönner, die sich für die Schneesport-Jugend einsetzen wollen, für die Stiftung zu gewinnen. «Finanzielle Hürden sollen keine sportlichen Träume zerstören. Nur zusammen mit unseren Gönnern und Partnern ist es uns möglich, das Engagement für die Förderung des Schneesport-Nachwuchses von Jahr zu Jahr auszubauen. Die finanziellen Aufwendungen, die nötig sind, um Schneesport schon in sehr jungen Jahren ambitioniert zu betreiben, werden laufend grösser.»
Wer sich als Gönnerin oder Gönner für die Stiftung Passion Schneesport engagiert, erhält mehrmals jährlich privilegierten Zugang zu herausragenden Schneesport-Erlebnissen. Der beliebteste Anlass ist jeweils der Ski-Weltcup am Chuenisbärgli in Adelboden, dem im
vergangenen Jahr rund 70 Personen beiwohnten. Zu den wiederkehrenden Events gehören auch die Swiss-Ski Night sowie die Golf Charity.
… und hochdekorierte Botschafterinnen und Botschafter
Unterstützung bei der Generierung zusätzlicher finanzieller Mittel erhält der achtköpfige Stiftungsrat durch namhafte Botschafterinnen und Botschafter, die insgesamt 23 Olympia- sowie 45 WMMedaillen auf sich vereinen. Neben den viermaligen Olympiasiegern Simon Ammann und Dario Cologna sowie der zweimaligen Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami gehören elf weitere aktuelle und ehemalige Athletinnen und Athleten dem Botschafter-Team an. Jüngstes Mitglied ist Franjo von Allmen, der bis 2023 selbst von der Stiftung finanziell unterstützt wurde. «Ich und meine Familie sind der Stiftung Passion Schneesport enorm dankbar. Ohne deren finanzielle
Stiftungsrat
Urs Wietlisbach (Präsident), Co-Founder Partners Group
Annalisa Gerber (Vizepräsidentin), Leiterin Relationship & Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss-Ski
Stéphane Bonvin, Founder Investis Group
Michael Müller, CEO Valora
Marc Maurer, ehem. Co-CEO On
Corine Blesi, Managing Director NZZ Connect
Didier Cuche, Markenbotschafter und Förderer
Diego Züger, CEO Commercial von Swiss-Ski
Unterstützung wäre mein Aufstieg an die Weltspitze kaum möglich gewesen», so der Abfahrts-Weltmeister von 2025. «Mit der wertvollen Unterstützung werden Träume von vielen jungen, schneesportbegeisterten Menschen gestärkt.»
Seit 2015 hält die Stiftung Passion Schneesport sportliche Visionen von ambitionierten und talentierten Jugendlichen am Leben. Rund 450 verschiedene Athletinnen und Athleten wurden bislang (über mehrere Jahre) zwecks Ausübung ihrer sportlichen Passion finanziell unterstützt. Mit der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im kommenden Februar in Norditalien oder an einer der Weltmeisterschaften im darauffolgenden Jahr in Crans-Montana (Ski Alpin), Falun (Ski Nordisch) oder im Montafon (Ski Freestyle/Snowboard) werden einige von ihnen ein grosses Ziel demnächst verwirklichen –und die Erfolgsstory von «Passion Schneesport» um zusätzliche grossartige Kapitel erweitern.
Text: Roman Eberle
www.passionschneesport.ch
Tel.-Nr.: 031 950 61 35

Seit mehr als 55 Jahren begleitet AMAG/Audi Schweiz den Schweizerischen Skiverband Swiss-Ski auf seinem Weg an die Wintersport-Spitze. Höchste Zeit die aktuelle Ski-Nation Nummer Eins mit einem Sondermodell zu feiern. Der Audi Q4 45 etron quattro «Edition Swiss-Ski» beeindruckt nicht nur mit einer besonders sportlichen Ausstrahlung und Ausstattung - samt hochwertiger Integration des Swiss-Ski Logos an der C-Säule, roten Ziernähten und einer tangoroten Schlüsselblende, sondern sorgt auch dank Allrad-Antrieb, einer Reichweite von bis zu 518 km und einer noch schnelleren Ladeleistung für ein sicheres Vorwärtskommen bei Schnee und Eis.
Audi und Swiss-Ski verbindet eine lange Tradition der Präzision, Zuverlässigkeit und des technischen Fortschritts. Beide stehen für höchste Qualitätsstandards, die nicht nur auf den Strassen, sondern auch in den Bergen zu spüren sind. Mit seinem hervorragenden Platzangebot und seinem schlanken Wendekreis, hat der Audi Q4 e-tron quattro bereits grosses Aufsehen erregt. Mit der Sonderedition «Swiss-Ski» bietet Audi eine Variante, die nicht nur durch ihr sportliches Design, sondern auch durch ihre enge Verbundenheit mit dem Schweizer Wintersport und den charakteristischen Werten der Marke Audi überzeugt.
Allradantrieb und Schweizer Präzision
Das Sondermodell basiert auf dem Audi Q4 45 e-tron quattro und überzeugt bereits in der Basis mit seinem fortschrittlichen AllradAntrieb quattro. Dieser sorgt nicht nur für

Schlüsselblende tangorot

herausragende Fahrstabilität und Sicherheit auf verschneiten Strassen, sondern spiegelt auch die enge Verbindung zum Schweizerischen Skiverband wider, wo Präzision und Perfektion über Erfolg und Leistung entscheiden. Aber auch in Sachen Technologie lässt die «Edition Swiss-Ski» keine Wünsche offen. Mit fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen, einem intuitiven Infotainment-System und einem beeindruckenden Head-up-Display mit Augmented Reality, ist der Q4 e-tron quattro bestens für jede Herausforderung gerüstet –sei es auf der Anreise über verschneite Bergpässe oder für die Fahrt ins Tal nach einem langen Skitag.
Sportlichkeit trifft alpine Tradition
Als einer der meistverkauften ElektroSUVs der Schweiz überzeugt der Audi Q4 45 etron quattro aber nicht nur technologisch, sondern auch mit seinem modernen Elektroantrieb. Mit bis zu 518 km Reichweite nach WLTP und einer elektrischen Maximalleistung von 210 kW (286 PS) gibt sich der schicke Stromer nicht nur sportlich - er ist es auch. Eine Sportlichkeit, die sich auch in der gesteigerten Ladeleistung von 175 kW widerspiegelt – in 28 Minuten lädt die «Edition Swiss-Ski» von 10 auf 80 %.

Sportsitze mit roten Ziernähten
Exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale der «Edition Swiss-Ski»
Optisch setzt der neue Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition Swiss-Ski» klare Akzente. Im Innenraum begeistern hochwertige Materialien und Microfaser Dinamica-Sportsitze mit roten Ziernähten – perfekt für lange Fahrten durch winterliche Landschaften. Die «Kristallkugel» sind die exklusiven tangoroten Schlüsselblenden.
Und weil das noch immer nicht genug ist, zahlt Audi pro verkauftes Fahrzeug «Edition Swiss-Ski» CHF 200.- in die Nachwuchsförderung Ski Alpin von Swiss-Ski ein, um den nachhaltigen Erfolg zwischen Audi und SwissSki zu untermauern.
Kurzum: Mit dem Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition Swiss-Ski» setzt Audi ein klares Zeichen: Der Winter kann kommen – und mit ihm ein Fahrzeug, das in den Alpen ebenso zu Hause ist, wie auf den Strassen der Stadt. Der Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition SwissSki» kostet CHF 65'200.- und als Sportback CHF 67'150.-
Mehr Informationen auf www.audi.ch
Audi Schweiz, als offizieller Fahrzeugpartner des Schweizer Skiverbandes, wünscht den Ski Alpin Athletinnen und Athleten für die Weltcup-Saison 2025/2026 viel Erfolg und allezeit eine sichere Fahrt.
Wir freuen uns auf unvergessliche Gänsehautmomente - auf alpinen Spitzenskisport!
Urs Lehmann hat Swiss-Ski während 19 Präsidiumsjahren geprägt wie niemand vor ihm. Eine Würdigung zum Abschied.
«Ein bisschen Bayern München bei Swiss-Ski» – so titelte der «Tages-Anzeiger», als Urs Lehmann im August 2006 ins Präsidium gewählt wurde. Bayern München, der Fussballclub, den die einstigen Stars Franz Beckenbauer, Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zum Weltverein geformt hatten. Urs Lehmann, damals erst 37-jährig und bekannt als Abfahrtsweltmeister von 1993, der erste frühere Spitzenathlet im obersten Skiverbandsgremium.
Die Erinnerungen an die medaillenlosen Ski-Alpin-Weltmeisterschaften 2005 in Bormio, diesen Tiefpunkt einer schmachvollen Saison, waren noch frisch. Und dann kam Urs, der zuvor als lautstarker Verbandskritiker aufgefallen war, und sprach von der Trophäenfabrik Bayern München. Der Ton war gesetzt.
Immer an den Besten orientiert
Spätestens mit der Wahl ins Präsidentenamt im Jahr 2008 sagte Urs Lehmann einem Giganten den Kampf an. Nicht dem FC Bayern, sondern dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), nicht Kaiser Franz, sondern «Liftkaiser»
Peter «Schröcksi» Schröcksnadel, dem schier allmächtigen ÖSV-Präsidenten.
Die Schweizer Alpinen hatten sich zwar einigermassen vom Debakel im Bormio-Winter erholt, aber 2007/08 halt doch nicht einmal halb so viele Weltcup-Punkte wie die dominante ÖSVArmada gewonnen.
Urs hat sich immer an den Besten orientiert. Und so gehörte ein Anruf bei Schröcksnadel zu seinen ersten Amtshandlungen. «Ich fuhr zu ihm, wir gingen essen», erzählte er mir in einem der vielen Interviews, die ich als Journalist mit ihm führte. «Ich sagte, ich wolle von ihm lernen. Und er sagte: ‹Lehmann, du musst schauen, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Weil es nichts Besseres gibt für den Skisport als Zweikämpfe zwischen Österreich und der Schweiz.›»
Schon den Athleten Urs Lehmann hatte ein Österreicher geprägt: Karl Frehsner, der «eiserne Karl». Urs wurde als Skirennfahrer in den achtziger Jahren sozialisiert, als sich die Schweiz in einem Erfolgsrausch befand und Österreich phasenweise an der Dominanz der Erzrivalen zu verzweifeln drohte. Karl Frehsner war das Trainergesicht jener Epoche. An den triumphalen Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana, dem Höhepunkt in der Schweizer Skigeschichte, kam Urs als Vorfahrer zum Einsatz; wenige Wochen später wurde er Abfahrtsweltmeister bei den Junioren.




Frehsner war auch der Stratege hinter Urs' «richtigem» WM-Titel sechs Jahre später in Morioka. Er hatte früh erkannt, dass die Piste in Japan bestens auf die Qualitäten des begnadeten Gleiters Lehmann zugeschnitten war. Als Frehsner den damaligen SSV 1991 verliess, war das Fundament für den Coup gelegt. Urs hat sich oft das wenig schmeichelhafte Attribut «Zufallsweltmeister» anhören müssen. Es ist Ausdruck eines grossen Missverständnisses, denn seinem einzigen Sieg und Podestplatz im Feld der Weltbesten lag ein brillanter Plan von Frehsner und der Skifirma Salomon zugrunde, den Urs am Tag X brillant umzusetzen vermochte.
Kein Mandat – eine Mission!
Der SSV in der Ära Frehsner, der ÖSV in der Ära Schröcksnadel – diese Idealvorstellungen hatte Urs im Kopf, als er sich aufmachte, Swiss-Ski als Präsident zurück an die Spitze zu führen. Seine Vorgänger waren Politiker gewesen, Nationalräte, die das Prestigeamt im Skiverband eher repräsentierend als gestaltend interpretierten. Urs stand für einen Stilbruch, den viele für überfällig hielten. Da kam einer, der mit der Präsidentschaft kein Mandat verband, sondern eine Mission. Am Tag seiner Wahl sagte Urs zu seinem Rollenverständnis: «Mich interessiert die Abgrenzung strategisch und operativ überhaupt nicht.» Da sprach ein Macher, der einige Jahre zuvor noch Chef Leistungssport hatte werden wollen.
Urs wurde in den ersten Jahren immer wieder dafür kritisiert, sich viel zu häufig ins Tagesgeschäft einzumischen – auch von mir. Swiss-Ski verschliess nach seiner Wahl vier Direktoren, ehe mit Markus Wolf ein operativer Chef installiert wurde, der selber zu einer starken Figur aufsteigen konnte – je nach Sichtweise neben oder unter der Überfigur Lehmann.
Swiss-Ski war in Urs' ersten Präsidentschaftsjahren durchaus erfolgreich, Vancouver 2010 mit den sechs Olympiasiegen (zweimal Simon Ammann, Didier Défago, Carlo Janka, Dario Cologna und
Mike Schmid) ragt aus dieser Zeit heraus. Doch personell rumpelte es immer wieder – «Knall bei Swiss-Ski» gehörte auf den Sportredaktionen zum SchlagzeilenStehsatz. Was manchmal vergessen ging: Zumindest der Direktorensessel war schon vor Urs' Amtsantritt ein Schleudersitz, der durchschnittlich im Zweijahresrhythmus betätigt wurde.
«Lehmann und der Scherbenhaufen»
Urs spürte immer wieder steife Brisen im Gesicht. Richtig ungemütlich wurde es in der Saison 2012/13, als das alpine Männerteam sportlich abstürzte und die Ski-Krise zu einem stehenden Begriff wurde. Didier Cuche zurückgetreten, Beat Feuz verletzt, die Materialumstellung verpatzt, die wichtigsten operativen Führungspersonen überfordert –und mittendrin Urs, der Krisenmanager,
Und wenn er einmal austeilte, so war das nichts im Vergleich zu dem, was er als Prellbock alles einsteckte.
im Kreuzfeuer der Kritik. Legendär die Medienkonferenz im Haus des Sports in Ittigen, als der Cheftrainer Osi Inglin die im Stolz verletzte Skination zur Einstimmung auf die Heimrennen im Berner Oberland als «Ski-Entwicklungsland» bezeichnete.
Nie hatte Präsident Lehmann schlechtere Presse. Der «Tages-Anzeiger» titelte am Saisonende: «Der richtige Mann am falschen Ort». Oder: «Lehmann und der Scherbenhaufen». Die «NZZ am Sonntag» schrieb: «Tatsache ist, dass sich bei Swiss Ski einige Leute die Frage stellen, ob

2023 in Méribel: Der Abfahrtsweltmeister von 1993 gratuliert der Abfahrtsweltmeisterin
der Präsident die Probleme lösen kann –oder ob er selber ein Teil des Problems ist. Das sollte auch er sich fragen.» Ein Rücktritt, freiwillig oder unfreiwillig, stand im Raum, zumindest als vage Option.
Urs hat sich auch in solchen Situationen nie verdrückt, sondern ist immer hingestanden. Und wenn er einmal austeilte, so war das nichts im Vergleich zu dem, was er als Prellbock alles einsteckte. Seine Unerschrockenheit und seine Nehmerqualitäten haben mich neben seiner Leidenschaft und seiner Unermüdlichkeit immer am meisten beeindruckt.
Persönlich angreifbar machte er sich damals, weil er etwas gar viele Hüte trug. Er war nicht nur CEO von Similasan und Präsident von Swiss-Ski, sondern auch noch Co-Kommentator bei Eurosport und 50-Prozent-Teilhaber der Agentur GFC, die er 2010 zusammen mit Bruno Kernen, seinem Zimmerkollegen von Morioka 1993, übernommen hatte und die zahlreiche Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten managte. Für Peter
Schröcksnadel war es selbstverständlich, die ÖSV-Stars wie Hermann Maier selber zu vermarkten. Doch in der einstigen Monarchie schert man sich wohl einfach weniger um Machtkonzentrationen als in der Schweiz mit ihrer basisdemokratischen Prägung.
Der Krisenwinter 2012/2013 ging durch Mark und Bein wie die Nullnummer von Bormio. Doch Swiss-Ski sollte sich rasch davon erholen. Die sehr erfolgreichen Heim-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz stehen als Startpunkt für alpine Jubeljahre, die bis heute anhalten. Vor jenen Titelkämpfen hatte Urs noch moniert: «Für die Mittel, die wir den Teams zur Verfügung stellen, kommt zu wenig zurück. Punkt.» Mit dieser Durchsage unterstrich er, dass die fulminante wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes der sportlichen noch voraus war. Lehmann, der Similasan-CEO und Doktor
Swiss-Ski von 2006/07 bis 2024/25
Olympische Spiele: 45 Medaillen (24 Gold/9 Silber/12 Bronze)
WM-Medaillen: 205 (75/68/62), davon 68 im Telemark und 57 im Ski Alpin
Weltcup-Kristallkugeln: 173, davon 77 im Telemark und 41 im Ski Alpin
Umsatzentwicklung
2005/06: 27 Mio. Franken 2024/25: 88 Mio. Franken (ohne Tochtergesellschaften)
der Ökonomie, hatte Swiss-Ski als Mann der Wirtschaft schon weitergebracht als Urs, der Abfahrtsweltmeister von Morioka, als Mann des Sports.
Doch das Ungleichgewicht zwischen finanziellem Aufwand und sportlichem Ertrag sollte ausgemerzt sein. 2019/20 gewannen die Alpinen erstmals nach 30 österreichischen Triumphen am Stück wieder die Weltcup-Nationenwertung. Zuletzt war Swiss-Ski zum fünften Mal innert sechs Jahren die Nummer 1 im grossen Ländervergleich. Und an allen Weltmeisterschaften 2025, von Ski Alpin über Freestyle und Ski Nordisch bis hin zu Biathlon, so erfolgreich wie noch gar nie oder fast nie.
Sportlicher Erfolg auf der ganzen Linie – das hat für Urs einen ganz besonderen Wert. Denn zu seiner Hinterlassenschaft gehört, dass er, der Alpine, stets ein Präsident für alle Swiss-SkiSportarten war, dass Swiss-Ski unter seiner Ägide alle gestützt und gefördert hat. Die eindrückliche Bilanz über alle elf Sparten hinweg ist oft etwas untergegangen – in guten wie in schlechten Ski-Alpin-Zeiten.
Jetzt ist Urs weitergezogen, als CEO zum Weltverband FIS und damit zu Johan Eliasch, dem er 2021 in der FIS-Präsidentschaftswahl unterlegen war. Seither kreuzten die beiden das eine oder andere Mal die Klingen, aber zu Beginn des Wahlkampfs hatte Urs einmal gesagt: «Eliasch ist ein guter Typ mit guten Ansichten, wir kennen uns schon lange.» Man darf gespannt sein, ob die FIS in den nächsten Jahren Swiss-Ski-like wird. Und wie Lehmannlike Swiss-Ski ohne ihn bleibt.
Als ein NZZ-Kollege und ich Urs 2017 einmal fragten, ob er ein Idealbild habe, wie Swiss-Ski bei seinem Abgang dereinst aussehen soll, antwortete er: «Wirtschaftlich und strukturell solid – in meiner Funktion ist dieser Aspekt am wichtigsten.» Das war für einmal
Understatement, so zur Abwechslung. Heute darf man Urs attestieren, dass er Swiss-Ski geprägt hat wie Arno Del Curto den HC Davos, ja vielleicht sogar wie Uli Hoeness den FC Bayern München.
Was sein grösstes Vermächtnis wäre?
Wenn die Verbandsgeschichte von SwissSki einmal zeigen sollte, dass das Ende der Ära Urs Lehmann gar kein Ende einer Ära war. Weil die Erfolgsserie noch jahrelang weiterging.
Text: Philipp Bärtsch
Der Autor hat die gesamte Präsidentschaft von Urs Lehmann eng begleitet, bis 2023 als Sportjournalist für die Sportinformation Si, den «Blick» und die «Neue Zürcher Zeitung», seither als Mitarbeiter von Swiss-Ski.

Mission erfüllt: Unter Urs Lehmann gewinnt Swiss-Ski endlich wieder die Nationenwertung im Ski Alpin - wie hier 2021 in Lenzerheide.

Ein starkes Team braucht starke Partner. Helvetia unterstützt euch auf eurem Weg zu sportlichen Höchstleistungen und bietet Schutz für alle Lebenslagen. Deine Vorteile:
Bequeme Abwicklung deiner Anliegen durch unser engagiertes Team 25% Rabatt auf Versicherungsprodukte
Attraktive Vorteile auf Vorsorgeprodukte (3b) Weitere exklusive Zusatzleistungen
In Kooperation mit

Leistungssport und berufliche Ausbildung zu vereinen, ist eine Herausforderung. Swiss-Ski will seinen Athletinnen und Athleten neue Perspektiven bieten – zum Beispiel Matthias Iten, der als Sportler ein Praktikum beim Verband macht.
Wer Spitzensport macht, meistert parallel dazu oft auch eine schulische oder berufliche Ausbildung – eine anspruchsvolle Doppelbelastung. Trainings, Wettkämpfe und Reisen dominieren den Alltag, während die Zukunftsperspektiven oft ungewiss sind. Denn eine Sportkarriere ist voller Chancen – kann aber auch gnadenlos und unberechenbar sein und abrupt enden. Für Matthias Iten ist daran momentan kaum zu denken. Er ist 26 Jahre jung, gesund und meistert
genau diese Doppelbelastung: Als Skirennfahrer und erster Athlet in einem Praktikum bei Swiss-Ski geht er neue Wege –und könnte damit eine Tür für viele weitere öffnen.
Matthias Iten aus Unterägeri (ZG) ist Slalom-Spezialist und Mitglied des BKaders. An der Sportmittelschule Engelberg absolvierte er seine kaufmännische Grundausbildung, doch für den Abschluss fehlt noch das zweijährige Praktikum –eine Pflicht, die sich als etwas komplizierter als erwartet erwiesen hat.
Iten suchte in seiner Region nach einer passenden Stelle – bei der Gemeinde, bei Sponsoren, doch es folgte Absage auf Absage. Erst der Tipp, sich an einen Betrieb mit Bezug zum Skisport zu wenden,
brachte die Wende – und führte ihn direkt zu Swiss-Ski. Seit August 2024 ist er nun der erste Athlet, der sein Praktikum beim Verband absolviert.
Ein herkömmliches Praktikum wäre mit Itens straffem Trainings- und Wettkampfplan kaum vereinbar, feste Arbeitszeiten oder Schalterdienst undenkbar. Bei Swiss-Ski ist das anders: Sein 100-ProzentPensum ist auf zwei Jahre verteilt, sodass er intensive Phasen im Sport überbrücken und in ruhigeren Zeiten mehr arbeiten kann – eine klare Sommer-Winter-Aufteilung. «Hier wissen sie, was es bedeutet, wenn ich unterwegs bin – ich muss mich nicht erklären», sagt Iten.
Swiss-Ski bietet eine vierjährige KVLehre an, die bisher vor allem von YBFussballerinnen und -Fussballern absolviert wurde. Während die Lernenden normalerweise verschiedene Abteilungen durchlaufen, ist bei Matthias Iten Fingerspitzengefühl gefragt. HR und das Team-Management kamen nicht infrage, da er dort zu nahe an internen Informationen wäre. Stattdessen wurde er
in der Abteilung Ausbildung eingesetzt – ein Bereich, in dem er mit Trainerinnen und Trainern arbeitet, aber keine vertraulichen Daten einsehen muss. Zudem fällt die arbeitsintensivste Phase genau in Itens wettkampffreie Zeit, was für beide Seiten ideal ist.
Voraussichtlich wird Iten auch in den Bereichen Sponsoring und Finanzen Erfahrungen sammeln. «Wir gestalten sein Praktikum dynamisch – so, wie es für ihn als Mensch und Athlet passt und so, wie es für uns Sinn macht», sagt Itens Berufsbildnerin Ursina Wittwer.
Erfahrung aus der Athleten-Perspektive
Während der Saison ist Iten nur vereinzelt im Büro, nutzt aber freie Tage, um Aufgaben zu erledigen – oft auch von unterwegs. «Ich kann meinen Tag selbst gestalten, das macht es einfacher.» Matthias Iten bringt nicht nur kaufmännische Fähigkeiten mit, sondern auch eine wertvolle Innensicht als Athlet. Er kennt die Strukturen von Swiss-Ski, weiss, was für Sportlerinnen und Sportler wichtig ist. «Das ist enorm wertvoll», sagt Therese Berger, Verantwortliche für das Ausbildungsmanagement. Zudem bringt er Eigenschaften mit, die ihn perfekt für diese Rolle machen: Ehrgeiz, Selbstständigkeit, Verlässlichkeit und Organisationstalent.
Dass Swiss-Ski mit Matthias Iten erstmals einen eigenen Athleten als Praktikanten beschäftigt, ist zwar zufällig entstanden, entpuppt sich aber als Vorteil. Das zeigte sich bei einem seiner ersten Projekte: Am Grand Prix Migros erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Geschenk – letztes Jahr ein Resistance-Band. Iten entwickelte die passenden Übungen und drehte ein Video dazu, teils sogar während des Gletschertrainings. Er kennt die Bedeutung eines solchen Geschenks aus eigener Erfahrung – auch wenn seine Zeit als GPM-Fahrer schon eine Weile zurückliegt.
Auch für Ursina Wittwer, seine Ausbildnerin, ist klar: «Wer, wenn nicht wir, sollte diesen Athletinnen und Athleten eine Chance geben?» Der Erfolg des

Iten meistert die Doppelbelastung aus Leistungssport und Ausbildung. Bild: Baqueira Beret
«Wer, wenn nicht Swiss-Ski, sollte diesen Athletinnen und Athleten eine Chance geben?»
Ursina Wittwer
Praktikums spricht sich bereits herum –weitere Sportlerinnen und Sportler haben sich beworben, bislang jedoch noch keine aus den eigenen Reihen.
Itens Stelle ist bisher eine Einzelfalllösung, doch das könnte sich ändern. Erst nach Abschluss seines Praktikums wird entschieden, ob daraus ein dauerhaftes Angebot entsteht. Denkbar wäre, alle zwei Jahre eine Praktikumsstelle speziell für Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten zu schaffen. Ein klares Zeichen: «Wir setzen uns auch ausserhalb des Sports für sie ein», sagt Wittwer.
Iten selbst denkt bereits über die Zeit nach seiner Karriere nach – vorsichtshalber. Falls es mit dem Skifahren nicht dauerhaft klappen sollte, interessiert ihn ein Beruf im Sport, vielleicht als Lehrer oder Trainer. Die Arbeit in der Abteilung Ausbildung hat ihn inspiriert. Doch vorerst bleibt er Skirennfahrer –und Athleten-Praktikant Nummer eins bei Swiss-Ski.
Text: Lia Näpflin
1 Grosse Momente abseits der Piste
Nach den Erfolgen im Winter feierten einige Athletinnen und Athleten in den vergangenen Monaten auch privat grosse Momente. Das Snowboard-Alpin-Paar Ladina und Dario Caviezel gab sich bereits im vergangenen Jahr zivil das Ja-Wort und feierte diesen Sommer nun sein grosses Fest. Slalomfahrer Marc Rochat heiratete ebenfalls – und wurde im Frühling Vater. Auch der Schweizer Riesenslalom-Meister Livio Simonet trat vor den Altar. Und zwei weitere feiern die Liebe mit Verlobungsringen: Sowohl der Technikspezialist Luca Aerni als auch die Speedspezialistin Joana Hählen. (LNN)


2 Swiss-Ski fördert Inklusion im Schneesport
Damit alle Schneesport erleben können, unterstützt Swiss-Ski seine Clubs und Mitglieder in ihrem Engagement für mehr Offenheit, Vielfalt und Teilhabe. Vom Januar 2025 bis Dezember 2026 beteiligt sich Swiss-Ski an Aus- und Weiterbildungskosten sowie an Coachings im Bereich Inklusion im Schneesport. Unterstützt werden unter anderem die J+S-Zusatzausbildung «Sport und Handicap» sowie Kurse von PluSport und der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. Pro Kurs übernimmt der Verband bis zu 200 Franken – das deckt je nach Angebot einen grossen Teil oder sogar den ganzen Kursbetrag ab. Ziel ist es, Hürden abzubauen und Schneesport für alle zugänglicher zu machen. (LNN)
Weitere Infos gibt's hier
3 Nachhaltigkeit lernen im Schneesport
Der Klimawandel stellt den Schneesport vor Herausforderungen: weniger Schneetage, kürzere Winter und steigende Energiekosten. Damit gerade junge Sportlerinnen und Sportler lernen, wie sie mit ihrem Verhalten etwas verändern können, haben die World Snowboard Federation (WSF) und SwissSki gemeinsam das EU-geförderte Projekt «ZERO – Zero Emission Rides» umgesetzt. Beteiligt sind neben der Schweiz auch Verbände aus Ländern wie Deutschland, Finnland, Portugal oder Belgien. Ziel ist es, Umweltbewusstsein zu fördern und nachhaltiges Handeln im Schneesport fest zu verankern.
Kernstück ist ein interaktiver Online-Kurs für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren – kostenlos zugänglich und altersgerecht aufbereitet. Er vermittelt Wissen zum Klimawandel, zu seinen Folgen für den Schneesport und zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, vom nachhaltigen Reisen bis zum bewussten Umgang mit Ausrüstung. Ergänzend wurde ein kostenloses «Print-&-Play-Spiel» entwickelt, das JO’s und Schulen unkompliziert einsetzen können – als Einstieg oder zur Vertiefung des Gelernten. (LNN)
Hier geht's zum Online-Kurs

3 Freestyle-Park am Schilthorn geht in die zweite Runde
Bisher bereiteten sich die Freestyle-Teams von Swiss-Ski meist in Übersee oder Österreich auf die neue Saison vor. Heuer können die Athletinnen und Athleten erneut «zu Hause» bleiben: Zum zweiten Mal haben die Schilthornbahnen in Mürren Ende September einen kompletten Freestyle-Park eröffnet – möglich dank des eingelagerten Schnees vom letzten Winter.
Das Engital auf Birg (2’500 m ü. M.) bietet ideale Bedingungen, da es fast ganzjährig im Schatten liegt. Neu steht neben dem bisherigen Setup ein zweiter Lift zur Verfügung, was die Kapazität verdoppelt. Auch die Sprünge sind grösser als im Vorjahr. Kein Wunder, dass sich neben den Schweizer Teams inzwischen auch andere Nationalteams angemeldet haben, um hier zu trainieren.
Der Park umfasst eine S/M- und L-Line mit Rails und Sprüngen von 8 bis 16 Metern – für alle Levels geeignet. Auch Amateurinnen und Amateure können sich anmelden, die Plätze sind jedoch begrenzt. Die Session dauert bis zum 25. Oktober 2025. (LNN)

Der frühere Trainer von «Gold-Vreni» Schneider ist am 28. August verstorben. Paul-André Dubosson, bekannt als «Duboss», starb im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Walliser führte als Chef der Schweizer Technikerinnen Vreni Schneider in den 90er-Jahren zu ihren grössten Erfolgen. «Ich hatte sensationelle Trainer – und Duboss war der beste», sagt Vreni Schneider im Gespräch mit Swiss-Ski. Nach seinem Rückzug aus dem Ski-Weltcup wirkte Dubosson als Sportdirektor beim FC Sion und später als Dopingkontrolleur. (PHB)
Hier geht es zum Tippspiel
5 Neues Tippspiel: Wer gewinnt?
Für alle, die sowieso schon wissen, wer das jeweilige Skirennen gewinnen wird, gibt es jetzt die Gelegenheit, das eigene Gespür unter Beweis zu stellen. In der Swiss-Ski App ist das neue Tippspiel «Tipp Champion» verfügbar. Getippt werden kann auf alle alpinen Weltcup-Rennen – entweder alleine oder in eigenen Tipp-Gruppen. Neben den Resultaten pro Rennen lassen sich auch Prognosen für den Gesamtweltcup und die Disziplinenwertungen abgeben. Eine Rangliste zeigt während der ganzen Saison, wer mit seinen Tipps die Nase vorne hat. Für die besten Tipperinnen und Tipper gibt es zudem exklusive Preise zu gewinnen. (LNN)

Crans-Montana 1987
Unvergesslich. Unerzählt.
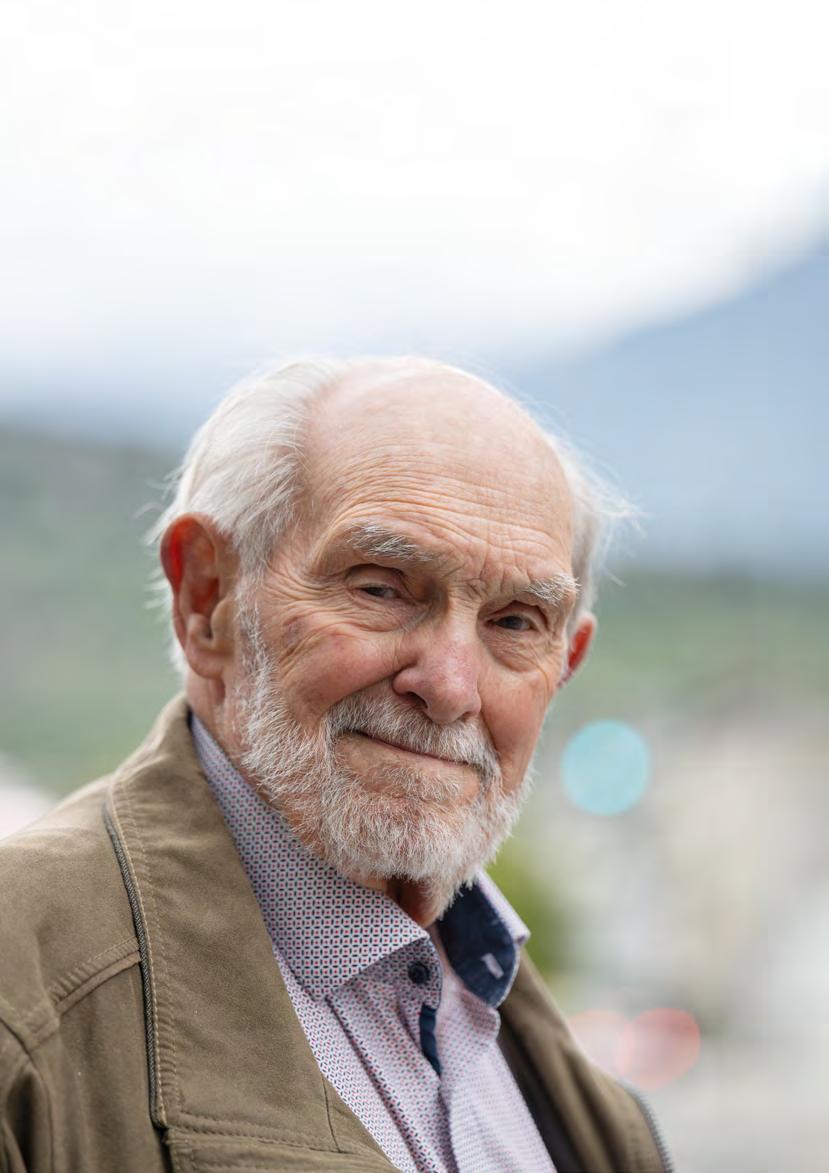
Georges Zermatten, 84, war 1987 der Mann hinter der WM-Abfahrt der Männer – als Pistenchef rollte er den weissen Teppich für die Schweizer Festspiele aus. Bild: Stephan Bögli

Den Schweizer Männern gelingt 1987 in Crans-Montana eine WM-Abfahrt für die Ewigkeit. Zum Auftakt unserer Serie treffen wir Georges Zermatten (84), den Mann, der Peter Müller und Co. als Pistenchef die weisse Bühne hergerichtet hat.
Diese Goldfahrten! Diese Euphorie! Diese historischen Tage!
Georges Zermatten schiebt die Tasse Hagebuttentee zur Seite. «Aussergewöhnlich…», fängt er an, «ja, das wars auf jeden Fall. Ich war damals mittendrin und nahm das Ausmass dieser Erfolgsgeschichte nicht sofort wahr.»
Der 84-Jährige sitzt in einem Café gleich neben dem Bahnhof von Sitten. Die paar hundert Meter von seiner Wohnung im Zentrum der Stadt hat er zu Fuss zurückgelegt. Zermatten ist seit einer Operation 2022 mit Gehhilfen unterwegs und deutet auf die Hüften: «Ich habe künstliche Gelenke.»
Aber deswegen nicht mehr an die frische Luft – kein Thema. Täglich muss er raus, regelmässig trifft er Kollegen, zum Beispiel Jean-Claude Rey, 1987 einer der Pistenverantwortlichen bei den Frauen. Aber in der Regel dauern
solche Begegnungen nicht länger als zwei Stunden. Da dringt der Pragmatiker durch: «Das reicht. In dieser Zeit ist alles gesagt.»
Dabei hat der Senior ziemlich viel Spannendes zu erzählen, vor allem aus seinem Leben. Zermatten betont zwar, dass er sich lieber zurückhalte und das Scheinwerferlicht meide. Aber er verweigert aus Respekt niemandem die Auskunft. Erst recht nicht, wenn sich im Gespräch vieles um den Skisport dreht. Das ist seine Welt, das ist seine Passion.
1987, als besagte Goldfahrten stattfanden, Euphorie ausbrach und das Schweizer Alpinteam an den Heim-Weltmeisterschaften in Crans-Montana Geschichte schrieb, meisterte Georges Zermatten eine anspruchsvolle Aufgabe. Als Pistenchef trug er die Verantwortung für die Männerabfahrt. Die Strecke war in sechs Sektoren unterteilt, und für jeden einzelnen Abschnitt war jemand zuständig. Zermatten hatte die Aufgabe, den Überblick zu behalten und die sechs «Sous-Chefs» zu führen.
Zudem konnte er auf rund 50 Soldaten zählen, die täglich unter seiner Anleitung im Einsatz standen. Für den Bau des Sprungs «Cry d’Er» setzte er eine ganze Kompanie ein.
Der gebürtige Unterwalliser, aufgewachsen in Vérossaz, kennt sich aus mit Führungsrollen. Im Militär hatte er sich zum Oberstleutnant hochgearbeitet. In seiner beruflichen Karriere war er im kantonalen Zeughaus zu einer wahren Instanz geworden. Er brachte es bis zu seiner Pensionierung auf mehr als 42 Jahre beim selben Arbeitgeber. Und als ausgebildeter Bergführer hatte er seine Seilschaften auf verschiedene Berggipfel geführt, darunter auch das Matterhorn.
Immer die Distanz gewahrt – aus gutem Grund
Zermatten fuhr in seiner Jugend Skirennen und etablierte sich später in der Welt der Funktionäre. 1974 stieg er zum FIS-Delegierten auf, der weit herumkam, manchmal Ferien opferte, vorwiegend aber an den Wochenenden zu den Rennen in Europa aufbrach. Vor Ort galt er als Mann, der sich nicht beeinflussen lässt. Ihm war es ein Anliegen, Distanz zu wahren, auch
zu prominenten Athletinnen und Athleten. «Ich wollte mir nie den Vorwurf anhören müssen, durch einen Entscheid jemanden zu bevorteilen», sagt Zermatten. «Darum verzichtete ich auch darauf, zusammen mit den Sportlern nach dem Rennen ein Bier zu trinken.»
Korrekt und gleich sein mit allen, das war stets sein Anspruch. Sei es als FIS-Delegierter oder 1987 an der WM als Pistenchef. Georges Zermatten war keiner, der an vorderster Front jubelte, als die Abfahrt der Männer eine Schweizer Machtdemonstration wurde. Peter Müller, Pirmin Zurbriggen, Karl Alpiger und Franz Heinzer belegen die Ränge 1 bis 4. «Schön», dachte er sich. Und ja, natürlich freute er sich für die Schweizer, auch für die Veranstalter.
Doch statt zu feiern, zog er sich mit Jean-Claude Rey in dessen Chalet nahe der Piste zurück, in der sie gemeinsam mehrere Wochen nächtigten. Sie hörten den Partylärm der Massen, nahmen aber ihre Rolle als Dienstleister mit aller Konsequenz wahr: Arbeit statt Vergnügen – das zogen er und Kollege Rey eisern durch.
«Meine hundertprozentige Konzentration gehörte der Piste», erklärt er. Glücklich war er, dass die Piste hielt, eine Strecke, die nicht mit Kunstschnee präpariert werden konnte. Und Wasser wurde nur in überschaubarem Mass eingesetzt. «Zum einen mangelte es an der technischen Infrastruktur», sagt Georges Zermatten, «zum andern war es – anders als heute – nicht üblich, auf Wasser zu setzen. Wir beschränkten uns darauf, nur stellenweise zu wässern, zum Beispiel in engen Kurven.»

Ein Tag, an dem einfach alles passte – vom Himmel bis zur Strecke, gekrönt vom Vierfach-Triumph der Schweizer.
«Ein Chef muss auch eine Lokomotive sein»
Zermatten trug zwar die Verantwortung und gab den Soldaten Anweisungen. Aber genauso packte er selber an. «Ein Chef muss auch eine Lokomotive sein», sagt er, «zuerst kam immer

Schaufeln, stampfen, schuften – drei Wochen lang, bis die Abfahrtspiste bereit war für den WM-Showdown.
die Arbeit, erst danach der Genuss.» Drei Wochen Vorbereitung. Drei Wochen, in denen Georges Zermatten alles andere ausblendete. Sein einziges Ziel: perfekte Verhältnisse für die perfekte Abfahrt. Die Gewissenhaftigkeit, mit der er seine Aufträge ausführte, ist ein Markenzeichen von ihm. Während der Spezial- und Kombinationsabfahrt positionierte er sich unterhalb des Sprungs «Cry d’Er» – und atmete auf, als alles so gelaufen war, wie er sich das vorgestellt hatte.
«Bei Georges wussten alle: Er hat es im Griff», sagt Hugo Steinegger, 1987 der Medienchef der Weltmeisterschaften. Nach der WM kreuzten sich die Wege der beiden immer wieder. Steinegger kümmerte sich als Vizepräsident an den Weltcup-Rennen in Crans-Montana zwischen 2008 und 2024 um die Medien und die Werbung –Zermatten gehörte fix zum Team im Rennbüro. Tauchten reglementarische Fragen auf, lieferte Zermatten Antworten. Sofort und ohne im Regelwerk nachschlagen zu müssen. «Er war eine absolute Koryphäe und unser Gewissen», sagt Steinegger, «mit einem solchen Fachmann lässt sich vorzüglich arbeiten.»
Als es 2019 bei der Frauenabfahrt in Crans-Montana zu einem veritablen Zeitmess-Chaos kam, waren zwar auch Georges Zermatten die Hände gebunden. Aber Steinegger erinnert sich, wie der Routinier mit sachlichen Argumenten beruhigend einwirkte und versuchte, Lösungswege aufzuzeigen. Er ist der Mann, der im Hintergrund still an seinem Schreibtisch wirkt, an Sitzungen teilnimmt und sein immenses Wissen einbringt.
Fotos oder
Akkreditierungen – nichts hat er aufbewahrt
Bis 2010 stand Georges Zermatten als FIS-Delegierter im Einsatz, bis 2024 im Rennbüro an Weltcup-Tagen in Crans-Montana. Als das Gehen für ihn anspruchsvoller wurde, liess er sich mit dem Auto bis vors Büro fahren und schaffte es, die Treppe eigenständig hochzulaufen. Zur Last fallen möchte er niemandem.
Jetzt hat er einen Schlussstrich gezogen. Die Vergangenheit hat er im Kopf gespeichert. Fotos, Akkreditierungen, Ausrüstungen von damals – nichts hat er aufbewahrt. «Wofür?», fragt er im Café am Sittener Bahnhof.
Wehmut kommt keine auf, Emotionen zeigt der 84-Jährige keine. Wenn er eine Theateraufführung besuche, klatsche er nur selten. Weil er findet, dass das Ensemble auf der Bühne nur seine Arbeit mache und dafür nicht ständig Lob bekommen müsse. «Oder bekommen Sie das ständig von Ihrem Chef?»
Wenn er vor dem Fernseher sitze, fahre er bei Spitzenleistungen nicht aus der Haut. Seine Frau reagiere emotional, er hingegen sei der Rationale, der auf Details achte, auf die Linienführung der Athletinnen und Athleten oder die Beschaffenheit der Strecke. So hatte er 1987 schon funktioniert: Sachlich, nüchtern, ohne Schnickschnack.
Als das Gespräch zu Ende ist, erzählt Georges Zermatten noch kurz von seinem weiteren Tagesprogramm. Am Computer schaut er sich Skirennen in Chile und Neuseeland an. «Ich bin ein bisschen verrückt, nicht wahr?», fragt er, lächelt, setzt sich die Mütze auf und macht sich an den Gehstöcken auf den Heimweg.
Ein Gang, gezeichnet von unzähligen Arbeitsstunden am Hang – alles für die eine perfekte WM-Abfahrt, die tatsächlich perfekt wurde. Und für all die Weltcup-Rennen danach.
Text: Peter Birrer
Die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana rücken immer näher. In unserer Serie «Crans-Montana 1987: Unvergesslich. Unerzählt.» blicken wir auf die historischen ersten Weltmeisterschaften auf dem Walliser Hochplateau zurück, als das Schweizer Team achtmal Gold und insgesamt 14 Medaillen gewann.
Die fünf WM-Botschafter:innen
Für die Heim-WM kriegt der Veranstalter auch Unterstützung von Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten: Michelle Gisin, Malorie Blanc, Aline Danioth, Franjo von Allmen und Luca Aerni treten als Botschafter:innen auf. Sie begleiten die Vorbereitungen, geben dem Anlass ein Gesicht und tragen dazu bei, die Begeisterung für die Heim-WM in die Skiwelt zu tragen.
Knackig, direkt, persönlich: Im Q&A verraten die fünf, was sie ausmacht und was Crans-Montana für sie bedeutet.
Lernen Sie die Botschafter:innen von Crans Montana 2027 kennen

Die Aussichtsplattform am Hundschopf beim Lauberhornrennen ist mit WLAN von Sunrise ausgerüstet.

Dank zusätzlichen, stationären und temporären Mobilfunkanlagen sorgt Sunrise selbst bei starkem Besucherandrang für zuverlässigen Empfang.

Gabriel Müller, Senior Projektleiter bei Sunrise – seit 16 Jahren im Einsatz für stabile Verbindungen, ob im Tal, auf der Skipiste oder mitten im Eventgeschehen.
Wie kommt eigentlich das Netz auf den Berg?
Wer glaubt, dass die Verbindung für Medien, Sportler, Partner und das OK bei Weltcups einfach so funktioniert, täuscht sich. Dahinter steckt ein hochspezialisiertes Team von Sunrise, das mit Technik, Know-how und einer ordentlichen Portion Abenteuerlust dafür sorgt, dass alles läuft – selbst auf 2000 Metern Höhe.
Einer von ihnen ist Gabriel Müller, Senior Projektleiter bei Sunrise. Im Interview erzählt er, wie er und sein Team die ICT-Infrastruktur für die grössten Schneesportevents der Schweiz bereitstellen – und dabei auch mal mit dem Rucksack voller Router auf Skiern unterwegs sind.
Gabriel, was genau macht ihr bei den Weltcuprennen?
Wir stellen die ICT-Infrastruktur bereit – also die gesamte Informations- und Kommunikationstechnologie, die hinter dem Eventbetrieb steckt. Dazu gehören Internetanschlüsse für das lokale Organisationskomitee, die Presse, TV-Sender und weitere Dienstleister. Neben der reinen Verbindung bauen wir auch lokale Netzwerke auf – sowohl kabelgebundene als auch drahtlose (WLAN). Über diese Netzwerke laufen dann zentrale Prozesse: Zum Beispiel werden Interviews live im TV ausgespielt, Fotos aus dem Pressezentrum direkt in die Redaktion übermittelt und Liveticker mit aktuellen Rennergebnissen versorgt.

Damit das Netz auch für die Besucherinnen und Besucher stabil und zuverlässig funktioniert, analysieren wir im Vorfeld die Mobilfunkabdeckung. Auf Basis unserer Erkenntnisse werden dann temporäre oder sogar dauerhafte Erweiterungen des Mobilfunknetzes umgesetzt.
Wie sieht ein typischer Renntag für dich aus?
Früh aufstehen ist Pflicht – meist sind wir ab 7:00 Uhr vor Ort. Oft erreichen uns noch kurzfristige Wünsche von Veranstaltern oder Medien, die wir gleich am Morgen umsetzen, bevor der Eventbetrieb richtig Fahrt aufnimmt. Während des Events sind wir ständig präsent, denn die Nervosität bei den Beteiligten ist spürbar. Alle wollen, dass alles reibungslos läuft und allein unsere Anwesenheit gibt vielen Sicherheit. Wir überwachen das Netzwerk permanent und greifen bei Problemen sofort ein. Bei grösseren Veranstaltungen sind wir strategisch verteilt – etwa in der Mixed-Zone im Zielbereich oder bei den Produktionswagen
der TV-Sender. Im Medienzentrum sind wir ebenfalls vertreten – dort ist es übrigens schön warm und das Essen ist meistens hervorragend (lacht).
Welche Herausforderungen bringt dein Job mit sich?
Ich bin viel unterwegs, arbeite oft am Wochenende und die Arbeitstage können lang werden. Dazu kommt eine grosse Verantwortung – denn ich weiss: Ein Rennen wird nicht wegen uns verschoben. Das erzeugt natürlich Druck. Aber genau diese Kombination macht den Job für mich besonders spannend.
Welches Projekt hat euch in der Saison 2024/2025 besonders gefordert?
Hier ist definitiv die Biathlon-WM in Lenzerheide zu erwähnen – auch wenn sie streng genommen kein Weltcup war. Wir haben dort zwei 10 GbitLeitungen installiert, 103 WLAN Access Points und 55 Switches verbaut. Zu Spitzenzeiten waren mehrere tausend Nutzer gleichzeitig im Netzwerk – und alles lief stabil. Es war beeindruckend zu
sehen, wie unsere Planung und Technik unter realen Bedingungen einwandfrei funktioniert haben. Solche Einsätze zeigen mir, wie viel wir gemeinsam als Team leisten können – und wie wichtig jedes einzelne Detail ist.
Welche Erfolge konntet ihr in den letzten drei Jahren feiern?
Wir haben ein starkes internes Team aufgebaut – technisch versiert und menschlich absolut verlässlich. In unserer ersten Saison als Hauptpartner von Swiss-Ski 2022/2023 waren einige lokale OKs noch skeptisch. Swisscom hatte den Job zuvor 20 Jahre lang gemacht – da war vieles eingespielt. Wir mussten nicht nur technisch überzeugen, sondern auch Vertrauen aufbauen. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen.
Und dein persönlicher Erfolg?
Dass während eines Rennens noch nie ein Netzausfall passiert ist, freut mich enorm. Es zeigt, dass unsere Vorbereitung und unser Einsatz wirklich etwas bewirken – und darauf bin ich stolz.
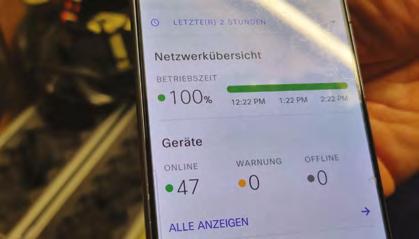
App kann das Team das Netzwerk kontrollieren.
Bei einem Geräteausfall schlägt das System sofort Alarm.

Materialtransport unter Extrembedingungen - wenn der Helikopter nicht mehr fliegen kann, muss das Pistenfahrzeug ran.

Was macht dich wütend?
Ich bin häufig mit dem Auto unterwegs. Wenn ich dann im Stau stehe, werde ich innerlich schon etwas wütend, weil ich die Zeit eigentlich lieber für etwas Sinnvolles nutzen möchte.
Wann hast du zum letzten
Mal geweint und warum?
Das letzte Mal war beim Film «Tout le bleu du ciel». Es ging dabei um eine wahre, traurige Geschichte. Bei so etwas kann es gut vorkommen, dass mich die Story emotional berührt.
Was erzählst du von dir, wenn du jemanden beeindrucken willst?
Grundsätzlich geht es mir nicht darum, jemanden zu beeindrucken.
Leute, die mich fragen, wie ich die beiden Sportarten Langlauf und Triathlon unter einen Hut bringe, sind meist automatisch fasziniert.
Ich erzähle davon aber nicht, um jemanden bewusst zu beeindrucken.
«Ich würde gerne einen Backflip aus dem Stand können.»
Anja
Was möchtest du unbedingt noch lernen?
Ich würde gerne einen Backflip aus dem Stand können. Letztens war ich beim Kunstturnen, da probierten wir auch die Schnitzelgrube aus. Dabei dachte ich mir: Jetzt ein Backflip aus dem Stand – das wäre cool.
Wann hast du das letzte
Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das war ebenfalls beim Kunstturnen, als wir Doppelsaltos in die Schnitzelgrube machten. Als ich als Kind beim Turnen war, gab es leider keine Schnitzelgruben.
Wo – wenn nicht in der Schweiz – würdest du leben wollen?
Frankreich ist landschaftlich ähnlich vielfältig wie die Schweiz, was mir sehr gefällt. Zum Leben könnte ich mir besonders die französischen Alpen oder den Süden am Meer vorstellen.
Was nervt dich an unserer Gesellschaft?
In der Schweiz sind die Leute meist weniger offen als in anderen Ländern. Das finde ich sehr schade.
Bei was hast du deine Meinung fundamental geändert?
Es kam sicher schon mal vor, dass ich Vorurteile gegenüber einer Person hatte. Und wenn ich sie dann besser kennenlernte, dann merkte ich, dass sie ganz anders ist als ich zunächst dachte.
Anja Weber fährt eine zweigleisige Profikarriere. Sie ist sowohl als Langläuferin als auch als Triathletin unterwegs. Ein Traum der Zürcher Oberländerin: Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano/Cortina und zwei Jahre später an den Sommerspielen in Los Angeles.
Weber ist überzeugt, dass sie im Winter auf den Langlauf-Ski von der Arbeit im Sommer im Triathlon profitieren kann – umgekehrt ebenso. «Hätte ich das eine nicht, wäre ich im anderen nicht mehr so gut.» In der letzten Weltcup-Saison vermochte die 24-Jährige an der LanglaufWeltspitze erstmals so richtig auf sich aufmerksam zu machen. An den Weltmeisterschaften in Trondheim gewann sie an der Seite von Nadine Fähndrich Bronze im Teamsprint.
instagram.com/_weber_anja_
Worüber sprichst du nicht gerne?
Es gibt eigentlich nichts, worüber ich nicht spreche. Ich bin der Meinung, ein relativ offener Mensch zu sein.
Was war die letzte Lüge, die du erzählt hast?
Kürzlich mal beim Pokern. Aber dort gehört es ja auch dazu –zumindest das Bluffen.
Bei wem müsstest du dich eigentlich entschuldigen?
Bei meiner Mutter. Ich habe sie kürzlich warten lassen, weil ich mich nicht melden konnte – mein Handy-Akku war leer und musste zuerst aufgeladen werden.
Ist es besser, als Sportlerin geliebt oder gefürchtet zu sein?
Als faire Athletin ist man eher geliebt als gefürchtet – deshalb: geliebt.
Wovor drückst du dich am meisten?
Vor dem Ausfüllen der Steuererklärung. Ich schiebe das immer hinaus und beantrage sofort eine Fristverlängerung – wohlwissend, dass ich am Ende trotzdem nicht darum herumkomme.
Wie lange hältst du es ohne Handy aus?
Das kommt auf die Situation an. Wenn alle ein Handy dabeihaben, fällt es mir schwerer. In den Ferien mit Freunden – ganz ohne Handy – würde ich es aber eine Woche aushalten, solange jemand meine organisatorischen Dinge übernimmt. Angst, auf Social Media etwas zu verpassen, habe ich nicht.
Wenn jemand deine WebSuchverläufe sehen würde: Was wäre dir am unangenehmsten?
Es gibt da nichts, was mir unangenehm wäre. Meistens benutze ich das Web, um für mich Fragen zu beantworten oder um Öffnungszeiten nachzuschauen.

Ihr grösster Erfolg bisher: Anfang März holte Anja Weber mit Nadine Fähndrich (rechts) WM-Bronze im Teamsprint. Bild: Nordic Focus
«Es gibt eigentlich nichts, worüber ich nicht spreche. Ich bin der Meinung, ein relativ offener Mensch zu sein.»
Anja Weber

Welche Freiheiten sind dir wichtig?
Meinungsfreiheit ist für mich sehr wichtig. Sie ermöglicht offenen Austausch und unterschiedliche Sichtweisen.
Wann hattest du so richtig Glück?
Bei einem Triathlon-Wettkampf stürzte eine Gegnerin mit dem Velo und riss mich mit. Ich erlitt beim Sturz glücklicherweise keine gröberen Verletzungen.
Ist es eine Illusion, zu glauben, Erfolg verändere einen nicht?
Ich denke schon, dass Erfolg einen verändert. Oft schwingt dabei die Meinung mit, man verändere sich auf eine schlechte Weise, zum Beispiel indem man arrogant wird. Ich denke jedoch, dass Erfolg auch positiv verändern kann – etwa, indem man
als erfolgreiche Sportlerin eine motivierende Wirkung auf den Nachwuchs hat. Erfolg kann zudem zu mehr Selbstvertrauen führen und dadurch eine positive Wirkung haben.
Welche Entscheidung in deinem Leben bereust du insgeheim immer noch?
Ich bereue keine. Alle Entscheidungen, auch wenn sie im Nachhinein vielleicht nicht ideal waren, sind für etwas gut gewesen.
Was würdest du gerne können, kannst es aber nicht?
Da wären wir wieder beim Backflip aus dem Stand.
Was glaubst du, denken andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
Ich hoffe, dass mich die Leute als aufgestellte, freundliche Persönlichkeit wahrnehmen.
Du hast drei egoistische Wünsche frei – was wünschst du dir?
Gesund und verletzungsfrei bleiben, meine Performance im entscheidenden Moment abrufen können und noch lange Freude an dem haben, was ich mache.
Aufgezeichnet: Roman Eberle
Mit Ihrer Patenschaft schenken Sie 13- und 14-Jährigen einen einfachen, unbeschwerten und günstigen Zugang zum Schweizer Kulturgut Schneesport. Als Dank für Ihre Unterstützung können Sie am exklusiven Patentag das JUSKILA an der Lenk hautnah miterleben.




Andreas «Sonny» Schönbächler hat Schweizer Sportgeschichte geschrieben. 31 Jahre nach seinem Olympiasieg prägt er die Skiakrobatik noch immer. Doch um den Visionär ist es leiser geworden. Vorläufig.
Die Hände in die Hosentaschen gesteckt, beobachtet Andreas «Sonny» Schönbächler die Schulklasse, die an diesem regnerischen Nachmittag im Spätsommer das Jumpin in Mettmenstetten besucht. Die Kinder rutschen kreischend über die zwei Meter hohe Schanze - extra gebaut für Schulklassen, direkt neben der der Profis – und fliegen durch die Luft ins Wasserbecken. Ein Bild, das beim 59-Jährigen Erinnerungen weckt. «Wenn ich die Kinder so sehe, muss ich daran denken, wie viel Freude ich damals hatte, so zu fliegen», sagt Schönbächler und schmunzelt zufrieden vor sich hin.
Die Kinder ahnen nicht, dass ihnen ein Olympiasieger zuschaut. Noch weniger, dass sie ohne diesen Mann hier nicht ihren Schulausflug verbringen würden. Denn Sonny Schönbächler ist mehr als ein ehemaliger Spitzenathlet. Er ist der Wegbereiter der Schweizer Aerials-Szene und ein Unternehmer, der seine Visionen in die Realität umsetzt.
Lillehammer 1994: Als Aerials zum ersten Mal olympisch ist, gewinnt Sonny Schönbächler mit seinem spektakulären Sprung «Full-Doublefull-Full» Gold, ein prestigeträchtiger Erfolg am Ende seiner Sportlerkarriere. Doch für ihn ist es mehr als ein sportlicher Triumph. «Mit dem Olympiasieg wusste ich, dass der Moment für mein Projekt endlich gekommen ist.»
Schon in der Partynacht von Lillehammer nutzte Sonny die Gelegenheit: Gemeinsam mit seinem damaligen Trainer und Freund Michel Roth schmiedete er den Plan, ihr lang gehegtes Projekt endlich Wirklichkeit werden zu lassen: den Bau einer Wasserschanze für Skiakrobatik nach ausländischem Vorbild, erstmals in der Schweiz. Dafür hatte Schönbächler 14 Gemeinden angeschrieben. Aber nur eine antwortete: Mettmenstetten, sein damaliger Wohnort. Hätte er Silber oder Bronze geholt, hätte er nie eine Zusage von einer Gemeinde erhalten, ist Schönbächler überzeugt. «In einer Randsportart wie Aerials kann man nur mit einem Titel etwas bewirken.»
Um seine Vision voranzutreiben, scharte Sonny Schönbächler Gleichgesinnte aus der Skiakrobatik-Szene um sich und gründete den Verein Jumpin.

Von der Banklehre zum Skiakrobaten: Mit seiner Showgruppe tourte Sonny Schönbächler um die Welt und begeisterte mit waghalsigen Sprüngen. Bild: Keystone-SDA
Das Jumpin ist seit seiner Eröffnung 1996 eine wichtige Trainingsstätte in der internationalen Aerials-Szene. Athletinnen und Athleten aus aller Welt trainieren hier, neben Schulklassen, die einen Ausflug machen, oder Firmen, die einen Teamevent buchen. Diese zusätzlichen Einnahmen brauche das Jumpin. Sonst würde die Finanzierung schwierig, so Schönbächler.
Der Vereinsvorstand ist seit dem Gründungsjahr unverändert. Nur die Geschäftsführung hat Sonny längst abgegeben. «Das macht mit Andreas Isoz, ein anderer ehemaliger Athlet, jetzt ein Jüngerer als ich, der kann das mittlerweile besser.»
Der Initiator, der weiterzieht
Diese Aussage ist bezeichnend für Sonny Schönbächlers Selbstverständnis. «Ich bin einer, der Projekte auf die Beine stellt; sie am Laufen halten und zu Ende bringen, das können andere besser als ich.»

Mit dem «Full-Doublefull-Full» holt Schönbächler 1994 in Lillehammer die bisher einzige Schweizer Aerials-Goldmedaille an Olympischen Spielen.
«In einer Randsportart wie Aerials kann man nur mit einem Titel etwas bewirken.»
Andreas «Sonny» Schönbächler



Er hat ein feines Gespür für Geschäfte – vom Gesundheitszentrum mit Gym bis zu weiteren Projekten vertraut er auf seinen Unternehmergeist.
Ein Muster, das sich durch sein Leben zieht. Schönbächler ist ein Macher, der Türen öffnet und Fundamente legt, dann aber weiterzieht.
«Somasana», sein bisher grösstes Unternehmen oder – wie er selber es lieber nennt – Projekt, ist ein Paradebeispiel dafür. Das Fitnesscenter ist nur fünf Autominuten von der Wasserschanze entfernt. Schönbächler hatte schon mit 16 darin trainiert, übernahm es später, baute es um und brachte es auf den neusten Stand. Aus dem einstigen Gym ist ein vielseitiges Gesundheitshaus geworden: Unter einem Dach vereint es heute Fitnessstudio, Physiotherapie, Haar- und Kosmetiksalon, Kinderhort und Massagepraxis.
Doch allmählich will er sich aus dem Projekt zurückziehen. Noch geht er jeden Tag um fünf Uhr morgens ins Büro, um das Geschäftliche zu erledigen. Zweimal pro Woche gibt er eine Lektion Reformer-Pilates. Von einem Flipchart, das neben der Rezeption hängt, grüsst auf einem Foto aber bereits sein Nachfolger, der Somasana in zweieinhalb Jahren ganz übernehmen wird.
Statt Unternehmer wollte Sonny Schönbächler einst Sänger oder Fotograf werden. Für die Kunsthochschule habe es nicht gereicht, also habe er sich auf die zwei Dinge konzentriert, die er gut konnte: Handstandlaufen und Saltos. Das verband er mit seinem Gespür fürs Unternehmerische. «Mein erstes Sackgeld verdiente ich, als ich mit fünf Jahren auf den Händen durchs Wohnzimmer lief», erzählt er. Den aufgestellten Buben mit den blonden Locken und dem verschmitzten Lachen nannten damals alle einen Sonnyboy – der Ursprung seines Spitznamens, der ihm bis heute geblieben ist.
Als Bub stellte Schönbächler im Kunstturnen fest, dass ihn nicht Reck und Bock begeisterten, sondern die Salti. Von da an übte er sie zu jeder Jahreszeit zu Hause im Garten. Als er Jahre später im

Nach seinem Olympiasieg setzte Sonny Schönbächler den Bau der Wasserschanze in Mettmenstetten durch. Das Jumpin ist seit 1996 eine wichtige Trainingsstätte in der internationalen Aerials-Szene.
Hoch-Ybrig einem alten Turnkameraden zusah, wie der über die Schanze einen Salto in den Himmel setzte, war für ihn der Fall klar: «Das will ich auch.»
Aus der Leidenschaft wurde rasch ein Geschäft: Nach der Banklehre setzte er ganz auf Skiakrobatik und stellte eine Showgruppe zusammen – meist mit Athletinnen und Athleten aus der Szene.
«Unsere Shows waren damals neu, das Publikum fuhr darauf ab und ich spürte, dass wir so Geld verdienen können.» Mit seiner Gruppe tourte er um die Welt, zeigte waghalsige Kunststücke in der Luft – und knüpfte Freundschaften, die bis heute Bestand haben.
In Schönbächlers Gesicht liegt eine Leichtigkeit, wenn er über die Zeit von damals spricht. «Eigentlich waren wir alle Einzelgänger, die Lust hatten, etwas zu machen, sich zu bewegen. Und wir zogen das dann einfach durch.»
Wie nehmen andere diesen vermeintlichen Einzelgänger wahr? Michel Roth, sein ehemaliger Teamkollege, Trainer und bis heute der Aerials-Nationaltrainer von Swiss-Ski, zeichnet ein differenzierteres Bild: «Sonny ist eigentlich
kein Einzelgänger. Im Team funktionierte er bestens, solange es nach seinem Kopf ging.» Und wenn nicht? «Dann scherte er einfach aus und zog sein eigenes Ding durch.»
Auch Aufgeben gebe es bei Sonny nicht, sagt Roth über seinen Freund: «Wenn er etwas will, dann macht er es so lange, bis es klappt.» Nur wegen Schönbächlers unternehmerischem Riecher und seiner Hartnäckigkeit gebe es die Trainingsanlage Jumpin überhaupt. Auch die Schweizer Aerials-Szene gäbe es ohne Schönbächlers Engagement wohl nicht mehr – zumindest nicht in dieser Form, ist Roth überzeugt: «Er hat den Weg geebnet.»
Der müde Kämpfer
Doch dieser Wegbereiter ist müde geworden. «In meinem Leben hatte ich eine Überdosis Menschen», sagt Sonny Schönbächler ohne Umschweife. Immer auf Achse, um seine Projekte voranzutreiben, Familie, Sport, Party, Freunde. Es sei jetzt Zeit für mehr Ruhe, vor allem im Kopf, sagt er: «Ich bin irgendwie müde geworden.»
Sein Rückzugsort ist im Moment sein Zuhause – ein abgelegenes Haus, umgeben von Ackern. Zu Fuss sind es über die Landstrasse rund 15 Minuten ins Dorf. Auf der drei Fussballfelder grossen Rasenfläche zieht der Roboter-Mäher seine Bahnen, zwischen den Bäumen ist eine Slackline gespannt, vom Trampolinnetz tropft der Regen, und Hund Marley trottet gemütlich durch den Garten.
Doch die Idylle ist trügerisch. Im Hause Schönbächler ist ständig etwas los. Die Betreuung seiner vier Kinder aus der zweiten Ehe, vom Teenager bis zur Achtjährigen, teilt er sich mit seiner Ex-Frau. Das bedeutet: die Älteste zum Reiten fahren, auf die Hausaufgaben achten, kochen, von der Schule abholen – oder die Fussball-Juniorenmannschaft des zweitältesten Sohnes trainieren. Seit Anfang August wohnt zudem die Lehrtochter im Gästehaus der Familie, die sich im Somasana zur Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung ausbilden lässt. Seine zwei Kinder aus der ersten langjährigen Partnerschaft sind inzwischen erwachsen und ausgezogen.
Zurück im Jumpin macht die Schulklasse ihre letzten Sprünge ins Wasser. Schönbächler steht noch immer da und beobachtet. Der Wegbereiter, der Visionär,
der weiss, wann es Zeit ist loszulassen und anderen das Feld zu überlassen. Seine bisher grössten Projekte laufen schrittweise ohne ihn weiter.
Dass ein weiteres folgen wird, sei gewiss. Wann und was es sein wird, behält Sonny Schönbächler lieber für sich. «Derzeit ist mein grösstes Projekt, die Kinder durchzubringen.»

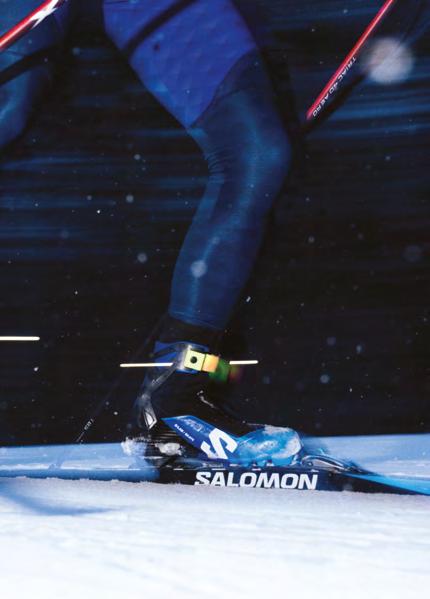
SCHNELL – EGAL, WIE DER SCHNEE FÄLLT Mit der G5%-Basis und dem SL22-Schliff bist du jeder Schneebedingung gewachsen. Und dank der verstellbaren Shift-Race-Bindung holst du dir den entscheidenden Feinschliff für maximale Geschwindigkeit und Performance. S/LAB


Um genügend Trainerinnen und Trainer für den Nachwuchs zu gewinnen, setzt Schnee Sport Churfirsten Toggenburg auf ein kreatives Modell: Die Entschädigung steigt mit dem persönlichen Einsatz.
Die Währung existiert seit 2020. Mit ihr lässt sich im Dorflädeli zwar kein Einkauf bezahlen, aber sie kann helfen, mehr und idealerweise qualifizierte Freiwillige für die Förderung des sportlichen Nachwuchses zu gewinnen.
Schnee Sport Churfirsten Toggenburg heisst der Verein im Tal der Churfirsten. Seine Verantwortlichen lamentieren nicht, sondern stellen sich Herausforderungen mit Kreativität. In diesem Fall hatten sie einen Einfall: Sie schufen einen eigenen Dollar. Genau gesagt: den SSCDollar. Dazu später mehr.
Als es immer schwieriger wird, Trainerinnen und Trainer für den Nachwuchs zu behalten oder neue zu finden, ergreift Angelika Künzle die Initiative. Die 43-Jährige aus Unterwasser, Mutter von drei Kindern, tauscht sich mit Sabrina Sprenger aus, die beiden kennen sich als Jugend+SportCoaches an der Basis aus.
Aus mehreren Wurzeln ein Verein
Der SSC entstand 2009 durch eine Fusion der Skiclubs Wildhaus, Unterwasser, Alt St. Johann, der Renngemeinschaft Churfirsten sowie des Biathlonclubs Alpstein. 600 Mitglieder zählt er mittlerweile, unter ihnen rund 140 Kinder und Jugendliche, die in den Bereichen Alpin, Nordisch und Freestyle gefördert werden.

«Uns war klar: Wir müssen etwas unternehmen, um den jungen Menschen im Toggenburg weiterhin die Möglichkeit zu bieten, in einer Wintersportart geschult zu werden», sagt Angelika Künzle. «Dazu braucht es eine entsprechende Anzahl an Ausbildnerinnen und Ausbildner, die wir möglichst aus den eigenen Reihen rekrutieren.»
Zusammen mit Sabrina Sprenger entwickelt sie die Idee, die eingangs erwähnte Währung einzuführen.

Die Ausgangslage ist simpel. Je mehr Zeit man investiert und je mehr spezifische Kurse man besucht, desto mehr SSC-Dollars sammelt man. Das schlägt sich automatisch auf dem «Lohnzettel» nieder.
Die Gruppenleiter erfassen die Stunden ihrer Trainerinnen und Trainer. J+S-Coach Sabrina Sprenger behält dank einer detaillierten Excel-Tabelle den Überblick und berechnet jeweils die Honorare, die aus dem Topf der J+SGelder stammen.
Das attraktive Prinzip funktioniert: Den Toggenburgern gelingt es, junge Menschen abzuholen, sie vom Sinn der Arbeit zu überzeugen und zu motivieren, sich in J+S-Kursen wertvolle Kompetenzen anzueignen. Meist handelt es sich dabei um ehemalige SSC-Nachwuchsleute, die nach ihrer Jugendzeit aufhörten. «Es ist uns ein Anliegen, sie und ihr Wissen nicht zu verlieren», sagt Angelika Künzle.
Heimat Toggenburg –Leidenschaft Schneesport
Die Liste der Trainerinnen und Trainer umfasst aktuell rund 50 Namen, im Club herrscht eine Stimmung, von der Jan Peter nur schwärmen kann. Der 29-jährige
Die Club Zone von Swiss-Ski ist die zentrale Anlaufstelle für alle Schneesportclubs. Als Herzstück bietet die Toolbox Vorlagen, Leitfäden und Factsheets zu verschiedenen Themen wie Strategie, Kommunikation, oder Ethik. Ausserdem sind Informationen zu Aus- und Weiterbildungen zu finden sowie attraktive Clubangebote oder eine Übersicht aller Events für Schneesportclubs.
Alle Infos zur Club Zone findest du hier
Architekt, Präsident des SSC seit 2022, profitierte als Kind von den Strukturen, schaffte es ins Kader des Ostschweizer Skiverbandes (OSSV) und schliesslich ins Nationale Leistungszentrum Ost nach Davos.
«Uns allen, die in irgendeiner Funktion für den Verein tätig sind, liegt es am Herzen, dem Verein etwas für die jahrelange Unterstützung zurückzugeben», sagt er. Als er noch ein Junior war, erforderte es ein enormes Engagement

Rund 50 Coaches engagieren sich im Verein – entschädigt in SSC-Dollars, die mit dem persönlichen Einsatz wachsen.
seiner Eltern, die ihren Sohn zweimal wöchentlich für Skitrainings in die Ostschweiz brachten. «Auch wenn ich aus dem Zürichsee-Gebiet komme, verbinde ich einen grossen Teil meiner Kindheit mit dem Toggenburg – mit einzigartigen sportlichen und emotionalen Momenten. Darum habe ich auch Ja gesagt zum Präsidialamt beim SSC.»
Mit derselben Motivation wie Jan Peter engagiert sich auch Sabrina Sprenger. Die 40-Jährige wuchs in Wildhaus auf, wohnt mit ihrer Familie nun in Sieben im Kanton Schwyz, ist aber Mitglied des SSC geblieben. Und es gibt für die ehemalige OSSV-Athletin keinen Grund, ihren Austritt zu geben, auch wenn sie nun nicht mehr in der Region lebt.
«Als 16-Jährige hat mich der Verein finanziell unterstützt», sagt sie, «ich hatte das Glück, von coolen Trainern wie Hans Vetsch zu lernen. Sport prägt junge Menschen. Er ist eine Lebensschule. Ich durfte das erleben und bin dankbar dafür.» Dass sie manche Stunde ihrer Freizeit in den SSC investiert, ist für sie ein Beitrag zum Erhalt eines Vereins, der ihr so viel bedeutet. Und der mit dem Dollar-System zusätzlich an Reiz gewonnen hat.
Text: Peter Birrer
Wofür?
Georges Zermatten, der Pistenchef der Alpin-WM 1987 in Crans-Montana, hat nichts aufbewahrt von früher, weder Fotos noch Akkreditierungen noch Ausrüstungen. Nichts. «Wofür?», fragt Zermatten auf Seite 50 dieser «Snowactive»-Ausgabe – wofür sollte er etwas behalten? Die Vergangenheit habe er im Kopf gespeichert.
Was haben Sie aufbewahrt? Wofür?
Wofür fahren wir Ski? Wofür laufen wir auf einer Loipe? Wofür schiessen wir auf eine Scheibe? Wofür springen wir über eine Schanze?
«Es war einfach super, ein Erlebnis. Das Ganze zu meistern, war genial», sagt Simon Ammann über seinen ersten Sprung über eine Schanze (S. 6). Dafür? «Oben bist du aufgeregt – und wenn du ausfährst, reagiert es einfach emotional.» Das reicht. Und es habe «kein Zurück» gegeben vor diesem ersten Sprung, alle anderen standen um ihn rum, schauten zu ihm, als habe es eine Überdosis Menschen um ihn rum, keine Chance auf ein Zurück.
Und danach: reagiert es einfach emotional, die Gefühle wie Fotos im Kopf gespeichert, wie Ausrüstungen für Herz und Seele.
Wie sagt Andreas «Sonny» Schönbächler, der Aerials-Olympiasieger von 1994, «ohne Umschweife» (S. 60): «In meinem Leben hatte ich eine Überdosis Menschen.»
Warum sollte er es mit Umschweifen sagen? Wofür?
Und was heisst «Überdosis»? Wo ist der Anfang einer «Überdosis»?
Wenn der frühere WM-Pistenchef Georges Zermatten Kollegen trifft, dauert es nicht länger als zwei Stunden – «das reicht», sagt er, «in dieser Zeit ist alles gesagt». Sonst droht womöglich eine Überdosis.
Was und wen speichern wir wo ab in unserem Leben? Welche Gefühle und welche Menschen? Diese Menschen, mit denen es einfach super war, ein Erlebnis – oder auch jene, mit denen etwas zu meistern war? Ohne Umschweife: Sind es oft dieselben Menschen? Etwa: Schwestern?
«Wir wollen unseren Töchtern mitgeben, dass eine Schwester etwas Wertvolles ist», sagt Corina Bätschi über die AlpinSnowboarderinnen Laila und Flurina Bätschi (S. 16).
Was heisst «wertvoll»? Wo ist der Anfang von «wertvoll»?
Wie und wo geben wir unseren Kindern zum Aufbewahren mit, dass sie und ihre Geschwister etwas Wertvolles sind?
Mit Applaus und ständigem Lob und überall, oben und wenn sie ausfahren. Mit dem Herzen, mit dem Kopf, mit der Seele und länger als zwei Stunden. Ohne Zurück und ohne Umschweife, ohne Angst vor einer Überdosis.
Der frühere WM-Pistenchef Georges Zermatten sagt auch, ohne Umschweife: «Ein Chef muss auch eine Lokomotive sein.»
Und später: In Theateraufführungen klatsche er nur selten, weil die Schauspielenden auf der Bühne nur ihre Arbeit machten und dafür nicht ständig Lob bekommen müssten - «oder bekommen Sie das ständig von Ihrem Chef?»
Ohne Umschweife: Ja, wenn er eine Lokomotive ist.
Das reicht, alles gesagt. Applaus, Applaus! Dafür!

































Werde Teil des Sunrise Teams und erlebe alle Wettkämpfe live – mit Highspeed Internet und über 280 TV-Sendern.
57.75
Nur für Swiss-Ski Mitglieder statt CHF 101.70/Mt.*
Jetzt scannen & starten
* Angebotsbedingungen: sunrise.ch

