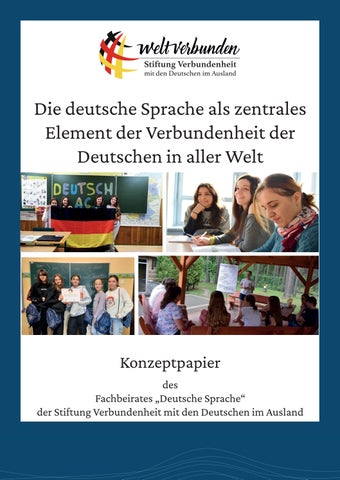Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland
zentrales
Element der Verbundenheit der Deutschen in aller Welt




Konzeptpapier des Fachbeirates „Deutsche Sprache“ der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland
IMPRESSUM
Herausgeber
Sti ft ung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland An der Feuerwache 19 95445 Bayreuth
info@sti ft ung-verbundenheit.de www.sti ft ung-verbundenheit.de Tel.: 0921/1510824-0
Stand Oktober 2024
Gestaltung und Layout
Verantwortliche: Sebasti an Machnitzke, Dr. Marco Just Quiles, Mónika Ambach

Stiftung Verbundenheit
mit den Deutschen im Ausland
Stiftungsrat:
Hartmut Koschyk (Vorsitzender), Florian Weisker (stv. Sti ft ungsratsvorsitzender), Ruth Maria Candussi, Thomas Kropp, Jörn Linster
Stiftungsvorstand: Prof. Dr. Oliver Junk (Vorsitzender), Andrea Wunderlich (stv. Vorstandsvorsitzende), Knut Abraham MdB, Dr. Astrid Freudenstein, Prof. Dr. Christopher Huth, Daniel Walther
Kuratorium:
Cristi na Arheit-Zapp, Bischof Rolf Bareis, Dr. Silvio Döring, Thomas Erndl MdB, Max von Frantzius, Stefan Frühbeißer MdL, Thomas Hacker MdB, Thomas Helm, Dorothée von Humboldt, Parl. Staatssekretärin Anett e Kramme MdB, Thomas Kreutzmann, Msgr. Peter Lang, Dr. Magdalena Lemańczyk, Federico Leonhardt, Dr. Kay Lindemann, Prof. Renate von Ludanyi, PhD, Bundestagsvizepräsidenti n Yvonne Magwas MdB, Tim Pargent MdL, Irina Peter, Prof. Dr. Gesine Lenore Schiewer, Dr. Alexander Schumacher, Werner Sonne, Sylvia Sti erstorfer, Hetav Tek MdBB, Dr. Markus Zanner
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt und verbreitet werden.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung/Präambel
2. Ausgangssituation
3. Ziele und Zielgruppen
4. Inhalte
4.1 Definition/Besonderheit des Forschungsgegenstandes und der Sprachförderung
4.2 Maßnahmenkatalog
5. Ressourcen
6. Kooperationen, Partner, Netzwerke
1. Einleitung/Präambel
Der Fachbeirat „Deutsche Sprache“ wurde satzungsgemäß durch den Stiftungsrat der Stiftung Verbundenheit in Abstimmung mit dem Vorstand durch einen Beschluss vom 05. Februar 2024 als beratendes und impulsgebendes Gremium ins Leben gerufen.
Der Fachbeirat hat sich im Jahr 2024 die Ausarbeitung des Konzeptes „Deutsche Sprache“ zur Aufgabe gemacht, um die Vision und geplante Arbeit der Stiftung Verbundenheit im Sprachbereich festzulegen, vorzustellen und durchzuführen.
Dieses Papier fasst die Arbeitsergebnisse des Fachbeirats „Deutsche Sprache“ der Stiftung Verbundenheit zusammen, der sich mit der Bedeutung der deutschen Sprache im Kontext deutscher Minderheiten und deutschsprachiger Gemeinschaften im Ausland beschäftigt. Sie umfassen in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Afrika sowie den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion mehr als 55 Millionen Personen. Deutsch ist für diesen Personenkreis keine Fremdsprache, sondern eine „Sprache der Herkunft“ oder eine „Minderheitenmuttersprache“. Die deutsche Sprache fungiert mithin als ein Identitätsmerkmal mit einer nachhaltigen Wirkkraft
Die Wirkkraft, die sich aus der identitätsstiftenden Rolle der deutschen Sprache ergibt, wird in der Bundesrepublik Deutschland noch zu wenig als Ressource für eine nachhaltige Spracharbeit erkannt und genutzt. Daher möchte der Sprachbeirat der Stiftung Verbundenheit diesem Thema eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Deutsche Minderheiten und deutschsprachige Gemeinschaften im Ausland besitzen als „kulturelle Broker“ eine wechselseitige Wirkkraft in ihren lokalen Kontexten. Sie sind nicht nur
Rezipienten der (Förderprogramme der) deutschen Sprache und Kultur vor Ort, sondern selbst einflussreiche, zivilgesellschaftliche Kultur- und Sprachvermittler.
Die Wirkungskraft, die sich aus der identitätsstiftenden Rolle der deutschen Sprache ergibt, ist bis jetzt unterschätzt und soll durch die Spracharbeit der Stiftung Verbundenheit erheblich hervorgehoben werden. Sie entfaltet eine nachhaltige Bindekraft, die oftmals über den Personenkreis mit biografischem Deutschlandbezug hinauswirkt.
Deutsche Minderheiten und deutschsprachige Gemeinschaften im Ausland besitzen als „kulturelle Broker“ eine wechselseitige Wirkkraft in ihren lokalen Kontexten; dies auch im Hinblick auf die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur. Sie sind also keineswegs nur Rezipienten, sondern auch Kommunikatoren, die im Sinn eines „Doppelblicks“ in den betreffenden lokalen Umfeldern ebenso wirken wie ihr fundiertes internationales Wissen auch in Deutschland weitergeben, das systematisch wahrgenommen werden sollte.
Aus dieser Besonderheit ergeben sich noch zu wenig erforschte und genutzte Chancen, u.a. im Hinblick auf das abnehmende globale Interesse an der deutschen Sprache und die damit verbundenen strukturellen Probleme, etwa dem allgemeinen Fachkräftemangel und Deutschlands in Frage stehende kulturelle Attraktivität in der Welt.
Durch eine kontinuierliche Sprachförderpolitik im internationalen Raum kann dem entgegengewirkt werden, wodurch die Bundesrepublik Deutschland Sympathien gewinnen und die Bereitschaft zu Allianzen und Loyalität gestärkt werden kann (vgl. etwa Togo bzw. Namibia als Beispiele).
Die Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik lassen das Potenzial der deutschen Organisationen und Gemeinschaften vor Ort, ihre regionalen Besonderheiten und die emotionale Sprachbindung im Sprachbereich leider ungenutzt, anstatt hier gezielt anzusetzen.
Die Stiftung Verbundenheit, ihr Sprachbeirat und ihre Partner haben einen anderen und tieferen Zugang zu den deutschen Minderheiten und deutschsprachigen Gemeinschaften weltweit als die traditionellen Mittlerorganisationen aus dem Netzwerk „Deutsch“. Dies erlaubt es Ihnen, gezieltere und intensivere Sprachinitiativen impulsgebend anzustoßen, die in die Gesellschaften hineinwirken und somit weit über die fachliche Öffentlichkeit hinausgehen.
Das Konzept für die Sprachförderung der deutschen Minderheiten und Sprachgemeinschaften im Ausland kann auf mehreren Ebenen angelegt werden, um sowohl die kulturelle Identität zu stärken als auch die deutsche Sprache in den jeweiligen Gemeinschaften langfristig zu fördern. Diese Förderung erfordert eine gezielte, mehrdimensionale Herangehensweise: frühkindliche Erziehung, Schulen, Kultur-und Bildungsvereine, kirchliche Gemeinden, deutschsprachige Medien spielen dabei eine große Rolle. Der Erfolg hängt jedoch stark von der aktiven Nutzung der Sprache und kultureller Komponenten innerhalb deutschsprachiger Gemeinschaften und Minderheiten ab ebenso wie von der Weitergabe an die jüngere Generation. Gleichzeitig bedarf es einer stärkeren Förderung dieser Gemeinschaften durch die Bundesrepublik Deutschland.
Dieses Konzeptpapier legt dar, welche Anforderungen an Institutionen des Bundes und der Bundesländer zu formulieren sind, um die Vermittlung der deutschen Sprache als entscheidendes Identitätsmerkmal zu stärken und substanziell zu fördern sowie die Position des Deutschen in der Welt in Bezug auf deutschsprachige Gemeinschaften und deutsche Minderheiten zu behandeln.
2. Ausgangssituation
Die gegenwärtigen Entwicklungen der Sprachsituation der deutschen Minderheiten, ihrer Dachverbände sowie der Sprachgemeinschaften in Lateinamerika und den USA werden in der partnerschaftlichen Tätigkeit der Stiftung „Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“ verankert. Die vorhandene Vielfalt der deutschsprachigen Räume kann und muss so im kulturpolitischen Diskurs lebendig werden.
Eine aktuelle Bedarfs- und Gebrauchsanalyse der deutschen Sprache einschließlich der Lerngelegenheiten wurden von der Stiftung in ihrem Dossier zur aktuellen Sprachsituation gesammelt und ist diesem Konzept in der Anlage beigefügt. Es handelt sich um insgesamt 21 Länderberichte aus dem Jahr 2024.
Für ein besseres Verständnis der Ausgangssituation wird zusätzlich auf folgende Publikationen verwiesen:
1. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): „Deutsche Minderheiten stellen sich vor“, Berlin, 2016.
2. Ulrich Ammon „Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt“, Kapitel „E“: Deutsch als Minderheitensprache, aber nicht staatliche Amtssprache“ S. 255-397.
3. Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland (Hrsg.): „Neue alte Partner für die Zukunft. Deutschsprachige Gemeinschaften in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik“ Berlin und Bayreuth, 2020.
3. Ziel und Zielgruppen
Ziel der Initiative der Stiftung Verbundenheit ist es, die deutschsprachigen Organisationen, kulturelle Vereine sowie Bildungsvereine vor Ort im internationalen Raum zu stärken und zu vernetzen. Dabei werden die lokalen und regionalen Erfahrungen der Bildungs- und Kultureinrichtungen im Sprachbereich in die Sprach- und Kulturpolitik Deutschlands einbezogen und eine gezielte Erhöhung der Zahl von internationalen Lernenden mit „Deutsch als Sprache der Herkunft“, „Minderheitenmuttersprache“ und „Deutsch als Sprache der Wertschätzung und Chancen“ angestrebt.
Die Zielgruppen ergeben sich wie folgt:
• Deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa, Baltikum, Russland und Zentralasien „Minderheitenmuttersprache“
• deutschsprachige Gemeinschaften in Nord- und Südamerika und andere Weltregionen „Sprache der Herkunft“
• Personen ohne biografische Verbindung in den deutschen Sprachraum als „Sprache der Wertschätzung und Chancen“
Um effektive und effiziente Lernerfolge zu gewährleisten, muss innerhalb dieser drei Zielgruppen eine weitere Differenzierung nach Altersgruppen erfolgen, da sie unterschiedliche Bedürfnisse und Spracherwerbsmotivationen haben.
4. Inhalte
4.1. Definition/Besonderheit des Forschungsgegenstandes und der Sprachförderung
In Hinblick auf die Zielgruppen bestehen markante Unterschiede zur Sprachförderung im Fremdsprachenunterricht. Diese Besonderheiten sind eng mit den historischen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten verknüpft.
Die Förderung der „Minderheitenmuttersprache“ und „Sprache der Herkunft“ erfordert die Berücksichtigung besonderer Voraussetzungen. Diese deutschen Gemeinschaften und Minderheiten leben in Ländern, in denen Deutsch
• keine Amtssprache ist,
• öfters auch nicht als erste Fremdsprache respektive
• weder als obligatorische oder fakultative Schulfremdsprache und
• oftmals unter den Gegebenheiten mehrsprachiger Lebensräume angeboten wird.
Sprachförderprogramme müssen daher nicht nur die Sprache Deutsch bewerben, sondern auch auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit eingehen und die Integration in die lokale Gesellschaft unterstützen.
Dazu zählen u.a. auch emotionale Formen der Unterstützung, wie Wertschätzung und Anerkennung der deutschen Minderheit, die in der Öffentlichkeit ausdrücklich zu betonen ist.
Für Zielgruppen ohne persönliche biographische Verbindung in den deutschen Sprachraum ist Deutsch die „Sprache der Wertschätzung und Chancen”. Für diese Gruppen spielen die ersten beiden Zielgruppen eine wichtige Multiplikatorenrolle.
Die feste Verbindung der deutschen Sprache mit der familiären Geschichte hat eine hochmotivierende Funktion für den Erhalt des Deutschen in der Folgegeneration, z.B. in Form einer zweisprachigen Erziehung bzw. einer kulturellen Bindung trotz geringer Sprachkenntnisse. Das Erlernen der deutschen Sprache wird oft weniger durch das Leistungsprinzip oder ökonomische und karriereorientierte Gründe dominiert als bei anders motiviertem Spracherwerb. Entscheidend sind vielmehr die Familien- bzw. Sprachgemeinschaftsgeschichte sowie Freude an der Verwendung der deutschen Sprache im Alltag und in der Öffentlichkeit, beispielsweise bei Veranstaltungen der deutschen Minderheiten bzw. Sprachgemeinschaften in ihren jeweiligen Regionen.
Daher muss die Sprachförderung gezielt darauf abzielen, Deutsch als Familiensprache und in der Gemeinschaft lebendig zu halten.
Weitere Besonderheiten der Zielgruppen sind die Plurizentrik und die variantenreiche Mündlichkeit, die einer besonderen Didaktik bedürfen. Das Deutsch dieser Gruppen entwickelt sich öfters isoliert und unter dem Einfluss der lokalen Sprache weiter, was auch zur Bildung von Sprachvarianten führt. Diese Formen des Deutschen weichen unter Umständen stark vom heutigen Standarddeutsch ab, worauf die Sprachförderung Rücksicht nehmen muss, um nicht mit der Enttäuschung von Erwartungen Lernabbrüche zu provozieren.
Besondere Berücksichtigung müssen auch die Sprachlernbiographien und das Interesse an bestimmten Sprachfertigkeiten finden. So ist die Verbreitung der Hör- und Sprechfertigkeiten (gegenüber dem Lesen und Schreiben) unter diesen Lernenden sehr ausgeprägt. Deswegen muss gerade das „Lernen über das Ohr“ deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, so dass für Schulen und Bildungseinrichtungen spezielle zweisprachige Bildungsprogramme entwickelt werden müssen. Als Beispiel dienen hier die erfolgreichen Schulen der deutschen Minderheit in Dänemark, die deutsche Gymnasien in Ungarn, Rumänien, Südtirol.
In Ländern, in denen es keine oder wenige deutsche Vollzeitschulen gibt, bieten sich die bestens erprobte und etablierte Form der „Samstagschulen“ bzw. „Sonntagsschulen“ oder ergänzender Deutschkurse an, wie es in den USA und dem kompletten postsowjetischen Raum üblich ist. Dieser Sprachunterricht ist meistens günstiger und flächendeckender als die Sprachlernangebote der klassischen Mittlerorganisationen.
Eine wichtige Besonderheit der Sprachförderung liegt in der Tätigkeit der Kulturvereine und Gemeinschaftsorganisationen, denn sie sind das Rückgrat der deutschen Minderheiten und Sprachgemeinschaften. Sie schaffen eine vernetzte Öffentlichkeit und das soziale Umfeld, in dem die deutsche Sprache im breiten Spektrum von kulturellen Veranstaltungen bis zu traditionellen Festen aktiv genutzt und gepflegt werden kann.
Diese Unterschiede zu berücksichtigen ist zentral, um die Zielgruppen und ihre „Lebensrealitäten“ zu respektieren und die Spracharbeit in diesem Sinne präzise anzupassen.
In diesen Gruppen ist der Spracherwerb im Vergleich zu den Sprachlernangeboten der klassischen Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut oder DAAD lokaler und breiter gestreut. Aufgrund ihrer geringeren finanziellen Ausstattung durch den deutschen Staat und oft auch geringeren Verbindungen und Kooperationen mit den deutschen Mittlerorganisationen entwickeln die Organisationen der deutschen Minderheiten und
Sprachgemeinschaften eine ausgeprägte Resilienz: sie sind zukunftsorientiert, lösungsorientiert und netzwerkorientiert. Die identitätsstiftende Rolle der deutschen Sprache führt bei diesen Gruppen zu erhöhter Motivation und verringert die Problematik des „Alumni-Verlustes“ (nachhaltige Verbindungspflege mit Alumni).
Diese Gruppen haben eine „Broker“-Funktion mit guten Antennen bezüglich der Frage: „Wie blickt die Welt auf Deutschland?“
4.2. Maßnahmenkatalog. Wie kann die zielgruppenspezifische Vermittlung der deutschen Sprache nachhaltig im internationalen Raum gestärkt werden?
Bei der Entwicklung des Maßnahmenkatalogs wird auf die bisherige Erfahrung der Organisationen bzw. Partnervereine in den jeweiligen Ländern besonderer Wert gelegt.
1. Das betrifft in erster Linie solche Projekte, die sich in den Organisationen bewährt haben, zur Erhöhung der Zahl der Deutschlernenden beigetragen haben und die an weitere Länder bzw. Kontinente im Sinn einer Multiplikation der Effekte angepasst werden können.
2. Weitere Maßnahmen sind mit dem Ziel der Sprachförderung und Kooperation mit ausgewählten Mittlerorganisationen vorgesehen, insbesondere im schulischen und hochschulischen Bereich, um den Bedarf an Deutschlehrkräften zu decken und eine zügige Ausbildung von Sprachlehrerinnen und -lehrern vor Ort zu gewährleisten.
3. Der außerschulische Bereich wird durch Maßnahmen gestärkt, die eine durchdachte Motivationsstrategie beinhalten und ein niederschwelliges Eintauchen in die deutsche Sprache und Kultur ermöglichen.
4. Da der Spracherhalt in der Familie stattfindet, kommt Eltern eine zentrale Rolle in der Sprachförderung zu. Aus diesem Grund müssen Eltern und Kinder in die Sprachförderprogramme einbezogen werden.
5. Deutschsprachige Medien im Ausland sind ein weiteres Instrument zur Sprachförderung: Zeitungen, Zeitschriften, Radiosendungen der deutschsprachigen Gemeinschaften im Land tragen zur Vermittlung der deutschen Sprache bei und dienen gleichzeitig ebenso der Präsenz vor Ort wie der Herstellung von Nähe zum deutschsprachigen Raum.
6. Auch der Ausbau und die Nutzung digitaler Sprachlernangebote berücksichtigen die o.g. drei Zielgruppen und verschiedene Altersgruppen in spezifischer Weise. Diese Maßnahmen ermöglichen beispielsweise der jüngeren Generation, die deutsche Sprache in einem für sie attraktiven Kontext zu nutzen.
7. Neben den digitalen Sprachlernangeboten werden gleichrangig Deutschlandaufenthalte, sogenannte „Sprachbäder“, in den Maßnahmenkatalog aufgenommen.
8. Alumni-Konzept muss mitgedacht werden, um die hohe Fluktuation bei anderen Sprachlerngruppen (z.B. Schülerinnen und Schüler deutscher Auslandsschulen) zu vermeiden.
Ein erweiterter Maßnahmenkatalog mit Projektübersicht soll aufgrund der vorhandenen und mittelfristig geplanten Ressourcen separat entwickelt werden.
5. Ressourcen
Folgende Ressourcenkategorien werden als notwendig für eine nachhaltige Förderung der Spracharbeit der Deutschen Minderheiten und deutschsprachigen Gemeinschaften ermittelt:
• Sicherstellen einer kontinuierlichen Finanzierung der Sprach- und Kulturarbeit
• Soziale Ressourcen stärken und die Vernetzung fördern
• Vorhandene Strukturen und Partnerorganisationen der Stiftung Verbundenheit nutzen
• Mittlerorganisationen des Bundes miteinbeziehen
• Wertschätzung der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten weltweit
6. Kooperationen, Partner, Netzwerke
Die entscheidende Rolle für die Zielgruppen spielen die Organisationen vor Ort, lokale deutsche Vereine, Kirchen und Kulturzentren, wie z.B. die Samstagschulen in den USA, die Vereinigung der deutschsprachigen Gemeinschaften in Lateinamerika, die Dachverbände der deutschen Minderheiten in Osteuropa und in den Staaten des postsowjetischen Raumes. Diese schaffen die Breitenarbeit und die Motivation für den Einstieg in die Welt der deutschen Sprache.
Partnerschaften mit Schulen, Bildungseinrichtungen sowie Städtepartnerschaften sind ein wichtiges Instrument der Zusammenarbeit und gewährleisten die Integration der deutschen Sprache und der kulturellen Thematik der deutschen Minderheiten und Sprachgemeinschaften in die internationale Zusammenarbeit.
Der weitere Ausbau der Kooperationen unter Einbeziehung der deutschen Mittlerorganisationen, wie der ZfA, Goethe-Institut, DAAD und dem Deutschen historischen Institut unterstützen die Realisierung schnellerer und qualitativ besserer Sprachlernleistungen, die Intensivierung des öffentlichen Interesses und der fachlichen Öffentlichkeit.
Für die Berücksichtigung der Thematik der Mündlichkeit und dialektalen Besonderheiten ist es sinnvoll mit dem IDS- Leibniz-Institut für deutsche Sprache zu kooperieren.
Eine weitere Plattform für Kooperation und Vernetzung bietet interdisziplinäre Zusammenarbeit und Forschung mit Universitäten im In- und Ausland, hier insbesondere mit den Deutschabteilungen und Internationalen Germanistiken.
Öffentliche gemeinsame Auftritte und Präsentationen der Deutschen Organisationen im Ausland bei internationalen Bildungs-und kulturellen Foren, wie z.B der Internationalen Tagung der Deutschlehrer (IDT), der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Buchmessen etc. werden sehr empfohlen.
Durch den Ausbau der Kooperationen und Netzwerke erhöhen sich nicht nur die Chancen auf Erhalt der zahlreichen Deutschen Minderheiten und Sprachgemeinschaften, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Sprache weltweit.
Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland
Informationen
über die deutsche Sprachsituation, den Umfang des Schulunterrichts in deutscher Sprache für die Angehörigen der Deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa, GUS, Zentralasien, Kaukasus sowie den deutschsprachige Gemeinschaften in Nord- und Südamerika
Dossier für den Fachbeirat „Deutsche Sprache“
Stand: 04.10.2024
ARGENTINIEN, CHILE, PARAGUAY
Deutsch als Fremdsprache spielt in Lateinamerika eine wichtige Rolle. Es gibt rund 765 Schulen mit Deutschunterricht. Insgesamt lernen in Lateinamerika etwa 350.000 Schüler/innen Deutsch. Besonderes Interesse am Deutschunterricht besteht in den Regionen mit vielen aus Deutschland eingewanderten Familien (Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay) (vgl. Auswärtiges Amt, 2019). Mit dem Partnerschulnetzwerk mit 193 Schulen in Lateinamerika, der PASCH-Initiative vom Auswärtigen Amt, ist ein Beispiel zahlreicher prägender Initiativen mit Förderprogrammen.
Insgesamt wird die Zahl deutschsprechender Lateinamerikaner auf ca. 1,8 Millionen geschätzt (Auswärtiges Amt, 2015). Etwa 1 % der Bevölkerung in Argentinien – ca. 300.000-500.000 Personen – spricht Deutsch (vgl. Rosenberg, 1998). In Chile gibt es ca. 20.000 Deutschsprachige und in Paraguay ca. 100.000 (die meisten davon sind Russlandmennoniten, viele davon leben im Chaco) (Rosenberg, 1998). Auch wenn großes Interesse an der deutschen Sprache besteht, sind die germanistischen Abteilungen und das Lehren der deutschen Sprache in Argentinien, Chile und Paraguay noch ausbaufähig (vgl. Auswärtiges Amt. 2019). In Lateinamerika stagniert die Zahl der Deutschlernenden laut Auswärtigem Amt auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu anderen Regionen der Welt weist Lateinamerika einen recht geringen Anteil der Deutschlernenden an der Gesamtbevölkerung auf (vgl. Auswärtiges Amt, 2020).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Gemeinschaften besonders in Lateinamerika prozentual gesehen sehr stark vertreten sind. Es gibt allerdings Entwicklungspotential beim Ausbau des Deutschunterrichts an Bildungseinrichtungen und der Präsenz der deutschen Sprache in Lateinamerika. Die Sprachkurse des Goethe-Institutes sind für viele Personen aufgrund der hohen Kosten, aber auch der begrenzten Institutspräsenz außerhalb der Metropolregionen, nicht erschwinglich.
In einigen deutsch-lateinamerikanischen Kulturvereinen wird eigenständig Sprachunterricht angeboten (weniger als 20%). Allerdings können sie nur schwer ihr Potenzial ausschöpfen, da die Vereine es sich finanziell kaum leisten können, den Unterricht unter professionellen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Zudem herrscht in der gesamten Cono Sur Region ein akuter Mangel an Deutschlehrkräften. Die wenigen Lehrkräfte arbeiten vorzugsweise in Sprachenzentren, die eine bessere Vergütung bieten können. Das vermittelte Sprachkursniveau in den Vereinen begrenzt sich in der Regel auf das A1- und A2-Niveau. Deutschlernende in den Vereinen kommen aus diversen Altersgruppen und sozialen Schichten. Das Interesse Deutsch zu lernen, entsteht meistens aus einer emotionalen, familiengeprägten Verbindung zu Deutschland. Jüngere Generationen sind an Studienmöglichkeiten in Deutschland interessiert.
ARMENIEN
In der Republik Armenien gibt es keine kompakte Ansiedlung von Deutschen. Die Anzahl der Angehörigen der Deutschen Minderheit wird auf unter 100 geschätzt.
Deutsche sowie Deutschstämmige sind in der gesellschaftlichen Kulturorganisation der Deutschen „Teutonia“ vereint, in der Interessierte Deutsch in zwei Gruppen sonntags lernen: Gruppe 1 (8-10 Kursteilnehmer), von 11-13 Uhr im Zentrum der nationalen Minderheiten, Gruppe 2 (5 Kursteilnehmer) von 17-19 Uhr, online. Die Motivation für das Erlernen der deutschen Sprache besteht darin, die Sprache zu pflegen, mit Deutschsprachigen zu kommunizieren und ins Ausland zu reisen. Die Aktivitäten der Organisation werden von der Regierung Armeniens unterstützt.
GEORGIEN
Die deutsche Sprache war noch in den sowjetischen Zeiten (in den 1970-90er Jahren) in meisten Fällen die erste Fremdsprache in Georgien. Bis 2003 gab es viele Schulen, in denen Deutschunterricht als Fremdsprache oder erste Fremdsprache erteilt wurde. Deutsch-Georgische Beziehungen waren traditionell in den 1960-90er Jahren gut. Die deutsche Minderheit in Georgien ist klein. Deshalb gab und gibt es auch heute keinen
Deutschunterricht als Muttersprache, es wird nur Fremdsprachenunterricht erteilt. Ab 2004 wurde Deutschunterricht von Jahr zu Jahr minimiert. Die meisten Deutschlehrer/innen wurden entlassen.
Die aktuelle Regierung (seit 2012), hat die prekäre Situation der deutschen Sprache an den Schulen wesentlich verbessert. Dennoch wurde das ursprüngliche Niveau des Deutschunterrichts an den Schulen nicht erreicht. Deutsch wurde auch aufgrund der EU-Integrierung wieder sehr populär. Die meisten Jugendlichen fahren nach Deutschland, um dort zu studieren oder zu arbeiten.
Deutschunterricht besuchen viele Mitglieder des Dachverbandes der Deutschen Minderheit „Einung“. In Tbilissi besuchen den Deutschunterricht bis zu 50 Personen, je nach Niveau, und in der BS Rustawi 15 Teilnehmer, d. h. insgesamt 65 Personen (durch das Goethe-Institut). Die Tendenz ist positiv, weil die Teilnehmerzahl zunimmt: immer mehr Menschen möchten Deutsch lernen!
ITALIEN und die AUTONOME PROVINZ BOZEN-BOLZANO ( SÜDTIROL/ALTO ADIGE)
Die deutsche Sprache gerät in Italien und der Autonomen Provinz Bozen zunehmend unter Druck. Auch wenn im aktuellen Bericht des Auswärtigen Amts (DaF weltweit 2020: 9) von einem Anstieg der Deutschlernenden die Rede ist, muss dieser vor einer generellen Abwertung der deutschen Sprache in Italien genauer interpretiert werden. Im aktuellen Bericht des Auswärtigen Amtes (AA) wird die Gesamtzahl der Deutschlernenden in Italien mit rund 458.000 Personen angegeben (DaF weltweit 2020: 13). Diese Zahl erscheint absolut gesehen als hoch, relativiert sich aber bei genauer Betrachtung.
Die beiden Sprachräume sind seit Jahrhunderten eng verbunden, die Auslandsgermanistik kann in Italien auf eine reichhaltige Tradition zurückblicken (Foschi Albert 2005), die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den DACHLändern und Italien sind sehr eng; nicht zuletzt beruhen sie auf der großen italienischsprachigen Diaspora in den deutschsprachigen Ländern, so leben etwa eine Million italienische Staatsbürger/-innen in einem DACH-Land, davon knapp 700.000 allein in der Bundesrepublik (Dörflinger/Atz 2020:12f). Deutlich geringer ist die Zahl der Deutschsprecher, die in Italien lebt, sie liegt bei knapp über 50.000. Im Tourismus ist das Zahlenverhältnis fast spiegelverkehrt: den rund 78,9 Millionen Übernachtungen von Deutschsprecher/-innen in Italien stehen rund 9 Millionen Übernachtungen von Italiener/-innen in den DACH-Ländern gegenüber. Insgesamt lässt sich an diesen hohen Zahlen die enge Verflechtung der beiden Sprachräume ablesen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es bedenkenswert, wenn die deutsche Sprache in Italien seit Jahrzehnten gleichbleibend „nur“ auf Platz vier der Fremdsprachen zu finden ist, hinter Englisch (48% der Bevölkerung), Französisch (30%) und Spanisch (11%) und dies zudem mit einem deutlichen Abstand. Deutsch als Fremdsprache lernen nur 6% der Bevölkerung; auf einem europäischen „Ranking“, bei dem der Anteil der Bevölkerung mit Deutsch als Fremdsprache gemessen wird, liegt Italien nur auf Platz 20, von insgesamt 25 europäischen Staaten; sogar in Großbritannien und Frankreich ist der Anteil der Deutschlerner höher als in Italien (Dörflinger/Atz 2020: 17). Zwar sollte bei diesen Daten die generell niedrige Fremdsprachenfreudigkeit der Italienerinnen und Italiener gesehen werden, jedoch wird das Potential von deutschen Mittlerorganisationen im Bereich der Auswärtigen Sprach- und Kulturpolitik bei weitem nicht ausgeschöpft.
Es ist ein Motivationsmix, der die Menschen in Italien dazu bringt, Deutsch zu lernen: die internationale Stellung der deutschen Sprache, die intrinsische Motivation, damit ist generell der Spaß am Erlernen einer Fremdsprache gemeint und die – insbesondere im Primar- und Sekundarschulbereich wahrgenommene – gute Deutschdidaktik gehören zu den positiven Faktoren. Gerade letzterer Befund ist eine Bestätigung dafür, dass eine
klug konzipierte und finanziell ebenso ausgestattete auswärtige Sprach- und Kulturpolitik ihre Früchte trägt (ausführlich dazu Dörflinger/Atz 2020). Denn die Deutschdidaktik an den italienischen Universitäten wird deutlich schlechter bewertet; hier wird das akademische Personal zumeist aus den heimischen Universitäten akquiriert, das traditionell in Italien einer eher konservativ-strukturalistischen, theoretisch-grammatisch orientierten Sprachdidaktik verpflichtet ist.
Die geografische Nähe zu den deutschsprachigen Nachbarländern spiegelt sich auch in den Deutschsprecherzahlen wider, so ist der Norden Italiens traditionell eher mehrsprachig im Vergleich zum Süden Italiens. Dennoch sind die lokalen Zentren der deutschen Sprache im Süden zu berücksichtigen, traditionell sind diese im Umfeld der Universitäten Bari, Neapel und Palermo oder im Zusammenhang mit deutschen Wirtschaftsunternehmen (etwa in Apulien) oder auch im Gebiet der prestigeträchtigen deutschen Schulen in Rom und Mailand zu finden (Dörflinger/Atz 2020: 12).
Eine Sonderstellung nimmt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Autonome Provinz Bozen-Bolzano (kurz: Südtirol) ein, da hier die deutsche Sprache als Minderheitensprache institutionalisiert und sowohl auf völkerrechtlicher wie auf verfassungsrechtlicher Ebene abgesichert ist. Deutsch fungiert hier als regionale Amtssprache (kategorisiert nach dem Konzept von Ammon 2015), die von etwa Zweidrittel der Bevölkerung, die die 500.000 Marke vor einigen Jahren überschritten hat, als Muttersprache verwendet wird. Da in dem komplexen dreisprachigen Schulsystem Deutsch in allen Schultypen mit einem hohen Stundenkontingent und unterschiedlichen didaktischen Ansätzen unterrichtet wird, kann man davon sprechen, dass alle Bewohner Südtirols in irgendeiner Form Deutsch gelernt haben und verwenden, sei es Deutsch als Erstsprache oder Zweitsprache oder Fremdsprache (ausführlich und mit aktuellen Daten: Risse 2024). Neben Italienisch als „Staatssprache“ und Deutsch als regionaler Amtssprache genießt die kleine Sprachminderheiten der Ladiner noch einen juristisch abgesicherten Status. Die rund 30.000 Sprecher/-innen (dies entspricht einem Anteil von rund 4,8% der Bevölkerung) haben als einzige ein konsequent dreisprachiges Schulsystem mit ihrer Muttersprache Ladinisch – die in den unterschiedlichen Idiomen Grödnerisch und Gadertal-Ladinisch vorliegt. Paradoxerweise wird die Erstsprache mit einem kleineren Stundenkontingent ab dem Kindergarten bis zur Matura unterrichtet, wohingegen Italienisch und Deutsch zu gleichen Anteilen als Unterrichtssprachen fungieren. Im Ergebnis entlässt die „paritätische“ Schule und Kindergarten dreisprachige Sprecher/-innen. In den deutschen und italienischen Schulen des Landes wird die jeweils andere Landesssprache durchgehend ab der Grundschule als Zweitsprache unterrichtet.
Die deutsche Sprache in Südtirol wird also nicht nur von den Muttersprachlern, sondern auch von denjenigen gelernt und angewendet, deren Muttersprache Ladinisch und Ita-
Die starke Bindung an die deutsche Standardsprache, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch politisch die Verbundenheit zum deutschen Sprachraum symbolisieren sollte, ist einer gewissen Entkoppelung der „Bildungssprache Deutsch“ gewichen. Salopp formuliert ist eine „Verschweizerung“ der Südtirolerinnen und Südtiroler insofern zu erkennen, als „der Dialekt“ den Alltag dominiert, das Standarddeutsche zunehmend gerade von der jungen Generation als „Zweitsprache“, die in den Bildungsinstitutionen erlernt werden „muss“, empfunden wird.
KASACHSTAN
In Kasachstan wird Deutsch sowohl an Schulen als auch an Universitäten erlernt. Es wird jedoch als Fremdsprache und nicht als Minderheitensprache unterrichtet. Darüber hinaus gibt es in Kasachstan das BMI-Förderprogramm für ethnische Deutsche, in dessen Rahmen das Erlernen der deutschen Sprache vorgesehen ist.
Ab Ende 2023 lernen in Kasachstan 11.163 Schüler Deutsch. Davon lernen 2.960 Deutsch als erste Fremdsprache und 8.203 lernen Deutsch als zweite Fremdsprache. Diese sind aber Schüler aller Ethnien. Die Statistik zu den Kasachstandeutschen fehlt.
Laut der Statistik des Bildungsministeriums Kasachstans nimmt die Zahl der Deutschlernenden an Schulen zu, aber die Zahl der Kursteilnehmer im Rahmen des Förderprogramms stagniert jedoch eher. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Jugendlichen, die einen aktiven Teil der Lerner bilden, nach dem Schulabschluss das Erlernen der Sprache nicht fortsetzen, sondern zum großen Teil zum Studium ins Ausland ziehen.
- 18lienisch ist. Die deutsche Sprache in Südtirol wurde in den vergangenen Jahrzehnten stetig ausgebaut, so dass man von einer Dominanz des Deutschen sprechen kann. Allerdings ist auch hier ein differenzierter Blick notwendig: Mit dem Einzug der sozialen Medien und damit der zunehmenden Mündlichkeit auch in schriftsprachlichen Domänen gerät das Standarddeutsche wiederum unter Druck. Zwar wird – anders als etwa in der Schweiz – das Standarddeutsche als Norm in den Bildungsinstitutionen vorgegeben, aber das Dialektsprechen bestimmt den Alltag. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die schriftsprachliche Kompetenz gerade der jüngeren Generation (Risse 2020).
KIRGISISTAN
In Kirgisistan wird in den Schulen sowie an den Hochschulen Deutsch als Fremdsprache (DaF) unterrichtet. Für die deutsche Minderheit wird im Rahmen des BMI-Förderprogramms die Spracharbeit in Form von verschiedenen Projekten zum Erlernen der deutschen Sprache in Bischkek und weiteren 7 Regionen angeboten. Das Goethe-Institut bietet für die deutsche Minderheit in einigen Regionen Außenkurse und die Teilnahme an Sprachcamps für ausgewählte Jugendliche an.
Im Rahmen von Projekten wie „Sprachkurse und Sprachzirkel“ und „Wunderkind“ lernen jährlich rund 140 Erwachsene und Schüler sowie rund 40 Vorschulkinder, die überwiegend Angehörige der deutschen Minderheit sind, in verschiedenen Formaten kirgisistanweit Deutsch. Zusätzlich werden Kindersprachtagestätten für 60 Kinder und Sprachcamps für 30-50 Jugendliche organisiert. Insgesamt wird Deutsch als Fremdsprache in den meisten allgemeinbildenden Schulen in der Kirgisischen Republik unterrichtet, wobei in 6 von ihnen Deutsch intensiv unterrichtet wird. An 5 Universitäten in Bischkek wird Deutsch als Hauptfach unterrichtet.
Die Zahl der Deutschlernenden in Kirgisistan nimmt zu, da die deutsche Minderheit, insbesondere die Jugendlichen ein Interesse an der Pflege ihrer Sprache und Kultur haben. Potenziale für ein verstärktes Interesse könnten durch Initiativen zur Förderung des kulturellen Austauschs und zur Stärkung der deutsch-kirgisischen Beziehungen geschaffen werden.
KROATIEN
Die deutsche Sprache wird auch aus Deutschland mittels verschiedener Programme gefördert, beispielsweise in Form der PASCH-Schulen oder der DSD-Programme. Auch die deutsche Minderheit gibt sich durch ihre Projekte große Mühe, Deutsch als Muttersprache in den Reihen der Minderheitsangehörigen wiederzubeleben. Leider steht Deutsch in Kroatien nicht unter dem besonderen Schutz, den einige andere Minderheitensprachen genießen, weil es bei der kroatischen Ratifizierung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen im Jahr 1997 nicht als Minderheitssprache aufgenommen wurde. Die Deutsche Gemeinschaft bemüht sich schon seit Jahren, diesen Umstand zu beheben. Die kroatische Regierung fördert Aufwendungen der Minderheiten für Unterricht, Publikationen, Rundfunk und Fernsehsendungen und kulturelle Veranstaltungen. In der Broschüre des Auswärtigen Amts „Deutsch als Fremdsprache Weltweit Datenerhebung 2020“ ist nachzulesen, dass es in Kroatien insgesamt 181.177 Deutschlernende im Jahr 2020 gab.
LETTLAND
Deutsch ist keine Minderheitensprache in Lettland, sondern eine Fremdsprache. Obwohl die Arbeit der deutschen Minderheitenvereine hauptsächlich auf Lettisch erfolgt, ist das Lernen der deutschen Sprache einer der zentralen Tätigkeitsbereiche der Vereine. Bis heute engagiert sich die Generation in den Vereinen, für die die deutsche Sprache mit der Kindheit verbunden ist, weil das Deutsche zumindest teilweise als Kommunikationssprache mit Eltern oder Großeltern fungierte, in Familien wurden deutsche Lieder gesungen und deutsche Traditionen gepflegt. Für diese Generation ist die deutsche Sprache die Verbindung zur Vergangenheit, für die jüngere Generation die Möglichkeit zur Horizonterweiterung und Bereicherung.
Seit einigen Jahren bietet der VDL die Möglichkeit, am deutschen Online-Sprach-Café teilzunehmen, in dem die Teilnehmer/-innen verschiedener Sprachniveaus unter Leitung einer erfahrenen Lehrkraft Deutsch üben und aktuelle Themen diskutieren können.
Mit Unterstützung des Goethe-Instituts Riga werden nach Möglichkeit Deutschkurse für Kinder und Erwachsene in folgenden Vereinen durchgeführt: Deutscher Kulturverein Riga, Deutscher Verein „Erfolg“ Daugavpils, Deutscher Kulturverein Dobele, Deutscher Verein Liepāja, Deutsch-Lettisches Begegnungszentrum Liepāja, Deutscher Kulturverein Ventspils. Insgesamt haben die Vereine der DMI in Lettland ca. 500 Mitglieder.
Es ist momentan die Tendenz, dass die deutsche Sprache wieder an Bedeutung gewinnt, da Russisch nicht mehr als Fremdsprache in den Schulen unterrichtet wird und dadurch die deutsche Sprache wieder eine Chance hat. Im April 2024 organisierte das GoetheInstitut gemeinsam mit den Botschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den anderen deutschen Mittlerorganisationen in Lettland den „Monat der deutschen Sprache“. Der Verband der Deutschen in Lettland und der Rigaer Deutscher Kulturverein veranstalteten im Rahmen dieses Monats den Liederabend „Gemeinsames Lied“. Obwohl die deutsche Sprache in Lettland wieder positive Perspektiven hat, bleibt die Entwicklung der deutschen Minderheitenorganisationen problematisch, da es wenig Kapazität ohne institutionelle Förderung gibt.
NORDSCHLESWIG
Anteil von Gymnasiasten mit Deutsch (keine Anfänger) 2023 – Zusatzinfo: In Dänemark gibt es eine Gesamtschule von der 0. bis zur 9. oder 10. Klasse und danach ggf. ein dreijähriges Gymnasium (also nur 11., 12. und 13. Klasse).
5,9 % haben Deutsch auf A-Niveau (im Deutschen einem Leistungskurs entsprechend)
59,7 % haben Deutsch auf B-Niveau (Grundkurs)
34,3 % haben überhaupt kein Deutsch
Der Anteil ist seit 2016 kontinuierlich gefallen, wenngleich er im grenznahen Nordschleswig einen ganz geringen Anstieg zeigt. Der Anteil derjenigen, die Deutsch studieren, fällt ebenfalls – bis auf Kopenhagen: In Aalborg gibt es seit 2020 gar kein Studienangebot mehr, das die deutsche Sprache umfasst (Deutsch in Odense: Rückgang von 2018 mit 20 Studierenden auf 14 2023 - -30 %; Internationale Unternehmenskommunikation in Deutsch, Odense: von 2018 mit 19 auf 12 Studierende 2023- - 36,8 %; Internationale Unternehmenskommunikation in Deutsch, Sonderburg - von 2019 mit 23 auf 20 in 2023; Deutsche Sprache und Kultur in Kopenhagen- von 2018 mit 27 auf 28 in 2023 - +3,7 %; Deutsche Sprache und Kultur in Aarhus - von 2018 mit 30 auf 18 in 2023 - -40 %; Internationale Unternehmenskommunikation in Deutsch in Aarhus - von 2018 mit 57 auf 28 in 2023 - -50,9 %)
Deutsch ist in Dänemark in den Klassen 5-9 obligatorisch, wenn es angeboten wird, stattdessen kann auch Französisch gewählt werden. Insgesamt erhalten die Schüler/innen 390 Stunden Deutschunterricht. In Englisch sind es 630 Stunden und in Dänisch 2.160 in der gesamten Schulzeit in der sogenannten folkeskole – Volksschule (0. bis 9. Klasse).
Im grenznahen Nordschleswig bieten einige Kommunen Deutsch schon ab der 1. Klasse an, die Gesamtstundenzahl erhöht sich aber nicht. Für die deutsche Minderheit gibt es 13 Volksschulen, 19 Kindergärten, ein Gymnasium und eine Nachschule (eine fakultative, einjährige Internatsschule zwischen Volksschule und weiterer Aus- oder Schulbildung). Hier wird Deutsch als Muttersprache genutzt. Dänisch wird im gleichen Umfang wie eine Muttersprache unterrichtet, alle anderen Fächer werden auf Deutsch unterrichtet. Die Abschlüsse gelten in Deutschland wie in Dänemark.
Die Schulen der deutschen Minderheit werden vom Staat als die öffentlichen Schulen der Minderheit betrachtet, gleichwohl sind sie rechtlich sogenannte „friskoler“ und zu 100 Prozent bezuschusst.
POLEN
Deutsch als Minderheitensprache wird in Polen an Schulen in Ortschaften, in denen die deutsche Minderheit lebt (vor allem in den Woiwodschaften Oppeln, Schlesien sowie Ermland und Masuren) unterrichtet. Am 01.04.2001 ratifizierte Polen das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und seit dem 01.06.2009 gilt in Polen die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Von grundlegender Bedeutung ist in Polen das Gesetz über nationale und ethnische Minderheiten vom 06.01.2005.
Die deutsche Sprache kann im polnischen Bildungssystem sowohl als Fremdsprache als auch als Muttersprache (Deutsch als Minderheitensprache) unterrichtet werden. Für die Kinder der deutschen Volksgruppe in Polen schafft der polnische Staat die Möglichkeit, ihre Muttersprache Deutsch im Fach Deutsch als Minderheitensprache (DaM) zu lernen. Hier handelt es sich um einen Unterricht, der so konzipiert wird, dass die Erhaltung der nationalen und sprachlichen Identität der Schüler/-innen im Mittelpunkt steht. Zur Pflege der nationalen Identität organisieren die Schulen auch den Unterricht der eigenen Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit und auf Wunsch auch den Unterricht in Geografie des Herkunftslandes. Es gibt leider keine Schule, in der der gesamte Unterricht in der deutschen Sprache stattfindet. Es gibt nur einige Schulen, in denen der Unterricht in zwei Sprachen (Deutsch und Polnisch) durchgeführt wird. Die meisten Schüler/-innen besuchen den Deutschunterricht nur in der dritten Unterrichtsform: Deutsch als Zusatzstunden/ Zusatzfach (3 Stunden Deutsch als Minderheitensprache pro Woche).
Der DaM-Unterricht kann auf allen Bildungsetappen (auf Antrag der Eltern) angeboten werden. Mit dem Beginn des Schuljahres 2017/2018 ist die neue Schulreform in Polen Wirklichkeit geworden. Diese Reform kehrte zu dem zweistufigen Schulsystem bestehend aus 8-jähriger Grundschule und weiterführender Schule zurück. Das neue Bildungsgesetz erforderte die Anpassung vieler gesetzlichen Vorschriften an die neuen Regelungen, darunter auch eine Verordnung des Bildungsministers, mit der der Unterricht für die nationalen Minderheiten geregelt wird. Vor der Schulreform erlaubte das Bildungsministerium, Deutsch gleichzeitig als Minderheitensprache als auch als Fremdsprache zu lernen. Die Schüler/-innen hatten sowohl in der Grundschule (1.-6. Klasse) als auch im dreijährigen Gymnasium DaM-Unterricht. Diese Praxis bewährte sich und wurde anerkannt. Die neue Interpretation des Gesetzes nach der Schulreform ermöglicht dies aber nicht. Nach der Änderung der Auslegung der Vorschriften durch das Bildungsministerium haben die Schüler/-innen der deutschen Minderheit ab der 7. Klasse weniger Deutschunterricht (2 statt 5 Stunden wöchentlich) und lernen Deutsch nur als Fremdsprache. Sie lernen Deutsch als Minderheitensprache nur bis zur 6. Klasse
der Grundschule (3 Stunden wöchentlich) und ab der 7. Klasse lernen sie Deutsch als Fremdsprache (2 Stunden wöchentlich).
In den Schuljahren 2022/2023 sowie 2023/2024 wurde der Minderheitenunterricht (Deutsch als Zusatzfach) von der damaligen Regierung auf eine Stunde wöchentlich reduziert. Die Reduzierung des Minderheitenunterrichts galt nur für Kinder der deutschen Minderheit; Kinder anderer Minderheiten konnten ihre Minderheitensprache wie bisher, d.h. 3 Stunden pro Woche, lernen. Die diskriminierende Verordnung des Bildungsministers hat viele engagierte Angehörige der deutschen Minderheit dazu veranlasst, ihre Kräfte darauf zu konzentrieren, für die Rücknahme der diskriminierenden Regelung zu kämpfen. Von den Kürzungen des muttersprachlichen Unterrichts waren mehr als 55.000 Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche Deutschlehrer über zwei Jahre lang betroffen. Die im Herbst 2023 neu gewählte Regierung hat inzwischen die diskriminierenden Regelungen aufgehoben, so dass ab dem neuen Schuljahr 2024/2025 Anfang September die Stundenzahl wieder auf das vorherige Niveau von 3 Stunden erhöht wird.
Die deutsche Minderheit wird von Institutionen wie Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, sozial-kulturelle Gesellschaften der deutschen Minderheit (regionale und lokale Ebene) sowie Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen vertreten. Innerhalb der deutschen Minderheit ist die deutsche Sprache verbreitet. Es gibt zahlreiche Projekte zur Unterstützung der deutschen Sprache, die sich vorwiegend an Kinder und Jugendliche richten und von der Bundesregierung gefördert werden. Dazu gehören u.a. Samstagskurse, Deutsche Kinderclubs, Deutsch AG, deutschsprachiges Theaterprojekt Jugendbox, Sprachcamps und Sprachworkshops, Sommerwerkstätten, Märchennächte, das Projekt Lernraum.
RUMÄNIEN
In Rumänien kann Deutsch als erste Fremdsprache, als zweite Fremdsprache oder als Erstsprache (L1-“Muttersprache”) gelernt werden. Das Recht auf Unterricht in der Muttersprache ist in Rumänien in der Verfassung verankert und wird im Bildungsgesetz konkretisiert.
Trotz der Auswanderung eines großen Teils der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Fall des “Eisernen Vorhangs” 1989, ist in den Städten das Schulsystem mit deutscher Unterrichtssprache aufgrund seiner Attraktivität für die Mehrheitsbevölkerung erhalten geblieben. Jeder Bürger hat in Rumänien die Möglichkeit, eine Schule in den Sprachen der Minderheiten zu besuchen, sofern genügend freie Plätze verfügbar sind.
Im Schuljahr 2022/2023 waren insgesamt 22.916 Schüler/-innen an Einrichtungen mit deutscher Unterrichtssprache immatrikuliert, an denen der Unterricht aller Fächer außer Rumänisch in deutscher Sprache erfolgen kann, wenn geeignetes Lehrpersonal verfügbar ist. Dies ist nach 1990 immer schwerer realisierbar (TEMPO Online (insse.ro)).
Die Schüler/-innen der 11. oder 12. Klasse haben die Möglichkeit, das deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz (Niveau B2 oder C1 des GeRS) zu erwerben.
Die Ausbildung der Lehrpersonen geschieht für die Elementar- und Primarstufe an Universitäten in Bachelor-Studiengängen mit deutscher Unterrichtssprache. Es gibt zurzeit zwei Bachelor-Studiengänge zur Ausbildung von Lehrpersonen für den Elementar- und Primarbereich mit deutscher Unterrichtssprache in Rumänien. Für die Ausbildung von Lehrpersonen für Gymnasien und Lyzeen gibt es Studiengänge mit deutscher Unterrichtssprache an der Babeș-Bolyai Universität (Geografie, Biologie, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Ingenieurwesen u. a.) und an der Universität Bukarest. An mehreren Universitäten werden im Rahmen von Germanistik-Studiengängen Lehrpersonen für Deutsch als Erstsprache oder Deutsch als Fremdsprache ausgebildet. Aufgrund schwacher Erwerbsaussichten im Lehramt, werden Studiengänge, die für den Lehrberuf professionalisieren, von zunehmend weniger jungen Menschen als Teil ihrer Bildungslaufbahn gewählt, so dass vor allem an weiterführenden Schulen ein akuter Lehrermangel zu verzeichnen ist.
Die Fortbildung deutschsprachiger Lehrpersonen geschieht durch das Zentrum für Lehrerfortbildung Mediasch, das jährlich ein differenziertes Angebot an Fortbildungen in deutscher Sprache anbietet.
Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien erfasst die Schülerzahlen an Einrichtungen mit deutscher Unterrichtssprache in einer jährlichen Statistik. Die Schülerzahlen sind in den letzten Jahren mit kleinen Schwankungen stabil geblieben.
Die Schulbildung in deutscher Sprache genießt ein hohes Ansehen, da die Ergebnisse der Absolvent/-innen im Vergleich über dem Durchschnitt ausfallen. Den Schulen in der Sprache der deutschen Minderheit wird aufgrund ihrer Partnerschaften mit dem deutschsprachigen Ausland ebenso wie der deutschen Minderheit eine Brückenfunktion zuerkannt.
RUSSISCHE FÖDERATION
In der Russischen Föderation gelten im Bereich der Umsetzung der staatlichen Sprachenpolitik das Gesetz vom 25.10.1991 Nr. 1807-1 „Über die Sprachen der Völker der Russischen Föderation“ und das Föderale Gesetz vom 01.06.2005 Nr. 53-FZ „Über die Staatssprache der Russischen Föderation“. Demnach kann Deutsch in der Russischen Föderation als Fremdsprache und als Muttersprache gelernt werden.
In den letzten zehn Jahren war eine deutliche Schwächung der Stellung der deutschen Sprache zu erkennen, sie wird durch andere Fremdsprachen verdrängt, zum Beispiel durch Englisch und Chinesisch, das in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen hatte. Unter anderem verschlechterte sich die Situation beim Studium der deutschen Sprache im Rahmen der allgemeinbildenden Programme in Schulen und an Universitäten.
Im Jahr 2020 hatte die Staatliche Universität Omsk (OmSU) einen Optimierungsprozess eingeleitet, der zur Zusammenlegung von Fakultäten, zur Reduzierung von Fachbereichen und zur Verringerung der Zahl der Deutschlehrer/-innen führte, insbesondere wurde der Lehrstuhl für romanische und germanische Sprachen und Kulturen zwischen den Fachbereichen Englisch und Englische Philologie aufgeteilt.
Zum Vergleich: 2005 hatte der Lehrstuhl für Deutsche Philologie 26 Lehrkräfte, die aktiv im Unterrichten, in der Wissenschaft, in der Verteidigung von Dissertationen, im Verfassen von Lehrbüchern und in der Forschung auf dem Gebiet des Deutschen als Muttersprache und als Fremdsprache tätig waren. Und das passiert, während in der Region Omsk, in der sich der Deutsche Nationalkreis Asowo befindet, mehr als 50.000 Deutsche leben.
Vom 25. Oktober 2022 bis zum 25. Oktober 2023 wurden laut dem Staatlichen Ausschuss für die Anerkennung akademischer Grade (VAK) des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung der Russischen Föderation von 191 Doktorarbeiten, die in Russland in den philologischen Wissenschaften verteidigt wurden, 5 den Problemen der deutschen Sprache gewidmet.
Seit 2022 ist der neue föderale staatliche Bildungsstandard (FGOS) in Kraft, nach dem die zweite Fremdsprache aus der Liste der Pflichtfächer in der Schule gestrichen wurde. Diese Änderung beeinflusst in erster Linie Deutsch. Es war die Sprache, die von den Mittelschulen am häufigsten als zweite Fremdsprache gewählt wurde.
Deutsch hat seit der Einführung der neuen FGOS-Bildungsstandards an Bedeutung verloren. In Kamyschin, Region Wolgograd, beispielsweise wird von den 16 Schulen, an denen Deutsch als erste und zweite Fremdsprache unterrichtet wurde, die letzte Klasse mit Deutsch als zweiter Fremdsprache im Jahr 2024 ihren Abschluss machen.
Auf der VIII. Internationalen wissenschaftlich-praktischen Sprachkonferenz im Jahr 2023 haben die Experten, Hochschuldozenten und Deutschlehrer festgestellt, dass in der Russischen Föderation eine weit verbreitete Tendenz zur Verringerung des Deutschunterrichts in den Schulen (Deutschklassen) sowie zur Verringerung der Zahl der ausgebildeten Fachkräfte - Hochschulabsolvent/-innen (Hochschuldozent/-innen und Deutschlehrer/-innen) - besteht.
Hinzu kommt, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen die Motivationsgründe für Eltern und Schüler/-innen, Deutsch zu lernen, stark zurückgegangen sind: Es gibt keine breit angelegte Werbekampagne und keine Möglichkeiten, an großen deutsch-russischen Kultur- und Sprachprojekten teilzunehmen, es gibt keine Möglichkeit des Schulund Jugendaustausches, es gibt keine Möglichkeit von Hospitationen für junge Profis und Ausbildung in Deutschland, die Zahl der deutschsprachigen Unternehmensstrukturen ist stark zurückgegangen, entsprechend gibt es keine berufliche Motivation. All dies wirkt sich auf den allgemeinen Hintergrund der Entwicklung der deutschen Sprache in Russland in naher Zukunft aus, was zu einem Mangel an Lehrern und anderen Fachkräften mit Deutschkenntnissen führen kann. Zudem ging die Zahl der Kultur- und Bildungsprogramme, die von ausländischen Organisationen in Russland durchgeführt werden, in den letzten zwei Jahren drastisch zurück.
So war das Goethe-Institut aus objektiven Gründen in den letzten Jahren mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert, u.a. im Bereich der Finanzierung und der Umstrukturierung seiner internen Struktur. 2023 wurde der größte Teil des Personals des Goethe-Instituts abgebaut, so dass nur noch wenige Mitarbeiter/-innen in drei Städten der Russischen Föderation (Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk) beschäftigt waren, was eine deutliche Reduzierung der Projektaktivitäten des Goethe-Instituts in der Russischen Föderation zur Folge hatte. Gleichzeitig setzt das Goethe-Institut in einem neuen Format seine Aktivitäten fort, wenn auch in einer eher verkürzten Form, und die Sprachlernzentren als GI-Partner arbeiten größtenteils weiter - sie führen Kurse durch, nehmen Prüfungen ab und organisieren lokale Veranstaltungen.
Eine wichtige Ressource zur Unterstützung der deutschen Sprache in Russland sowie der Lehrkräfte ist das Institut für ethnokulturelle Bildung (BiZ) und insbesondere der Fachbereich Deutsche Sprache, der die Aktivitäten von Sprachclubs und das Erlernen der deutschen Sprache wie folgt unterstützt:
• bietet einen Deutsch-Fernkurs für die Zielgruppe der RD, Niveau A1 und A2 - ein einzigartiges Angebot auf dem derzeitigen Markt in der Russischen Föderation: deutsche Sprache + ethnokulturelle Komponente (Kennenlernen der Kultur und Traditionen der RD).
• unterstützt ein System von regionalen Koordinatoren und Multiplikatoren im Bereich der Spracharbeit, die vor Ort Maßnahmen für Clubleiter/-innen organisieren (6-10 pro Jahr).
Das System der Multiplikatoren ermöglicht es den Leiter/-innen von Sprachclubs, die mit den Begegnungszentren der RD in den Regionen der Russischen Föderation und den GUS-Ländern zusammenarbeiten, didaktische und methodische Unterstützung zu bieten und so die Clubaktivitäten auf einem bestimmten Niveau zu unterstützen. Zurzeit sind 8 Koordinatoren/-innen und 27 Multiplikatoren/-innen an dem Programm beteiligt.
Das Institut (BiZ) führt ein Projekt zur methodischen Beratung der Leiter/-innen von Sprachclubs in den Regionen durch (Hospitationen, Meisterklassen, Workshops mit den Leitern/-innen der Begegnungszentren der RD). Das Institut (BiZ) unterstützt die didaktische Plattform „DaF-Lehrerzimmer“ (https://vk.com/daflehrerzimmer) für Deutschlehrer/-innen und Leiter/-innen von Sprachclubs in den Begegnungszentren der Russlanddeutschen (BZ RD) und den Zentren der deutschen Kultur (ZDK) zur Heranführung an die deutsche Sprache und Kultur. „DaF-Lehrerzimmer“ ist eine moderne, interaktive Fortsetzung der didaktischen Zeitschrift „Taxi“ und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Deutschlehrern, Leitern von ethnokulturellen Clubs und Zirkeln, Sonntagsklubs für Kinder in den Zentren der deutschen Kultur (ZDK).
Das Institut (BiZ) führt regelmäßig und systematisch Webinare, Seminare und Weiterbildungsprogramme (WBP) für Clubleiter durch, erstellt Programme, Online-Kurse und Videovorlesungen und baut eine Methodensammlung zur Unterstützung der Sprachund ethnokulturellen Arbeit auf.
Das Institut (BiZ) führt Programme zu Methoden des Sprachunterrichts für unterschiedliche Altersgruppen und zur Verbesserung der Sprachkompetenz von Clubleitern durch und sorgt für didaktische Materialien für Clubaktivitäten.
Die Abteilung arbeitet mit Partnerinstitutionen zusammen und gewinnt Deutschlehrer und -spezialisten für die Teilnahme an Weiterbildungs- und Umschulungsprogrammen als Experten, Referenten und Berater.
Die internationale Zusammenarbeit des Instituts (BiZ) mit deutschen Bildungseinrichtungen wurde vorübergehend ausgesetzt.
Trotz der gegenwärtigen Tendenzen spielt die deutsche Sprache in Russland nach wie vor eine wichtige Rolle, vor allem in den Kompaktsiedlungsstätten der Russlanddeutschen.
Dank der Projekttätigkeit des IVDK zur allumfassenden Förderung der deutschen Sprache, der groß angelegten föderalen Sprachprojekte wie „Freunde der deutschen Sprache“, „Tolles Diktat“, der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Sprachkonferenz, der föderalen und regionalen ethnokulturellen Sprachtreffen für Jugendliche und Familien der RD sowie der geplanten Breitenarbeit in den Regionen im Rahmen der Klubs der Freunde der deutschen Sprache und der ethnokulturellen Klubs wird die deutsche Sprache in den Regionen Russlands erhalten (wie die große Zahl der Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Russlands an der Gesamtrussischen Aktion „Tolles Diktat“ und dem Wettbewerb „Freunde der deutschen Sprache“ belegt), insbesondere in den Kompaktsiedlungsstätten der Russlanddeutschen, wo viele Russlanddeutsche in ihrem Mutterdialekt - Deutsch - miteinander kommunizieren. Sie wird nicht nur von der älteren Generation, sondern auch von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Das Interesse der Jugendlichen am Erlernen der deutschen Sprache ist groß, wie der Bedarf an allen Projektvorschlägen des IVDK und der regionalen Organisationen sowohl bei der Zielgruppe Russlanddeutsche und ihre Familienangehörigen als auch bei externen Zielgruppen unterschiedlichen Alters zeigt.
Darüber hinaus gibt es viele Sprachprojekte, die vom Internationalen Verband der deutschen Kultur in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Universitäten und anderen Partnerorganisationen durchgeführt werden.
Leider gibt es in Russland keine staatlichen deutschen Schulen, an denen alle Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Derzeit gibt es allgemeinbildende Schulen, die im Rahmen ihres Bildungsprogramms Programme mit einer ethnokulturellen Komponente in außerschulischen Aktivitäten einsetzen, in denen neben dem Unterricht in Deutsch als Muttersprache auch Themen wie russlanddeutsche Literatur, die Geschichte der Russlanddeutschen und die Kultur, Traditionen und Bräuche der Russlanddeutschen im außerschulischen Teil des Lehrplans behandelt werden. Alle diese außerschulischen Aktivitäten werden vom Staat bezahlt und sind für die Schüler kostenlos. Darüber hinaus werden im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem IVDK und diesen Schulen (z.B. in Nowosibirsk - Progymnasium Nr. 1 „Solnyschko“ und Bildungszentrum „Gornostaj“, in Tomsk - Munizipale Bildungseinrichtungen Progymnasium „Kristina“ und Gymnasium Nr. 6, in Omsk - „Wiedergeburt“, in der Region Altai - „Zwetnopolskaja Allgemeinbilden-
de Mittelschule“, „Aleksandrowskaja Allgemeinbildende Mittelschule“) kostenlos Verbrauchsmaterialien und möblierte Räume zur Verfügung gestellt, in denen im Rahmen der außerschulischen Aktivitäten ethnokulturelle Sprachzirkel (Gesang, Theater usw.) in deutscher Sprache stattfinden. In den Kompaktsiedlungsstätten der Russlanddeutschen wird Deutsch sowohl in Schulen als auch in Kindergärten unterrichtet.
Es ist anzumerken, dass der IVDK auch Verlagsprojekte unterstützt und eine beträchtliche Menge an schöngeistiger und methodischer Literatur in deutscher Sprache herausgibt, die den Begegnungszentren der RD und ZDK russlandweit zur wirksamen Umsetzung der Projektaktivitäten zur Verfügung gestellt wird.
Ein wichtiges Instrument bei der Förderung und Popularisierung der deutschen Sprache ist das 2003 gegründete Informationsportal der Russlanddeutschen RusDeutsch - eine Ressource zu aktuellen Ereignissen im Leben der Gemeinschaft der Russlanddeutschen in Russland und im Ausland. In der deutschen Version des Portals https://rusdeutsch.eu/ werden Publikationen in deutscher Sprache veröffentlicht, die 70 Prozent der gesamten russischsprachigen Publikationen ausmachen.
SERBIEN
Bis auf wenige Ausnahmen, die nur wenige Kinder betreffen, wird in den Schulen in Serbien kein Unterricht in der Form „Deutsch als Minderheitensprache“ erteilt, da die Anzahl der Menschen, die sich der Deutschen Minderheit zugehörig fühlen, sehr gering ist und darunter auch die Zahl der Kinder mit deutschen Wurzeln einen noch geringeren Anteil ausmacht. Deutsch wird in Serbien in den Schulen als Fremdsprache bzw. als Deutsch als zweite Fremdsprache gelehrt. Englisch ist die für alle Schüler/-innen verpflichtete erste Fremdsprache, die zweite Fremdsprache ist wählbar. Deutsch kann als Minderheitensprache unterrichtet werden, sobald sich an einer Schule genügend Kinder der DMi anmelden.
Studiengänge der Germanistik gibt es an fünf Hochschulen des Landes.
Die deutsche Sprache wird in Serbien durch die bekannten Institutionen und deren Programme gefördert: Zentrale für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, DAAD, Deutsche Schule Belgrad etc. Bezüglich der Zahlen der Deutschlernenden insgesamt können wir nur auf die Erhebung aus dem Jahr 2020 zurückgreifen: Im Jahr 2020 gab es in Serbien insgesamt über 171.000 Deutschlernende.
Das Goethe-Institut Serbien wurde seitens des Auswärtigen Amtes um die Erhebungen der Statistiken zu den aktuellen Deutschlernenden gebeten, Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Im Jahr 2020 wurde die Tendenz der Zahlen für Serbien als steigend eingeschätzt. (Quelle: ebenda) Der DHV „St. Gerhard“ stellt für die Region um Sombor allerdings ein eher sinkendes Interesse an Deutschkursen fest.
Infolge der Nachkriegsereignisse, Diskriminierung und natürlichen Assimilation in der Slowakei kann leider keine Gemeinde mehr eine Klasse mit ausschließlichem Unterricht in der deutschen Muttersprache bilden. Der Karpatendeutsche Verein (KDV) setzt sich dafür ein, dass Kinder aus karpatendeutschen Familien die Möglichkeit haben, neben der slowakischen Sprache auch Deutsch zu lernen. Zu diesem Zweck bietet der KDV erweiterten Deutschunterricht an Schulen in Preßburg, Deutsch Proben, Kesmark, Hopgarten und Metzenseifen an. Allerdings findet an diesen Schulen kein Unterricht ausschließlich in deutscher Sprache statt. Vollständig deutschsprachiger Unterricht wird nur an der privaten Deutschen Schule Preßburg (Kindergarten, Grundschule, Gymnasium) und am Deutschen Gymnasium in Deutschendorf (Poprad) angeboten. Diese Schulen sind jedoch nicht spezifisch für die Karpatendeutschen gedacht, sondern bieten ein vertieftes Deutschlernprogramm für alle Schüler/-innen an, die sich für eine intensive Deutschspracherfahrung interessieren.
Das Goethe-Institut bietet ebenfalls Deutsche Sprachkurse in der Slowakei an, um die deutsche Sprache zu unterstützen. Der KDV organisiert traditionelle Kinder- und Jugendlager sowie eine Kinderwerkstatt zur Förderung der deutschen Sprache. Seit über 25 Jahren veranstaltet der KDV Friedrich-Lam-Wettbewerbe im deutschen Vortragen von Poesie und Prosa an Schulen.
In den letzten Jahren ist der Unterricht der deutschen Sprache in der Slowakei stark rückläufig, insbesondere nach der Novellierung des Schulgesetzes im Jahr 2011, das Englisch als erste Fremdsprache verpflichtend gemacht hat. Deutsch wird meist als zweite Fremdsprache unterrichtet. Trotz zahlreicher Initiativen zeigt sich nur ein geringer Effekt bei der Förderung der deutschen Sprache als Sprache der deutschen Minderheit.
Die Slowakei hat ihre erste deutschsprachige Hochschule, die „Goethe-Hochschule Bratislava“, erhalten, nachdem die slowakische Regierung im Juli 2012 die Genehmigung zur Gründung erteilte. Die Hochschule wird spezialisierte Programme in Internationaler
Unternehmensführung, Fremdenverkehrswirtschaft und Medienkommunikation anbieten und wird von privaten Förderern und Studienbeiträgen finanziert.
TSCHECHIEN
Im Jahr 2023 hat Tschechien beschlossen, die rechtliche Stellung und Förderung der deutschen Sprache stark auszubauen. Teil III der Europäischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen wurde speziell für Deutsch angewendet, was am 28. Februar 2024 in Kraft trat. Diese Maßnahme umfasst 35 Förderbestimmungen, die in ausgewählten Kreisen der Tschechischen Republik gelten. In diesen Kreisen wird an öffentlichen Schulen ein zweisprachiger Unterricht mit einem deutschsprachigen Wochenstundenanteil von mindestens 50% angeboten. Die deutsche Geschichte und Kultur sollen vertieft unterrichtet werden, und ein unabhängiges Aufsichtsorgan überwacht den deutschsprachigen Unterricht. An Universitäten und Hochschulen wird Deutsch nicht nur als Fach (Germanistik) angeboten, sondern auch als Sprache anderer Studienfächer genutzt. Zusätzlich verpflichtet sich Tschechien zur Förderung von deutschsprachigen Medien, Veranstaltungen und kulturellen Einrichtungen sowie zur Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Gebietskörperschaften im Ausland. Diese Schritte markieren einen historischen Moment und sollen die gesellschaftliche Bedeutung der deutschen Sprache in Tschechien stärken.
Deutsche und deutsch-tschechische Institutionen im Bereich Sprache und Kultur umfassen das Goethe-Institut Prag, das Goethe-Zentrum Pardubice, das Goethe Centrum Budweis, das Collegium Bohemicum, den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, das Centrum Bavaria Bohemia und das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren.
Wichtige deutsche Kulturveranstaltungen sind die Datenbank „šprechtíme“, eine Kampagne zur Förderung der deutschen Sprache in Tschechien, die vom Goethe-Institut Prag, Goethe-Zentrum Pardubice, Goethe Centrum Budweis und weiteren deutschen und österreichischen Institutionen unterstützt wird. Weitere Initiativen umfassen das Informations- und Beratungszentrum des DAAD in Prag, das IfA Entsendeprogramm in Kooperation mit der Landesversammlung, das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen, das Deutsch-Tschechische Jugendforum, die Deutsche Schule Prag, die Initiative Schulen: Partner der Zukunft (PASCH), ZfA & DSDSchulen für das Deutsche Sprachdiplom und die Deutsch-Tschechische Fußballschule.
Allerdings ist die deutsche Sprache innerhalb der deutschen Minderheit nicht so weit verbreitet. Es gibt jedoch einige Projekte zur Unterstützung der deutschen Sprache, darunter „Deutsch macht Spaß 2024“, deutschsprachige Wochenenden, Sprachkurse, Deutschunterricht für Kinder und Sprachcamps.
Die deutsche Minderheit wird von Institutionen wie der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, dem Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechischen Republik, dem Landesecho, dem Thomas-Mann-Gymnasium und der Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung vertreten.
In der Tschechischen Republik wird der staatliche Deutschunterricht ausschließlich unter dem Titel „Deutsch als Fremdsprache“ angeboten. Die deutsche Minderheit, vertreten durch die Landesversammlung der deutschen Vereine, trägt die Verantwortung für die Grundschulen zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung, insbesondere des Thomas-Mann-Gymnasiums. Diese Schulen haben den rechtlichen Status von Privatschulen in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft. Etwa 600 Schüler/-innen besuchen diese Schulen, wobei die Mehrheit deutschstämmig ist oder einen deutschen Hintergrund in ihren Familien hat. Es zeigt sich eine leichte Zunahme an Deutschlernenden.
Am 28. Februar 2024 wurde der Schutz der deutschen Sprache durch die Europäische Charta der Minderheiten- oder Regionalsprachen wirksam. Dieser Antrag wurde bereits 2019 von der Landesversammlung der deutschen Vereine an die tschechische Regierung gestellt. Ziel ist es, die deutsche Sprache und den Deutschunterricht in 9 Bezirken des Landes künftig deutlich zu stärken.
Zusätzlich zu den genannten Schulen wird der erweiterte Deutschunterricht an folgenden Schulen angeboten:
DAS – Deutsche Auslandsschulen, betreut von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – 1 Schule
DSD-Schulen: Schulen in nationalen Bildungssystemen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten, ebenfalls betreut von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – 30 Schulen
DPS – Deutsch-Profil-Schulen: Schulen in nationalen Bildungssystemen mit einem ausgeprägten deutschen Unterrichts- und Abschlussprofil, ebenfalls betreut von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – 1 Schule
Fit-Schulen: Schulen in nationalen Bildungssystemen, an denen Deutschunterricht aufbzw. ausgebaut wird, betreut vom Goethe-Institut – 3 Schulen
Die deutsche Sprache ist eine von 13 Sprachen, die von der Charta der Regional- oder Minderheitensprachen unterstützt werden. In der Ukraine gibt es keine Klassen, in denen Deutsch als Minderheitensprache unterrichtet wird. Derzeit möchten die DMi den Status der deutschen Sprache im Bildungsbereich erhalten.
Eine Roadmap zur Schaffung von Bedingungen für die Verbesserung der Qualität des Unterrichts in der Staatssprache sowie in den Sprachen der indigenen Völker und nationalen Gemeinschaften in den allgemeinbildenden Schulen für die Jahre 2023-2027 wurde ins Leben gerufen. Sie soll dazu beitragen, Bedingungen für die Verbesserung der Qualität des Unterrichts in der Staatssprache sowie in den Sprachen der indigenen Völker und nationalen Minderheiten zu schaffen (oder deren Erlernen zu fördern). Es ist vorgesehen, die Sprache in außerschulischen Bildungszentren, den Kulturzentren, zu unterstützen.
Gleichzeitig haben Vertreter der deutschen Gemeinschaft, die Deutsch als Fremdsprache und als Muttersprache in den Begegnungszentren der DMi in der Ukraine lernen, die Möglichkeit, die Sprache nicht nur mit professionellen Lehrern/-innen zu lernen, sondern auch durch ethnokulturelle Projekte sowie Prüfungen zur Bestätigung des Sprachlevels im Bildungs- und Prüfungszentrum ÖSD oder im Partner-Goethe-Institut abzulegen, um ein internationales Zertifikat zu erhalten.
Das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Englisch zur Sprache der interkulturellen Kommunikation macht. Allerdings darf die Anzahl der Unterrichtsstunden für Deutsch in allgemeinbildenden Schulen keinesfalls reduziert werden, und die Bedeutung der deutschen Sprache darf weder in Schulen noch an Universitäten verringert werden! Denn Deutsch ist die Sprache der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Gemeinschaft. In der Ukraine gibt es keine deutschen Klassen und keine deutschen Schulen, in denen Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Daher ist es für die DMi wichtig, die bisherige Unterrichtsbelastung in Deutsch beizubehalten und nicht zu reduzieren, da die Vertreter/-innen der deutschen Gemeinschaft und Eltern für ihre Kinder Bildungseinrichtungen mit Deutschunterricht (2–3-mal pro Woche) wählen.
Zusammen mit der Germanistenvereinigung macht der Rat der Deutschen der Ukraine auf allen Plattformen des Bildungsministeriums, des DESS und des Parlaments auf diese Problematik aufmerksam und wendet sich an die Verwaltungen, Schulen und Universitäten. Der RDU ist der Ansicht, dass die Muttersprache bewahrt werden muss, um den interkulturellen Dialog und das gegenseitige Verständnis in der ukrainischen Gesellschaft weiter zu stärken.
Für die ethnischen Deutschen hat das Treffen der gemischten Regierungskommission in diesem Jahr große Bedeutung, eines der Themen ist das Erlernen der deutschen Sprache und ihre Rolle im Bildungsprozess der Ukraine.
Die Anzahl der allgemeinbildenden Schulen staatlicher und kommunaler Trägerschaft, in denen die Sprachen der nationalen Minderheiten und indigenen Völker als eigenständiges Schulfach unterrichtet wurden, belaufen sich auf 3.392 im Jahr 2023. Die Anzahl der Schüler/-innen, die die Sprachen der nationalen Minderheiten und indigenen Völker als eigenständiges Schulfach in allgemeinbildenden Schulen staatlicher und kommunaler Trägerschaft lernten: Deutsche – 543.560 im Jahr 2023. Die Arbeit zur Unterstützung und Entwicklung der deutschen Muttersprache ist bei der DMi sehr effektiv organisiert, insbesondere in den deutschen Begegnungszentren der Ukraine. Sprachkurse und Seminare, die regelmäßig für ethnische Deutsche in der Ukraine, insbesondere für die Jugend, abgehalten werden, helfen nicht nur beim Erlernen der deutschen Sprache, sondern auch beim Vertiefen des Wissens über Kultur, Geschichte und Traditionen der deutschen Gemeinschaft.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit der RDU ist die Veröffentlichung von Literatur, Lehrbüchern, Lehr- und Lernmaterialien, wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen in deutscher Sprache, was ebenfalls zur Bewahrung der Sprache und Kultur beiträgt. Es ist sehr wichtig, dass in den Lehrbüchern unbedingt Informationen über die ethnischen Deutschen und ihre tausendjährige Geschichte enthalten sind.
UNGARN
Deutsch als Minderheitensprache wird den ca. 65.000 Heranwachsenden vom Kindergarten bis hin zum Abitur in mehr als 500 Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Grundschule, Mittelschule) beigebracht. Das Fach „Deutsche Sprache und Literatur“ wird in 5 Wochenstunden und das selbständige Fach „Volkskunde der Minderheit“ in einer Wochenstunde unterrichtet. Wenn die Zusammensetzung der Lehrkräfte es ermöglicht, werden einige Fächer in deutscher Sprache wie Geschichte, Geografie, Mathematik, Biologie/Naturkunde, Informatik, Sport, Musik vermittelt. Als Schulträger können der Staat, die Landesselbstverwaltung der Minderheit, die örtliche Minderheitenselbstverwaltung, die Kirche oder eine Stiftung fungieren.
Einschätzung zu den Tendenzen der Popularität der deutschen Sprache: Die Zahl der Deutschlerner geht in den letzten Jahren in einem schnelleren Tempo als zuvor zurück. Dabei gewinnt Englisch (Welt-, Wirtschafts-, IT-Sprache und leichter als Deutsch) im-
mer mehr an Bedeutung, aber auch das Interesse andere, eventuell exotische Sprachen zu erlernen, wie Spanisch, Chinesisch etc. nimmt zu.
Dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist auch aus der Sicht der deutschen Minderheit in Ungarn äußerst wichtig.
Potenziale:
• intensive und proaktive Öffentlichkeitsarbeit, wie u.a. Wunderbar-Woche etc.
• Betonung der Bedeutung der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen (deutsche Firmen in Ungarn)
• besonders wichtig ist die Rolle der Angehörigen der deutschen Minderheit, da bei ihnen auch emotionale Argumente auch für die Wahl der deutschen Sprache sprechen – daher Förderung der deutschen Minderheit insbesondere des Bildungssystems, der kulturellen Tätigkeiten und der Jugendarbeit
USA
Begriffsbestimmung
Die Sprachsituation der in den USA lebenden Deutschsprachigen lässt sich nicht in die politische Bestimmung einer Minderheitensprache einordnen, wie sie von der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen für die europäischen Länder vorgesehen ist. Der Begriff ‘Minderheitensprache’ ist daher für Deutsch in den USA, auch für die Sprachschulen/sog. Samstagsschulen nicht zweckdienlich.
Neben den Termini ‘Fremdsprache’, worunter die herkömmlich im institutionalisierten Schulbetrieb gelernte Zweit- oder weitere Sprache/n verstanden wird, und ‘Muttersprache’, wobei Unterschiedliches zum Ausdruck kommt, z.B. Elternsprache, Erstsprache oder bestbeherrschte Sprache, bedient sich die angloamerikanische Sprachwissenschaft zusätzlich der Bezeichnung „Herkunftssprache“. Dieser Begriff (im engeren Sinn) entspricht der zumeist zuerst erworbenen Sprache eines Individuums, das in einer Familie aufwächst, in der nicht (nur) die dominante Umgebungs- oder Landessprache benutzt wird, sondern auch die Sprache der Eltern oder eines Elternteiles. Dies hat Einfluss auf die besondere Identitätsbildung der heranwachsenden Person, bewahrt kulturelle Zugehörigkeit und historisch-sprachliche Werte. In ihrer Beherrschung fällt die Herkunftssprache meist unterschiedlich aus. Mündliche Sprachfähigkeit ist durchgehend besser entwickelt als schriftliche. Die Herkunftssprache erlangt im Vergleich zur Muttersprache und Fremdsprache verschiedene Kompetenz, andersartigen Einsatz und Bedeutung für die Sprecher.
Schulisch gesehen haben Fremdsprache, Herkunftssprache und Muttersprache daher vielerlei unterschiedliche und besondere Ansprüche und Lernbedürfnisse.
In Deutschland wird Herkunftssprache meist als Deutsch als Fremdsprache (DaF) oder Zweitsprache (DaZ) bezeichnet, was aus praktischen und politischen Gründen unangebracht und unzuträglich ist.
Sprachsituation
Deutsch in den USA existiert seit 1608, als deutsche Handwerker halfen, Jamestown aufzubauen. Die folgende enorme deutschsprachige Einwanderung, vor allem im 19. Jh., verhalf dazu, dass Deutsch weitverbreitet gesprochen und gelehrt wurde und eigene deutsch-amerikanische Dialekte sich bildeten. Eine zweite Welle starker Einwanderung fand nach dem 2. Weltkrieg statt. Zu diesem Zeitpunkt entstanden die meisten heute existierenden privaten Samstagsschulen in den USA.
Deutschstämmige in den USA sind laut letzter Volkszählung mit fast 50 Millionen Menschen noch immer die größte ethnische Volksgruppe. 1,06 Millionen Menschen geben an, deutschsprachig zu sein, was die höchste Zahl von Deutschsprechern außerhalb der deutschsprachigen Länder Europas bedeutet. Obgleich die USA noch vereinzelt ein reges deutsches Vereinsleben führt, existieren keine geographischen “communities” mehr wie früher. Bereits Heinz Kloss (1935) spricht von “scattered Germans”, Streudeutschtum.
Außerhalb der im landesweiten Schulsystem verankerten meist DaF-Institutionen, existieren in den USA ca. 70 von Eltern gegründete und geführte private Sprachschulen mit ca. 7000+ Schülern/-innen. Es handelt sich dabei um anspruchsvollen Deutschunterricht, meist am Samstag, daher Samstagsschulen genannt, mit 3 Unterrichtsstunden, der Schüler/-innen bereits im Vorschulalter ab 3 Jahren aufnimmt und sie oft durchgehend bis zum Abgang aus der high school behält. Die Schüler/-innen sind weitgehend Herkunftssprachler, wobei ebenso Fremdsprachler/-innen, falls in ihrer Umgebung der offizielle Deutschunterricht fehlt, diese Schulen besuchen. Die Sprachschulen sind somit klassische “Begegnungsschulen “ und folglich die von der Auswärtigen Kultur und Bildungspolitik (AKBP) oft gewünschten Multiplikatoren. Viele dieser Schulen sind Paschschulen und in vielem identisch mit den “Auslandsschulen”, die Frank-Walter Steinmeier als “Brücken in Richtung Zukunft” bezeichnete hat.
Datenerhebungen
Angebotsdifferenzierte, geographisch umfassende und neuere Zahlen für den Deutsch-
unterricht auf den verschiedenen Unterrichtsebenen sind aufgrund der föderalistischen Situation der USA und der unterschiedlich beschriebenen und bewerteten Unterrichtsangebote schwer erhältlich.
Eine quantitative Erhebung des Auswärtigen Amtes von 2020, “Deutsch als Fremdsprache weltweit”, weist auf eine Reihe von Fördermaßnahmen für Deutsch hin, zählt für die USA 6 Auslandsschulen, 114 Paschschulen, 95 DSD Schulen und 13 Fit-Schulen und informiert, dass sie die deutschsprachigen Minderheiten (aller Länder), die Deutsch im privaten Umfeld sprechen und lernen, in ihrer Statistik nicht berücksichtigen kann. Diese Statistik zeigt ebenso, dass bei 1.548 DaF (Deutsch als Fremdsprache) -Schulen in den USA und 330.398 DaF-Lernenden im Vergleich zu 2015 ein Rückgang von 69.102 Lernenden existiert und verzeichnet bei 990 Hochschulen mit Deutsch und 80.594 Studierenden seit 2015 ebenfalls einen Rückgang von 15.755 Studenten. Weiterhin zählt sie in den USA 59 DaF-Einrichtungen für Erwachsenenbildung, 6.040 DaF-Lernende in der Erwachsenenbildung und 4.203 DaF-Lernende an Goethe-Instituten.
Neuere Angaben von Unterrichtseinrichtungen ergeben sich aus der AATG German Programs May 2023 Statistik. Danach existieren Deutschprogramme ohne Ortsangabe wie folgt: in 1859 high schools, in 924 Universities and Professional Schools, in 340 Junior Colleges, in 335 MS-Middle Schools, in 104 K-12 Comprehensive Programs, in 98 Middle-High School Combos, in 98 Sprachschulen (wozu GI-Programme gezählt werden), und in 5 Virtual Programs.
Die Statistik der Modern Language Association, deren Zahlen sich lediglich auf das Universitätsstudium beziehen, zeigt, dass Deutsch als Angebot für Undergraduates an Universitäten heute nicht mehr nach Spanisch und Französisch an dritter Stelle, wie meist angegeben, sondern nach zusätzlich American Sign Language und Japanisch an 5. Stelle rangiert und von 2016 bis 2021 eine Einbuße von 32.2 % erlitten hat. Für Graduate Students ist Deutsch nach zusätzlich Altgriechisch, Hebräisch und ebenfalls ASL zwischen 2016 und 2021 an sechste Stelle geraten mit einer Einbuße von 76.9%. Die Gesamtzahl der universitären Einrichtungen wird in dieser Erhebung mit 818 angegeben. Neben dieser quantitativen Auflistung publiziert die AATG (American Association of Teachers of German) erfreulicherweise auch qualitative Angaben in Form von Ergebnissen der AATG National German Examinations, Stufen 1 – 4, an denen sowohl Schüler der high schools als auch der Samstagsschulen teilnehmen. Auf Stufe 4, die etwa dem Sprachniveau B1/2 entspricht, nehmen 2.460 Schüler öffentlicher high schools, 560 Schüler privater high schools und 382 Schüler von Samstagsschulen teil. Die erlangte Gesamtpunktzahl (Lese-/Hörverstehen) liegt bei 60.85 für die high schools und bei 81 für die Samstagsschulen.
Noch deutlicher lassen sich unterschiedliche Resultate zwischen dem institutionellen Deutschunterricht und den privaten deutschen Samstagsschulen in den USA erkennen, wenn die DSD-Ergebnisse dieser Schulen in Vergleich gestellt werden. Nach den letzten den Sprachschulen vorliegenden Statistiken aus dem Jahre 2017, wurden 43 % aller DSD I Prüfungen in den USA an Samstagsschulen abgelegt und 80 % aller Prüflinge erreichten B1 in allen 4 Bereichen. 67 % aller DSD II Prüfungen wurden an Samstagsschulen abgelegt und 89 % aller Prüflinge erreichten das DSD II (59 % DSD auf C1 Niveau und 30 % DSD auf B2 Niveau). Dieser qualitative Unterschied ist verständlich als das Ergebnis von Herkunftssprachlern, wie sie oben beschrieben wurden, im Vergleich zu DaF-Lernenden. Er ist auch ein bedeutender Beweis der Leistungsfähigkeit der Samstagsschulen und ihrer Schüler/-innen und eine Voraussetzung dafür, dass die Samstagsschulen als wichtiger und legitimer Bestandteil im deutschen Sprachangebot in den USA anerkannt und weiterhin unterstützt werden.
Das allgemeine Abnehmen an Interesse und Angebot am Deutschunterricht oder Deutschstudium teilt die USA mit anderen Ländern. Die Zahlen der US-Samstagsschulen dagegen bleiben konstant. Als private, eigenständige Institutionen, deren Einschreibezahlen von unter 50 bis zu 500 reichen, sind sie institutionellen Anweisungen und dem Druck von Schließungen nicht ausgesetzt. Die Beziehung zu den deutschsprachigen Ländern wird durch die Schüler/-innen durch Sommerbesuche bei den europäischen Verwandten und während des Jahres durch die Möglichkeiten internationaler Medien aufrechterhalten. Ihr Wunsch in Deutschland zu studieren oder eine Lehre zu machen, nimmt zu. Die Tendenz US Sprachunterrichts an Hochschulen und High Schools ist negativ, an den Samstagsschulen positiv.
USBEKISTAN
In der Republik Usbekistan genießt die deutsche Sprache einen sehr guten Ruf. Es gibt in dem Land nach wie vor Schulen mit erweitertem Deutschunterricht, an denen man Deutschkenntnisse bis zum Niveau C1 erwerben kann. Solche Schulen gibt es in Taschkent, Margilan, Samarkand und Buchara. Neben den staatlichen Schulen existieren auch private Schulen, die neben Englisch auch Deutsch unterrichten. Es gibt auch Kindergärten, in denen Deutsch spielerisch erlernt wird.
In Taschkent lernen am Goethe-Institut Hunderte von Studenten/-innen Deutsch. Außerdem gibt es in vier Städten Usbekistans (Taschkent, Fergana, Buchara und Samarkand) deutsche Kulturzentren, in denen ebenfalls Deutsch unterrichtet wird. Diese Zentren sind hauptsächlich für die deutsche Minderheit bestimmt, die auf dem Staatsgebiet lebt.
Auch in Städten wie Taschkent, Fergana, Andischan, Nukus, Samarkand und Buchara bieten staatliche Universitäten Deutschkurse an. Für Studenten/-innen, die an Colleges, Lyzeen und Universitäten studieren, besteht die Möglichkeit, an Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes teilzunehmen. Der DAAD bietet zahlreiche Programme an, die es Studierenden ermöglichen, ihre Kenntnisse zu verbessern oder sich in Deutschland weiterzubilden: Semesterstipendien, einmonatige Sommerkurse, Bachelor- und Masterstudiengänge. Darüber hinaus schließt Usbekistan verschiedene Partnerschaftsabkommen mit diversen Organisationen in Deutschland (medizinische Einrichtungen, Industrie usw.) ab, in deren Rahmen Fachkräfte aus Usbekistan in Deutschland arbeiten können. Dazu sind zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache erforderlich, was wiederum dazu führt, dass die Zahl derer, die Deutsch lernen möchten, steigt.
• Bildung und Forschung - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de): https://www. auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/lateinamerika/bildung/201474
• Goethe-Schule Buenos Aires - PASCH-Initiative (pasch-net.de): https://www. pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/suedamerika/arg/goethe-schulebuenos-aires.html
• Weltweit gefragt: Deutsch als Fremdsprache - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt. de): 200803-xlsx-data.xlsx (live.com)
• Rosenberg-1998-2002_Deutsche-Minderheiten-in-Lateinamerika.pdf (europa-uni. de): https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/ Rosenberg_Publikationen_Texte/Rosenberg-1998-2002_Deutsche-Minderheitenin-Lateinamerika.pdf
• Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2020 (auswaertiges-amt. de): https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2344738/b2a4e47fdb9e8e2739bab2565f8fe7c2/deutsch-als-fremdsprache-data.pdf
• Bundesministerium des Innern (2016): Deutsche Minderheiten stellen sich vor, online unter: deutsche-minderheiten-stellen-sich-vor-1.pdf (fuen.org)
• Germandsen, Dominika Judtya (2020): Masterarbeit zum Thema Deutsch in Dänemark in kleinen und mittleren Unternehmen: https://projekter.aau.dk/projekter/ files/343223572/Masterarbeit_Dominika_Germandsen_AAU.pdf
• Auswärtiges Amt (2020): Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2020 (auswaertiges-amt.de)
• Dörflinger, Markus; Atz, Hermann (2020): DaF: Zielgruppen und Motivation. Quantitative und qualitative Studie zur Rolle der deutschen Sprache in Italien. GoetheInstitut Italien
• Foschi Albert, Marina (2005): „Andere Länder, andere Sitten“. Germanistik in Italien und ihr Verhältnis zur Inlands-Germanistik. In: Deutsche Sprache/33, S. 169-181
• Risse, S. (2024): Ein Sonderfall: Migration in der mehrsprachigen Autonomen Provinz Bozen-Bolzano. In: Redder, Angelika (ed.): Sprachliche Teilhabe Migrierter – Sprachenpolitik in Deutschland, Frankreich und Italien im Vergleich. Münster: Waxmann, S. 97-108
• Risse, S. (2020): «Zerschtl schaug ma olm af die Respirazione». Mehrsprachige Schreibroutinen von deutschsprachigen Studierenden in Südtirol. In: Hepp, Marianne/Salzmann, Katharina (Hg.): Sprachvergleich in der mehrsprachig orientierten DaF-Didaktik: Theorie und Praxis, Istituto Italiano di Studi Germanici, Rom, S. 205220
• Risse, S. (2016): Societal Multilingualism in South Tyrol: Language Contact, Diglossia and the Dominance of the German-Speaking Minority. In: Alpen-Kaukasus. Natur- und kulturräumlicher Vergleich, ed. by Scharr, K./Steinicke, E. Innsbruck: University Press, 97-104
• Risse, S. (2013): Sieg und Frieden - Zum sprachlichen und politischen Handeln in Südtirol/Sudtirolo/Alto Adige, Monaco: iudicium
• Bernhard Brehmer, Grit Mehlhorn (2018), Herkunfssprachen (Linguistik und Schule), Tübingen: Narr Francke Attemptro Verlag GmbH, S. 24
• Ammon, Ulrich (1991), Die Internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin, New York
• US Census Bureau American Community Survey (2009-2013)
• Kloss, Heinz (1935) Fremdniederlassungen - Streudeutschtum, Berlin, Volk und Reich.
• https://www.auslandsschulwesen.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/Webs/ZfA/DE/ Aktuelles/2022/220301_Bundespraesident_Schirmherr.html
• https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2344738/b2a4e47fdb9e8e2739bab2565f8fe7c2/deutsch-als-fremdsprache-data.pdf
• https://www.aatg.org/german-program-network
• https://www.mla.org/content/download/191324/file/Enrollments-in-LanguagesOther-Than-English-in-US-Institutions-of-Higher-Education-Fall-2021.pdf
• https://www.nge.aatg.org/
• Ammon, Ulrich: Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt, Kapitel „E“: Deutsch als Minderheitensprache, aber nicht staatliche Amtssprache“ S. 255-397
• Neue alte Partner für die Zukunft. Deutschsprachige Gemeinschaften in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Hrsg.: Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, 2020
DIE MITGLIEDER DES FACHBEIRATES „DEUTSCHE SPRACHE“

Dr. Olga Martens
Leiterin des Fachbeirats, Germanistin, Sprach- und Partnerschaftsinitiative e. V.,

Prof. Dr. Renate v. Ludanyi
Professorin German Department, Western Connecticut State University und Präsidentin der German Language School Conference in den USA

Prof. Dr. Ildikó Erika Stephanie Risse
Professorin an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen

Prof. Dr. Gesine Lenore Schiewer
Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik, Universität Bayreuth und Präsidentin der internationalen Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik

Florencia Agozino
Deutschlehrerin an der Goethe-Schule in Buenos Aires

Sybilla Dzumla
Projektkoordinatorin von Deutsch-AG und Begegnungsstättenarbeit beim VdG in Polen

Luis Bastidas
Wissenschaftler an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth

Maria Gołąbek
Methodische Beraterin im Fach Deutsch als Minderheitensprache am regionalen Zentrum für Lehrerbildung in Rybnik in Polen

Claudia Knauer
Büchereidirektorin
Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig

Olga Beder
Methodikerin für deutsche Sprache Gesellschaftliche Stiftung Wiedergeburt Kasachstan

Dr. Liana Regina Iunesch
Universitätsdozentin Deutscher Studiengang für Grundschulpädagogik an der Lucian-Blaga-Universität, Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien

Theresia Szauter
Beauftragte des Vorstandes der Gemeinnützigen Stiftung des Ungarndeutschen Bildungszentrums
Von der Stiftung Verbundenheit begleitet durch:

Dr. Marco Just Quiles
Stellv. Geschäft sführer, Projektleiter für Lateinamerika

Mónika Ambach Projektkoordinatorin, Koordinatorin des Fachbeirates „Deutsche Sprache“