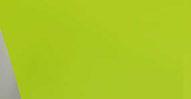contamination control report
Offizielles Organ

n Viele Spezies in kontrollierten Umgebungen
n Per Reinraumtechniker durch die Galaxis
n Ausbau des Reinraums in Buchs

Offizielles Organ

n Viele Spezies in kontrollierten Umgebungen
n Per Reinraumtechniker durch die Galaxis
n Ausbau des Reinraums in Buchs


n Annex 1 – spannend wie ein Krimi
AUTOMATISIERTE


Reduzierte Eingriffe durch Automatisierung
Erhöhte Produktivität und niedrigere Kosten
Autonome 24-StundenProbenahme
Einfache Erfüllung regulatorischer Anforderungen
Minimiertes Risiko von Bedienungs fehlern
Zuverlässige Datendokumentation

n Strategisches Geo-Risikomanagement
Liebe Leserinnen und Leser, liebe SwissCCS-Mitglieder,
Die geopolitischen Spannungen und protektionistischen Massnahmen der letzten Jahre stellen die Reinraumtechnik vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere die jüngst verschärften US-Zölle auf High-Tech-Produkte und essenzielle Materialien aus Europa und Asien wirken sich spürbar auf Hersteller und Betreiber von Reinräumen aus. Die Versorgung mit Schlüsselkomponenten wie Hochleistungsfiltern, Reinraumtextilien und Steuerungssystemen wird zunehmend unsicher. Lieferzeiten sind kaum vorhersehbar, alternative Bezugsquellen oft mit hohen Mehrkosten und regulatorischen Hürden verbunden. Diese Unsicherheiten zwingen Unternehmen zur Anpassung. Während grosse Konzerne ihre Lieferketten diversifizieren und verstärkt auf regionale Produktionsnetzwerke setzen, stehen kleine und mittlere Betriebe vor erheblichen Herausforderungen. Die Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern wird zunehmend kritisch hinterfragt, doch lokale Alternativen sind selten kurzfristig verfügbar. Zudem erfordern solche Umstellungen erhebliche Investitionen und langfristige Planung. Die Unwägbarkeiten geopolitischer Entscheidungen machen strategisches Risikomanagement und belastbare Beschaffungsstrategien unerlässlich. Neben der Kostenfrage gewinnt auch die technologische Souveränität an Bedeutung. Wie unabhängig können Europa und die Schweiz in der Herstellung von Reinraumkomponenten werden? Die Einführung neuer Handelszölle auf Metalle, Elektronik und Spezialchemikalien beeinflusst die Kosten, Innovationsprozesse und Investitionsentscheidungen. Während einige Unternehmen bereits auf Nearshoring setzen, bleibt abzuwarten, ob diese Massnahmen ausreichen, um den Handelskonflikten langfristig zu begegnen.
Die Branche muss auf nachhaltige Strategien setzen. Effizienzsteigerungen im Betrieb, optimierte Energieverbräuche und gezielte Materialeinsparungen können dazu beitragen, wirtschaftliche Belastungen durch Handelsbarrieren abzufedern. Gleichzeitig gewinnen resi -

Roman Schläpfer SRRT-SwissCCS Vorstandsmitglied
liente Beschaffungsketten an Bedeutung, alternative Bezugsquellen und flexible Beschaffungsstrategien werden zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regulierungsbehörden ist entscheidend, um wirtschaftliche Tragfähigkeit mit regulatorischer Konformität in Einklang zu bringen.
SwissCCS nimmt diese Entwicklungen ernst und fördert den Dialog zwischen Industrie, Behörden und Normungsgremien. In Zeiten tiefgreifender Umbrüche sind alle Akteure der Branche gefordert, sich aktiv einzubringen und gemeinsam Strategien für eine nachhaltige und widerstandsfähige Reinraumtechnik zu entwickeln. Die derzeitigen geopolitischen Unsicherheiten können auch als Chance für eine strukturelle Neuausrichtung genutzt werden.
Die kommenden Jahre werden wegweisend sein – sie bieten die Möglichkeit, den Wandel mitzugestalten und den Übergang von globalen Abhängigkeiten hin zu resilienteren, technologisch souveränen Strukturen voranzutreiben. Nur durch vorausschauendes Handeln, den Austausch von Wissen und konsequente Innovation bleibt die Reinraumtechnik langfristig wettbewerbsfähig und zukunftssicher.
Mit freundlichen Grüssen

Roman Schläpfer
n Gestion stratégique des risques géopolitiques
Chères lectrices, chers lecteurs, chères et chers membres de la SwissCCS,
Les tensions géopolitiques et les mesures protectionnistes de ces dernières années confrontent la technologie en salle blanche à des défis considérables. Ce sont notamment les droits de douane américains en hausse récente sur les produits high tech et les matériaux essentiels provenant de l’Europe et de l’Asie qui affectent sensiblement les fabricants et les exploitants des salles blanches. L’approvisionnement en composants clés tels que les filtres haute performance, les textiles pour salles blanches et les systèmes de commande, devient de plus en plus problématique. Les délais de livraison ne sont guère prévisibles et aux sources d’approvisionnement alternatives sont souvent liés d’importants surcoûts et des obstacles réglementaires.
Ces incertitudes obligent les entreprises à s’adapter. Si les grands groupes diversifient leurs chaînes d’approvisionnement et misent de plus en plus sur les réseaux de production régionaux, les petites et moyennes entreprises font face à d’importants défis. La dépendance envers des fournisseurs asiatiques étant de plus en plus remise en question, les alternatives locales ne sont toutefois que rarement disponibles à court terme. De plus, de telles restructurations requièrent d’importants investissements et une planification dans la durée. Les aléas des décisions géopolitiques nécessitent impérativement une gestion stratégique des risques et de robustes stratégies d’approvisionnement. Outre l’aspect des coûts, la souveraineté technologique gagne en importance. Dans quelle mesure l’Europe et la Suisse peuvent-elles devenir indépendantes au niveau de la fabrication de composants pour les salles blanches? La mise en place de nouveaux droits de douane commerciaux sur les métaux, l’électronique et les produits chimiques spéciaux influe sur les coûts, les processus d’innovation et les décisions d’investissement. Certaines entreprises misant déjà sur le nearshoring, on verra si ces mesures suffiront pour faire face aux conflits commerciaux sur le long terme.
Le secteur doit miser sur des stratégies durables. Les gains d’efficacité dans l’exploitation, les consommations d’énergie optimisées et les économies de matériaux ciblées peuvent contribuer à atténuer les charges financières résultant des barrières commerciales. En même temps, les chaînes d’approvisionnement résilientes gagnent en importance, les sources d’approvisionnement alternatives et les stratégies d’approvisionnement flexibles deviennent des facteurs cruciaux pour la réussite. Une étroite collaboration de l’industrie, la science et les autorités de régulation est essentielle pour concilier viabilité économique et conformité réglementaire.
La SwissCCS observe attentivement ces évolutions et encourage le dialogue entre l’industrie, les autorités et les organismes de normalisation. Dans des périodes de grands bouleversements, tous les acteurs du secteur sont invités à s’impliquer activement et à développer conjointement des stratégies pour assurer la durabilité et la résilience de la technologie en salle blanche. Les incertitudes géopolitiques actuelles peuvent également servir d’opportunité pour une réorientation structurelle.
Les années à venir seront cruciales –elles offrent la possibilité de participer activement à la transformation et d’accélérer la transition des dépendances mondiales vers des structures plus résilientes et technologiquement autonomes. Ce n’est que par une approche prévoyante, l’échange de connaissances et l’innovation permanente que la technologie en salle blanche restera compétitive à long terme et saura faire face à l’avenir.

Cordialement, Roman Schläpfer
Dear Readers, dear Members of the SwissCCS
Geopolitical tensions and protectionist measures of the last years confront the cleanroom technology industry with considerable challenges. The recently increased US customs duties on high-tech products and essential materials from Europe and Asia, in particular, affect producers and operators of cleanrooms. Supplies of key components such as high-performance filters, cleanroom fabrics and control systems are increasingly endangered. Delivery times are difficult to predict and alternative sources of supply frequently lead to high extra costs and regulatory problems. Enterprises are forced to adjust to these uncertainties. While large concerns diversify their supply chains and rely increasingly on regional production networks, small and medium-size companies face major problems. The dependence on Asian suppliers is more and more questioned and criticised, while local alternatives are only rarely available at short notice. Moreover, such changes call for considerable investments and long-term planning. The unforeseeable consequences of geopolitical decisions definitely require a strategic risk management and reliable procurement strategies.
Apart from the question of costs, the technological superiority becomes more important. How independent can Europe and Switzerland get in the production of cleanroom components? Levying new commercial duties on metals, electronics and special chemicals influences costs, innovation processes and investment decisions. While some enterprises resort already now to nearshoring, it re -
mains to be seen whether or not these measures are sufficient to overcome the trade conflicts in the longer term.
The industry must rely on lasting strategies. Efficiency increases in the operations, optimised energy use and specific material savings can contribute to the elimination of economical strains from trade barriers. Resilient procurement chains become more important at the same time, alternative sources of supply and flexible procurement strategies reveal to be a central success factor. A close cooperation between industry, science and regulatory authorities is decisive to achieve a balance between commercial viability and regulatory conformity.
SwissCCS takes these developments serious and encourages the dialogue between industry, authorities and standardisation committees. In these times of extensive changes, all actors of the industry are requested to actively engage themselves and jointly develop strategies for a sustainable and robust cleanroom technology. The current geopolitical uncertainties may also be a chance for a structural realignment.
The years ahead will be revolutionary in that they enable us to shape along the change, to make the transition from global dependences resilient and to promote technologically superior structures. It is only by far-sighted acting, the exchange of know-how and uncompromising innovation that cleanroom technology remains competitive and holds a secure future in the long term.
Sincerely

Roman Schläpfer



«Überraschend viele Spezies in kontrollierten Umgebungen»
interview
«Überraschend viele Spezies in kontrollierten Umgebungen» Seite 4
fachartikel
Per Reinraumtechniker durch die Galaxis Seite 8
Mikrobiologische Verunreinigungen im Reinraum lassen sich mit einem Mopp von Oberflächen entfernen –Risiko gebannt. Welches Bakterium oder welches Virus der Mitarbeiter dabei eliminiert hat, interessiert nicht, oder doch? Der «Annex 1» verlangt dennoch eine Identifizierung!

Reinraumtechnik verändert unsere Lebenswelt und macht viele Innovationen überhaupt erst möglich – ein Streifzug vom Brotofen bis zum Weltraum. 04
22 08
Per Reinraumtechniker durch die Galaxis

Annex 1 hat viel gelöst, bleibt dennoch spannend wie ein Krimi
Der Annex 1 wird vielfach immer noch als «neu» empfunden. Dabei ist er schon zweieinhalb Jahre in Kraft. In den letzten beiden Jahren habe ich eine Welt-Tour zu diesem Thema gemacht, und so ist es Zeit für eine Bilanz aus der Perspektive der Reinraum-Praxis.
Selbstklebende Objektträger für reproduzierbare Gewebe-Färbung Seite 12
kundenprojekt
OP-Teams freuen sich über eine dritte Option zur Lüftung Seite 14
publireportage
Modulare Reinraumanlage als langfristige Übergangslösung Seite 16
firmenberichte
Hautschutzcreme schützt und pflegt Haut von Handschuhträgern Seite 18
Partikelzähler: In kritischen Bereichen zählt der Komfort Seite 18 Produktion läuft und läuft dank Auto-Sedimentationsplattenwechsler Seite 19
A n der Reinraumwerkbank zum Teil Geräuschpegel wie leichte Musik Seite 20 Ausbau des Reinraums in Buchs für die Innovationsförderung Seite 21
normierung
Annex 1 hat viel gelöst, bleibt dennoch spannend wie ein Krimi
veranstaltungen
Seite 22
Schweizer Aussteller bereichern Cleanzone Seite 26
Reinraum profitiert von Facebook-Milliarden Seite 29
Optimierung der Filtereffizienz im Fokus Seite 33
LOUNGES 2025 – Das war Reinraum pur Seite 34
Mit AI schneller zum Wirkstoff oder zum Analyseergebnis Seite 35 Von Processing bis Packaging, Partikelanalyse und Verpackung Seite 37
verband
Jahresbericht 2024 der SwissCCS Seite 38 Rapport annuel 2024 Seite 39
SwissCCS an der Ilmac: Future Trends in der Reinraumtechnik Seite 40
SwissCCS lanciert neues Format: «Coffee Break Session» Seite 41 4 8 14 16 18 22 26 38
Mikrobiologische Verunreinigungen im Reinraum lassen sich mit einem Mopp von Oberflächen entfernen – Risiko gebannt. Welches Bakterium oder welches Virus der Mitarbeiter dabei eliminiert hat, interessiert nicht, oder doch? Der seit zweieinhalb Jahren gültige «Annex 1» verlangt im Rahmen der EMPQ (Environmental Monitoring Performance Qualification) dennoch eine Identifizierung von mikrobiellen Verunreinigungen bis hin zur Bestimmung von unbekannten Organismen. Christian Scheuermann, Global Technical Services Manager bei Charles River Laboratories, erläutert, was dies für die betriebliche Praxis bedeutet.
Christian Ehrensberger: Herr Scheuermann, was genau verlangt der Annex 1?
Christian Scheuermann: In der Vergangenheit waren Trends auf die quantitative Bestimmung der mikrobiologischen Belastung im Allgemeinen und im Besonderen in Bezug auf die Warn und Aktionslimits fokussiert. Im neuen EU Annex 1 wird das Trending im Rahmen des Umgebungs und Prozessmonitorings um die Kenntnis von Veränderungen in der mikrobiellen Flora und bei den dominierenden, spezifischen Organismen erweitert. In diesem Kontext werden Sporenbildner und Schimmelpilze explizit erwähnt. Genauere Anforderungen werden für die verschiedenen Reinraumklassen formu
liert. In den Reinraumklassen A und B müssen Isolate bis zur Speziesebene identifiziert werden. Darüber hinaus sollte der mögliche Einfluss dieser Organismen auf die Produktqualität evaluiert werden. Für die Identifizierung von Isolaten aus den Reinraumklassen C und D wird keine taxonomische Ebene gefordert. Dennoch gilt ein besonderes Augenmerk Sporenbildnern und Schimmelpilzen. Zusammen genommen sollte die Betrachtung aller Mikroorganismen in einer Risikobewertung eingebunden sein. Die Aussagekraft der Risikobewertung ist infolge einer Identifizierung auf Speziesebene wesentlich höher als beispielsweise auf Genusebene. Daher sollte auch bei der Qualifizierung

der Reinraumklassen C und D die Identifizierung aller Isolate auf Speziesebene in Betracht gezogen werden.
Um ein Verständnis der typischen mikrobiellen Flora aufrecht zu erhalten, sollten auch in diesen Reinraumklassen Identifizierungen in ausreichender Häufigkeit erfolgen. Dies ist insofern ratsam, als dass Mikroben häufig aus Reinraumklassen niedrigerer Stufen in Reinraumklassen höherer Stufen gelangen. Dementsprechend ist eine grundlegende Beschreibung der mikrobiellen Flora auf Speziesebene auch in niedrigeren Reinraumklassen ein sinnvoller, da vorausschauender Ansatz für eine beschleunigte Ursachenermittlung und effektive CAPA Massnah

Vergleich zwischen Identifizierungsergebnissen auf Speziesebene aus dem Umgebungsmonitoring über den Zeitraum eines Jahres und aus verschiedenen EMPQ-Projekten. (Grafiken: Scheuermann):
Über einen längeren Zeitraum (allgemeine EM-Daten dargestellt: 1 Jahr) nimmt die Anzahl verschiedener Arten zu, zeigt aber auch saisonale Veränderungen (hier nicht dargestellt). Insgesamt weist das Umgebungsmonitoring eine signifikant höhere Anzahl an verschiedenen Arten (n = 1992) aus als während unterschiedlicher EMPQs (n = 161, 114, 61, 48, 288) festgestellt. Die Zunahme des Keimspektrums im Umgebungsmonitoring ist überwiegend durch Spezies verursacht, die nicht einem gemäß der EMPQ zu erwartendem Keimspektrum zu zuordnen sind. Die Normalisierung der Art- vs. Probenanzahl zeigt jedoch insgesamt eine reduzierte Biodiversität im Umgebungsmonitoring (# Isolate/ Sp ezies: 47) im Vergleich zur EMPQ (# Isolate/Spezies = 10,88; 3,95; 4,85; 6,54; 12,63; durchschnittlich 7,8 # Isolate/Spezies).

Einige Ziele für die Desinfektion: Luftkeime in 1000-facher Vergrößerung, darunter zum Beispiel verschiedene Arten der Gattung Mic rococcus various. (Bild: Adpic)
men: corrective action, preventive action. Hier gilt: Je besser die Kenntnis der mikrobiellen Flora, desto genauer das Verständnis einer aktuellen bzw. die Antizipation einer möglichen Bedrohungslage. Ebenso werden Entscheidungsprozesse beschleunigt und die Effektivität beschlossener Massnahmen gesteigert.
Die Berücksichtigung der mikrobiellen Flora auf Speziesebene findet nicht nur beim Umgebungs und Prozessmonitoring Eingang, sondern ebenso in anderen Kapiteln, wie beisielsweise der «Aseptic Process Simulation», kurz: APS, der parametrischen Freigabe und Desinfektion. Auch hier wird explizit auf die Notwendigkeit einer genauen Identifizierung hingewiesen. Gründe dafür sind die Ermittlung möglicher Kontaminationsquellen (APS), die mögliche mangelnde Effektivität von Sterilisierungsprozessen (parametrische Freigabe) beziehungsweise Veränderungen in der mikrobiellen Flora als Ergebnis unzureichender Desinfektionsmassnahmen.

Typisch Bacillus: Diese Bakterien weisen die Form von Stäbchen auf. (Bild: Adpic)
Christian Ehrensberger: Warum ist es überhaupt wichtig, die Mikroorganismen im Einzelnen zu kennen, statt sie einfach nur zu beseitigen?
Christian Scheuermann: Wir haben Daten aus dem Umgebungsmonitoring über ein Jahr ausgewertet und mit Identifizierungsergebnissen aus Projekten der Reinraumqualifizierung verglichen (Abbildung 1). Ziel dieses Vergleichs war ein besseres Verständnis hinsichtlich einer möglichen Veränderung der Art Zusammensetzung über die Zeit zu gewinnen. Die Daten aus dem Umgebungsmonitoring verschiedener pharmazeutischer Hersteller zeigen im Zeitraum eines Jahres 1992 verschiedene Spezies in 93626 Isolaten. Diese Zahl ist um ein Vielfaches höher als die durchschnittliche Anzahl von 134 verschiedenen Arten in 6475 Isolaten im Rahmen unterschiedlicher ReinraumQualifizierungen, obwohl innerhalb des für das Umgebungsmonitoring genannten Zeitraums verschiedene Reinigungsmass

Besonders gefährliche Art der Gattung Staphylococcus: der Staphylococcus aureus – seine Eliminierung kann Mitarbeiter vor schweren Er krankungen bewahren. (Bild: Adpic)
nahmen durchgeführt wurden. Über einen längeren Zeitraum zeigen sich zudem auch saisonale Veränderungen, insbesondere im Hinblick auf filamentöse Pilze. Normalisiert man die oben erwähnten Werte, so ergibt sich mit durchschnittlich 47 Proben pro Art (93626 Proben bei 1992 verschiedene Spezies) im Umgebungsmonitoring und durchschnittlich 7,8 Proben pro Art (6475 Proben bei 134 verschiedene Spezies) in der Reinraumqualifizierung eine niedrigere Biodiversität für das Umgebungsmonitoring. Geht man jedoch von einer kontrollierten Umgebung aus, so ist die Anzahl der im Umgebungsmonitoring identifizierten Arten überraschend hoch.
Obwohl die häufig vorkommenden Gattungen, sprich: Micrococcus spp., Staphylococcus spp. und Bacillus spp., in ihrer Artenzusammensetzung recht stabil erscheinen, tragen eher ungewöhnliche Gattungen und Arten im Laufe der Zeit zur Artenvielfalt bei. Es sind meist diese ungewöhnlichen Mikroorganismen, die Kontaminationen, Fälle ausserhalb der Spezifikationen (Out of Specification, OOS) oder sonstige Abweichungen verursachen und daher so früh wie möglich und genau identifiziert werden sollten.
Aus diesen Beobachtungen lassen sich zwei Hypothesen formulieren: Pharmazeutische Herstellungsumgebungen sind weniger in einem «state of control» als angenommen und angewandte Beseitigungsmassnahmen sind zum einen weniger effektiv und zum anderen wird deren selektiver Druck auf die mikrobielle Flora und deren Anpassungsfähigkeit unterschätzt.
Christian Ehrensberger: Welches sind die wichtigsten oder gefährlichsten Mikroorganismen? Und wie weist man sie nach?
Christian Scheuermann: Zunächst einmal ist die Kritikalität einer Art an die Produktionsumgebung, den Herstellungsprozess, das Produkt an sich, die Gefahr beziehungsweise das Risiko für den Patienten sowie an die Eigenschaften dieser Spezies gebunden. Folglich kann das mit einer Art assoziierte Risiko und damit eine Kategorisierung dieser Spezies als beispielsweise bedenklicher Organismus («objectionable organism») nur durch eine genaue Identifizierung des Isolates erfolgen.
Im Hinblick auf die «Gefährlichkeit» der Mikroorganismen wird das von Pilzen ausgehende Risiko massiv unterschätzt. Wie eine Überprüfung der letzten fünf Jahre Rückrufbescheide zeigt, sind verschiedene Arten von Mikroorganismen mit dem Rückruf von Arzneimitteln verbunden. Einer der Hauptgründe für Rückrufe ist –neben gramnegativen Bakterien (die den häufigsten Grund für mikrobiologisch bedingte Rückrufe darstellen) – eine Pilzkontamination [1]. Dennoch entsprechen nur


…doch empfiehlt es sich häufig, diese Identifizierung auch für C und D vorzunehmen. (Bild: Shutterstock)
zirka 14 Prozent aller in der pharmazeutischen Industrie von uns identifizierten Isolate Pilzen.
In einem Kontaminationsszenario sind wir angehalten, den möglichen Ursprung einer Kontamination zu ermitteln. Diese Anforderung setzt eine genaue Kenntnis der verursachenden Art voraus. Daraus lassen sich weitere Information wie beispielsweise Endotoxin /Toxinsynthese, Habitat, Kohlenstoffquellen, Wachstumstemperatur, anaerobe/aerobe sowie sporenbildende Fähigkeiten ableiten. Basierend auf dieser Information können weitere Proben der gleichen Spezies, aber unterschiedlicher Herkunft bei vergleichbarem Habitat für eine Stammtypisierung, beispielsweise mittels Single oder MultiLocus Sequence Ty ping Assays, zur Ermittlung des Kontaminationsursprungs gezogen werden.
Single oder Multi Locus Sequence Typing Assays sind aufgrund der zu sequenzierenden Zielgene artspezifisch. Folglich lässt die Häufigkeit der Nutzung dieser Assays Rückschlüsse auf kontaminierende und damit «wichtige beziehungsweise gefährliche» Mikroorganismen zu. Daten aus knapp 2100 Stammtypisierungen zeigen, dass 46 Prozent der Kontaminanten Wasser , teilweise auch Boden assoziierte Bakterien (Pseudomonas spp., Ralstonia spp., Bacillus spp., Burkholderia spp.) waren. 40 Prozent der kontaminierenden Arten waren mit dem Menschen assoziiert, darunter, wie erwartet, mehrheitlich Hautkeime (Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Curtobacterium spp.), aber auch Salmonella spp. und Enterococcus spp. Der Anteil sporenbildender Arten war mit 23 Prozent und der filamentöser Pilze mit 13 Prozent signifikant. Wenn man also von den «wichtigsten» oder «gefährlichsten» Mikroorganismen spricht, sollte nicht der Mensch als Hauptrisiko, sondern sämtliche möglichen Einflüsse, ergo auch der Eintrag von aussen sowie Pilze Eingang in diese Analyse finden. Gerade im Hinblick auf die Patienten
sicherheit sollten wir alle Risiken und nicht nur die möglicherweise wahrscheinlichsten berücksichtigen. Denn insbesondere immunsupprimierte Patienten sind wesentlich höheren Risiken ausgesetzt als Gesunde. Besonders vor diesem Hintergrund muss die Analyse und das Trending der Artzusammensetzung auf einer möglichsten genauen Art Identifizierung basieren.
Christian Ehrensberger: Wie bestimmt man die unbekannten Mikroorganismen? Zum Beispiel solche, für die es keine Vergleichsstandards gibt oder bei denen man nur weiss: «Da sind noch Mikroorganismen, die wir nicht kennen – aber welche?» Christian Scheuermann: Die grundlegende Herausforderung bei der Bestimmung von Mikroorganismen ist zunächst einmal deren Anzucht. Gerade in pharmazeutischen Herstellungsbetrieben sind Mikroorganismen infolge wachstumshemmender oder wachstumsverhindernder Massnahmen gestresst. Das hat zur Folge, dass nicht alle in der Umgebung oder beispielsweise in einem Wassersystem lebenden Organismen repräsentativ isoliert werden können. Dennoch erfolgreich kultivierte Isolate sind zusätzlich häufig lebens , aber nicht weiter kultivierungsfähig (viable, but not culturable; VBNCs). Solche Isolate können mit biochemischen Systemen, aber auch mittels Massenspektrometrie nicht identifiziert werden. Diese Keime müssen aufgrund der Stabilität der DNA durch die Sequenzierung entsprechender Zielgene (16S rDNA für Bakterien und ITS Region für Hefen/Pilze) bestimmt werden.
Im Allgemeinen beruht die Phylogenie und damit Taxonomie der Bakterien und Pilze auf der 16S/ITS Sequenzierung. Das hat zur Folge, dass jede bekannte Spezies durch einen sogenannten Typ Stamm definiert ist, für den eine jeweilige 16Soder ITS DNA Sequenz publiziert wurde. Ist also für ein Isolat keine 16S oder ITSDNA Sequenz valide publiziert, liegt für
diese Spezies keine Beschreibung nach den geltenden ICNP/ICSP Regeln vor (International Code of Nomenclature of Prokaryotes/International Committee on Systematics of Prokaryotes). Folglich gehört diese Probe einer bis dato nicht beschriebenen und veröffentlichen Art an. In diesen Fällen wird das Isolat einer höheren taxonomischen Ordnung, beispielsweise der Gattung, zugeordnet. Einer der vielen Vorteile der 16S ITS DN ASequenzierung ist die Möglichkeit der Vergleichbarkeit verschiedener Sequenzen unterschiedlicher Isolate. Ein solcher Vergleich kann beispielsweise hinsichtlich von Isolaten des gleichen Genus, die aber bisher nicht beschriebenen Spezies angehören, weitere wertvolle Informationen bezüglich der Verwandtschaft dieser Proben liefern. Resultiert der Sequenzvergleich solcher Proben in einem, von anderen Spezies des gleichen Genus, separaten Cluster im Stammbaum und haben die Isolate untereinander sehr ähnliche oder gar identische Sequenzen, so kann davon ausgegangen werden, dass diese Proben der gleichen, bisher nicht beschriebenen
Mehr als ein Name! Eine mikrobielle Identifizierung beinhaltet ber eits die Charakterisierung der Mikrobe, die klarstellt,… – …wo sich die Mikrobe befindet und wie sie sich möglicherweise ausbreiten könnte (Kontaminationsursprung), – …inwieweit sie welchen Reinigungsund Desinfektionsverfahren widersteht (Sporenbildung), – …ob sie Endotoxine oder andere Toxine im Allgemeinen produziert, – …welche Art von Risiko sie für Einrichtung, Mitarbeiter und Produkte darstellt, – …wie sich Sterilität noch besser gewährleisten lässt, – …wie sich Kosten, beispielsweise verursacht durch ineffizientes CAPA, einsparen lassen.


Besser, es genau zu wissen: Laboruntersuchung an der Sequenzierungs-Workbench. (Bild: Shutterstock)
Art angehören. Eine solche Erkenntnis ist gerade für Investigationen, aber auch für das Tracking und Trending sehr aufschlussreich.
Christian Ehrensberger: Wie könnte aus Ihrer Sicht ein Gesamtkonzept zur effektiven Kontrolle von Mikroorganismen im Reinraum aussehen? Und an welchen Stellen muss man es nach dem «neuen» Annex 1 etwas anders gestalten als nach dem alten?
Christian Scheuermann: Das im neuen Annex 1 geforderte Trending des Keimspektrums in Verbindung mit der bisherigen quantitativen Beschreibung rückt die
mikrobielle Identifizierung näher ans Zentrum der Kontaminationskontrollstrategie (Contamination Control Strategy, CCS). Eine CCS fordert Überwachungssysteme, einschliesslich der Einführung wissenschaftlich fundierter, moderner Methoden, die die Erkennung von Kontaminationen optimieren. Wie bereits erwähnt, soll ein präventiver Ansatz verschiedene Aspekte wie Trendanalyse, Untersuchungen, CAPA und Ursachenermittlung mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung, umfassen.
Kurzum: Die genaue Kenntnis mikrobieller Risiken für die Produktionsumgebung, den Herstellungsprozess und für das Produkt
soll eine Kontamination des Produkts möglichst von vornherein verhindern. Diese Forderung kann ein quantitativer Ansatz alleine nicht erfüllen, da ein solcher Ansatz das mikrobielle Risiko nicht weiter qualitativ charakterisiert. Eine solche qualitative Einschätzung ist nur durch eine genaue mikrobielle Identifizierung möglich.
Genaue Identifizierungen von verschiedenen Probenahmestellen schaffen in Ihrer Gesamtheit ein Überwachungssystem. Denn eine mikrobielle Identifizierung ist nicht nur ein Name. Sie beinhaltet bereits die Charakterisierung der Mikrobe.
Folglich gehört eine ausreichende Kenntnis der Veränderungen der Anzahl und der Zusammensetzung der vorliegenden Mikroflora auf Speziesebene zur Basis eines Gesamtkonzeptes zur effektiven Kontrolle von Reinräumen. In diesem Zusammenhang ebenso wichtig ist eine ausreichende Anzahl und Variation der Probenahmenstellen, insbesondere in «Problembereichen», sowie ein aussagekräftiges Tracking und Trending zur Beschreibung von aktuellen und Antizipation von möglichen zukünftigen Veränderungen des Keimspektrums. Eine entsprechende Reinraumqualifizierung schafft dafür die Grundlage.
Literatur
1. Sandle, Tim (March 2018): Investigating and Addressing Fungal Contamination in Pharmaceutical Cleanrooms. Journal of GxP Compliance. 22.)

Reinraumtechnik verändert unsere Lebenswelt und macht viele Innovationen überhaupt erst möglich – ein Streifzug vom Brotofen bis zum Weltraum.
Reinraumplaner kommen herum. Sie haben Einblick in viele Branchen. Von Satellitenmanufaktur bis Mikrochipfabrik, von Apotheke bis Krankenhaus, vom Brotofen bis ins Labor – die Bandbreite der Einsatzgebiete von Reinraumtechnik hat mit den Jahrzehnten stark zugenommen. Bei den Bauformen und Gebäudeausstattungen herrscht eine ebenso grosse Vielfalt wie bei den Verhaltensvorschriften und Kleidungsregeln. All dies folgt aus dem beabsichtigten Anwendungsbereich, der mal allumfassende äusserste Strenge, mal nur punktuelle Hygiene verlangt. Was man beim Blick in diese Reinräume zu sehen bekommt, unterscheidet sich entsprechend stark voneinander. Das erkennt man gut an der Kleidung der Menschen, die dort arbeiten. Die einen sehen aus wie Raumfahrer, sind komplett verhüllt, tragen Schutzbrillen und atmen durch Masken. Chirurgen operieren nicht ohne Maske und aseptische Handschuhe – ein steriler Anblick, der es selten in Krankenhaus-Seifenopern schafft. Andere Reinraumbeschäftigte tragen zum Overall
ein Bart-Netz und antistatische Schuhe, aber keine Handschuhe und Atemmasken. Wiederum andere lassen sich in einem Reinraum geringerer Klasse in Strassenkleidung blicken. Sie marschieren durch die Schleuse, ab ob gar nichts wäre. Letzteres ist zwar oft ein Zeichen mangelnder Einweisung oder Disziplin. Wir sahen einen Bauarbeiter mit Schubkarre in einer Satellitenmontagehalle, der hatte sein Haarnetz über den Helm gestülpt statt über seine Matte. Dass seine Proforma-Haube nichts bringt, sondern die Produktion gefährdet, war ihm entweder nicht bewusst oder egal. Es gibt zwar Reinraum-Arbeitsplätze, wo tatsächlich nur minimale Kleidungsvorgaben gemacht werden – zum Beispiel eine OP-Maske und Handschuhe für solche, die Käse oder Wurst verpacken, oder ein Haarnetz für jene, die an einer Maschine Plastikfolien herstellen. Das ähnelt der Funktion einer guten alten Kochmütze. Was jemand trägt, hängt von dem Zweck ab, dem der jeweilige Reinraum dienen soll. Das Produkt bestimmt die Strenge der Kleiderordnung

und den nötigen Reinheitsgrad. Dass dieser in der Praxis immer erreicht wird, kann leider nicht behauptet werden. Mit Beispielen für Nachlässigkeit und Ignoranz liesse sich eine Bibliothek der Reinraumliteratur anlegen. Was tun diese mehr oder weniger aufwendig gekleideten Reinraumbeschäftigten, wenn sie ihrem Tagwerk nachgehen? 40 Jahre Berufserfahrung als spezialisierter Planer und Zertifizierer von Reinräumen bieten dem Autor die Gelegenheit für einen Über-, Rück- und Ausblick: Wie hat sich die Querschnittstechnologie entwickelt und wie wird es weitergehen? Damit eine Entwicklung deutlich wird, lohnt sich der Blick von den 1980er-Jahren bis heute und noch etwas darüber hinaus. Auch wenn viele den Fortschritt nicht bemerkt haben oder ihn nicht der Reinraumtechnik zuschreiben würden, so ist er doch eingetreten. Ohne die Reinraumzunft und ihre Innovationen wären die Erfolgsgeschichten aus den folgenden Einsatzgebieten undenkbar.
Techno-Paläste der Reinheit: «Zucht» von Mikrochips
Der Mensch ist im Umfeld von empfindlichen Mikrostrukturen ein Problem –umso mehr, je kleiner und feiner diese werden. Als stete Quelle von Verschmutzungen emittieren Arbeitskräfte Partikel, die Schaden anrichten. Atem, Schuppen, Hygiene, Verhalten – alles gefährdet Prozesse, die steril und partikelfrei bleiben sollen. Kaum etwas beschreibt die Mission der Reinraumtechniker besser, als das Streben, die Beschäftigten davon abzuhalten, mit ihren Emissionen Produktionsprozesse zu gefährden. Und wie erbarmungslos Reinraumtechniker diesen Gedanken zu Ende denken, zeigt sich nirgends stärker als in der Mikroelektronik. Elektronische Bauteile wurden von 40 Jahren noch von fleissigen Händen hergestellt, oft in den Fabriken Asiens. Viele Leute sassen an Werkbänken, Absaugvorrichtungen über sich, und löteten vor sich hin. Im Lauf der Zeit sassen immer weniger da, weil Arbeitsschritte automatisiert
wurden. Die Investition in Maschinen lohnte sich, weil damit die menschengemachten Emissionen und damit die Ausschussraten sanken.
Wird heute eine Mikrochipfabrik errichtet, ist diese menschenleer. Der Chip entsteht eingehaust im Vakuum und wird von Fertigungsschritt zu Fertigungsschritt in Vakuumboxen transportiert, über Shuttles an der Decke. Geburtshelfer der Hochleistungschips sind somit Reinräume im Reinraum. Wenn Menschen mal eingreifen und die Halle betreten, dann sind auch sie maximal eingehaust. Die Atemmaske lässt keinen Hauch aufs Produkt zu. Denn einmal auf die Chipstruktur geatmet, wäre diese wertlos. Eine Reinigung bringt nichts, da auch sie die Struktur schädigen würde. Nur Vorbeugung hilft. Reinigungskräften dies klarzumachen, ist ein Unterfangen für sich. Nicht immer ist es erfolgreich.
Bitte atmen Sie nicht in einer Ba tteriefabrik für E-Autos!
Ein Autokennzeichen mit einem «E» am Ende ist heute nichts Besonderes mehr. Möglich wird die E-Mobilität durch grosse integrierte Batterien, die die Energie für den Antrieb liefern. Deren Herstellung im grossen Stil ist ein Thema unserer Zeit –und ein aktuelles Innovationsgebiet für Reinraumtechnik.
Die Herausforderung ergibt sich daraus, dass die Fertigung der Batteriezellen noch vergleichsweise neu und unerprobt ist. Die Hersteller steigen auf einem niedrigen Qualitätsniveau ein. Es gibt Werke, in denen ist jede zweite Batterie Ausschuss. Vergleichbar ist diese Fehlerrate mit dem Niveau der Mikrochipfertigung in den 1980er-Jahren. Der Vergleich stimmt hoffnungsvoll, dass die Ausschussrate der Batteriefabriken drastisch sinken wird. Bei Mikrochips liegt der Ausschussanteil heu -
te nämlich bei unter 1 Prozent. Mit anderen Worten: Wo die Mikroelektroniker heute stehen, wollen die Batterietechniker erst noch hin.
Neben elektrisch geladenen Partikeln gibt es jedoch eine besondere Bedrohung für die Batteriequalität. Das bislang unbeherrschte Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Batteriekathoden sind hochempfindlich gegen Feuchte. Unter 2 Prozent Luftfeuchte werden verlangt. Zum Vergleich: Wo sich Menschen aufhalten, sind 50 bis 70 Prozent Luftfeuchte normal. Wer auch immer in einer Batteriefabrik arbeiten wird, kommt um eine besonders konstruierte Atemmaske nicht herum. Wahrscheinlich hält man diese Arbeitsbedingungen nur wenige Stunden lang aus. Die Energie für die Batterien stammt heute häufig aus Quellen, die nicht nachhaltig sind. Auch das soll sich dank Reinraumtechnik ändern. Sie ermöglicht Fortschritte neuer Technologien zur Stromerzeugung. So entstehen Solarzellen in streng kontrollierter Umgebung. Deren möglichst uniforme kristalline Mikrostruktur ist schutzbedürftig. Diese Fertigung ist am besten aufgehoben in Roboterhand. Auch hier sind Menschen kaum noch anzutreffen.
Äusserst empfindlich ist auch die Herstellung von Spiegeln, die zu Hunderten in solarthermischen Kraftwerken zum Einsatz kommen. Sie bündeln Sonnenlicht konzentriert auf die Spitze eines Towers, wo Hitze entsteht und zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Je genauer die Spiegel gefertigt sind, desto besser funktioniert die Lichtkonzentration. Fremdpartikel im Spiegel würden die Ausbeute trüben, wie bei einer Brille. Auch im Betrieb sollte man die Finger von den Spiegeln lassen. Geringste Fettspuren an der Oberfläche genügen, und bei Hitze platzt der Spiegel.

Götter in Weiss gibt es nur dank
Te chnik und Hygiene
Wer medizinischer Behandlung bedarf, muss nicht wissen, wie im Operationssaal eines Krankenhauses für mikrobiologische Reinheit gesorgt wird. Oder wie der Impfstoff hergestellt wird, den man sich in die Blutbahn spritzen lässt. Oder wo die Tablette herkommt, die als nächste zu schlucken ist. Sicher ist nur, dass es im Interesse aller Behandlungsbedürftigen liegt, dass dabei alles mit sauberen Dingen zugeht. Dafür sorgen – neben diszipliniertem Personal – praxiserprobte Reinraumtechnik und Hygienestandards. Wo sie versagen, öffnet sich eine Hölle trotz Göttern in Weiss. Wie der Blick in Kliniken in fernen Ländern lehrt, herrscht dort oft erst ein Hygienebewusstsein wie bei uns vor 40 Jahren.
Die höchsten Sicherheitsstandards in Krankenhäusern gelten in aseptischen Bereichen. Hier steht die Abwehr von Keimen im Fokus. Deren Bekämpfung wird überwacht und zertifiziert – etwas, wovon Patienten nichts merken. Dass es immer noch besser werden kann, zeigen multiresistente MRSA-Keime. Das sind hartnäckige Erreger, die sich bevorzugt in Krankenhäusern aufhalten und dort regelmässig Opfer finden.
Ideen zur Weiterentwicklung der Krankenhaushygiene gibt es viele. Eine ungewöhnliche ist der mobile Reinraum. Je nach Bedarf errichtet, rasch transportiert und woanders aufgebaut, herrscht im Innern höchster Reinraumstandard. Der Container könnte in Pandemien, Kriegen, Flüchtlingscamps statt Zelten zum Einsatz kommen. Mehrere Module gekoppelt bildeten ein Krankenhaus. Die Technik gibt es, die Module gibt es. Aber Käufer gibt es nicht, weil im Gesundheitswesen und in der Katastrophenvorsorge oft nicht Qualität, sondern die Kosten optimiert werden.


Künstliche Befruchtung – erfolgsträchtig wie natürliche Zeugung
Es ist kaum noch vorstellbar, aber in Einrichtungen der Fortpflanzungsmedizin war Reinraumtechnik früher entweder nicht üblich oder nicht ausreichend an die Erfordernisse angepasst. Dabei sind die Umstände der In-vitro-Fertilisation (IVF) besonders heikel, besonders beim Transfer des selektierten Samens in die Eizelle. Einst fand dieser sensible Transfer an einer Werkbank unterm Mikroskop statt, das in einem Luftstrom stand. Dieser sollte Staub und Keime von der Arbeitsstätte wegdrängen. Was dabei aber nicht bedacht wurde, war die hohe Empfindlichkeit von Embryonen. Wer in so einer Zugluft gezeugt wird, geht ein. Entsprechend hoch war die Zahl von Fehlversuchen. Inzwischen hat besser durchdachte Reinraumtechnik Einzug gehalten in die Fruchtbarkeitsinstitute. Die Erfolge sind messbar. Dank der Veränderung haben tiefgefrorene Embryonen inzwischen eine gleich hohe oder gar höhere Chance auf eine erfolgreiche Schwangerschaft wie auf natürliche Weise gezeugte Nachkommen. Auch unerwünschte Mehrlingsgeburten, ein vergleichsweise häufiger Begleiter von IVF, sind auf dem Rückzug. Ihre Rate sinkt.
Kein Brotschimmel – keine Konservierungsstoffe Toastbrot aus dem Supermarkt war früher voller Konservierungsstoffe. Heute kommt es ohne aus. Das Beispiel zeigt: Die Lebensmittelindustrie ist ebenfalls zum Einsatzgebiet für Reinraumtechnik geworden. Chemische Zusätze hinderten Pilzkeime daran, Schimmel zu bilden oder Bakterien zu kultivieren. Der Fachbegriff für diese Mikroorganismen, die die Haltbarkeit gefährden, sagt alles über deren Umtriebe: «koloniebildende Einheiten». Wer auf Chemie verzichten und trotzdem verhindern will, dass sich so ein Eigenleben in Brot,
Käse oder Wurst bildet, muss bei der Herstellung und beim Verpacken Keime vom Eindringen ins Produkt abhalten. Das ist schwierig. Es ist aber – wie sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt hat –machbar. Gemüse wächst auch nicht mehr nur auf dem Acker, sondern mehr und mehr in Nährlösungen. Die Idee vom Gewächshaus treibt die sogenannte Vertical Farm auf die Spitze. Das ist ein komplett isoliertes Gewächshaus, dessen Betreiber jeden
Parameter je nach Pflanze einstellen können, seien es Temperatur, Luftfeuchte, Nährstoffzufuhr oder Licht. Die Isolation hat den Vorteil, dass fremde Lebewesen und unerwünschte Erdbewohner ferngehalten werden. Wo keine Schädlinge, braucht es keine Pflanzenschutzmittel. Agrarfabriken dieser Art entstehen aktuell im grossen Stil am Persischen Golf. Der Grund ist der Mangel. In der Wüste wächst kaum Gemüse und wird von der dortigen Bevölkerung entsprechend wenig gegessen. Die Diabetes-Rate ist sehr hoch. Abhilfe sollen die Indoor-Farmen schaffen, die vor Ort Gemüse produzieren. Wie Gemüse lassen sich auch Fische im geschlossenen System züchten. Eine Indoor-Fischzucht unter kontrollierten idealen Bedingungen – möglich etwa mit Lachs oder Shrimps – minimiert die Störfaktoren für die Tiere und damit die Krankheiten. Sie sind eine Antwort auf die Verschmutzung mit Antibiotika, die bei Aquakulturen im offenen Meer anfällt.
Die Erde bewegt sich im grössten Reinraum von allen Erstmals entwickelt wurden IndoorFarming-Konzepte von der US-Raumfahrtbehörde NASA für den Betrieb von Raumstationen. Sollte die Menschheit in Zukunft zu fernen Planeten fliegen, wäre dank Vertical Farming für die Wegzehrung gesorgt. Ob solche Fernreisen sinnvoll sind, steht auf einem anderen Blatt.

Oberstes Gebot in der Mikroelektronik: Schutz der empfindlichen Teile vor Partikeln.

Der Mikroelektronik-Standard vor 40 Jahren: Verlöten bei elektronischen Bauteilen –Schutzvorrichtung gegen Partikelverschmutzung war höchstens ein Abzug.

Zusammenbau eines Mikrochips auf einer Leiterplatte heute: In einem menschenleeren Labor positionieren automatisierte Roboterarme Bauteile penibel genau auf einem Mik rochip.

Vertical farming: Humusboden verzichtbar –Reinraumtechnik für kontrollierte Umgebungsbedingungen Pflicht.
Die Transportmittel für die Reise kämen jedenfalls auch aus einem Reinraum. Bei der Montage von Satelliten und Raketen werden Staubquellen weitgehend ausgeschlossen. Partikel im Satelliten sind fatal, weil sie Kurzschlüsse oder andere Ausfälle verursachen und, einmal ins All gebracht, nicht repariert werden können. Wer fremdes Leben auf anderen Planeten entdecken will, muss sicher sein, dass die untersuchten Keime nicht von der Erde stammen. Das letzte Mal, als eine solche Meldung über anderes Leben im All die


Besiedlung anderer Planeten: Sinn fraglich – ohne Reinraumtechnik aber überhaupt nicht denkbar.
Runde machte, waren die gefundenen Mikroben mit dem Messgerät mitgereist. Die kurze Umschau über die Verbreitung der Reinraumtechnik nach ihren Anwendungsgebieten zeigt: Die Zahl der Einsatzorte wächst, ebenso wie die Menge der Produkte und Prozesse, die unter kontrollierten Umgebungsbedingungen entstehen oder ablaufen. Möglich ist das, weil die Reinraum-Lösungen zielgenau an jeweilige Zwecke angepasst werden können. Zudem lassen sich immer höhere Reinheitsgrade erreichen. Es gibt keine Grenzen dieser
Entwicklung. Sie führt von weiteren technischen Fortschritten, die das Leben auf Erden verbessern, bis zum Aufbruch ins Weltall, den grössten aller Reinräume.
Autor und Kontakt
Dr. Gernod Dittel
DITTEL Engineering GmbH D-82444 Schlehdorf am Kochelsee info@dittel-ce.de www.dittel-engineering.de
Masken, Overalls und mehr
Passende Schutzausrüstung für Ihre Contamination Control Strategy, gemäss EU GMP Annex 1

Mit Hilfe von selbstklebenden Objektträgern lassen sich Gewebeschnitte endlich schnell anfärben und dann und mit reproduzierbaren Ergebnissen mikroskopieren.
Die Entwicklung von Krankheiten und die Wirkung von Therapien lässt sich mit Hilfe der Zellmikroskopie besser verstehen. Um die interessierenden Strukturen unter dem Mikroskop gut erkennen zu können, werden Gewebeschnitte in unterschiedlichen Experimenten angefärbt. Für reproduzierbare Ergebnisse müssen die flüssigen Färbe-Reagenzien definiert zugeführt werden [1]. Dies gelingt zuverlässig und zeitsparend unter Verwendung spezieller Objektträger mit integrierten Kanälen und mit einer selbstklebenden Unterseite [https://ibidi.com/sticky-slides/322-stickyslide-tissue.html].
Viele Protokolle – ähnliche S chwierigkeiten
Wissenschaftler können heutzutage auf eine Vielzahl von Standard-Protokollen zur
Behandlung von Geweben für eine effektive Mikroskopie zurückgreifen. Zu ihnen behören beispielsweise die Immunhistochemie, das Multiplexing und die sogenannten «spatial omics». Bei der Immunhistochemie werden Strukturen mit markierten Antikörpern sichtbar gemacht. Eine spezielle Technik ist die Markierung der Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen. In diesem Falle spricht man von Immunfluoreszenz.
Bei der Multiplex-Mikroskopie werden mit Fluoreszenzfarbstoff markierte Antikörper auf ein Gewebe gegeben. Dadurch können Zellen, die das zum Antikörper passende Molekül auf der Oberfläche tragen, unter dem Mikroskop identifiziert und lokalisiert werden. Anschliessend wird der Farbstoff ausgebleicht, und der nächste Marker kann aufgegeben werden. Diese

Um Objekte unter dem Mikroskop beurteilen zu können, ist der richtige Objektträger eine entscheidende Komponente – besonders wenn es sich um Gewebeschnitte handelt. (Bild: Adpic)
Prozedur lässt sich beliebig oft wiederholen. In der Regel verwendet man 60 bis 100 Marker pro Experiment [2].
Der Begriff «spatial omics» wiederum umfasst ein breites Spektrum von Techniken, die gleichzeitig die physikalische Gewebestruktur erkennen lassen und molekulare Eigenschaften messen [3]. Allen diesen Standard-Protokollen gemeinsam sind ein hoher Zeitaufwand und eine geringe Robustheit. Es kommt häufig von Experiment zu Experiment zu unterschiedlichen Ergebnissen. Objektträger mit selbstklebender Unterseite versprechen nun eine einfachere und schnellere Durchführung und das Erzielen vergleichbarer Ergebnisse.
Anwendung in der Praxis
Die kanaldurchzogenen Objektträger mit selbstklebender Unterseite sind so konzipiert, dass sie auf Standard-Objektträger aufgebracht werden können. So lassen sie sich leicht in bereits etablierte Arbeitsabläufe integrieren. In Kombination mit einem Objektträger oder Deckglas steht dann ein Färbeflüssigkeits-Reservoir mit einem kleinen und definierten Volumen über Gewebeschnitten zur Verfügung. Typischerweise arbeitet man hier entweder mit FFPE-Gewebe oder mit Kryo-Verfahren.
Beim gängigen FFPE-Verfahren wird das Gewebe zur Konservierung und Stabilisierung in Paraffin eingebettet und in Formalin fixiert. So kann das Gewebe zunächst gelagert und später beispielsweise mit einem Mikrotom zu mikroskopischen Schnittpräparaten weiterverarbeitet werden. Alternativ dazu kommt das Gewebe in einen Kryostaten, und anschliessend werden Gefrierschnitte durchgeführt; dieses Verfahren wird zum Beispiel auch zur Beurteilung von Geweben bei laufenden Operationen.
Über zwei Luer-Anschlüsse ist das Färbereservoir manuell oder automatisiert über Perfusionssysteme für Hochdurchsatzoder Multiplex-Experimente zugänglich. Dies ermöglicht einen einfachen und definierten Austausch von Flüssigkeiten und


Das interessierende Gewebe kann in Paraffin eingebettet und in Formalin fixiert oder – wie hier – gekühlt gelagert und anschliessend mit fe inen Kryo-Schnitten in die richtige Form für die mikroskopische Analyse gebracht werden. (Bilder: Adpic)
damit ein reproduzierbares Färben von Gewebeschnitten [1].
Dieses Verfahren ist sogar für die hochauflösende Mikroskopie jenseits der Abbe- Grenze möglich. Nach dieser liegt beispielsweise die maximale Auflösung des Lichtmikroskops bei etwa 0,3 Mikrometern. Diese Grenze lässt sich heute jedoch überschreiten. Für die Mikroskopie von Gewebeschnitten kommen dabei ein
klassischer Objektträger, ein Objektträger mit selbstklebender Unterseite und ein Deckglas zum Einsatz [1].
Literatur
1. https://ibidi.com/img/cms/about_us/press/ ibidi_pr_2025_02_sticky_tissue.jpg, eine Pressemeldung der ibidi GmbH, D-82166 Gräfelfing, info@ibidi.de, https://ibidi.com, Zugriff am 19.2.2025
2. https://charite3r.charite.de/metas/meldung/ artikel/detail/weniger_tierversuche_durch_die_ multiplex_mikroskopie, Zugriff am 19.2.2025
3. Dario Bressan, Giorgia Battistoni, Gregory J. Hannon: The dawn of spatial omics. Science. 2023 Aug 4;381(6657):eabq4964. doi: 10.1126/ science.abq4964, Zugriff am 19.2.2025
Autor und Kontakt
Dr. Christian Ehrensberger

Zu den bekannten Optionen für Lüftungssysteme in Operationssälen kommt mit dem «Temperaturkontrollierten Airflow» eine dritte. Damit lässt sich Energie einsparen, und das OP-Team freut sich über ein komfortableres Arbeitsklima.
Die Gefahr einer unkontrollierten Verbreitung von Mikroorganismen, insbesondere Bakterien im Operationssaal über die Raumluft ist ein bekannter und relevanter Risikofaktor für postoperative Wundinfektionen. Ein wesentlicher Mechanismus, dieses Risiko zu vermindern, stellt die Unterbrechung der durch die Wärmeabstrahlung von Personal und technischen Geräten thermodynamisch induzierten Konvektionsströmung dar. Bei Lüftungssystemen mit geringer Luftgeschwindigkeit ist die Gefahr grösser, dass bakterientragende Partikel nicht verdrängt und somit entfernt werden. Das kann zu einer Kontamination der Luft im Operationsbereich führen. Höhere Luftgeschwindigkeiten hingegen können Zugluft, Lärm, eine Austrocknung des Operationsfeldes, eine Auskühlung des Patienten und Turbulenzen verursachen. Diese verringern die Wirkung einer Verdrängungsströmung.
Drei Lüftungs-Verfahren zur Auswahl Als herkömmliche Alternativen für die Lüftung von Operationssälen kommen die Turbulenzarmen Verdrängungsströmung (TAV) und die Turbulenten Mischlüftung (TML) in Betracht. Sie sind in der DIN 1946 Teil 4 aus dem Jahr 2018 unter dem Punkt «Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens» beschrieben [https://cci-dialog. de/so-funktioniert-die-opragon-lueftungcci_wissensportal]. Im Oktober 2023 hat nun die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Berlin, eine ak tualisierte Fassung ihrer «Krankenhaushygienischen Leitlinie für die Planung, Ausführung und Überwachung von Raumlufttechnischen Anlagen für OP-Bereiche und Eingriffsräume» veröffentlicht [https:// www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/ 244_253_DGKH_LL_RLTA_HM_10_23. pdf]. Darin wird als dritte Option ein Lüftungskonzept auf Basis des «Temperaturkontrollierten Airflow» (TcAF) erwähnt. Somit kann es alternativ zu TAV und TML in Operationssälen eingesetzt werden. Um die komplexen Anforderungen an Raumluftsysteme im Operationssaal zu erfüllen, hat die Avidicare AB, Lund (Schweden) ein TcAF-System mit dem Namen Opragon entwickelt (Abb. 1). Es kombiniert die Misch-/Verdünnungslüftung mit einem gekühlten unidirektionalen Luftstrom.
Schutzwirkung nach dem Gravitationsprinzip
Die Wirkung des Systems basiert darauf, dass leicht gekühlte, hochrein gefilterte Zuluft aus halbkugelförmige Luftdurchlässen von der Decke aus in eine Zone um den Operationstisch herum eingebracht wird (Abb. 2 und 3). Da kühle Luft schwerer ist als die umgebende wärmere Luft, sinkt sie in den Operationsbereich hinab und entfaltet so ihre Schutzwirkung (Gravitationsprinzip). Die Konvektionsströme werden unterbrochen, und die in der Luft befindlichen Bakterien werden aus dem kritischen Bereich des Patienten, des Personals und der sterilen Instrumente verdrängt bzw. abtransportiert. Die eingebrachte Zuluft wird beim TcAF-System ausschliesslich bodennah abgesaugt, somit werden potenzielle Kontamination mit der Raumluft sicher abgeführt. So ist im OP-Bereich für eine hochreine Umgebung gesorgt. Bei dem System wird die Luftgeschwindigkeit im OP durch den Temperaturunterschied zwischen Zuluft und Raumluft bestimmt und geregelt. Damit die hochreine Zuluft den Operationsbereich erreicht und bestmöglich wirken kann, muss auf der Ebene des Operationsbereichs eine Luftgeschwindigkeit von etwa 0,25 Metern pro Sekunde herrschen. Bei der Entwicklung von Opragon wurde ermittelt, dass dafür ein Temperaturunterschied von 1,5 bis 3°C zwischen der Zuluft und der Raumluft am OP-Tisch erforderlich ist. Um dies verlässlich zu gewährleisten, prüft das System kontinuierlich, ob die Zuluft unabhängig von der Temperatur der umgebenden Raumluft


Abb. 2: TcAF-Lüftungssystem in einem OP-Raum: Das Einbringen der HEPA-gefilterten Zuluft erfolgt über die halbkugelförmigen Durchlässe über der OP-Zone und in den Nebenbereichen.

Abb. 3: Prinzipieller Aufbau eines Opragon-Lüftungssystems mit den wesentlichen Komponenten:
– Ze ntrale Opragon-Einheit: Gekühlte, HEPA-gefilterte Zuluft sorgt im OP-Bereich für eine hochreine Umgebung.
– Periphere Luftduschen mit HEPA-gefilterter Umluft kontrollieren die Raumtemperatur und beschleunigen die Sedimentation.
– Die Abluft wird symmetrisch auf Bodenhöhe abgesaugt.
eine konstante Untertemperatur von 1,5 bis 3°C beibehält. Dadurch ergibt sich eine zuverlässige, kontrollierte und stabile Steuerung der thermodynamischen Verhältnisse.
Der Zuluftvolumenstrom kann in den mit Opragon ausgestatteten OP-Sälen an die Art der Operation angepasst werden. So lässt er sich bei risikoärmeren Eingriffen verringern und damit Energie sparen (Abb. 4 und 5).
Bei infektionsgefährdeten Eingriffen oder zum Schutz im Rahmen von pandemischen Ereignissen, wie der Corona-Pandemie, sorgt beim Opragon-System ein optionaler «Ultra-Clean-Modus» für zusätzliche Sicherheit. Bei Nichtbelegung kann der energiesparenden «Stand-byModus» mit einem geringeren Luftstrom gewählt werden. Oder das System wird ganz abgeschaltet.


Abb. 4 und 5: Mit der Temperaturkontrollierten-Airflow-Technologie (TcAF) lässt sich im Bereich des Operationsfeldes die Anzahl der koloniebildenden Einheiten (KBE, engl.: CFU) auf 1 pro Kubikmeter bringen. Statt des dabei voll eingeschalteten 100-Prozent-Zuluftvolumenstrome (oben) kann für risikoärmere Eingriffe energiesparend mit 50 Prozent Zuluftvolumenstrom gearbeitet werden (unten).
Das TcAF-System Opragon ist in der Lage, die Anforderungen an die Raumluftqualität in Operationssälen gemäss DIN 1946 Teil 4 zu erfüllen. Laut DGHK sind für TAV-, TML- und TcAF-Lüftungssysteme gleichermassen die Abnahmeverfahren der DIN 1946 Teil 4 anzuwenden. Dabei versteht es sich von selbst, dass die Einzelheiten zum Betrieb des Systems stets mit dem zuständigen Krankenhaushygieniker abzustimmen sind. Was das Sicherheitsniveau angeht, so erfüllt das TcAF-System die DGHK-Anforderungen ebenso wie die anderen beiden. Allerdings bedarf es eines deutlich geringeren Luftdurchsatzes. Er liegt in der Grössenordnung von 50 Prozent der sonst für hochreine Bedingungen erforderlichen Luftdurchsätze. So steht mit dem TcAFSystem bei ebenbürtiger Funktionalität

Abb. 6: Das OP-Team des St. Agnes-Hospital in Bocholt freut sich seit dem vergangenen Jahr über ein komfortableres Arbeitsklima – dank der frisch installierten TcAF-Technologie. (Bild: Klinikum Westmünsterland)
gegenüber den herkömmlichen Lüftungssystemen eine nachhaltigere und kostengünstigere Alternative zur Verfügung. Aufgrund dieser Vorteile ist das Verfahren bereits in der Praxis angekommen. Ein aktuelles Beispiel dafür stellt die Installation im St. Agnes-Hospital in Bocholt im vergangenen Jahr dar. Dieses Klinikum möchte seinen Patienten eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung «direkt vor der Haustür» bieten – mit State-of-the-art-Einrichtungen und einem Team aus erfahrenen Fachkräften. Dazu dient unter anderem ein Programm zur Erhöhung der Patientensicherheit und zur Optimierung der Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal.
Im Zentrum der Modernisierung stand für das Spital jüngst die Verbesserung der Luftqualität in den Operationssälen. Ein wichtiger Bestandteil stellt die TcAF-Installation dar. Sie erfolgte in einem reibungslosen Umbau. Während der zweiwöchigen Installationsphase war die gewohnte Qualität in der Regel- und Notfallversorgung zu jeder Zeit gewährleisten, so dass es zu keinerlei Einschränkungen in der Patientenversorgung kam. Im Ergebnis gewährleistet das neue Lüftungssysteme seither, laut Leitung-OP, angenehme Raumtemperaturen und eine gleichmässige Luftverteilung. Das führt im Vergleich zur Situation davor zu einem komfortableren Arbeitsklima für das OPTeam (Abb. 6).
Weitere Informationen
Avidicare AB Medicon Village SE-223 63 Lund info@avidicare.com https://www.avidicare.com/
Als Reinraumstandort ist Gemü Schweiz das Service- und Kompetenzzentrum der GemüGruppe für hochwertige Kunststofflösungen mit Reinraumanforderungen. Mit seinen High-Purity-Produkten aus technischen und Fluorkunststoffen, für die Bereiche Semiconductor, Medical und Pharma, Food sowie Biotech, verzeichnet das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und plant eine Kapazitätserweiterung in einem zusätzlichen Werk. Bis zur Fertigstellung der neuen Produktionsstätte wurde als mittelfristige Übergangslösung in einer angemieteten Halle ein Reinraum mit einer Fläche von über 500 m² eingerichtet.
Am Produktionsstandort Emmen werden auf einer Fläche von über 5’300 Quadratmetern unter reinen Bedingungen nach ISO 8 bis ISO 6 Ventile und Baugruppen für die Pharmaindustrie, Mikroelektronik, Solar- und Halbleiterindustrie sowie für die Medizintechnik gefertigt. Aufgrund der Wachstumsstrategie der Gemü-Gruppe, stösst das Werk an seine Kapazitätsgrenzen und eine umfangreiche Erweiterung des Produktionsstandortes ist geplant.
Erweiterung der Produktionsstätte in Emmen
Die erste Stufe der Werkserweiterung soll 2030 abgeschlossen sein, bis dahin muss Gemü eine Zwischenlösung für den erhöhten Platzbedarf in der Reinraumfertigung bereitstellen. In unmittelbarer Nähe des Standorts konnte eine zusätzliche Halle angemietet werden, in der weitere 500 Quadratmeter Reinraum nach ISO 8 erstellt wurden. Das neu installierte Reinraumsystem soll idealerweise später an
den neuen Standort verlagert werden und besteht aus einer modularen Bauweise, die flexibel und zerstörungsfrei umgebaut werden kann.
Adrian Schilling, Operations Manager der Gemü GmbH in Emmen, erläutert die Planung für die nächsten Jahre: «Wir brauchten eine mittelfristige Lösung, um unsere Produktionskapazitäten für die nächsten Jahre zu erweitern, bevor wir in die neuen Räumlichkeiten des bestehenden Werkes umziehen können. Zu diesem Zweck haben wir eine Halle angemietet, in der die gefertigten Ventile und Baugruppen für die Halbleiterindustrie unter Reinraumbedingungen ISO 8 montiert und verpackt werden. Für unsere Kunden mit ihren Anwendungen und Anforderungen dürfen bei der Reinheit der Produktion keine Abstriche gemacht werden. Deshalb haben wir in der angemieteten Halle sozusagen eine perfekte Übergangslösung geschaffen. Im Idealfall wollen wir die Reinraumanlage im zukünftigen Werk weiter nutzen, deshalb

Die 16 m langen Fachwerkträger werden in einem Stück verladen und transportiert.
haben wir nach einem flexiblen Modulsystem gesucht, das wieder abgebaut und weiterverwendet werden kann.»
Freitragender Reinraum mit 16 Meter langen Fachwerkträgern Der Reinraum von Schilling Engineering entspricht der modernen Produktionsumgebung von Gemü. Auf einer Länge von 35 Metern und einer Breite von 16 Metern ist eine zusammenhängende Fläche ohne Stützen entstanden, die eine sehr flexible Gestaltung der Arbeitsplätze und Prüfungen ermöglicht. Die freitragende Konstruktion in dieser Grösse wurde mit 16 Meter langen Fachwerkträgern realisiert, die der Reinraumspezialist in seinem Werk im baden-württembergischen Wutöschingen vorfertigte und in einem Stück per Sondertransport nach Emmen lieferte. Vollverglaste Umluftwände, die die gesamte Front einnehmen, beleuchtete LEDTüren mit intuitiver Benutzerführung und eine Beleuchtung aus flächenbündig inte -

Der Reinraum ist in Modulbauweise konzipiert und kann bei Bedarf ab- und wieder aufgebaut werden.

Der freitragende Reinraum bietet eine zusammenhängende Fläche von 481 m ².

Vollverglaste Umluftwände sorgen für viel Tageslicht.
grierten LED-Streifen verstärken den modernen Eindruck. Adrian Schilling ist sichtlich zufrieden mit Funktion und Optik der neuen Reinraumanlage: «Das System entspricht präzise unseren Anforderungen und Wünschen. Wir haben die technische Konzeption und Auslegung der Reinraumanlage in enger Abstimmung mit dem Verkaufsteam und den Projektleitern von Schilling geplant. Die Pläne wurden eins zu eins umgesetzt und unsere Produktion ist ohne Probleme angelaufen. Die Komplettlösung und die Qualität des Reinraums haben uns beeindruckt. Mich freut auch, dass der Reinraum wirklich super aussieht. Ein Kundenbesuch macht auf diese Art und Weise doppelt Spass, da man dem Kunden von aussen alles im Detail zeigen kann, ohne den Reinraum betreten zu müssen. Hier hatten wir in der Vergangenheit noch Defizite.»
Die Reinraumklasse ISO 8 wird mit insgesamt 27 Reinluftunits erreicht, die die Frischluft direkt aus der Halle ansaugen und einem energieeffizienten Umluftverfahren zuführen. Die Klimatisierung erfolgt über einen Kaltwassersatz, der im Aussenbereich der Halle aufgestellt wurde. Die Steuerung des Reinraumsystems erfolgt über das Multifunktionstool CRControl, mit dem alle Funktionen im Reinraum, die Türen und die Klimatechnik gesteuert und überwacht werden. In der Steuerung ist gleichzeitig ein ISO-Monitoring inte -

In der Reinraumanlage CleanCell 4.0 nach ISO 8 werden Kunststoffteile für hochreine Anwendungen montiert und verpackt.

Die Schleusenmöblierung ist für die Einschleusung von 20 Personen pro Schicht konzipiert.
griert. Für eine schnelle und flexible Hilfe im Störungsfall wurde eine gesicherte Fernwartung über das Internet eingerichtet.
Personaleinschleusung für 60 Mitarbeitende
Im neuen Reinraum arbeiten bis zu 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei Schichten. Das Personal betritt den Reinraum mit Kittel, Reinraumschuhen und Haube. Für eine schnelle und ergonomische Einschleusung wurden 35 m² Schleusenfläche eingeplant. Schleuseneinrichtung und Mobiliar wurden ebenfalls von Schilling Engineering geliefert.
Die Personalschleusen sind mit Vollglastüren mit LED-Visualisierung ausgestattet. Die Farbgebung der gegenseitig verriegelten Türen signalisiert dem Personal, wann eine Tür geöffnet werden kann. Neben der Personalschleuse wurde eine 12 m² grosse Materialschleuse installiert, die Platz für bis zu sechs Europaletten bietet und über automatische Schiebetüren betreten und bestückt werden kann.
Neun Monate vom Auftrag bis zur Inbetriebnahme
Die gesamte Reinraumanlage wurde innerhalb weniger Monate geplant, gefertigt, installiert und qualifiziert. Der Umzug in die neue Anlage konnte ohne Verzögerung erfolgen. Adrian Schilling freut sich
über den erfolgreichen Projektverlauf: «Der zeitliche Ablauf des Projektes war sehr gut. Da alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand kamen, waren die Abstimmungen einfach. Vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur endgültigen Inbetriebnahme haben wir neun Monate gebraucht. Damit waren wir sehr zufrieden und lagen voll im Zeitplan.»
Der Aufbau der Reinraumanlage wurde mit Kamera und Drohnenaufnahmen begleitet. Mit dem QR-Code geht es zu einem 2,5-minütige Video. (Bilder: Gemü Schweiz/Schilling Engineering GmbH)

Autorin und Kontakt Iris Dörffeldt
Schilling Engineering GmbH Industriestrasse 26 79793 Wutöschingen +49 (0)7746 - 92789 - 71 i.doerffeldt@schillingengineering.de www.SchillingEngineering.de
Aktuelle Partikelzähler vereinen jetzt die Empfindlichkeit eines Kondensationspartikelzählers mit der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität eines herkömmlichen ReinraumPar tikelzählers.
Diese Geräte wurden wurde für die Überwachung ultrareiner Umgebungen entwickelt und bieten eine Nachweisempfindlichkeit von 10 nm bei einem Luftdurchsatz von 2,8 l/min (bzw. 0,1 Kubikfuss pro Minute; CFM). Dank seiner geringen Dimensionen lässt sich das Gerät in Geräten für Halbleiterprozesse einsetzen. Ohne weiteres ist die Verwendung in Reinräumen der ISO Klasse 1 möglich.
Weitere Informationen
CAS Clean Air Service Reinluftweg 1 CH 96 30 Wattwil pmsswitzerland@pmeasuring.com https://www.pmeasuring.com

Empfindlich und komfortabel zugleich: Im Halbleiterbereich sind Partikelzähler, die beides vereinen, jetzt einsetzbar. (Bild: Adpic)
Zeitgemässe Hautschutzcremes für Trägern von Schutzhandschuhen sorgen für einen wasserabweisendem Schutzfilm, fördern die Regeneration der Haut und unterstützen den Erhalt ihres natürlichen Säureschutzmantels.
Häufiges Händewaschen, das Tragen von Schutzhandschuhen und der Kontakt mit rauen Oberflächen können die Haut austrocknen und reizen. Regelmässiges Waschen und die Verwendung von Desinfektionsmitteln entziehen der Haut Fett und Feuchtigkeit. Der Trend geht daher zu Hautschutzcremes, welche die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und ihre Regeneration unterstützen.
Sie basieren auf Silikon, essentielle Fettsäuren, Allantoin sowie rechtsdrehender Milchsäure und weisen einen pH Wert von 4 auf. Solche Hautcremes bilden einen wasserabweisenden Schutzfilm, fördern

Zur Feuchtigkeitsversorgung und Regeneration: Hautcreme auf dem Stand der Technik.
(Bild: Roth)
die Regeneration der Hautzellen und unterstützen den Erhalt des natürlichen Säureschutzmantels.
Die Anwendung erfolgt in der folgenden Weise: Eine kleine Menge Creme wird aus einem Spender vor Beginn der Arbeit und nach dem Händewaschen aufgetragen und gleichmässig auf der Haut verteilt (z. B. Rotiprotect [https://www.carlroth. com/de/de/hautschutz/hautschutz rotiprotect creme/p/0543.2], Carl Roth).
Weitere Informationen
Roth AG CH 4144 Arlesheim info@carlroth.ch www.carlroth.ch
Mit einem neuen Instrument lässt sich das Wechseln von Sedimentationsplatten automatisieren und damit Kosteneffizienz und Produktivität steigern.
Der EU GMP Annex 1 schreibt für die Reinraumklasse A eine kontinuierliche Überwachung der Luft vor. Diese erfolgt unter anderem mit Standard Sedimentationsplatten, die alle vier Stunden manuell gewechselt werden müssen. Die Folge sind regelmässige Produktionsunterbrechungen; im schlimmsten Fall droht aufgrund von Bedienfehlern und Kreuzkontaminationen sogar der Verlust der gesamten Charge.
Neue automatische Sedimentationsplattenwechsler lassen sich mit bis zu sechs Standard Sedimentationsplatten befüllen und führen dann eine automatisierte 24 Stunden Beprobung ohne jeglichen Eingriff durch. Die Deckel der Platten werden vollautomatisch abgehoben, jede einzelne Platte der Luft ausgesetzt, wieder verschlossen, und die nächste Platte kommt zum Einsatz. Diese Automatisierung reduziert sowohl Eingriffe in den Reinraum als auch Produktionsunterbrechnungen, was zu einer höheren Produktivität bei gleichzeitig niedrigeren Kosten führt.

Der automatische Wechsler für Sedimentationsplatten lässt sich in einen Isolator-HMI (Human Machine Interface) integrieren oder als portable Stand-alone-Lösung einsetzen. (Bild: MBV)
Darüber hinaus erhält man zu 100 Prozent vergleich und reproduzierbare Messergebnisse. Abweichungen durch zu lange oder zu kurze Beprobungszeiten gehören der Vergangenheit an.
Der automatische Sedimentationsplattenwechsler lässt sich zum Beispiel in einen Isolator HMI (Human Machine Interface) integrieren und über die grafische Benutzeroberfläche steuern. Alternativ dazu ist auch der Einsatz als portable Stand aloneLösung möglich. In jedem Falle vereinfachen sich die Umsetzung einer Kontaminationskontrollstrategie und das Einhalten der Vorgaben des EU GMP Annex 1.
Weitere Informationen
MBV AG CH 8712 Stäfa welcome@mbv.ch www.mbv.ch

Kostenloses
PrioCode: ccr-25
Dank einer speziellen Lüftertechnologie bleiben Mitarbeiter an Reinraumwerkbänken bei Geräuschpegeln zwischen «Bürobetrieb» und «Industriearbeitsplatz» vor übermässiger Lärmbelästigung geschützt.
Neben der Umweltverschmutzung durch Schadstoffe ist der Mensch immer mehr einer neuen Gefahrenquelle ausgesetzt: einer zunehmenden Umweltverschmutzung durch Geräusche und schlimmer noch durch Lärm.
Dauerhafter Stress durch Lärm kann krank machen. Die gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung von Lärm ist sehr vielfältig. Sie reicht von schwerwiegenden Hörschäden bis zu verborgenen, meist über viele Jahre sich langsam entwickelnden Symptomen, wie Schlafstörungen, Gereiztheit oder Nervosität.
Während man im privaten Bereich Massnahmen ergreifen kann, Lärm zu reduzieren oder zu vermeiden, ist dies am Arbeitsplatz häufig nicht möglich. Der Arbeitgeber hat hier die Pflicht, Massnahmen zu ergreifen, um den Schalldruckpegel so niedrig wie nur möglich zu halten.
Geräuscharmes Lüfterkonzept
Die Anforderungen an Sauberkeit bzw. Reinheit der Laborumgebungen und einer Betriebsstätte sind insbesondere in den Bereichen der industriellen Produktion und Verpackung sowie im analytischen und medizinischen Labor und in der Forschung immens gestiegen. Partikel und Keimfreiheit sind hier vielfach ein Muss. Kleine, lokale Reinraumwerkbänke oder LaminarFlow Boxen erfüllen diesen Zweck und

schützen den Arbeitsbereich vor Partikeln, Keimen und Staub.
In einer Flow Box wird die Raumluft mittels eines Ventilators angesaugt und durch einen Hochleistungs Par tikel Filter des Typs HEPA H14 gepresst. Viele Kunden empfinden die unvermeidbaren Ventilatorgeräusche als dauerhaft störend.
Ein besonders geräuscharmes Lüfterkonzept sorgt jetzt für Abhilfe: Durch die Filteranordnung wird im Arbeitsbereich ein laminarer Luftstrom erzeugt. Die gereinigte Luft schützt die Probe durch einen Überdruck wie ein Vorhang vor eintretenden Partikeln. Alle Laminar Flow Boxen bleiben im normalen Betriebsmodus unter
dem Geräuschpegel eines normalen Bürobetriebes (55 db); zum Teil wird nicht einmal der Geräuschpegel leichter Musik überschritten. Selbst in der höchsten Leistungsstufe überschreitet er nicht die Werte, wie sie für industrielle Arbeitsplätzen vorgeschrieben sind (80 db).
Fazit für den Reinraum Bezüglich der Geräuschentwicklung erfüllen die Laminar Flow Boxen gemäss dem neuen Lüfterkonzept alle Anforderungen, um die Lärmbelästigung am Arbeitsplatz zu minimieren. Der erzielbare Geräuschpegel entspricht dem derzeitigen Stand der aktuellen Lüftertechnologie; im Normalbetrieb werden Werte, wie sie in allgemeinen Büros vorgeschrieben sind, nicht überschritten. Die entsprechenden Module lassen sich im analytischen Labor ebenso wie in der elektronischen und optischen Fertigung oder der Verpackung medizinischer oder pharmazeutischer Produkte nachträglich einbauen (als Deckenversion) oder aufstellen – und das ohne aufwendige Baumassnahmen oder Änderung der bestehenden Klimaanlagen.
Weitere Informationen Spetec GmbH D 85 435 Erding spetec@spetec.de www.spetec.de
Ruhe an der Reinraumwerkbank: Mit einem speziellen Lüfterkonzept werden Geräuschpegel wie bei leichter Musik, bei Büroatmosphäre oder am industriellen Arbeitsplatz erreicht. (Bild: Spetec) Antworten finden Sie
Die Kooperationspartner «OST – Ostschweizer Fachhochschule», «RhySearch – das Forschungs und Innovationszentrum Rheintal» und der Switzerland Innovation Park Ost benötigen einen ausgebauten und weiterentwickelten Reinraum. Die vorberatende Kommission hat die Vorlage der Regierung zur Unterstützung mit zwei Sonderkrediten von insgesamt rund 22 Millionen Franken beraten und beantragt Eintreten.
Die Hochpräzisionsfertigungsindustrie ist für den Kanton St. Gallen und insbesondere für das Rheintal wirtschaftlich bedeutend. Sie benötigt ein leistungsfähiges Forschungsumfeld und Zugang zu modernster Technologie und Infrastruktur. Spezialisierte Anlagen stellen jedoch sehr hohe Anforderungen an ihre Umgebung. Die Verfügbarkeit von zukunftsfähigen Reinräumen und entsprechenden Fachpersonen sind deshalb für die Hersteller von Präzisionskomponenten entscheidend.
Regierung will 22 Millionen Franken beisteuern
Die Kooperationspartner wollen unter dem Titel «Sensor Innovation Hub» die For
schungsmöglichkeiten des bestehenden Reinraums in Buchs an der OST, der auch von RhySearch stark genutzt und mit eigenen Anlagen betrieben wird, erhalten und ausbauen sowie diesen bekannter und zugänglicher machen. Sie treiben dabei die Erneuerung, die Erweiterung und den Betrieb des Reinraums gemeinsam voran, damit er auch künftigen Anforderungen genügt.
Die Regierung unterstützt die Ziele des «Sensor Innovation Hub» und möchte diesen mit rund 22 Millionen Franken unterstützen. Die vorberatende Kommission hat unter der Leitung von Andreas Broger, Altstätten, die Vorlage in Buchs beraten. Die Kommission liess sich von den Kooperationspartnern umfassend informie

ren und besichtigte die bestehenden Räumlichkeiten. Sie unterstützt den Sonderkredit und beantragt Eintreten auf die Vorlage.
Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Frühjahrssession in erster Lesung und voraussichtlich in der Sommersession 2025 in zweiter Lesung. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich im Herbst 2025 stattfinden. Die Botschaft und der Entwurf sind im Ratsinformationssystem unter der Geschäftsnummer 33.24.05 zu finden.
Die Bedeutung der Fertigungskompetenz für den Industriestandort Ostschweiz wird zusätzlich durch das geplante Projekt «Swiss FabLab» am Standort Dübendorf herausgestrichen. Beide Vorhaben dürften einander gut ergänzen.
Innovation für einen starken Wir tschaftsstandort St. Gallen
Der Kanton St. Gallen lanciert und unterstützt zahlreiche Massnahmen, um seine Innovationskraft zu erhöhen. Wichtige Initiativen neben dem Ausbau der Forschungsräume an der OST in Buchs sind die Innovationsförderstrategie für KMU und die Start up Strategie. Im Dezember hat zudem der Bund RhySearch, das Forschungs und Innovationszentrum Rheintal, als Technologiekompetenzzentrum von nationaler Bedeutung anerkannt. Damit erhält das Forschungszentrum jährlich Förderbeiträge. Die Anerkennung ermöglicht einen Ausbau von RhySearch und steigert das Ansehen des «Sensor Innovation Hub» und des Standorts erheblich. Zudem stärkt sie die Innovationskraft und das Innovationsökosystem der Region Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein.
Weitere Informationen sg.ch und ost.ch
Der Annex 1 wird vielfach immer noch als «neu» empfunden. Dabei ist er schon zweieinhalb Jahre in Kraft. In den letzten beiden Jahren habe ich eine WeltTour zu diesem Thema gemacht und konnte auf vielen globalen Workshops und Konferenzen mit mehr als 16’000 Personen sprechen, darunter viele Inspektoren aus der gesamten Welt, und so ist es Zeit für eine Bilanz aus der Perspektive der Reinraum Praxis.
Der Annex 1, genauer: der EU GMP Annex 1, regelt die Herstellung, Kontrolle und Freigabe von endsterilisierten und aseptisch abgefüllten pharmazeutischen Produkten. Als zentraler Leitfaden legt er die Anforderungen an einen Reinraum in der pharmazeutischen Industrie fest und dient als Referenz für die Überwachung und Überprüfung der Einhaltung dieser Anforderungen. Seit dem August 2022 ist der neue Annex 1 implementiert und seit 2023 in Kraft. Ausnahme war zunächst das Kapitel 8.123 zur automatisierten Beund Entladung von Lyophilisationen, das seit August 2024 nun auch in Kraft gesetzt wurde.
Ein besonderes Highlight auf meiner WeltTour war die Einladung der Europäischen Kommission, im Jahr 2024 zum Annex 1 in Brüssel eine globale Inspektoren Schulung zu geben. Dass es sich hier um ein Top Thema handelt, war allerorten zu spüren.
Auch rein sachlich ist dies absolut gerechtfertigt. Da der Annex 1 eine komplette Überarbeitung der 2008 Version ist, hat
sich sehr viel geändert. Schon bei der ersten Draft Publikation im Jahr 2017 hat man dies in der Praxis gesehen. Speziell das Thema «Barrier», wie RABS (Restricted Access Barrier System) oder Isolatoren, hat enorm an Bedeutung gewonnen. War vor der Draft Publikation etwa jede zweite aseptische Füll Linie mit einem Barrier System ausgestattet, sind es mittlerweile mehr als 80 Prozent. Man braucht eine sehr gute Begründung, kein BarrierSystem einzusetzen, und dies ist auch im Annex 1 erwähnt. Viele der neuen Installationen werden mittlerweile mit Isolatoren ausgestattet, da auch weiter Anforderungen im Annex 1 dies unterstützen (Abb. 1).
Es gibt noch Implementierungsbedarf
Bei all den Diskussionen zum Annex 1 wurde deutlich, dass es in einigen Bereichen noch Klärungs und Implementierungsbedarf gibt.
Bei der PDA handelt es sich um eine internationale Organisation für die Bereitstellung von wissenschaftlichen, technischen und regulatorischen Informationen für

Abb. 1: Beispiel Füll-Linien-Isolator: Viele neue Installationen werden so ausgestattet, zumal einschlägige Anforderungen im Annex 1 dies un terstützen. (Bild: SKAN)
pharmazeutische und biopharmazeutische Hersteller mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland (USA) und der Europa Niederlassung PDA Europe gemeinnützige GmbH in Berlin. Seit April gibt es auch die PDA DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz). Zwei wesentliche Punkte bei den Aufgabestellungen für die Zukunft stellen Sicherheit und Komfort dar.
Freier bewegen, sicherer produzieren Das Streben nach mehr Komfort und mehr Sicherheit führt auf IsolatorTechnologien. Zunächst ein Beispiel zum Komfort: Der Mitarbeiter kommt durch den Einsatz von Isolatoren aus der Reinraumzone B in die Reinraumzone C oder D, je nachdem ob es sich um ein in sich geschlossenes Isolator System wie beim Steril Test handelt (Zone D) oder um ein Isolator System mit keinen Öffnungen, um zum Beispiel kontinuierlich befüllte primäre Packmittel wie Vials aus der aseptischen Füllmaschine zu transferieren (Zone C). Bei Einsatz von Isolatoren ist die Kleidung für den Mitarbeiter viel einfacher anzuziehen, und er kann sich auch viel freier bewegen. Klar hat dieser nun keinen direkten Eingriff mehr in den kritischen Bereich der Zone A. Dieser «gefühlte Kontrollverlust» erhöht aber sogar die Produktsicherheit. Denn die noch notwendigen Eingriffe erfolgen nun durch am Isolator angebrachte Handschuhe, und selbst diese verbleibenden Eingriffe werden durch automatisierte Systeme immer stärker reduziert (Abb. 2, 3).
Die Automation in der Zone A mittels moderner Technologien (z. B. Robotik) oder Automation in die Zone A mit validierten Material Transfer Systemen (z. B. E Beam) haben durch den Annex 1 einen enormen Aufwind bekommen. Der Grund für die steigende Bedeutung des Oberflächensterilisationsprozesses E Beam: Im Annex 1 ist erwähnt, dass Transfers ein hohes Risiko der Kontamination darstellen

Abb. 2: Steril-Test-Isolators mit integrierten Handschuhen: Nur über diese erfolgen Eingriffe, und selbst diese werden durch automatisierte Systeme immer stärker reduziert. (Bild: SKAN)
und daher mit Hilfe automatisierter und validierter Technologien durchgeführt werden sollten.
Der E Beam kommt speziell zum Einsatz bei vorsterilisierten primären Packmittel eingebettet in einem Nest und von einem Tub mit Folie verschlossen. Diese Primärverpackung wird durch den Hersteller umverpackt in eine Folie und der gesamte Inhalt anschliessend sterilisiert. Die Umverpackung der Folie wird vor dem Einschleusen in den E Beam entfernt und im Inneren des E Beams werden dann die äusseren Oberflächen sterilisiert, bevor das Tub die Zone A erreicht.
Isolator und Ebeam erhöhen Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit
Die zusätzlichen initialen Kosten für einen Isolator oder E Beam amortisieren sich recht schnell und zahlen sich auch in einer höheren Sicherheit und höherem Komfort für die Mitarbeiter aus. Darüber hinaus erweist sich ein E Beam aufgrund seines geringen Platzbedarfs und der reduzierten

Abb. 4: Validiertes Material-Transfer-System gemäss Annex 1: E-Beam an einer Füll-Linie für Spritzen. (Bild: SKAN)

3: Vor seinem ersten Einsatz wird der Handschuh eingehend geprüft. (Bild: SKAN)
Umverpackung als nachhaltig (Abb. 4). Ähnliches trifft für einen Isolator zu. Zur Nachhaltigkeit tragen der geringere Materialverbrauch, die geringere Anzahl an Personal Schleusen und deren einfacheres Monitoring (in Zone C oder Zone D und nicht mehr in Zone B) bei.
Eine zukünftige Kontaminationskontrolle braucht Automation und Digitalisierung. Dies fand schon in der ersten DraftVersion des Annex 1 von 2017 Erwähnung. Ziel ist es damals wie heute, manuelle Eingriffe in den kritischen Bereich der Zone A zu minimieren oder im Idealfall komplett zu vermeiden. Der Annex 1 hat die Entwicklung von robotisierten aseptischen Füll Linien mit Isolator Systemen vorangetrieben. Ich konnte selber die Entwicklung einer komplett neuen robotisierten Anlage von den ersten Gedanken bis zum fertigen Produkt begleiten. Dies war für das gesamte Entwicklungs Team eine enorme Herausforderung. Bereiche, die Handschuheingriffe benötigen, mussten so automatisiert werden, dass solche Eingriffe komplett entfielen. Auch der Annex 1 musste in das Design einfliessen. Ausserdem sollte die gesamte Anlage auch für hochaktive Substanzen ausgelegt sein.
Dazu mussten neue Technologien entwickelt werden. Hier konnte ich meine ganze Erfahrung in der Umsetzung der GMPAnforderungen einbringen sowie auch als «Mr. Containment» meine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der hochaktiven Substanzen dem Team vermitteln. Das Resultat kommt in der Industrie sehr gut
an und erntet viel Lob. Die Anlage ist unter dem Namen Robocell bekannt, eine gemeinsame Entwicklung der Firmen SKAN und Groninger. Da für eine solche Verknüpfung moderner Technologien viele Kompetenzen zusammengeführt werden müssen, setze ich mich für einen gezielten Wissenstransfer auf Fachveranstaltungen ein, wie etwa dieses Jahr auf dem «Future Robotics Workshop» der ISPE DACH vom 25. bis zum 27. September 2025 in Odense und Kopenhagen bei der Firma Novo Nordisk (Dänemark). Bei der ISPE DACH handelt es sich um die deutschsprachige Sektion der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), der grössten globalen Non Profit Organisation in der pharmazeutischen Industrie.
Die ISPE DACH Robotik Gruppe habe ich vor fast sechs Jahren zusammen mit Charly Coulon, Leiter Herstellungskonzep

Abb. 5: Lösung für den «Stopfensortiertopf» und den Transfer der Stopfen: Anstelle eines komplexen Designs werden die Stopfen auf einer Sortierplatte in die richtige Position ge bracht. (Bild: SKAN)
Klärungs- und Implementierungsbedarf zum Annex 1 – Implementierung der Contamination Control Strategy CCS: speziell wie diese aufgebaut sein soll, wie deren Flexibilität an Anpassungen aussieht oder wie diese bei einer Inspektion einfach zu verstehen ist, um nur ein paar Punkte zu nennen – Aseptic Process Simulation APS, auch Mediafill genannt: Hier gibt es viele Diskussionen bezüglich der genauen Ausführung und der Integration des Füllmaschinen Set ups etc. – PUPSIT: Dies ist ein Thema, das schier unzählige Diskussionen hervorruft. Um nur ein zwei Beispiele zu nennen. Sollte der PUPSIT in der Barriere oder ausserhalb der Barriere installiert und durchgeführt werden. Benötige ich PUPSIT bei kleinen Mengen und was fällt genau unter kleinen Mengen etc.
– First Air und deren Anforderungen sowie der Umsetzung in bestehende Installation – Sterilisation von indirekt produktberührten Oberflächen und deren Transfer – Material Transfer speziell in die Zone A und welche Systeme hierzu angewendet werden können
Diese Aufzählung könnte um einiges erweitert werden. Es gibt noch viel zu tun, und dies hat auch eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Parenteral Drug Association (PDA) zur Implementierung des Annex 1 gezeigt. In der Umfrage wurde gezeigt, welche Bereiche in Bezug auf den Annex 1 rückständig sind: ganz oben die Kontaminations Kontroll Strategie (CCS), direkt gefolgt von Barrieresystemen.
Bei der PDA handelt es sich um eine internationale Organisation für die Bereitstellung von wissenschaftlichen, technischen und regulatorischen Informationen für pharmazeutische und biopharmazeutische Hersteller mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland (USA) und der Europa Niederlas sung PDA Europe gemeinnützige GmbH in Berlin. Seit April gibt es auch die PDA DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz).
te der Zukunft bei der Invite GmbH, einem Public Private Partnership der Technischen Universität Dortmund und der Bayer Technology Services GmbH, Leverkusen, gegründet. Unser Ziel ist es, die Automation in der Pharmazeutischen Industrie voranzubringen. Vor vier Jahren haben wir dazu den RAYA Award (Robotic Application of the Year Award) ins Leben gerufen, der während des Workshops an insgesamt neun Gewinner in unterschied

Abb. 6: Vollautomatisierte Füll-Linie mit Robotertechnologien – ein Meisterwerk der Automation. (Bild: SKAN)

Abb. 7: Den ISPE DACH RAYA Award 2024 sicherte sich eine vollautomatisierte Herstellungszelle für patientenspezifische Zell- und Gen-Therapien (PEWO Flex TLC Vial Handling). (Bild: ISPE)
lichen Kategorien vergeben wird. Der Workshop wird von Jahr zu Jahr grösser und dadurch auch interessant für ein globales Publikum.
In 2024 fand der Robotik Workshop und RAYA Award bei der Firma Roche in Kaiseraugst/Schweiz statt. In diesem Jahr wird er bei der Firma Novo Nordisk und Odense Robotics durchgeführt. Die dänische Stadt Odense wird mittlerweile auch Robotic City genannt. Der Work
shop wird in diesem Jahr drei Tage dauern, da wir sowohl Firmen in der Robotic City besuchen werden sowie auch die Firma Novo Nordisk. Ich bin selber jedes Jahr aufs Neue überrascht, welche Innovationen wir bei Bewerbungen um den RAYA Award zu sehen bekommen und wie weit die Industrie in manchen Bereichen schon ist.
Einer unserer Gewinner von 2024, der über die Prämierung durch die RAYA
Spezielle Herausforderungen bei der Entwicklung von Robocell – Automatisierter Einbau der Füll Nadeln. Hierzu wurden die Füll Nadeln in einem Rapid Transfer Por t Container (RTP) fix eingebaut, mit einer speziellen Aufnahme und bereits vorsterilisiert. Der Roboter in der Füll Linie nimmt dann das Füll Nadel Set heraus und platziert es an der Füllposition. Dies hört sich einfach an, bedeutete jedoch viel Entwicklungsarbeit, um alle Details mit GMP Compliance umzusetzen.
– Das Thema «Stopfensortiertopf» und den Transfer der Stopfen war ebenfalls eine der grossen Herausforderungen. Anstelle eines komplexen Designs sollte es eine Lösung werden, bei der die Stopfen auf einer Sortierplatte in die richtige Position gebracht werden (Abb. 5). Die Sortierplatte sollte auch so gestaltet werden, dass der «First Air» über die Stopfen fliesst und seitlich entweichen kann. Auch sollten die gesamten Bauteile von der Grösse in einen RTP passen.
–
Auch die Be und Entladung des Gefriertrockners sollte automatisiert werden. Neben der Automatisierung war es uns wichtig, ein vollständiges «Track and Trace» im Gefriertrockner zu haben sowie auch einen Einsatz von Sonden, um an vordefinierten Positionen den GefriertrocknungsProzess zu überwachen. Auch sollte es bei einem möglichen Bruch eines Vials nicht zur Kontamination von umliegenden Vials kommen. All diese Faktoren wurden erfolgreich umgesetzt.
Diese Aufzählung könnte noch um viele Bereiche erweitert werden. Von dem Ergebnis bin ich seit Jahren begeistert und bislang wurden alle Betrachtungen erfolgreich durchgeführt. Ein Meisterwerk der Automation in der aseptischen Herstellung (Abb. 6).
Award Jury hinaus auch noch den Publikumsaward bekommen hat, ist eine vollautomatisierte Herstellungszelle für patientenspezifische Zell und Gen Therapien (Abb. 7). Durch den Workshop mit seinen zahlreichen Praxisbeispielen können sich die Teilnehmer ein Bild machen, was es schon alles in der Industrie gibt und diese Information in ihr Unternehmen mitnehmen. Interessenten melden sich zum Workshop über die ISPE DACHWebseite www.ispe dach.org an.
Unterm Strich: Gesamtbewertung des Annex 1 Bei einem meiner ersten Vorträge, nachdem der Annex 1 im Jahr 2022 publiziert wurde, hatte ich erwähnt, dass der Annex 1 aus meiner Sicht die Möglichkeit bietet, viel voranzubringen. Das geschieht nun bereits durch den Einsatz von Isolatoren, durch bessere Material Transfers wie durch E Beam oder durch Automation, wie etwa durch robotisierte Anlagen. Nichtsdestotrotz gibt es noch viel zu tun und auch viel Klärungsbedarf. Es bleibt spannend.
Präzision
fi lter, made in Niederlenz.











Schweizer Qualität, geprüft & zertifiziert.
Wir sind in der Schweiz der einzige Hersteller von Schwebstofffiltern in allen Klassen von E10 - U17. Sie erhalten bei uns alle Abmessungen, auch Einzelstücke, und wir liefern schnell dank kurzen Wegen.
Autor und Kontakt
Richard Denk SKAN AG
CH 4123 Allschwil info@skan.ch skan.ch
In unserem hochmodernen Labor prüfen wir diese Filter nach ISO 29463 und EN 1822 und stellen so jederzeit die geforderte Produktqualität sicher.
Kontaktieren Sie uns für eine massgeschneiderte Lösung. Mehr erfahren Sie auf unserer Webseite.
Die Messe Cleanzone brachte am 25. und 26. September 2024 in Frankfurt 77 Aussteller aus 16 Ländern und insgesamt 1400 Teilnehmer aus 41 Ländern zusammen. Als gemeinsames Interesse standen Reinraum- und Reinheitstechnik, Hygiene und Kontaminationskontrolle im Fokus. Die Unternehmen aus der Schweiz deckten vom schlüsselfertigen Bau von Reinräumen über deren Energiemanagement bis zur Qualifizierung und Validierung ein grosses Spektrum ab.
Am Stand von Valtria, Uster, erläuterte Thomas Krauss aktuelle Entwicklungen bei den Reinraumbetreibern. Das Nachfragehoch im Batterie-Bereich zeigt Bremsspuren, unter anderem weil die deutsche Regierung Elektroautos nicht weiter pusht. Der jüngste Hype in der Mikroelektronik ist noch intakt, doch die Verzögerung des Baus einer grossen Halbleiterfertigung durch Intel in Magdeburg zeigt auch hier eine Teilabschwächung.
Zwei Flaschenhälse: Monteure und Banksicherheiten
An solchen Grossprojekten zeigt sich auch exemplarisch, wie schwierig es ist, sie
überhaupt zu stemmen. Denn es läuft doch so: Das Gewicht liegt immer stärker auf dem Reinraum-Engineering unter reichlichem Einsatz von Building Information Modeling (BIM) und mit vielen 3DDarstellungen. Am Ende dieses Prozesses ist der Reinraum gefühlt schon fertig, und dann muss die Montage aus Effizenzgründen sehr schnell erfolgen. Wer aber kann die benötigten 500 qualifizierten Monteure ad hoch herbeischaffen?
Ein weiterer Flaschenhals ist die Finanzierung. Für Grossprojekte braucht man Banksicherheiten, doch die Finanzinstitute zögern oft. Darum geht der Trend zu grösseren Einheiten. Darum gehört Valtria


Neu bei der Firma Icotek – Reinraumkabel mit Schraubverlängerung: So lassen sich die vielen doppelten Wände in Reinräumen gut überbrücken.
selbst seit knapp einem Jahr zu französischen Clauger, Brignais.
Spitäler fragen Hygiene-Inspektion stärker nach Steht ein Reinraum, so müssen nach nationalen und internationalen Normen regelmässig bestimmte Parameter überprüft werden. Dazu gehören Partikelzählungen, mikrobiologische Keimzahlbestimmungen, Kalibrierungen von Differenzdruckanzeigen, Temperaturfühlern und Feuchtefühlern und vieles mehr.
Spezialisiert hat sich darauf die Q-Tec AG, Volketswil. Jüngst hat das Unternehmen infolge einer stärkeren Nachfrage aus Spitäler zusätzlich die Hygiene-Inspektion nach VDI 6022 und SWKI VA 01-104 in Reinlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in sein Programm aufgenommen.
Visualisierung für die Energieef fizienz s teigerung
Die zahlreichen Messungen in Reinräumen resultieren in einer Vielzahl von Daten. Diese zu visualisieren und im Sinne eines effizienten Reinraumbetriebs zu nutzen, hat sich die Ost-Energie GmbH, Zürich/St. Gallen, zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen bekommt quasi automatisch Daten von Stromzählern herein und kann vielfach weitere dazu sammeln, ind em es sie zum Beispiel aus BUSSystemen ausliest. Das führt zu einer grossen Transparenz. Abweichungen vom Normalbetrieb, wie etwa aussergewöhnliche Trends bei Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder anderen Parametern. Die Auswertung erfolgt, wo es sinnvoll erscheint, mit unkonventionellen Mitteln. So hat das Ost-Energie-Team schon einmal Daten und Graphiken aus einer Solaranlage in den bekannten Chatbot ChatGPT eingegeben und ihn danach gefragt, wo hier das Problem liege – Antwort: ein defekter Wechselrichter. Das war’s dann auch!


+ Dr. Ing. Huber GmbH + Co. KG spürt eine stärkere Nachfrage von grossen Playern der Mikroelektronik wie von Startups vom Bodensee.
Ist das schon Künstliche Intelligenz? «Nein», erläutert Thomas Allemann am CleanzoneMessestand, «denn alles muss von Hand in ChatGPT eingegeben werden.» Von einer Künstlichen Intelligenz würde man sich ein kontinuierliches «Mitdenken» und Aktionen zur Verhinderung defekter Teile oder wenigstens den vorausschauenden Austausch «fast» defekter Teile erhoffen.
Das grosse Thema für den Reinraum lautet nach Thomas Allemann: Wie stark lässt sich die Luftwechselrate senken? Zum Beispiel visualisiert sein Team dabei einen Vorher-Nachher-Vergleich nach Absenkung der Luftwechselraten in einem Reinraum und verifiziert später, ob er sich in der Realität genauso verhält.
An seine Grenze kommt das Ost-EnergieTeam zurzeit dort, wo es um validierte
Prozesse geht insbesondere im PharmaBereich. Dennoch sind die Systeme des Unternehmens auch in der PharmaBranche im Einsatz, so etwa bei Johnson & Johnson in der Schweiz. Im Falle solch grosser Betriebe geht es schnell einmal um jährliche Einsparungen im sechsstelligen Franken-Bereich.
Einen Stand auf der Cleanzone unterhielt darüber hinaus auch die International Confederation of Contamination Control Societies – ICCCS, Bern.
Starke Nachfrage von Mikroelektronik- Startups
Auf der Cleanzone zeigten sich weitere Unternehmen mit starker Präsenz und/ oder engerem Bezug zur Schweiz. Dazu zählte beispielsweise Bardusch im baden-

Im Universitätsklinikum Zürich bereits im Einsatz: UV-Desinfektions-Roboter Hero 21 von ICA, ein Kandidat für den Cleanzone Award 2024.



Thomas Krauss (M.), Valtria: «Der hohe Bedarf an Monteuren und eine gute Finanzierung für Grossaufträge führt im Reinraum-Bereich zu Unternehmenszusammenschlüssen.»

Der Stand von Ost Energie auf der Cleanzone: Visualisierung von Reinraumparametern für einen grüneren CO2-Fussabdruck.
württembergischen Ettlingen. Der Spezialist für die Reinigung von Reinraumwäsche dehnt sein Betätigungsfeld regional weiter aus und verdichtet es gleichzeitig. Das Highlight dieses Jahres war die Eröffnung eines neuen Standorts in Satteldorf, Baden-Württemberg. Das führt zu kürzeren Anfahrtswegen, einem geringeren CO2Fussabdruck und zu einer höheren Reserve: Fällt eine Wäscherei aus, übernimmt die nächstgelegene. Die Schweiz deckt

Unter Lichteinfluss selbstdesinfizierend: Jo sef Ortner präsentiert Reinraumbekleidung, die mit einem neuentwickelten, gelben Farbstoff eingefärbt ist.

Julia Cervenak, Q-Tec, Volketswil: «Als neueste Ergänzung unseres Angebots übernehmen wir auch die Hygiene-Inspektion nach VDI 6022 und SWKI VA 01-104 in Reinlufttechnischen Anlagen.»

Bardusch hat mit seinen Reinraum-Wäschereien die gesamte Schweiz abgedeckt und dehnt sich weiter aus – bis nach Spanien, Ungarn und Polen.
Bardusch mit Reinraumwäschereien vollständig ab.
Daldrop + Dr. Ing. Huber GmbH + Co. KG, Neckartailfingen, ein Unternehmen, das je nach Auftragslage temporär ein eigenes Büro in der Schweiz betreibt, sieht den Hype in der Mikroelektronik noch intakt. Das Unternehmen spürt eine stärkere Nachfrage von grossen Playern (z. B. Bosch) wie von Startups, viele davon aus der Bodenseeregion.
Thomas Nagel, Prokurist bei dem Unternehmen freut sich auch über Nachfrage aus Fernost. Denn selbst wenn es zuweilen so scheint, als entwickelten sich die dortigen Halbleiterhersteller zu globalen Monopolisten, so fragen sie doch Reinraumtechnik aus Europa nach. Daldrop hat über sein Büro in Singapur unter anderem einige Projekte in Taiwan realisiert.
Gelb ist das neue Blau Übrigens liegt bei der Anwendung moderner Reinraumtechnologie das Universitätsklinikum Zürich gut im Rennen. Es setzt bereits den UV-Roboter Hero 21 der ICA, Dortmund, ein, einen Kandidaten für den Publikumspreis der Messe, den Cleanzone Award. Der Roboter rollt durch ein Zimmer und desinfiziert es mit 254-NanometerStrahlen. Die Ansteuerung erfolgt bequem und zeitgemäss über ein Smartphone. Gewonnen hat den Cleanzone Award allerdings ein neues Verfahren zum Test
von Reinraumbekleidung auf Durchlässigkeit für Mikroorganismen [https://ccreport. com/artikel/durchlaessigkeitstest-fuerreinraumbekleidung-gewinnt].
Eine wichtige Innovation aus dem Nachbarland Österreich präsentierte Josef Ortner, Ortner Reinraumtechnik, Villingen, fast ein wenig am Rande der Cleanzone. Auf die Frage, wie sich ein «sauberer Mensch» in den Reinraum bringen lässt, hat das Unternehmen mit seiner PDcT (PDc-Technologie, Photodynamic Disinfection certified technology, Ortner Reinraumtechnik) eine Antwort gegeben: Mit einem blauen Farbstoff eingefärbte Kleidung wird durch Licht aktiviert, wobei sich Singulett-Sauerstoff bildet. Dieser entfaltet eine desinfizierende Wirkung (98-prozentige Keimabtötung). Im Spital ist diese Bekleidung bereits im Einsatz.
Jetzt hat Ortner Reinraumtechnik in Kooperation mit der Humboldt-Universität einen noch viel effektiveren gelben Farbstoff entwickelt (99,99-prozentige Keimabtötung). Damit eingefärbte Reinraumbekleidung könnte für weite Bereiche einschliesslich der Industrie interessant werden und dürfte auch den bisherigen Farbstoff in den Spitälern ablösen. Gelb ist das neue Blau!
Autor
Dr. Christian Ehrensberger

Fürs Training und für die tägliche Praxis: Das Mixed-Reality-System mit VR-Brille von Mycleanroom, Heidelberg, sichert ein reinraumadäquates Putz-Ergebnis. (Bild: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Jochen Günther)
Eine neue Dichtigkeitsprüfung für Reinraumbekleidung hat aktuell den Cleanzone Award der gleichnamigen Reinraummesse in Frankfurt am Main abgeräumt, doch auch die fünf Wettbewerber zeugen von der hohen Innovationskraft der Branche und verdienen eine extra Würdigung.
Die neue ReBa²-Testmethode [https://ccreport.com/artikel/durchlaessigkeitstest-fuer-reinraumbekleidung-gewinnt] haben auf der Cleanzone das Unternehmen Dastex, Muggensturm, und das Deutsche Institut für Textil- und Faserforschung (DITF), Denkendorf, gemeinsam präsentiert. Das Kürzel ReBa² steht für Realitätsnahe Bakterienbarriere und ermöglicht die Bestimmung des Keimdurchgangs bei Reinraumbekleidungstextilien. Die neue biologische Methode stellt eine signifikante Verbesserung im Hinblick auf realitätsnahe Belastungen und hohe Flexibilität im Vergleich zu bisherigen Testmethoden dar.
Durchlässigkeitstest für Reinraumbe kleidung gewinnt Alina Kopp, Leiterin Forschung und Entwicklung bei der Dastex Group, Muggen -
sturm, und Evi Held-Föhn, Leiterin Prüflabor Biologie beim Entwicklungspartner DITF (Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung) in Denkendorf, sind über die herkömmlichen Testverfahren hinausgegangen und haben zum Beispiel zusätzlich den mechanischen Stress, den Einfluss der Unterbekleidung und der unvermeidlichen Schweissbildung auf die mikrobiologische Durchlässigkeit berücksichtigt. Als Testkeim für den Nachweis der Penetration von Bakterien durch Reinraumbekleidung wählten sie Staphylococcus epidermidis und damit einen Keim, der in der Realität tatsächlich auf der menschlichen Haut vorhanden ist.
Die bisher verfügbaren Testverfahren sind beispielsweise für Gesichtsmasken entwickelt worden und berücksichtigen die Charakteristika von Reinraumbekleidung
und die speziellen Bedingungen im Reinraum nicht adäquat. Alina Kopp und Evi Held-Föhn haben an dem realitätsnahen Verfahren nicht nur fünf Jahr geforscht, sondern auch die Ergebnisse dieses komplexen Projekts mit dem abstrakt anmutenden Namen ReBa² in einem Vortrag von wenigen Minuten anschaulich und verständlich einem gespannten Fachpublikum nahegebracht. Es hat sie am 26. September 2024 im Wettbewerb mit fünf weiteren starken Kandidaten zum Gewinner des Cleanzone Award gewählt.
Grosses Kino mit dem «21st Century Rob»
Als Wettbewerber traten gleich zwei Desinfektionsverfahren auf der Basis von UVStrahlung an. Der als «Health Robot for the 21st Century» präsentierte Roboter

Im Wettbewerb um den Cleanzone Award: Präsentation der Elisair von Elis, Saint-Cloud, Frankreich, vor dem Messepublikum. (Bilder: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Jochen Günther)
mit dem Namen Hero21 von ICA, Dortmund, ist ein autonomer, mobiler UV-CDesinfektionsroboter. Er verbindet die umfassend erforschten Vorteile der UVC-Technologie mit der mobilen Robotik. Der gesamte Prozess läuft im Vergleich zur manuellen Desinfektion deutlich schneller. Risikobereiche können gezielt länger und aus unterschiedlichen Winkeln bestrahlt werden. Das macht den UV-Roboter wirkungsvoller und schneller als stationäre

Frischluftzufuhr und eine Vollbrille, die nicht beschlägt: Anprobe des «Helms» des Elisair-Systems von Elis, Frankreich, am Messestand des Unternehmens. (Bilder: Ehrensberger)
UV-Quellen. Hero 21 schafft in zehn bis fünfzehn Minuten 25 Quadratmeter. Darüber hinaus verbessert der Hero21 die Desinfektionsqualität und vergrössert den Desinfektionsbereich. Gemäss Einzelkeimtest nach Din 17272 wird eine Keimreduktion um 88,55 erreicht. Der UV-Roboter arbeitet bei 254 Nanometern. Diese UV-Strahlung zerstört die DNA von Mikroorganismen, doch auf für den Menschen ist sie eine Gefahr. Darum wird während der Desinfektion ein Sensor

Das neue Testverfahren mit dem Namen ReBa² («Realitätsnahe Bakterienbarriere») hat die Dastex Group – hier ihr Stand auf der Cleanzone – gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung in Denkendorf entwickelt. (Bild: Ehrensberger)
an die Tür gehängt, der den Roboter im Falle einer Türöffnung automatisch stoppt und ausschaltet.
Der Roboter lässt sich per Smartphone über eine App ansteuern. Der Anwender erhält nach Abschluss der Desinfektion eine Dokumentation. Der UV-Roboter hat bereits den Weg in die Praxis gefunden und ist zum Beispiel bei Bayer und im Universitätsspital Zürich im Einsatz. Die UV Medico, Aabyhoej, Dänemark, schickte als Award-Kandidat die HumanSafe Far-UVC-Solution ins Rennen. Diese UV-Kabine ermöglicht es dem vollständig bekleideten Bedienpersonal, den Reinraum zu betreten, ohne dass Kittel, Maske, Schutzbrille, Handschuhe und andere Ausrüstungsteile mikrobiell kontaminiert sind. Mit einer vollständig berührungslosen Schnittstelle können die Bediener die UVKabine betreten und sie aktivieren, um einen zwanzig Sekunden schnellen und effizienten Dekontaminationsprozess einzuleiten. Eine spezielle Stufe sorgt sogar extra für die Dekontamination der Fusssohlen.
Die UV-Kabine steht als Schleuse zurzeit in einer Ausführung für den Übergang zwischen den Reinraumklassen B und C zur Verfügung. In der Pharma-Industrie ist dieses Verfahren schon angekommen und ist dort auch in bestimmten Produktionsbereichen interessant, weil es biologische Strukturen nicht zerstört.
Statt der üblichen, für Menschen schädlichen Dekontaminationswellenlänge 254 Nanometer arbeitet die Human-Safe FarUVC-Solution bei 222 Nanometer. So lassen sich Mitarbeiter in zwanzig Sekunden dekontaminieren, ohne sie zu gefährden.
Ein weiterer Vorteil: Die verwendeten UVStrahler kommen ohne Quecksilber aus –ein Vorteil für die Umwelt.
Mit einem aseptischen Bekleidungssystem für sterile Umgebungen ging das
Unternehmen Elis, Saint-Cloud, Frankreich, an den Start: Elisair bedeckt die Haut vollständig und stellt eine kontrollierte Luftzufuhr sicher. Dafür sorgt ein in einen «Helm» integrierter Ventilator. Er führt Frischluft zu, was das CO 2 in der verfügbaren Atemluft um 80 Prozent reduziert. Gleichzeitig kann die nach Annex 1 vorgeschriebene Vollbrille nicht beschlagen, weil sie immer wieder «freigeblasen» wird. So wird das Arbeiten im Reinraum ein ganzes Stück komfortabler und angenehmer empfunden. Der «Helm» wiegt nur 486 Gramm und bleibt etwa drei Jahre (6000 Stunden) funktionsfähig.
«Nichtraucher» als Next-levelStrömungsvisualisierung
Ein weiterer Cleanzone-Award-Kandidat, das «Flowbos-Verfahren» von Lavision, Göttingen, ermöglicht Luftstromtests ohne Rauch. Klassischerweise ist zwar ein Rauch-Test zur Strömungsvisualisierung im Reinraum üblich, teils sogar verpflichtend. Doch Rauch kann auch die Integrität des Produkts beeinträchtigen. So kam der Anstoss von einem Pharma-Unternehmen: «Wir brauchen den Next-level-Test!»
Das «Flowbos-Verfahren» arbeitet ohne Rauch, verwendet stattdessen Edelgase und visualisiert ihre Strömung mit einer speziellen Kamera. Die bringt das Ergebnis sogar direkt auf den Monitor. So werden

Die 28-Milliarden-Dollar-Investition «VRBr ille»: Zunächst etwas für Gamer – jetzt für indus trielle Zwecke attraktiv, insbesondere im Reinraum. (Bild: Ehrensberger)
die Reinigungskosten erheblich gesenkt und Produktionsausfälle vermieden – und ebenso Kontamination durch Rauch-Rückstände. Das Verfahren kann zum Beispiel im Isolator und im RABS-Umfeld (Restricted Access Barrier System, physische Barriere zwischen dem Produktionsbereich und der Bedienerumgebung) angewendet werden.


Der «Nichtraucher» Flowbos von Lavision, Göttingen, macht Str ömungsvisualisierung ohne potenziell produktverunreinigenden Rauch möglich. (Bild: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Jochen Gün ther)
Ein Dankeschön an den FacebookGründer
Die Mycleanroom, Heidelberg, setzte für den Cleanzone-Award-Wettbewerb auf eine neue VR-Brille für eine ReinraumReinigung mit Unterstützung durch «Mixed Reality» – virtuelle Realität und erweiterte Realität. Viele hatten zuvor gedacht, dass man virtuelle Unterstützung




Demonstration in der Schleuse (hier ohne Reinraumbekleidung): Mit einer für Mens chen ungefährlichen, doch gegen Keime ef fektiven UV-Wellenlänge punktet UV Me dico, Aabyhoej, Dänemark. (Bild: Ehrensberger)
vor allem zu Schulungszwecken einsetzen könnte. Doch das neue System kann in Schulungssituationen und im Alltag eingesetzt werden.
Markus Thamm von Mycleanroom kommentierte am Rande der Messe: «Ein

Auch für die Desinfektion der Fusssohlen ist gesorgt. (Bild: Ehrensberger)
Dankeschön an Mark Zuckerberg! Er hat in die Entwicklung der VR-Brille 28 Milliarden investiert. Zunächst war sie etwas für Gamer, aber inzwischen können wir sie für industrielle Anwendungen nutzen.»
Diese Anwendungen gehen weit über ein virtuelles Spiel oder ein spielerisches Training hinaus. Da ist ein realer Tisch, und der Mitarbeiter reinigt ihn mit einem Tuch. Über die VR-Brille sieht er den Tisch in Farben, eine für «schon geputzt» und eine andere für «noch nicht geputzt». Damit hat der Mitarbeiter die volle Kontrolle. Und auch der Kollege im Büro kann sich das Putz-Ergebnis auf seinen Bildschirm holen und im Falle eines Falles den Tipp geben: «Du musst in Raum 3 oben an der Wand nachputzen – ich markiere Dir das mal mit einer extra Farbe.»
Für all das braucht die Reinigungskraft nur die VR-Brille, keinen Computer und nicht einmal ein Kabel – eine ebenso einfache wie effektive Sache!
Spitze des Eisbergs der Innovationen Die sechs Cleanzone-Award-Kandidaten hatte vor Messebeginn eine Jury ausgewählt. Insofern stellten sie nur die Spitze des Eisbergs dar. Darunter tummelten sich noch viele andere interessante Innovationen. Sie haben die Cleanzone 2025 zu einer besonders lohnenswerten und lebendigen Messe gemacht.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger
SwissCCS ist eine wissenschaftlich-technische Fachvereinigung zur Förderung der Kontaminations-Kontrolle und Reinraumtechnik. Sie vertritt die Schweiz in den europäischen und internationalen Normengremien ISO/CEN.
Jetzt Mitglied werden!

SwissCCS veranstaltet und organisiert Fachseminare, Schulungen, Workshops und Informationsaustausch unter Spezialisten. Mehr Infos unter swissccs.org.
Hochentwickelte Luft- und Wasserfiltrationssysteme, die den strengen Sicherheitsstandards wichtiger Industrien wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie des Bergbaus und der Mineraliengewinnung entsprechen, wurden auf der Messe Filtech in Köln von über 590 Ausstellern vorgestellt.
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten strenge Spezifikationen, um durchgängig sichere Prozesse zu gewährleisten, da selbst kleinste Verunreinigungen und Kontaminationen die Haltbarkeit von Produkten verringern oder sogar zum Verlust ganzer Chargen führen können. Hochentwickelte Filtermembranen eignen sich hervorragend für Reinigungsverfahren bei der Herstellung von zum Beispiel Milch, Käse, Zucker und Süssungsmitteln, während in vielen anderen Bereichen hochmoderne Biofilter eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Verunreinigungen wie Legionellen, Bakterien, Parasiten, Trübungen, Rost, Arzneimittelrückstände, Arsen und störende Aromen zu entfernen. Die Filtration ist auch für den Geschmack von Tee und Kaffee entscheidend. Im Bergbau gelten inzwischen ebenso strenge Vorschriften für die Kontrolle von Staub, Abwasser und anderen Emissionen, die durch wirksame Filtersysteme erfüllt werden. Bei der Aufbereitung von Mineralien werden erhebliche Mengen an Wasser verbraucht, und die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten ermöglicht die Wiederverwendung von Wasser, wodurch der Verbrauch gesenkt und die Umweltbelastung verringert wird. Gefährliche «Tailings» – das Abfallmaterial, das nach der Gewinnung von Mineralien zurückbleibt – werden mit den riesigen automatisierten Filterpressen, die von Unternehmen wie Andritz, Diemme und Metso entwickelt wurden, ebenfalls effektiv entwässert. Das reduziert die Abfallmenge weiter und verhindert die Bildung von Absetzteichen, die Umweltund Sicherheitsrisiken darstellen können. Bei der Mineralienaufbereitung sorgen Filtrationssysteme für eine hohe Produktreinheit, indem sie unerwünschte Feststoffe entfernen und so sowohl die Produktqualität als auch den Marktwert verbessern. Die Rückgewinnung feiner Partikel wertvoller Mineralien, die andernfalls verloren gehen könnten, ist ein weiterer wichtiger Vorteil.

Mit einem Auslandsanteil von 61 Prozent verzeichnet die Messe einen Besucherrekord, wobei die Zahl der internationalen Gäste aus Nordafrika, Südamerika und dem Nahen Osten sowie aus den etablierten Zentren in Europa, den USA und Asien deutlich zugenommen hat. (Bild: Filtech)
Konferenz mit 200 Vorträgen
Bei der Optimierung der Effizienz von gewebten oder nicht gewebten Filtermedien geht es im Wesentlichen darum, ein perfektes Gleichgewicht zwischen der Fähigkeit des Materials, Staub oder andere Partikel aufzufangen und festzuhalten und seinem Druckabfall (seinem Widerstand gegenüber der Luft, der Flüssigkeit oder dem Gas, das durch das Material geleitet wird) zu erreichen.
Es gibt viele Parameter, die dies beeinflussen können – ebenso wie eine potenziell endlose Reihe möglicher Gewebekonstruktionen – und es werden weiterhin intensive Forschungen und Versuche durchgeführt, um dieses Gleichgewicht zu optimieren. Das ist auch jeweils grundlegendes Thema an der Filtech-Konferenz. Auf der Veranstaltung 2024 wurden viele neue Konzepte zur Optimierung der Filtereffizienz vorgestellt: von der Individualisierung von Hochleistungsmembranen auf der Nanoskala bis hin zum Einsatz von KI und digitalen Zwillingen.
Trends im Bereich Filtermedien
Bei den Filtermedientrends war besonders auffällig, dass die Integration von Nanofaserpartikeln und -vliesen in Vliesstoffe
immer mehr an Bedeutung gewinnt und die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe als Alternative zu Kunststoffen ein wichtiges Thema war.
Technologiehersteller von Nanofasern wie Elmarco und Inovenso erforschen mit ihren Kunden die Einführung von erneuerbaren Rohstoffen und umweltfreundlichen Lösungsmitteln bei der Herstellung von elektrogesponnenen Nanofasern, um diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden.
Termin der Filtech 2026 bekannt
Kurz: Die Anwendungen für Filtersysteme sind vielfältig. Suzanne Abetz, Geschäftsführerin von Filtech, ergänzt: «Wichtige neue Märkte für effektive Filtration in Bereichen wie der Elektrifizierung von Fahrzeugen, dem Transport und der Speicherung von Wasserstoff und der Kohlenstoffabscheidung bedeuten, dass die Industrie weiterhin die technologischen Optionen vorantreibt und erweitert.» Die nächste Messeausgabe der Filtech findet vom 30. Juni bis am 2. Juli 2026 in Köln (D) statt.
Weitere Informationen www.filtech.de
Über 230 Unternehmen und Partner präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Cleanroom und Prozess. Begleitend standen rund 300 Fachbeiträge auf dem Programm.

Eine erste Rückschau zur Messe in Karlsruhe (25. bis 27. März 2025) finden Sie unter diesem QR-Code.


Die Besucher erwartete einmal mehr ein vollgepacktes und spannendes Programm. (Bild: Thomas Füglistaler)
HOTEC_TSO_183x131_4c_2017_2_Layout 1 17.03.17 14:48 Seite 1
MBV AG stellte den Echtzeit-Luftkeimpartikelzähler Rapid-C+ vor. (Bild: Thomas Füglistaler)

HOtec –Ihr Partner für die Reinraum-Messtechnik









Reinraum-Qualifizierung Messinstrumente Verkauf und Service Monitoring Expertisen Planung
Hotec Systems GmbH
Unterdorfstrasse 21
CH-8602 Wangen b. Dübendorf
Telefon +41 44 880 07 07 info@hotec-systems.ch www.hotec-systems.ch

Stefano Trossarello von Levitronix GmbH präsentierte den auf aktiver Magnetsc hwebe tec hnik basierenden Lüfter für den aseptischen Bereich. (Bild: Luca Meister)



Präzise Zuverlässig Benutzerfreundlich
Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) ist weder künstlich noch intelligent, aber ungemein nützlich in der Wirkstoffentwicklung, in der Materialforschung und vor allem bei der Auswertung unterschiedlichster Bildinformationen. Wie sich diese Chancen in den betrieblichen Alltag eines Chemie-, Pharma- oder Biotech-Unternehmens umsetzen lassen, zeigt das Branchenevent Ilmac 2025 in Basel.
Künstliche Intelligenz stellt bei der Auswertung von Röntgen- und MRT-Aufnahmen (z. B. M ammographie), Infrarot- und Massenspektren eine effektive Unterstützung für den Arzt oder Chemiker dar.
Damit lassen sich Krebs und andere Erkrankungen schneller erkennen und mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit behandeln. Ebenso beschleunigt sich der Weg vom Analyseergebnis in Rohdaten bis zur

Abb. 1: «Ich schalte mal eben die Künstliche Intelligenz ein» – so einfach ist es dann doch nicht. Was und wie es im Betrieb funktioniert, zeigt das kommende Branchenevent Ilmac Basel. (Bildquelle: Shutterstock)

Auswertung. Selbst unbekannte Substanzen lassen sich mit AI-Unterstützung identifizieren.
Ein weiteres typisches Einsatzgebiet betrifft die Wirkstoffforschung: Ausgehend von bekannten Substanzen schlägt AI aussichtsreiche Kandidaten vor. Diese können zum Beispiel wirksamer, verträglicher oder komfortabler applizierbar sein.
Analog dazu lassen sich in der Materialforschung Werkstoffe mit Wunscheigenschaften in silico kreieren. Dabei kann es sich zum Beispiel um 3D-druckbare Kunststoffe mit bestimmten Festigkeiten und Farben handeln.
Ausserdem kann AI sich bei der Kontrolle von Chemie-, Pharma- und Biotech-Prozessen nützlich machen. Denn beispielsweise weisen Temperatur- und Druckverläufe über bestimmte Zeiträume gewisse Charakteristiken auf. Künstliche Intelligenz kann solche Muster prüfen: Bewegt sich der Prozess in ruhigem Fahrwasser, oder kommt es zu Anomalien? Im letzteren Falle ist womöglich ein Eingreifen notwendig. Hier zahlt sich ein hoher Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad mehrfach aus. Denn die AI benötigt als Input viele Messwerte in Form digitaler Daten. Das

Abb. 2 und 3: Hier ist Künstliche Intelligenz stark: Bildauswertung in der Medizin und in der chemischen Analytik (z. B. Massenspektrometrie), bei der Werkstoffentwicklung (z. B. f ür den 3D-Druck) und der Prozesskontrolle. (Bildquelle: Shutterstock)

4: Die Chancen von Künstlicher Intelligenz im Zusammenspiel mit Automatisierung und Digitalisierung für die betriebliche Praxis sind enorm – und präsent an der Ilmac in Basel. (Bildquelle: Shutterstock)
können Temperaturen, Drücke, Färbungen von Flüssigkeiten, Vibrationen von Kompressoren, Axialbeschleunigungsmessungen von Motoren und vieles mehr sein. Über diese sensorischen Informa
Allerdings ist AI in der Regel kein «Plugand-play-Werkzeug». Das dafür notwendige Datenerfassungssystem schliesst Maschinen mit speicherprogrammierba -
Ilmac Basel 2025
Dauer: 16. bis 18. September 2025
(Dienstag bis Donnerstag)
Öffnungszeiten: 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Messe Basel, Halle 1.0
Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG
E-Mail: info@ilmac.ch
www: https://www.ilmac.ch/
Darüber hinaus muss die Datensicherheit gewährleistet werden, insbesondere bei Internetanbindung zur Nutzung von IoTTools («Internet of Things»).
In allen Anwendungen ist Künstliche Intelligenz nicht künstlich, weil an erster Stelle ein Training durch Menschen steht. Der Arzt teilt der künstlichen Intelligenz mit, ob er auf einem Röntgenbild einen Tumor erkennt; der Analytiker sagt, ob im IRSpektrum die CO 2 -Bande sichtbar ist; Wirkstoff- und Materialentwickler geben erfolgreiche Medikamente bzw. Werkstoffe als Trainings-Input. Die mit vielen Röntgenaufnahmen, Wirkstoffen, Werkstoffen oder Spektren gefütterte AI erledigt anschliessend viele Aufgaben zuverlässiger als der Mensch.
Das birgt für den Einsatz von AI in der betrieblichen Praxis enorme Chancen, insbesondere im Zusammenspiel mit Automati -


Die Messe Powtech Technopharm, 23.–25. September 2025 in Nürnberg, bringt ihre Besucher vom Processing bis zum Packaging auf den neusten Stand – inklusive interessanter Aspekte für den Reinraum.
Die klassische Powtech ist die internationale Fachmesse für Technologien zur Verarbeitung von Pulvern, Feststoffen und Flüssigkeiten in Europa. Neben mechanischen, thermischen sowie analytischen Verfahren fallen hierunter auch diejenigen, die mit flüssigen oder pastösen Stoffen und Schüttgütern vereinigt und gemeinsam prozesstechnisch verarbeitet werden.
Durch die Erweiterung, um den Messebestandteil «Technopharm» liegt ein zusätzlicher Fokus auf der GxP konformen Herstellung von flüssigen, halbfesten und festen Pharmazeutika. Durch die Fertigung unter aseptischen Bedingungen kommen Aspekte der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle hinzu, die für Reinräume von entscheidender Bedeutung sind.
Parallelveranstaltungen Fachpack und Partech
Die Verpackung von Arzneimitteln und anderen Produkten steht auf der Agenda der Fachpack, des zentralen Treffpunkts für die Verpackungsindustrie und ihre Anwender. Einen Top Themenbereich bildet dabei die Vereinigung spezieller Funktionen (z. B. Barriere Eigenschaften) und Nachhaltigkeit (z. B. Bioabbaubarkeit). Eingeschlossen sind auch die Themen «Logistik», «Verpackungsanlagen» und «Verpackungsdruck». Die Fachpack findet parallel zur Powtech Technopharm am selben Ort statt – ebenso wie die Partec. Bei der Partec handelt es sich um einen internationalen Kongress für Partikeltechnologie. Zahlreiche Forscher aus Universitäten, Industrieunternehmen und
anderen Partikelforschungszentren präsentieren hier Beiträge zu Themen wie Partikelbildung, Partikelcharakterisierung, Messmethoden und Partikelmessgeräte, Verfahren und Anwendungen von Partikeln jeder Art oder Grösse. Auch Aerosolund Nanotechnologien sind dabei von Bedeutung – und das alles auf vielen unterschiedlichen Anwendungsfeldern.
Weitere Informationen NürnbergMesse GmbH D 90 471 Nürnberg powtech technopharm@ nuernbergmesse.de www.powtech technopharm.com www.fachpack.de www.partec.info

Sehr geehrte Mitglieder des SwissCCS, als Präsident des SwissCCS freue ich mich, Ihnen den Jahresbericht für das Jahr 2024 vorlegen zu dürfen. Dieser Bericht gibt einen Überblick über unsere Aktivitäten, erreichten Meilensteine und Herausforderungen, die wir im vergangenen Jahr gemeinsam bewältigt haben. Dank des Engagements unserer Mitglieder, der tatkräftigen Arbeit des Vorstands und der Unterstützung unserer Geschäftsstelle konnten wir wichtige Fortschritte erzielen.
Rückblick auf das Jahr 2024
Das vergangene Jahr war von vielen Entwicklungen geprägt, die unseren Verband nachhaltig beeinflusst haben. Besonders im Fokus standen die Zusammenarbeit mit dem SWKI sowie die künftige Kooperation mit der Ilmac.
Generalversammlung
Die Generalversammlung fand erstmals gemeinsam mit dem SWKI statt. Die Mitglieder haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Absichtserklärung mit dem SWKI zu unterzeichnen und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Zudem wurde Michael Meier, Direktor des SVGW, neu in den Vorstand gewählt. Unser langjähriger Revisor Riccardo Schena wurde mit Dank verabschiedet; seine Nachfolge übernimmt Angel Gomez von der Firma Admeco.

Roman Schläpfer, Präsident SwissCCS: «Mit der erstmaligen Integration unserer Fachtagung in die Ilmac und der Fortsetzung der Gespräche mit dem SWKI stehen bedeutende Veränderungen an.» (Bild: SwissCCS)
Fachtagung
Die letzte Fachtagung in der bisherigen Form fand am 22. Mai im Mercure Hotel Krone in Lenzburg zum Thema «Geopolitische Einflüsse» statt. Trotz der positiven Resonanz des Vorjahres konnten die Teilnehmerzahlen nicht gesteigert werden; rund 50 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Den Abschluss bildete eine exklusive Führung bei Hitachi Ltd. in Lenzburg sowie ein gemeinsames Apéro Riche. Da die Veranstaltung finanziell nicht optimal verlief, hat der Vorstand neue Konzepte für die künftige Ausrichtung der Fachtagung erarbeitet.
Kooperation mit Ilmac
Im Herbst 2024 wurde die Zusammenarbeit zwischen Ilmac und SwissCCS offiziell besiegelt. Zukünftig wird die Fachtagung im Rahmen der Ilmac durchgeführt. Am 17. September 2025 wird uns dort der Speakers’ Corner zur Verfügung stehen, um Fachbeiträge zur Reinraumtechnik einem grösseren Publikum vorzustellen. Diese Neuausrichtung soll nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die Sichtbarkeit des SwissCCS und seiner Themen erheblich steigern.
Zusammenarbeit mit dem SWKI
Nach dem positiven Entscheid der Generalversammlung haben die Vorstände von SwissCCS und SWKI die Gespräche intensiviert. Das langfristige Ziel ist eine Integration innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dazu sind Anpassungen auf beiden Seiten erforderlich, um die Interessen des SwissCCS auch im internationalen Kontext nachhaltig zu verankern.
Mitarbeit in Normenausschüssen
Die aktive Beteiligung an internationalen Normungsgremien wie ISO, CEN und VDI bleibt eine tragende Säule unserer Arbeit. Auch 2024 waren unsere Mitglieder im Namen des SwissCCS national und international unterwegs, um die Interessen der Schweiz in der Reinraum und Kontrollraumtechnik zu vertreten.
Schulungsprogramm
Der Vorstand hat sich im Jahr 2024 neu organisiert, um das Schulungsangebot gezielt voranzutreiben. Die Entwicklung neuer Schulungsunterlagen erfordert erhebliche Ressourcen, doch wir sind zuversichtlich, bald konkrete Ergebnisse und Termine kommunizieren zu können.

ISO Audit in einer Lebensmittel und Ge tränkeherstellung: Die aktive Beteiligung an interna tionalen Normungsgremien zählt zu den Säulen der SwissCCS Verbandstätigkeit. (Bild: Adpic)
Medienpräsenz und LinkedIn
Ein besonderes Highlight war die verstärkte Präsenz des SwissCCS auf LinkedIn, insbesondere durch die Vorstellung unserer Mitglieder. Mit knapp 60 00 0 Impressionen konnten wir unsere Reichweite deutlich erhöhen und das Netzwerk des Verbandes erweitern.
Einführung der Coffee Break Sessions
Zur Wissensvermittlung haben wir ein neues Konzept entwickelt: Die «Coffee Break Sessions» sind kompakte Online Webinare von 30 bis 45 Minuten, in denen Mitglieder ihr Fachwissen weitergeben. Die offizielle Einführung ist für 2025 geplant.
Ausblick auf 2025
Das Jahr 2025 wird ein Jahr der Neuausrichtung und Weiterentwicklung für den SwissCCS. Mit der erstmaligen Integration unserer Fachtagung in die Ilmac und der Fortsetzung der Gespräche mit dem SWKI stehen bedeutende Veränderungen an. Unser Fokus liegt darauf, die Sichtbarkeit und den Einfluss des SwissCCS weiter auszubauen und den Mitgliedern innovative Formate zur Wissensvermittlung zu bieten. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unseren Verband. Gemeinsam gestalten wir eine starke Zukunft für den SwissCCS. Ich freue mich darauf, Sie 2025 bei unseren Veranstaltungen persönlich begrüssen zu dürfen.
Herzliche Grüsse

Roman Schläpfer Präsident SwissCCS

Chères et chers membres de la SwissCCS, En tant que président de la SwissCCS, je suis ravi de pouvoir vous présenter le rapport annuel pour l’année 2024. Ce rapport fournit un aperçu de nos activités, des jalons atteints et des défis que nous avons relevés ensemble au cours de l’année écoulée. Grâce à l’engagement de nos membres, au travail assidu de notre comité directeur et au soutien de notre secrétariat général, nous avons accompli d’importants progrès.
Rétrospective de l’année 2024
L’année écoulée était marquée par de nombreux changements qui ont influé durablement sur notre association. En particulier, l’accent a été mis sur la collaboration avec la SICC ainsi que la future coopération avec l’Ilmac.
Assemblée générale
L’assemblée générale a pour la première fois eu lieu en même temps que celle de la SICC. Les membres se sont majoritairement prononcés pour la signature de la déclaration d’intention avec la SICC et le renforcement de la collaboration. De plus, Michael Meier, Directeur de la SVGW, a été nouvellement élu au comité directeur. Notre réviseur de longue date, Riccardo Schena, a été remercié pour son travail; sa succession est assurée par Angel Gomez de la société Admeco.
Congrès
Le dernier congrès sous la forme actuelle a eu lieu le 22 mai à l’Hôtel Mercure Krone à Lenzburg sur le thème «Influences géopolitiques». Malgré l’écho positif de l’année précédente, le nombre de participants

Roman Schläpfer, Président de la SwissCCS: «Avec la première intégration de notre congrès à l’Ilmac et la poursuite des discussions avec la SICC, d’importants changements sont à prévoir..» (Photo: SwissCCS)
n’a pas pu être augmenté; environ 50 personnes ont participé à l’événement. La journée s’est terminée par un tour guidé exclusif de la société Hitachi Ltd. à Lenzburg ainsi que par un apéro riche en commun. L’événement n’ayant pas été optimal sur le plan financier, le comité a élaboré de nouveaux concepts pour l’organisation future du congrès.
Coopération avec l’Ilmac
En automne 2024, la coopération entre l’Ilmac et la SwissCCS a été officiellement confirmée. Dorénavant, le congrès sera organisé dans le cadre de l’Ilmac. Le 17 septembre 2025 sera mis à notre disposition le Speaker’s Corner pour présenter à un plus large public des articles spécialisés sur la technologie en salle blanche. Cette réorientation ne devra pas seulement permettre de réduire les coûts mais aussi d’augmenter considérablement la visibilité de la SwissCCS et de ses thèmes.
Coopération avec la SICC
Après la décision positive de l’assemblée générale, les comités directeurs de la SwissCCS et de la SICC ont intensifié les discussions. L’objectif à long terme est une intégration dans les cinq prochaines années. Pour ce faire, des ajustements des deux côtés sont nécessaires pour ancrer durablement les intérêts de la SwissCCS dans un contexte international.
Coopération dans des comités de normalisation
La présence active au sein d’organismes internationaux de normalisation tels que l’ISO, le CEN et le VDI reste un pilier de notre travail. En 2024 également, nos membres se sont engagés au nom de la SwissCCS, tant au niveau national qu’international, afin de défendre les intérêts de la Suisse dans le domaine des salles blanches et des salles de contrôle.
Programme de formation
Le comité s’est réorganisé en 2024 pour promouvoir l’offre de formation de manière ciblée. La conception de nouveaux matériels de formation demande d’importantes ressources, mais nous sommes confiants de pouvoir prochainement communiquer des résultats concrets et des dates.
Présence médiatique et LinkedIn
Un point particulier fort était la présence renforcée de la SwissCCS sur LinkedIn, notamment par la présentation de nos membres. Avec près de 60’000 impressions, nous avons pu augmenter notre

La présence active au sein d’organismes in ternationaux de normalisation tels que l’ISO, le CEN et le VDI reste un pilier du travail de la SwissCCS. (Photo: Adpic)
portée de manière significative et élargir le réseau de l’association.
Lancement des «Coffee Break Sessions»
Pour le transfert des connaissances, nous avons élaboré un nouveau concept: Les «Coffee Break Sessions» sont de brefs webinaires en ligne allant de 30 à 45 minutes, au cours desquels les membres partagent leur expertise. Le lancement officiel est prévu pour 2025.
Perspectives pour 2025
L’année 2025 sera une année de réorientation et de développement continu pour la SwissCCS. Avec la première intégration de notre congrès à l’Ilmac et la poursuite des discussions avec la SICC, d’importants changements sont à prévoir. Nous visons principalement à renforcer la visibilité et l’influence de la SwissCCS et à offrir à nos membres des formats innovants pour le transfert des connaissances. Je vous remercie toutes et tous de votre engagement, de votre soutien et de votre confiance en notre association. Conjointement, nous concevrons un avenir fort pour la SwissCCS. J’anticipe le plaisir de vous accueillir personnellement lors de nos événements en 2025.
Avec mes cordiales salutations,

Roman Schläpfer Président de la SwissCCS
Die neue Kooperation zwischen der SwissCCS und dem Branchenevent Ilmac in Basel weist in die Zukunft und bedeutet für die Verbandsmitglieder unmittelbar handfeste Vorteile.
Die Reinraumtechnik entwickelt sich stetig weiter, getrieben durch neue regulatorische Anforderungen, technologische Fortschritte und steigende Qualitätsansprüche. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, ist die SwissCCS in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Programm auf der Ilmac 2025 vertreten. Dank der strategischen Kooperation zwischen der SwissCCS und der Ilmac wird die Reinraumtechnik auf der Messe noch stärker in den Fokus gerückt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, relevante Fachthemen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die neuesten Entwicklungen gezielt zu präsentieren.
Future Trends der Reinraumtechnik –Fachvorträge im Speakers’ Corner Am Mittwoch, 17. September 2025, ab 14.30 Uhr gestaltet die SwissCCS ein exklusives Vortragsprogramm im Speakers’ Corner. Diese Veranstaltung ist ein direktes Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit der Ilmac.
Die Vorträge bieten tiefe Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen der Reinraumtechnik. Renommierte Experten aus Industrie und Wissenschaft werden unter anderem folgende Themen beleuchten:
– neue Herausforderungen in der Reinraumplanung und -validierung – Automatisierung und Digitalisierung im Reinraumumfeld – regulatorische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Betrieb – Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der Reinraumtechnik
Austausch und Networking –Einladung zum Apéro Riche Durch die Zusammenarbeit mit der Ilmac wird diese Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform für Fachleute aus der Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Mikroelektronikbranche, die sich über zukünftige Trends informieren und praxisnahe Einblicke erhalten möchten.


Am Mittwoch, 17. Se ptember 2025, ab 14.30 Uhr gestaltet die SwissCCS ein exklusives Vortragsprogramm und lädt im Anschluss ihre Mitglieder zu einem Apéro Riche ein. (Bild: Jegge)
Im Anschluss an das Vortragsprogramm lädt die SwissCCS ihre Mitglieder zu einem Apéro Riche ein. Dieses NetworkingEvent bietet die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen und Referenten in entspannter Atmosphäre auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Kostenlose Tickets für SwissCCS-Mitglieder Mitglieder der SwissCCS haben die Möglichkeit, über die Gesellschaft kostenlose Tickets für die Ilmac zu beziehen. Details zur Ticketvergabe werden in Kürze kommuniziert.
Die enge Kooperation zwischen der SwissCCS und der Ilmac zeigt, wie wichtig die Reinraumtechnik für die Zukunft der Branche ist. Durch Ihre Teilnahme an der Ilmac 2025 leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Sichtbarkeit und Weiterentwicklung dieses Fachgebiets. Dies bietet die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und mit führenden Experten der Branche in den Austausch zu treten.
SwissCCS CH-3001 Bern info@swissccs.org http://www.swissccs.org
Die erste Coffee Break Session findet mit dem Thema «Wasser ist wie Luft, nur dichter» am Dienstag, den 20. Mai 2025, 12.00 Uhr statt.
Die Reinraumvereinigung SwissCCS lanciert mit den «Coffee Break Sessions» ein neues Format. Das Programm bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Ihre Expertise in ihrem speziellen Reinraum-Fachgebiet zu präsentieren und so zur Vernetzung und zum Wissensaustausch in der Branche beizutragen.
Es handelt sich bei den Coffee Break Sessions um 30 Minuten kurze, prägnante Online-Veranstaltungen. Die Moderation übernimmt der Verband. Die Veranstaltungen finden stets über die Mittagszeit statt. So erhalten maximal viele Mitglieder der SwissCCS die Chance zur Teilnahme; auch Externe sind herzlich eingeladen.

Prägnant, kurz und online: Beim Format «Coffee Break Sessions» setzt die Reinraumvereinigung SwissCCS auf das bekannte Sprichwort «In der Kürze liegt die Würze» – Kontakt: info@swissccs.org. (Bild: Adpic)
Die Online-Veranstaltungen bieten eine Bühne zur Vorstellung der eigenen Expertise und der eigenen Leistungen bzw. von Expertise und Leistungen des Unternehmens. Angedacht sind zunächst sechs Sessions pro Jahr. Bei grosser Nachfrage und positiver Resonanz wird der SwissCCS das Angebot erweitern.
In der ersten Coffee Break Session am 20. Mai wird Referentin Lisa Günther von der ewah AG eine Einführung in die Trinkwassermikrobiologie geben und anschliessend Fallbeispiele aus der Praxis zeigen – von der Planung bis zum Betrieb. Moderiert wird die Session durch den Präsidenten der SwissCCS, Roman Schläpfer.
SwissCCS CH-3001 Bern info@swissccs.org http://www.swissccs.org
19. Jahrgang. Erscheint 2× jährlich (und in Ergänzung alle 2 Monate der elektronische ccr-Newsletter). Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGImedia AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Copyright 2025 by SIGImedia AG, CH-5610 Wohlen ISSN 1662-1786
Herausgeber / Verlag
Anzeigenverwaltung
SIGImedia AG
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.ccreport.com
Titelbild/Quelle: Shutterstock/Gorodenkoff
Redaktion
SIGImedia AG
Dr. Christian Ehrensberger
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 52 52 c.ehrensberger@sigimedia.ch
Vorstufe
Triner Media + Print
Schmiedgasse 7
CH-6431 Schwyz
Telefon +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch
Druck
merkur Medien ag
Gaswerkstrasse 56 CH-4900 Langenthal
Telefon +41 62 919 15 15 info@merkurmedien.ch www.merkurmedien.ch
Offizielles Publikationsorgan

Swiss Contamination Control Society
Schweizerische Gesellschaft für Reinraumtechnik
Société Suisse pour la prévention de la contamination www.swissccs.org

























































































































Erleben Sie hautnah die neuesten Trends und Technologien für die GxP-konforme Herstellung flüssiger, halbfester und fester Pharmazeutika – praxisnah, e zient und innovativ.





Nutzen Sie das branchenübergreifende Know-how und Netzwerk für Ihren Geschäftserfolg.
Hier gestalten Branchenprofis gemeinsam die Zukunft.
powtech-technopharm.com