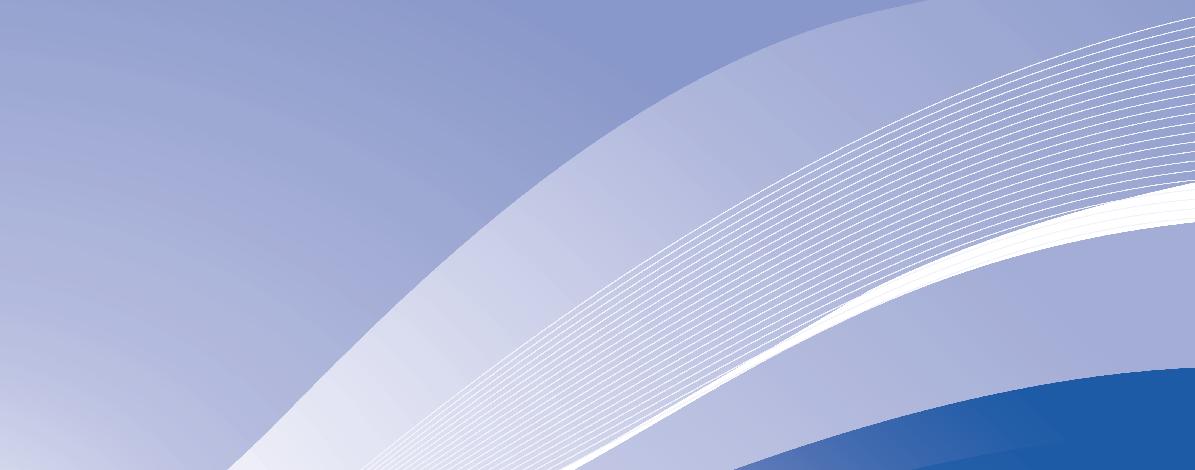



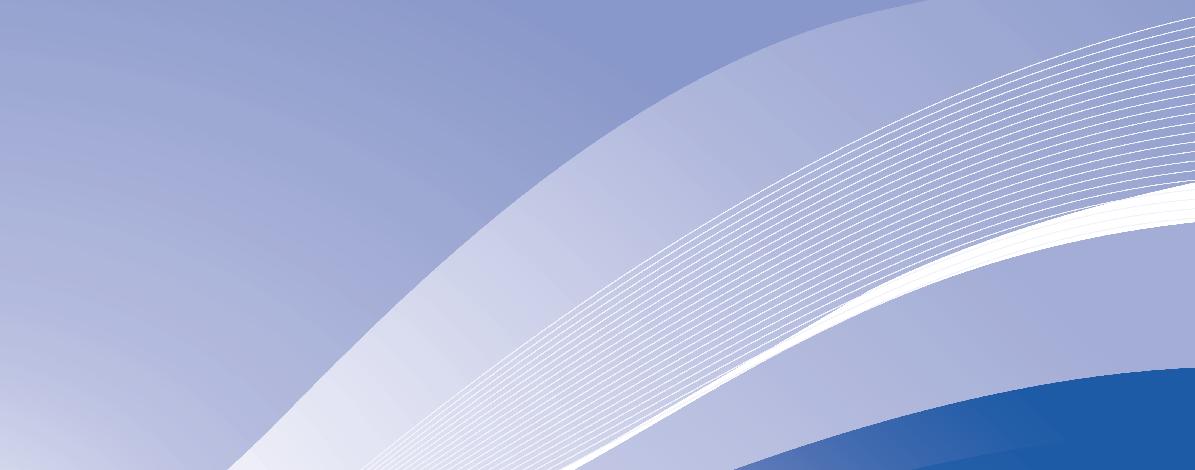


Im Grogg-Shop einfach und bequem Ihren kompletten Laborbedarf bestellen.
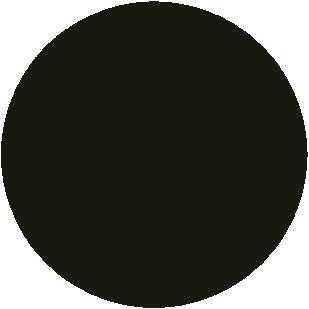
Bei uns finden Sie Verbrauchsmaterialien und Geräte von allen namhaften Hersteller*Innen, Chemikalien und Reagenzien bekannter Marken wie z.B. Avantor, Merck, Sigma-Aldrich sowie individuelle Eigenabfüllungen und Eigenproduktionen. Schauen Sie rein!
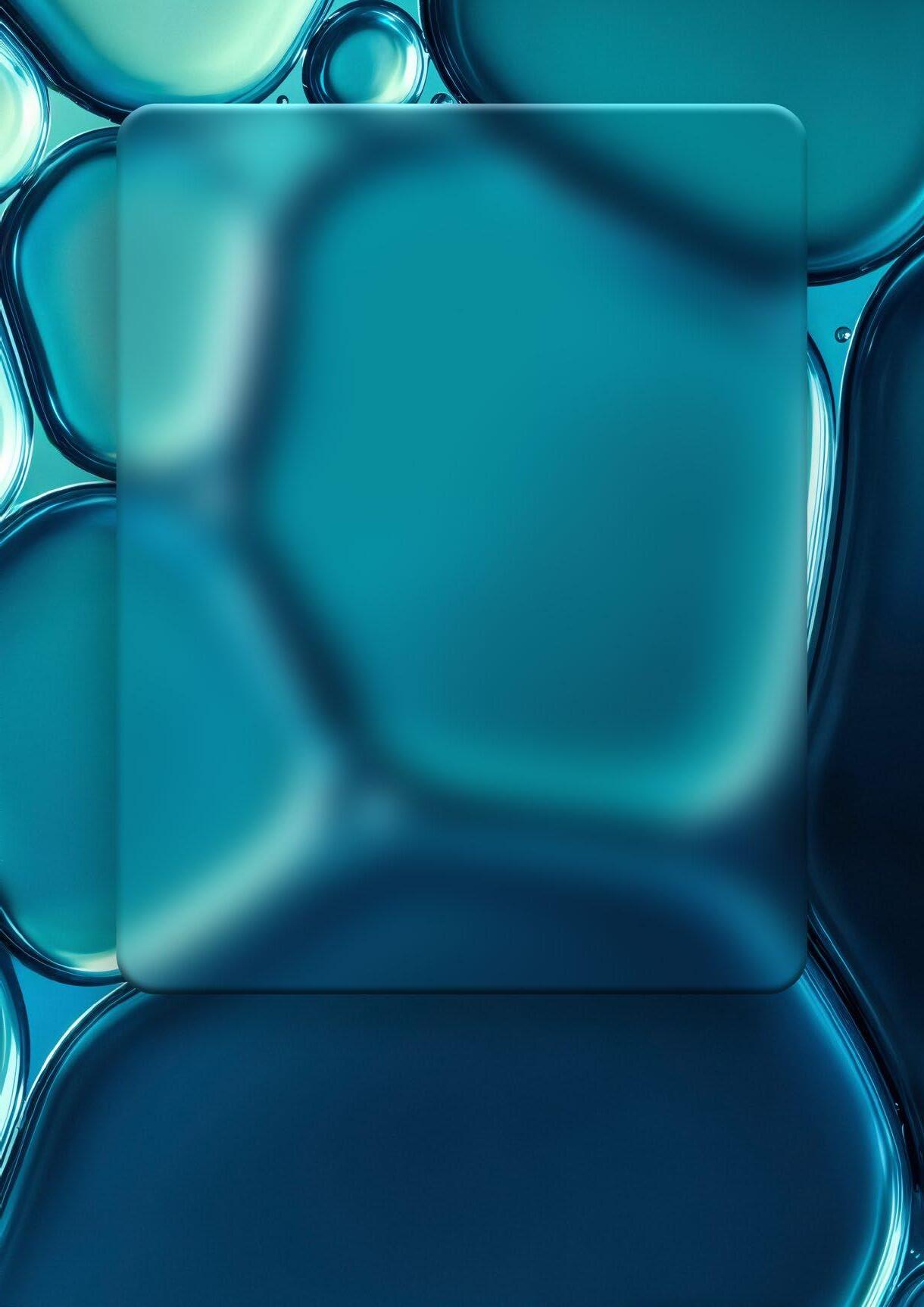
Dr. Grogg Chemie AG Gümligentalstrasse 83 CH-3066 Stettlen-Deisswil +41 31 932 11 66 info@grogg-chemie.ch www.grogg-chemie.ch

Das Museum im Kornhaus in Rorschach wirbt für einen Besuch mit dem Satz: «Entdecke die phänomenalen Reize des Puzzle-Zaubers – eine Extraktion mit positiver Auswirkung auf Stimmung und geistige Fähigkeiten!» Ein Besuch der Messe für Life Science und Chemie «Ilmac Basel» hatte für die Besucher viel mit diesem Zauber zu tun, zumal schon die «Extraktion» auf die Fundamente dieser Fachdisziplinen verweist.
Beispiel «Digitaler Zwilling auf der Ilmac»: In der Theorie lassen sich damit alle Produkte, Maschinen, Prozesse und Anlagen digital entwerfen, simulieren und optimieren. Danach geht es in die Realisierung. Läuft dort ein Prozess erst einmal, so wird er parallel als «Digitaler Zwilling» abgebildet, überwacht und optimiert.
In der Praxis – so war im Speakers Corner der Ilmac zu hören – gibt es den idealen «Digitalen Zwilling» allerdings nicht. Stattdessen Puzzleteile: Building Information Modeling, Common Date Environment, Internet-of-Things-Sensoren, Computer-Aided Facility Management u.v.m. Das Gute daran: Es kommt weniger darauf an, mit welchen Puzzleteilen man anfängt. Und das Beste: Jeder konnte auf der Ilmac damit beginnen –ein intensives Fachgespräch an diesem Messestand, eine Information von jenem. Schliesslich sind genügend Puzzleteile zusammen, der «Digitaler Zwilling» für das eigene Unternehmen steht dem Besucher vor Augen.
Genauso führte diese Vorgehensweise Teilnehmer der Ilmac zum Ziel, die sich primär für andere Zukunftsfelder interessierten (z.B. Digitalisierung, Biotechnologie, Waste-to-Resources, Künstliche Intelligenz, Messen, Steuern, Regeln oder Reinraumtechnologie). Die Leidenschaft fürs «Puzzeln» hat bei allen Messebesuchern Stimmung und geistige Fähigkeiten gestärkt sowie die Life-Science- und Chemieunternehmen in der Schweiz und in der Welt vorangebracht.
Für eine zusätzliche Stärkung ist die hier vorliegende Ausgabe gedacht. Dabei haben wir auf einigen Seiten unsere Aufnahmen zusammengepuzzlet, bis die Teile sich zu einem Abbild der ganzen Ilmac fügten. Diese Bildergalerie zeigt Ihnen zusammen mit unseren in Worte gesetzten Messereportagen, was in den Hallen los war und wo die Reise hingeht.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Christian Ehrensberger c.ehrensberger@sigimedia.ch



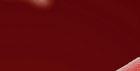







/ Wir liefern den Nachweis.


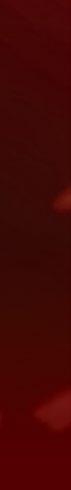

Immunologie by Carl ROTH
Immunologische Nachweismethoden spielen eine zentrale Rolle in der modernen biomedizinischen Forschung und Diagnostik.

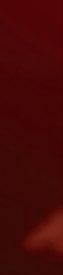

Darum unterstützen wir Sie ab sofort mit über 1000 neuen Produkten im Bereich der Immunologie. In den Produktkategorien der Antikörper, der ELISA Kits und der Peptiden können wir für Sie auch ganz individuelle Anfragen realisieren. Und dies natürlich mit dem gewohnten Service und der Zuverlässigkeit von Carl ROTH
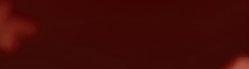


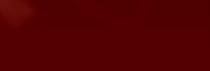
Entdecken Sie jetzt unsere grosse Sortimentserweiterung unter carlroth.com

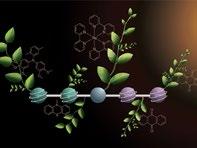

Ein neuartiges Molekül speichert zwei positive und zwei negative Ladungen – eine Steilvorlage für die Entwicklung einer künstlichen Photosynthese und vielleicht noch viel mehr. 04
08

Kleiner Schritt zur künstlichen Photosynthese
16

Unerwartete Nebenwirkungen
Allergiemittel, Antidepressiva oder Hormonpräparate schwächen die natürliche Schutzfunktion des Darms, sodass sich krankmachende Bakterien leichter dort ansiedeln können.
Speicheltypen als möglicher Risikoindikator
Eine Untersuchung zeigt, dass sich das Mikrobiom des oberen Verdauungstrakts über Speichelproben charakterisieren und Menschen verschiedenen Mikrobiomtypen zuordnen lassen.

Nachweis gar nicht so einfach
Forschende haben Methoden aus der Umweltanalytik weiterentwickelt, um sie für die Untersuchung von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten nutzbar zu machen.
IMPRESSUM
Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche www.chemiextra.com
Erscheinungsweise
7 × jährlich
Jahrgang 15. Jahrgang (2025)
Druckauflage 7300 Exemplare
ISSN-Nummer 1664-6770
Verlagsleitung
Thomas Füglistaler

Herausgeber/Verlag
SIGI media AG
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.chemiextra.com
Anzeigenverkauf
SIGI media AG
Jörg Signer
Thomas Füglistaler
Andreas A. Keller
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch
Redaktion
Luca Meister
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 l.meister@sigimedia.ch
Dr. Christian Ehrensberger +41 56 619 52 52 c.ehrensberger@sigimedia.ch

Warum der Schaum so lange hält
Bierschaum: Seine zugrunde liegende Physik kann beim Vergleich der mikroskopisch kleinen Bierfilme, welche die Blasen im Schaum voneinander trennen, sehr unterschiedlich sein.

Ilmac Basel bestätigt allgemeine Event-Trends
Mit der Ilmac hat sich am Rheinknie gezeigt, dass Messen auch im digitalen Zeitalter eine wichtige Business-to-Business-Plattform bieten. Auch bei geänderten Standkonzepten.
Vorstufe
Triner Media + Print
Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch
Abonnemente +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.chemiextra.com
Druck Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch
Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.) Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)
Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGI media AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Copyright 2025 by SIGI media AG, CH-5610 Wohlen


Gehören alte Chemikalien neu bewertet?
Werden die Risiken problematischer Chemikalien angemessen beurteilt? In bestimmten Fällen wohl eher nicht – diesen Schluss zieht eine chinesische Forschungsgruppe.
42

Neues über «Ewigkeitschemikalien»
Von Ersatzstoffen über die Rolle der Bienen bis hin zu kritischen Konzentrationen im Blut gebärfähiger Frauen: Eine Zusammenstellung aktueller Forschungsmeldungen über PFAS.
44

Palmölersatz durch CO 2-Recycling
Endlich gelungen: Aus CO2 kann jetzt ein palmölfreies Fett gewonnen werden. Dadurch soll Palmöl in Kosmetik und vielen anderen Produkten des täglichen Lebens ersetzt werden.
ZUM TITELBILD
Nachhaltige Sensorik für die Zukunft der Chemie
VEGA denkt Nachhaltigkeit ganzheitlich – nicht nur in den Prozessen der Chemie, sondern auch in der eigens dafür entwickelten Messtechnik: Unsere Sensoren sind langlebig und reparierbar, sie halten extremen Bedingungen stand und der Wartungszyklus kann mit dem digitalen Zwilling geplant werden. Unsere Technologie unterstützt die Chemieindustrie dabei, effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher zu produzieren (siehe Fachartikel ab Seite 31)

cGMP-Produktionsanlage für virale Vektoren 46
Stätte erster Chemie-Doktorinnen geehrt
Neuer Vertriebsstandort in Indien
48

VERBANDSSEITEN
SCV-Informationen
PRODUKTE 50
53
LIEFERANTENVERZEICHNIS


VEGA Messtechnik AG
Barzloostrasse 2 CH-8330 Pfäffikon ZH +41 44 952 40 00 info.ch@vega.com www.vega.com

Ein neuartiges Molekül speichert zwei positive und zwei negative Ladungen – das ist eine Steilvorlage der Universität Basel für die Entwicklung einer künstlichen Photosynthese und vielleicht sogar die Rettung des Verbrennungsmotors durch CO2-neutrale Treibstoffe.
Dr. Christian Ehrensberger
Eine Idee für CO2-neutrale Treibstoffe lautet: «Landwirtschaft statt Ölförderung». Statt Erdöl aus unterirdischen Lagern zu holen, soll es doch lieber auf dem Feld wachsen. So wird aus Rapsöl durch Umesterung Rapsölmethylester, und den können wir als Biodiesel verwenden. Aus Zuckerrüben gewinnen wir Zuckersaft und vergären ihn mit Hilfe von Hefen zu Bioethanol. Auch der lässt sich nach Rektifikation und Dehydratation als Treibstoff einsetzen.
Das Beste daran: Was wir im Verkehr durch Treibstoffverbrennung an CO2 ausstossen, verbrauchen die Pflanzen auf dem Feld und spenden uns dafür Sauerstoff. Alles ist in der Balance. Aber es kostet auch viel – vielleicht wären wir weiter, wenn das Öl nicht über viele Jahrzehnte so billig gewesen wäre. Und in der Gesamtumweltbilanz dürfen die energiefressenden Verarbeitungsschritte nicht unter den Tisch fallen, zum Beispiel beim Raps das Mahlen in der Ölmühle.
So mancher Experte ist schon zu dem Schluss gekommen: Ein Biodieselfahrzeug ist in sensiblen Bereichen sinnvoll, etwa in der Näher von Trinkwasserreservoiren, denn da wirkt Rapsöl, anders als Erdöl, nicht als Kontamination. Aber in der Gesamt-Ökobilanz ist es doch nicht CO2-neutral.
Besser als die Natur
Diese Überlegungen haben zu einer neuen Idee geführt: Wir nehmen uns die Natur zum Vorbild und designen danach eine Treibstoffgewinnung mit einem echten CO2-Kreislauf. Wir stossen nur so viel Kohlendioxid aus, wie wieder aufgenommen wird.
Wie sieht unser Vorbild aus? Die Pflanze strebt danach, zu wachsen, und braucht dafür Baustoffe. Dazu setzt sie energiearme Edukte (CO2, H 2O) in energiereiche Produkte um (Zucker), wobei als Nebenprodukt Sauerstoff entsteht. Diese Reaktion benötigt Energie, und die wiederum holt sich die Pflanze aus dem Sonnenlicht.
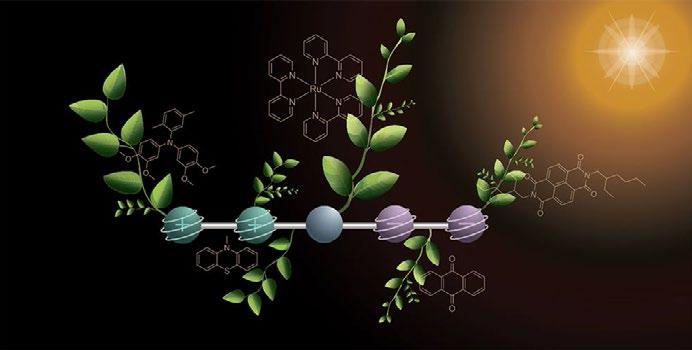
In der Mitte ein metallorganischer Komplex mit sechsfach koordiniertem Ruthenium: Wie bei der natürlichen Fotosynthese speichert das neue Molekül zwischenzeitlich zwei positive und zwei negative Ladungen. (Bild: Deyanira Geisnæs Schaad)

Bei der Reaktion muss die Pflanze ihren wichtigsten Baustoff, den Kohlenstoff, zunächst in eine nutzbare Form bringen –sprich: Sie muss ihn reduzieren. Dafür braucht sie ein Reduktionsmittel. Das ist im einfachsten Falle das Wasser; der enthaltene Sauerstoff wird oxidiert.
In der Natur kann es auch etwas anders laufen: Als Reduktionsmittel stehen alternativ beispielsweise Einsen-II-Ionen oder Schwefelwasserstoff (H2S statt H2O) zur Verfügung. Und es kann auch alles ohne Sauerstoff ablaufen, dann kommt hinten statt Sauerstoffgas zum Beispiel Schwefel heraus. Damit gibt es hier gleich mehrere Stoffwechsel-Designs in der Natur.
reaktion und Dunkelreaktion
Schon die uns geläufigere Photosynthese der Grünpflanzen erweist sich beim genauen Hinsehen als recht komplex. Zum Beispiel wird in einem ersten Schritt («Lichtreaktion») die Lichtenergie der Sonne in chemische Energie umgewandelt –genauer: Das Licht wird genutzt, um Adenosintriphosphat (ATP) zu synthetisieren. Dieses Molekül dient dann sowohl als Energieüberträger als auch als kurzfristiger Energiespeicher.
Bei der Lichtreaktion wird ausserdem NADPH (die reduzierte Form von NADP = Nicotinsäureamid-Adenin-DinukleotidPhosphat) gewonnen. Beide Substanzen, der Energieträger ATP und das Reduktionsmittel NADPH, sind im zweiten Schritt («Dunkelreaktion») am Aufbau der Baustoffe (Zucker) beteiligt.
Lichtreaktion unter der Lupe: Ladungsspeicher sind wichtig Sieht man sich die Lichtreaktion genauer an, so erkennt man: Ganz am Anfang nehmen Farbstoffe, wie etwa der grüne Pflan -
zenfarbstoff Chlorophyll, Licht auf, es werden Elektronen angeregt und können dann an andere Moleküle weitergegeben werden. Unter anderem kommt es darauf an, dass sich dabei Ladungen zwischenspeichern lassen; dann lassen sie sich gut nutzen, um Reaktionen anzutreiben. Ein Forscherteam der Universität Basel hat jetzt ein neues Molekül entwickelt, das unter Lichteinfluss gleichzeitig zwei positive und zwei negative Ladungen speichert. Das Molekül besteht aus fünf Teilen, die in einer Reihe verknüpft sind und jeweils eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Auf der einen Seite des Moleküls sitzen zwei Teile, die Elektronen abgeben und dabei positiv geladen werden. Zwei auf der anderen Seite nehmen die Elektronen auf und werden dadurch negativ geladen. In der Mitte platzierten die Chemiker einen Baustein, der Sonnenlicht einfängt und die Reaktion (die Elektronenübertragung) startet.
Zwei LadungserzeugungsSchritte – schwaches Licht reicht Um die vier Ladungen zu erzeugen, gingen die Forscher schrittweise mit zwei Lichtblitzen vor. Der erste Lichtblitz trifft auf das Molekül und löst eine Reaktion aus, bei der eine positive und eine negative Ladung entstehen. Diese Ladungen wandern jeweils nach aussen an die gegenüberliegenden Enden des Moleküls. Beim zweiten Lichtblitz geschieht die gleiche Reaktion nochmal, so dass das Molekül nun zwei positive und zwei negative Ladungen enthält.
Diese schrittweise Anregung erlaubt es Licht in der Nähe der Stärke von Sonnenlicht zu nutzen. In früheren Forschungsarbeiten war extrem starkes Laserlicht nötig gewesen. Auch bleiben die Ladungen im Molekül lange genug stabil, um sie für weitere chemische Reaktionen zu nutzen.
Prof. Dr. Oliver Wenger und sein Doktorand Mathis Brändlin sehen ihr LadungsspeicherMolekül als wichtigen Zwischenschritt hin zu einer künstlichen Photosynthese . Angesichts der Komplexität der natürlichen Photosynthese fehlt allerdings zu ihrer Imitation noch eine ganze Menge.
«Aber wir haben ein wichtiges Puzzleteil identifiziert und realisiert», sagt Oliver Wenger. Die Erkenntnisse aus der Studie tragen dazu bei, die für die künstliche Fotosynthe -
se zentralen Elektronentransfers besser zu verstehen. Das neuartige Molekül besteht aus fünf kovalent mit einander verbundenen Teilen und weist die Struktur D2–D1–PS–A1–A 2 auf. Dabei ist D2 ein Triarylamin, gefolgt von einem Phenothiazin als D1, in der Mitte als PS ein metallorganischer Komplex mit sechsfach koordiniertem Ruthenium (genauer: [Ru(bipyridyl)3]2+), dann ein Anthrachinon als A1 und schliesslich als A 2 ein Naphthalindiimid [1].
Perspektiven für eine nachhaltige
Das eigentliche (Fern-)Ziel der künstlichen Photosynthese besteht darin, mit Sonnenlicht energiereiche Verbindungen herzustellen: sogenannte Solartreibstoffe wie Wasserstoff, Methanol oder synthetisches Benzin. Werden sie verbrannt, entsteht nur so viel Kohlendioxid, wie zur Produktion der Treibstoffe gebraucht wurde. Sie wären also CO2-neutral.
Mit einer künstlichen Photosynthese im Labor bzw. im industriellen Betrieb wäre auch die lästige Diskussion vom Tisch, warum man Raps und Zuckerrüben, wenn sie schon einmal auf dem Feld gewachsen sind, nicht lieber zu Nahrungsmitteln weiterverarbeitet, statt zu Treibstoffen („TellerTank-Problematik“). Der Verbrennungsmotor erhielte neue Chancen. Und vielleicht lassen sich en passant unsere Wissenslücken über die natürliche Photosynthese schliessen oder exotische Stoffwechselsysteme entwickeln. Denn diese Forschung bewegt sich auch an den Grenzen der Geheimnisse des Lebens.
Zunächst gilt es nun allerdings, über die Ladungsbildung und -speicherung hinaus die gesamte natürliche Lichtreaktion zu imitieren, dann auch die Dunkelreaktion – kurz: die gesamte Photosynthese. Das ruft nach einem stark kooperativen Projekt unter Beteiligung von Universitäten, weiteren Forschungsinstituten sowie ChemieEnergie- und Automobilunternehmen.
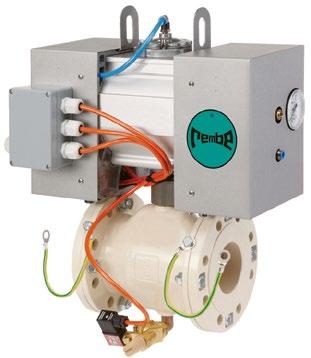
Entkopplung von Explosionen, Funken und Flammenfronten: das EXKOP® System von REMBE® ist eine sichere, kostengünstige und unkomplizierte Entkopplung für staubführende Anlagen.

Explosionsdruckentlastung ohne Flammen- und Staubausbreitung: mit dem REMBE® Q-Rohr® können Apparate und Behälter innerhalb von geschlossenen Räumen druckentlastet werden.
Literatur
1. Brändlin, M., Pfund, B. & Wenger, O.S. Photoinduced double charge accumulation in a molecular compound. Nat. Chem. (2025). https:// doi.org/10.1038/s41557-025-01912-x
8703 Erlenbach Telefon 044 910 50 05 www.paliwoda.ch
Offizieller Partner der

Dank Pionierarbeiten an der Universität Genf eröffnen extrem stabile chirale Moleküle mit einer neuartigen Struktur Pharma-Ingenieurinnen und Werkstoff-Ingenieuren weite Forschungsfelder.
Dr. Christian Ehrensberger
Symmetrien spielen in der Natur eine wichtige Rolle. Zum Beispiel können Moleküle mit einem Asymmetriezentrum in zwei räumlichen Konfigurationen auftreten, die sich zueinander spiegelbildlich verhalten: Sie können, wie unsere rechte und linke Hand, nicht durch Drehung oder andere Verschiebungen im Raum zur Deckung gebracht werden. Daher kommt auch die Bezeichnung «chirales Molekül» –von chiral = händisch. Es gibt eine Rechtsund eine Links-Konfiguration (R und S).
Dieselbe Zusammensetzung –mal Heilmittel, mal Gift Ein trauriges Beispiel für die Auswirkungen in biologischen Systemen stellt der Skandal um das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan: Der enthaltene Wirkstoff Thalidomid besteht aus chiralen Molekülen. Moleküle in der einen Konfiguration weisen den gewünschten sedierenden Effekt auf, ihr Spiegelbild jedoch wirkt fruchtschädigend.
Tragischerweise vertrieb das deutsche Pharmaunternehmen Grünenthal, Stolberg, das Medikament zwischen 1957 und 1961 als Racemat (Gemisch aus beiden Konfigurationen) und noch dazu ursprünglich mit einer Empfehlung für Schwangere. Die Folgen zeigten sich an Missbildungen und fehlenden Gliedmassen bei Neugeborenen.
Prägnant lässt sich sagen: Bei chiralen Molekülen kann das eine Heilung bringen und das andere giftig sein. Bei der Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln ist dies zu berücksichtigen. Da die beiden Konfigurationen eine identische chemische Zusammensetzung und (fast) dieselbe Struktur besitzen (bis auf den kleinen Unterschied in der räumlichen Anordnung der Atome), scheint auf den ersten Blick

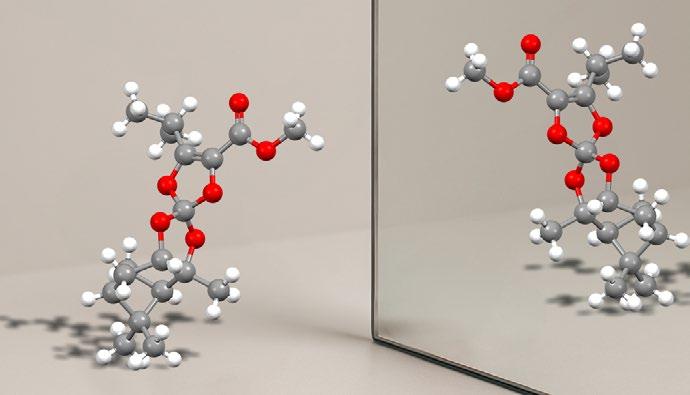
Im Herzen eine neuartige Architektur: Spiegelbildliche Moleküle mit einem Asymmetriezentrum aus einem Kohlenstoffatom (grau), das nur von Sauerstoffatomen (rot) umgeben ist (Wasserstoffatome: weiss); genauer: Es handelt sich um Tetraoxa-Spiro-Verbindungen, bei denen zwei sauerstoffhaltige Ringe über jeweils zwei Sauerstoffatome mit dem zentralen Kohlenstoffatom («Spiro-Atom») verknüpft sind. (Jérôme Lacour et al., 2025; Bild: Pierrick Berruyer)
eine Trennung unmöglich, doch kann sie beispielsweise mit Hilfe chromatographischer Verfahren unter Verwendung von chiralen Säulenmaterialien gelingen. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass sich ein Molekül in der R-Konfiguration in ein Molekül der S-Konfiguration umwandeln kann. In Abhängigkeit von äusseren Parametern, zum Beispiel der Temperatur, kann dies in unterschiedlichen Zeitspannen erfolgen. Das hat Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines entsprechenden Arzneimittels.
Novum: nur Sauerstoff und Stickstoff um chirales
Das Asymmetriezentrum, das für die Chiralität verantwortlich ist, besteht in der Regel aus einem Kohlenstoffatom, das an unterschiedliche Reste gebunden ist, zum Beispiel an ein Wasserstoffatom, an Kohlenwasserstoffketten oder Ketten mit Heteroatomen (Sauerstoff, Stickstoff). Die
Gruppe von Jérôme Lacour, ordentlicher Professor am Departement für organische Chemie der Abteilung für Chemie und Biochemie der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf, hat nun einen neuen Typ von Asymmetriezentren designt. Dabei ist das zentrale Kohlenstoffatom nur von Sauerstoff- und Stickstoffatomen umgeben. Es handelt sich um Tetraoxa-Sprioverbindungen (vier Sauerstoffatome, Abb. 1) oder um AzatrioxaSprioverbindungen (ein Stickstoffatom und drei Sauerstoffatome).
«Moleküle mit dieser neuen Art von stereogenem Zentrum sind noch nie zuvor in stabiler dreidimensionaler Form isoliert worden. Ihre Synthese und Charakterisierung stellen einen bedeutenden konzeptionellen und experimentellen Fortschritt dar», erklärt Jérôme Lacour (Abb. 2) . Die Molekülstrukturen mit Asymmetriezentren aus einem nur an Sauerstoff- und Stickstoffatome direkt gebundenen Koh -
lenstoffatom weisen eine aussergewöhnliche Stabilität auf. Die Umwandlung von einem Molekül in der R-Konfiguration in sein S-Spiegelbild findet in langen Zeiträumen statt.
Olivier Viudes, Doktorand und Erstautor der Studie, präzisiert: «Mit Hilfe von dynamischen Chromatographietechniken und quantenchemischen Berechnungen konnten wir abschätzen, dass es bei einem der entwickelten Moleküle bei Raumtemperatur 84 000 Jahre dauern würde, bis sich die Hälfte einer Probe in ihr Spiegel-Molekül umgewandelt hat.» Bei einem anderen kam man auf 227 Tage bei 25 ° C. Das bedeutet für die Praxis der Pharmaforschung: Für ein Medikament garantiert eine solche Stabilität eine sichere Lagerung, ohne dass besondere Bedingungen (z. B. Kühlung bei Lagerung und Transport) erforderlich sind.
Die von dem Genfer Team entwickelten neuen stereogenen Zentren dürften das Design von dreidimensionalen, stabilen und kontrollierten chiralen Molekülen ermöglichen. Diese Strukturen eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Medikamenten oder Materialien.
«Unsere stereogenen Zentren eröffnen einen völlig neuen
Grad an Freiheit und Vorstellungskraft in der chemischen Synthese.»
Prof. Gennaro Pescitelli
Universität Pisa
«Es geht um eine neue Art, den molekularen Raum zu organisieren. Unsere stereogenen Zentren eröffnen einen völlig neuen Grad an Freiheit und Vorstellungskraft in der chemischen Synthese», betont Gennaro Pescitelli, Professor an der Universität Pisa und Hauptmitwirkender an diesem Artikel .
Vorgezeichnetes Vorgehen –Ansatzpunkte für die Forschung
Die Aufgabe für Pharma-Forschergruppen liegt damit auf der Hand: Da die Natur in vielfacher Hinsicht chiral organisiert ist (z. B. Aminosäuren, Zucker, DNA), kom -
men chirale Moleküle als Wirkstoffe grundsätzlich an vielen Stellen in Betracht. Das trifft insbesondere auf die neuartigen Kompositionen mit dem Asymmetriezentrum aus einem Kohlenstoff, umgeben von Sauerstoff und Stickstoff (sonst nichts!) als unmittelbare Bindungspartner, zu. Ist erst einmal ein solcher Wirkstoffkandidat identifiziert, bringt er automatisch einen grossen Vorteil mit: Um die Lagerfähigkeit braucht man sich wohl nicht zu sorgen, liegt die «Halbwertszeit» doch im Bereich einer dreistelligen Anzahl von Tagen oder einer fünfstelligen Anzahl von Jahren. Ähnlich verhält es sich in der Materialforschung: Ein Material mit genialen neuen Eigenschaften und mit dem besagten neuartigen Asymmetriezentrum brächte quasi von Natur aus eine hohe Langzeitstabilität mit. Zu den lohnenswerten Forschungsfeldern sollten ganz allgemein Werkstoffe mit richtungsabhängigen Eigenschaften gehören, wie zum Beispiel Flüssigkristalle, oder stationäre Phasen für die Chromatographie (stereoselektive Trennungen, s. o.).
Auch prädestinieren ihre lichtoptischen Eigenschaften (Drehung der Ebene polarisierten Lichts) langzeitstabile chirale Verbindungen für eine Reihe von Spezialaufgaben. Zu ihnen könnten der Einsatz in extrem scharf sichtbaren Displays oder, umgekehrt, in besonders schlecht identifizierbaren Tarnmaterialien, in Sensoren zur Bestimmung chemischer und biologischer Kampfstoffe oder bei der Verschlüsselung von Daten zählen.
Zugegeben: Das ist zurzeit zum grossen Teil noch etwas spekulativ. Wo aber heute Universitäten, andere Forschungsinstitute und Unternehmen auf den Zug der neuartigen Chiralität aufspringen, könnten morgen ungeahnte Früchte zu ernten sein.
Literatur
1. Une nouvelle architecture au coeur des molécules. Pressemitteilung der Universität Genf vom 15. Juli 2025. https://www.unige.ch/medias/2025/cdp-lacour
2. Olivier Viudes, Céline Besnard, Alexander F. Siegle, Oliver Trapp, Thomas Bürgi, Gennaro Pescitelli, Jérôme Lacour: All-Heteroatom-Substituted Carbon Spiro Stereocenters: Synthesis, Resolution, Enantiomeric Stability, and Absolute Configuration. J Am Chem Soc 2025; 147(24): 21121–21130. doi: 10.1021/jacs.5c06394














››› Gefahrsto e – e zient, flexibel und nachhaltig lagern




››› Lithium-Ionen-Akkus – sicher aufbewahren und laden








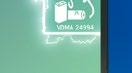




















JETZT ENTDECKEN:



Das gesamte asecos Produktportfolio







Eine einfache Speichelprobe könnte künftig wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung des Magen- und Dünndarm-Mikrobioms liefern – und damit helfen das individuelle Risiko für bestimmte Erkrankungen abzuschätzen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass sich das Mikrobiom des oberen Verdauungstrakts zuverlässig über Speichelproben charakterisieren und Menschen verschiedenen Mikrobiomtypen zuordnen lassen.
Das orale Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien im Mundraum, spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit eines Menschen: Es beeinflusst das Risiko und den Verlauf zahlreicher Erkrankungen von der Mundhöhle bis zur Speiseröhre und dem Magen sowie von Entzündungen im Darm und Infektionen der Atemwege und des Herzens (Endokarditis). Es kann als Reservoir für Erreger dienen, die für gesunde Menschen harmlos sind, aber bei Personen mit geschwächtem Immunsystem schwere Krankheiten auslösen können.
«Das Mikrobiom von Magen und Dünndarm ist jedoch noch verhältnismässig unerforscht», sagt W. Florian Fricke, Professor im Fachgebiet Mikrobiom und Angewandte Bioinformatik der Universität Hohenheim (D). «Um Proben aus Magen und Dünndarm zu nehmen, müssen sich Patientinnen oder Studienteilnehmer einer aufwändigen und unangenehmen Magenspiegelung unterziehen. Viel einfacher und unkomplizierter lassen sich Speichelproben aus dem Mund gewinnen», erklärt der Experte.
Verbindung zwischen Mundund Dünndarmmikrobiom
In einer Studie mit 20 Personen, die sich wegen leichter nahrungsmittelbedingter Magen-Darm-Beschwerden einer Magenspiegelung unterziehen mussten, konnten die Forschenden zwei stabile Mikrobiomtypen in Speichel, Magen und Dünndarm identifizieren. Diese bakteriellen Gemeinschaften waren bei den betreffenden Personen vom Mundraum bis in den Magen und Dünndarm konstant und wurden von jeweils einer Bakteriengattung dominiert. Bestätigen konnten die Forschenden diese Ergebnisse an einem öffentlich zugängli -


chen Datensatz von 254 Menschen, die an der «Reimagine»-Studie teilnahmen. Dabei handelt es sich um eine gross angelegte Forschungsinitiative des Cedars-Sinai Medical Center in den USA, die sich mit der Zusammensetzung und Funktion des Dünndarm-Mikrobioms bei Gesundheit und Krankheit des Menschen beschäftigt. Besonders interessant ist der SpeichelMikrobiomtyp, in dem die Bakteriengattung Prevotella-7 vorherrscht. Teilnehmende beider Studien mit diesem Profil wiesen geringere Mengen potenziell krankmachender Bakterien auf, darunter Arten, die mit Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) oder Darmkrebs in Verbindung stehen.
Ausserdem hatten sie niedrigere Werte des Entzündungsmarkers TNF- α im Blut. Da dieses Protein als Zytokin bei vielen chronisch-entzündlichen und Autoimmu -
nerkrankungen eine wichtige Rolle spielt, könnte das auf ein insgesamt geringeres Risiko für Entzündungen und Infektionen bei Menschen mit diesem Mikrobiomtyp hinweisen.
Die Ergebnisse basieren auf einem neu entwickelten Verfahren, mit dem sich auch aus den vergleichsweise bakterienarmen Proben aus Speichel, Magen und Zwölffingerdarm verlässliche Aussagen über das Mikrobiom ableiten lassen. «Aufgrund der geringen Bakterienzahl kann schon ein geringer Eintrag von Bakterien, die nahezu überall in der Umwelt und im Labor vorkommen, bei der Aufarbeitung der Proben zu Verunreinigungen führen, die die Ergebnisse stark verfälschen», erklärt Doktorandin Nina Schmidt die Problematik. Um die
Einsatz von Tieren im Projekt Für die Entwicklung der Mikrobiomanalyse-Methodik wurden Proben aus dem MagenDarm-Trakt von insgesamt 19 Mäusen verwendet. Dabei handelt es sich um Tiere, die bereits für ein anderes Forschungsprojekt getötet worden waren, so dass für dieses Projekt keine zusätzlichen Tiere eingesetzt werden mussten. Weitere Infos zum Thema unter www.uni-hohenheim.de/tierversuche
Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, schloss die Forschungsgruppe deshalb mögliche Verunreinigungen durch strenge Kontrollen in allen Arbeitsschritten aus.
Grundlage für ihre Analysen ist das Erbgut der Bakterien. «Wir nutzten eine Kombination aus DNA und RNA, die sich in den Proteinfabriken der Zelle, den Ribosomen, befindet. RNA kann nur aus aktiven, lebensfähigen Mikroben isoliert werden», beschreibt die Wissenschaftlerin das Vorgehen. «So können wir zum Beispiel aktive
Bakterienarten im Dünndarm von toten, verschluckten und inaktiven Bakterien aus dem Mund oder der Nahrung unterscheiden und die Zusammensetzung der relevanten bakteriellen Gemeinschaften in Magen und Dünndarm besser beschreiben.»
Einfaches Instrument zur individuellen Risikoprognose
«Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Speichelproben künftig in nicht-invasiven und regelmäßig wiederholbaren dia -
gnostischen Tests eingesetzt werden könnten, um das individuelle Risiko für bestimmte entzündliche und infektiöse Erkrankungen abzuschätzen», fasst Professor Fricke die Erkenntnisse zusammen.
Eine solche Diagnostik könnte in der klinischen Praxis helfen, Risikogruppen frühzeitig zu identifizieren und gezielte Präventionsmassnahmen, zum Beispiel prophylaktische Antibiotikabehandlungen, einzuleiten. Angesichts der leichten Handhabung und geringen Belastung für die Patientinnen und Patienten könnten sich damit neue Wege für Speicheltestbasierte personalisierte Mikrobiom-Untersuchungen zur Prävention, Früherkennung und Beobachtung von Erkrankungen eröffnen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Gut Microbes publiziert.
www.uni-hohenheim.de


Wenn es auf die Technik ankommt –zählt nur der Mensch.
Komplettlösungen aus einer Hand. Mess- und Reinraumtechnik müssen immer zuverlässig arbeiten, wenn es um Sicherheit und Gesundheit geht. Weiss Klimatechnik bietet nicht nur höchste Produktqualität als Gerätehersteller, sondern auch zuverlässigen, persönlichen Service von der Planung über die Inbetriebnahme bis zur Qualitätssicherung. Das schätzen unsere Kunden, denn so wird moderne Mess- und Reinraumtechnik nachhaltig zeit- und kostene zient.
info.ch@weiss-technik.com
Weiss Technik AG · Clean Room · www.weiss-technik.ch


Ob und wie sich verschiedene Diäten auf das Immunsystem auswirken, wird jetzt auch klinisch untersucht. (Bild: Shutterstock)
Mikrobiomforschung und mukosale Immunologie
Die Zusammensetzung unserer Nahrung in der frühen Lebensphase kann das Immunsystem stärken. Forschende haben am Mausmodell gezeigt, dass bestimmte Nahrungsbestandteile die Produktion und Vielfalt der Antikörper im Darm erhöhen, und zwar unabhängig von der bestehenden Darmflora.
In unserer Darmflora befinden sich Billionen von Bakterien. Diese sind nicht nur für unsere Verdauung, sondern auch für ein gesundes Immunsystem unerlässlich. Die Erkenntnis, dass sich unsere Ernährung auf unser Immunsystem auswirkt, gewinnt sowohl in der Forschung als auch im öffentlichen Bewusstsein zunehmend an Bedeutung. Bereits 2020 konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die Mikroorganismen im Darm, die Darmmikrobiota, das Antikörperrepertoire im gesamten Körper beeinflussen kann.
Lipopolysaccharide (LPS) im Fokus
Insbesondere Antikörper des Typs Immunglobulin A (IgA) sind für die Immunität der Darmschleimhaut entscheidend und spielen eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern, indem sie deren Eindringen und Vermehrung im Darm verhindern. Lipopolysaccharide (LPS) sind Be -

standteile der bakteriellen Zellwand. Diese werden natürlicherweise von lebenden Darmbakterien gebildet, können aber auch in unserer Nahrung vorkommen, insbesondere in fermentierten und wenig prozessierten Lebensmitteln wie Joghurt, Obst und Gemüse. Welchen Einfluss diese LPSMoleküle auf die Immunantwort im Darm haben, wurde in der vorliegenden Studie im Detail untersucht.
Forschende der Universität Bern, des Inselspitals, Universitätsspital Bern und der Charité (Universitätsmedizin Berlin) haben herausgefunden, dass LPS-reiche, ausgewogene Diäten die Vielfalt des Antikörperrepertoires im Darm der Maus erhöhen, insbesondere in der frühen Lebensphase. Die Ergebnisse, die kürzlich in der Fachzeitschrift Cell Press Immunity veröffentlicht wurden, bieten neue Einblicke in die komplexen Mechanismen, durch die sich die Ernährung auf das Immunsystem auswirkt.
Um die Auswirkungen verschiedener Diäten auf das Immunsystem zu untersuchen, nutzten die Forschenden einerseits keimfreie Mäuse, das heisst Mäuse, die komplett ohne Mikroorganismen, einschliesslich Darmbakterien, aufwachsen, und andererseits Mäuse, deren Darm mit Bakterien kolonisiert waren. «Die Clean Mouse Facility an der Universität und dem Inselspital gehört zu den grössten gnotobiotischen Tierhaltungsanlagen Europas und war entscheidend für die Durchführung der Studie», erklärt Stephanie Ganal-Vonarburg, Co-Letztautorin.
Die Mäuse erhielten entweder eine LPSreiche, ausgewogene Standarddiät oder eine LPS-arme, fett- und kohlenhydratreiche Diät. Letztere ähnelt einer typischen westlichen Ernährung mit hohem Fett- und Kohlenhydratanteil und wenig Ballaststoffen oder pflanzlichen Bestandteilen. «Durch den Einsatz von keimfreien Mäusen konn -
ten wir die direkte Wirkung der Ernährung und Nahrungsbestandteile auf das Immunsystem isoliert beobachten und so die Rolle von LPS in der Immunmodulation klarer definieren», sagt Prof. Dr. Francesca Ronchi, eine der Erstautorinnen der Studie, welche die Arbeit an der Universität Bern als Postdoktorandin begonnen hat und jetzt am Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie an der Charité arbeitet. «Um die Immunantwort im Detail zu analysieren, untersuchten wir die IgA-Produktion in darmassoziierten Lymphknoten und den Antikörperspiegel. Das Antikörperrepertoire wurde mittels modernen Sequenziertechniken charakterisiert», so Ronchi.
LPS-reiche Ernährung stärkt Darmimmunität
Die Studie zeigt, dass eine LPS-reiche, ausgewogene Ernährung die Produktion und Diversifizierung von Antikörpern des Typs Immunglobulin A (IgA) im Darm anregen, was für die Abwehr von Krankheitserregern entscheidend ist. «Wenig ausgewogene und wenig vielfältige Diäten enthalten geringere Mengen solcher bakteriellen Moleküle wie LPS und stimulieren das mukosale Immunsystem entsprechend schwächer» sagt Ganal-Vonarburg. Besonders in der frühen Lebensphase ist der Einfluss der Ernährung entscheidend, da er zu einer langfristigen Förderung der Antikörperdiversität im Darm führt. Zu ihrer Überraschung konnte das Team von Forschenden den nahrungsbedingten Effekt sowohl bei keimfreien als auch bei mit kolonisierten Mäusen beobachten. GanalVonarburg hält fest: «Mit anderen Worten: Ernährung im frühen Leben prägt die Darmimmunität, selbst in Abwesenheit von Darmbakterien.» Die Studienergebnisse weisen zudem darauf hin, dass LPS, je nachdem, ob es aus der Nahrung stammt oder von lebenden Darmbakterien gebildet wird, unterschiedliche immunologische Effekte haben kann. Diese Unterscheidung war bisher unzureichend beschrieben.
Die Forschungsarbeiten stärken die Position der Universität Bern als international anerkanntes Zentrum für Mikrobiomforschung und mukosale Immunologie. «Die Erkenntnisse erweitern unser Verständnis darüber,
wie Ernährung und mikrobielle Signale das Immunsystem formen, insbesondere im frühen Leben. Sie zeigen, dass nicht nur die Zusammensetzung der Mikrobiota, sondern auch die Art der aufgenommenen Nahrung langfristig beeinflussen kann, wie der Körper auf Krankheitserreger oder Impfstoffe reagiert», sagt Prof. Dr. Andrew Macpherson, Co-Letztautor der Studie und emeritierter Professor für Gastroenterologie. GanalVonarburg ergänzt: «Wir untersuchen der-

zeit, welche weiteren diätetischen Komponenten das Immunsystem beeinflussen können. Und natürlich, ob sich diese Effekte auch beim Menschen beobachten lassen». Die Erkenntnisse könnten zur Entwicklung neuer Ernährungsrichtlinien beitragen, die die Immunfunktion optimieren, sowie zur Entwicklung neuer Ansätze für die Prävention und Behandlung von Krankheiten.
www.unibe.ch

YMC – Die Konstante in Ihrer Trennung.
Gleichbleibende Ergebnisse – Tag für Tag. YMC-Triart Säulen liefern reproduzierbare Trennungen mit exzellenter Stabilität, hoher Auflösung und analytischer Genauigkeit.
Sie möchten mehr über uns wissen?
ymc-schweiz.ch

Forschende des Max Rubner-Instituts (D) haben Methoden aus der Umweltanalytik weiterentwickelt, um sie für die Untersuchung von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten nutzbar zu machen. Dabei mussten sie einige methodische Herausforderungen bewältigen.
Wie viel Mikroplastik steckt in Fisch und Meeresfrüchten, die auf unseren Tellern landen? Die Angaben schwanken stark. Das liegt auch daran, dass der Lebensmittelüberwachung standardisierte Analyseverfahren fehlen, um die winzigen Kunststoffpartikel in Fischereierzeugnissen quantitativ nachzuweisen. Dadurch lassen sich die Ergebnisse unterschiedlicher Studien nur schwer bewerten und oft ist unklar, wie zuverlässig vorliegende Daten sind.
Um Plastik im essbaren Gewebe von Fisch und Meeresfrüchten detektieren zu können, müssen organische Verbindungen wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette gründlich entfernt werden. «Das darf die winzigen Kunststoffpartikel nicht beschädigen», sagt Julia Süssmann, Wissenschaftlerin am Max Rubner-Institut und Leiterin des Forschungsprojekts. Süssmann und ihr Team haben eine spezielle Methode erarbeitet, bei der die Proben zunächst enzymatisch und chemisch behandelt werden,
um das Fischgewebe aufzulösen. Die Plastikteilchen werden anschliessend mittels Druckfiltration aus der Flüssigkeit abgetrennt.
Mikroplastik kommt in Fisch und Meeresfrüchten laut bisherigen Daten in geringen Mengen und sehr ungleichmässig verteilt vor. «Darum brauchen wir besonders empfindliche Nachweismethoden», erklärt Süssmann. Mit sogenannten massebasierten Verfahren lässt sich der Gesamtgehalt an Kunststoff in einer Probe bestimmen. Dabei wird beispielsweise die Probe unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Produkte bildet. Anhand deren Signale kann anschliessend berechnet werden, wie viel Plastik in der Probe enthalten war. Mit dieser Methode kann eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), nachgewiesen werden.
Ausserdem entwickelten die Forschenden ein Verfahren, um Kunststoffe selektiv anzufärben. Durch die Zugabe eines Fluoreszenzfarbstoffs, etwa Nilrot, können kleine, farblose Kunststoffpartikel, die mit klassischer Lichtmikroskopie oft nur schwer erkennbar sind, besser sichtbar gemacht werden. Die Fluoreszenz natürlicher Partikel, wie Bruchstücke von Garnelenschalen oder Gräten, wird dabei mit einem zweiten Farbstoff, der nur natürliches Gewebe anfärbt, unterdrückt. Mit einer halbautomatischen Bildanalyse kann Mikroplastik zuverlässig von natürlichen Partikeln unterschieden werden, was es ermöglicht, Menge, Grösse und Form der Kunststoffteilchen zu charakterisieren.
Um die Art des Mikroplastiks zu identifizieren, stellen schwingungsspektroskopische Verfahren gegenwärtig den Standard dar. Dabei wird die Probe mit Infrarotlicht (Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie) oder Laserlicht (Raman) bestrahlt und aus dem Absorptionsverhalten beziehungsweise
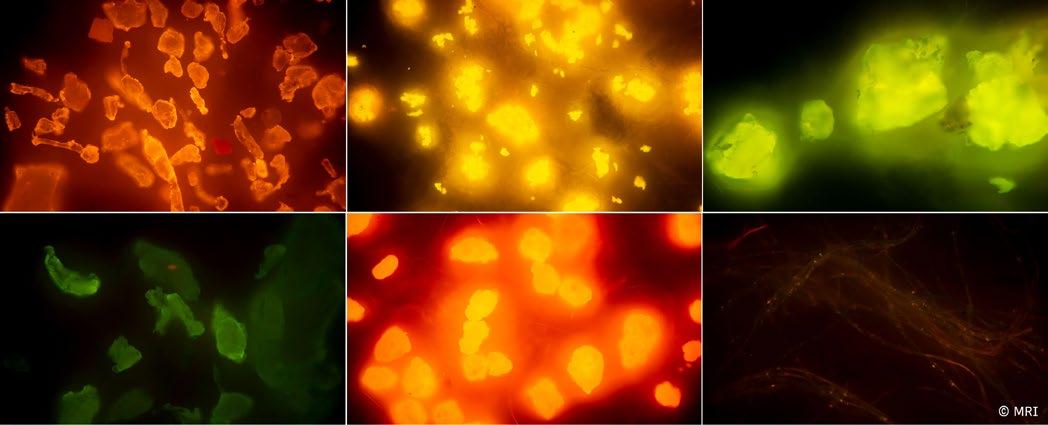

der Streuung am Partikel Rückschluss auf die Art des Kunststoffs gezogen. Beide Methoden können mit der Mikroskopie gekoppelt werden, wodurch sich auch kleinste Plastikpartikel zuverlässig von natürlichen Partikeln unterscheiden lassen. Diese Analytik ist jedoch meist sehr zeitaufwendig und nicht für den Nachweis von Nanoplastik geeignet.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (Py-GC/MS) am besten für die quantitative Analyse von Mikroplastik in Fischereierzeugnissen geeignet ist. Dabei wird die Probe unter Sauerstoffausschluss erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Pyrolyseprodukte bildet. Über die Intensität des Signals dieser Produkte kann anschliessend berechnet werden, wie viel des jeweiligen Kunststoffs in der Probe enthalten war. Die Py-GC/MS konnte im Projekt eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol oder Polypropylen, empfindlich nachweisen (Untergrenze der erfassbaren Menge: 0,4 bis 1,7 Mikrogramm reiner Kunststoff). Zu beachten ist, dass es in Proben mit unbekannter Zusammensetzung zu Unsicherheiten bei den Messungen bezüglich der genauen Menge der Kunststofftypen kommen kann. Bei der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) werden Kunststoffe anhand spezifischer Wechselwirkungen von Atomen mit elektromagnetischer Strahlung identifiziert. Da die Signalintensität von der Menge abhängt, kann auch hier der Kunststoffgehalt berechnet werden. Die NMR war im Projekt für weniger Kunststofftypen geeignet als die Py-GC/MS, konnte deren Menge aber genauer bestimmen. Es zeigte sich, dass dieses Verfahren besser für die gezielte Analyse einzelner Kunststoffe statt einer unbekannten Mischung geeignet ist. Die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC), ein klassisches Verfahren der Polymeranalyse, wurde im Projekt als zu unempfindlich für den Nachweis von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten eingeschätzt. Es waren mindestens 100 Mikrogramm je Kunststofftyp nötig, damit diese detektiert werden konnten. Die DSC wurde deshalb im Methodenvergleich nicht weiter berücksichtigt.
Zum Screening – also zur schnellen Überprüfung, ob überhaupt Plastik in einer Probe enthalten ist – eignet sich das Fluoreszenz-Imaging. Dabei wird die Masse von Partikeln anhand optischer Informationen geschätzt. Weil dabei nur zwischen Plastik und Nichtplastik unterschieden werden kann, ist die Bestimmung der Masse einzelner Kunststofftypen nicht möglich. Im Projekt zeigte sich, dass die Abschätzung der Gesamtmasse an Mikroplastik grundsätzlich zwar möglich war, das Fluoreszenz-Imaging aber im Vergleich zu den anderen Verfahren ungenau ist. Es kann dennoch Hinweise liefern, ob eine Untersuchung mit aufwendigeren Methoden sinnvoll wäre
Nachweis von
Dass Gegenstände aus Plastik überall zu finden sind, erschwerte die Arbeit im Labor. Denn trotz grosser Sorgfalt können durch Messgeräte, Schutzkleidung oder die verwendeten Chemikalien Kunststoffpartikel in die Proben gelangen. «Wir haben deshalb penibel darauf geachtet, nicht selbst Plastik in die Proben einzutragen», sagt Süssmann. Zudem wurden «Blindproben» parallel zu den Lebensmittelproben untersucht, um eine Kontamination abschätzen zu können.
Auch am Nachweis von Nanoplastik – also noch kleineren Teilchen als Mikroplastik –wurde im Projekt gearbeitet. Die Abtrennung solcher Kunststoffpartikel vom Lebensmittel war jedoch sehr schwierig, selbst nach chemischem Aufschluss. Nanoplastik verklumpte und haftete zum Teil an den Poren des eingesetzten Membranfilters. Zudem überlagerten Lebensmittelbestandteile wie Proteine oder Fette die Kunststoff-Signale bei den Analysen. Ein zuverlässiger Nachweis von Nanoplastik in Fisch und Meeresfrüchten ist bisher nicht gelungen.
Das Thema Mikroplastik ist komplex und die Datenlage zu möglichen Auswirkungen noch unzureichend. «Mikroplastik ist kein Problem, das sich nur auf Fisch und Meeresfrüchte beschränkt», sagt Süssmann. «Im Rahmen unserer Forschung haben wir auch in Milch, Fleisch, Eiern und Honig Hinweise auf Plastikpartikel gefunden.»
Nach derzeitigem Wissensstand ist es laut Bundesinstitut für Risikobewertung un -
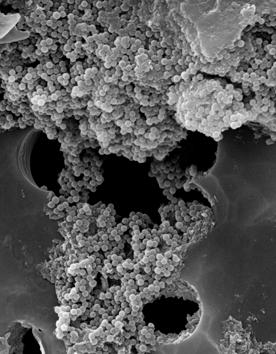
Polystyrol-Nanopartikel in einer Fischprobe – Aufnahme mit Rasterelektronenmikroskop, im Hintergrund ist der Membranfilter zu erkennen.
wahrscheinlich, dass von Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für die Menschen ausgehen. Zur wissenschaftlichen Absicherung ist jedoch noch weitere Forschung, etwa zur Wirkungsweise und zu den Aufnahmepfaden, nötig. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Food Control veröffentlicht.
www.mri.bund.de

LIMS bringen Effizienz und Flexibilität in den Laboralltag. Doch eine solide Planung bei der Implementierung ist notwendig. Der Tiergesundheitsdienst Bayern hat ein LIMS eingeführt – und profitiert jetzt nicht nur im Bereich der Auftragsverwaltung und des Probenmanagements.
Mark Schneider ¹
Der Tiergesundheitsdienst Bayern (TGD) ist eine Selbsthilfeeinrichtung der bayerischen Landwirtschaft mit grosser Verantwortung für alle wichtigen Nutztierarten. Im Mittelpunkt steht die Gesundheit der Tiere und damit auch die Sicherstellung gesundheitlich einwandfreier Nahrungsmittel, die von diesen Tieren stammen. Doch wie erfüllt man diesen Auftrag am besten?
Das Herzstück der gesamten Infrastruktur ist beim TGD Bayern ein Labor-Informations und Management-System, das Dienstleistung, menschliche Skills und Analysedaten in Form eines Auftrages zusammenführt und verwaltet. «Bei der Digitalisierung von Unternehmensprozessen ist es wichtig, dass man sowohl die eigenen Prozesse wie auch die Firmen-Infrastruktur und Bedürfnisse aller Stakeholder kennt», sagt Sabine Otto, IT-Leiterin beim TGD. «Nur dann verschmelzen alle Komponenten zu einer effizienten Arbeitsumgebung.»
Das war vor 10 Jahren keineswegs der Fall. Damals wurden die Aufträge in Papierform verwaltet, man war also weit entfernt von einem holistischen Ansatz. Als der ExcelDschungel und selbstgestrickte Datenbanken dem wachsenden Auftragsvolumen nicht mehr gerecht wurden, engagierte man einen externen Dienstleister. Dieser war aber nicht vom Fach und verstand die Laborumgebung zu wenig – der Tiefpunkt war erreicht. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung machte sich Frau Otto auf die Suche nach einem LIMS und definierte einen Anforderungskatalog. Erfüllen konnte diesen die AAC Infotray AG, die neben «Limsophy
1 AAC Infotray AG


IT-Leiterin
LIMS» auch Fachwissen und Erfahrung in das Projekt einbrachte.
System durch Prozesse geformt
Der Tiergesundheitsdienst bietet ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Diagnostik, Tiergesundheit und Beratung an, wobei sich der Auftrag nicht nur auf die grossen Nutztierarten konzentriert, sondern auch Bienen und Fische umfasst. Landwirte können sich zum Umgang mit Maul-und-Klauenseuche beraten lassen, zum optimalen Ausbau ihrer Ställe, der Belüftung oder zur Ernährung ihrer Tiere. Die Leistungen des TGD stehen den praktizierenden Tierärzten genauso zur Verfügung wie der interessierten Wirtschaft. Zwei weitere wichtige Bereiche sind die praxisorientierten Forschungsaufträge , die vom Bund und dem Freistaat Bayern vergeben werden, oder die Einbindung in landesweite Untersuchungs- und Bekämpfungsprogramme gegen Seuchen. Das Labor des TGD Bayern findet täglich die Balance zwischen diesen verschiedenen Anforderungen: einerseits wenige Proben mit grossem Verwaltungsaufwand,
andererseits Massenproben mit hohem Durchsatz, die gleichzeitig auch zeitkritisch sind. Limsophy LIMS puffert die Heterogenität dieser Aufträge, indem es den Auftrag als zentrales Element erstellt und die Zusatzinformationen zu Landwirt, Proben und Medikamenten mit diesem Auftrag verknüpft. Die gleiche Komplexität herrscht bei den Rechnungen. So hat z. B. jedes Tier eine eigene Verrechnungsklasse, die Stundensätze von Ärzten oder Technikern sind verschieden hoch, viele Landwirte sind Mitglied bei einem Agrarverband, wo sie günstigere Konditionen für Veterinärdienstleistungen erhalten. Die Medikamente und Sachmittel kommen als krönender Abschluss noch hinzu.
«Unsere Fakturierung stellt sehr hohe Anforderungen an das Laborsystem», sagt IT-Leiterin Otto. «Das geht so weit, dass gewisse Aufträge mehrere Rechnungsempfänger haben können: den Landwirt, seinen Verband und vielleicht noch eine Ausgleichskasse. Unser LIMS stellt für diese verschiedenen Leistungsempfänger gesammelte Rechnungen zusammen, sodass nicht jede Rechnung einzeln verschickt werden muss.» Die Komplexität bei diesen Rechnungsvarianten konnte im Vorfeld unmöglich antizipiert werden. Es braucht also eine Software, die sich an diese unerwarteten Situationen anpassen kann. Die Umsetzung von spezifischen Anforderungen wird in solchen Fällen vom Team des TGD Bayern und der Projektleitung der AAC Infotray AG gemeinsam ausgearbeitet, wobei oft Erfahrungswerte aus anderen LIMS-Projekten in die Lösung einfliessen.
«Die Expertise des LIMS-Herstellers im Laborumfeld ist ein wichtiges Kriterium», sagt
Dr. Claudia Nessler, Laborleiterin und LIMSBeauftragte: «Bei AAC Infotray hat uns gefallen, dass die Projektleitung ausschliesslich aus Naturwissenschaftlern besteht, die uns verstehen und auf Augenhöhe begegnen. Beeindruckt waren wir vom ‹Perlenprinzip› der Software, was vereinfacht bedeutet, dass die Daten in verschiedenen Modulen und Darstellungen betrachtet werden können. Dadurch ist eine komplexere Analyse möglich.» Die enge Zusammenarbeit im Team führt fast immer zu den besten Ergebnissen. Daher einigte man sich darauf – auch nach Projektabschluss – wöchentliche Meetings abzuhalten, um die Anwendung weiter zu optimieren. Mittlerweile ist dabei die 156. Version der angepassten Basissoftware entstanden. «Technisch können wir fast alles selbst machen, aber wir brauchen die Meetings, um das System weiterzuentwickeln – und da sind unzählige gute Ideen entstanden», berichtet Sabine Otto. «Als zum Beispiel das Lizenzmodell des ERP-Systems vom Hersteller über Nacht geändert wurde, mussten wir dieses System kurzfristig ersetzen. Bei den wöchentlichen Meetings kam das Problem zur Sprache und als Lösung bot Limsophy ein fertig integrierbares Modul zur Chemikalien- und Referenzsubstanzenverwaltung an, das nach kleinen Anpassungen die Aufgaben des ERP übernehmen konnte.»
Der TGD Bayern unterhält an allen Standorten Apotheken mit Medikamenten, die
aus rechtlichen Gründen streng getrennt sein müssen. An jedem Standort ist ein Arzt verantwortlich für die Medikamentenlogistik. Die Angestellten müssen wissen, wo das jeweilige Medikament liegt, was dank des aufgedruckten Barcodes problemlos möglich ist. Wenn eine Packung die Apotheke verlässt, wird der neue Standort des Medikaments in Limsophy erfasst. Der neue Standort ist in diesem Fall der Kofferraum eines Tierarztes, wo die Medikamente bis zur Abgabe an den Landwirt verbleiben. Falls bei der Behandlung nur ein Teil der Verpackungseinheit verbraucht wird, notiert man auch das in Limsophy und die restlichen Packungen oder Flaschen können bei einem neuen Einsatz weiterverwendet werden. Diese mobilen Apotheken werden bei der halbjährlichen Inventur des TGD Bayern genauso wie die Apotheken an den Standorten mitkontrolliert. Das LIMS ermöglicht jederzeit eine Übersicht über den Bestand. Ein weiterer Vorteil der LIMS-Integration: die Medikamentenlogistik ist automatisch mit dem Rechnungsoder Berichtsmodul verknüpft. So wurde aus der anfänglichen Idee einer einfachen Verwaltung von Substanzen eine komplette digitale Medikamentenverwaltung. Wie in jedem Labor tauchen beim TGD immer wieder neue Situationen auf, bei denen bestehende Prozesse verändert werden müssen. So zum Beispiel die Anpassung eines Importfilters für ein neues Gerät oder eine geänderte Methode. Auch bei der Logistik können plötzlich neue Prozesse hinzukommen: Momentan wird die Probenanlieferung aus den unzähligen

Tiergesundheitsdienst Bayern
Der TGD besitzt 10 Standorte und betreibt mehrere Labore am Hauptstandort Poing. 260 Angestellte, darunter Tierärzte, Beratungs- und Laborpersonal werten im Jahr 3
Millionen Proben aus und untersuchen unzählige Tiere. Ohne unterstützenden IT-Infrastruktur kann ein solcher Betrieb heute nicht aufrechterhalten werden.
Schlachthöfen Bayerns noch in Papierform abgewickelt, aber demnächst soll jedes Paket einen Barcode erhalten und Limsophy die digitalen Sendungsnachweise einschliesslich Zeitstempel an jedem Übergabeort übernehmen. Kann sich das LIMS an solche neuen Herausforderungen anpassen, macht das den Kunden unabhängig und reaktionsfähig. So kann ein Labor flexibel neue Geschäftsmodelle entwickeln.
Die LIMS-Installation und der damit verbundene Aufwand seitens Kundschaft und Projektleitung ist eine Investition in die Zukunft. Ist die Software einmal eingeführt, wird sie zu einem vollwertigen Mitglied der Laborgemeinschaft. «Wir arbeiten sicherer, schneller und transparenter», fasst Sabine Otto zusammen. «Wir sparen auch Kosten, indem wir nur noch mit einer Software arbeiten und die Mitarbeitenden nur noch in einer Software schulen müssen.»
Der TGD Bayern feierte 2024 seinen 75. Geburtstag. Und die IT-Leiterin ist davon überzeugt, dass auf Basis des permanenten LIMS-Ausbaus noch viele erfolgreiche Dekaden vor ihnen liegen: «Bislang wurde noch kein einziger unserer Wünsche nicht erfüllt.» Beispielsweise können über das integrierte Web-Interface die Probenergebnisse und die Antibiotikanutzung an die staatliche HIT-Datenbank übermittelt werden. Dafür wurde ein eigenes HIT-Modul gebaut. Frau Otto sagt abschliessend: «Mit Limsophy können wir uns generell viel besser auf neue Situationen vorbereiten.»
www.infotray.com Eine Art digitale Apotheke: Mithilfe von «Limsophy LIMS» haben die Angestellten jederzeit den Überblick über die Medikamentenvorräte.


Rasterelektronenmikroskopische Darstellung einer Darmbakteriengemeinschaft (1:1 000 000). Durch ihre Interaktionen bilden diese Mikroorganismen ein für die menschliche Gesundheit essentielles Ökosystem. Medikamente können dieses fragile Gleichgewicht empfindlich stören – sie eliminieren nützliche Bakterien und begünstigen damit das Wachstum schädlicher Arten. (Bild: Maier Lab, Strukturmikroskopie Core Facility, Elke Neudert)
Allergiemittel, Antidepressiva, Hormonpräparate und Co.: Viele Nicht-Antibiotika schwächen die natürliche Schutzfunktion des Darms, sodass sich krankmachende Bakterien leichter dort ansiedeln können. Das zeigt eine neue Studie der Universität Tübingen.
Der menschliche Darm beherbergt ein dichtes Netzwerk aus Mikroorganismen, insgesamt als Darmmikrobiom bezeichnet, das unsere Gesundheit aktiv mitgestaltet. Die Mikroorganismen helfen bei der Verdauung, trainieren das Immunsystem –und schützen uns gegen gefährliche Eindringlinge. Dieser Schutz kann nicht nur durch Antibiotika gestört werden, mit denen bei einer Therapie das Wachstum krankheitserregender Bakterien gehemmt werden soll. Eine neue Studie zeigt: Auch viele Medikamente, die eigentlich nur auf den menschlichen Körper wirken sollen, können das Mikrobiom verändern. Dadurch können Krankheitserreger leichter im Darm wachsen und Infektionen verursachen. Die Studie unter der Leitung von Professorin Lisa Maier vom Interfakultären Institut für Mikrobiologie und Infektions -

medizin und dem Exzellenzcluster «Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen» (CMFI) der Universität Tübingen wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.
Die Forschenden untersuchten 53 gängige Nicht-Antibiotika, darunter Allergiemittel, Antidepressiva oder Hormonpräparate. Ihre Wirkung wurde im Labor in synthetischen und echten menschlichen Darmgemeinschaften getestet. Das Ergebnis: Rund ein Drittel dieser Wirkstoffe förderte das Wachstum von Salmonellen, Bakterien, die schwere Durchfallerkrankungen auslösen können. Lisa Maier, die Seniorautorin der Studie, sagt: «Dieses Ausmass war vollkommen unerwartet. Viele dieser nichtantibiotischen Medikamente hemmen nützliche Darmbakterien, während krankmachende Keime wie Salmonella Typhimurium unempfindlich sind. So entsteht im Mikrobiom ein Ungleichgewicht, durch das Krankheitserreger im Vorteil sind.»
Die Forschenden beobachteten einen ähnlichen Effekt bei Mäusen, bei denen bestimmte Medikamente zu einer stärkeren Vermehrung von Salmonellen führten. Die Folge war ein schwerer Verlauf einer Salmonellose, gekennzeichnet durch einen schnellen Krankheitsausbruch und starke Entzündungen. Der Wirkmechanismus sei vielschichtig, berichten Dr. Anne Griesshammer und Dr. Jacobo de la Cuesta, Hauptautoren der Studie und aus der Forschungsgruppe von Lisa Maier. Die Medikamente senkten die Gesamtbiomasse der Darmflora, störten die Artenvielfalt oder beseitigten jene Bakterien, die normalerweise mit den Krankheitserregern um Nährstoffe konkurrieren. Dadurch ver-
schwänden natürliche Konkurrenten krankmachender Keime wie Salmonella, die sich dann ungehindert vermehren können. Die Medikamente senkten die Gesamtbiomasse der Darmflora, störten die Artenvielfalt oder beseitigten jene Bakterien, die normalerweise mit den Krankheitserregern um Nährstoffe konkurrieren.
«Nun haben wir starke Hinweise, dass auch viele andere Medikamente diese natürliche Schutzbarriere unbemerkt schädigen.»
Prof. Dr. Lisa Maier
Seniorautorin der Studie
«Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei der Einnahme von Medikamenten nicht nur die gewünschte therapeutische Wirkung beobachtet werden muss, sondern auch der Einfluss auf das Mikrobiom», sagt Griesshammer. «Die Einnahme von Medikamenten ist häufig unvermeidbar. Aber selbst Wirkstoffe mit vermeintlich wenigen Nebenwirkungen können im Darm sozusagen die mikrobielle Schutzmauer zum Einsturz bringen.» Und Maier ergänzt: «Es ist bekannt, dass Antibiotika die Darmflora stören können. Nun haben wir starke Hinweise, dass auch viele andere Medikamente diese natürliche Schutzbarriere unbemerkt schädigen. Das kann für geschwächte oder ältere Menschen gefährlich werden.»
Forderung nach Neubewertung von Medikamentenwirkungen
Die Forschenden empfehlen, dass die Wirkung von Medikamenten auf das Mikrobiom bei der Entwicklung systematisch mituntersucht werden sollte – insbesondere bei Medikamentenklassen wie Antihistaminika, Antipsychotika oder selektiven Östrogen-Rezeptormodulatoren und bei der Kombination mehrerer Medikamente. Das Team von Lisa Maier hat ein neues Hochdurchsatzverfahren entwickelt, mit dem sich schnell und zuverlässig testen lässt, wie Medikamente die Widerstandsfähigkeit des Mikrobioms unter Standardbedingungen beeinflussen. Dieses grossangelegte Screening soll helfen, Risiken
frühzeitig zu erkennen und Therapien anzupassen. Diese Erkenntnisse erfordern ein Umdenken in der Arzneimittelforschung: Medikamente sollten künftig nicht nur pharmakologisch, sondern auch mikrobiologisch bewertet werden. «Wer das Mikrobiom stört, öffnet Krankheitserregern Tür und Tor – es ist integraler Bestandteil unserer Gesundheit und muss als solches in der Medizin betrachtet werden», betont Maier. Medikamente sollten künftig nicht nur pharmakologisch, sondern auch mikrobiologisch bewertet werden.





Rektorin Prof. Dr. Dr. h.c. (Doshisha) Karla Pollmann unterstreicht: «Die Mikrobiomforschung in Tübingen hat hier einen wichtigen Erkenntnisgewinn vorzuweisen. Wenn bei der Entwicklung von Arzneimitteln die Wirkung auf das Mikrobiom einbezogen wird, besteht die Hoffnung, dass Patientinnen und Patienten langfristig passendere Therapien mit reduzierten Nebenwirkungen erhalten können.»
https://uni-tuebingen.de


















EIN INSTRUMENT. ZWEI FUNKTIONEN.
































Vollautomatisierte Derivatisierung mit patentierter Micro-Droplet Sprühtechnologie und integriertem Plattenheizer








MAXIMAL EFFIZIENT UND FLEXIBEL
Das Module DERIVATIZATION wurde speziell für die vollautomatische Derivatisierung von HPTLC-Platten entwickelt und kombiniert präzises Sprühen von Derivatisierungsreagenzien mit gleichmässigem Erhitzen der Platte – für maximale Effizienz und exakte Ergebnisse.
Flexibel einsetzbar, sowohl stand-alone, als auch nahtlos integriert mit weiteren HPTLC PRO Modulen.



































Höchste Anwendersicherheit durch Automatisierung und Abzugsanbindung
Maximale Homogenität in der Reagenz- und Wärmeverteilung
Optimaler Reinigungsablauf zwischen den Düsenwechseln
Kostengünstig durch geringen Reagenzienverbrauch


wichtig. (Bild: Shutterstock)
Erkenntnisse, die nicht nur Brauereien dienen
Braukunst misst sich auch im Rezept für stabilen Bierschaum. Die neuste Erkenntnis aus der Forschung: Sowohl Lagerbiere als auch belgische Ales können sehr stabilen Schaum haben. Die zugrunde liegende Physik kann jedoch beim Vergleich der mikroskopisch kleinen Bierfilme, welche die Blasen im Schaum voneinander trennen, sehr unterschiedlich sein.
Peter Rüegg ¹
Nichts geht der Bierliebhaber und der Bierliebhaberin über eine Schaumkrone, die auf dem goldenen, perlenden Gerstensaft sitzt. Doch bei vielen Bieren platzt dieser Traum schnell, und der Schaum fällt in sich zusammen, bevor man den ersten Schluck nehmen kann. Allerdings gibt es auch Biersorten, bei denen die Schaumkrone lange hält.
Weshalb das so ist, haben Forschende um Jan Vermant, Professor für Weiche Materialien an der ETH Zürich, jetzt herausgefunden. Ihre Studie wurde soeben in der Fachzeitschrift Physics of Fluids veröffentlicht. Sieben Jahre haben der Belgier und seine Mitarbeitenden daran gearbeitet.
1 ETH Zürich

Alles begann mit einer einfachen Frage an einen belgischen Brauer: «Wie kontrollierst du den Brauprozess?» – «Indem ich den Schaum beobachte», lautete die Antwort. Heute kennen die Wissenschaftler die Mechanismen hinter dem perfekten Bierschaum. Und vielleicht können Biertrinkerinnen künftig die Schaumkrone im Glas etwas länger bewundern, ehe sie ihren Durst löschen.
In der Studie zeigen die Materialwissenschaftler, dass «Tripel»-Biere unter den untersuchten belgischen Bieren den stabilsten Schaum haben, gefolgt von «Dubbel»-Bieren. Am wenigsten stabil ist der Schaum bei «Singel»-Bieren, die weniger intensiv vergoren werden und den geringsten Alkoholgehalt aufweisen.
Auch zwei Lagerbiere von grossen Schweizer Brauereien haben die Forschenden untersucht. Die Schaumstabilität dieser Biere sei vergleichbar mit jener von Belgischen Ales, obwohl die Physik hinter der Schaumstabilität verschieden sei. Interessanterweise habe eines der getesteten Schweizer Lagerbiere bezüglich der Schaumstabilität nicht so gut abgeschnitten. «Das könnten wir dank unserer neuen Erkenntnisse durchaus verbessern», sagt Jan Vermant.
Bisher nahmen die Forschenden an, dass die Stabilität des Bierschaums vor allem von proteinreichen Schichten an der Oberfläche der Bläschen abhängt: Die Proteine stammen aus dem Gerstenmalz und beeinflussen die Oberflächenviskosität, also
deren Fliessfähigkeit, sowie die Oberflächenspannung.
Doch die neuen Experimente zeigen, dass der entscheidende Mechanismus komplexer ist und stark von der Biersorte abhängt. Bei Lagerbieren ist ausschlaggebend, wie elastisch und gleichzeitig zähflüssig die Oberfläche der Bläschen ist (Viskoelastizität). Sie wird beeinflusst durch die im Bier vorhandenen Proteine sowie durch deren Denaturierung: Je mehr Proteine im Bier vorhanden sind, desto starrer wird der Film um die Bläschen und desto stabiler wird der Schaum. Anders bei den Tripel-Bieren: Hier ist die Viskoelastizität der Oberfläche minimal. Die Stabilität entsteht durch sogenannte Marangoni-Spannungen. Das sind Kräfte, die durch Unterschiede in der Oberflächenspannung entstehen.
Beobachten lässt sich dieser Effekt, indem man zerstossene Teeblättchen auf eine Wasseroberfläche gibt. Die Bruchstücke verteilen sich zunächst gleichmässig. Gibt man einen Tropfen Seife dazu, werden die Teeblättchen schlagartig an den Rand gezogen. Dabei treten Strömungen auf, die auf der Oberfläche zirkulieren. Halten solche Strömungen lange an, stabilisieren sie die Bläschen im Bierschaum.
Proteinreiche Hüllen umgeben Bläschen
Verschiedene Biere, unterschiedliche Braubedingungen und darum unterschiedliche Schaumphysik: Die Lösung liegt in der Struktur und der Dynamik von proteinreichen Hüllen, welche die Bläschen umgeben. Im belgischen Singel-Bier verhalten sich diese proteinreichen Hüllen so, als würden sich kleine, kugelförmige Partikel dicht an der Oberfläche der Blasen anordnen. Dies entspricht einer zweidimensionalen Suspension, das heisst einer Mischung aus einer Flüssigkeit und fein verteilten Feststoffen, die wiederum die Blasen stabilisiert.
Im Bier vom Typ Dubbel bilden Proteine eine netzartige Struktur, die wie eine Membran die Bläschen noch stabiler macht. Bei Tripel-Bieren wird die Physik noch komplexer: Die Dynamik der Bläschenoberflächen ähnelt der von Tensiden – Molekülen, die Schaum in vielen alltäglichen Anwendungen stabilisieren. Der genaue Grund für das unterschiedliche Verhalten ist noch unbekannt. Es scheint aber so, dass das Protein LPT1 (Lipid Transfer Protein 1) eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Bierschaumes spielt. Das konnten die Forschenden durch Analysen der molekularen Struktur und der Menge des Proteins in den untersuchten Bieren bestätigen.
Jan Vermant betont: «Die Stabilität des Schaums hängt nicht linear von einzelnen Faktoren ab. Man kann nicht einfach ‹etwas› ändern und es ‹richtig› einstellen.» Wird die Viskosität durch zusätzliche Tenside erhöht, könne das den Schaum sogar instabiler machen, weil man damit die Marangoni-Effekte zu stark verlangsame. «Entscheidend ist, gezielt an einem Mechanismus zu arbeiten – nicht an mehreren gleichzeitig. Bier macht das offensichtlich von Natur aus gut!», sagt Vermant. In dieser Studie arbeitete der ETH-Professor mit einer der weltgrössten Brauereien zusammen. Diese tüftelt an der Schaumstabilität ihrer Biere. Sie wollen verstehen, was den Bierschaum wirklich stabilisiert. «Wir kennen den physikalischen Mechanismus jetzt genau und können der Brauerei helfen, den Schaum ihrer Biere zu verbessern», sagt Vermant.
Für belgische Bierkonsumenten sei der Schaum wichtig, wegen des Geschmacks und als «Teil der Experience», wie der Materialforscher sagt. «Aber nicht überall, wo

Das Bild zeigt einen sehr dünnen Bierfilm zwischen zwei Blasen. Die verschiedenen Farben entsprechen unterschiedlichen Filmdicken, ähnlich wie bei einer topografischen Karte mit Höhenlinien. (Grafik: Manolis Chatzigiannakis, ETH Zürich)
Bier getrunken wird, ist der Schaum so wichtig. Das ist etwas Kulturelles.»
Anwendungen in Technik und Umwelt möglich
Die Erkenntnisse aus der Bierschaumforschung haben auch ausserhalb der Braukunst Bedeutung. In Elektrofahrzeugen etwa können Schmiermittel schäumen –ein gefährliches Problem. Unter anderem mit der Firma Shell untersucht Vermants Team nun, wie sich solche Schäume gezielt zerstören lassen.
Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger Tenside, die auf Fluor oder Silizium verzichten. «Unsere Studie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung», so Vermant.
In einem EU-Projekt arbeiten die Forschenden zudem an Schäumen als Träger für bakterielle Systeme. Und in Zusammenarbeit mit Lebensmittelforscher Peter Fischer von der ETH Zürich geht es um die Stabilisierung von Milchschaum durch Proteine. «Es gibt also viele Bereiche, wo uns das mit Bier erworbene Wissen nützt», sagt Vermant.
https://ethz.ch
Hochtemperatur-Anforderungen? Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite Kein Problem!
Und alles andere haben wir natürlich auch im Griff!




Ilmac Basel 2025
Mit der Ilmac hat sich am Rheinknie gezeigt, dass Fachmessen im digitalen Zeitalter nach wie vor eine wichtige Business-to-Business-Plattform bieten. Auch bei geänderten Standkonzepten.
Luca Meister
Die Jungen wollen keine Face-to-FaceTermine mehr, heisst es. Das ist verständlich, in vielen Firmen werden Videocalls für jeden noch so trivialen Austausch angesetzt. Effizienz ist bei weitem nicht nur in den Unternehmensprozessen wichtig, sondern genauso in der Kommunikation unter den Mitarbeitenden und Abteilungen. Kein Wunder, sind heute im gleichen Zug Weisungen zu solchen Meetings zum Standard geworden.
Lehnt der Nachwuchs den persönlichen Austausch ab?
Vielleicht aufgrund zu vielen solchen NullInhalt-Meetings hält vor allem die jüngere Generation grundsätzlich auch nichts vom persönlichen Austausch vor Ort. Sich ausschliesslich virtuell zu treffen mag bei einer Einstiegsstelle nach der Ausbildung legitim sein und gut funktionieren. Doch

nach ein paar Jahren auf dem Buckel kann sich das ändern. So steht plötzlich jemand der Generation Z vor dem Kauf eines teureren Laborgeräts im Auftrag des Chefs oder der Chefin – und muss dafür Verantwortung übernehmen.
Nachdem ersten Erfahrungen mit kostengünstigen Geräten (wer billig kauft, kauft teuer!) werden auch sie merken: Ein persönlicher Austausch könnte hilfreich sein. Eine Begegnung in der realen Welt lässt es zu, die Verkaufsperson besser einzuschätzen als dies über den Bildschirm möglich ist, wo sich viele mit einfachen Mitteln ihren Eindruck frisieren. Bei einem Kaffee –oder einem Mategetränk (eines wurde übrigens an der Ilmac verteilt) merkt man eher, ob die propagierten Serviceleistungen realistisch oder eher leere Versprechen sein könnten. Wer jemandem auf die Finger sieht, kann besser einschätzen, ob das Gegenüber vertrauenswürdig ist oder nicht. Denn bestimmte Gesten können
Rückschlüsse auf das Handeln zulassen oder ein gespieltes Interesse entlarven (wer kennt ihn nicht, den Aussteller, der während dem Gespräch schon zur nächsten Besucherin hinüberguckt!). Es sind oft feinste Details mit entscheidender Wirkung: Gibt sich jemand übertrieben freundlich? Wie viel Zeit nimmt sich jemand für eine Beratung? Lange Rede, kurzer Sinn: Es geht um Vertrauen, das gerade beim Kauf von teurer Laborausrüstung essenziell ist.
Die Jüngeren waren zwar nicht in Scharen an die Ilmac gereist, aber erstaunlicherweise einigermassen präsent. Gerade das neue Format «Women in Life Sciences» (siehe Bild) hat das bestätigt.
Firmen müssen nicht mehr imponieren
So könnte es im besten Fall nur eine wirtschaftliche Delle sein, welche die Pandemie bei den Publikumszahlen von Fach -

messen verursacht hat. Im schlechtesten Fall wird es die künstliche Intelligenz mit der direkteren Vermittlung von Interessenten und potenziellen Kundinnen richten, die ausserhalb des Messerahmens Menschen zueinander führt (innerhalb ist es das Online-Netzwerk «Ilmac 365»). Doch selbst wenn eine Fachmesse nicht schneller und nicht derart passende «Matches» bilden kann, kann sie immer noch gut trumpfen: und zwar mit Effizienz. Dass eine Handvoll Personen an einem Tag an einem einzigen Ort getroffen werden können, schafft im Rahmen der aktuellen physikalischen Gegebenheiten bislang kein anderes Format (entgegen den Zukunftsszenarien von der Mitte des letzten Jahrhunderts ist auch 2025 das «beamen» noch nicht möglich).
Aufgefallen ist, dass die Messestände der Aussteller tendenziell kleiner geworden












sind, was vermutlich eine logische Konsequenz der neuen virtuellen Möglichkeiten ist. Ein Stand muss heute kein Laufpublikum mehr zum Staunen bringen mit einem klotzigen Konzept. Dass ein Hersteller oder Dienstleister an einer Messe «entdeckt» wird, ist im digitalen Zeitalter kaum mehr der Fall. Zum Vergleich: in Nordamerika haben sich Tischmessen durchgesetzt, die vor diesem Hintergrund maximale Wirtschaftlichkeit bieten: Ein kleiner Tisch, ein Panel dahinter und ein paar Exponate – von einer oder zwei ausstellenden Personen einfach zu transportieren. Eine interessante und in gewissem Masse solidarische Einigung auf Minimalismus.
Gemäss der Messeleitung haben sich dieses Jahr 12 800 Teilnehmerinnen und Teil -



nehmer in der Stadt am Rheinknie getroffen. 400 Aussteller präsentierten an der Ilmac 2025 ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen und Entwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit über 150 Fachreferaten und Pitches bot die Messe zudem ein ausführliches Rahmenprogramm an.
Mit der Premiere von «Women in Life Sciences» wurde ein neues Format einschliesslich Networking-Apéro, der intensiv genutzt wurde, geboten. Gemäss Medienmitteilung soll damit dem «Gender Health Gap» entgegengewirkt werden und Frauen für Führungspositionen gestärkt werden. Auf der neuen «Future of Life Sciences»Area standen Themen wie Digitalisierung in der Forschung, KI-gestützte Diagnostik, innovative Therapien und nachhaltige Produktion auf dem Programm. Das Format stiess sowohl auf Publikum- als auch auf Ausstellerseite auf Interesse – und, so das Communiqué, «besitzt das Potenzial, sich dauerhaft im Programm zu etablieren.» Das Ziel: Akteure in den Biowissenschaften miteinander zu verbinden und sich mit neuen Trends und Technologien auseinanderzusetzen. «Damit sollen Branchen-Umbrüche antizipiert werden, Flexibilität gewonnen und gemeinsam Lösungen entwickelt werden, um die komplexen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen», so Frank Kumli von The Futuring Alliance.
www.ilmac.ch









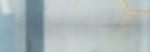























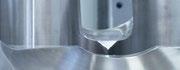












Die MAAG Group ist Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie weltweit. Unsere integrierten Lösungen für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie Pelletizing-, Pulvermühlen- und Recyclingsysteme zeichnen sich durch hervorragende Leistungen für anspruchsvolle Kundenanforderungen aus.
















Avintos – Am Stand «abgebildet» wurde das Portfolio mit Industriearmaturen und Schlauchleitungen für die Prozessund Life-Sciences-Industrie.
Während drei Tagen war das Team der ChemieXtra an der Messe Basel unterwegs und hat das Wichtigste der Veranstaltung am Rheinknie eingefangen. (Bilder: ChemieXtra)

AAC Infotray – Bei den Spezialisten für Prozessdigitalisierung: Mark Schneider, Marketing, Jessica Martins Anes, Verkauf & Marketing, und Johannes Stadler, CEO.

Aquasant – Trennschichtmessung «smart im Feld»: Roger und Thomas Inauen, beide Geschäftsleiter, vor dem Exponat, das die Extraktion organischer Produkte zeigt.


Anton Paar – Doïna Gachet, Marketingmanager, kündigte symbolisch zwei neue Laborgeräte im Bereich Rheologie und thermische Analyse an. ChemieXtra wird darüber berichten.

Cem – Umut Aygül, Kundenberater Schweiz, im Gespräch hinter dem «MARSXpress 2.0» (r.). Mit dem Mikrowellensystem für die Schwermetallanalytik wird z.B. der Bleigehalt von Chilischoten gemessen.


Baumer Electric – Roberto Spricigo, Produktmanager, neben der Simulation einer CIP-Anlage (Cleaning in Process) mit verschiedenen Sensoren: Leitfähigkeit, Durchfluss, Temperatur, Druck und Füllstand.

ChemieXtra – Natürlich auch wieder vor Ort: Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche.

Contec – Anziehende Nachfrage nach Desinfektionsmitteln: Nailin Solórzano, Verkauf Schweiz, mit dem diesjährigen Kassenschlager «Contec Polychlor» (Hypochlorsäure), der sich doppelt so gut verkaufte wie letztes Jahr.

H. Lüdi – Hans Remschnig: «Wenn es um Medienträger geht, steht die Sicherheit ganz oben, daneben immer häufiger auch Energieeffizienz, Agilität, Schnelligkeit durch einen (patentierten!) parallelen Einbau und eine leichte Konvertierbarkeit in die Reinraumzone – auch mit speziellen Reinraum-Medienträgern.»

Felix Transport – Das Familienunternehmen präsentierte seine Dienstleistungen, die vom Pharma- und Gefahrgut- bis hin zum Kühlund Thermotransport reichen.

Almatechnik – Für Labor oder Produktion: Paolo Lepore, Verkauf, und Michael Misteli, Geschäftsleitung, machen den Durchfluss in Systemen sichtbar mit dem Single-use-CoriolisDurchflussmesser. Einmal kalibrieren, unabhängig von Dichte, Temperatur usw., und reproduzierbar auf ±1 % genau messen.

Endress+Hauser – Mittels «Heartbeat-Technology» die Prozesse besser in den Griff kriegen und die Effizienz des Anwenders steigern: Michael Staudinger ist seit 1. Juni als Geschäftsführer Schweiz tätig.

Haberkorn – Automatisch sicherer: Durch Abwiegen stellt der Wiegezellenschrank fest, wie viele «Tychem-2000»-Schutzoveralls (orange) oder andere PSA-Bestandteile Sabine Glassnegg, Geschäftsleiterin, entnommen hat und bestellt selbständig nach.

Hach – Kompakt und modular aufgebaut: Im Fokus standen Ozonmesssysteme, sowohl portabel als auch für den Labortisch, unter anderem für die Pharmaindustrie.


Gemü – Neue Ventilgeneration, Membranwechsel wie der Blitz: Dank Bajonettverschluss muss anstelle von 4 nur noch 1 Schraube angezogen werden, wie Andreas Gerle, Verkaufsleiter Schweiz, zeigt.

Hiltrade – Hochdruckreaktor mit Steuerung, Heizung, Kühlung, Rührer sowie Temperatur- und Druckmessung: Stefan Hiltebrand, Geschäftsführer, neben dem All-inOne-Tischgerät «highpreactor» von Berghof.


Huberlab – Besonders erfrischend in der trockenen Hallenluft und daher auch besonders beliebt unter dem Messepublikum: Drinks wie der «Mai-Croscope» oder «Science on the Beach».

Knick – Sandra Parolari, Marketing, bei der Präsentation der neusten Produkte am Stand. Teaser: Bald wird neue Knick-Technologie auch für Schweizer Kunden erhältlich sein.


Hitec Zang – David Sieben, Marketing, hat die Hände frei dank Sprachsteuerung: Die Software «LabVision» (auf dem Bildschirm ein grafisch dargestellter Versuchsaufbau) kann jetzt auch ohne Maus und Tastatur bedient werden. «Rührer starten!».
Julabo – Das Unternehmen präsentierte einen Querschnitt seiner Palette für präzises und einfaches Temperieren.

Infochroma – Jetzt kommt Harry Hygiene: Das StandardVial-Sortiment wurde erweitert um partikelfreie, sterile und pyrogenfreie Produkte aus Borosilikat Typ I mit Aluminiumbördelkappe und Butylgummi-Stopfen.

Kaeser – Effizienz als Versprechen, Betriebs- und Zustandsdaten in Echtzeit: So sieht das Herzstück eines Schraubengebläses mit «Sigma»-Profil aus.
Krohne – In einem Gerät vereint: Das intelligente Messventil für Durchfluss-, Druck- und Prozessregelung «Focus-1», präsentiert von Marc Madacs, Vertriebsleiter Schweiz.

DroneXploration – Hochpräzise Exploration und Inspektion: Das in der Start-up-Area ausstellende Unternehmen bietet auch Lösungen für Industrieanlagen und Abwassersysteme.
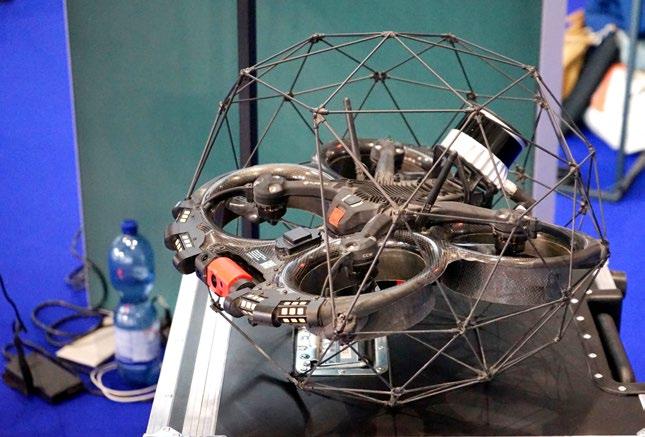
Merck – Intelligent, intuitiv und für eine höhere Laborproduktivität: Das «Milli-Q IQ 7000» gewährleistet eine konstante Erzeugung von Reinstwasser höchster Qualität.


Metrohm – Volles Haus beim Spezialisten für Verfahren wie Titration, Ionenchromatographie, Elektrochemie, Spektroskopie und Prozessanalytik.

Hettich – Nahe am Sonnenlicht, mit Regal, Elektronik und Klima: Fabiana Bächli, Business Development & Marketing, zeigt die neuen «Plant Growth Cabinets». Auch klein erhältlich.

Rotronic – Als Marke der DwyerOmega-Gruppe präsentierte das Unternehmen seine Messgeräte für Feuchte, Temperatur und Wasseraktivität.

Sefiltec – Einfacher Filterwechsel mit aseptischem Clamp: Kevin Gammeter, Geschäftsleiter, mit dem 5-fach-Filtergehäuse für Biopharma-Anwendungen und Highend-HCF (Hygienic Cartridge Filter).


Shimadzu – Europäische Premiere in der PFASAnalytik: Samantha Wörner, Anwendungs- und Kundenbetreuung, und Sascha Sütterlin, Servicemanager, vor dem neuen Triple-QuadrupolMassenspektrometer «LCMS-8065XE».

Skan – Mit dem PSA-Hersteller Dach Farbe ins Spiel gebracht: Christian Maurer, Produktmanager, Sara Ferreira, Produktspezialistin, und Giuseppe Cirillo, Leiter Marketing & Verkauf, vor der Box, wo Besuchende sich selber künstlerisch verwirklichen konnten.

Socorex – Gérald Nicolet, Verkauf und Produktmanagement, präsentierte Präzisionsdosiergeräte für die Flüssigkeitshandhabung und Services für Mikropipetten und Dispenser aller Marken.

TEG – Joël Fricker, Verkauf für DACH, ist dabei, den Vertrieb des in Irland ansässigen Unternehmens in der Schweiz aufzubauen.

Th. Geyer – Für Lernende: Sebastian Averkamp und Claudia Eisele, beide im Marketing, mit der individualisierbaren Starter-Box «Labstar», einschliesslich Maskottchen.


STZ Euro – Optimierungspotenziale für eine höhere Energieeffizienz und für nachhaltige Lösungen im Reinraum zeigte Michael Kuhn, Steinbeis-Transferzentrum Energie-, Umwelt- und Reinraumtechnik, auf.

Vacuubrand – David Leuenberger, neuer Produkt- und Anwendungsberater für die Schweiz und Liechtenstein, im Gespräch.

Vega – Für einfache bis moderate Messaufgaben in der Fabrikautomation: Jürgen Feser, Geschäftsleiter, mit dem «Vega Pulse 42», Radarsensor für die kontinuierliche Füllstandmessung.

Sebio – Die Zusammenarbeit mit Tosoh Bioscience, Dr. Möller & Schmelz und Hahnemühle FineArt stand im Fokus.

MLS – Werner Lautenschläger, Geschäftsführer, betätigt «die schnellste Mühle der Welt»: Stein wird in Sekunden zu Pulver.

Roth AG – Nachhaltigkeit messbar gemacht, nach dem Motto: Qualität, die wirkt, und Verantwortung, die bleibt. Mireille Folk, Sonia Zorzetto, Frédérique Varoqueaux und Christian Draeger.

Weiss Technik – Die mikrobiologische Sicherheitswerkbank «UVF-S» mit integrierter Robotik für GMP Small Batches «Fill and Finish»-Aufgaben fand grossen Anklang.

Denios – Personenbezogene Authentifizierung via Chipkarte: Niklas Gabriel, Business Development, und Titus Zimmermann, Geschäftsleiter, präsentieren einen Sicherheitsschrank mit digitaler Inventarisierung.


Die Powtech Technopharm, Messe für «Process Operations», und die Fachpack, Messe für Verpackung, Technik und Prozesse, feierte unter erweiterter Konstellation als Duo Premiere: Während drei Tagen wurde das Messezentrum Nürnberg zu einer Stadt mit 72 000 Menschen. Dieses Jahr wie gehabt mit dabei: der Wissenschaftskongress Partec.
«Auf dem Messegelände war zu erleben: Europa ist innovativ», freut sich Marianny Eisenhofer, Geschäftsführerin der Powtech Technopharm. Die Messe war Treffpunkt für Experten aus unterschiedlichen Branchen, die voneinander profitieren, und bestätigte ihre internationale Ausrichtung –mit einem Schwerpunkt auf Europa und einer Reichweite, die bis in die weltweit führenden Processing-Märkte reicht. Vereint wurden vor allem Industriebereiche wie Chemie, Food & Feed sowie Pharma. Auch die Maschinen- und Anlagenbauer waren stark vertreten. Mit der flankierenden Fachpack konnte das Publikum die neuesten Innovationen und Lösungen aus den Bereichen Verpackung, Verarbeitung und Verfahrenstechnik gebündelt an einem Ort entdecken. In der Tat präsentierten zahlreiche Aussteller beider Messen Lösungen, die beide Welten
zusammen verbinden. Vor allem für die Bereiche Pharma, Chemie und Lebensmittel ist diese Schnittstelle wichtig.
Dass die Powtech Technopharm auch für Inspiration gesorgt hat, bestätigt Guntram Preuss, Stellvertretender Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Allgemeine Lufttechnik: «Die Messe hat uns wertvolle Lösungsansätze geliefert, um die Prozessindustrie zukünftig noch effizienter und nachhaltiger aufzustellen.» Neben diversen Veranstaltungen für den BranchenNachwuchs gab es zwei neue Formate: «Women4Processing» für das Netzwerken und der «Pharma-in-Focus»-Pavilion, auf dem Unternehmen ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen rund um pharmazeutische Verfahrenstechnik präsentierten.

Impression der diesjährigen Powtech Technopharm. (Bild: Nürnberg Messe)

Fachwissen, Wissensaustausch und neue Ideen erfolgten im Halbstundentakt bei dem «Powtech Forum» und dem «Technopharm Forum» mit insgesamt 88 Expertenvorträgen. Hersteller und Anwender kamen dort miteinander in den Dialog zu aktuellen Themen wie Zukunftstechnologien im Maschinenbau, Safety & Security, Food Processing, Fluids meet Solids, Umweltschutz & Nachhaltigkeit.
Unter dem Motto «Particles Empowering Tomorrow: Innovationen für unsere globale Welt» fand der Wissenschaftskongress Partec statt. Den rund 500 Teilnehmern aus über 20 Ländern wurde ein siebenzügiges Programm mit über 400 Beiträgen in 30 thematischen Sessions geboten. Erstmals war eine Plattform für zwei Nachwuchswettbewerbe der VDI-Gesellschaft Verfahrens- und Chemietechnik (VDIGVC) dabei: «chemPLANT», bei dem theoretisches Wissen und praktische Anwendungen in der Verfahrenstechnik gefragt sind, und «ChemCar», ein Rennen zwischen Modellautos, die durch eine (bio) chemische Reaktion angetrieben werden. Die nächste Powtech Technopharm findet vom 29. September bis am 1. Oktober 2026 wieder am gleichen Ort statt.
www.powtech-technopharm.com
BIOSOLUTE® LIFE SCIENCE PRODUKTE
DIE MARKE FÜR DEN SPEZIELLEN LABORBEDARF
BIOSOLUTE® bietet mikrobiologische Nährmedien sowie Biochemikalien für Ihr Life Science Labor mit konstant hoher Qualität, attraktiven Preisen und zuverlässiger Verfügbarkeit.
Die «Pumps & Valves Zürich» findet vom 26. bis am 27. November in der Messe Zürich statt – parallel zur «Aqua Suisse» und der «Maintenance Schweiz». Während den zwei Messetagen geht es um Pumpen, Antriebe, Filtration, Prozesse, Wasserbewirtschaftung und Instandhaltung. Insgesamt 210 Aussteller und Partner sind dabei.
Die Pumps & Valves, Plattform für industrielle Pumpen-, Armaturen- und Prozesstechnik, bündelt mit rund 60 Ausstellern Neuheiten aus den Bereichen Pumpensysteme, Ventiltechnik, Antriebstechnik, Filter- und Dichtungstechnik, Rohrleitungen und Prozessautomatisierung. Dabei stehen die zentralen Herausforderungen im Mittelpunkt: energieeffiziente Pumpen, sichere Ventilsteuerung, hygienische Lösungen sowie nachhaltige Filter- und Dichtungssysteme. Die Digitalisierung und Automatisierung durch moderne Steuerungen (wie z .B. IO-Link oder Profinet), Predictive Maintenance, der KI-Einsatz und Echtzeitdaten definieren dabei die technologische Ausrichtung.
Die Schwerpunkte Antrieb und Prozessautomatisierung, insbesondere in der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemiebranche, sind auch für süddeutsche Unternehmen interessant, die ein Bedürfnis nach flexiblen und robusten Technologien haben. Ein kleiner Vorgeschmack: Die Aran AG präsentiert z. B. Systemlösungen für die Industriearmaturen - und Dichtungstechnik, Samson Controls stellt intelligente Stellventile und Automationssysteme für prozesskritische Anwendungen vor, oder Zimmerli Messtechnik fokussiert auf präzise Mess- und Regeltechnik für Flüssigkeiten und Gase. KSB zeigt energieeffiziente Pumpen und digitale Überwachungssysteme für unterschiedliche Industrien und Egger Pumpen rundet das Spektrum mit massgeschneiderten Pumpensystemen und innovativen Iris - Blenden-Regulierschiebern ab.
Aqua Suisse: von der Komponente bis zum System
Parallel zeigen an der Aqua Suisse über 100 Aussteller ihre neuesten Entwicklun -

Synergien nutzen: Die drei Fachmessen in Zürich Oerlikon behandeln ein vielfältiges Themenspektrum aus der Verfahrenstechnik. (Bild: Easyfairs)
gen in den Bereichen Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Abwasser- und Prozesswasserbehandlung, aber auch Messtechnik und Prozessautomatisierung. Die Messe konzentriert sich damit auf die zentralen Anforderungen der Schweizer Wasserindustrie: Sichere Trinkwasserversorgung, effiziente Abwasserreinigung, Prozesswasseroptimierung sowie die Kanalinfrastruktur. Die Schwerpunkte reichen von Filter- und Rohrsystemen über Armaturen, Automationslösungen, Wasseranalyse bis hin zur modularen Lims- Datenerfassung.
Dabei stehen Themen wie mikroverunreinigte Stoffe, energieeffiziente Dosierungssysteme, Automation und datengestützte Analytik im Fokus. Technologische Entwicklungen zur UVC- Desinfektion, modulare Messlösungen sowie KI - gestützte Monitoring -Tools sind sowohl für kommunale Versorger als auch für industrielle Anwender relevant. Auch für Süddeutschland interessant und auf der Agenda: nachhaltige Rohrsysteme, digitalisierte Wassernetze und praxisgerechte Retrofits.
Das Rahmenprogramm der «Aquatalks» umfasst Referate, unter anderem zu Mikroverunreinigungen, Modernität in Desinfektionstechnologien sowie innovativen Produktpräsentationen. Hier geht es zum Programm: www.aqua-suisse-zuerich.ch/ de/programm.
Maintenance Schweiz: von reaktiv zu zustandsbasiert Von der akustischen Lecksuche bis hin zu digital gestützten Wartungs-Workflows und CMMS-Integrationen – die Maintenance Schweiz bündelt Lösungen und Trends rund um die zukunftssichere Anlagenwartung, effiziente Ersatzteillösungen, Smart Maintenance, die Arbeitssicherheit und modernste technische Services. Darunter finden sich auch Anwendungen von KI zur Produktivitätssteigerung. Es haben sich über 70 Aussteller angemeldet.
Die Messe für die industrielle und digitale Instandhaltung adressiert Themen wie Anlagenverfügbarkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, Dekarbonisierung, digitale Transparenz oder OT-Sicherheit.

Kostenloser Eintritt und Nachhaltigkeitskonzept Kostenlose Eintritte sind für alle drei Messen erhältlich mit dem Gutscheincode «1600» unter allen drei Messe-Websites: www.pumps-valves.ch/de/ihr-messeticket www.aqua-suisse-zuerich.ch/de/messetickets www.maintenance-schweiz.ch/de/ihr-messeticket
Ausserdem: Das Messetrio fördert mit einem Nachhaltigkeitskonzept die ressourcenschonende An- und Abreise, Abfallvermeidung und energieeffiziente Messestände. Mehr dazu ebenso auf den drei Messe-Websites.
Smart-Maintenance-Ansätze mit KI, Condition-Monitoring und eine vorausschauende Wartung schieben den Fokus von der reaktiven auf die zustandsbasierte Instandhaltung und machen Lebenszyklusdaten nutzbar. Darüber hinaus prägen Retrofit-Strategien, die Datenqualität entlang des Asset-Lebenszyklus, Fachkräftesicherung sowie der Transfer von Forschung in die Praxis die aktuelle Diskussion. Hochschul- und Industrieprojekte wie zu Predictive-Maintenance-Algorithmen oder Lifecycle-Management liefern dafür die Grundlagen. In Zürich wird gezeigt, wie diese Entwicklungen in robuste und industrietaugliche Betriebsmodelle umgesetzt werden.
Mit dem kostenfreien Vortragsprogramm «Maintenance Talks» in Halle 3 liefert die Veranstaltung ausserdem praxisorientierte Einblicke. Hier teilen Expertinnen und Experten ihr Wissen zu aktuellen Herausforderungen, Best Practices und Zukunftstechnologien. Das Programm ist unter
www.maintenance-schweiz.ch/de/programm ersichtlich.
Der «Pumps & Valves Industry Insights Blog» liefert einen tiefen Einblick in Entwicklungen und Trends der Pumpen- und Ventiltechnik. Ein Schwerpunkt liegt auf smarten Pumpensystemen, die mit 3-D - gedruckten Komponenten und KI - gestützter Prozessoptimierung arbeiten. Diese Technologien ermöglichen es lernenden Systemen, die Betriebsparameter selbstständig anzupassen und dadurch den Energieverbrauch sowie den Wartungsaufwand zu reduzieren. Weitere Beiträge befassen sich mit Predictive Maintenance und der Digitalisierung von Steuerungs- und Überwachungssystemen mittels IoT- Anbindung. Themen wie die Effizienzsteigerung in der Wasserstoffwirtschaft, Schutzmechanismen vor Trockenlauf und Kavitation sowie hygienische Armaturenlösungen für Lebensmittel- und
Pharmaprozesse runden die Vielfalt ab. Schon vor Messebeginn sind erste Impulse für den Messebesuch ersichtlich www.pumps-valves.ch/de/messeblog. Der offizielle Messeblog der «Aqua Suisse» beleuchtet praxisrelevante Innovationen und Projekte aus der Wasserbranche. Ein Beitrag zeigt zum Beispiel, wie IIoT-basierte Überwachungssysteme in Versorgungsunternehmen Wasserverluste reduzieren. Durch die Vernetzung von Messpunkten, Echtzeit-Analyse und automatische Alarmmeldungen lassen sich Leckagen schneller lokalisieren und beheben. In einem weiteren Beispiel geht es um modernes Wassermanagement mit Echtzeit-Monitoring, bedarfsgerechter Wartung und optimierter Energienutzung. Hier gehts zum Blog: www.aqua-suisse-zuerich.ch/de/messeblog.
mit «Touch & Collect»
Neben der Wissensvermittlung steht auch das Networking im Vordergrund: Die drei Messen schaffen Raum für den direkten Austausch mit Fachleuten, Entscheidungsträgern und potenziellen Geschäftspartnern. Mit dem digitalen Tool «Touch & Collect» können Besucherinnen und Besucher Kontaktinformationen und Unterlagen von Ausstellenden sammeln.
www.pumps-valves.ch www.aqua-suisse-zuerich.ch www.maintenance-schweiz.ch

Erfahren Sie mehr über Ihr Einsparpotential. Wir zeigen Ihnen gerne persönlich unsere neuen individuellen Lösungen. Scannen Sie den QR-Code, füllen Sie das Kontaktformular aus und lassen Sie sich von unseren Experten beraten. info@busch.ag | www.buschvacuum.com

Die chemische Industrie muss kreislauffähig werden. Doch um geschlossenen Materialkreisläufe Realität werden zu lassen, sind präzise Daten entscheidend. Transparenz und Kontrolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind unabdingbar – und genau hier setzt die Messtechnik von Vega an.
Die chemische Industrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Druck, Umweltbelastungen zu reduzieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben, nimmt stetig zu. Eine der vielversprechendsten Antworten auf diese Herausforderungen liegt in der Kreislaufwirtschaft. Sie hat zum Ziel, Materialien und Produkte möglichst lange im Wirtschaftskreislauf zu halten und dadurch Abfälle zu minimieren. Der Schlüssel hierzu liegt in der datengestützten Prozessüberwachung.
Vega-Sensoren, die für die Messung von Füllständen, Drücken und weiteren kritischen Parametern entwickelt wurden, sind das Rückgrat einer nachhaltigen Chemieproduktion. Sie überwachen Prozesse präzise, liefern Echtzeitdaten und ermöglichen es, die Nutzung von Ressourcen optimal zu steuern. Gleichzeitig helfen langlebige, reparierbare Sensoren, die Umweltbelastung durch technische Geräte selbst zu minimieren. Mit Vega wird der Weg zu einer ressourceneffizienten und nachhaltigen Industrie nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich rentabel.





Sichere Werte auch bei herausfordernden Prozessen in der Chemie-Industrie: «Vegabar 82», «Vegaswing 61» und «Vegapuls 6X». (Bilder: Vega)
Ressourcenschonung und Abfallreduktion durch Präzision















In der Chemieindustrie geht es heute nicht mehr nur darum, Produkte herzustellen, sondern dies soll mit möglichst geringem Ressourceneinsatz und minimalen Umweltbelastungen geschehen. Rohstoffe werden knapper, die Entsorgung von Abfällen teurer und der Druck, nachhaltige Lösungen zu finden, wächst. In diesem Spannungsfeld spielt Präzision eine zent-
The Original Filter Papers since 1883
Protect what matters
Environment
rale Rolle – denn je genauer ein chemischer Prozess geführt wird, desto effizienter werden Ressourcen genutzt und desto weniger unerwünschte Nebenprodukte oder Abfälle entstehen.
Environment
Protect what matters
The advantages of Hahnemühle‘s AI automated-driven core production:
• Total safety and control • Unequalled accuracy
Consistent quality
High precision
Flexibility
Hier setzen die Sensoren von Vega an. Sie liefern nicht nur präzise Messwerte, sondern schaffen durch ihre Zuverlässigkeit die Grundlage dafür, Produktionsprozesse eng zu führen. Etwa in chemischen Reaktionen, die komplex und empfindlich auf
Go and explore our range of high-quality products!
Protect what matters
Environment
The Original Filter Papers since 1883
The Original Filter Papers since 1883
The Original Filter Papers since 1883
Environment
Environment
• Filter papers
The Original Filter Papers since 1883
The advantages of Hahnemühle‘s AI automated-driven core production:
• Total safety and control
• Unequalled accuracy
• Thimbles
Go and explore our range of high-quality products!
Go and explore our range of high-quality products!
The advantages of Hahnemühle‘s AI automated-driven core production:
The advantages of Hahnemühle‘s AI automated-driven core production:
• Consistent quality
• Membranes
• High precision
• Flexibility
• Total safety and control

The advantages of Hahnemühle‘s AI automated-driven core production:
• Filter papers
• Syringe Filters
• Filter papers
• Total safety and control
Protect what matters Food & Beverage
New! PES Membranes
• Total safety and control
• Unequalled accuracy
• Unequalled accuracy
• Unequalled accuracy
• Consistent quality
• Thimbles
• Thimbles
Environment Diagnostic
• Consistent quality
• High precision
• High precision
• Membranes
• Flexibility
• Flexibility
• Consistent quality
• Membranes
Syringe Filters

• High precision
• Flexibility
• Syringe Filters
• Syringe Filters


New! PES Membranes
Syringe Filters
New! PES Membranes & Syringe Filters


The Original Filter Papers since 1883





Scan & explore more about us:

Schwankungen von Druck, Temperatur oder Füllständen reagieren. Mit den Echtzeitdaten der Vega-Sensoren können Produktionsbedingungen optimal eingestellt und kontinuierlich überwacht werden, was unerwünschte Abweichungen verhindert und die Qualität der Produkte sichert. Eine präzise Steuerung ist auch in der Rohstofflagerung und Weiterverarbeitung entscheidend. Tanks und Silos, in denen wertvolle Materialien aufbewahrt werden, können mit Füllstandsensoren von Vega zuverlässig überwacht werden. Das verhindert nicht nur Materialverluste durch Überoder Unterfüllungen, sondern trägt auch dazu bei, die Effizienz entlang der gesamten Produktionskette zu steigern.
In der Praxis wird dies in verschiedenen Industrien deutlich: In der pharmazeutischen Produktion, wo selbst kleinste Abweichungen in Syntheseprozessen zu Qualitätsverlusten führen können, helfen die Sensoren, unerwünschte Nebenprodukte zu minimieren und hochreine Wirkstoffe effizient zu erzeugen. In der Kunststoffproduktion tragen Vega-Sensoren dazu bei, Fehlproduktionen zu verhindern, die nicht nur Abfall verursachen, sondern auch Energie und Rohstoffe verschlingen.
Die Messtechnik von Vega reduziert nicht nur Abfälle, sondern senkt gleichzeitig die Betriebskosten – ein klarer Gewinn für Unternehmen und Umwelt.
Wasserstoff und CCS:
Messtechnik für grüne Zukunft
Wasserstoff und die CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) gelten als Schlüsseltechnologien der Energiewende. Beide Ansätze sind entscheidend, um die Emissionen der Industrie zu senken und langfristig klimaneutral zu produzieren. Doch sie bringen hohe technische Herausforderungen mit sich, die nur mit verlässlicher Messtechnik gemeistert werden können.
Wasserstoff, der als Energieträger der Zukunft gilt, stellt besondere Anforderungen an die Prozessüberwachung. Seine geringe Dichte, die extremen Drücke und Temperaturen, unter denen er gespeichert wird, sowie die Sicherheitsanforderungen machen eine hochpräzise und robuste Messtechnik unabdingbar. Vega-Sensoren sind für diese Herausforderungen entwickelt. Sie überwachen etwa Wasserstofftanks, die bei Drücken von bis zu 700 bar arbeiten und messen Füllstände sogar bei extremen Temperaturen von –253 ° C, wie sie bei flüssigem Wasserstoff auftreten. Vega-Drucksensoren messen Drücke bis 1000 bar und sind ideal für Anwendungen mit komprimiertem Wasserstoff geeignet. Auch bei der Herstellung von Wasserstoff, etwa in der Elektrolyse, steuern die Sensoren kritische Parameter und tragen so zu einer effizienten und stabilen Produktion bei.

Vega-Füllstandsensoren überwachen zuverlässig die Materialtank der Rohstofflager und verhindern so eine Über- oder Unterfüllung.
Im Bereich CCS sind es vor allem die Abscheidung, der Transport und die sichere Lagerung von Kohlendioxid, die präzise Daten erfordern. Vega-Sensoren überwachen Drücke und Füllstände in den Abscheidungsanlagen, um eine maximale Effizienz sicherzustellen. Beim Transport des verflüssigten CO2 in Pipelines stellen sie sicher, dass keine Leckagen auftreten und in unterirdischen Lagerstätten sorgen sie dafür, dass das Klimagas sicher eingeschlossen bleibt.
Beispiele aus der Praxis zeigen, wie VegaTechnologie die Umsetzung dieser Zukunftstechnologien unterstützt: In Wasserstofftankstellen sorgen Drucksensoren für eine sichere Betankung und in Zementwerken, in denen CCS-Technologien bereits zum Einsatz kommen, ermöglichen die Sensoren eine präzise Überwachung der CO2-Abscheidung. Mit ihrer Zuverlässigkeit leisten die Sensoren einen Beitrag zu einer klimafreundlicheren Zukunft.
Geschlossene Materialkreisläufe durch präzise Daten
Die Kreislaufwirtschaft verspricht eine Welt ohne Abfall. Materialien sollen so lange wie möglich genutzt, aufbereitet und erneut verwendet werden. Doch um dieses Modell umzusetzen, braucht es technologische Innovationen – insbesondere in der Messtechnik und Digitalisierung. Die Sensoren und digitalen Lösungen von Vega spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie Prozesse transparent und steuerbar machen. In Recyclingprozessen ermöglichen sie beispielsweise die präzise Trennung von Materialien. Ob Kunststoff, Metall oder Glas – mit Füllstand- und Drucksensoren können die Mengen in Trennanlagen überwacht werden, sodass die einzelnen Stoffe effizient sortiert und weiterverarbeitet werden können. Auch im chemischen Recycling, bei dem Kunststoffe in ihre chemischen Grundstoffe zurückgeführt werden, sind die Sensoren unverzichtbar. Sie sorgen für stabile Bedingungen und tragen so dazu bei, dass die Reaktionen möglichst ressourcenschonend ablaufen.
Ein weiterer Vorteil der Vega-Technologie liegt in digitalen Plattformen wie etwa dem «myVEGA»-Portal. Hier lassen sich Backups der Parameter oder für viele der Sensoren auch Protokolle von Wiederholungsprüfungen speichern. Zudem können


Vega-Sensoren sind nicht nur robust und präzise, sondern auch langlebig und reparierbar: So sorgen sie für nachhaltige Prozesse.
hier die Zugangscodes in einem virtuellen Schlüsselbund synchronisiert werden, die Bestellhistorie jederzeit eingesehen und alle notwenigen Produktdokumente auf einen Klick abgerufen werden.
Die schnelle und unkomplizierte Verfügbarkeit aller Sensordaten macht sich speziell in der Kreislaufwirtschaft bezahlt, wo sich durch eine vorausschauende Planung un -
nötige Ausfälle vermeiden und Ressourcen schonen lassen. Die digitale Integration ist somit ein weiterer Schritt, um die Kreislaufwirtschaft Realität werden zu lassen. Ohne verlässliche Daten, die transparent und zugänglich sind, bleibt die Rückverfolgbarkeit und effiziente Wiederverwertung von Materialien nur Theorie. Messtechnik macht Kreisläufe möglich – und Nachhaltigkeit messbar.
Nachhaltige
Langlebig und reparierbar
Nachhaltigkeit beginnt nicht erst in der chemischen Produktion, sondern bereits bei den Technologien, die dabei eingesetzt werden. Vega verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die Nachhaltigkeit der eigenen Produkte in den Fokus rückt. Sensoren von Vega sind so konstruiert, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen in der Chemieindustrie standhalten und eine lange Lebensdauer erreichen. Robustheit allein reicht jedoch nicht aus.



Vega setzt auf ein modulares Design, das Reparaturen und den Austausch einzelner Komponenten ermöglicht. Ersatzteile sind über Jahre hinweg verfügbar und umfassende Wartungsservices sorgen dafür, dass die Geräte nicht nur lange halten, sondern auch präzise bleiben.
Mit dieser Kombination aus Präzision, Langlebigkeit und Digitalisierung setzt Vega Massstäbe für nachhaltige Messtechnik und unterstützt die Chemieindustrie auf ihrem Weg in eine ressourceneffiziente Zukunft.
Fazit: Messtechnik von Vega ist ein Wegbereiter für eine nachhaltige Chemieindustrie. Von der ressourcenschonenden Prozessführung über die Unterstützung von Wasserstoff- und CCS-Anwendungen bis hin zur Kreislaufwirtschaft schafft Vega die Grundlage für eine chemische Produktion, die ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz verbindet.
www.vega.com
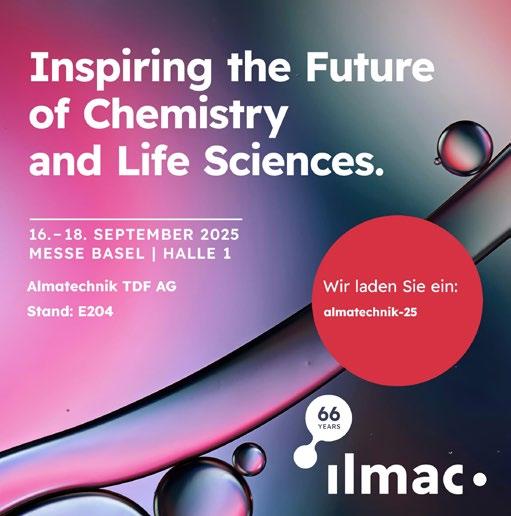

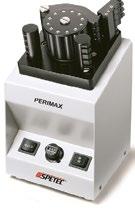



























Sarah Vanessa Kröner hat bei der CSB-System SE die Nachfolge von Dr. Peter Schimitzek angetreten. Die neue Vorstandsvorsitzende hält seit Mitte Juli die Fäden des international tätigen ERP-Anbieters für die Prozessindustrie in der Hand.
Firmengründer Peter Schimitzek, der über 48 Jahre an der Spitze von CSB stand, bleibt als Mitglied des Vorstands an Bord. Er wird an der Seite seiner Tochter weiterhin wichtige Impulse für die Entwicklung des Unternehmens einbringen. Sarah Vanessa Kröner dazu: «Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als CEO und bin stolz, ein so grossartiges Unternehmen zu leiten und zu repräsentieren. Dabei ist es ein gutes Gefühl, dass ich auf ein starkes internationales Team zählen kann.»
Sarah Vanessa Kröner (geb. Schimitzek) hat nach ihrem Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen mehrere Jahre im Bereich «Mergers and Acquisitions» bei einer international tätigen Grossbank gearbeitet. Sie lebt mit Ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der Schweiz. Mit dem Generationenwechsel setzt das Unternehmen seine langfristig angelegte Nachfolgeplanung um. Ziel ist es, die Zukunft von CSB SE als familiengeführtes und unabhängiges Unternehmen zu sichern – als verlässlicher Arbeitgeber sowie als Technologie- und Qualitätsführer für Kunden weltweit. «Seit der Gründung zusammen mit meinem Bruder Karl-Heinz im Jahre 1977 habe ich mein ganzes berufliches Leben viel Herzblut in die Firma gesteckt. Noch heute bin ich jeden Tag mit Engagement dabei. Mit meinen 76 Jahren freue ich mich jetzt besonders, dass mit der Übernahme des Vorsitzes durch Vanessa der dauerhafte Erfolg von CSB als Familienunternehmen gesichert bleibt», sagt Peter Schimitzek.
Klarer Zukunftsblick: Anpassungsfähigkeit und Kontinuität
Seit ihrem Eintritt in den Vorstand 2013 hat Sarah Vanessa Kröner das internationale Wachstum und die Produktentwicklung strategisch vorangetrieben. Für die kom -


(Bild: CSB)
menden Jahre hat sie einen klaren Blick nach vorn: die weltweite Präsenz von CSB weiter ausbauen und Innovationen im Produktportfolio gezielt fördern. Ziel ist es, neue Märkte zu erschliessen, spannende Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende zu eröffnen und Kunden massgeschneiderte Lösungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu bieten. «Das ERPSystem ist und bleibt dabei unser Herzstück. Doch die Zukunft gehört auch der Robotik und der Künstlichen Intelligenz –beides werden wir bei unseren Kunden noch stärker implementieren und ins ERP integrieren. Die Vision dahinter: die Smart Factory, in der alle Prozesse von der Bestellung bis zum Verkauf digital miteinander verzahnt sind. Dieses Ziel verfolgen wir gemeinsam.»
CSB als Organisation so auszurichten, dass sie ihre Kunden mit den besten IT-Lösungen unterstützen kann – auch damit beschäftigt sich Kröner seit vielen Jahren sehr intensiv. «Ich handle dabei immer nach der Maxime ‹Structure follows Strategy›. Wenn wir uns als Unternehmen an neue Situationen anpassen müssen oder neue Märkte erobern wollen, dann machen wir das mit aller Konsequenz.»
An einem wesentlichen Punkt setzt aber auch die neue Vorstandsvorsitzende auf Kontinuität: «Wir haben als eines der wenigen inhabergeführten Software-Unternehmen eine besondere Bedeutung und Verantwortung für die mittelständische Prozessindustrie. Dieser Verantwortung wollen und werden wir immer gerecht werden», so Kröner.
Die CSB Unternehmensgruppe hat sich seit mehr als 45 Jahren konsequent auf die Prozessindustrie und den Handel spezialisiert. Durch eine starke Nachfrage und zufriedene Kunden erzielte sie einen kontinuierlichen Umsatzzuwachs im Inund Ausland. Die Gruppe beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende und erwirtschaftet mehr als 82 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mit rund 25 CSB-Systempartnern ist die Gruppe in vielen Regionen der Welt vor Ort mit eigenen Experten tätig. Insgesamt werden durch die globale Organisation Kunden in 50 Ländern betreut. Das CSB-System steht in 25 Sprachen zur Verfügung.
CSB System AG Schweiz Gäustrasse 52 CH-4703 Kestenholz www.csb.com
Ob Labor, Apotheke oder Forschungseinrichtung – die Arbeit mit unterschiedlichen Gefahrstoffen gehört zum Alltag. Mit dem V-Classic-90 Multirisk von Asecos können all diese Stoffe nun sicher in nur einem einzigen Gefahrstoffschrank gelagert werden.
Wo mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, sind Gefährdungsbeurteilung und sichere Lagerkonzepte Pflicht. In Laboren und Co. waren bisher meist drei unterschiedliche Sicherheitsschränke nötig: feuerfeste für brennbare Flüssigkeiten, abschliessbare für Gifte sowie spezielle Säure-/LaugenSchränke. Mit dem V-Line Multirisk können all diese Stoffe nun sicher, kompakt und uneingeschränkt in nur einem Schrank gelagert werden – dank innovativem Schrankaufbau und effizientem Lüftungssystem. Praktisch dazu: Wie ein Apothekerschrank in der Küche verfügt er über Vertikalauszüge – für einen übersichtlichen, schnellen und ergonomischen Zugriff von beiden Seiten.
Die Konstruktion macht den Unterschied
Der Typ-90-Sicherheitsschrank besteht aus feuerwiderstandsfähigen Materialien und schliesst sich im Brandfall automatisch. So wird ein gefährlicher Temperaturanstieg im Inneren verhindert und die gelagerten Substanzen tragen nicht zur Ausbreitung des Feuers bei – es bleibt Zeit, um Rettungsmassnahmen einzuleiten.

In den ION-Line-Sicherheitsschränken können Lithium-Akkus sicher gelagert und geladen werden. (Bilder: Asecos)

Der V-Classic-90 Multirisk kann nach Belieben bestückt und von beiden Seiten be- und entladen werden.
Innen ist der Schrank weitgehend metallfrei und korrosionsbeständig. Lagerebenen aus melaminharzbeschichteten Spezialplatten sowie Einlege- und Auffangwannen aus chemikalienresistentem Kunststoff sorgen für Beständigkeit.
Das Lüftungskonzept des V-Line Multirisk geht über die Anforderungen der EN 14470-1 und -2 hinaus: Durch einen 30-fachen Luftwechsel pro Stunde wird sowohl die Entstehung von explosionsfähiger Atmosphäre im Schrank als auch von Korrosion an der Inneneinrichtung effektiv verhindert. Dank der gleichmässigen Absaugung jeder einzelnen Lagerebene, können Nutzer selbst entscheiden, wo im Schrank sie welche Gefahrstoffe lagern.
Der V-Line Multirisk spart teure Stellfläche, denn er ersetzt gleich drei unterschiedliche Gefahrstoffschränke, die häufig nur teilweise gefüllt sind, und ist zudem effizi -
ent dimensioniert: Er ist schmaler und tiefer als andere Schränke, integriert sich perfekt in das etablierte Labormöbel-Raster und nutzt so auch den vorher ungenutzten Raum «hinter dem Schrank».
Neben klassischen Gefahrstoffen rückt auch die sichere Lagerung von LithiumAkkus in Laboren und Forschungseinrichtungen immer stärker in den Fokus. Zwar gelten sie als sicher, doch falscher Umgang oder Defekte bergen ein Brandrisiko. Eine ideale Ergänzung zum V-Line Multirisk ist daher ein ION-Line Sicherheitsschrank von Asecos für das sichere Lagern und Laden von Lithium-Akkus.
Asecos Schweiz AG CH-6264 Pfaffnau info@asecos.ch www.asecos.ch

Einweg-Schutzbekleidung und -handschuhe sind unerlässlich in Branchen, in denen Hygiene und Sicherheit oberste Priorität haben.
Haberkorn bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Einweg-Schutzartikel der Marken LeiKaTech ® , LeiKaTex ® und Solidstar® , die für Komfort mit zuverlässigem Schutz und exzellenter Funktionalität zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis stehen.
Ganzheitlicher Schutz –von Kopf bis Fuss
Das Sortiment von Haberkorn deckt alle relevanten Körperbereiche ab und erfüllt die Anforderungen der PSA Kategorie 1. Dazu zählen unter anderem:
– Kopfhauben und Bartschutz, die verhindern, dass Haare oder Hautpartikel in sensible Produktionsbereiche oder Labore gelangen
– Einweg-Overalls mit Kapuze, die sich ideal für Reinräume, Laborbereiche oder die Verarbeitung sensibler Stoffe eignen
– Einweg-Überziehschuhe mit rutschhemmender Sohle, die für sicheren Halt auf glatten oder feuchten Böden sorgen – auch bei Einsatz von Chemikalien

Elastischer Einweg-Überziehschuh aus strapazierfähigem Gewebe. (Bilder: Leipold)


Sicherer Griff – auch bei kritischen Substanzen
Einweghandschuhe sind ein zentrales Element im Umgang mit chemischen Stoffen. Die puderfreien Modelle von Haberkorn bieten dank texturierter Fingerkuppen und Handflächen optimalen Grip – selbst bei öligen, feuchten oder aggressiven Medien. Besonders hervorzuheben ist der Solidstar® Premium 1393: ein puderfreier Nitrilhandschuh mit hoher chemischer Beständigkeit, der sich ideal für Personen mit Latex-Allergie eignet und gleichzeitig hohe Tastempfindlichkeit bietet – ein Vorteil bei präzisen Laborarbeiten.
Normgerecht und praxisbewährt
In chemischen Betrieben gelten strenge Vorgaben – etwa gemäss REACH, CLP oder TRGS-Richtlinien. Einwegprodukte von Haberkorn unterstützen die Einhaltung dieser Standards zuverlässig. Sie minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen, schützen vor gefährlichen Stoffen und ermöglichen eine lückenlose Dokumentation
hygienischer und sicherheitsrelevanter Massnahmen.
Antistatische und partikelfreie
Lösungen für Reinräume
Für den Einsatz in Reinräumen oder explosionsgefährdeten Bereichen bietet Haberkorn spezielle Einwegprodukte mit antistatischen Eigenschaften und geringer Partikelemission. Diese Artikel sind ideal für Produktionsumgebungen, in denen elektrostatische Entladungen oder mikroskopische Verunreinigungen ein Risiko darstellen – etwa bei der Herstellung von Feinchemikalien oder pharmazeutischen Wirkstoffen.
Komfort trifft Funktionalität
Gerade bei langen Tragezeiten ist der Komfort entscheidend. Die Einwegprodukte von Haberkorn überzeugen durch ergonomische Passformen, atmungsaktive Materialien und hautfreundliche Eigenschaften. So wird sichergestellt, dass Mitarbeitende ihre Schutzkleidung konse -
quent und gerne tragen – ein wichtiger Faktor für die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Nachhaltigkeit in der Chemieproduktion
Auch in der chemischen Industrie gewinnt Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Haberkorn setzt bei vielen Produkten auf recyclingfähige Materialien und unterstützt Betriebe mit Informationen zur fachgerechten Entsorgung. Darüber hinaus werden ressourcenschonende Verpackungslösungen und Mehrweg-Alternativen dort angeboten, wo sie sinnvoll und sicher umsetzbar sind.
Speziallösungen für anspruchsvolle Anwendungen
Neben Standardprodukten bietet Haberkorn auch Speziallösungen für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche. Dazu zählen etwa chemikalienbeständige Overalls, säurefeste Handschuhe oder partikelfreie Schutzhauben für Reinräume. Auch für Allergiker stehen spezielle Produkte zur Verfügung, die frei von Latex oder sensibilisierenden Stoffen sind.
Einwegschutzartikel für Sicherheit und Produktqualität
In der chemischen Industrie sind Sicherheit, Hygiene und Prozessreinheit essenziell – nicht nur zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch zur

Sicherstellung der Produktqualität und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. EinwegSchutzbekleidung und -handschuhe leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag. Sie schützen vor Kontaminationen, gefährlichen Substanzen und unterstützen die Einhaltung von Reinraum- und Arbeitsschutzstandards. Durch die richtige Auswahl und Anwendung – abgestimmt auf die jeweiligen Arbeitsbereiche – lassen sich Risiken minimieren und die Sicherheit für Mitarbeitende und Prozesse erhöhen. Nachhaltige Materialien und durchdachte
Entsorgungskonzepte unterstützen zudem einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Technik, Beratung und Service aus einer Hand
Als führender technischer Händler bietet Haberkorn nicht nur Einwegschutzartikel, sondern ein umfassendes Sortiment für die chemische Industrie – von persönlicher Schutzausrüstung über Betriebshygiene bis hin zu Fluidtechniklösungen, die speziell für den Einsatz in chemisch sensiblen Bereichen entwickelt wurden. Ob Schläuche, Armaturen oder Dichtungen: Auch hier stehen Qualität, Sicherheit und chemische Beständigkeit im Fokus. Neben dem breiten Produktspektrum überzeugt Haberkorn mit individueller Beratung – etwa zur Auswahl passender Artikel für spezifische Arbeitsbereiche oder zur Integration in bestehende Sicherheitskonzepte. Mit schneller Lieferfähigkeit, fundierter Branchenkenntnis und einem starken Service ist Haberkorn die erste Wahl für Betriebe, die auf Qualität, Sicherheit und Effizienz setzen.
Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH-9442 Berneck
+41 71 747 49 20 info@haberkorn.ch www.haberkorn.com

Kombination: statische Methode und dynamische Belastungsszenarien
Die Analyse von Flüssigkeiten erfordert höchste Genauigkeit – und diese steht und fällt mit der Temperierung. Die flucon fluid control GmbH aus Niedersachsen setzt deshalb auf Thermostate von JULABO, die stabile Rahmenbedingungen und reproduzierbare Ergebnisse ermöglichen. So wird Messtechnik zum verlässlichen Werkzeug in Forschung und Industrie.
flucon entwickelt und vertreibt hochspezialisierte Messsysteme zur Analyse von Flüssigkeiten unter praxisnahen Bedingungen – von Schmierstoffen, Kühlmitteln bis hin zu Farben und Lacken. Für das Unternehmen steht und fällt die Qualität von Messdaten mit der Qualität der Temperierung. Deshalb setzt flucon in zentralen Prüfprozessen auf Thermostate von JULABO. Systeme der CORIO- und MAGIOSerien gewährleisten eine hochpräzise Temperaturführung, stabile thermische Randbedingungen und reproduzierbare Ergebnisse – inklusive moderner Schnittstellen für die Einbindung in Laborautomatisierungen.
Das Unternehmen ist nicht nur Entwickler und Anbieter, es nutzt seine Messinstrumente selbst im eigenen Labor und bietet Labordienste für Kunden an. So verbindet flucon die Hersteller- mit der Anwenderperspektive – stets mit dem Anspruch, die Geräte kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das hauseigene Hochdrucklabor, in dem Stoffeigenschaften unter extremen Bedingungen von bis zu 1,4 GPa (14.000 bar) analysiert werden können.
Im Fokus des aktuellen Entwicklungsansatzes steht der sogenannte Dual Approach –

Testaufbau des E-Lub Testers im flucon-Labor mit angeschlossenem MAGIO Kältethermostat für präzise Temperierung unter praxisnahen Bedingungen. (Bild: JULABO)
ein innovatives Konzept, das die statische Methode des Laborgeräts Epsilon+ mit der dynamischen Untersuchung im E-Lub Tester kombiniert. Der Epsilon+ charakterisiert die elektrischen Eigenschaften von Schmierstoffen unter konstanten Bedingungen – entscheidend etwa für die Beurteilung von Durchschlagsrisiken in elektrischen Antrieben. Der E-Lub Tester analysiert hingegen dynamische Belastungsszenarien in befüllten Kugellagern unter variablen Drehzahlen, Lasten und Temperaturen. In beiden Fällen sind die präzise Regelgüte und die hohe Pumpenleistung der JULABO-Thermostate mass -
geblich für valide, reproduzierbare Messergebnisse.
Die langjährige Partnerschaft zwischen flucon und JULABO basiert auf technischer Zuverlässigkeit, direkter Kommunikation und schnellem Support – bis hin zur taggleichen Beantwortung komplexer Anfragen.
JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1 D-77960 Seelbach info.de@julabo.com www.julabo.com


Werden die Risiken problematischer Chemikalien angemessen beurteilt? In bestimmten Fällen wohl eher nicht –diesen Schluss zieht eine chinesische Forschungsgruppe aus einer Studie, die in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie veröffentlicht wurde.
Gefährliche Chemikalien werden häufig im Rahmen nationaler und internationaler Regelwerke bewertet, die sich in erster Linie auf deren toxische Eigenschaften, Umweltpersistenz und Anreicherung in Organismen konzentrieren. Welche Umwandlungen sie in der Atmosphäre durchlaufen, wird dagegen kaum oder gar nicht berücksichtigt, obwohl sekundäre Umwandlungsprodukte eine höhere Toxizität und Persistenz aufweisen können. Für eine adäquate Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsrisiken kommerzieller Chemikalien sollten diese aufgeklärt werden.
Das Team um Xiaole Weng von der Zhejiang-Universität (Hangzhou, China) hat unter diesem Blickwinkel flüchtige chlorierte organische Verbindungen (CVOC) unter die Lupe genommen, wichtige kommerzielle Chemikalien, die in Industrie und Landwirtschaft weit verbreitet sind und zum Beispiel in Farben und Lacken, zum chemischen Reinigen sowie Abbeizen verwendet werden. Müllverbrennungsanlagen und -deponien sind weitere Emissionsquellen.
Umwandlung
Mit zunehmender Industrialisierung werden die CVOC-Emissionen weiter steigen, vor allem in Entwicklungsländern. CVOCs sind als Vorläufer von Dioxin-Verbindungen in industriellen Verbrennungsprozessen bekannt. So können etwa Chlorbenzole, zum Beispiel katalysiert durch Flugasche, in polychlorierte Dibenzo-p-Dioxine und Dibenzofurane (PCDD/Fs) umgewandelt werden. Viele Mitglieder dieser Stoffgrup -
1 Zhejiang-Universität, China

Die Studie zeigt auf, dass chlorierte flüchtige organische Verbindungen in der Atmosphäre auf Mineralstaubpartikeln unter Sonneneinstrahlung in hochtoxische polychlorierte Dibenzop-dioxine und Dibenzofurane umgewandelt werden können. (Bild: Shutterstock)
pe sind toxisch und krebserregend, wie spätestens seit dem verheerenden Chemie-Unfall in Seveso (IT) 1976 allgemein bekannt ist. Dennoch gibt es bisher nur wenige Daten über den Verbleib und potenzielle Umwandlungen der CVOCs in der Atmosphäre.
Atmosphärische Partikel enthalten unter anderem Eisen- und Aluminiummineralien, die katalytisch aktiv sein können. Das Team stellte die Hypothese auf, dass diese unter Sonneneinstrahlung die Umwandlung von CVOCs in PCDD/Fs katalysieren und somit eine wichtige, übersehene Quelle für Dioxine sein könnten. Um diese Hypothese zu prüfen, führten die Forschenden Laborexperimente an verschiedenen Mineralpartikeln durch und ermittelten mögliche Reaktionswege anhand von Computerberechnungen. Anschliessend erfolgte ein Feldversuch mit Umgebungsluft und Fallasche in einem Industriepark, der das Auftreten der pho -
tochemischen Umwandlung in der realen Atmosphäre bestätigte.
Eisenoxid-Staub an Mäusen getestet
Die Ergebnisse belegen, dass allgegenwärtige CVOCs wie Monochlorbenzol, Dichlormethan und Perchlorethylen die übersehenen Vorläuferschadstoffe für PCDD/Fs sein könnten. Dabei spielen vor allem Eisenoxide (α-Fe2O3) eine Rolle für die Entstehung von Chlorphenolen und Dioxin-Verbindungen. Tests an Mäusen ergaben zudem, dass der Eisenoxid-Staub nach der photochemischen Reaktion schwere Schäden am Lungen- und Hirngewebe verursachte.
Die in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie publizierte Studie (doi.org/10.1002/ ange.202500854) unterstreicht die Notwendigkeit, die Toxizität atmosphärischer Vorläuferschadstoffe, wie kommerzieller CVOCs, sowie ihrer Umwandlungen neu zu bewerten.

Der rasante Anstieg der weltweiten Raketenstarts könnte die Erholung der lebenswichtigen Ozonschicht verlangsamen. Das Problem wird unterschätzt – dabei liesse es sich durch vorausschauendes, koordiniertes Handeln abmildern.
Dr. Sandro Vattioni 1
Timofei Sukhodolov 2
In den letzten Jahren hat sich der Himmel mit immer mehr Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn gefüllt. Dahinter steht eine boomende Raumfahrtindustrie, die spannende Möglichkeiten eröffnet, aber auch neue Umweltprobleme mit sich bringt. Startende Raketen und verglühender Weltraumschrott setzen Schadstoffe direkt in die mittlere Atmosphäre frei – genau dort, wo sich die Ozonschicht befindet, die das Leben auf der Erde vor gefährlicher UVStrahlung schützt. Welche Auswirkungen diese Emissionen auf die Ozonschicht haben, beginnt die Wissenschaft jedoch erst allmählich zu verstehen.
Die Forschung zu Raketenemissionen begann bereits vor über 30 Jahren. Jedoch wurden die Auswirkungen auf die Ozonschicht lange als gering eingeschätzt. Mit der steigenden Anzahl an Raketenstarts ändert sich dieses Bild. 2019 gab es weltweit lediglich 97 Starts – 2024 waren es bereits 258. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.
Das Besorgniserregende: Schadstoffe aus Raketen und wiedereintretendem Weltraummüll gelangen direkt in die mittlere und obere Atmosphäre – in Höhen, in denen sie bis zu 100-mal länger verweilen als bodennahe Emissionen, da es dort keinen Niederschlag gibt, der sie auswaschen könnte. Die meisten Starts finden auf der
1 Postdoc in der Gruppe für Atmosphärenphysik an der ETH
2 Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos


Nordhalbkugel statt, doch die atmosphärische Zirkulation verteilt die Schadstoffe weltweit.
Um die langfristigen Effekte der Raketenemissionen besser zu verstehen, arbeiteten wir mit einem internationalen Forschungsteam unter Leitung von Laura Revell von der University of Canterbury zusammen. Mithilfe eines Chemie-Klimamodells, das an der ETH Zürich und am Physikalischen Meteorologischen Observatorium Davos (PMOD/WRC) entwickelt wurde, simulierten wir, wie sich die prognostizierten Raketenemissionen bis ins Jahr 2030 auf die Ozonschicht auswirken würden.
Geht man von einem Szenario mit 2040 jährlichen Raketenstarts im Jahr 2030 aus – das entspricht etwa dem Achtfachen der Starts von 2024 –, würde die globale durchschnittliche Ozonschicht um etwa 0,3 Prozent abnehmen. Über der Antarktis, wo sich jedes Frühjahr noch immer ein Ozonloch bildet, könnte es saisonal zu Reduktionen von bis zu vier Prozent kommen.
Diese Zahlen mögen auf den ersten Blick gering erscheinen. Doch sollte man nicht vergessen, dass sich die Ozonschicht nach wie vor von den schweren Schäden erholt, welche durch langlebige Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) verursacht wurden. Diese Stoffe wurden 1989 mit dem Inkrafttreten des Montrealer Protokolls erfolgreich verboten.
Jedoch liegt die globale Dicke der Ozonschicht noch immer etwa zwei Prozent unter dem vorindustriellen Niveau, und eine vollständige Erholung wird frühestens 2066 erwartet. Unsere Ergebnisse zeigen: Unregulierte Raketenemissionen könnten diese Erholung um Jahre oder gar Jahrzehnte verzögern – je nachdem, wie stark die Raumfahrtindustrie wächst.
Die Wahl des Treibstoffs ist entscheidend
Verantwortlich für den Ozonabbau sind vor allem gasförmiges Chlor und Russpartikel. Chlor zerstört Ozonmoleküle durch katalytische Reaktionen, während Russ die Atmosphäre erwärmt und da -






durch ozonabbauende Reaktionen beschleunigt. Die meisten Raketentreibstoffe emittieren Russ. Die Chloremissionen stammen in erster Linie von Feststoffraketenmotoren. Die einzigen Antriebssysteme mit vernachlässigbaren Auswirkungen auf die Ozonschicht sind gegenwärtig jene, die kryogene Treibstoffe wie flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff nutzen. Aufgrund ihrer technischen Komplexität kommen diese bislang jedoch nur bei rund 6 Prozent aller Raketenstarts zum Einsatz.
Auswirkungen des Wiedereintritts sind noch ungewiss
Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Studie nur die Emissionen berücksichtigt, die von Raketen während des Aufstiegs ins All freigesetzt werden. Dies ist jedoch nur ein Teil des Bildes. Die meisten Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn treten am Ende ihrer Lebensdauer in die Atmosphäre ein und verglühen.
Dabei entstehen zusätzliche Schadstoffe, wie etwa verschiedene Metallpartikel und Stickoxide. Während Stickoxide in der mittleren Atmosphäre bekanntermassen katalytisch Ozon abbauen, können Metallpartikel zur Bildung polarer Stratosphärenwolken beitragen oder selbst als Reaktionsflächen dienen – beides kann den Ozonabbau weiter verstärken.
Diese Wiedereintrittseffekte sind noch wenig erforscht und in den meisten Modellen noch nicht berücksichtigt. Aus unserer Sicht ist dennoch klar, dass mit der wachsenden Anzahl Satelliten auch diese Emissionen zunehmen und der Gesamteffekt auf die Ozonschicht wahrscheinlich noch höher ist als die derzeitigen Schätzungen. Um diese Verständnislücken rasch zu schliessen, besteht dringender Forschungsbedarf.
Es braucht Weitsicht und Koordination
Doch das allein genügt nicht. Die gute Nachricht: Wir glauben, dass eine Raketen -
industrie, die ohne Schäden an der Ozonschicht auskommt, durchaus möglich ist. Entscheidend sind: ein wirksames Monitoring von Raketenemissionen, der weitgehende Verzicht auf Chlor- und Russ produzierende Treibstoffe, die Förderung alternativer Antriebssysteme sowie die Einführung angemessener und verbindlicher Vorschriften. Nur so kann sich die Ozonschicht weiter erholen. Dies erfordert koordiniertes Handeln von Wissenschaft, Politik und Industrie.
Das Montrealer Protokoll hat erfolgreich gezeigt, dass selbst globale Umweltbedrohungen durch internationale Zusammenarbeit erfolgreich eingedämmt werden können. In der neuen Ära der Raumfahrt braucht es dieselbe Weitsicht und Koordination, um unseren wichtigsten natürlichen Schutzschild – die Ozonschicht –dauerhaft zu bewahren.
https://ethz.ch





























































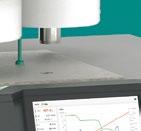























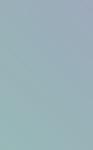






















Ölhaltige Schmierstoffe werden tonnenweise verbraucht. Im Falle eines Lecks kann ein einziger Liter bis zu einer Million Liter Grundwasser verseuchen. Forschende haben jetzt nachhaltige Dichtungen entwickelt, die frei von umweltschädigenden Stoffen wie PFAS und für wasserbasierte Schmiermittel geeignet sind. Die Dichtungen verfügen über tribologische Schichten und diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtungen.
www.fraunhofer.de
Forschende am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung haben gezeigt, dass sich eine hohe PFAS-Exposition negativ auf die zelluläre Immunantwort auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 auswirkt. Die Vermutung: Menschen mit hoher PFAS-Belastung könnten ein höheres Risiko für einen schlechten Krankheitsverlauf haben oder auch weniger gut auf Impfungen ansprechen.
www.ufz.de
Biomonitoring-Daten aus der Schweiz zeigen, dass 41 Prozent der gebärfähigen Frauen möglicherweise kritische PFAS-Konzentrationen im Blut aufweisen.
www.scnat.ch
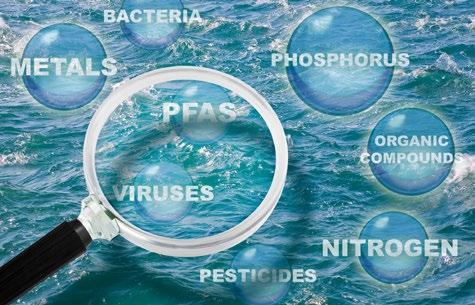
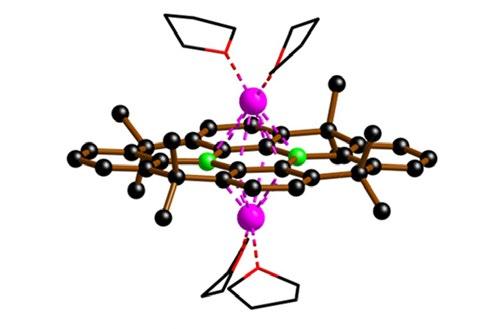
Zwei Bor-Atome (grün) sind in ein Gerüst aus Kohlenstoffatomen (schwarz) eingebettet. Die für die C-FSpaltung nötigen Elektronen stammen derzeit noch aus Lithium (pink), künftig aus elektrischem Strom. (Bild: Goethe-Universität Frankfurt)


Mit einem neuen Katalysator könnten sich per- und polyfluorierte organische Verbindungen gezielt abbauen lassen. Und dieser kommt ohne kostspielige oder giftige Schwermetalle wie Platin, Palladium oder Iridium aus. Für die Spaltung der C-F-Bindungen werden Elektronen benötigt, die der Katalysator sehr effizient überträgt. Als Quelle dieser Elektronen wurden Alkalimetalle wie Lithium verwendet. Die Forschenden arbeiten aber daran, stattdessen elektrischen Strom als Elektronenquelle zu nutzen, was zu einem deutlich einfacheren und effizienteren Verfahren führen wird.
Der Katalysator könnte auch in der Pharmaindustrie Anwendung finden, um den Fluorierungsgrad von Substanzen zu steuern. Sehr viele pharmakologische Substanzen enthalten Fluoratome, um die physiologische Stabilität zu erhöhen, die Wirkung zu optimieren oder die Wirkstoffaufnahme zu verbessern.
www.uni-frankfurt.de

Analytische Bestimmung von PFAS-Proben durch Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung nach der Filterung. (Bild: TUM)

Honigbienen sind die neuen Helfer bei der Untersuchung der Vorkommen von PFAS. Die Tiere schleppen die Chemikalien entweder über ihren Körper oder über Nektar und Pollen in den Bienenstock ein. Das lässt Rückschlüsse auf die räumliche und zeitliche bzw. saisonale Verteilung der Schadstoffe zu. Sammelbienen leben nur wenige Wochen, wodurch sich die aufgenommenen Chemikalien nur über kurze Zeit in ihrem Körper anreichern. Damit liefern die gemessenen Konzentrationen aktuelle Informationen über das Vorkommen der Umweltgifte.
www.uni-graz.at
In einer Analyse von 251 PFAShaltigen Anwendungen zeigte sich, dass in 16 Prozent ein Ersatz heute schon möglich ist und in weiteren 37 Prozent potenzielle PFAS-Alternativen bekannt sind.
www.scnat.ch
PFAS können unter anderem Leberschäden, Krebs und hormonelle Störungen verursachen. An der Technischen Universität München wurde jetzt eine effiziente Methode entwickelt, welche diese Stoffe aus dem Trinkwasser herausfiltert. Mittels metall-organischen Gerüstverbindungen können selbst extrem niedrige PFAS-Konzentrationen im Wasser aufgefangen werden.
www.tum.de
Forschenden des Katalyse-Exzellenzclusters UniSysCat ist es erstmals gelungen, eine theoretisch vorhergesagte Klasse von sogenannten Super-Lewis-Säuren herzustellen, die das Element Silizium sowie ein Halogenatom enthalten. Diese Verbindungen gehören zu den stärksten bisher hergestellten Lewis-Säuren und können auch sehr stabile chemische Bindungen aufbrechen. Damit sind sie von grossem Interesse für Recyclingprozesse und das Konzept der grünen Chemie, beispielsweise für den Abbau von PFAS. Das Besondere dieser Lewis-Säuren: Durch einen Kreislaufprozess innerhalb der Abbau-Reaktion werden sie nicht verbraucht und könnten daher künftig wie Katalysatoren wirken.
www.tu.berlin


Nach langjähriger Forschung ist es Mibelle, Lanzatech und dem Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) gelungen: Mithilfe moderner Biotechnologie wird aus CO2 ein palmölfreies Fett gewonnen. Dadurch soll Palmöl in Kosmetik und vielen anderen Produkten des täglichen Lebens ersetzt werden.
Palmöl ist aufgrund des hohen Ertrags der Ölpalme, seiner langen Haltbarkeit und seiner Hitzebeständigkeit ein unverzichtbarer Rohstoff für die Industrie. Ob in Lebensmitteln, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln oder Biokraftstoffen – Palmöl ist in vielen Produkten enthalten, die wir täglich verwenden.
Für den Anbau von Palmöl werden jedoch immer grössere Teile der Regenwälder abgeholzt. Dadurch werden viele Tier- und Pflanzenarten bedroht und grosse Mengen an gespeichertem CO2 freigesetzt. Palmöl aus zertifiziertem Anbau stellt sicher, dass der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammt. Doch nachhaltiger Palmölanbau kann den wachsenden Bedarf der Industrie langfristig nicht decken. Es braucht neue Lösungsansätze für die Zukunft.
Beim komplett neuen Lösungsansatz wird durch die Kombination zweier aufeinanderfolgender Fermentationsprozesse das Treibhausgas zu einer palmölfreien Fettmischung umgewandelt. Diese ähnelt mit ihrer Zusammensetzung dem Palmöl so sehr, dass sie zukünftig tropische Öle in zahlreichen Anwendungen ersetzen kann.

Im ersten Schritt wird das Gas, das als CO2 ausgestossen worden wäre, mithilfe des von Lanzatech entwickelten Gasfermentationsprozesses biotechnologisch zu Alkohol umgewandelt. Ein Prozess, der mit dem Bierbrauen vergleichbar ist. Nur dass hier als Ausgangsmaterial CO2 anstelle von Getreide verwendet wird.
Im zweiten Fermentationsverfahren, das massgeblich vom Fraunhofer IGB entwickelt wurde, wird der aus CO2 hergestellte
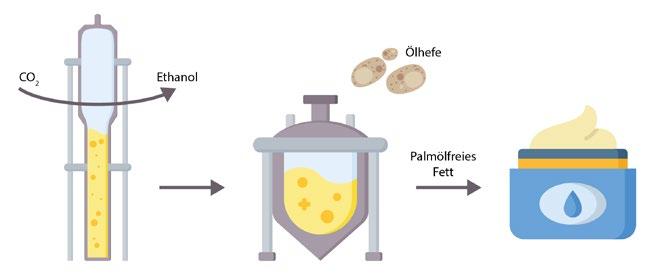
Zweistufige biotechnologische Umwandlung von CO 2 in palmölfreies Fett. (Grafik: Fraunhofer)

Alkohol von spezialisierten Öl-Hefen in die gewünschten Fette umgewandelt. Bei beiden Fermentationen werden nur natürlich vorkommende und nicht genveränderte Mikroorganismen eingesetzt. Das Endprodukt: ein vielseitig einsetzbares Fett von hoher Qualität, 100 Prozent palmölfrei und natürlich. Zudem besitzt es herausragende pflegende Eigenschaften, ein wichtiges Merkmal für kosmetische Produkte. «Diese Innovation ist ein Meilenstein für die Kosmetikindustrie. Damit setzen wir neue Massstäbe für die gesamte Branche», so Peter Müller, CEO der Mibelle Group.
Nach erfolgreichen Versuchen im Labor des Fraunhofer IGB und vielversprechenden Anwendungstests in den Labors der Mibelle Group starten die Partner jetzt mit der Herstellung der palmölähnlichen Fettmischung im Kilogramm-Massstab. Hierzu werden die Fermentationsprozesse am Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse (CBP) in Leuna (D),

Die CEOs von Mibelle Group und LanzaTech sowie der Institutsleiter des Fraunhofer IGB kamen zum Start des Fermentationsprozesses nach Leuna. (Bild: Fraunhofer)
einem Institutsteil des Fraunhofer IGB, schrittweise in einen grösseren Massstab übertragen.
«Nach erfolgreicher Forschung im Labor konnten wir nun mit der Entwicklung des Pilotprozesses beginnen», freut sich Susan -
ne Heldmaier, Leiterin Research & Technical Innovation bei der Mibelle Group. «Dies ist der wichtige nächste Schritt, an dessen Ende wir erste Mengen eines hochwertigen Fettes vorliegen haben. Dieses ermöglicht uns, Kosmetikprodukte zu entwickeln, die nicht nur einen Schutz für unsere Haut bieten, sondern auch zum Schutz der Umwelt beitragen. In Zukunft hoffen wir, mit Unterstützung unserer Rohstofflieferanten, immer mehr palmölbasierte Rohstoffe auf diese nachhaltige Lösung umstellen zu können.» Durch die neue Technologie leisten die drei Akteure einen Beitrag, um langfristig die Abholzung der Regenwälder zu reduzieren und eine nachhaltige Wertschöpfungskette aufzubauen.
www.mibellegroup.com www.lanzatech.com www.igb.fraunhofer.de
LEITMESSE FÜR INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG
ZÜRICH 2025
26. 27. NOVEMBER


FACHMESSE FÜR INDUSTRIELLE PUMPEN, ARMATUREN & PROZESSE
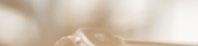










26. & 27. NOVEMBER 2025 I MESSE ZÜRICH









FÜR KOSTENLOSES MESSETICKET
BARCODE SCANNEN ODER AUF DER WEBSEITE DEN CODE 1405 EINLÖSEN! WWW.MAINTENANCE-SCHWEIZ.CH



FÜR KOSTENLOSES MESSETICKET

BARCODE SCANNEN ODER AUF DER WEBSEITE DEN CODE 1405 EINLÖSEN! WWW.PUMPS-VALVES.CH


Als erste Hochschule Europas hat die Universität Zürich Frauen zum Studium zugelassen und als erste der Welt einer Frau einen Doktortitel in Chemie verliehen. Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz ehrt die Hochschule nun als bedeutende historische Stätte der Chemie mit einem Chemical Landmark. An der Rämistrasse 59, wo heute das Asien-Orient-Institut beheimatet ist, hat die Universität Zürich Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Im Chemielabor im Keller der ehemaligen Kantonsschule erforschte Lydia Sesemann vor über 150 Jahren die chemischen Eigenschaften der Dibenzylessigsäure und entdeckte ein neues Verfahren, um Homotoluylsäure herzustellen. Beide Säuren sind wichtige Ausgangsstoffe für die Herstellung von Medikamenten. Am 15. Mai 1874 verlieh die «hohe philosophische Facultät» der Universität Zürich der Chemikerin den Doktortitel. Die gescheite Finnländerin, wie sie von Zeitgenossen genannt wurde, war die erste Frau der Welt, die in Chemie promovierte.

Pionierinnen an der Universität Zürich: die weltweit ersten Doktorinnen der Chemie. (Illustration: Gregor Forster & Monique Borer)
Für ihre Rolle als Wegbereiterin für die ersten Doktorinnen der Chemie wird die Universität Zürich von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) jetzt mit dem «Chemical Landmark» geehrt. Mit diesem Preis zeichnet die SCNAT Wirkungsstätten in der Schweiz aus, die für die Chemie historisch bedeutend sind. Dr. Sesemann blieb nicht die einzige Pionierin. Die Universität war zu dieser Zeit vielmehr ein Magnet für Chemikerinnen aus der ganzen Welt. Frauen, denen andernorts eine akademische Laufbahn verwehrt blieb, konnten hier ihren Wis-
sensdurst stillen. So promovierten unter anderem Rachel Lloyd als erste Amerikanerin 1886, Olga Wohlbrück als erste Deutsche 1887, Geertruida W. P. van Maarseveen als erste Niederländerin 1897 und Edith E. Humphrey als erste Britin 1901 in Zürich.
In vielen Ländern war es Frauen verboten, ohne Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemanns zu reisen. Um in der Schweiz studieren zu können, heirateten einige überstürzt oder gingen eine Scheinehe ein. Auffallend viele Studentinnen stammten aus dem Zarenreich, das sich
Gefahrstofflager Münchenstein
3’000 m2 Gesamtlagerfläche im Dreispitz-Areal
1’000 Palettenplätze – Ex-Schutz-Zone für Gefahrgutklassen 2 & 3
1’400 Palettenplätze – für weitere Gefahrstoffe & Gefahrgüter
im gesellschaftlichen Umbruch befand. Oft waren die Frauen politisch aktiv und hatten auch in Zürich Kontakt zu revolutionären Kreisen. 1873 erliess der Zar deshalb ein Dekret, das es russischen Frauen verbot, in Zürich zu studieren. Die meisten verliessen daraufhin die Stadt. Lydia Sesemann, deren Heimatland damals zum russischen Reich gehörte, blieb und schloss ihre Doktorarbeit ab. Ihre Dissertation sei zweifellos eine der besten Arbeiten der Fakultät, befand einer ihrer Doktorväter.
Kaum Schweizerinnen Während ausländische Studentinnen an die Universität Zürich und andere Schweizer Hochschulen kamen, blieben Schweizerinnen zunächst grösstenteils aussen vor. Denn um studieren zu können, brauchten sie eine Matura. Der Besuch eines Gymnasiums war Mädchen aber nicht erlaubt. Um trotzdem an einer Universität zugelassen zu werden, mussten sie teure Privatkurse besuchen und eine extra Aufnahmeprüfung ablegen.
https://scnat.ch
Kontakt & Anfragen
Marcel Läubli, Leitung BU Logistik & Betriebsleitung mlaeubli@felixtransport.ch, +41 61 766 10 02
Fabian Felix, Geschäftsführung ffelix@felixtransport.ch, +41 61 766 10 03

Weitere Informationen zum Gefahrstofflager

Hochdruck-Reaktoren – mit und ohne PTFE-Auskleidung – Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy
Hochdruck-Reaktoren - mit und ohne PTFE-Auskleidung - Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy
Der Spezialist für Antriebssysteme im Bereich der Miniaturund Mikroantriebstechnik Faulhaber stärkt seine Marktpräsenz in Asien mit einem neuen Vertriebsstandort in Indien. Am 8. August 2025 wurde das Büro in Pune offiziell eröffnet.
«Der neue Standort ermöglicht es uns, noch näher an unseren Kunden in Indien zu sein – sowohl geografisch als auch technologisch», betont Sashin Kurlekar, der als Regional Sales Manager gemeinsam mit einem lokalen Team den indischen Markt betreut und der auch die Leitung des neuen Standorts übernommen hat.
Dort werden Vertriebsingenieure und Motion-Control-Exper-

ten die technische Beratung und den lokalen Support realisieren. In Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Kunden wird Faulhaber seine Position insbesondere in den Märkten Medizintechnik, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt stärken – allesamt Sektoren, in
denen die hochpräzisen Kleinantriebe eine zentrale Rolle spielen. Dabei gewinnen individuelle, schlüsselfertige Antriebslösungen für komplexe Anwendungen zunehmend an Bedeutung.
Strategisch eingebettet ist der Standort Punein die Vertriebsregion Asien-Pazifik unter der Führung von Managing Director Vester Tan. Alle Produkte werden aus den europäischen Werken geliefert.
Faulhaber SA CH-6980 Croglio info@faulhaber.ch www.faulhaber.ch
Dinamiqs, ein Unternehmen der Siegfried Gruppe, hat kürzlich im Bio-Technopark Zürich eine neue cGMP-Produktionsanlage eingeweiht. Die neue Anlage ermöglicht die vollständige Herstellung von viralen Vektoren für Zellund Gentherapeutika, vom Moleküldesign bis zur aseptischen Abfüllung des Arzneimittels. Seit dem dritten Quartal 2024 sind zudem Labore mit umfangreicher Ausstattung für die Prozessentwicklung und Qualitätskontrolle in Betrieb. Siegfried will damit seine Präsenz im wachsenden Markt für Zell- und Gentherapien ausbauen. Zur Feier der Eröffnung gab Dinamiqs zudem eine strategische Zusammenarbeit mit Seal Therapeutics bekannt, um die Entwicklung und Herstellung einer Gentherapie für eine schwere Form der Muskeldystrophie zu unterstützen.

Marcel Imwinkelried, CEO von Siegfried: «Seit der Übernahme des Start-ups 2023 ist es unser Ziel, die Fähigkeiten von Dinamiqs zu skalieren und das Unternehmen als führenden CDMO im Bereich der Zellund Gentherapien zu etablieren. Mit der Eröffnung der neuen Produktionsanlage und der steigenden Kundennachfrage sind wir auf einem sehr guten Weg, dies zu erreichen.»
Die neue 2500 m² grosse cGMP-Anlage vereint Forschung und Entwicklung, klini -
sche und kommerzielle Produktion viraler Vektoren unter einem Dach und bietet eine Produktionskapazität von bis zu 1000 Litern pro Charge. Die Anlage verfügt über eine modulare, räumlich getrennte Bauweise sowie modernste Einweg-Technologien. Dadurch sind höchste Qualitätsstandards, kurze Durchlaufzeiten sowie die vollständige Einhaltung der GMP-Richtlinien sichergestellt.
www.siegfried.ch
Hochdruck-Reaktoren
mit und ohne PTFE-Auskleidung
Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy
Hochdruck-Reaktoren

Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy
Mini-HochdruckReaktoren – mit und ohne PTFE-Auskleidung – Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy
Hochdruck-Reaktoren
Hastelloy
Mini - Hochdruck-Reaktoren - mit und ohne PTFE-Auskleidung - Edelstahl, Edelstahl/Hastelloy, Hastelloy -

Inwendig metallfreie (nur PTFE)
Inwendig metallfreie
Inwendig metallfreie (nur PTFE) Hochdruckreaktoren

selbst



■ Infostelle SCV
Schweizerischer Chemieund Pharmaberufe Verband Postfach 509
CH-4005 Basel info@cp-technologe.ch www.cp-technologe.ch
■ Präsident Kurt Bächtold
Bodenackerstrasse 15F CH-4334 Sisseln praesident@cp-technologe.ch
CPT-Lernende bei Lonza in Visp
Der SCV heisst die neuen Lernenden herzlich willkommen und wünscht ihnen zum Start in das 1. Lehrjahr viel Erfolg.
Erwachsene

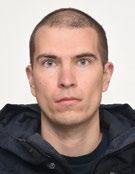
■ Höhere Fachprüfung Chemietechnologe
Remo Kleeb weiterbildung@cp-technologe.ch
■ Termine Alle Termine online anschauen: www.cp-technologe.ch

Im Namen des Vorstandes der SCV-Sektion Oberwallis wünsche ich allen Lernenden einen guten Start in die Lehre als Chemie- und Pharmatechnologen (CPT). Wenn alles klappt, werdet ihr nach 3 Jahren mit viel neuem Fachwissen ausgestattet sein, um euch im Berufsleben zu beweisen. Wenn ihr neugierig und offen für neues seid, wird die Ausbildung im nu vorüber sein.
Jugendliche


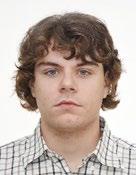

Am 12. September trafen sich 7 Mitglieder der Sektion Oberwallis, um sich in die Kunst des Curlings einweihen zu lassen.
Nach dem wir offenlegen mussten, ob wir Links- oder Rechtshänder sind, bekam je -






Michael Wyer Präsident Sektion Oberwallis




der ein Paar schöne Schuhe mit speziellen Sohlen. Eine Sohle war glatt und die andere war mit einem abnehmbaren Gummiüberzug versehen. Was das auf sich hatte, merkten wir bald. Zum Schluss bekam jeder noch einen Besen in die Hand gedrückt und schon ging es los.
Wir wurden von unserm Instrukteur auf die Tücken auf dem Eis hingewiesen und durften anschliessend vorsichtig auf die kalte Fläche treten. Bald wurde uns klar, wofür der Gummiüberzug benötigt wird. Der Gummi ermöglichte es uns, sicher auf einem Bein zu
stehen, während der andere Schuh auf dem Eis gleitet. Nachdem wir unseren Rumpf etwas anspannten und den Besen als weiteren Stützpunkt einzusetzen lernten, konnten wir relativ sicher über das Eisfeld, den sogenannten «Rink», laufen.

Das Eis war nicht komplett glatt, wie man es vom Eislaufen kennt. Auf der Oberfläche waren überall Wassertropfen verteilt. Die «Pebbles», wie die Wassertropfen genannt wer-
Wo der Spass ins Rollen kommt
Liebe Mitglieder und Freunde des SCV, wir laden Euch herzlich ein zu unserem Bowling-Event 2025. Gemeinsam wollen wir einen sportlich-geselligen Abend verbringen – mit viel Spass, Bewegung und einem gemütlichen Ausklang.
Liebe Mitglieder und Freunde des SCV, wir laden Euch herzlich ein zu unserem BowlingEvent 2025.
Gemeinsam wollen wir einen sportlich-geselligen Abend verbringen – mit viel Spass, Bewegung und einem gemütlichen Ausklang.
�� Anlassdetails
– Datum: Mittwoch, 17. Dezember 2025
den, sind dazu da, den Stein einfacher über das Feld gleiten zu lassen. Nachdem wir den Abstoss etwas geübt hatten, durften die Teamkollegen mit dem Besen das Eis zum Schmelzen bringen. Uns wurde erklärt, dass durch das Fegen die oberste Eisschicht mit den Pebbles damit zum Schmelzen gebracht werden und so der Stein weiter über das Eis gleiten kann. So könnten wir jene Steine, die zu langsam unterwegs waren, noch etwas weiter «curlen» lassen. Alle Mitglieder konnten die Grundtechniken des Curlings erlernen und sind jetzt bereit, bei ihrem nächsten Einsatz direkt loszulegen. Nach dem Plausch kam der gesellige Teil: Hierfür gingen wir einen Stock höher ins Buf-

fet, wo wir einen feinen Apéro und eine herzhafte «Gommer Cholera» geniessen durften. Es war wieder ein gelungener Abend und ich danke allen, die dabei waren, für ihre Zeit und freue mich auf das nächste treffen.
Michael Wyer Präsident Sektion Oberwallis

(Symbolbild: Shutterstock)
– Treffpunkt: Restaurant Vicino, Rössligasse 1, 4132 Muttenz
– Beginn: 18.00 Uhr
– Ende: ca. 20.30 Uhr
�� Teilnehmende
– SCV-Mitglieder aus allen Sektionen sind herzlich willkommen
�� Kosten (inkl. Apéro und Bowling)
– Lernende gemeldet beim SCV: kostenlos
– Mitglieder des SCV: kostenlos
– Nicht-Mitglieder: Fr. 10.– pro Person
�� Anmeldung
Bitte meldet Euch bis spätestens 8. Dezember 2025 an bei: Felice Bertolami
�� WhatsApp/SMS:
+41 (0)78 799 64 90
�� E-Mail: felice.bertolami@gmx.ch
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme und einen schwungvollen Abend!
Herzliche Grüsse Sektion Nordwestschweiz


Auf 3000 m² Fläche bieten wir die sichere Lagerung von Gefahrstof-
fen und Gefahrgut nach höchsten Sicherheitsstandards an.

Unser Dienstleistungsangebot
– 1000 Palettenstellplätze für Gefahrgutklassen 2 und 3 in einer Ex-Schutz-Zone
– 1400 Palettenstellplätze für weitere Gefahrgutklassen (u.a. 4, 6.1, 8, 9) und Gefahrstoffe
– Handling, Kommissionierung und Inventur Ihrer Güter
– Modernes Lagerverwaltungssystem
Ihre Vorteile
– Optimale Verkehrsanbindung im Dreiländereck CH/DE/FR – Sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Chemikalien – Professionelles Handling durch geschulte Logistik-Experten
Mit der TAFS (Total Air Filtration Solution) gehen Filterhersteller wie Ärzte an den «Patienten Luftqualität im Reinraum» heran: erst eine standortspezifische Analyse mit anschliessender «Diagnose» des Kontaminationsprofils, dann als «Therapie» eine darauf abgestimmte Auslegung des Filtersystems. Nach diesem Verfahren lässt sich ein Filtersystem spezifisch für einen bestimmten Reinraum bzw. für

eine bestimmte Reinraumumgebung auslegen, um zuverlässig alle relevanten luftgetragenen Verunreinigungen (AMC) einschliesslich flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) effektiv zurückzuhalten. Luftfiltersysteme zur gezielten Abscheidung von AMCs lassen sich heute teilweise massschneidern, mindestens jedoch konfektionieren. Das erhöht die Energieeffizienz und mindert unerwünschte
Kompaktwaagen verbinden einfache Handhabung und zuverlässige Leistung mit einem platzsparenden Design und können mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten – bei präzisen Resultaten in einem grossen Wägebereich. Der maximale Wägebereich liegt, je nach Waagen-Typ, beispielsweise bei 220 g, 620 g, 1200 g, 2200 g oder 5200 g («CX-Serie»). Die Ablesbarkeit beträgt 0,1 g bei einer Linearität von ±0,2 g und ei -
ner Reproduzierbarkeit von ±0,2 g.
Die Abmessung der Edelstahl-Wägeplatte beträgt 128×142 mm. Durch ein stabiles ABS-Gehäuse und rutschfeste Gummifüsse werden solche Waagen besonders robust und eignen sich damit für verschiedenste Anwendungen – vom schnellen Wiegen bis hin zum Ansetzen einfacher Rezepturen mittlerer und grösserer Volumina. Eine Hintergrundbeleuchtung kann das LCD-Display einer Kompakt-

Gefahrguttransport – alles aus einer Hand
Mit unseren 70 LKWs übernehmen wir Ihre Gefahrguttransporte innerhalb der Schweiz sowie im nahen Ausland. Die Lagerung und der Transport aus einer Hand garantieren Ihnen maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen: www.felixtransport.ch
Felix Transport AG
Marcel Läubli
Leitung BU Logistik/ Betriebsleitung
Tel. +41 61 766 10 02 mlaeubli@felixtransport.ch
Auswirkungen auf die Umwelt. Insbesondere der TAFS-Ansatz sorgt für geringe Anfangsdruckverluste, minimiert den Energieverbrauch und reduziert den ökologischen Fussabdruck durch wiederverwendbare Systemkomponenten.
GE Technology Inc. (Getek) CN-709015 Tainan City sales@getek.com.tw www.ge-tek.com
waage auch unter mittleren Lichtverhältnissen, wie in manchen Abzügen, gut lesbar machen. Mit einer externen Justierfunktion, einem Überlastschutz und einer Batteriewechselanzeige läuft das Gerät noch dazu ausgesprochen energieeffizient.
Roth AG CH-4144 Arlesheim info@carlroth.ch www.carlroth.ch

Die präzisen Differenzdruck-Messumformer der P 26 und P 34 Serie von Halstrup-Walcher erreichen in kleinen Druckbereichen eine hohe Messgenauigkeit und Stabilität. Mit diesen High-End-Transmittern können beispielsweise die Druckkaskaden in Reinräumen oder in sauberen Produktionszonen kontinuierlich überwacht werden. Dies dient sowohl der Produktionsqualität als auch dem Personenschutz. Dank des induktiven Messprinzips sind sowohl Langzeitstabilität als auch ein adäquates Temperaturverhalten gewährleistet. In Kombination mit Wirkdruckgebern können die Druckmessumformer auch zur Volumenstrommessung eingesetzt werden.


Wasseranalytik ohne Labor DIMA-easyTOC mit DIMA-easyTNb

Kompakt – Leistungsstark – Preiswert
TOC/TNb-Kompaktanalysator bei geringem Probenaufkommen
Schnelle Analysen bei einfachster Handhabung Sie benötigen lediglich eine 230V-Steckdose
DIN-konform nach EN 1484 und EN 12260 www.dimatec.de
Analysentechnik GmbH
DIMATEC
Analysentechnik GmbH DE-79112 Freiburg (TB-Südwest)
Tel. +49 (0) 76 64 / 50 58 605 essen@dimatec.de www.dimatec.de
Sie erhalten die DIMATEC-Systeme auch bei unserem Schweizer Vertriebspartner ensola AG 8902 Urdorf
Tel. +41 (0)44 870 88 00 info@ensola.com www.ensola.com
Produkteigenschaften:
– hochpräzise Messumformer für kleinste Messbereiche von ± 10 Pa –
Messgenauigkeit je nach Ausführung 0,2 % oder 0,5 % FS – hohe Überlastsicherheit durch eingebautes Ventil – integrierte zyklische Nullpunktkorrektur für höchste Langzeitstabilität
Swissfilter AG
CH-5037 Muhen info@swissfilter.ch www.swissfilter.ch
ROTAVER Composites AG Kunststoffwerk
CH-3432 Lützelflüh 034 460 62 62 www.rotaver.ch
Erdverlegte Tanks begeh- oder befahrbar
Im Fachhandel erhältlich oder ab Werk
Regen- & Trinkwasser bis 200m3 Pelletslagerung bis 175m3
Retentionstanks
Abwassertanks Sammelgruben Pumpschächte Kleinkläranlagen swiss made Wasser
Oeltanks


Seit 20 Jahren führt Socorex, Ecublens, ISO-17025-akkreditierte Kalibrierungen durch und stellt entsprechende, international anerkannte Zertifikate aus.
Diese Norm betrifft das Qualitätsmanagement von Prüf- und Kalibrierlaboren bei der Durchführung von Umwelt-, Lebensmittel-, chemischen, kosmetischen, klinischen oder pharmazeutischen Analysen sowie von Materialprüfungen. Die ISO-17025-Akkreditierung für Socorex wurde von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS)

für eine präzise und normgerechte Durchführung gemäss einschlägigen Qualitätsstandards vorgenommen.
Das Laborteam bietet seinen Service für alle auf dem Markt befindlichen Marken an. Während die übliche Bearbeitungszeit zwischen drei und fünf Werktagen liegt, ermöglicht der «Express-Service» eine effiziente Durchführung in nur 48 Stunden.
Socorex verfügt über Expertise in der Flüssigkeitsdosierung. Darüber hinaus bietet das «Socorex Service
Die Busch Group präsentiert am 26. und 27. November auf der Pumps & Valves 2025 in Zürich, Fachmesse für industrielle Pumpen, Armaturen und Prozesse, ihre beiden Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions mit ihren unterschiedlichen Anwendungen in Industrie, Forschung und Labor (Halle 4, Stand L28).
Zum Beispiel mit der neuesten Generation von Scroll-Vakuumpumpen: Sie sind ölfrei, besonders leise und energieeffizient. Damit eignen
sie sich für analytische Geräte, Lecksuchsysteme sowie als Vorpumpe für Turbomolekular-Vakuumpumpen – optional auch in Atex-zertifizierter Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche. Als weiteres Highlight rücken kompakte, mobile Turbomolekular-Vakuumpumpeneinheiten in den Fokus. Sie schaffen Ultrahochvakuum in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand, sind flexibel konfigurierbar, einfach zu bedienen, mobil und in zwei Baugrössen verfügbar. Solche Vakuumpumpeneinheiten sind ins-

Grundlegende photometrische Parameter lassen sich unter Verwendung sogenannter diskreter Analysatoren mit hoher Effizienz bestimmen, doch das volle Potenzial wird erst mit standardisierten Reagenzien wirklich ausgeschöpft. Mit diskreten Analysatoren kann eine Automatisierung der Bestimmung grundlegender photometrischer Parameter erfolgen. Es ist jedoch ein hoher Aufwand zur Herstellung von Proben und Referenzstandards bzw. entsprechender Verdünnungen einzukalkulieren.

Auch verursacht das Mischen von Reagenzien Fehler und verschlechtert die Reproduzierbarkeit. Hier liegt der Ansatzpunkt für standardisierte Reagenzien, die auf anerkannte Standards rückführbar sind (z.B. NIST, National Institute of Standards and Technology, USA). Denn solche vorgefertigten Reagenzien eliminieren Vorbereitungsfehler und sparen wertvolle Laborzeit beim Wechsel von Methode zu Methode. Somit steigern sie die Produktivität, etwa für die Bestimmung von Ammonium, Chlorid,
Center» von Standard-Reparaturen bis hin zu Kalibrierungen Wartungsarbeiten für Pipetten und Dispenser an. Das Dienstleistungsspektrum schliesst massgeschneiderte Servicepläne ein, die auf die Anforderungen des jeweiligen Laborbetriebs abgestimmt sind.
Socorex Isba SA CH-1024 Ecublens socorex@socorex.com www.socorex.com
besondere in Universitäten und Forschungseinrichtungen gefragt. Neue trockene Klauen-Vakuumpumpen bieten sich für das Verpacken, Spannen, Heben, Fördern oder Pick-and-Place an. Das System schafft stabile Vakuumniveaus im Prozess und eignet sich auch als energieeffizienter Ersatz für Druckluftinjektoren.
Busch AG CH-4312 Magden www.buschvacuum.com www.buschgroup.com
Nitrat und Nitrid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat. Ein Plus an Effizienz lässt sich herausholen, wenn solche StandardReagenzien auf bestimmte Analysegeräte hin entwickelt wurden. Bewährte Methoden können dann direkt (weiter)genutzt werden.
Spetec GmbH D-85435 Erding info@spetec.de www.spetec.de

ANTRIEBSTECHNIK ANTRIEBSTECHNIK





Ihr Spezialist für Anlagen und Prüfmittel in der ZfP www.helling.de

Helling GmbH Spökerdamm 2 D-25436 Heidgraben Tel.: +49 4122 922-0 info@helling.de


ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE


Elektromotorenwerk
Brienz AG

Mattenweg 1 CH-3855 Brienz Tel. +41 (0)33 952 24 24 www.emwb.ch



ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE




FAULHABER SA
Croglio · Switzerland Tel. + 41 91 611 31 00 www.faulhaber.com



Rötzmattweg 105 CH-4600 Olten Tel. +41 (0)62 207 10 10
IEP Technologies GmbH info.iep.ch@hoerbiger.com - www.ieptechnologies.com

ABWASSERBEHANDLUNG ABWASSERBEHANDLUNG

Ihr Partner für individuelle Abwasserbehandlung FLONEX AG sales@flonex.ch CH-4127 Birsfelden www.flonex.ch Sternenfeldstrasse 14 Tel. +41 61 975 80 00
ALLGEMEINE LABORMESSUND ANALYSEGERÄTE
ALLGEMEINE LABORMESSUND ANALYSEGERÄTE

Ihr Partner für erfolgreiche Laboranalytik
Analytik Jena GmbH+Co. KG info@analytik-jena.com • w ww.analytik-jena.de
TITRATION

Metrohm Schweiz AG Industriestrasse 13 CH-4800 Zofingen
Schweiz AG

Telefon +41 62 745 28 28

Telefax +41 62 745 28 00
E-Mail info@metrohm.ch www.metrohm.ch

ANALYTIK UND ÖKOTOXIKOLOGIE
ANALYTIK UND ÖKOTOXIKOLOGIE

IES Ltd Benkenstrasse 260 4108 Witterswil
Ihr Auftragsforschungslabor in Witterswil.
Tel. + 41 (0)61 705 10 31 info@ies-ltd.ch www.ies-ltd.ch

Industrie Neuhof 30 3422 Kirchberg
APPARATE-, ANLAGENUND MASCHINENBAU

APPARATE-, ANLAGENUND MASCHINENBAU





Theodorstr. 10 | D-70469 Stuttgart Tel +49 711 897-0 | Fax +49 711 897-3999 info@coperion.com | www.coperion.com

APPARATEBAU ANLAGEN- UND APPARATEBAU


Rohrleitungsbau AG Anlagenbau – Apparatebau

Helblingstrasse 10 4852 Rothrist Telefon 062 785 15 15 info@fischer-rohrleitungsbau.ch www.fischer-rohrleitungsbau.ch
ANLAGEN- UND APPARATEBAU





ARMATUREN

ASEPTISCHE VENTILE

ANLAGEN- UND APPARATEBAU ANLAGEN- UND APPARATEBAU

Anlagenbau AG
GEMÜ Vertriebs AG Schweiz Telefon: 041 799 05 55
E-Mail: vertriebsag@gemue.ch · www.gemue.ch


Rohrleitungsbau AG
Tel. +41 34 447 70 00 Fax +41 34 447 70 07 info@anlagenbau.ch www.anlagenbau.ch
Ihr Partner für ProzesstechnikANLAGEN- UND APPARATEBAU

Grosswiesen 14 8044 Gockhausen/Zürich




Anlagenbau – Apparatebau
Helblingstrasse 10 4852 Rothrist Telefon 062 785 15 15 info@fischer-rohrleitungsbau.ch www.fischer-rohrleitungsbau.ch ANLAGEN- UND APPARATEBAU








CHROMATOGRAPHIESÄULEN
Swit erland
eS v n g
Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach
Tel. +41 61 971 83 44 Fax +41 61 971 83 45 info@sebio.ch www.sebio.ch
DÜSEN DÜSEN
DICHTUNGEN
DICHTUNGEN
liquitec AG
Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg

T +41 55 450 83 00
F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
DIENSTLEISTUNGEN
DIENSTLEISTUNGEN
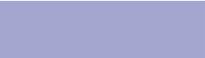
DACHSER Spedition AG Regional Offi ce Switzerland Althardstrasse 355 CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch
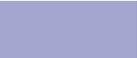

Spraying Systems Switzerland AG Eichenstrasse 6 · 8808 Pfäffikon Tel. +41 55 410 10 60 info.ch@spray.com · www.spray.com/de-ch
ERP-SOFTWARE ERP-SOFTWARE


casymir schweiz ag Fabrikmattenweg 11 CH-4144 Arlesheim www.casymir.ch kontakt@casymir.ch Tel. +41 61 716 92 22



DIENSTLEISTUNGEN

Weidkamp 180 DE-45356 Essen
Technical Laboratory Services Europe GmbH & Co. KG
Tel. +49 201 8619 130 Fax +49 201 8619 231 info@teclabs.de www.teclabs.de
Herstellerübergreifender Service für HPLC und GC
DISPENSER / PIPETTEN
DISPENSER / PIPETTEN
ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE
EXPLOSIONSSCHUTZ



Socorex Isba S A • Champ-Colomb 7a • 1024 Ecublens socorex@socorex.com • www.socorex.com
DOSIERPUMPEN PUMPEN


Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch DOSIERPUMPEN


KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab PUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Pumpen | Ersatzteile | Instandhaltung www.rototec.ch
Luzernstrasse 224C| CH-3078 Richigen +41 31 838 40 00 | info@rototec.ch

FILTER

FILTER FILTER

Bachmannweg 21 CH-8046 Zürich T. +41 44 377 66 66 info@bopp.ch www.bopp.com


FILTER

Sefiltec AG · Separation- und Filtertechnik Engineering Haldenstrasse 11 · CH-8181 Höri · Tel. +41 43 411 44 77 Fax +41 43 411 44 78 · info@sefiltec.com · www.sefiltec.com

Trenntechnik Siebe + Filter Metallgewebe
FILTERPATRONEN FILTERPATRONEN
TECmetall 5436 Würenlos T +41 44 400 12 80 info@tecmetall.ch www.Lochblech.ch www.shopmetall.ch


iFIL AG
Industriestrasse 16 CH-4703 Kestenholz www.ifil.eu.com info@ifil.eu.com

FITTINGS FITTINGS

Rötzmattweg 105 CH-4600 Olten Tel. +41 (0)62 207 10 10
IEP Technologies GmbH info.iep.ch@hoerbiger.com - www.ieptechnologies.com


EXPLOSIONSSCHUTZ, EX-GERÄTE (ATEX) PROZESSAUTOMATION
Längfeldweg 116 · CH-2504 Biel/Bienne Telefon +41 32 374 76 76 · Telefax +41 32 374 76 78 info@ch.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.ch
FABRIKPLANUNG
Prozesse – Anlagen – Fabriken Konzepte – Planung – Realisierung www.assco.ch ∙ info@assco.ch
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)



• Photometer • Messgeräte • Reagenzien

Hach Lange GmbH Rorschacherstr. 30 a 9424 Rheineck Tel. 084 855 66 99 Fax 071 886 91 66 www.ch.hach.com

FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN
FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION SWISS EXCELLENCE SINCE


Hagmattstrasse 19


FLÜSSIGKEITSPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com
FÜLLSTAND FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com

GASE / GASVERSORGUNG GASE/GASVERSORGUNG
INNOVATIV, NACHHALTIG, FLEXIBEL!
H. Lüdi + Co. AG Moosäckerstrasse 86 8105 Regensdorf P +41 44 843 30 50 E sales@hlag.ch W www.hlag.ch
GASGEMISCHE, SPEZIALGASEGASGEMISCHE, SPEZIALGASE
Messer Schweiz AG Seonerstrasse 75 5600 Lenzburg
Tel. +41 62 886 41 41 · info@messer.ch · www.messer.ch


Industrie ogistik
Maschinentransporte
Kranarbeiten
De- und Remontagen
Schwertransporte
Schwergutlager


Kälte- und Klimaanlagen
Ostringstrasse 16 4702 Oensingen
Tel. +41 62 388 06 06 Fax +41 62 388 06 01 kaelte@pava.ch www.pava.ch
KOMPRESSOREN 100% ÖLFREI
KOMPRESSOREN 100% ÖLFREI


KAESER Kompressoren AG
KREISELPUMPEN PUMPEN

Grossäckerstrasse 15 8105 Regensdorf Tel. +41 44 871 63 63 Fax +41 44 871 63 90 info.swiss@kaeser.com www.kaeser.com


Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER
KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER
AUCH FÜR ZERTIFIZIERTE PROZESSE MIT INTEGRALER DOKUMENTATION, +41 41 420 45 41 gabler-container.ch

LABORBAU / LABOREINRICHTUNGEN GASE/GASVERSORGUNG
INNOVATIV, NACHHALTIG, FLEXIBEL!
LABORBEDARF
committed to science
Ihr Vollversorger für Laborbedarf & Laborgeräte
LABORBEDARF LABORBEDARF
instruments

LABOR- / MEDIKAMENTENUND BLUTKÜHLSCHRÄNKE

LABOR- / MEDIKAMENTENUND BLUTKÜHLSCHRÄNKE
LOGISTIK
Wir vertreiben und bieten Service für Laborschränke der folgenden Marke: LOGISTIK
HETTICH AG | 8806 Bäch SZ | +41 44 786 80 20 sales@hettich.ch | www.hettich.ch Succursale Suisse Romande (Canton de Vaud) Tél. +41 44 786 80 26
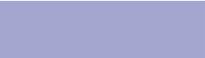

LOHNABFÜLLUNG
LOHNABFÜLLUNG
DACHSER Spedition AG Regional Offi ce Switzerland Althardstrasse 355 CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch
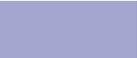

MEMBRANPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab PUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Industrie Allmend 36 4629 Fulenbach +41 62 387 74 35 printsupplies@fischerpapier.ch
LOHNABFÜLLUNG

Inserat_FiP_ChemieExtra_60x22_DE.indd 1


Mischwerk Trockenmischungen Flüssigmischungen www.mmb-baldegg.ch

MAGNETPUMPEN PUMPEN

H. Lüdi + Co. AG Moosäckerstrasse 86 8105 Regensdorf
P +41 44 843 30 50 E sales@hlag.ch W www.hlag.ch
HUBERLAB. AG Industriestrasse 123 CH-4147 Aesch T +41 61 717 99 77 info@huberlab.ch www.huberlab.ch




DICHTUNGEN
MAGNETRÜHRER
liquitec AG

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg
T +41 55 450 83 00 F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
MASSENSPEKTROMETRIE CHROMATOGRAPHIESÄULEN

MEMBRANEN MEMBRANEN

Tel. +41 31 972 31 52 Fax +41 31 971 46 43 info@msp.ch www.msp.ch
Gold-coated membranes (PC/PET) and Aluminum-coated membranes (PET) for: - Particle (Pharmaceuticalsanalysis & Microplastics) - Asbestos analysis (VDI 3492) www.i3membrane.com lab@i3membrane.de
Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


MESSTECHNIK MESSTECHNIK

VEGA Messtechnik AG Barzloostrasse 2 · 8330 Pfäffikon ZH www.vega.com · info.ch@vega.com
MIKROBIOLOGIE MIKROBIOLOGIE
Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach
10.01.20 11:19

Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach Tel. +41 61 971 83 44 Fax +41 61 971 83 45 info@sebio.ch www.sebio.ch vreS n g Sc encein Switzerland PIPETTENKALIBRATIONEN PIPETTENKALIBRATIONEN


Wartung, Reparatur und Kalibration Ihrer Pipetten und anderen Volumenmessgeräten Akkreditiertes Kalibrierlabor Labor Service GmbH Eichwiesstrasse 2 CH-8645 Rapperswil-Jona info@laborservice.ch Tel. +41 (0)55 211 18 68 www.laborservice.ch


Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com

PROZESSAUTOMATION PROZESSAUTOMATION
Längfeldweg 116 · CH-2504 Biel/Bienne Telefon +41 32 374 76 76 · Telefax +41 32 374 76 78 info@ch.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.ch
RÜHRTECHNIK RÜHRTECHNIK

Anlagenbau AG Ihr Partner für Prozesstechnik
Industrie Neuhof 30 3422 Kirchberg


Tel. +41 34 447 70 00 Fax +41 34 447 70 07 info@anlagenbau.ch www.anlagenbau.ch
SCHAUGLASARMATUREN FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

PUMPEN
CH-4314 Zeiningen • infoo@almatechnik-tdf.ch • ww w.almatec hnik-tdf.ch
PUMPEN PUMPEN


PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil SWITZERLAND
SCHAUGLASLEUCHTEN FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

Pumpen Rührwerke
4153 Reinach BL Tel. +41 61 711 66 36 alowag@alowag.ch www.alowag.ch PUMPEN




PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil SWITZERLAND
FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

SCHEIBENWISCHER FÜR SCHAUGLÄSER

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch PUMPEN


Pumpen | Ersatzteile | Instandhaltung www.rototec.ch
Luzernstrasse 224C| CH-3078 Richigen +41 31 838 40 00 | info@rototec.ch PUMPEN
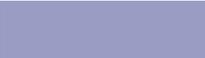


AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER


PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
ARMATUREN
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil SWITZERLAND
liquitec AG
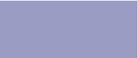
SDD GmbH Spichermatt 8 CH-6365 Kehrsiten +41 41 612 17 60 info@sdd-pumpen.ch www.sdd-pumpen.ch



ROTATIONSVERDAMPFER DOSIERPUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
RÜHRTECHNIK PUMPEN



Pumpen Rührwerke
Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg

T +41 55 450 83 00 F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
TECHNISCHE GLASBLÄSEREI / LABORFACHHANDEL

TECHNISCHE GLASBLÄSEREI / LABORFACHHANDEL
● Technische Glasbläserei
● Reparaturen
● Spezialanfertigungen
● Laborfachhandel
– LabWare – Lab Instruments – Liquid Handling
Glaswaren www.glasmechanik.ch info@glasmechanik.ch
TEMPERATURMESSTECHNIK TEMPERATURMESSTECHNIK
Thermocontrol GmbH
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com
4153 Reinach BL Tel. +41 61 711 66 36 alowag@alowag.ch www.alowag.ch
SICHERHEITSSCHRÄNKE
SICHERHEITSSCHRÄNKE NACH EN 14470-1/-2

NACH EN 14470-1/-2


asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz
asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz


Gewerbe Brunnmatt 5, CH-6264 Pfaffnau
Gewerbe Brunnmatt 5, CH-6264 Pfaffnau Telefon 062 754 04 57, Fax 062 754 04 58
Telefon 062 754 04 57, Fax 062 754 04 58 info@asecos.ch, www.asecos.ch
SINGLE-USE


Tel. +41 (0)44 740 49 00 Fax +41 (0)44 740 49 55 info@thermocontrol.ch www.thermocontrol.ch
TEMPERIERSYSTEME
TEMPERIERSYSTEME

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Strasse 1 77960 Seelbach / Germany










Tel. +49 (0) 7823 51-0 · info.de@julabo.com · www.julabo.com

TOC-ANALYSATOR TOC-ANALYSATOR

TOC und TNb
Wasser- und Feststoffanalytik für Labor- und Online-Anwendungen TOC-ANALYSATOR


Nünningstrasse 22–24 D-45141 Essen Tel. +49 (0) 201 722 390 Fax +49 (0) 201 722 391 essen@dimatec.de www.dimatec.de

Elementar Analysensysteme GmbH Elementar-Straße 1 D-63505 Langenselbold Tel. +49 6184 9393 – 0 info@elementar.com www.elementar.com
TRENNSCHICHTENMESSGERÄTE FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com




TRÜBUNGSMESSUNG FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

TRÜBUNGSMESSUNG
Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com


FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN) • Photometer • Messgeräte • Reagenzien
Hach Lange GmbH

Rorschacherstr. 30 a 9424 Rheineck Tel. 084 855 66 99 Fax 071 886 91 66 www.ch.hach.com

ÜBERFÜLLSICHERUNG FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com
UV-LEUCHTEN UV-LEUCHTEN P T M T LT R T V T U T

liquitec AG
WASSERANALYSEGERÄTE TOC-ANALYSATOR

Nünningstrasse 22–24
D-45141 Essen



Ihr Spezialist für Anlagen und Prüfmittel in der ZfP D Leuchten www.helling.de U LED-





VAKUUMPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab

Helling GmbH Spökerdamm 2 D-25436 Heidgraben Tel.: +49 4122 922-0 info@helling.de

Alter Weg 3
DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com
VAKUUMPUMPSTÄNDE DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
Alter Weg 3
DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg
F +41 55 450 83 01

GEMÜ Vertriebs AG Schweiz Telefon: 041 799 05 55 E-Mail: vertriebsag@gemue.ch · www.gemue.ch info@liquitec.ch www.liquitec.ch


WÄRME- UND TROCKENSCHRÄNKE

WÄRME- UND TROCKENSCHRÄNKE
Wir vertreiben und bieten Service für Wärme- & Trockenschränke der folgenden Marke: WÄRME- UND TROCKENSCHRÄNKE

Will & Hahnenstein GmbH D-57562 Herdorf
Tel. +49 2744 9317 0 Fax +49 2744 9317 17 info@will-hahnenstein.de www.will-hahnenstein.de

TOC und TNb Wasser- und Feststoffanalytik für Labor- und Online-Anwendungen
Tel. +49 (0) 201 722 390 Fax +49 (0) 201 722 391 essen@dimatec.de www.dimatec.de

ZAHNRADPUMPEN
ZAHNRADPUMPEN

Maag Pump Systems AG Aspstrasse 12 CH-8154 Oberglatt Telefon +41 44 278 82 00 welcome@maag.com www.maag.com
ZENTRIFUGEN ZENTRIFUGEN
Wir vertreiben und bieten Service für Zentrifugen der folgenden Marke:


Energieeffizienz zahlt sich aus: Mit Hochleistungsschmierstoffen von Klüber Lubrication senken Sie den Energieverbrauch Ihrer Maschinen spürbar – und damit auch Ihre Betriebskosten. Die massgeschneiderten Lösungen reduzieren Reibung und Verschleiss, verlängern die Lebensdauer Ihrer Anlagen und steigern die Produktivität. So wird «AntiAging für Ihre Maschine» zur nachhaltigen Investition in Ihre Zukunft.
