contamination control report
Offizielles Organ

n Robotik unter Containment-Bedingungen
n Bubendorfer in Frankreich GMP-zertifiziert
n Normierung: Nasenschleim inspiriert
n Zwölf Uhr mittags Coffee Break Session
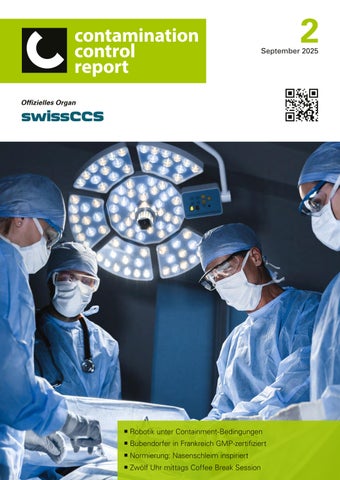
Offizielles Organ

n Robotik unter Containment-Bedingungen
n Bubendorfer in Frankreich GMP-zertifiziert
n Normierung: Nasenschleim inspiriert
n Zwölf Uhr mittags Coffee Break Session



Der brandneue Nachfolger des weltweit meistverkauften aktiven Luftkeimsammlers ist da. Er überzeugt mit magnetischem Lochdeckel mit Griff und zukunfts weisenden Features.
Höchste Prozesssicherheit mit intelligenter Automatisierung
Weniger Sekundärkontamination dank aseptischer Handhabung
Absolute Effizienz durch einfache Bedienung und 200 SLPM
Manipulationssicherer AuditTrail und automatischer Daten Export

MAS-100 Sirius. For serious air sampling.

n Kommunikationsräume für Reinraumtechnik
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe SwissCCS-Mitglieder
Die Reinraumtechnik steht unter Druck. Neue regulatorische Anforderungen, steigende Erwartungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie wachsende Komplexität in Planung und Betrieb verlangen nach Austausch auf Augenhöhe. SwissCCS schafft Räume dafür. Nicht in Form langer Konferenzen, sondern in kompakten, fokussierten Formaten, die konkrete Fragen aufgreifen und Orientierung bieten. Im Mai startete unsere neue Reihe der Coffee Break Sessions. Dr. Lisa Günther eröffnete mit einem Beitrag zur Mikrobiologie des Wassers. Unter dem Titel «Wasser ist wie Luft, nur dichter» sprach sie über mikrobiologische Herausforderungen im Umfeld von Reinräumen und Produktionsprozessen. Die Diskussion zeigte, wie viel Unsicherheit beim Thema Wasserqualität besteht und wie gross der Bedarf an praxisnaher Einordnung ist.
Im August folgte Christoph Strubl mit einem Beitrag zu Reinraumverpackungen und der Frage, wie sich Hygienestandards mit den Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung PPWR in Einklang bringen lassen. Es wurde deutlich, dass technische Notwendigkeiten und politische Vorgaben nicht immer miteinander vereinbar sind. Entscheidend ist nicht nur die Materialwahl, sondern auch die regulatorische Lesbarkeit und die wirtschaftliche Umsetzbarkeit. Im September folgt der nächste Schritt. Am 17. September 2025 ist SwissCCS mit einem eigenen Programm im Speakers Corner der ILMAC in Basel präsent. Fachleute aus Normung, Planung, Monitoring, Energie und Forschung geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen nicht Produkte, sondern Prozesse. Es geht um reale Bedingungen, konkrete Erfahrungen und praxistaugliche Lösungen. Der Austausch vor Ort ist offen für alle.
Am 5. Februar 2026 findet das Innovationsforum Reinraumtechnik an der Hochschule Luzern statt. Fachpersonen aus Industrie, Wissenschaft und Behörden diskutieren dort gemeinsam über Zukunftsthemen. Im Fokus stehen Pro -

Roman Schläpfer SRRT-SwissCCS Vorstandsmitglied
jekte, offene Fragen und konkrete nächste Schritte. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der HSLU und Willers organisiert. Sie versteht sich nicht als Präsentationsplattform, sondern als Arbeitsraum.
Und noch etwas: 2026 starten wir wieder mit den SwissCCS-Fachschulungen. Die Inhalte werden zurzeit grundlegend überarbeitet. Ziel ist es, die Schulung ICCCS-zertifiziert anbieten zu können. Kompakt, aktuell und mit klarer Verbindung zur Praxis. Die ersten Termine sind in Vorbereitung. Wir freuen uns, damit ein Angebot zurückzubringen, das in der Branche echten Mehrwert schafft. SwissCCS ist kein Verband im klassischen Sinn. Wir verstehen uns als Netzwerk, das Wissen zugänglich macht, Umsetzung unterstützt und Austausch fördert. Nicht abstrakt, sondern konkret. Nicht theoretisch, sondern anwendungsnah.
Mit besten Grüssen

Roman Schläpfer SRRT-SwissCCS Vorstandsmitglied
n Espaces de communication pour la technologie des salles blanches
Chères lectrices, chers lecteurs, chères et chers membres de la SwissCCS, La technologie des salles blanches est mise sous pression. De nouvelles exigences réglementaires, des attentes toujours plus élevées en matière d’efficacité énergétique et de durabilité ainsi que la complexité croissante au niveau de la planification et de l’exploitation exigent un échange d’égal à égal. La SwissCCS crée des espaces pour cela. Ce n’est pas sous forme de longues conférences mais dans des formats compacts et ciblés qui abordent des questions concrètes et offrent une orientation.
En mai, nous avons lancé notre nouvelle série de Coffee Break Sessions. Dr. Lisa Günther a ouvert le bal avec une contribution au sujet de la microbiologie de l’eau. Sous le titre «L’eau est comme l’air, seulement plus dense», elle a abordé les défis microbiologiques dans le domaine des salles blanches et des processus de production. La discussion a montré à quel point le sujet de la qualité de l’eau suscite des incertitudes et combien il est nécessaire de disposer d’une classification pratique.
En août, Christoph Strubl a présenté sa contribution sur les emballages pour salles blanches et la question de savoir comment concilier les normes d’hygiène avec les exigences du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR). Il s’est avéré que les nécessités techniques et les directives politiques ne sont pas toujours compatibles. Ce n’est pas seulement le choix des matériaux qui est déterminant mais aussi la lisibilité réglementaire et la faisabilité économique.
En septembre suivra la prochaine étape. Le 17 septembre 2025, la SwissCCS sera présente avec son propre programme au Speakers Corner de l’ILMAC à Bâle. Des experts en normalisation, planification, surveillance, énergie et recherche donneront un aperçu des évolutions actuelles. Ce ne sont pas les produits qui seront mis en avant mais les processus. Il s’agit de conditions réelles, d’expériences concrètes et de solutions applicables. L’échange sur place est ouvert à toutes et tous.
Le 5 février 2026, le forum sur l’innovation dans le domaine de la technologie des salles blanches se tiendra à la Haute école de Lucerne. Des experts de l’industrie, du monde scientifique et des autorités y discuteront ensemble des thèmes d’avenir. En point de mire: les projets, les questions en suspens et les prochaines étapes concrètes. L’événement est organisé en collaboration avec la HSLU et Willers. Elle ne se considère pas comme une plateforme de présentation mais comme un espace de travail. Et encore une petite chose: en 2026, nous reprendrons les formations spécialisées SwissCCS. Le contenu est actuellement en cours de révision approfondie. L’objectif est de pouvoir proposer une formation certifiée ICCCS. Compacte, actuelle et clairement axée sur la pratique.
Les premières dates sont en cours de préparation. Nous sommes ravis de proposer à nouveau une offre qui apporte une réelle valeur ajoutée à la branche. La SwissCCS n’est pas une association au sens classique du terme. Nous nous considérons comme un réseau qui rend les connaissances accessibles, soutient leur mise en œuvre et encourage les échanges. Pas de manière abstraite, mais bien concrète. Pas de manière théorique mais orientée vers la pratique.
Cordialement,

Roman Schläpfer
Readers,
The Cleanroom Technology is under pressure. New regulatory requirements, increasing demands as regards energy efficiency and sustainability as well as a growing complexity of planning and operation, all these urgently call for an exchange of views at eye-level. SwissCCS creates suitable spaces for this. Not in the form of long conferences, but in compact, focussed formats which address concrete questions and provide valuable orientation.
Our new series of coffee-break sessions started last May. Dr. Lisa Günther opened the event with a contribution on the microbiology of water. Under the title of «Water is like air, only of a higher density», she spoke about microbiological challenges in the environment of cleanrooms and production processes. The discussion revealed how much uncertainty exists concerning the quality of water and how big the need for practical classification is.
Christoph Strubl followed in August with his contribution on cleanroom packaging and the question of how standards for hygiene can be brought into conformity with the EU Packaging Regulation PPWR. It became clear that technical necessities and political specifications cannot always be tallied. Decisive is not only the choice of material, but also the regulatory legibility (comprehensibility) and the economic viability.
The next step follows on 17th September 2025, when the SwissCCS presents its own programme in the Speakers Cor-
ner of the ILMAC in Basel/Switzerland. Specialists in standardisation, planning, monitoring, energy and research give an insight in current developments. The focus is on processes, not products. Concered are real conditions and circumstances, concrete experiences and practical solutions. The mutual exchange in the location is open to everybody.
The innovation forum on Cleanroom Technology will take place at the University of Lucerne/Switzerland on 5th February 2026. Experts from industry, science and authorities will discuss topics of the future, e.g. projects, open questions and concrete next steps. The event will be organised jointly by the University of Lucerne and Willers and sees itself as a working space rather than a presentation platform.
And another matter: In 2026 we start our SwissCCS technical seminars again. A fundamental revision of the contents is currently under way. The aim is to be able to offer this training ICCCS-certified. Compact, topical and with a clear link to current practice. The first dates are in preparation and we are pleased to come back with a product that creates real extra value in our branch of the industry.
SwissCCS is not an association in the classical sense. We understand ourselves as a network which makes knowledge accessible, encourages exchange and supports implementations. Not in abstract form, but concrete. Not theoretical, but close to practical applications.
Sincerely

Roman Schläpfer



Im Spital der Zukunft
Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit wurde Ende Februar am Kantonsspital Baden ein hochmodernes Klinikgebäude eröffnet. Durch die Vernetzung von Geräten, Systemen und Sensoren ermöglicht das Internet der Dinge dort eine viel effizientere Nutzung der Ressourcen.

Trockenraum könnte
Endspiel in der Autoindustrie mitentscheiden
Das Schweizer Technologie-Innovationszentrum CSEM eröffnet im Herbst 2025 einen landesweit einzigartigen Trockenraum für die Batterieentwicklung. In einem eigens reservierten Teil erhalten Startups sowie kleine KMU Zugang zu einer Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik.

04 26 06
Hände weg, Wände weg!
In der Pharmazie und Medizintechnik verschmelzen Reinraumproduktion und Sterilverpackung, werden systematisch gemeinsam automatisiert, und über eine RFID-gestützte Chargenverfolgung auf Produktebene entsteht eine lückenlose transparente Kette.
4 13 17 22 22 34 38
Der Weg zum massgeschneiderten Filtersystem für den Reinraum
veranstaltungen Der Weg zu E-Mobilität und Pharma-Fortschritt: Lounges 2025
Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit wurde Ende Februar am Kantonsspital Baden ein hochmodernes Klinikgebäude eröffnet. Durch die Vernetzung von Geräten, Systemen und Sensoren ermöglicht das Internet der Dinge dort eine viel effizientere Nutzung der Ressourcen. Herzstück der Analytik ist eine 33 Meter lange Laborstrasse.
Die Gesundheitsbranche verursacht 5 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Das entspricht dem Ausstoss des fünftgrössten Landes. Ein starker Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sind intelligente Spitäler, die mittels moderner Gebäudetechnik und neuer Digitalisierungslösungen den Ressourcenverbrauch so klein wie möglich halten. Im Zentrum: der aus einer Vielzahl an Daten gezogener Nutzen. Mit dem 600-Millionen-Neubau «Agnes» ist in Baden eine der modernsten Krankenhausinfrastrukturen der Schweiz entstanden. Diese baut auf zahlreiche verbundene Datenströme auf und verfügt über ein digitales Navigationssystem. Über eine hauseigene App können Patientinnen und Patienten schnell und einfach Behandlungsräume, Cafés oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Krankenhausgelände finden. Dies reduziert Wartezeiten und steigert die Effizienz der Behandlungsprozesse.


Links, am Fenster: Sysmex-«XN-3100»-System für automatisierte Blutbildanalysen. Mitte: Die «Cobas 8100»-Prä-Analytik-Strasse für die Serum- und Plasmachemie. Dahinter (nur schemenhaft sichtbar): Die beiden «Cobas Pro»-Analysenstrassen. Links davon: Der automatisierte Kühlschrank. (Bild: KSB)
7000 IoT-Sensoren, 2000 Geräte
Die intelligente Krankenhausumgebung dient auch den Mitarbeitenden. Über 7000 IoT-Sensoren, die in eine digitale Plattform integriert sind, verbessern die Betriebsabläufe und optimieren den Aufenthalt von Patientinnen und Patienten.
Rückgrat ist die «Smart Hospital Platform» von Siemens, an die von der Infusionspumpe bis zum Ultraschallsystem insgesamt 2000 Geräte angeschlossen sind. Sogenannte «Asset-Tags» sind an medizinischen Geräten wie Krankenhausbetten oder Rollstühlen angebracht. EchtzeitOrtungsdienste erleichtern dem Krankenhauspersonal das Auffinden dieser Gegenstände, was den Arbeitsaufwand reduziert und letztlich zu einer besseren Patientenversorgung beiträgt. Laut einer Studie von Frost & Sullivan verbringen Mitarbeitende in Spitälern ohne solche Systeme durchschnittlich 72 Minuten pro Schicht mit der Suche nach Geräten – wertvolle Zeit, die durch intelligente Technologien effektiver genutzt werden kann.
Dank dieses Systems können darüber hinaus Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an mobilen Geräten besser geplant und

Links: Die beiden Gerinnungsautomaten «Stago STA R Max3». Rechts: Die zwei redundanten «Cobas Pro»-Analytiksysteme (hintereinander).
Im Hintergrund: Der automatisierte Kühlschrank für die Probenarchivierung (der graue Kubus mit den blauen Plexiglasfenstern). (Bild: KSB)
durchgeführt werden, weil für die Fachleute jederzeit ersichtlich ist, wo sich die Geräte befinden. Ein Servicetechniker, der beispielsweise mit Revisionsarbeiten an Rollstühlen oder an mobilen Beatmungsgeräten beauftragt ist, hat somit die Gewissheit, dass er an seinem Einsatztag die betroffenen Geräte findet und lückenlos bearbeiten kann.
Intelligente Gebäudeautomation
Ein wichtiger Pfeiler der Digitalisierung ist die von Siemens Smart Infrastructure realisierte Gebäudeautomation. Eine umfassende Managementplattform («Desigo CC») steuert eine Vielzahl technischer Systeme und ermöglicht die Überwachung und Bedienung der HLK-Anlagen, der Sicherheits- und Brandschutzsysteme sowie des Energieverbrauchs. Mit Funktionen wie Alarmmanagement, Trendanalysen, Berichterstellung und flexibler Raumverwaltung optimiert die SoftwarePlattform den Krankenhausbetrieb und gewährleistet Produktivität, Energieeffizienz und – nicht zuletzt – Komfort. So wird etwa das Raumklima mittels automatisierter Beschattung optimiert. Wetterstationen auf dem Dach erfassen den Sonnenstand und steuern die Sonnenschutzvorrichtungen entsprechend. Im Zusammenspiel sorgt eine Konstantlicht-
regelung dafür, dass die Beleuchtung automatisch an das Tageslicht angepasst wird. Auch die Überwachung von Medizinalgasen und Kühlketten erfolgt smart: Ein zentrales Überwachungssystem kontrolliert permanent die Druckwerte von Medizinalgasen, um eine sichere Nutzung im Operationsbereich zu gewährleisten. Und Medikamentenkühlschränke sind mit Sensoren ausgestattet, die bei Temperaturabweichungen sofort Alarm schlagen. Neben den Zutritts- und Sicherheitssystemen überwacht zudem ein Brandschutzsystem mit mehr als 7300 Meldern, 6500 Indikatoren und 9 Rauchansaugsystemen das Gebäude.
Wer denkt, dass ein derart durchdigitalisiertes Spital ein Risiko für Stromausfälle darstellt, wird vom Notstromkonzept überzeugt, wie Adrian Schmitter, Geschäftsführer des KSB, erklärt: «Unsere Diesel-Aggregate sind in der Lage, den Spitalbetrieb über 54 Tage aufrecht zu erhalten.»
Vollautomatische Laborstrasse
Im komplett autonom funktionierenden Gebäude sind auch hochmoderne Analysegeräte installiert. Neben den neusten Bildgebungsverfahren beeindruckt vor allem die Laborstrasse von Roche Diagnostics. 2200 Proben pro Stunde werden auf
der 33 Meter langen Geräte-Ökosystem automatisiert bearbeitet. Dabei werden die Proben via Rohrpostsystem in den Ablauf eingespeist, bevor sie dann in das gekühlten Lager gehen. Was früher Stunden in Anspruch genommen hatte, erfolgt heute in Minuten.
Die miteinander kommunizierenden Laborgeräte sind während 24 Stunden in Betrieb. Sollte eine Probe im Trubel vergessen worden sein, ist das System in der Lage, dies selbständig nachzuholen – zum Beispiel in der Nacht, wo weniger Durchlauf herrscht.
Auch andere Spitäler nutzen bereits solche Systeme, doch dieses im Kantonsspital Baden soll am modernsten sein. Verbaut wurde eine Prä-Analytik-Strasse von Roche mit dem «Cobas 8100» für die Serum- und Plasmaanalysen, die dann auf dem «Cobas Pro» abgearbeitet werden (davon hat das KSB zwei Exemplare in Betrieb, jeweils mit ISE-, C- und E-Modul). Zudem steht ein «p501»-Kühlschrank im Einsatz. Die weiteren Vollautomaten stammen von Sysmex: Eine Hochdurchfluss-Flow-Zytometrie für die Blutbildanalysen und eine Kombination aus Teststreifengerät, Flowzytometer und digitalem Mikroskop für die Urinanalytik.
Autor
Luca Meister


Eine Fachkraft am CSEM Battery Innovation Hub löst vorsichtig Dünnschicht-Lithium-Metallanoden, die durch thermisches Aufdampfen auf einen Kupfer-Stromkollektor aufgebracht wurden. (Bild: Christian Beutler)
Das Schweizer Technologie-Innovationszentrum CSEM eröffnet im Herbst 2025 einen landesweit einzigartigen Trockenraum für die Batterieentwicklung. In einem eigens reservierten Teil dieses Hightech-Labors erhalten Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Zugang zu einer Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik.
Der neue Trockenraum schafft auf 37 Quadratmetern mit einem besonders niedrigen Taupunkt von –50 °C die Voraussetzung für die Verarbeitung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien, wie sie in modernen und künftigen Batterien zum Einsatz kommen [1]. Dies betrifft namentlich Lithium, ein Schlüsselmaterial für neuartige Batterien mit hoher Energiedichte. Ausserdem ist der Trockenraum mit einer Pilotlinie zur Montage von Pouch-Zellen ausgestattet, wie sie in Elektroautos und Smartphones verwendet werden. Dabei handelt es sich um eine typische Bauform, in der ein Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt werden kann.
Trockenraum und Pilotlinie zusammen erlauben die Entwicklung von Batterieprototypen in industrieähnlichen Formaten und Kapazitäten. Im Besonderen lassen sich
Test-Pouch-Zellen mit einer Kapazität von bis zu 5 Amperestunden fertigen. Das reicht aus, um zum Beispiel ein Gerät mit einem Ampere Verbrauch für fünf Stunden oder mit fünf Ampere Verbrauch für eine Stunde zu versorgen.
Die neuen technischen Möglichkeiten stellen ausserdem einen integralen Bestandteil der Infrastruktur des CSEM Battery Innovation Hub in Neuchâtel dar. Dieser verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in Beschichtungstechnologien für Photovoltaik und konzentriert sich auf Materialien und Schnittstellen. Zudem ist der Hub in der Entwicklung fortschrittlicher Batteriemanagementsysteme aktiv. So finden Unternehmen hier ein Sprungbrett für einen schnellen Übergang von der Idee über die Forschung bis zur Marktreife.
Kritische Technologie für Automobilindustrie
Grosse Hoffnungen ruhen auf FestkörperLithium-Metall-Batterien. Sie bringen gegenüber herkömmlichen Akkus höhere Energiedichten, mehr Reichweite (ca. +30%) und kürzere Ladezeiten (ca. die Hälfte) ins Automobil. Noch dazu senken sie das Risiko von Bränden und die Produktionskosten.
Mercedes hat bereits ein Erprobungsfahrzeug auf die Strasse geschickt. VW plant noch für dieses Jahr eine Pilotanlage für die Testproduktion von Feststoff-Akkus [2].
Unterschiedliche Elektroden-Designs Nissan will bis Ende des Geschäftsjahres 2028 eine Festkörperbatterie («all solid state battery», ASSB) auf den Markt brin -

Andrea Ingenito Co-Direktor des Battery Innovation Hub: «Die Erweiterung um einen Trockenraum ist weit mehr als ein technisches Upgrade für CSEM. Sie ist ein entscheidender Schritt, um die industrielle Realisierbarkeit der in unserem Hub entwickelten Technologien zu demonstrieren. Damit möchten wir die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie stärken und Startups und KMU auf ihrem Weg zu Innovationen unterstützen. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist essenziell, um neue Ideen und Technologien effizient in marktreife Lösungen zu überführen.»
gen. Das Unternehmen steht zwar noch nicht kurz vor der Serienproduktion, ist aber bei der Fertigstellung des Designs schon weit fortgeschritten [3].
Bei seiner ASSB verwendet Nissan eine Lithium-Metall-Anode mit einem Schwefelelektrolyten. Für die Kathode kommt Nickel-Mangan-Kobalt in Frage möglich, doch möchte man Kobalt wegen seiner Seltenheit und des entsprechend hohen Preises nach Möglichkeit vermeiden. Günstigere Alternativen werden in NickelMangan oder Schwefel-Mangan gesehen. In Zukunft dürfte eine weitere Diversifizierung der heute verfügbaren Akku -

Andreas Hutter, Co-Direktor des CSEM Battery Innovation Hub: «Neben der Verbesserung der Batterieleistung ist unser oberstes Ziel die Entwicklung intelligenter, integrierter Energiespeicherlösungen. Durch die Kombination von Festkörperbatterien, optimierten Batteriemanagementsystemen und unserer anerkannten Expertise im Bereich Photovoltaik sind wir in einer führenden Position, um effizientere und widerstandsfähigere Energieinfrastrukturen zu schaffen.»
mulator-Technologien erfolgen. Einige Experten sehen einen Durchbruch bei Festkörper-Lithium-Metall-Batterien als kritische Grösse für die Wettbewerbsfähigkeit. Über sie könnte AutomobilbauEndspiel in der Akku-Technik mitentscheiden.
Trockenraum in einer Schlüsselrolle Allerdings bleibt die Produktion von Festkörper-Lithium-Metall-Batterien einstweilen eine Herausforderung, insbesondere die komplexe Herstellung und Handhabung von Lithium-Metall-Anoden. Der neue CSEM-Trockenraum kann eine
Schlüsselrolle bei der Entwicklung skalierbarer Prozesse spielen. Darüber hinaus werden die hier entwickelten Batterien in vielen Bereichen Anwendung finden, von biomedizinischen Produkten bis hin zur Raumfahrt. Diese ehrgeizige Initiative wird von wichtigen Finanzpartnern unterstützt, darunter die Banque Cantonale Neuchâteloise, der Fonds Cantonal de l’Énergie, der Energieund Umweltdienst des Kantons Neuenburg sowie der Fonds Vitale Energie, ergänzt durch Beiträge mehrerer Industriepartner.
Impuls für Schweizer Startups und KMU
CSEM öffnet einen Teil des Trockenraums gezielt für Startups, kleine und mittlere Unternehmen, um ihnen den Zugang zu einer Infrastruktur auf dem Stand der Technik zu erleichtern und ihre Innovationsrisiken zu senken. Rund 10 Quadratmeter der Fläche stehen flexibel zur Verfügung, so dass junge Unternehmen neue Technologien unter professionellen Bedingungen entwickeln und schneller in die industrielle Produktion überführen können – bei reduzierten Kosten und Risiken.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger
Literatur
1. CSEM eröffnet ersten Schweizer Trockenraum und beschleunigt so die Batterieinnovation, Medienmitteilung des CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique)/Basis für den vorliegenden Artikel, https://www.csem.ch/ de/presse/die-erste-trockenraum-anlage-derschweiz/, Zugriff am 10.6.2025
2. Holger Holzer, Wolfgang Rudschies: Feststoffbatterie: Ist das die Zukunft im Elektroauto? https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/feststoffbatterie/, Zugriff am 10.6.2025
3. https://insideevs.de/news/755965/nissanfestkoerperbatterie-marktstart-2028/#google_vignette, Zugriff am 10.6.2025


Dank einer speziellen Silikonfolie lassen sich jetzt ausgesprochen genügsame Pumpen und Ventile konstruieren, die auf Schmiermittel und vieles mehr verzichten und sich damit für den Einsatz im Reinraum empfehlen.
Kompakt, leicht, flach und energieeffizient: Eine dünne Silikonfolie macht eine neue Art miniaturisierter Pumpen und Ventile möglich. Sie funktionieren auf kleinem Raum, ohne Druckluft, ohne Motoren und Gerätschaften und ohne Schmiermittel. Sie sind reinraumtauglich und lassen sich während des Betriebs regulieren. Mit dem Prototyp einer neuartigen Vakuumpumpe zieht die Arbeitsgruppe um Prof. Stefan Seelecke und Prof. Paul Motzki, Universität des Saarlandes, stufenlos ein Vakuum von bis zu 300 Millibar Druck. Vakuum ist in vielen Bereichen gefragt: sei es im Bremskraftverstärker von Autos oder in medizinischen Absaugsystemen im OP Saal, in den Laboren der Pharmazie und Biotechnologie und vielfach auch in der Industrie. Unter Vakuum werden Lebensmittel schonend getrocknet und Saugnapfgreifer sortieren damit Produkte auf Förderbändern. Um das Vakuum zu ziehen ist heute oft Druckluft im Spiel. Dabei kommen Pumpen zum Einsatz, die im Hintergrund mit Kompressoren oder Motoren betrieben werden. Grundsätzlich kann dies unter Ölschmierung erfolgen, aber in Reinräumen und in sterilen Umgebungen verbietet sich das wegen der Kontaminationsgefahr. Operationswunden oder Lebensmittel sollen nicht mit Schmiermitteln verunreinigt werden. Im industriellen Bereich beeinträchtigen Ölspuren zum Beispiel die Wirkung von Klebstoffen. Die regelmässige Wartung verursacht einen erheblichen Aufwand; ausserdem verbrauchen herkömmliche Kompressoren oder Motoren eine Menge Energie. Durch ihre Geräuschentwicklung beeinträchtigen sie die Mitarbeiter und erschweren schlimmstenfalls die Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen.
Dünne Folien mit «akrobatischem»
Talent Gänzlich ohne Druckluft oder Motoren, dafür mit wenig Energie kommen die Pumpen und Ventile aus, die das Forschungsteam der Professoren Stefan Seelecke und

Paul Motzki, Professor für smarte Materialsysteme für innovative Produktion der Universität des Saarlandes und Geschäftsführer des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA). (Bild: Oliver Dietze, Universität des Saarlandes)
Paul Motzki an der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) entwickelt: Sie funktionieren mit dünnen Silikonfolien, in die allein mithilfe von elektrischer Spannung Bewegung kommt. «Die Technologie ist kostengünstig in der Herstellung, die Bauteile sind leicht, das hilft Platz und Gewicht zu sparen. Dazu sind diese Pumpen und Ventile erheblich energieeffizienter als heutige Verfahren», sagt Paul Motzki. «Im Vergleich zu einem marktüblichen Prozessventil für Druckluft, das mit einem Elektromagneten betrieben wird, hat dasselbe Ventil mit unserem Antrieb einen 400 mal niedrigeren Energieverbrauch», erklärt der Professor für Smarte Materialsysteme für innovative Produktion an der Universität des Saarlandes und Zema Geschäftsführer. Auch kommen diese Verfahren ohne schwer verfügbare oder teure Materialien wie seltene Erden oder Kupfer aus. Und im Gegensatz zu mit Kompressoren be
triebenen Pumpen sind die Folienpendants zudem angenehm leise. Die Forscherinnen und Forscher können die 50 Mikrometer dünnen Folien nach Belieben Bewegungen vollführen lassen. Hierzu sind diese beidseitig mit einer elektrisch leitfähigen, hochdehnbaren Elektrodenschicht bedruckt. Legen die Ingenieure hier eine elektrische Spannung an, drückt sich die Folie wegen der elektrostatischen Anziehung vertikal zusammen und dehnt sich in ihrer Fläche aus.
Innovationsfeld von Reinraumtechnik bis Robotik «Mit diesen sogenannten dielektrischen Elastomeren entwickeln wir verschiedene neuartige Antriebe, die keine zusätzlichen Sensoren benötigen», erläutert Paul Motzki. Indem die Forscherinnen und Forscher das elektrische Feld verändern, können sie die Folien stufenlos Hub Bewegungen verrichten oder auch mit beliebiger Frequenz und Schwingung vibrieren lassen.
Die Folie kann auch jede gewünschte Stellung halten, wobei sie im Übrigen keinen Strom verbraucht.
An der Technologie der dielektrischen Elastomere forschen im Team der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki auch viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler im Rahmen mehrerer Doktorarbeiten. Sie ist Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und wurde in mehreren Forschungsprojekten gefördert: unter anderem von der EU im Rahmen eines Marie Curie Research Fellowships, von der saarländischen Landesregierung im Rahmen der EFRE Projekte Ismat und Multi Immerse sowie unter anderem auch durch die Mesaar im Rahmen eines Promotionskollegs. Das Forschungsteam nutzt die Technologie für die verschiedensten Anwendungen, ausser für reinraumtechnisch vorteilhafte Ventilen und Pumpen auch für Lautsprecher, smarte Textilien (z.B. Sensorstreifen zur kontinuierlichen Überwachung von Bauteilen aus karbonfaserverstärktem Kunststoff), für ein haptisches Feedback von Geräten (ähnlich wie beim «vibrierenden Handy») und für Robotergreifer.
Ihre Zustandsüberwachung übernimmt die Pumpe selbst «Die Folien sind selbst ihr eigener Sensor. Die Funktion eines Positionssensors lie
fern die dielektrischen Elastomere gleich mit», sagt Paul Motzki. Jede Verformung der Folie lässt sich einem Messwert der elektrischen Kapazität zuordnen. Bei der kleinsten Bewegung verändern sich die Werte. Anhand der Messwerte erkennen die Ingenieure, wie die Folie mechanisch ausgelenkt ist, also wie sie sich gerade verformt. In einer Regelungseinheit können sie anhand dieser Messwerte mithilfe Künstlicher Intelligenz Bewegungsabläufe programmieren. Eingesetzt als Antrieb in entsprechenden Apparaturen ziehen und lösen die Folien in motorlosen Pumpen ein Vakuum mit gewünschtem Druck, dosieren als Ventil Flüssigkeiten exakt oder fungieren als stufenlose Schalter.
Ausserdem können die Folienpumpen und ventile ihren eigenen Zustand überwachen und signalisieren, wo der Fehler liegt. Die Messwerte verraten, wenn etwas schiefgeht, also etwa das Vakuum nicht richtig gezogen wurde oder Ventil oder Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert sind. Passiert dies heute in grossen Industrieanlagen, kann die Fehlersuche mitunter kompliziert werden.
Schnell zur Katalogware
«Die Technologie lässt sich einfach skalieren. Hierzu schalten wir unsere Aktoren und Pumpenkammern entweder parallel
oder in Reihe oder beides zugleich und können so Druck und Volumenstrom vergrössern», sagt Paul Motzki. Um die Technologie für die Messebesucherinnen und besucher anschaulich zu machen, haben die Forscherinnen und Forscher einen Demonstrator gebaut: Ihre smarte Folie zieht hier ein Vakuum in einer Vakuumglocke. Sichtbar wird dies an einem Luftballon, der sich im Innern der Glasglocke selbst «aufbläst» – eine Anordnung wie im Physikunterricht: Da die Luft um den Ballon herum abgesaugt wird, haben die Luftteilchen im Ballon mehr Platz, sich auszudehnen – nur, dass dies hier ganz ohne die laute Geräuschkulisse des Druckluftkompressors vonstattengeht.
Die Forscher können ihre Pump und Ventil Technologie in verschiedensten Bauformen unterbringen, sie ist massentauglich und kann in weiterentwickelter Form binnen weniger Jahre zur Katalogware werden. Die Forscher wollen die Ergebnisse ihrer anwendungsorientierten Forschung in die Industriepraxis bringen. Hierzu haben sie aus dem Lehrstuhl heraus die mateligent GmbH gegründet und suchen nun Partner aus der Wirtschaft.
Autoren
Claudia Ehrlich, Dr. Christian Ehrensberger


Wissenschaftlern der Universität Wien ist es gelungen, Experimente mit zweidimensionalen Graphenschichten unter dauerhafter Isolierung von der Umgebungsluft und den darin enthaltenen Fremdpartikeln durchzuführen – und nebenbei besonders dehnbare Varianten des «Wundermaterials» zu entwickeln.
Die Voraussetzung für viele neue Impulse für Graphen in Forschung und Anwendung hat eine konsequente Implementierung von Reinraumtechnik geschaffen. So wurden die Experimente mit hochmodernen Geräten in luftleeren ultrasauberen Kammern durchgeführt, und diese Kammern waren durch ebenfalls luftleere Metallröhren miteinander verbunden. Dadurch konnten die Proben von einem Gerät zum anderen gelangen, ohne jemals in Kontakt mit der Umgebungsluft zu kommen. «Dieses einzigartige System, das wir an der Universität Wien entwickelt haben,

Da ist viel Musik drin: Akkordeonstrukturen, auf die Welt der ultradünnen einatomigen Schichten übertragen, geben gewellte Materialien mit steuerbarer Zugfestigkeit. (Bild: Adpic)
ermöglicht uns eine ungestörte Untersuchung von 2D Materialien», erklärt Prof. Kotakoski. Wael Joudi, Erstautor der Studie fügt hinzu: «Damit ist es uns erstmals gelungen, das Graphen während dieser Art von Experimenten dauerhaft von der Umgebungsluft und den darin enthaltenen Fremdpartikeln zu isolieren. Andernfalls würden sich diese innerhalb kürzester Zeit auf der Oberfläche ablagern und sowohl die Versuchsdurchführung als auch die Messung beeinflussen.»
Graphen mit steuerbarer Zugfestigkeit
Erst mit dieser neuen experimentellen Anordnung konnten die Wissenschaftler bisherige Widersprüche bei der Zugfestigkeit von Graphen aufklären, die auf seiner seiner bienenwabenförmigen atomaren Anordnung beruht. Eine Störung dieses «idealen 2D Gitters» durch Entfernen einiger Atome samt Bindungen aus dem Material sollte intuitiv zu einer Verringerung der Zugfestigkeit führen. Allerdings sagen Experimente teilweise das Gegenteil: Sowohl eine kleine Verringerung als auch eine starke Erhöhung der Zugfestigkeit können gemessen werden. Erst der Fokus auf Reinheit der Materialoberfläche führte zu einer Lösung dieser

enorm
vermeintlichen Widersprüchlichkeit. So fanden die Wissenschaftler Folgendes heraus: Bereits die Entfernung von nur zwei benachbarten Atomen verursacht eine gewisse Wölbung des ursprünglich flachen Materials. Zusammen resultieren mehrere solcher Wölbungen in einer Wellung des Graphens.
«Man kann sich das wie ein Akkordeon vorstellen. Beim Auseinanderziehen werden diese Wellen abgeflacht», erklärt Wael Joudi.
Für das Auseinanderziehen des gewellten «Akkordeon Graphens» bedarf es wesentlich weniger Kraft als für die Spannung von störstellenfreiem und daher komplett flachem Graphen. Von den theoretischen Physikern der Technischen Universität Wien Rika Saskia Windisch und Florian Libisch durchgeführte Simulationen bestätigen sowohl die Wellenbildung als auch die daraus resultierende geringere Zugfestigkeit des Materials. Es wird letztendlich dehnbarer. Fremdpartikel auf der Materialoberfläche unterdrücken diesen Effekt und können sogar eine gegenteilige Wirkung hervorrufen. Dadurch erscheint das Material zugfester. Das erklärt auch die Widersprüche in der Vergangenheit.
«Damit haben wir die grosse Bedeutung der Messumgebung im Umgang mit 2D

Kleine Störungen der idealen wabenartigen Anordnung führen zu Wölbungen und schliesslich zu «Akkordeon-Strukturen». (Bild:

Als Mikroskope verwendet die Universität Wien ein drei Meter hohes Rastertransmissionselektronenmikroskop (Nion Ultra STEM, Bruker Corporation; links) und ein Rasterkraftmikroskop (AFSEM, Quantum Design GmbH; rechts); dieses befindet sich währen der Experimente in einer luftleeren Kammer (r.). (Bild: Uni Wien)
Materialien bewiesen», resümiert Wael Joudi. Auf der Basis der nun vorliegenden Erkenntnisse über den «Akkordeon Effekt» sollte sich die Zugfestigkeit von Graphen in Zukunft gezielt steuern lassen. Neben der Zugfestigkeit sticht Graphen durch seine hohe Leitfähigkeit heraus. Das eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, in denen sowohl eine gewisse Dehnbarkeit als auch bestimmte elektrische Materialeigenschaften nötig sind. Ein Paradebeispiel stellen «wearable electronics»
dar. Sie kennt man unter anderem aus den beliebten Fitness Trackern. Andere am Körper getragene bzw. in die Kleidung eingearbeitete Mini Computer messen die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel, den Kalorienverbrauch und vieles mehr; die Messergebnisse können anschliessend per App bewertet werden.
Fazit für die Zukunft von Graphen
Die Erfolgsgeschichte von Graphen sollte sich mit den Forschungsergebnissen aus
Wien unter höherem Tempo fortsetzen. Der erste experimentelle Nachweis gelang im Jahr 2004 und etablierte eine komplett neue Klasse von Materialien: die sogenannten zweidimensionalen (2D) Festkörper. Sie weisen eine einzige Lage von Atomen auf. Mit dieser minimalen Schichtstärke entstehen exotische Materialeigenschaften.
Graphen ist extrem leitfähig und extrem fest, also sehr gut für elektrische und mechanische Anwendungen geeignet. Dank des nun entdeckten «Akkordeon Effekts» wird eine drastische und steuerbare Dehnbarkeits Steigerung möglich. In Verbindung mit massgeschneiderten elektrischen Eigenschaften werden viele neue Anwendungen möglich.
Die Wissenschaftler um Prof. Dr. um Jani Kotakoski, der sich an der Universität Wien unter anderem mit zweidimensionalen Materialien, mit auf atomarer Ebene «massgeschneiderten» Materialien und mit der Transmissionselektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung beschäftigt, haben beim «Akkordeon Graphen» mit der Technischen Universität Wien zusammengearbeitet. Den genauen Mechanismus dieses Phänomens publizierten sie im Fachjournal Physical Review Letters.
Weitere Informationen www.univie.ac.at

Geladene Molekülbruchstücke wurden bisher hauptsächlich zur Strukturbestimmung in der analytischen Chemie untersucht, doch sie haben sich nun auch für die Dünnschichtsynthese als bedeutsam erwiesen.
Das ist ein Resultat fünfjähriger Forschungstätigkeit an der Universität Leipzig. Die Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse kürzlich, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern an der Purdue-Universität (USA), in der Fachzeitschrift «Nature Reviews Chemistry» veröffentlicht.
Nano- bis mikrometerdünne Schichten Zusammen hat man unter anderem neue Methoden entwickelt, um gasförmige, geladene Molekülbruchstücke gezielt zu neuen, komplexen Molekülen zusammenzusetzen. Diese Substanzen werden auf Oberflächen abgeschieden. Das innovative Verfahren eröffnet neue Perspektiven für Anwendungen in der modernen Nanoelektronik und Sensorik. Es bietet auch neue Forschungsansätze in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, von der Katalysatorforschung bis hin zu medizinischen Anwendungen.
«Bisher wurden geladene Molekülbruchstücke hauptsächlich in der analytischen Chemie untersucht, um die Struktur von Molekülen zu bestimmen. Die Forschung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass diese Molekülbruchstücke auch für synthetische Anwendungen von grosser Bedeutung sind. Durch ihre kontrollierte Abscheidung auf Oberflächen können chemische Reaktionen initiiert werden, die mit herkömmlichen Synthesemethoden nicht möglich wären», erklärt Forschergruppenleiter Prof. Dr. Jonas Warneke vom Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Leipzig. Die verwendeten Forschungsinstrumente, die speziell für sogenannte Dünnschichtsynthesen mit geladenen Molekülbruchstücken optimiert wurden, existieren weltweit nur an zwei Standorten. Sie wurden gemeinsam von den Forschungsgruppen um Professor Warneke und Professorin Julia Laskin von der Purdue Universität entwickelt. Als Dünnschichtsynthese bezeichnet man die Herstellung dünner Schichten mit Dicken im Nanometer- bis Mikrometerbereich.
Aggressivstes Molekülbruchstück angebunden
Das Leipziger Forschungsteam berichtet in dem Artikel über seine Arbeiten zur kontrollierten chemischen Bindungsbildung mit «aggressiven» Molekülbruchstücken. So konnte das chemisch reaktivste, negativ geladene Molekülbruchstück, das bisher bekannt ist, gezielt an andere Moleküle angebunden werden. Beispielsweise wurde auch der als wenig reaktiv geltende Stickstoff aus der Luft in Schichten auf Oberflächen gebunden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, solche wenig reaktiven chemischen Rohstoffe zur Synthese neuer Moleküle und Funktionsmaterialien auf Oberflächen zu verwenden oder die Eigenschaften von Materialoberflächen gezielt zu verändern.

Die Leipziger Autoren des Übersichtsartikels:
Prof. Dr. Jonas Warneke (l.), Dr. Markus Rohdenburg (Mitte) und Dr. Harald Knorke (r.) neben einem Instrument zur Synthese dünner Schichten mit gasförmigen geladenen Molekülbruchstücken. (Bild: Ziyan Warneke)
Das Forschungsteam der Purdue-Universität beschreibt in dem Artikel seine Arbeiten zur Verknüpfung metallhaltiger, geladener «Nanocluster» (kleine Partikel mit genau definierter Atomanzahl). Aufgrund ihrer besonderen magnetischen und elektronischen Eigenschaften sind sie für Quantentechnologien von Interesse. Darüber hinaus wird über die gemeinsame Arbeit der beiden Forschungsgruppen zur Entwicklung der Instrumente und zur Reaktion molekularer, geladener Katalysatoren auf Oberflächen berichtet.
Ausblick: Mikrosystemtechnik und Biomoleküle «Wir möchten in den kommenden Jahren unsere Arbeiten durch die Entwicklung noch leistungsfähigerer Instrumente zur Dünnschichtsynthese mit Molekülfragmenten optimieren», sagt Warneke. Dies könnte die Synthese von Materialien im Mikromassstab ermöglichen und den Weg für Anwendungen der aussergewöhnlichen neuen Verbindungen, die aus Molekülbruchstücken zusammengesetzt wurden, in der Mikrosystemtechnik ebnen. Zudem entwickelt das Leipziger Forschungsteam neue Wege zur Analyse grosser Biomoleküle auf Oberflächen durch Anbindung geladener Molekülbruchstücke, was für das grundlegende Verständnis der biologischen Funktionen dieser Moleküle an Zelloberflächen von Bedeutung sein könnte.
Weitere Informationen
Susann Sika (Universität Leipzig), Dr. Christian Ehrensberger
Literatur
Warneke, J., Samayoa-Oviedo, H.Y., Rohdenburg, M. et al. Molecular synthesis with gaseous fragment ions on surfaces. Nat Rev Chem 9, 470–480 (2025). https://doi.org/10.1038/s41570-02500719-1
Ganz allgemein geht der Trend im Zuge des neuen Annex 1 zu umfassenden Kontaminations Kontroll Strategien. Es liegt nahe anzunehmen, dass vorsichtshalber jeder Prozess zwingend aktiv kontinuierlich überwacht werden muss. Doch auch durch die Kombination einer aktiven Luftprobenahme und der kontinuierlichen Überwachung mit einer herkömmlichen Sedimentationsplatte («Passivsammler») werden die Anforderungen erfüllt.
Die Frage nach der aktiven oder passiven Prozesskontrolle stellt sich typischerweise insbesondere in Reinräumen. Doch wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Methoden?
Prinzipielle Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Bei der aktiven Prozesskontrolle handelt es sich um eine quantitative Messmethode. Gemessen wird ein bestimmtes Volumen über eine gewisse Zeit in einer bestimmten Geschwindigkeit – genauer: Ein definiertes Luftvolumen wird durch einen sogenannten Impaktor gepumpt, und dieser scheidet die Partikel auf einer AgarOberfläche ab.
Dort wird die Anzahl der koloniebildenden Einheiten (KbE) bestimmt. Im Anschluss wird die Agar Platte inkubiert, so dass Mikroorganismen auf dem Nährmedium wachsen und, falls vorhanden, am Ende gezählt werden können. Im Falle positiver Ergebnisse («Mikroorganismen vorhanden») folgt eine Identitätsprüfung. Damit kennt man die Gattung(en) des Organismus bzw. der Organismen. Das Ergebnis lässt sich dann als KbE pro Luftvolumen (KbE/m³) angeben. Dement

sprechend ist der aktive Luftkeimsammler ein Messgerät und muss jährlich kalibriert werden.
Bei der passiven Prozesskontrolle wird der Luftprobensammler (= Agar Platte mit Nährmedium) üblicherweise für vier Stunden «ausgelegt», und so benötigt sie an sich kein Messgerät. Etwaige Keime setzen sich einfach ab; in einem separaten Schritt werden die Platten in einen Inkubator gelegt und nach einer festgelegten Zeit die bis dahin gewachsenen Kulturen ausgezählt sowie gegebenenfalls eine Identitätsprüfung vorgenommen.
Der Austausch der Agar Platten bei der passiven Prozesskontrolle kann automatisch mit einem geeigneten Gerät erfolgen (z.B. MAS 100 Libra, MBV, Stäfa). Für dieses wird lediglich ein regelmässiger sogenannter «Selbsttest» empfohlen, der sich einfach durchführen lässt.
Bewertung der Methoden im Vergleich
Beide Methoden, die aktive und die passive Luftprobenahme, sind Agar basiert und erlauben die Identifikation der möglichen Kontaminanten, wie es der Annex 1 vorschreibt. Die passive Probenahme lie

«Nur» semiquantitativ, aber näher an der betrieblichen Realität im Reinraum: Der automatische Wechsler für Sedimentationsplatten lässt sich in einen Isolator HMI (Human Machine Interface) integrieren oder als portable Stand alone Lösung einsetzen. (Bilder: MBV)
fert zwar kein Ergebnis im Sinne einer exakten Quantifizierbarkeit (in KbE/m³), sondern ist «nur» semiquantitativ. Dafür bewegt sie sich aber näher an der betrieblichen Wirklichkeit und simuliert sedimentierte Partikel, wie sie in ein abzufüllendes Gut gelangen.
Mit einem vollautomatisierten Plattenwechsler steigert sich nicht nur die Effizienz des Verfahrens. Gleichzeitig sinkt auch das Risiko, durch menschliche Eingriffe (= Plattenwechsel) womöglich Kontaminationen einzubringen und am Ende falsch positive Ergebnisse zu erhalten, weil der eingreifende Mensch die detektierte Verunreinigung selbst eingebracht hat. Mit einem automatischen Plattenwechsler muss man nur einmal die Platten einfüllen und dann erst nach 24 Stunden wieder wechseln.
Über die Effizienz im Betrieb hinaus stehen auf der Haben Seite der passiven Prozesskontrolle im Reinraum auch ökonomische Überlegungen. Für die aktive Probenahme bedarf es der erwähnten Pumpe und des Impaktors. Damit sind zusätzliche Kosten verbunden. Sie lassen sich mit einer passiven Prozesskontrolle vermeiden.
«Ritterschlag» durch Kontrollämter Die zuständigen Behörden bzw. Prüfstellen verlangen wichtige regulatorische Dokumente zur Messung mit Sedimentationsplatten. Allein das weist schon darauf hin, dass sich diese (passive) Methode in der Reinraumüberwachung als ein Standard etabliert hat.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger
In diesem Jahr feiert die Enzler Reinigungen AG ihr 90-jähriges Firmenjubiläum. Was 1935 mit einem Fahrrad, einer Leiter und einem Eimer begann, ist heute ein schweizweit etabliertes Kompetenzzentrum für Hygiene- und Reinigungsdienstleistungen. Die 1998 gegründete Enzler Hygiene AG hat sich auf besonders anspruchsvolle Felder spezialisiert, darunter insbesondere Reinräume in der Pharma- und Biotechindustrie und in Spitälern.
Die Erfolgsgeschichte der Enzler Reinigungen AG ist nicht nur ein Porträt unternehmerischen Muts, sondern auch ein eindrücklicher Einblick in die Entwicklung eines Familienbetriebs über vier Generationen hinweg.
Die Ursprünge des Unternehmens sind bescheiden: Karl Enzler sen., ein Mann ohne Berufsausbildung, verliess seine Heimat Walchwil am Zugersee, um in Zürich eine neue Existenz aufzubauen. Mit seiner Frau Frieda gründete er 1935 die Enzler Reinigungen – der Firmensitz war das Wohnzimmer der Familie an der Schubertstrasse in Zürich. Bereits wenige Jahre später gelang dem kleinen Betrieb ein grosser Durchbruch: Die Landesausstellung, kurz Landi, in Zürich 1939 war
ein Wendepunkt in der Geschichte der Enzler Reinigungen AG.
Vom Hilfsarbeiter zum Manager
Die «Landi» mit 10,5 Millionen Besuchern und einem sechsmonatigen Zeitrahmen stellte das junge Fünf-Mann-Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Karl Enzler sen. musste über Nacht vom Fensterreiniger zum Manager werden. Der Erfolg dieses Projekts legte den Grundstein für das Wachstum des Familienbetriebs, der in den Nachkriegsjahren vom Bauboom profitierte und in Zürich zum führenden Anbieter in der Baureinigung wurde. 1960 übernahm Karl Enzler II., der Sohn des Gründers, das Unternehmen. Nach dem Tod seines Vaters entschied er sich,

den Fokus des Familienbetriebs klar auf die Gebäudereinigung zu legen und die Kleiderreinigung hinter sich zu lassen. Mit einer durchdachten Strategie expandierte das Unternehmen national und sicherte sich 1964 die Reinigung der EXPO in Lausanne. Trotz Arbeitskräftemangel meisterte Enzler auch diesen Grossauftrag und stärkte damit die Position des Unternehmens nachhaltig.
Bereits Ende der 1960er-Jahre setzte Karl Enzler II. auf Digitalisierung: Er liess einen IBM-Kleincomputer in das Unternehmen integrieren und entwickelte in Eigenregie Softwarelösungen für Buchhaltung und Materialverwaltung. Damit setzte er neue Massstäbe und führte die Digitalisierung in der Branche ein.
Innovationsfreude und Familientradition
Das Streben nach Innovation und Fortschritt prägt die Firmenphilosophie bis heute. Diese Haltung hat die Enzler Reinigungen AG zu einem der renommiertesten Dienstleister in der Reinigungsbranche gemacht. «Wir wollen nicht nur Papierkörbe leeren und Teppiche staubsaugen –unser Ziel ist es, der Know-how-Leader im Bereich Hygienedienstleistungen zu sein», erklärt Karl Enzler III., der das Unternehmen seit 1993 in dritter Generation leitet.
Als Karl Enzler III. die Führung übernahm, befand sich die Branche in einem Wandel: Neben der Reinigung wurde zunehmend auch das Facility Management ausgelagert. Doch anstatt in die Breite zu gehen, entschied sich die Enzler Gruppe für eine Strategie der Spezialisierung. Der Fokus lag darauf, anspruchsvolle Reinigungs- und Hygienedienstleistungen weiterzuentwickeln – ein Ansatz, der sich als äusserst erfolgreich erwiesen hat. Heute beschäftigt die Enzler Gruppe rund 2.700 Mitarbeitende aus 88 Nationen und hat sich besonders in der Pharma- und Biotechin -

dustrie als renommierter Dienstleister etabliert.
Um den hohen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden, betreibt die Enzler Gruppe ein eigenes Kompetenzzentrum mit mikrobiologischem Labor. Hier werden Messungen durchgeführt und Erkenntnisse gewonnen, die direkt in die Schulungen der Mitarbeitenden einfliessen. Dieses fundierte Wissen ermöglicht es, auch



die strengsten Hygienevorschriften der Pharma- und Medizinaltechnik-Branche zu erfüllen.
Die Digitalisierung ist ein weiterer Treiber des Erfolgs. Mit dem firmeneigenen «Enzler DigiLab» verfolgt die Enzler Gruppe die neuesten Entwicklungen in Robotik und Automatisierung. Dabei werden nicht nur modernste Roboterlösungen getestet, sondern auch massgeschneiderte An -


und für Unterhaltsreinigungen (hier: von den 1970er Jahren bis heute) verantwortlich.

wendungskonzepte entwickelt. Durch die Digitalisierung von Reinigungsflächen und eine präzise Planung können Roboter effizienter eingesetzt werden, wodurch sowohl Qualität als auch Effizienz gesteigert werden.
Ein Familienunternehmen mit Zukunft Trotz des Wachstums und der technologischen Fortschritte bleibt die Enzler Reinigungen AG ein unabhängiges Familienunternehmen. Die vierte Generation ist bereits aktiv in die Unternehmensführung eingebunden und beide Töchter definieren als Teil des Verwaltungsrats die Strategie. Livia Mietzsch, die Tochter von Karl Enzler III., ist zusätzlich Teil der Geschäftsleitung und betreut das Hygieneforum.ch, eine Plattform für den Austausch über aktuelle Hygiene- und Reinigungsthemen. «Nach 90 Jahren sind wir stolz auf unsere Wurzeln und unsere Geschichte, jedoch richtet sich unser Blick stets in die Zukunft», betont Karl Enzler III. «Wir bleiben ein Familienbetrieb mit einer starken Kultur und einer klaren Vision.»
Autorin und Kontakt
Tanja Reichmuth Spezialistin Marketing Enzler Reinigungen AG Förrlibuckstrasse 70 8004 Zürich +41 44 455 55 55 marketing@enzler.com www.enzler.com
Wir sind da! Stand D205
In der Lebensmittelindustrie, dem Gesundheitswesen, der Umweltanalytik, der Gastronomie und angrenzenden Bereichen lassen sich jetzt Hygieneprüfungen auf mikrobielle Verunreinigungen mit Ergebnissen in unter 30 Sekunden durchführen, vom Messgerät via Bluetooth und USB übertragen und zum Beispiel in einer Cloud speichern.
Sowohl Fachkräfte als auch ungeübtes Personal entnehmen die Probe mit einem Stäbchen. Dieses löst im Gerät bei Anwesenheit von ATP, ADP oder AMP eine Biolumineszenzreaktion aus. Die drei Nukleotide spielen eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel von Zellen und dienen als Indikatoren für biologische Verunreinigungen.
Das Gerät ist in nur acht Sekunden einsatzbereit, kalibriert sich automatisch und
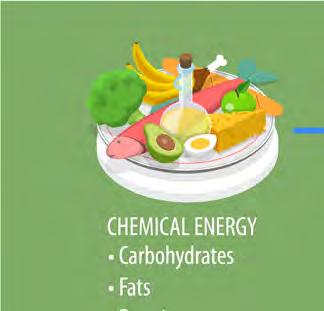

erlaubt die Festlegung individueller Grenzwerte. Ein LED Display sorgt für eine intuitive Bedienung, während USB und Bluetooth Schnittstellen eine Synchronisierung mit einem Smartphone, Tablet oder PC sowie eine nahtlose Datenübertragung und Cloud Speicherung ermöglichen.
Dank seinem geringen Gewicht und der kompakten Bauweise lässt sich das Gerät («Lumitester Smart») einfach mitnehmen.
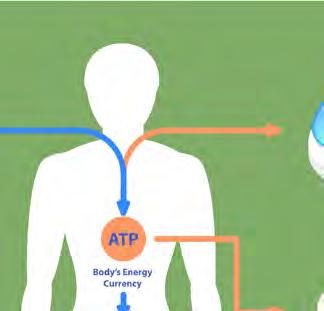



Komplexe Aufgaben im Energiestoffwechsel: ATP und zwei weitere Nukleotide, ADP und AMP, üben wichtige und vielfältige Funktionen aus. (Bild: Adpic)
Die Probennahmeröhrchen für Oberflächen und Flüssigkeitsanalysen («LuciPac») sind separat erhältlich.
Weitere Informationen Roth AG CH 4144 Arlesheim info@carlroth.ch www.carlroth.ch

Einfach gemessen: Dank einem Verfahren auf der Basis von Biolumineszenz können Fachkräfte und ungeübtes Personal die Bestimmung der Nukleotide als Hygieneprüfungen auf mikrobielle Verunreinigungen durchführen. (Bild: Roth)

Egal ob Objekte bezüglich ihrer Aerodynamik verbessert, die Strömung in Reinräumen optimiert oder Lecks in Anlagen oder Gebäuden detektiert werden sollen: die Visualisierung der vorhandenen Strömung unter Verwendung eines Nebelgenerators hilft, diese und weitere Herausforderungen anzugehen.
Interne und externe Messdienstleister von Reinräumen wissen genau: Ein wichtiges Merkmal des reinen Raumes ist das verwendete Strömungsregime. Hierbei unterscheidet man zwischen turbulenzarmer Verdrängungsströmung (TAV) und turbulenter Verdünnungsströmung. Beide Regime können mit Hilfe des optimierten Nebelgenerators CFG 291 sichtbar gemacht, bildtechnisch dokumentiert und qualitativ bewertet werden.
Strömungsvisualisierung in Reinräumen
Auch das Erkennen von potentiellen Quellen von Strömungsstörungen in Reinräumen ist eine essentielle Aufgabe. Die Störungen können durch Temperatur und Druckunterschiede, räumliche Barrieren aber auch durch das Einbringen von Luftströmungen aufgrund vor Ort genutzter Geräte verursacht werden. Mit Hilfe des optisch auffälligen Nebels können Nutzer des Generators potentielle Störquellen identifizieren, deren Einfluss bewerten und Optimierungsmöglichkeiten entwickeln. Wird das Gerät in der Nähe von Türen und Schleusen eingesetzt, sind an

hand der Zugbewegung des Nebels Rückschlüsse auf die Druckverhältnisse zwischen den aneinandergrenzenden Räumen möglich. Der Transport des Nebels beispielsweise aus dem Raum heraus, ist ein Indiz, dass der angrenzende Raum ein geringes Druckniveau aufweist. Eine regelmässige Aufgabe von Reinraumexperten ist auch die Prüfung der Aktivität der Abluftfilter im Reinraum. Wird der Testnebel vor deren Ansaugfläche generiert, so müsste er direkt vom Abluftfilter

eingesaugt werden. Sollten Gegenstände in der Nähe des Abluftfilters positioniert sein, können Reinraumzuständige zudem mittels der Strömungsvisualisierung eine Abschätzung treffen, ob die Funktionalität des Filters (Absaugen der Raumluft) durch die Gegenstände minimiert wird.
Innovationsfokus auf Unabhängigkeit und Flexibilität
Der Nebelgenerator CFG 291 setzt nicht nur auf ein handliches Design und ein geringes Gewicht. Vor allem die Unabhängigkeit der Kunden steht bei dieser Technologie im Vordergrund. Dafür werden drei handelsübliche Lithium Ionen Akkumulatoren genutzt, die eine autarke Stromversorgung garantieren. Sind die Akkus entladen, können sie vom Kunden direkt gegen aufgeladene Akkus getauscht werden. Dank externer Lademöglichkeiten entfallen weitere Wartezeiten.
Das Befüllen des Nebelgenerators ist ebenso schnell und mühelos umsetzbar mit Hilfe des mitgelieferten Befüll Systems. Die Menge kann je nach Anwendung frei gewählt werden, selbst das Entleeren des Tanks ist möglich.
Das Herzstück des Nebelgenerators – der eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Verdampfer – ist in einer leicht zugänglichen und austauschbaren Kartusche an der Gerätefront platziert. Im Falle eines Defektes entfallen lange Servicezeiten. Nutzer können die Kartusche noch im Reinraum eigenständig tauschen und sofort weiterarbeiten. Im Anschluss senden sie die defekte Kartusche zum Service ein, während weitere Projekte mit dem Nebelgenerator nahtlos stattfinden können.
Weitere Informationen
Topas GmbH
D 01237 Dresden
sales@topas gmbh.de www.topas gmbh.de
Aufwändige Prozesse unter Containment-Bedingungen sind durch Kostendruck, Fachkräftemangel und zusätzliche Sicherheitsanforderungen mit wachsenden Herausforderungen verbunden. Die Zukunft repetitiver Prozesse unter Containment-Bedingungen liegt daher in der Laborautomatisierung.
Nicht zuletzt durch die Neufassung des Annex 1 der EU-GMP sind die Auflagen an Hersteller und Forschungseinrichtungen weiter gestiegen. Ausdrücklich werden nun Robotersysteme zur Einhaltung der Hygienevorgaben genannt. Dabei spielt der Aspekt des Containments eine ausserordentlich wichtige Rolle, um den Schutz des Produktes sicherzustellen. Nach der im neuen Annex 1 genannten Contamination Control Strategy (CCS) müssen Hersteller Risiken in ihren Prozessen und Verfahren identifizieren und bewerten, Möglichkeiten zur Risikominimierung prüfen und vorbeugende Massnahmen festlegen. Die CCS erstreckt sich u. a. auf das Design von Anlagen und Prozessen, die Räumlichkeiten und die Ausstattung. Im Mittelpunkt stehen die Risiken durch:
– mikrobielle Kontamination – Kontamination durch pyrogene oder endotoxine Partikel – partikuläre Kontamination
Mit Robotik neuen Herausforderungen begegnen
Die Risiken beim Umgang mit gefährlichen Substanzen sind vielfältig und von vielen Faktoren abhängig. Fehler können verheerende Folgen haben. Aber auch wirtschaftliche Aspekte müssen berücksichtigt werden, um im Markt handlungsfähig zu bleiben.
Faktor Mensch: Der zunehmende Fachkräftemangel wirkt sich auch auf das Angebot geschulter und geeigneter Mitarbeitenden aus. Darüber hinaus sind viele Aufgaben im Labor repetitiv und binden wertvolle Arbeitskräfte an zeitaufwändige Standardtätigkeiten. Mit der Robotik werden Aufgaben autonom durchgeführt und Mitarbeitende für komplexere und kreativere Tätigkeiten freigesetzt.
Faktor Produktivität: Automatisierte Systeme können rund um die Uhr arbeiten. So lässt sich die Ausbeute ohne zusätzliche Arbeitskräfte oder Produktionseinrichtungen durch Verlängerung der Be -

Der in der Sicherheitswerkbank integrierte Roboter entnimmt die Vials aus einem Magazin, übergibt sie an eine Füllstation zur Dosierung der Injektionslösung mit gravimetrischer Überwachung der Füllmengen, setzt die Stopfen ein und verschliesst die Vials. Ein intuitiv bedienbares Display ermöglicht die Konfiguration von Parametern für verschiedene Flaschengrössen, Füllmengen und Chargengrössen (Bilder: Goldfuss Engineering).
triebszeiten steigern. Das kann auch die Zeit bis zur Markteinführung neuer biotechnologischer oder pharmazeutischer Produkte verkürzen. Neue Entwicklungen erreichen früher die Marktreife und sichern die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile.
Faktor Konsistenz: Die Präzision der Robotik in der Laborautomatisierung ermöglicht es, Experimente mit einer Konsistenz durchzuführen, die manuell kaum zu erreichen wäre. Dies verbessert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und trägt zur Validität wissenschaftlicher Studien bei. Für die Produktion bedeutet es die zuverlässige Einhaltung vorgegebener Standards.
Containment in der Laborautomatisierung
Die Automatisierung bietet in allen Bereichen des Laborbetriebs von medizinischen Anwendungen bis zur Mikrobiologie und der Forschung mit zellbiologischen Aufgabenstellungen viele Anwendungsmöglichkeiten. Von der Lagerlogistik für Laborware und Probengefässe über die Filtration und Inkubation bis hin zur Detektion von Kolonien ist der gesamte Workflow mit Robotern automatisierbar. Dabei ist der Einsatz von Robotik nicht nur bei grossen Losgrössen sinnvoll, sondern kann schon bei kleinen Batches effizient sein. Der verstärkte Einsatz von Robotiklösungen markiert einen ökonomisch sinnvollen Weg zu mehr Sicherheit. Wo mit hochaktiven und potenziell gefährlichen Substanzen gearbeitet wird, ist ein effektives Containment unerlässlich. Automatisierte Isolatoren und geschlossene Systeme ermöglichen es, dass selbst hochpotente Substanzen sicher gehandhabt werden können, ohne die Gesundheit des Personals oder die Integrität des Produkts zu gefährden. Die Anwendungsmöglichkeiten im Labor sind sehr vielseitig:
–
Magazinieren von Behältnissen und Proben, Öffnen und Schliessen von Gefässen, Dosieren von Feststoffen und Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskositäten bis in den Kleinstmengenbereich
– Aufbereiten der Proben durch Mischen, Schütteln, Zentrifugieren, Erhitzen oder Kühlen
– Liquidhandling mit Pipetten und verschiedensten Pumpensystemen
– Automatisierte Kultivierung von verschiedenen Zelllinien in Nährmedien für Asseys und Screening unter Reinraumbedingungen
– Zellwachstum und Ernte in verschiedenen Gefässen wie Mikrotiterplatten, Petrischalen, Flaschen oder Multi- LayerGefässen
– Kultivierung von Zelllinien in verschiedenen Gefässen: Inkubation, Medienwech -

sel, Splitten und Ernten, Zentrifugation, Zellzählung und Konfluenzüberwachung – Einwiegeprozesse, Pipettierautomation und Abfüllung
Anwendungen in der Biopharma Ob für Aufgaben in Bereich Forschung, Anlegen von Gewebekulturen, Probenvorbereitung, zellfreien Bioproduktion oder Analytik – Laborautomatisierung kann auch für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Effizienzsteigerung in Life Sciences und Biotechnologie entscheidend sein. Die Suche nach neuen pharmazeutischen Wirkstoffen, Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern ist sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden. Weltweit wird an innovativen Verfahren geforscht, die der Therapie von Erkrankungen, der nachhaltigen Rohstoffsynthese oder der Energiegewinnung dienen. Erst die Laborautomatisierung ermöglicht, dass wissenschaftliche Entwicklungen schnell von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung gelangen. Ohne moderne Analyseautomaten ist die wirtschaftliche Durchführung dieser vielfältigen Prozesse nicht denkbar, da es in Zukunft immer mehr auf geringe Testkosten, schnelle Verarbeitung und leichte Interaktion mit LIS/HIS-Systemen ankommt.
Anwendungen in der Pharmazie Besonders bei Arzneimitteln in flüssiger Form stellt die aseptische Herstellung und Abfüllung eine besondere Herausforderung dar. Während pulverige Substanzen weniger kritisch in der Verarbeitung sind, ist dies bei flüssigen Darreichungsformen deutlich komplexer. Pulver lassen sich besser vor dem Verpacken sterilisieren als z. B. biotechnisch hergestellte Liquida, die zur Injektion vorgesehen sind. Diese Substanzen gehen direkt in die Blutbahn, wohingegen Pulver oder Tabletten häufig erst in der Darmpassage ihre Wirkung entfal -

ten, nachdem diese «natürlich» im Magen des Patienten von eventuell verbliebenen Keimen befreit wurden. Die aseptische Abfüllung in einem automatisierten Prozess, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, wird künftig ebenso an Bedeutung gewinnen, wie eine personalisierten Medizin oder die wirtschaftliche Entwicklung und Synthese neuer Wirkstoffe. Nicht zuletzt muss hier auch der Aspekt des Kostendrucks im Gesundheitswesen mitberücksichtigt werden.
«Fill and Finish» individueller Injektionslösungen
Die Abfüllung von Vials mit Injektionslösungen stellt hohe Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Flexibilität. Der Prozess erfolgt in der Regel in Reinräumen, die eine kontrollierte Umgebung mit geringer Partikel- und Keimbelastung bieten. Für kleine Losgrössen ist die Abfüllung mit konventionellen Anlagen oft unwirtschaftlich und zeitintensiv, da sie einen grossen Rüstaufwand und einen hohen Materialeinsatz verursachen. In einem von Weiss Technik und Goldfuss Engineering gemeinsam konzipierten System simuliert eine roboter-gestützte Abfüllanlage beispielshaft für kleine Losgrössen, wie eine automatisierte und präzise Abfüllung von Vials mit einer individuellen Injektionslösung effizient und sicher erfolgt. Die Anlage besteht aus einer Sicherheitswerkbank gemäss ISO 5 bzw. Klasse A Reinraumbedingungen mit einem integrierten Roboter in Pharmaausführung. Der Roboter nimmt mit seinem Dreifachgreifer nacheinander den Stopfen, den Deckel sowie das leere Vial aus den Magazinen auf. Zunächst wird das Vial in der Abfüllstation platziert, wo es über eine Dosierpumpe mit Injektionslösung befüllt wird. Eine integrierte Präzisionswaage mit der Genauigkeit von 0,1 mg überprüft gravimetrisch den Füllstand der Vials. Ein
Regelalgorithmus minimiert die Abfülltoleranzen der Charge. Nach der Abfüllung wird vom Roboter direkt der Stopfen eingesetzt und das verschlossene Vial in die Verschlussstation transportiert. Dort wird die Kappe auf das Vial aufgesetzt und mit einem Werkzeug vercrimpt. Optische Sensoren überwachen jeweils die exakte Positionierung von Stopfen und Verschlusskappe. Zuletzt setzt der Roboter das fertig abgefüllte und verschlossene Vial in das Ausgabemagazin. Abhängig von den Volumina dauert das Abfüllen und Verschliessen eines Vials rund 30 Sekunden.
Die Sicherheitwerkbank bietet eine laminare Luftströmung, die dem First-Air-Prinzip gemäss Neufassung des EU-GMP Annex 1 «Manufacture of Sterile Medicinal Products» folgt. Diese Anlagen lassen sich modular aufbauen, die Durchsatzzahlen sind nach Bedarf skalierbar.
Gebündelte Kompetenz
Weiss Technik ist ein kompetenter Anbieter von anspruchsvollen Reinluft- und Containment-Lösungen. Das Produktprogramm umfasst unter anderem BarrierSysteme, Laminar-Flow-Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren, Schleusensysteme und Stabilitätsprüfsysteme. Zusammen mit der auf Robotiklösungen spezialisierten Goldfuss Engineering GmbH werden Automatisierungssysteme für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen unter Containment-Bedingungen in Biotechnologie- und Pharmalaboren entwickelt.
Weitere Informationen
Weiss Technik AG CH-8852 Altendorf info.ch@weiss-technik.com www.weiss-technik.com
In GMP-kritischen Bereichen ist dokumentierte Hygiene kein «Nice-to-have» – sie ist Pflicht. Papierchaos, Excel-Listen und analoge Freigaben reichen nicht mehr. «Digital GMP» hebt das Hygiene-Monitoring auf ein neues Level: Echtzeit-Daten, lückenlose Rückverfolgbarkeit, automatische Prüfpfade. Willkommen in der Ära der hygienischen Beweiskraft.
Sauberkeit war schon immer ein zentraler Bestandteil der Good Manufacturing Practice (GMP). Doch in einer Welt, in der Audits detaillierte Nachweise fordern, reicht es längst nicht mehr, nur zu reinigen – man muss es auch beweisen können. Und zwar digital, manipulationssicher und in Echtzeit.
Papier ist geduldig – aber nicht auditfest
Ob FDA, Swissmedic oder EMA – die Anforderungen an die Dokumentation von Reinigungs- und Dekontaminationsmassnahmen sind gestiegen. Analoge Checklisten, unleserliche Unterschriften oder Excel-Tabellen mit Lücken gehören der Vergangenheit an. Behörden verlangen digitale Nachweise, die jederzeit lückenlos und nachvollziehbar sind. Hier kommt Digital GMP ins Spiel: ein Konzept, das die Hygieneüberwachung in sensiblen Zonen auf das nächste Level hebt.
Digital GMP: Hygiene wird zur Datenfrage
Digitale Dokumentation ersetzt unsichere manuelle Prozesse und bringt zahlreiche Vorteile. Das Ergebnis: Kein «Ich glaube, es wurde gereinigt», sondern ein «Hier ist der digitale Nachweis.»
Enzler h-tec: Innovation trifft Praxis Unter dem Label Enzler h-tec setzt ein spezialisiertes Service-Team der Enzler Gruppe auf die digitale Zukunft. Aktuell evaluiert es ein GMP-konformes Framework, das Reinigung, Monitoring und Do -

kumentation modular miteinander verbindet. Das Ziel: eine praxisnahe, validierbare Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integriert.
Warum das wichtig ist?
Weil Vertrauen alles ist – in Produkte, Prozesse und Menschen. Wer dokumentiert, schützt. Wer digital dokumentiert, sichert.
Digital GMP ist mehr als nur ein technischer Fortschritt. Es ist der nächste logische Schritt in der Qualitätskontrolle. Wer
heute reinigt, muss morgen beweisen können: was, wann, wo und durch wen –und das digital. Das Enzler h-tech-Team wird gemeinsam mit seinen Kunden die Standards neu definieren.
Weitere Informationen
Enzler Hygiene AG Simon Beyer, Geschäftsführer info@enzler-htec.ch www.enzlerh-tec.com
Besuchen Sie auch unser
In den letzten Monaten hat sich das Laborteam der Unifil AG, eines Familienunternehmens aus Niederlenz mit Fokus auf die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Filtern für die Klimafiltration, personell verändert.
Nach vielen Jahren engagierter Mitarbeit durfte Andy Bernhard seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Thomas Mosimann, der bisherige Laborleiter, hat sich beruflich neu orientiert. Für ausgewählte Projekte steht er weiterhin mit seinem wertvollen Know-how zur Verfügung – zur Freude aller Kolleginnen und Kollegen.
Neu leitet Christian Sirtl das Labor-Team, das durch Felix Bots ergänzt wird. Beide bringen fundierte Fachkenntnisse und neue Impulse mit und sorgen gemeinsam für frischen Wind im Labor. Sie tragen dazu bei, dass die hohen Qualitätsstandards weiterhin gewährleistet und auch zukünftige Herausforderungen kompetent gemeistert werden.
Christian Sirtl ist Dipl.-Ing. (FH) für Textile Technologie und bringt viel Erfahrung aus den Bereichen Filtermedien- und Filterentwicklung mit. Darüber hinaus hat er sich vertiefte Managementkenntnisse als MAS Wirtschaftsingenieur ZFH erarbeitet (Master of Advanced Studies/ Zürcher Fachhochschule). Zuvor war er als Technologieingenieur, Projektleiter und Leiter eines Prüf- und Entwicklungslabors in verschiedenen Unternehmen tätig.
Er freut sich, dass er bei der Unifil seine Industriekenntnisse aus den Bereichen OEM-Komponentenherstellung, Produktund Qualitätsentwicklung sowie Qualitätsmanagement einbringen kann. Strukturierte Abläufe schätzt er genauso wie eine offene Kommunikation und Teamarbeit. Er engagiert sich ehrenamtlich als Trainer und Ausbilder für Rettungsschwimmen. In seiner Freizeit kocht und grillt er gerne. Felix Bots hat eine Ausbildung als Chemielaborant EFZ absolviert und eine Weiterbildung zum Dipl.-Qualitätsmanager NDS HF abgeschlossen (Qualifikation für leitende Funktionen im Qualitätsmanagementbereich). An seiner Arbeit schätzt er besonders die Kombination aus Präzision, analytischem Denken und dem direkten Beitrag zur Produktsicherheit. In seiner Freizeit interessiert er sich für Segeln und

Wintersport, am liebsten verbringt er jedoch Zeit mit Familie und Freunden.
Sicher ist sicher!
In Lüftungsanlagen spielen Luftfilter eine wesentliche Rolle. Egal, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause: Überall besteht das Bedürfnis nach guter Luftqualität und gleichzeitig der Wunsch nach einer energieeffizienten Lösung. Um die Luftfilter laufend weiterzuentwickeln und zu verbessern, verfügt die Unifil AG seit Jahren über eines der modernsten Filterprüflabore in Europa.
Das dort verfügbare AFS-150-Testsystem steht für Gesamtprüfungen nach EN 1822 und ISO 29463 zur Verfügung. Schwebstofffilter der Klassen E10 bis U17 können lokal auf Leckfreiheit geprüft werden. Zudem können der integrale Gesamtwirkungsgrad ermittelt und der Druckverlust

gemessen werden. So wird sichergestellt, dass alle Kunden erhalten, was sie bestellt haben: Filter, hergestellt nach höchsten Qualitätsansprüchen.
Feldversuche, Schulungen und internationale Anerkennung Feldversuche sind ein fester Bestandteil der Produktentwicklung. Die Planung, Betreuung und Auswertung dieser Versuche gehören ebenso zu den Aufgaben des Labors wie Schulungen für Kunden oder Hochschulen. Auch international ist das Unifil-Filterprüflabor anerkannt. Es steht weltweit mit anderen Prüfinstituten, Filterexperten und Prüflaboren von Filtermedienherstellern in Kontakt. Als einziges Schweizer Luftfilterlabor nimmt es an internationalen Round-Robin-Versuchen teil, bei denen verschiedene Labore ihre Messergebnisse untereinander vergleichen. Dadurch ist eine laufende Überprüfung und Vergleichbarkeit der Genauigkeit der Messsysteme im Labor gewährleistet. So enden Innovation und Qualität nicht etwa im Filterprüflabor – sie beginnen dort.
Weitere Informationen
Unifil AG Filtertechnik Industriestrasse 1 5702 Niederlenz
Tel. 62 885 01 00 www.unifil.ch
Die präzisen Differenzdruck-Messumformer der P 26 und P 34 Serie von Halstrup-Walcher erreichen in kleinen Druckbereichen eine hohe Messgenauigkeit und Stabilität.

Mit diesen High-End-Transmittern können beispielsweise die Druckkaskaden in Reinräumen oder in sauberen Produktionszonen kontinuierlich überwacht werden. Dies dient sowohl der Produktionsqualität als auch dem Personenschutz. Dank des induktiven Messprinzips sind sowohl Langzeitstabilität als auch ein adäquates Temperaturverhalten gewährleistet. In Kombination mit Wirkdruckgebern können die Druckmessumformer auch zur Volumenstrommessung eingesetzt werden.
Produkteigenschaften:
hochpräzise Messumformer für kleinste Messbereiche von ± 10 Pa – Messgenauigkeit je nach Ausführung 0,2% oder 0,5% FS – hohe Überlastsicherheit durch eingebautes Ventil – integrierte zyklische Nullpunktkorrektur für höchste Langzeitstabilität
Weitere Informationen Swissfilter AG CH-5037 Muhen info@swissfilter.ch swissfilter.ch
Im Zuge der europäischen Anstrengungen zur Intensivierung der eigenen Verteidigung rücken Elemente der Reinraumtechnik stärker ins Rampenlicht – zum Beispiel Filtertechnik zur Maximierung der Einsatzbereitschaft von Militärflugzeugen.
Da geht es beispielsweise um die Kühlluft für die Rüstungs- und Bordelektronik. Wasser und feste Partikel müssen aus der Kühlluft entfernt werden, um die Zuverlässigkeit aller Systeme zu gewährleisten.
Zu ihnen zählen beispielsweise Kommunikations-, Navigations-, Flugkontroll- und Überwachungssysteme.
Kühlsysteme werden mit der zunehmenden Bedeutung der Elektronik in Flugzeugen der

Wenn es darauf ankommt, müssen Rüstungs- und Bordelektronik funktionieren, wobei auch das richtige Filtersystem seinen Anteil hat. (Bild: Adpic)
Luftwaffe sogar immer wichtiger. Das Stichwort lautet hier: «Fly-by-wire»-Technologie. Wer speziell im militärischen Bereich vorn dabei sein will, muss selbstverständlich die militärischen Spezifikationen der Flugzeuge von Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Denel Aeronautics oder Bell Helicopter kennen (z.B. A300/310, A320, B737, B747, B757, B767, B777 sowie der Hubschrauber AH64, CH-53K, Rooivalk und V-22). Die Filtersysteme müssen speziell dafür die passenden Lösungen anbieten.
Weitere Informationen
Pall (Schweiz) AG CH-1700 Fribourg https://www.pall.com/en/ aerospace.html# www.pall.com
Der neue «HygroFlex Advanced HF5A» von Rotronic kombiniert Feuchte-, Temperaturund Taupunktmessung mit Smartphone-Kompatibilität. Der Messumformer ist dank der integrierten NFC-Technologie besonders einfach konfigurierbar.
Der kompakte, wandmontierte «HF5A» im robusten IP65-Gehäuse ist für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert. Er misst relative Feuchte (0 100% rF) und Temperatur (–100 °C bis +200 °C) und er-


möglicht psychrometrische Berechnungen wie den Taupunkt. Optional sind CO2- und Differenzdruckmessungen verfügbar. Das LCD-Display zeigt bis zu drei Parameter gleichzeitig an und verwendet Farbcodes für den Betriebszustand (grün), die Ausgangssimulation (orange) und den Alarm (rot). Zur Standardausstattung gehören analoge 4–20 mA-Ausgänge und digitale RS485-Ausgänge. Die Konfiguration erfolgt mit der Rotronic HygroSoft-App oder PC-Software per Smartphone oder NFCUSB-Lesegerät – für eine intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung.
Rotronic ist ein Unternehmen von DwyerOmega (vormals Process Sensing Technologies) und verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Präzisionsmessgeräten, die weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt werden. Rotronic stellt an der Ilmac Basel aus in Halle 1.0, Stand B173.
Weitere Informationen
Rotronic AG
8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 838 11 11 www.processsensing.com


Eine Forschergruppe unter Federführung der Universität Leiden hat ein neues Kalkulationsverfahren für den Energiebedarf von Reinräumen vorgeschlagen und unterstreicht mit ihren ersten Ergebnissen vor allem die Bedeutung des Standorts.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströmung und andere Parameter unterliegen in Reinräumen einer striken Kontrolle, und das kostet Energie. Die Autoren einer aktuellen Studie mit dem Titel «Quantifying the present and future environmental sustainability of cleanrooms» [https://doi. org/10.1016/j.crsus.2024.100219] haben mit einer komplexen Kalkulation den Bedarf von Reinräumen in der Zukunft abgeschätzt. Unter Berücksichtigung möglicher klimatischer Veränderungen erhielt die Forschergruppe 68 Trillion Einzelergebnisse.
Eine wichtige Schlussfolgerung lautet: Für den nachhaltigen Betrieb eines Reinraums

Der beste Standort eines Reinraums hängt von den klimatischen Bedingungen in seiner Umgebung ab, wobei deren Veränderungen über den ganzen Lebenszyklus zu berücksichtigen sind. (Bild: Adpic)
hat sein Standort eine herausragende Bedeutung. Denn wie heiss und feucht es in seiner direkten Umgebung ist, das entscheidet über den Energiebedarf zur Konstanthaltung der Parameter im Reinraum. Der Betreiber hat damit eine wesentliche Stellschraube in der Hand und kann unter Verwendung des neuen Kalkulationsmodells den Standort gezielt wählen. Nun kommt es darauf an, das Rechenverfahren auf konkrete betriebliche Fragestellungen anzuwenden und so einen echten Nutzen daraus zu ziehen.
Weitere Informationen https://www.universiteitleiden.nl
Carbogen Amcis, ein Unternehmen in der pharmazeutischen Prozessentwicklung und der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen mit Sitz in Bubendorf, hat die erste Inspektion für seine im Februar 2023 eröffnete aseptische Arzneimittelherstellung in SaintBeauzire, Frankreich, erfolgreich bestanden.
Dies teilte das Unternehmen am 24. März 2025 mit. Der Standort hatte von der französischen ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) zunächst die Genehmigung zur Herstellung, Prüfung und Freigabe von Arzneimitteln ab Februar 2023 bekommen und arbeitet seither im Rahmen dieser Genehmigung. Die erste klinische Charge wurde im Januar 2024 freigegeben. Die aktuelle Inspektion ist Teil eines ANSMRoutineprozesses. Carbogen Amcis hat damit ein GMP-Zertifikat für die Anlage erhalten; so entspricht sie in jeder Hinsicht den aktuellen Standards für sterile Arzneimittel gemäss dem Annex 1 des EU-GMPLeitfadens. Dieses ermöglicht die Herstel -

Die Anlage der Bubendorfer Carbogen Amcis in Frankreich: Tanks mit Kapazitäten von bis zu 400 Litern, flüssige und lyophilisierte Formulierungen, vollintegrierte Isolatoren für das Handling empfindlicher oder hochpotenter Wirkstoffe. (Bild: Carbogen)
lung und Freigabe von klinischen und kommerziellen sterilen Arzneimitteln. Der 9.500 Quadratmeter grosse Standort verfügt über zwei vollautomatische Produktionslinien für flüssige und lyophilisierte Arzneimittel. Insbesondere sind Isolatoren für das Handling empfindlicher oder hochpotenter Wirkstoffe integriert. Damit decken die Produktionslinien ein breites therapeutisches Spektrum ab, darunter auch vielversprechende innovative Therapien (z.B. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate).
Weitere Informationen
Carbogen Amcis CH-4416 Bubendorf https://www.carbogen-amcis.com
Laborflaschen aus hochreinen Tetrafluorethylen-Perfluoralkoxyvinylether-Copolymeren (PFA) werden für die Spurenanalytik und andere ultrareine Laboranwendungen zunehmend unverzichtbar.
Es ist wie bei kommunizierenden Röhren: Auf der einen Seite bewegen sich die Nachweisgrenzen in der Elementspurenanalytik im Parts-per-billion- oder gar Parts-per-trillion-Bereich und sinken weiter. Entsprechend steigen auf der anderen Seite die Anforderungen an die eingesetzten Laborgefässe.
Bewährte Behältermaterialien wie Glas, Quarz, Polyethylen und Polypropylen reichen nicht mehr, denn sie können durch Wechselwirkungen des Gefässmaterials mit der Probe oder einer Referenzlösung Konzentrationsänderungen hervorgerufen und die Analysenergebnisse verfälschen. Anders bei Laborflaschen aus hochreinem PFA. Dieses Copolymer zeigt sich gegenüber nahezu allen Chemikalien als beständig. Damit eignet es sich für die Ultraspurenanalytik, die Halbleiter-Prozessanalytik, verschiedene Bereiche der Werkstoff- und Materialwissenschaften, für die Bioanalytik mit kleinsten Proteinkonzentrationen und überall dort, wo es auf ultrareine Bedingungen ankommt.

In der Spurenanalytik bietet sich unter den verschiedenen Materialien für Laborgefässe mit immer grösserem Nachdruck hochreines Tetrafluorethylen-PerfluoralkoxyvinyletherCopolymer als das zuverlässigste an. (Bild: Adpic)
Zu den typischen Verwendungszwecken von PFA-Laborflaschen zählen die Aufbewahrung von hochreinen Flüssigkeiten, flusssäurehaltigen und alkalischen Lösun -
gen, die Langzeitlagerung von ultrareinen Flüssigkeiten (HNO3, HCl, HF, H2O, H 3PO 4, H2SO 4 etc.), aber auch von Standards und Proben mit kleinsten Elementkonzentrationen (ng/L bis µg/L) sowie von wertvollen molekularbiologischen Proben mit kleinsten Proteinkonzentrationen. Hinzu kommen generell die Bruchsichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten, Ätzmischungen und Prozesschemikalien sowie Anwendungen bei der Probenahme von sensiblen Stoffen und Gasen.
Tipp für das Labor: Als besonders praktisch erweisen sich PFA-Flaschen mit GL45-Normgewinde. Denn dieses eignet sich beispielsweise für die Kombination mit Flaschenaufsatz-Dispensern oder für den Flüssigkeitstransfer innerhalb geschlossener und steriler Systeme.
Weitere Informationen
AHF analysentechnik AG D-72074 Tübingen info@ahf.de www.ahf.de

In der Pharmazie und Medizintechnik verschmelzen Reinraumproduktion und Sterilverpackung, werden systematisch gemeinsam automatisiert, und über eine RFID gestützte Chargenverfolgung auf Produktebene entsteht eine transparente Kette vom Reinraum bis zum Anwender des Medizinprodukts bzw. zum Patienten.
Klassisch war die Reinraumproduktion mit dem fertigen, reinen Produkt abgeschlossen. Dort endet auch die hohe Automatisierung, und in einem separaten Verpackungsbetrieb griffen wieder mehr Hände in den Prozess ein. Sie notieren Daten, erfassten damit Chargeninformationen. Wenn aber Fehler passierten oder gar ein Rückruf nötig wurde, war die Rückverfolgung schwierig und aufwendig.
Behördliche Vorgaben – Verpackung im Fokus
Nun liessen die regulatorischen Anforderungen (z.B. GMP, Vorgaben der Food and Drug Administration FDA) schon immer eine möglichst weitgehende Automatisierung im Reinraum als wünschenswert erscheinen. Zunächst entwickelten sich Mischformen mit teilautomatisierten Prozessen und mit einer teildigitalen Datenerfassung.
Gleichzeitig erhielten sterile Primärverpackungen (z. B. Blister, Beutel, Flaschen) eine neue Bedeutung als kritischen Komponente schon bei der Zulassung von Medizinprodukten und Pharmazeutika. Denn hier muss vom Pharma GradeRohstoff über die Reinraumproduktion nach DIN 14644 (z.B. Reinraumklasse 5) und nach Guter Herstellungspraxis (GMP) bis zum validierten Sterilprodukt (z.B. ISO 111372) alles stimmen. Dazu zählt auch die Verpackung des Produkts, beispielsweise die Doppelverpackung in verschweissten Beuteln aus LDPE gemäss dem US oder dem Europäischen Arzneibuch.
Die Impulse sowohl von der regulatorischen Seite als auch von der Entdeckung der strategischen Bedeutung der Verpackung führen die Hersteller (1) zu einer Zusammenführung von Reinraumproduktion und Verpackungsbetrieb zu einem Ganzen, das dann konsequenterweise ganzheitlich automatisiert wird, und (2) zu einem selbstverständlichen Einsatz von RFID Tracking über die Sekundärverpackung (z.B. in Kartons) und den Versand bis hin zum Endverbraucher, also nicht nur auf Chargenebene, sondern auf der Ebene der einzelnen Produkte. Ein jedes von

Abb. 1: Automatisierung und Digitalisierung: auf dem Weg zur kompletten Rückverfolgbarkeit von der Produktion im Reinraum bis zum Endverbraucher. (Bilder: Adpic)
ihnen lässt sich über die Transponderdaten unmittelbar bis zu seiner Produktion im Reinraum zurückverfolgen. Insbesondere kann bei einem Rückruf oder bei einer Abweichung von den genehmigten Prozessen, Verfahren, Anweisungen, Spezifikationen oder Standards der Weg jedes einzelnen Produkts durch die Produktion, Verpackung und Auslieferung nachvollzogen werden.
Rein und verpackt
So kann das dann in der Realität aussehen: Im Reinraum arbeiten ohne menschliches Zutun viele Förderbänder und Greifarme automatisch. Sie beladen AGVs (Automated Guided Vehicles) mit dem Medizinprodukt oder Medikament, fahren es hinüber zum Primärverpackungsbetrieb, und dort entladen wiederum Greifarme die AGVs und geben das Produkt weiter zur automatischen Heiss oder Ultraschallversiegelung.
In Abhängigkeit vom Produkt lassen sich allerdings unterschiedliche Integrationsgrade von Reinraumproduktion und Pri
märverpackung als Ziel vorgeben. So wird man etwa bei Implantaten, Spritzen und ähnlich en oder sensiblen Produkten eine Vollintegration der Primärverpackung in die Reinraumproduktion anstreben. Ähnlich verhält es sich bei Produkten, die

Abb. 2: Normen, Richtlinien und viele andere behördliche Massgaben treiben die Entwicklung im Reinraum.
Abb. 3: Eine aktueller Trend: die ganzheitliche Betrachtung von (Reinraum )Produktion und Pharmaverpackung.

Abb. 5: Die Rückverfolgung von Medizinprodukten soll vom Anwender (z.B. eines Tropfs im Krankenhaus) bis zur Reinraumproduktion reichen.
Abb. 4: Ein wesentlicher Baustein für eine gute Rückverfolgbarkeit stellt die RFID Technologie dar.
nach der Verpackung endsterilisiert werden, zum Beispiel durch Gammastrahlen (ISO 11137 2), und bei kleinen Mengen individueller Medikamente, wie sie in der personalisierten Medizin gegeben werden.
Die Primärverpackung, zum Beispiel durch Heissversiegelung oder Ultraschallversiegelung, erfolgt vollautomatisch wie die Produktion im selben Reinraum – keine Hände, keine Wände. Am Ende fällt das fertig verpackte Produkt, bildlich gespro
chen, einfach heraus. Bei Vollintegration stehen dem maximalen Schutz vor Kontaminationen allerdings hohe Aufwendungen für viele reinraumtaugliche Maschinen gegenüber.
Bei Produkten mit hohem Durchsatz oder mit einer komplexeren Verpackung als die Herstellung selbst wird man Produktion und Primärverpackung in aneinander angrenzenden Reinräumen unterbringen und diese durch Schleusen verbinden. Produktion und Verpackung werden bevorzugt
vollautomatisiert, bleiben aber voneinander getrennt und werden oft unterschiedliche Reinraumklassen aufweisen. Dem Vorteil einer einfacheren Wartung des Gesamtsystems und einer einfacheren Planung stehen ein höheres Kontaminationsrisiko beim ProduktTransfer in das Verpackungsmodul gegenüber. Müssen sterile Produkte höchste GMPAnforderungen erfüllen oder ist an eine räumlich getrennte Optimierung von Produktion und Verpackung gedacht, so wird die Verpackung bevorzugt in einem Container oder Isolator innerhalb des HauptReinraums untergebracht. Gegenüber der Variante mit aneinander angrenzenden Reinräumen ist auf diese Weise das Kreuzkontaminationsrisiko verringert, wobei sich allerdings die Anfangsinvestition, der Aufwand während des Betriebs und insbesondere für Validierung und Dokumentation erhöhen.
In jedem Falle erhält im Zuge der Verpackung jedes Produkt automatisch seinen RFID Transponder. Zum Beispiel wir er bei einer typischen Doppelbeutelverpackung als Etikett auf den inneren Beutel geklebt.
Aktuelle Erfolge und Blick in die Zukunft Eine hohe Automatisierung und eine RFID gestützte Rückverfolgbarkeit von der Produktion über die Logistik bis zur Auslieferung an einen Anwender bzw.


Abb. 7: Alles im Blick im Reinraum: Nicht nur auf Chargenebene, sondern sogar auf Produktebene lässt sich alles bis hierhin zurückverfolgen.
Endverbraucher sind zwar in vielen Bereichen wünschenswert, besonders jedoch in der Herstellung und Auslieferung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Denn wenn hier etwas schiefgeht, ist die Wirksamkeit von Therapien gefährdet –mit unter mit gravierenden Folgen für die betroffenen Patienten. Allerdings lassen sich angesichts von Reinraumproduktionen mit scharfen behördlichen Vorgaben und zusätzlichen produktindividuellen Aspekten gerade im Pharma und Medizinproduktebereich diese hohe Automatisierung und RFID gestützte Rückverfolgbarkeit nur mit einem stringenten Konzept und einer intelligenten Implementation umsetzen. Zu den Erfolgsbeispielen zählt beispielsweise eine Produktion/Ver
packung von technischen Bauteilen und Baugruppen für die Pharma und Medizintechnik Branche nach GMP Anforderungen unter Verwendung der Kunststoffspritzgusstechnik (z.B. Nasenspray Zerstäuber, Apothekerdosen mit Schraubdeckel, Tablettenröhrchen mit Federsegment Stopfen, Pöppelmann Famac, Lohne/Niedersachsen).
In Zukunft dürften sich durch eine durchgehende Automatisierung die Reinräume weiter leeren. Mitarbeiter, die heute noch Filter wechseln, Oberflächen reinigen, Stichproben nehmen, Maschinen rüsten und umrüsten sowie bei Störungen mit den Händen eingreifen, werden mehr und mehr die Rolle eines Beobachters und Entscheiders spielen. Auf die dafür benötigten Daten greifen sie bei Bedarf von remote über eine Cloud zu; den Prozess steuern sie mit dem Smartphone oder mit anderen digitalen Endgeräten.
Zusätzliche Unterstützung erhalten sie von Künstlicher Intelligenz (KI). Sie dürfte die Überwachung des Gesamtprozesses noch effektiver machen. Das betrifft besonders die Mustererkennung in Bildern und Spektren. Auf diesem Gebiet verfügt KI bekanntlich über ihre grössten Stärken, so dass sie beispielsweise bei der Tablettenkontrolle «die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen» sortieren und dabei Fehler im Prozess erkennen kann. Chancen für eine zusätzliche Absicherung von Datenintegrität und Prozesstransparenz könnte des Weiteren die Blockchain Technologie bergen. Sie bietet sich zur Validierung und Speicherung von RFID Daten an.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger

Ihre erfolgreiche Suche nach Werbemöglichkeiten!
Bei uns finden Sie wertvolle Anknüpfungspunkte für Ihre Kundenbeziehungen. Im Print und Digital. Sprechen Sie mit uns!
Das pre-use, post-sterilization integrity testing, kurz: PUPSIT, sichert die Integrität von Filtern, kann aber eine beliebig komplexe Sache werden. Abhilfe schaffen konsequente Mitarbeiterschulungen und Single-use-Komponenten.
Die behördlichen Vorgaben für die aseptische Verarbeitung werden strenger. Gemäss den aktuellen regulatorischen Vorgaben der Europäischen Union für die Gute Herstellungspraxis, wie sie im EU GMP Annex 1 festgelegt sind, müssen flüssige Arzneimittel eine Sterilfiltration durchlaufen. Darüber hinaus ist ihre Wirksamkeit durch einen Filterintegritätstest vor der Verwendung, nach der Verwendung und/oder nach der Sterilisation sicherzustellen (pre-use, post-sterilization integrity testing, PUPSIT).
Die genaue Vorgabe kann von Land zu Land variieren. So gilt beispielsweise in der EU nach dem Annex 1 im europäischen Arzneibuch: «vor der Verwendung nach der Sterilisation und nach der Verwendung». Dagegen lässt die US-amerikanische FDA (Food and Drug Administration) dem Hersteller war die Möglichkeit, den Filter zusätzlich vor der Verwendung zu prüfen; das ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Doch die zu beantwortenden Fragen sind im Grunde gleich: Ist die Filterstruktur noch intakt, und darf daher davon ausgegangen werden, dass es eine effektive Risikominderung von Verunreinigungen des Arzneimittels leistet?
Filterintegrität im grossen Zusammenhang
Die Überprüfung der Filterintegrität ist Bestandteil jeder umfassenden Strategie zur Kontaminationskontrolle (contamination control strategy, CCS). Sie zielt darauf, Risiken für die Qualität des Arzneimittels zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren – je kritischer ein Filter eingestuft wird, desto schärfer. Was kann überhaupt einen Filter für den Einsatz in der Sterilfiltration unbrauchbar machen? Da gibt es viele Möglichkeiten: Beschädigung beim Transport, bei der Installation oder an einem anderen Punkt der Handhabung. Da kann über die Filtermembran hinaus auch andere Teile betreffen, wie etwa das Gehäuse, die Stützstruktur, die Anschlüsse – kurz: die gesamte Baugruppe.

Bei der Filtration und bei Filterintegritätstests nach PUPSIT (pre-use, post-sterilization integrity testing) können Single-useKomponenten mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit bringen (hier: Exponate auf der jüngsten Chemie- und Prozesstechnikmesse Achema in Frankfurt am Main).
(Bild: Ehrensberger)
Der Test selbst ist ein (beherrschbares) Risiko
Nun kann sich jedoch PUPSIT selbst zu einem komplexen Verfahren auswachsen. Dieses ist dann neuerlich mit spezifischen Risiken behaftet. Zum Beispiel können den Mitarbeitern im Zuge vieler Einzelschritte Bedienungsfehler unterlaufen. Oder Mikroorganismen dringen durch das Test-Zubehör in den Filter ein.
Die Risiken durch manuelle Arbeitsschritte können durch Automatisierung vermindert werden, aber bei komplexen Systemen (z.B. redundante Filter) und einem komplizierten Aufbau einzelner Filter stösst sie schnell an ihre Grenzen. Für eine zusätzliche Risikominderung kann die Gesamtkeimzahl in der Flüssigkeit, die den Filter benetzt hat, bestimmt werden. Der
Annex 1 lässt übrigens auch die Option einer anderen Risikoabschätzung zu, sollte ein PUPSIT unter Verwendung der klassischen Verfahren (z.B. Bubble-Point-Test, Druckabfalltest) nicht möglich sein. Der betreffende Hersteller muss natürlich dafür sorgen, dass seine Alternative nicht schwächer als PUPSIT wirkt.
Zudem können die für einen Filterintegritätstest verwendeten Hilfsmittel selbst fehlerhaft sein, beispielsweise Lecks aufweisen oder durch ihre Handhabung zu Lecks führen. Als Gegenmassnahme helfen ausführliche Schulungen des Bedienpersonals und/oder die Verwendung von Single-use-Komponenten, gegebenenfalls mit einem speziellen «Poka-Yoke»-Design (japanisch für «Sicherung gegen Fehler»). Und noch etwas: Sollen im Rahmen von PUPSIT ein Monitoring von Durchflussraten erfolgen, so stellt die Umrechnung gemessener Drücke in Durchflüsse ein verbreitetes Verfahren dar. Alternativ dazu steht aber auch eine direkte Bestimmung zur Verfügung; dafür wird das betreffende Filterintegritätstestgerät für das Messprinzip «Volumendosierung» ausgelegt, um die tatsächlichen Durchflussraten aufzuzeichnen.
Nach der Filtration die Abfüllung Um die Ergebnisse eines sorgfältigen PUPSIT-Prozederes nicht nachträglich zu gefährden, ist an Folgendes zu denken: Nach der Sterilfiltration kommt die Sterilabfüllung des Arzneimittels (z.B. in Fläschchen). Für diesen abschliessenden Schritt sind genauso strenge Massstäbe anzulegen.
Bei allen Vorteilen eines konsequenten Vorgehens gemäss PUPSIT löst dieses Verfahren doch auch Diskussionen aus. Skeptiker fragen zum Beispiel danach, ob beim Arbeiten mit kleinen Produktmengen stets ein Filterintegritätstest durchgeführt werden muss bzw. ab welchen Mengen er nötig wird – ein noch offener Punkt.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger
Ein deutscher Forschungsverbund entwickelt ein Verfahren zur intelligenten Qualitätssicherung von Filtermodulen. Ein neues Prüfsystem soll Leckagen automatisch, zerstörungsfrei und in Echtzeit erkennen.
Das Ziel: Die bisher manuelle Qualitätskontrolle in der Membranproduktion grundlegend verbessern, um Produktionskosten zu senken, Umweltstandards zu erfüllen und die Qualität industrieller Filtersysteme zu sichern – effizient, präzise und nachhaltig. Entwickelt wird das Prüfsystem im Rahmen des Projekts «CLeo» unter der Leitung der DBI Gas und Umwelttechnik GmbH. Das Fraunhofer Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächentechnologien AZOM entwickelt dafür ein laserbasiertes Leckdetektionsverfahren und eine KI Auswertung.
Die Nachfrage nach leistungsfähigen Filtersystemen wächst. Getrieben durch verschärfte Umweltauflagen wie die neue EU Abwasserrichtlinie, die eine vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen fordert, leisten Mikro und Ultrafiltrationssysteme einen zentralen Beitrag. Sie sind jedoch bislang auf manuelle, arbeits und zeitintensive Lecktests angewiesen. Diese Verfahren sind weder skalierbar noch nachhaltig. Gleichzeitig steht die Branche vor der Herausforderung, ihre Qualität im Produktionsprozess effizient zu sichern. Herkömmliche Prüfmethoden wie der Blasentest im Wasserbad sind aufwendig, fehleranfällig und nicht automatisierbar. Das Verbundprojekt «Cyber physisches System zur Inline Leck Detektion an Membranfiltrationsmodulen mittels ortsaufgelöster Diodenspektroskopie» (CLeo)
adressiert dieses Problem: Ziel ist ein cyber physisches Inline Prüfsystem, das Leckagen optisch lokalisiert und mithilfe künstlicher Intelligenz direkt während der Produktion auswertet, ohne die empfindlichen Membranen zu beeinträchtigen. «Unser Ziel ist es, mit dem CLeo System eine hochpräzise Leckageprüfung zu ermöglichen, die sich nahtlos in industrielle Fertigungsprozesse integrieren lässt», erklärt Dr. Tobias Baselt, Gruppenleiter für Optische Fasertechnologien am Fraunhofer AZOM. «Durch die Kombination aus laseroptischer Spektroskopie, intelligentem Datenhandling und automatisierter Mechanik entsteht eine robuste Lösung, die Qualität sichert und gleichzeitig Zeit, Ressourcen und Kosten spart.»
Für Umwelt, Industrie und Gesellschaft
Das Prüfverfahren basiert auf ortsaufgelöster Diodenspektroskopie. Ein Prüfgas wird durch das Filtermodul geleitet, potenzielle Leckagen lassen sich über spezifische Absorptionssignale sichtbar machen. Die Daten werden in Echtzeit KI gestützt ausgewertet und Leckagen nicht nur erkannt, sondern punktgenau lokalisiert. So lassen sich Module gezielt reparieren oder selektiv ausschleusen.
Membranfiltration im Wandel Modular aufgebaute Mikro und Ultrafiltrationssysteme sind essenziell für die

Ein Mitarbeiter des Projektpartners WTA Unisol kontrolliert die FiltrationsmembranenQualität. (Bild: carolin.photography)

Die laserbasierte Technologie kombiniert optische Spektroskopie mit KI-gestützter Auswertung und ermöglicht eine automatisierte, zuverlässige Qualitätskontrolle in der Membranproduktion. (Fraunhofer IWS, KI-gestützt bearbeitet)
sichere, platzsparende Reinigung industrieller Abwässer. Doch Fertigungsprozesse wie Kleben und Schweissen führen häufig zu Leckagen – mit aufwendiger Nacharbeit oder Ausschuss zur Folge. Die bisher eingesetzten manuellen Prüfverfahren gelten als Engpass im Produktionsprozess. «CLeo» setzt hier an: Mit digitaler Präzision, automatisierter Erkennung und KI gestützter Analyse soll das Projekt die Weichen für eine skalierbare, wirtschaftliche und ökologisch verantwortungsvolle Filterproduktion stellen. Neben dem ökonomischen Nutzen trägt die Technologie auch zur Ressourcenschonung bei: Prüf und Reparaturzeiten verkürzen sich erheblich und eine Nachbehandlung der Module aufgrund des Wasserbades entfällt. Die automatisierte Erkennung und gezielte Nachbearbeitung reduziert Ausschuss, was einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Produktion darstellt. Darüber hinaus lässt sich das System branchenübergreifend einsetzen. Neben der Wasserwirtschaft profitieren die Lebensmitteltechnik, Pharmazie oder Chemie, in denen absolute Dichtheit essenziell ist.
Weitere Informationen www.iws.fraunhofer.de
Nasenschleim steht in der Beliebtheitsskala der meisten Menschen nicht weit oben, doch nun hat er eine Luftfilterinnovation in Richtung energieeffizienterer Systeme mit höheren Standzeiten angestossen.
Der Schleim, der die Nasenhaare bedeckt, übernimmt eine zentrale Funktion bei der Reinigung der eingeatmeten Luft. Er filtert Pollen und Staubpartikel heraus, die sonst bis in die Lunge vordringen könnten. Forschende haben jetzt gezeigt, dass sich dieses natürliche Prinzip auch auf technische Luftfilter übertragen lässt – generell in Klimaanlagen, speziell in Reinräumen oder in medizinischen Schutzmasken. Ein neuer Filter nutzt eine hauchdünne Flüssigkeitsschicht, um Partikel mithilfe von Kapillarkräften festzuhalten. Dabei bilden sich Flüssigkeitsbrücken zwischen den Staubpartikeln und den Fasern des Filters. Diese verhindern, dass sich die Staubpartikel ablösen und führen zu kompakten Staubaggregaten. Anders als herkömmliche Filter, die sich mit der Zeit zusetzen und die Luftzirkulation behindern, bleibt der neue Filter länger durchlässig – bei gleichzeitig hoher Filterleistung.

Nasenschleim hat selten eine gute Presse, doch am Max-Planck-Institut für Polymerforschung hat er ein internationales Forscherteam zu einer Innovation inspiriert. (Bild: Adpic)

Inspiriert durch die natürliche Filterwirkung des Nasenschleims haben die Forscher einen neuartigen Luftfilter mit Flüssigkeitsbeschichtung entwickelt. (Bild: MPI-P)
Top-Anwendungsbereich: Filter für luftgetragene Partikel
«Die Technologie ist ein Schritt in Richtung langlebiger, energieeffizienter Filtersysteme», sagt Dr. Michael Kappl vom MaxPlanck-Institut in Mainz, einer der beteiligten Autoren. «Besonders beeindruckend ist, dass selbst ultrafeine Partikel im Nanometerbereich zuverlässig gebunden werden.»
Das Projekt vereint Fachwissen aus Südkorea (Chung-Ang University, Incheon National University), den USA (University of Cincinnati) und Deutschland (MaxPlanck-Institut für Polymerforschung).
Federführend war das Team um Professor Sanghyuk Wooh (Chung-Ang University, Seoul), das die zugrunde liegende Idee und das Design entwickelte. Diese neue Filtertechnologie eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche sowie in
Lüftungs- und Klimaanlagen, industriellen Abluftsystemen, medizinischen Schutzmasken, Reinräumen sowie Staub- und Rauchfiltern in städtischen Gebieten. Durch die hohe Partikelbindung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch kann die Technologie langfristig Kosten senken und Umweltbelastungen verringern.
Die Forscher schreiben in der Fachzeitschrift «Nature», dass die neuartigen Filter mit ihren dünnen Flüssigkeitsschichten zu innovativen Filtersystemen für luftgetragene Partikel führen dürften. Dies macht sie insbesondere für Reinräume hochinteressant.
Weitere Informationen www.mpip-mainz.mpg.de
Mit der TAFS (Total Air Filtration Solution) gehen Filterhersteller wie Ärzte an den «Patienten Luftqualität im Reinraum» heran: erst eine standortspezifische Analyse mit anschliessender «Diagnose» des Kontaminationsprofils, dann als «Therapie» eine darauf abgestimmte Auslegung des Filtersystems.
Nach diesem Verfahren lässt sich ein Filtersystem spezifisch für einen bestimmten Reinraum bzw. für eine bestimmte Reinraumumgebung auslegen, um zuverlässig alle relevanten luftgetragenen Verunreinigungen (AMC) einschliesslich flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) effektiv zurückzuhalten.
Vorteile des TAFS-Verfahrens Selbstverständlich müssen die Filter saure und basische Gase, Isopropylalkohol, Aceton, Ozon, deren Reaktionsprodukte sowie Bor- und Phosphorverbindungen erfassen. Durch die präzise Masskonfektion des Adsorptionsmediums wird eine hohe Abscheideleistung bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdruckverlust erzielt. Dies sorgt gleichzeitig für maximale Energieeffizienz und verlängerte Wartungsintervalle. So lassen sich, über die Grundfunktion des Filtersystems hinaus, die Energieeffizienz an das mögliche Optimum heranführen, Filterstandzeiten verlängern und Nachhaltigkeitsziele erreichen (Stichwort: ESG-Anforderungen: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Es versteht sich, dass Filter für AMC die generellen internationalen Normen erfüllen müssen, darunter ISO 9001, ISO

14001, ISO 45001, ISO 14064-1, ISO 14067, RoHS, REACH sowie den ANSI/ ASHRAE-Standard 145.1. Diese Konformität gewährleistet Zuverlässigkeit, Sicherheit und regulatorische Absicherung für Anwendungen in Reinräumen und der Hightech-Fertigung.
Modulare Filtersysteme –werk zeugfreie Wartung
Für den Einsatz in zentralen Zuluftsystemen (MAU, Make-up Air Unit) können modulare Filtereinschubsysteme empfehlenswert sein. Denn damit steht gleichzeitig ein werkzeugfreies Wartungskonzept zur Verfügung. Die Mitarbeiter können die Filtereinschübe schnell und unabhängig voneinander austauschen. Das reduziert Ausfallzeiten und produziert wenig Abfall.
Die Standardrahmenabmessungen für solche Filtereinschubsysteme betragen typischerweise 610 × 610 × 450 Kubikmillimeter (Breite × Höhe × Tiefe). Dort passen mehrere Einschübe hinein, wobei sich die Luftführung vorteilhaft gestalten lässt. Die Materialien für den Rahmen lassen sich an standortspezifische Anforderungen anpassen; er kann zum Beispiel aus Edelstahl, aus verzinktem Stahl


Abb. 4: Die Abmessungen des Rahmens und der einzelnen Filtereinschübe sind in Standardausführungen verfügbar und lassen sich darüber hinaus für die Gegebenheiten vor Ort konfektionieren.
oder thermoplastischem Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS-Kunststoff) bestehen.
Die Königsklasse: Filterindividualisierung Darüber hinaus lassen sich Individualisierungen vornehmen. Das betrifft sowohl die Abmessungen des Rahmens als auch die verwendeten Materialien. So kann das Modul auf Korrosionsbeständigkeit oder kritische Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Anwendungen optimiert werden.
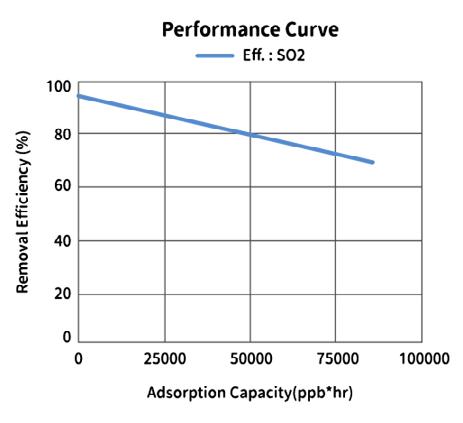
Abb. 1–3: Unterschiedliche Rückhalteprofile für unterschiedliche Substanzen (v.l.n.r.: Ammoniak, Ozon Schwefeldioxid) und vielfältige Anforderungen des Reinraums mit behördlichen und produktbezogenen Auflagen machen ein differenziertes Vorgehen bei der Auslegung eines Filtersystems für luftgetragene Kontaminationen und flüchtige organische Verbindungen wünschenswert: Diagnose zuerst, dann die Konzeption des Filtersystems.

Abb. 5: In jedem Falle lässt sich die Luftführung – auch bei den individuell ausgelegten Ausführungen – für eine möglichst hohe Energie effizienz auslegen.
In jedem Falle führt die exakte Passung der Einschübe mit den Filtern in die Gesamtkonstruktion dazu, dass Baumwollauskleidungen zur Verhinderung von Leckagen sich erübrigen. Das reduziert den Materialeinsatz und vereinfacht die Handhabung. Darüber hinaus lässt sich das Adsorptionsmedium vor Ort einfach austauschen und nachfüllen, während das Gehäuse des Filtereinschubs wiederverwendet wird. Dieses Vorgehen verlängert die Lebensdauer der Komponenten und
verbessert so die Nachhaltigkeit. Sie lässt sich noch auf verschiedene andere Weisen stärken, beispielsweise durch Filter mit geringem Druckverlust. Diese reduzieren den Energieverbrauch, ohne dass die Luftförderleistung beeinträchtigt werden müsste.
Fazit für den Anwender Luftfiltersysteme zur gezielten Abscheidung von AMCs lassen sich heute teilweise massschneidern, mindestens je -
doch konfektionieren. Das erhöht die Energieeffizienz und mindert unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt. Insbesondere der TAFS-Ansatz [https:// www.ge-tek.com/amc-solutions] sorgt für geringe Anfangsdruckverluste, minimiert den Energieverbrauch und reduziert den ökologischen Fussabdruck durch wiederverwendbare Systemkomponenten. Das Verfahren lässt sich unter Berücksichtigung standortspezifischer Anforderungen und der jeweils geltenden Normen in vielen Branchen einsetzen [https://www. ge-tek.com/amc-solutions], so etwa in der Halbleiterfertigung, der Pharmaindustrie, der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge, der Elektronikfertigung sowie bei Anwendungen in der Lüftungs- und Klimatechnik.
Weitere Informationen
GE Technology Inc. (Getek) CN-709015 Tainan City sales@getek.com.tw https://www.ge-tek.com/










Hotec Systems GmbH
Unterdorfstrasse 21
CH-8602 Wangen b. Dübendorf Telefon +41 44 880 07 07 info@hotec-systems.ch www.hotec-systems.ch
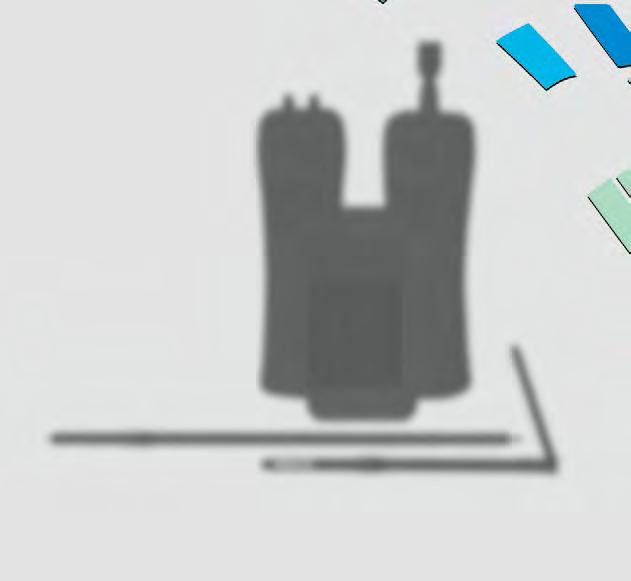



Das grosse Interesse an der Reinraum-und-Prozesstechnik-Messe «Lounges Karlsruhe 2025» manifestierte sich sowohl in den Zahlen (250 Aussteller, 9300 Besucher) als auch in der fachlichen Tiefe – ein Streifzug entlang besonders interessanter Entwicklungen und herausragender Exponate.
Mit dem Mega-Trend zur Elektromobilität kommen auf die Reinraumtechnik schon aktuell neue Herausforderungen zu. Und sie werden vermutlich noch grösser.
Batteriefertigung: energieeffizient zum Tieftaupunkt
Ein brandneues Mini-Environment für die Batterieproduktion kommt im Laufe des Jahres auf den Markt und schickt sich an, ein Doppelproblem zu lösen. Für die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen benötigt man bereits heute extrem geringe Luftfeuchten. Zukünftige Zellmaterialien dürften eher noch schärfere Vorgabe zur Folge haben.
Konkret müssen Taupunkte von –60 °C oder sogar tiefer erreicht werden. (Das heisst: So weit muss die Temperatur gesenkt werden können, ohne dass die relative Feuchte 100 Prozent übersteigt und Wasser auskondensiert.) Schon ein Taupunkt von –30 °C wird als «Tieftaupunkt» bezeichnet. Selbstverständlich müssen auch bei solchen Minusgrad-Taupunkten Mitarbeiterschutz, Produktqualität und Prozesskontrolle gewährleistet sein.
Über die «Herausforderung Tieftaupunkt» hinaus stellt sich als zweite Aufgabe, dabei auch Energiebedarf und Kosten im Griff

zu behalten und gleichzeitig den CO2-Fussabdruck gering zu halten. Der Schlüssel dazu liegt in Mini-Environments mit einem innovativen Luftmanagement. Daran hat die Weiss Klimatechnik, Reiskirchen, im Rahmen des Projekts «Queen – innovative Anlagentechnik für eine nachhaltige Batterieproduktion» mit der Fraunhofer-Ein -

richtung FFB (Forschungsfertigung Batteriezelle) mitgewirkt.
Die Quintessenz: Statt grosser Trockenräume wird die kritische Produktionsumgebung in Mini-Environments eingekapselt. Da die herkömmliche Nassentfeuchtung für die geforderten Tieftaupunkte nicht ausreicht, arbeitet man mit einer Adsorptionstrocknung. Beim innovativen Luftmanagement wirken eine gezielte Materialauswahl, Sensorik, Steuerungs- und Regelungstechnik zusammen. Ausserhalb des Mini-Environments gelten weniger strenge Anforderungen an Reinheit und Trockenheit.
Während bei der Batterieherstellung das Produkt selbst den wesentlichen Impuls zur Innovation gibt, stellen in anderen Bereichen Vorschriften die Markttreiber dar.
Nach Vorschrift und darüber hinaus: Annex 1 und Atex
Im Pharmabereich wirkt sich der «neue» Annex 1 nach wie vor auf Neuentwicklungen aus. Einen weiteren Trend gibt die personalisierte Medizin mit individuellen Arzneimitteln vor, im Extremfalle eine ein -

Im Hintergrund liefen verschiedene Vortragsveranstaltungen mit aktuellen Antworten auf brennende Fragen der Reinraum- und Prozesstechnik.
zige Dosis für einen bestimmten Patienten («Losgrösse 1»). Beides führt unter anderem zu einem ganz neuen Fokus auf sterile Primärverpackungen. Denn sie werden zur kritischen Komponente – schon bei der Zulassung von Medizinprodukten und Pharmazeutika.
Einige Partner der Industrie bringen daher vom Pharma-Grade-Rohstoff über den Produktionsstandard nach Guter Herstellungspraxis (GMP) bis zum validierten Sterilprodukt (ISO 11137-2) die unterschiedlichen Anforderungen zusammen: flexible, verschweissbare und sterile Verpackungen mit LDPE nach dem US- oder dem Europäischen Arzneibuch, Produktion in einem Reinraum der Klasse 5 (ISO 14644-1). So entsteht ein Rundum-Sorglos-Paket für die erfolgreiche Zulassung (z.B. KWP, Gründau).
Von «Losgrösse 1» zum grösseren Massstab
Wo es darum geht, grössere Mengen von Antibiotika, Hormonen, Zytostatika oder anderen hochwirksamen Substanzen herzustellen, bewähren sich modulare Isolator-Systeme für aseptische oder toxische Prozesse. Ein Scale-up erfolgt hier einfach

Die «Lounges Karlsruhe 2025» bot ein breites Spektrum an Verfahren und Produkten rund um Reinraum- und Prozesstechnik- Fortsetzung folgt vom 24. bis zum 26. März 2026.
über die Verbindung eines bestehenden Systems mit weiteren Isolatoren. Dabei ist eine Aufrüstung mit zusätzlichen Dekontaminationseinheiten nicht nötig, denn bei State-of-the-art-Isolatoren erledigt das eine zentrale interaktive Einheit zum Einbringen von Wasserstoffperoxid (H2O2), englisch: Interactive Superinduce Unit (z.B. ISU-Station, Ortner Reinraumtechnik, Villach). Sie erzeugt das Dekontaminationsmittel selbst und erzielt damit bei Raumtemperatur eine «Log-6-Dekontamination». Sie wirkt sowohl gegen Viren, Bakterien und Pilze als auch gegen Schimmel (u.a. HIV, Influenza, Hepatitis, COV). Im Betrieb lässt sich eine sichere Trennung von Bediener und Prozess über eine spezielle Luftführung und das Handling über Handschuheingriffe erreichen. Das Ein- und Ausbringen von Materialien erfolgt über Transferschleusen mit innenliegenden, automatischen Schiebetüren. Diese dekontaminationssicheren H2O2Schnellschleusen lassen sich links oder rechts an den Isolator anschliessen. Zusätzliche Sicherheit geben ein Unterdruckbetrieb (z.B. –10 bis –100 Pa), ein vollintegrierter Handschuh- und Isolator-Lecktest nach ISO 14644-7 und ein 19"-Display zur Bedienung und Überwachung des Prozesses.
Für die Qualitätssicherung (u.a. gemäss Annex 1) empfiehlt sich elektronische Überwachung und Dokumentation über relevante Zeiträume (Audit-Trail). Mit Blick auf den Komfort ist bei der Entscheidung für ein bestimmtes Zytostatika-IsolatorSystem auch auf elektrisch höhenverstellbare Sitz- oder Steh-Arbeitsplätze (z.B. +/– 150 mm), an einen niedrigen Geräuschpegel (z.B. < 60 dB [A]) und an die Auslegung der Bedienung als Plug-&-PlaySystem zu achten.
Die Qualitätssicherung durch kontinuierliches Monitoring dient letztlich der Produktsicherheit von ganzen Chargen. Ziel sind eine schnelle Freigabe und, im Falle von Problemen, die Freigabe wenigstens eines Teils der aktuell produzierten Charge.
Ein Nachweisverfahren dazu basiert auf Biofluoreszenz-Partikelzählern (BFPC), die sowohl lebensfähige Partikel als auch Gesamtpartikel in der Luft in Echtzeit nachweisen und kontinuierlich Proben auf Sedimentationsplatten zur mikrobiellen Identifizierung sammeln. Diese Verbindung von modernen spektroskopischen Messungen mit der traditionellen aktiven Luftprobenentnahme eignet sich insbesondere für die aseptische Produktion und hier speziell für handschuhlose Isolatoren bzw. interventionslose Umgebungen (z.B. Rapid-C+, MBV, Stäfa).
MBV: Biofluoreszenz-Partikelzählern (BFPC) plus traditionelle aktive Luftprobenentnahme – diese Kombination eignet sich insbesondere für die aseptische Produktion und hier speziell für handschuhlose Isolatoren bzw. interventionslose Umgebungen. Dabei arbeiten die BFPC mit laserbasierter Lichtstreuung und Fluoreszenzenspektroskopie. Dies ermöglicht die Detektion verschiedenster Luftmikroben. Zu ihnen zählen beispielsweise Bakterien, Schimmel, Hefe und Sporen.
Zur Dekontamination von Oberflächen mit H2O2 kann die Kaltvernebelung mit einem geeigneten Gerät die Methode der Wahl sein. Besonders viele Interessenten sahen

Biofluoreszenz-Partikelzählern (BFPC) plus traditionelle aktive Luftprobenentnahme –diese Kombination eignet sich insbesondere für die aseptische Produktion und hier speziell für handschuhlose Isolatoren bzw. interventionslose Umgebungen. (Bild: Weiss)
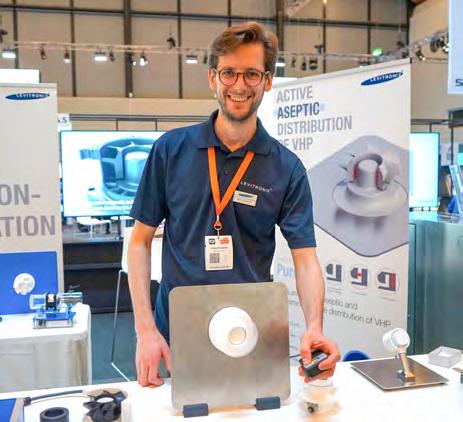
Stefano Trossarello von Levitronix GmbH präsentierte den auf aktiver Magnetschwebe technik basierenden Lüfter für den aseptischen Bereich.

Reinigung, Desinfektion – selbst hartnäckige Rückstände lassen sich von Scheiben entfernen.
sich auf der Lounges das Beispiel eines neuen Lüfters auf der Grundlage der Magnetschwebetechnik an (Levitronix Puro Maglev, Levitronix, Zürich). Er wird zur Steuerung von vernebeltem H2O 2 und Gasfluss in der biopharmazeutischen Produktion eingesetzt. Dank des berührungslosen Betriebs ohne mechanische Lager entsteht praktisch keine Partikelverunreinigung durch Reibung, was wiederum gute Voraussetzungen für die Herstellung aseptischer Verhältnisse schafft. Keine mechanischen Lager, keine Schmiermittel, keine Dichtungen – damit empfiehlt sich diese Ventilatortechnologie für Isolatoren, Reinräume der Pharmaklasse A und für andere aseptische Bereichen. Dank der fehlenden Lager sind ausserdem extrem hohe Drehzahlen möglich, so dass selbst schwer zugängliche Nischen wie Handschuhkästen oder komplexe Abfüllmaschinen dekontaminiert werden können.
Von GMP und Annex 1 zur Atex Wo neben mikrobiellen oder PartikelBelastungen der Luft auch Explosionsgefahren ein Risiko darstellen, greifen die ATEX-Richtlinien der Europäischen Union (ATmosphères EXplosives) und/oder die NFPA-Sicherheitsstandards aus den USA (National Fire Protection Association). Ein danach zertifiziertes bzw. konformes Verfahren zur Behandlung von gesundheits -

Holger Fritzsche, Segment Manager Pharma bei Camfil, Reinfeld, stellt sein dezentrales Entstaubungssystem mit Hepa-Filtern vor –Atex-Zertifizkat inklusive, keine zusätzlichen Schutzausrüstungen nötig.

Pharmaherstellung, Zelltherapie und Gentechnik – insbesondere robotergestützte Systeme nach menschlichen Vorbildern setzen in diesen Bereichen aktuell neue Mass stäbe.
gefährdenden Stäuben aus der pharmazeutischen Produktion und chemischen Prozessen mit einem Betriebsvolumenstrom von 1000 bis 3000 Kubikmetern pro Stunde basiert auf einem Trockenabscheider mit zwei Hepa-Filterpatronen (High Efficient Particulate Air). Dies ermöglicht einen unterbrechungsfreien Produktionsprozess (z.B. Quad Pulse Package, Camfil, Reinfeld). Mit einem sogenannten «Bibo»System gelingt ein einfacher kontaminationsfreier Filter- und Staubaustragswechsel.
Bei der Einhaltung der Anforderungen von FDA 21 CFR Part 11 (USA) und EU Annex 11 (Europa) helfen neue Wifi-Datenlogger. Sie unterstützen ein Echtzeitmonitoring in regulierten Anwendungen und benötigen zur Installation nicht einmal neue Kabel (z.B. RMS-LOG-W-D und RMS-LOGW-T10-D, Rotronic, Ettlingen).
Die kleinen Helfer Jenseits der grossen Geräte und Systemlösungen wartete die Lounges mit verschiedenen kleinen Helfern auf. So klappt die Reinigung und Desinfektion und insbesondere die Entfernung hartnäckiger Rückstände von Scheiben mit einem neuen Hilfsmittel (Contec, Vannes, Frankreich). Durchdachte Mopphalter nehmen ohne Handkontakt Mopps auf und wirft sie nach Verwendung wieder ab – Kreuzkontaminationsrisiko praktisch null. CFK («Carbon») macht solche Hilfsmittel leicht und daher gut handhabbar, und passende Einwegmopps aus einem neuen Mikrofasermaterial verbessern die Reinigungsleistung, insbesondere auch in den Ecken (z.B. Purmop Black C4, Hydroflex, Buseck).
Wer auf Nachhaltigkeit Wert legt, kann jetzt auf autoklavierbare Mopps aus recyceltem Polyester mit Zulassung für die GMP-Bereiche A/B, C und D sowie für die ISO-Klassen 5 bis 8 (z.B. Micro Sicura CR/A-R, Pfennig, Durach). Technisch gesehen identisch mit dem Original-Produkt (Micro Sicura CR/A), kommt als weitere Nachhaltigkeits-Komponente die Mehrweg-Nutzung hinzu: Nach 50 sterilen oder 100 unsterilen Aufbereitungszyklen im
Reinraum ist die Weiterverwendung in bis zu 200 Zyklen im Graubereich möglich.
Desinfektion mit ultravioletter
Strahlung
Gegenüber den absoluten Neuheiten wirkte der Cleanzone-Award-Kandidat von 2024 «Health Robot for the 21st Century» fast schon wie ein alter Hase (Hero21, ICA, Dortmund). Sogar in der Praxis hat er sich schon vielfach bewährt (z.B. bei Bayer und im Universitätsspital Zürich). Es handelt sich um einen autonomen, mobilen UV-C-Desinfektionsroboter, der die umfassend erforschten Vorteile der UV-C-Technologie mit der mobilen Robotik verbindet und damit im Vergleich zur manuellen Desinfektion deutlich schneller ist. Die Ansteuerung per Smartphone über eine App macht den Einsatz besonders einfach. Nach Abschluss der Desinfektion erhält der Anwender eine Dokumentation. Damit bot die Messe «Lounges Karlsruhe 2025» ein breites Spektrum an Verfahren und Produkten rund um Reinraum- und Prozesstechnik. Vortragsveranstaltungen in den Messehallen dienten dazu, spezielle Themen zu vertiefen und bessere Antworten auf brennende Fragen zu finden. Flankierend wurden über die CleanroomProcesses-Academy, eine Weiterbildungs-Plattform für die Reinraum- und Prozesstechnikbranche, Online-Fortbildungen angeboten, und zwar in zwei unterschiedlichen Formaten mit den Bezeichnungen «Basics» und «Live-Seminare»
Die nächste Ausgabe der Lounges ist vom 24. bis zum 26. März 2026 geplant.
Autoren
Dr. Christian Ehrensberger und Luca Meister, Redaktion CCR
Kontakt Inspire Media GmbH Rudolf-Wild-Str. 84 69214 Eppelheim www.cleanroom-processes.de
Welche Lösungsansätze intelligente Automation und Robotik für die Herausforderungen der Zukunft bieten, demonstrierte die Automatica vom 24. bis 27. Juni 2025 in München. Knapp 49’300 Besucherinnen und Besucher aus mehr als 90 Nationen, rund 800 Aussteller aus 40 Ländern, 1’100 Roboter und ein begleitendes Rahmenprogramm unterstrichen die breit gefächerte Ausrichtung dieser Messe.
Im Fokus standen KI-gestützte Robotik, Mittelstands-Automation, HealthtechLösungen, mobile Robotik und vernetzte Produktion. Viele Besucher kamen aus der Schweiz nach München, so dass sie unter den «Top-Ten»-Besucherländern rangierte. Unter den Exponaten stachen Humanoide hervor (z.B. von Neura Robotics, Metzingen), unter den Trends das Machine Vision. Hier wird die komplexe Aufgabe, Roboter die Fähigkeit des Sehens zu geben, immer besser gelöst. Auf dem Feld der Reinraumtechnologie schickten sich massgeschneiderte reinraumtaugliche Maschinenanzüge an, kostspielige Umrüstungen für Reinraumklassen zu vermeiden (z.B. Fraunhofer IPA, Stuttgart). Um die Megatrends in Robotik und KI drehte sich der Munich_i Hightech-Summit. Die top besetzte Veranstaltung – unter anderem mit Referenten von Google DeepMind, Microsoft und Nvidia – kuratierte auch in diesem Jahr das Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) der Technischen Universität München. Zehn Führungen und drei Workshops ermöglichten einen intensiven Wissenstransfer. Dabei stand das Thema Healthtech besonders im Fokus, ebenso wie beim zweitägigen Medtecsummit. Die nächste Automatica findet von 22. bis 25. Juni 2027 statt, erneut parallel zur «Laser World of Photonics» und zur «World of Quantum in München».
Aussteller freuen sich über Impulse «Die Automatica ist einmal mehr Impulsgeber für die gesamte Branche. Die Messe ist besucher- und ausstellerseitig trotz konjunkturellem Gegenwind deutlich gewachsen», stellte Dr. Reinhard Pfeiffer, Co-CEO Messe München fest. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hob ihm Rahmen seines Rundgangs auf der Automatica und den parallel stattfindenden Messen Laser World of Photonics sowie World of Quantum die


zentrale Bedeutung dieser Zukunftstechnologien hervor: «Robotik und Automation werden unsere Produktionsprozesse revolutionieren. Besonders die Integration von Künstlicher Intelligenz eröffnet völlig neue Möglichkeiten.»
«Mit 800 Ausstellern und 1120 Robotern vor Ort ist die Automatica eine Leistungsschau über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg», sagt Exhibition Director Anja Schneider. Sie weist ausserdem auf den «ausgeprägter Charakter der Automatica als Arbeitsmesse» hin.
Für Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer «Robotik + Automation» im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die Automatica 2025 gezeigt: «Robotik und Automation sind der Schlüssel für starke Wettbewerbsfähigkeit.»
«Die Automatica ist nicht nur für Fanuc, sondern für die gesamte Robotikbranche in Europa eine der wichtigsten Veranstaltungen», sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics (IFR) und zuvor Vice President bei Fanuc (Oshino, Präfektur Yamanashi/Japan), einem Pionier in Fabrikautomation, Robotik, CNC-Werkstückbearbeitung und Werkzeugmaschinen. «Hier kommen weltweit führende Technologieunternehmen und Anwender zusammen, um Ideen auszutauschen, Innovationen zu entdecken und
die Zukunft der Automatisierung voranzutreiben. Als Präsident der IFR schätze ich diese Plattform für den internationalen Dialog und die Zusammenarbeit sehr.» Reinhold Gross, CEO der Robotersparte von Kuka, dem seit fast zehn Jahren in chinesischem Besitz (Midea, Foshan, Provinz Guangdong) befindlichen RoboterSpezialisten aus Augsburg, hebt hervor: «In diesem Jahr erleben wir bemerkenswertes Interesse von Kunden, die bislang noch nicht automatisieren. Für uns war die Automatica 2025 daher die ideale Bühne, um zu zeigen, dass ‹making automation

Ein fachliches Messe-Highlight zur Unterstützung der Qualitätskontrolle: Auditieren von Künstlicher Intelligenz mit Hilfe eines Software-Frameworks (Projektbezeichnung: «AlQualify»). (Bild: Fraunhofer IPA/Rainer Bez)
easier› weit über einen einfachen und intuitiven Zugang zur Robotik hinausgeht.»
Dass nicht zuletzt deshalb immer mehr mittelständische Unternehmen automatisieren, sieht auch Martin Bender, Geschäftsführer Bender+Wirth, aus der Perspektive des Anwenders. «Ich schätze den fachlichen Austausch mit den Ausstellern und spüre, dass ich als Vertreter eines KMU auf der Automatica richtig bin», so Bender. «Die Messe inspiriert und motiviert mich, neue Dinge auszuprobieren und mit der Automatisierung voranzuschreiten.»
Frank Konrad, Vorsitzender, CEO Hahn Automation, meint: «Die Automatica 2025 hat einmal mehr verdeutlicht, wie entscheidend smarte Automation und Robotik für die Zukunft der Industrie sind. Agilität, Technologieoffenheit und eine konstruktive Standortpolitik sind entscheidend, um Europa als Automatisierungsstandort zukunftsfähig zu machen. Wir nehmen viele starke Impulse aus München mit und gehen mit einer klaren Botschaft aus dieser Woche: Die Zukunft ist automatisiert – und wir sind bereit, sie gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten.»
Weitere Informationen https://messe-muenchen.de
SwissCCS ist eine wissenschaftlich-technische Fachvereinigung zur Förderung der Kontaminations-Kontrolle und Reinraumtechnik. Sie vertritt die Schweiz in den europäischen und internationalen Normengremien ISO/CEN.
Jetzt Mitglied werden!

SwissCCS veranstaltet und organisiert Fachseminare, Schulungen, Workshops und Informationsaustausch unter Spezialisten. Mehr Infos unter swissccs.org.
In der Schweiz sind Erfolgsmeldungen aus der Biotechnologie an der Tagesordnung. Wie sich das eigene Unternehmen in diesem innovativen und wettbewerbsintensiven Umfeld Vorteile sichert, zeigt das wegweisende Branchenevent in Chemie und Life Science Ilmac 2025 Basel.
Im vergangenen Jahr ging es Schlag auf Schlag: Mal startet ein Unternehmen mit einem innovativen Mitochondrien-Therapeutikum-Kandidaten gegen altersbedingte Erkrankungen in die erste klinische Studie am Menschen (Vandria SA, Lausanne). Ein anderes befindet sich mit Impfstoffen gegen Haut- und Weichgewebeinfektionen schon in der klinischen Erprobungsphase, da erhält es von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) das «Go» für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren (LimmaTech Biologics AG, Schlieren). Oder illustre Unternehmensgründer werden von der Stanford Univer-
Ilmac Basel 2025
Dauer: 16. bis 18. September 2025 (Dienstag bis Donnerstag)
Öffnungszeiten: 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Messe Basel, Halle 1.0
Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG
E-Mail: info@ilmac.ch www: https://www.ilmac.ch/

Abb. 1: Der Bioreaktor steht symbolisch für eine der erfolgreichsten Branchen der Schweiz – und auch ganz praktisch: Auf der Messe Ilmac Basel 2025 gilt es, das richtige Modell für den Erfolg des eigenen Unternehmens auszuwählen. (Bild: Depositphotos)
sity in die Liste der besten 2 Prozent aller Wissenschaftler aufgenommen (Dr. Horst Vogel und Dr. Shuguang Yuan, Alphamol Science AG, Allschwil).
Die Schweiz bietet mit zwei grossen TopPharma-Playern als Zugpferden, mit dem weltweit führenden Life-Sciences-Standort Basel sowie mit einer Vielfalt von Inkubatoren, Biotech-Startups und mittelständischen Unternehmen als Innovatoren ein ideales Umfeld. Oft geht es darum, neue Wirkstoff-Kandidaten zu entwickeln, ihre Effektivität nachzuweisen und sie später biotechnologisch herzustellen (z.B. Impfstoffe). Darüber hinaus eigenen sich biotechnologische Verfahren für breite Bereiche der Werkstoffproduktion (z.B. Polymere), der Landwirtschaft, des Umweltschutzes, der Lebensmittelherstellung und der Energiegewinnung. Bioreaktoren, Zentrifugen, Inkubatoren, Thermostatschränke und weiteres Zubehör für bahnbrechende Entwicklungen finden Besucher auf der Ilmac Basel 2025. Ein Highlight sind automatisierte Zentrifugen für den Einsatz von Mikrotiterplatten im Hochdurchsatz-Screening, wobei sogar zwei Platten gleichzeitig aufgenommen


Abb. 2: Bei Zentrifugen weist ein Trend zu einer effektiven Kühlung mit umweltfreundlichen natürlichen Kühlmitteln (Bild: Depositphotos)
werden. Zu den weiteren wichtigen Trends zählen Bioreaktoren mit kalibrierfreien Massenflussreglern (sog. thermisches Prinzip), ein Feintuning von Kühlungen (z.B. zwischen 2 °C und 40 °C in 0,1-°CSchritten einstellbare Kühl-Inkubatoren) und ein umweltfreundlicher Betrieb (z.B. Kühlung mit sogenannten natürlichen Kühlmitteln). Alle Programmpunkte und Themen zur Ilmac finden sich auf Ilmac 365, dem Community Netzwerk der Ilmac: https://365.ilmac.ch/event/ilmac

Abb. 3 und 4: Zwei Inkubatoren für Biotech, beide erfolgsrelevant und auf der Messe Ilmac Basel 2025 auffindbar: einer für die unternehmerische Begleitung, einer für Laborforschung oder Produktion. (Bilder: Depositphotos)
Klassische verfahrenstechnische Fragestellungen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und überraschende Zukunftsvisionen rund um die Partikeltechnologie bringen Fachleute vom 23. bis 25. September auf dem Kongress «Partec 2025» in Nürnberg zusammen, einem Treffpunkt für Wissenschaft, Industrie und Ingenieurwesen rund um Partikel, Pulver und Feststoffe.
Wer sich über die neuesten Entwicklungen informieren möchte, sieht sich schon jetzt einmal das Programm an und bestellt seine Eintrittskarte. Ein Blick auf die Hauptthemen der Partec 2025 zeigt eine grosse Bandbreite:
– Partikelherstellung und -formulierung
– Messtechnik, Charakterisierung und Modellierung
– Prozesse zur Feststoffverarbeitung
– Anwendungen in Branchen wie Pharma, Chemie, Lebensmittel und Energie – Digitalisierung, Simulation und künstliche Intelligenz in der Verfahrenstechnik – Nachhaltige Prozesse und Kreislaufwirtschaft
Insgesamt sind es über 400 Beiträgen in rund 30 thematischen Sessions, unter
anderem zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung komplexer Produktionsabläufe. Die Session «Particles and Processes in Food Engineering» zeigt auf, wie granulare Materialien und moderne Prozesstechnologie in der Lebensmitteltechnologie zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung beitragen können. Ein weiteres Highlight betrifft Materialsysteme und Verfahren für die Energiewende. Die Session «Green Particle Technology» demonstriert, wie partikelbasierte Prozesse umweltfreundlicher gestaltet werden können. Und in «Digital Twins and Multiscale Simulations» geht es darum, wie virtuelle Modelle uns Prozesse besser verstehen und effizienter steuern lassen. Kurz: Die ganze Bandbreite aktueller Ent-

wicklungen von KI-gestützten Prozessen über nachhaltige Partikeltechnologien bis hin zu innovativen Anwendungen in Energie, Pharma und Lebensmitteltechnik ist vertreten.
Wissenschaft und Anwendung im Dialog
Ein besonderes Highlight im Programm sind international anerkannte Speaker mit Leitthemen und Impulsen zur fachübergreifenden Diskussion. Ein weiterer Höhepunkt ist der Friedrich-Löffler-Preis für die besten wissenschaftlichen Nachwuchsbeiträge – auch ein Stimmungsbarometer für kommende Trends in der Partikeltechnologie.
Die Partec findet parallel zur Powtech Technopharm statt, einer Messe für mechanische Verfahrenstechnik, Analytik und Handling von Pulver und Schüttgut sowie für die Pharma- und Life-Science-Industrie – wissenschaftliche Erkenntnisse und industrielle Lösungen an einem Ort und zur gleichen Zeit. Das Ticket für die Teilnahme an der Partec gilt gleichzeitig auch für den Besuch der Powtech Technopharm.
«Die Zukunft unserer industriellen Prozesse hängt stark davon ab, wie gut wir Partikel verstehen und kontrollieren können», sagt Lutz Mädler, Chairman der Partec 2025. «Mit der Partec schaffen wir einen Raum, in dem Forscherinnen, Entwickler und Anwender gemeinsam an Lösungen arbeiten.»
Autoren
Marius Schaub, Dr. Christian Ehrensberger
Kontakt zur Messe Nürnbergmesse GmbH D-90471 Nürnberg partec@nuernbergmesse https://www.partec.info/en
Für einen gezielten Wissenstransfer veranstaltet die ISPE DACH vom 25. bis zum 27. September 2025 gemeinsam mit der ISPE Nordic und den Unternehmen Odense Robotics und Novo Nordisk in der «Robotic City» Odense und Kopenhagen (Dänemark) den «Future Robotics and AI Workshop».
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an mittleres bis höheres Management sowie an gleichermassen an Experten und Berufseinsteiger im Bereich Robotics. Die Veranstalter vereinen eine breite Expertise, insbesondere aus der pharmazeutischen Industrie und dem damit verbundenen Reinraum Bereich. Dies lässt spannende Vorträge und interessante Site Visits bei Unternehmen vor Ort erwarten. Bei der ISPE DACH und der ISPE Nordic handelt es sich um lokale Sektionen der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), der grössten globalen Non Profit Organisation in der pharmazeutischen Industrie. Odense Robotics ist das nationale Cluster Dänemarks für Robotik, Drohnen und Industrieautomation, Novo Nordisk ein Healthcare Unternehmen mit Schwerpunkt «Diabetes». Weitere Partner sind das Danish Technological Institute und Teradyne, ein Anbieter von automatischen Systeme, die in vielen Branchen zum Testen von Halbleitern, drahtlosen Produkten, Datenspeichern und komplexen elektronischen Systemen eingesetzt werden.

Selbst in einer Stadt wie Odense mit ihrem Beinamen «Robotic City» ist es so weit noch nicht (Bild mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt). (Bild: Adpic)
Ein Highlight stellt die Verleihung des Raya Awards dar (Robotics Application of the Year Award). Er ging beispielsweise im vergangenen Jahr in der Kategorie «Pa

ckaging & Final Assembly» für einen automatisierten Tubpalettierer zum sicheren Verpacken wertvoller Medikamente an das Team Vetter Pharma, Ravensburg/ Essert Robotics, Bruchsal. In der Kategorie «Fill & Finish» wurde die schweizerische Wilco AG, Wohlen, für eine Entwicklung im Bereich der robotergestützten visuellen Inspektion ausgezeichnet. Sie basiert auf dem menschlichen Vorbild und schickt sich an, neue Massstäbe in der Automatisierung der Pharma und Biotechnologiebranche zu setzen. «Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, welche Innovationen wir bei Bewerbungen um den Raya Award zu sehen bekommen und wie weit die Industrie in manchen Bereichen schon ist», sagt Richard Denk, Senior Consultant Aseptic Processing & Containment bei der Skan AG, Allschwil, und Gründer der ISPE Special Interest Group für Robotic/Cobotic zum Thema Pharma 4.0.
Autor
Dr. Christian Ehrensberger
Auf der Messe parts2clean vom 7. bis zum 9. Oktober 2025 (jeweils 9-17 Uhr) in Stuttgart erleben Messebesucher den Stand der Technik in puncto «Sauberkeit definieren, erreichen, erhalten nachweisen und dokumentieren».
Anwendungsgerecht saubere Bauteile und Oberflächen sind in allen Branchen eine Grundvoraussetzung für Qualitätsprodukte. Dabei stellen strengere Sauberkeitsspezifikationen, neue und modifizierte Produkte, Fertigungstechnologien und Werkstoffe sowie höhere Anforderungen an die Energie- und Ressourceneffizienz die Unternehmen der industriellen Teileund Oberflächenreinigung vor neue Herausforderungen.
Die Ausstellung in den Messehallen wird begleitet vom Vortragsprogramm p2c. Expertenforum. Diese Wissensquelle zur industriellen Teile- und Oberflächenreinigung bringt aktuelle Themen auf den Punkt – auch kontroverse wie etwa dieses: «Sauber gedacht – teuer gemacht: Der vermeidbare Irrtum der Durchlaufwaschanlagen».
Der Fachverband industrielle Teilereinigung e.V. (FiT) ist mit seiner Sonderschaufläche dabei. Sie bietet ein Vortragsprogramm und Gelegenheit zum Netzwerken. Ein Höhepunkt wird die Verleihung des FiT2clean Awards am dritten Veranstaltungstag sein.
Zeitgleich zur parts2clean finden vom 7. bis zum 8. Oktober zwei weitere Fachmessen statt: die Hy-fcell in Halle 4 und

Wer sich für Wasserstoff- und Brennstoff zellentechnologie oder anwendungsorientierte Quantentechnologie interessiert, besucht ausser der parts2clean die Parallelveranstaltungen Hy-fcell in Halle 4 und die Quantum Effects im C2. (Bilder: parts2clean/Rainer Jensen)
die Quantum Effects im C2. Die Hy-fcell ist eine führende internationale Messe und Konferenz für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Die Quantum Effects bringt als anwendungsorientierter Treffpunkt die internationale Quantenindustrie und die Politik in Stuttgart zusammen, um neueste Entwicklungen und Herausforderungen der Branche zu diskutieren.

Steigende Sauberkeitsanforderungen – Reaktionsstrategien in Stuttgart: Messe für Teile- und Oberflächenreinigung parts2clean.
Die Eintrittstickets [https://www.parts2clean.de/de/applikation/ticketshop/] gelten für den Besuch aller Fachmessen.
Weitere Informationen
Messegelände Stuttgart Messepiazza/Flughafenstrasse D-70629 Stuttgart info@messe.de www.parts2clean.de

Wissensquelle zur industriellen Teile- und Oberflächenreinigung: messebegleitendes Vortragsprogramm p2c.Expertenforum auf der parts2clean.

Veranstaltungen
Protokoll der Generalversammlung vom 28. März 2025 Gurtenpark, Bern, Raum Wyttsicht, 15.00–15.30 Uhr
Vorstand: Roman Schläpfer, Präsident
Stéphane Blanc
Marco Cucinelli
Thomas Krauss, Kassierer, entschuldigt
Michael Meier
Thomas Mosimann, entschuldigt
Norbert Otto
Sekretariat: Jeanette Wengler
Beisitzer: Marie-Teres Moser Miriam Schönenberger
Revisoren: Angel Gomez Riccardo Schena
Traktanden
1. Begrüssung und Genehmigung Traktandenliste
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung Protokoll GV 5. April 2024 (versandt am 7. Mai 2024)
4. Jahresbericht des Präsidenten (im Internet aufgeschaltet)
5. Jahresrechnung 2024, Revisionsbericht
6. Décharge
7. Änderungen im Mitgliederstand
8. Mitgliederbeiträge 2025
9. Budget 2025
10. Wahlen Vorstand/Präsident und Kassierer
11. Wahl Revisoren
12. Varia
1. Begrüssung
Der Präsident, Roman Schläpfer, begrüsst die Anwesenden zur Generalversammlung auf dem Gurten in Bern. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
2. Wahl des Stimmenzählers
Als Stimmenzählerin wird Marie-Teres Moser gewählt.
3. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 5. April 2024 (versandt per Email am 7. Mai 2024)
Das Protokoll der Generalversammlung vom 5. April 2024 wurde mit Mail vom 7. Mai 2024 an die Mitglieder versandt.
Antrag des Vorstandes
Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 5. April 2024.
Beschluss
Das Protokoll der Generalversammlung vom 5. April 2024 wird einstimmig und mit Dank an die Verfasserin genehmigt.
4. Jahresbericht 2024 des Präsidenten Der Jahresbericht des Präsidenten wurde wiederum vorgängig zur Generalversammlung auf der SwissCCS-Homepage aufgeschaltet.
Antrag des Vorstandes
Genehmigung des Jahresberichts 2024.
Beschluss
Der Jahresbericht 2024 wird einstimmig genehmigt.
5. Jahresrechnung 2024, Revisionsbericht
Rechnung 2024
Der Präsident, Roman Schläpfer, präsentiert die Jahresrechnung 2024. Diese schliesst mit einem Verlust von CHF 9’907.29. Der Verlust resultiert insbesondere auf Mehrkosten für die Unterstützung der Young Professionals, dies sind junge Berufsleute, die sich im Auftrag des SwissCCS für die Reinraumbranche im internationalen Kontext engagieren. Ebenso musste für die Fachtagung im Mai 2024 ein Verlust verzeichnet werden, es konnten nicht genug Teilnehmende verzeichnet werden. Aus diesem Grund hat der Vorstand entschieden, zukünftig keine Fachtagungen mehr durchzuführen, sondern neue Formate wie z.B. Zu Gast bei, Coffee Breaks etc. zu lancieren und eine Kooperation mit der ILMAC einzugehen. Die Finanzlage gibt jedoch auch weiterhin keinen Anlass zur Sorge, der Verein verfügt über eine stabile Finanzlage mit einem Vereinsvermögen per 31.12.2024 von CHF 132’550.69.
Revision 2024
Die Revision wurde am 3. März 2024 erfolgreich durchgeführt. Der Vorstand dankt den Revisoren, Angel Gomez, Admeco Group, und Riccardo Schena, Weiss Technik AG.
Angel Gomez verliest den Revisionsbericht. Die Revisoren empfehlen, die vorliegende Rechnung zu genehmigen und danken der Geschäftsstelle für die saubere und korrekte Buchführung.
Die detaillierte Buchhaltung kann auf der Geschäftsstelle eingesehen werden und für Fragen steht Jeanette Wengler zur Verfügung.
Antrag des Vorstandes
Genehmigung der Rechnung 2024 und des Revisionsberichts 2024.
Beschluss
Die Rechnung 2024 und der Revisionsbericht 2024 werden einstimmig genehmigt.
6. Décharge Erteilung
Antrag des Vorstandes
Erteilung der Décharge an den Vorstand.
Beschluss
Dem Vorstand wird einstimmig Décharge erteilt.
7. Änderungen im Mitgliederstand 2023 2024 Änderung
Einzelmitglieder 58 52 –6 Kollektivmitglieder 111 108 –3 (max. 5 Nominationen)
Statistik:
Mitglieder Stand Dezember 2024: Einzelmitglieder: 52 Kollektivmitglieder: 108
Die Akquise von Neumitgliedern ist für den Vorstand auch weiterhin ein zentraler Faktor seiner Arbeit. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass mit den neu lancierten Eventformaten neue Mitglieder gewonnen werden können.
8. Mitgliederbeiträge 2025
Der Präsident Roman Schläpfer beantragt im Namen des Vorstandes, die Mitgliederbeiträge 2025 auf CHF 100.00 bzw. Euro 100.00 für Einzelmitglieder und CHF 500.00 bzw. Euro 500.00 für Kollektivmitglieder festzulegen.
Beschluss
Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Mitgliederbeiträge 2025 wie folgt:
– Einzelmitgliedschaft CHF 100.00 (Euro 100.00)
– Kollektivmitgliedschaft CHF 500.00 (Euro 500.00)
9. Budget 2025
Der Präsident, Roman Schläpfer, erläutert das Budget 2025. Dieses sieht eine ausgeglichene Jahresrechnung bei gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen vor (Detailinformationen siehe Präsentation). Die Kosten für die Fachtagung entfallen, zudem wird mit mehr Einnahmen durch Neumitglieder gerechnet.

Antrag des Vorstandes
Genehmigung des Budgets 2025.
Beschluss
Das Budget 2025 wird einstimmig genehmigt.
10. Wahlen Vorstand/Präsident und Kassierer
Thomas Mosimann hat auf die heutige GV seinen Rücktritt eingereicht. Roman Schläpfer dankt ihm in Abwesenheit für sein langjähriges Engagement für den Verein und die internationale Normierung. Die anwesenden Mitglieder verabschieden Thomas Mosimann mit grossem Applaus.
Antrag des Vorstandes
Der Vorstand schlägt den Mitgliedern die Erweiterung des Vorstandes durch Dr. Miriam Schönenberger, MBV AG vor, diese stellt sich kurz vor.
Beschluss
Die Mitglieder wählen neu Dr. Miriam Schönenberger einstimmig und mit grossem Applaus für 1 Jahr in den Vorstand. Der Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen und ist noch bis zur GV 2026 gewählt:
– Roman Schläpfer, Präsident – Stéphane Blanc
– Marco Cucinelli
– Thomas Krauss, Kassierer
– Michael Meier – Norbert Otto
– Dr. Miriam Schönenberger
11. Wahl Revisoren
Thomas Christen, vali.sys GmbH, hat seinen Rücktritt als Revisor auf die heutige Generalversammlung angemeldet. Roman Schläpfer dankt ihm für sein langjähriges Engagement in Abwesenheit. Riccardo Schena, Weiss Technik AG, hat in seiner Vertretung zusammen mit Angel Gomez,
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2025 Gurtenpark, Berne, Raum Wyttsicht, 15h00–15h30
Comité: Roman Schläpfer, président
Stéphane Blanc
Marco Cucinelli
Thomas Krauss, trésorier, excusé
Michael Meier
Thomas Mosimann, excusé
Norbert Otto
Secrétariat: Jeanette Wengler
Assesseures: Marie-Teres Moser
Miriam Schönenberger
Réviseurs: Angel Gomez
Riccardo Schena
Ordre du jour
1. Salutation et approbation de l’ordre du jour
2. Élection des scrutateurs/scrutatrices
3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 05 avril 2024 (envoyé le 07 mai 2024)
4. Rapport annuel du Président (mis en ligne sur Internet)
5. Comptes annuels 2024, rapport de révision
6. Décharge
7. Évolution de l’effectif des membres
8. Cotisations des membres 2025
9. Budget 2025
10. Élection du Comité/Président et Trésorier
11. Élection des réviseurs
12. Divers
1. Salutation
Le Président, Roman Schläpfer, salue les personnes présentes à l’Assemblée Générale qui se tient à Gurten à Berne. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Élection des scrutateurs/scrutatrices
Comme scrutatrice est élue Marie-Teres Moser.
3. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2024 (envoyé par e mail le 07 mai 2024)
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2024 a été envoyé par e-mail aux membres le 07 mai 2024.
Admeco AG, am 3. März 2025 die Revision durchgeführt.
Roman Schläpfer schlägt als Nachfolger von Thomas Christen und als neuen Revisor Christopher Moser, Weiss Technik AG, vor.
Antrag des Vorstandes
Wiederwahl von Angel Gomez für ein weiteres Jahr sowie Neuwahl von Christopher Moser als Revisoren.
Beschluss
Der bisherige Revisor Angel Gomez sowie neu Christopher Moser werden einstimmig und mit grossem Applaus als Revisoren für ein Jahr gewählt.
12. Varia
Keine Wortmeldung seitens Mitglieder. Der Präsident, Roman Schläpfer, dankt den Vorstandsmitgliedern und den Beisitzern für die gute Zusammenarbeit, den Revisoren (Herren Angel Gomez und Riccardo Schena), der Geschäftsstelle (Jeanette Wengler, Gabriela Delapraz und Christian Stüssi) sowie allen Mitgliedern für ihre Treue.
Ende der Veranstaltung: 15.30 Uhr Im Anschluss an die Generalversammlung findet die Generalversammlung der SWKI statt.
Proposition du Comité
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2024.
Résolution
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2024 est approuvé à l’unanimité et avec remerciements à son auteure.
4. Rapport annuel 2024 du Président
Le rapport annuel du Président a de nouveau été mis en ligne sur le site de la SwissCCS, préalablement à l’Assemblée générale.
Proposition du Comité
Approbation du rapport annuel 2024.
Résolution
Le rapport annuel 2024 a été approuvé à l’unanimité.
5. Comptes annuels 2024, rapport de révision
Comptes 2024
Le Président, Roman Schläpfer, présente les comptes 2024 se soldant par un déficit

de CHF 9’907.29. Cette perte résulte notamment des coûts supplémentaires pour le soutien des Young Professionals, soit des jeunes professionnels qui s’engagent au nom de la SwissCCS pour la branche des salles blanches dans le contexte international. De même, une perte a dû être enregistrée pour le congrès du mois de mai 2024, face au nombre insuffisant de participants. C’est pour cette raison que le Comité a décidé de ne plus organiser de congrès mais plutôt de lancer de nouveaux formats tels que les «Zu Gast bei», «Coffee Breaks» etc. et d’entamer une coopération avec l’ILMAC. La situation financière n’est pourtant pas encore préoccupante, l’association dispose d’une situation financière stable grâce à un capital s’élevant à CHF 132’550.69 au 31 décembre 2024.
Révision 2024
La révision a été effectuée le 03 mars 2024. Le Comité remercie les réviseurs, Angel Gomez, Admeco Group, et Riccardo Schena, Weiss Technik AG. Angel Gomez présente le rapport de révision. Les réviseurs recommandent d’approuver les présents comptes et remercient le secrétariat de la tenue comptable impeccable.
La comptabilité détaillée peut être consultée au Secrétariat général et Jeanette Wengler se tient à votre disposition pour toute question.
Proposition du Comité
Approbation des comptes 2024 et du rapport de révision 2024.
Résolution
Les comptes 2024 et le rapport de révision 2024 sont approuvés à l’unanimité.
6. Délivrance de la décharge
Proposition du Comité
Délivrance de la décharge au Comité.
Résolution
Le Comité obtient la décharge à l’unanimité.
7. Évolutions de l’effectif des membres 2023 2024 Bilan Membres individuels 58 52 –6 Membres collectifs 111 108 –3 (max. 5 nominations)
Statistiques:
Membres en décembre 2024: Membres individuels: 52 Membres collectifs: 108
Pour le Comité, l’acquisition de nouveaux membres est toujours un facteur central de son travail. Le Comité est optimiste concernant l’acquisition de nouveaux membres grâce aux formats d’événements récemment lancés.
8. Cotisations des membres 2025
Le Président, Roman Schläpfer, propose, au nom du Comité, de fixer les cotisations 2025 à un montant de CHF 100.00 ou 100.00 Eur pour les membres individuels et à CHF 500.00 ou 500.00 Eur pour les membres collectifs.
Résolution
L’Assemblée Générale approuve les cotisations 2025 à l’unanimité comme suit: – Adhésion individuelle CHF 100.00 (100.00 Eur) – Adhésion collective CHF 500.00 (500.00 Eur)
9. Budget 2025
Le Président, Roman Schläpfer, présente le budget 2025. Ce budget prévoit des comptes annuels en équilibre sans changement des cotisations des membres (pour les détails, voir la présentation). Les frais pour le congrès sont supprimés et l’on s’attend en même temps à une hausse des recettes grâce aux nouveaux membres.
Proposition du Comité
Approbation du budget 2025.
Résolution
Le budget 2025 est approuvé à l’unanimité.
10. Élections du Comité/Président et Trésorier
Thomas Mosimann a remis sa démission à l’AG d’aujourd’hui. Roman Schläpfer le remercie en son absence de son engagement de longue date en faveur de l’association et de la normalisation internationale. Les membres présents prennent congé de Thomas Mosimann par de grands applaudissements.
Proposition du Comité
Le Comité propose aux membres d’élargir le Comité avec la présence de Dr. Miriam
Schönenberger, MBV AG. Elle se présente brièvement.
Résolution
Les membres élisent à l’unanimité et sous de grands applaudissements Dr. Miriam Schönenberger au Comité directeur pour une durée d’un an.
Le Comité se compose donc de la façon suivante et reste en place jusqu’à l’AG 2026:
– Roman Schläpfer, président
– Stéphane Blanc
– Marco Cucinelli
– Thomas Krauss, trésorier
– Michael Meier
– Norbert Otto
– Dr. Miriam Schönenberger
11. Élection des réviseurs
Thomas Christen, vali.sys GmbH, a annoncé sa démission en tant que réviseur à l’Assemblée Générale de ce jour. Roman Schläpfer le remercie en son absence de son engagement de longue date. Riccardo Schena, Weiss Technik AG, en tant que son représentant, a effectué la révision avec Angel Gomez, Admeco AG, le 03 mars 2025.
Roman Schläpfer propose Christopher Moser, Weiss Technik AG, comme successeur de Thomas Christen au poste de réviseur.
Proposition du Comité
Réélection d’Angel Gomez pour une nouvelle année et nouvelle élection de Christopher Moser comme réviseurs.
Résolution
L’ancien réviseur, Angel Gomez ainsi que le nouveau réviseur, Christopher Moser sont élus à l’unanimité pour une année et sous de vifs applaudissements.
12. Divers
Aucune motion de la part des membres. Le Président, Roman Schläpfer, remercie les membres du Comité et les Assesseures de leur bonne collaboration, les Réviseurs (Messieurs Angel Gomez et Riccardo Schena), le Secrétariat général (Jeanette Wengler, Gabriela Delapraz et Christian Stüssi) ainsi que tous les membres, de leur fidélité. Fin de la réunion: 15h30
L’Assemblée Générale est suivie de l’Assemblée générale de la SICC.
Einen erfolgreichen Verlauf nahm am 20. Mai 2025 ab 12 Uhr die erste «SwissCCS Coffee Break Session – Online Webinar» der Schweizerischen Reinraum-Gesellschaft SwissCCS.
Die Veranstaltung in einem neuen Format zur Mittagszeit setzte bei den Grundlagen an – konkret: bei zweien der vier klassischen Elemente, Wasser und Luft. Die Referentin des Tages, Dr. Lisa Günther, Team- und Projektleitung Wasserhygiene bei der ewah AG, legte unter dem Titel «Wasser ist wie Luft, nur dichter» dar, wie sich diese beiden so verschiedenen Elemente gegenseitig beeinflussen. Vor allem geschieht das auf der mikrobiologischen Ebene.
Zwar stellen die öffentlichen Wasserversorger in der Schweiz biologisch stabiles Trinkwasser bereit, doch in Gebäuden erfährt es eine drastische Veränderung. Veränderte Umweltbedingungen aber können das Wachstum von potenziellen Krankheitserregern begünstigen. Zum Beispiel fühlen sich Legionellen, die wir von der gefürchteten Legionärskrankheit her kennen, bei Temperaturen zwischen 25 und 45 °C besonders wohl und können sich gut vermehren. So werden Aerosole aus Duschköpfen zur potenziell tödlichen Gefahr. Auch aus Lebens- und Genussmittelproduktionen sind schon Legionellen in ungewöhnlich grossen Mengen ausgetreten (z.B. bei Bierbrauern).

Dr. Lisa Günther brachte reichlich Beispiele aus der Praxis und resümierte: In der Regel sind hygienische Probleme auf allgemein technische, speziell auf installationsseitige oder auf sonstige betriebliche Unstimmigkeiten zurückzuführen. Typi -

«Wasser ist wie Luft, nur dichter» – das erste «Coffee-BreakSession»-Webinar der SwissCCS am Dienstag, 20. Mai 2025, 12 Uhr, war spannend und machte Lust auf mehr. (Bild: Adpic)
sche Beispiele dafür sind die kontinuierliche Erwärmung von Kaltwasser und die Warmhaltung von Warmwasser bei kritischen Temperaturen.
Vor allem zeigte Dr. Günther auch, wie sich die Risiken durch eine konsequente Planung bis hin zum Betrieb so gering wie möglich halten lassen.
Als Moderator des Online-Webinars fungierte der Präsident der SwissCCS, Roman Schläpfer. Am Schluss konnte er sich über eine gelungene erste Coffee Break Session mit interessierten Teilnehmern freuen. Die Coffee Break Sessions sind kurze, prägnante Online-Veranstaltungen, die maximal 30 Minuten dauern. Sie bieten eine Plattform für den Wissensaustausch und ermöglichen pro Session einem SwissCCS Mitglied, das eigene Unternehmen, seine Produkte und seine Expertise einem breiten Publikum, vorzustellen. Das erste Online-Webinar in diesem neuen Format hat Lust auf mehr gemacht.
Weitere Informationen SwissCCS CH 3001 Bern info@swissccs.org http://www.swissccs.org

Prägnant, kurz und online: Beim Format «Coffee Break Sessions» setzt die Reinraumvereinigung SwissCCS auf das bekannte Sprichwort «In der Kürze liegt die Würze» – Kontakt: info@swissccs.org. (Bild: Adpic)
Tout s’est bien passé le 20 mai 2025 à partir de 12h00 lors de la première édition des « SwissCCS Coffee Break Sessions – Webinaires en ligne » de la Société suisse des salles blanches SwissCCS.
L’évènement dans un nouveau format à midi commence par les bases – concrètement par les deux des quatre éléments classiques, l’eau et l’air. La référente actuelle, la Dr. Lisa Günther, responsable d’équipe et de projet hygiène de l’eau auprès de la société ewah AG, a démontré sous le titre « L’eau est comme l’air, seulement plus dense » comment ces deux éléments si différents influent l’un sur l’autre. Cela se produit surtout au niveau microbiologique.
Même si les services publics de distribution d’eau en Suisse fournissent une eau potable biologiquement stable, celle-ci subit un changement radical à l’intérieur des bâtiments. Or, des conditions environnementales modifiées peuvent favoriser la croissance d’éventuels agents pathogènes. Les légionelles, par exemple, que nous connaissons par la redoutable légionellose, aussi appelée « maladie du légionnaire », sont particulièrement à l’aise à des températures comprises entre 25 et 45 °C et peuvent rapidement se propager. Ainsi les aérosols provenant des pommeaux de douche constituent un risque potentiellement mortel. La production de denrées alimentaires et de produits d’agrément a également déjà été à l’origine de l’émergence de légionelles en

quantités inhabituelles (par ex. chez les brasseurs de bière).
La Dr. Lisa Günther a apporté de nombreux exemples issus de la pratique et en a tiré la conclusion suivante: en règle générale, les problèmes d’hygiène sont dus à des dysfonctionnements techniques et en particulier au niveau des

« L’eau est comme l’air, seulement plus dense » – la première édition du webinaire « Coffee-Break-Session » de la SwissCCS, mardi, 20 mai 2025, 12h00, était passionnante et a fait naître l’envie d’en voir plus. (Photo: Adpic)
installations, ou à d’autres irrégularités opérationnelles.
Des exemples typiques sont le chauffage continu de l’eau froide et le maintien de l’eau chaude en cas de températures critiques.
La Dr. Günther a surtout démontré comment une planification cohérente jusqu’à la mise en service permet de réduire les risques au minimum.
En tant que modérateur du webinaire en ligne, le Président de la SwissCCS, Roman Schläpfer, s’est réjoui à la fin de cette première « Coffee Break Session » réussie avec des participants intéressés.
Les Coffee Break Sessions sont des événements en ligne courts et concis qui durent 30 minutes maximum. Elles offrent une plateforme d’échange de connaissances et permettent à un membre de la SwissCCS de présenter à chaque session sa propre entreprise, ses produits et son expertise à un large public. Le premier webinaire en ligne dans ce nouveau format a fait naître l’envie d’en voir davantage.
De plus amples informations SwissCCS CH-3001 Berne info@swissccs.org http://www.swissccs.org

info@swissccs.org.
Die Hochschule Luzern (HSLU) sucht Partner für die Überführung eines wissenschaftlich bereits gut fundierten Verfahrens zur Qualifizierung von Reinräumen in die praktische Anwendung. Der Fachverband SwissCCS unterstützt dieses Vorhaben und ruft seinerseits zum Mitmachen auf.
Wer teilnimmt, zählt zu den Ersten, die Erfahrung mit dem innovativen Verfahren gewinnen. Das Projekt läuft unter dem Titel: «Qualifizierung von Reinräumen mittels DNA-Tracern – Entwicklung, Durchführung und Auswertung eines praxisnahen Versuchsaufbaus».
Vorteile gegenüber chemischen Tracern
DNA-Tracer sind unter anderem aus der Öl- und Gasindustrie und der Umweltchemie bekannt und dienen beispielsweise dazu, Flüssigkeitsbewegungen, Flüssig -
keitsverteilungen in geologischen Reservoiren und Grundwasserkontaminationen aufzuklären. Dabei haben sich verschiedene Vorteile gegenüber Farbstoffen und anderen chemischen Tracern (z.B. Isotopenmarkern) gezeigt.
Auch für die Verteilung von Kontaminationen auf Oberflächen erscheinen DNA-Tracer geeignet, und dies wiederum macht sie für die Qualifizierung von Reinräumen interessant. Bei dem HSLU-Projekt werden unter Leitung der ETH Zürich synthetische, in eine Schutzhülle eingeschlossene DNA-Tracer als Aerosol unter realen

DNA-Tracer könnten viele Vorteile bei der Qualifizierung von Reinräumen einbringen und sind reif für die Überführung eines Verfahrens der Hochschule Luzern in die betriebliche Praxis –jetzt mitmachen und bei den Ersten sein, die davon profitieren! (Bild: Adpic)
Betriebsbedingungen appliziert. Die Probenentnahme erfolgt an festgelegten Oberflächenmaterialien und Luftstellen über definierte Zeitintervalle. Dabei sollen die Verteilung, Rückgewinnung und Nachweisbarkeit der Tracer untersucht und bewertet werden.
Innovative Reinraumqualifikation im eigenen Betrieb
Ziel des Projekts ist es, eine Methode zur Reinraumqualifikation mittels synthetischer DNA-Tracer zu entwickeln und zu testen. Die Eignung der Methode zur Reinraumqualifikation (Sensitivität, Aufwand, Rückverfolgbarkeit) wird anhand der Tracer-Verteilung, -persistenz und -rückführung bewertet und mit Sollvorgaben bzw. mit anderen Nachweisverfahren verglichen. Interessenten melden sich direkt bei Martin Hämmerle [martin.haemmerle@hslu.ch], Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für integrale Gebäudetechnik des HSLU-Instituts für Gebäudetechnik und Energie.
Weitere Informationen SwissCCS CH 3001 Bern info@swissccs.org http://www.swissccs.org
Am Nachmittag des 5. Februar 2026 findet die zweite Ausgabe des «Reinraum Innovationsforums» an der Hochschule Luzern in Horw statt. Die Veranstaltung richtet sich an Fachpersonen aus dem Bereich Reinraumtechnik im gesamten DACH Raum – insbesondere aus den Sektoren Life Sciences, Mikroelektronik sowie Planung, Betrieb und Bau von Reinräumen.
Ziel des Forums ist es, aktuelle, zukunftsweisende Projekte sichtbar zu machen und den fachlichen Austausch über innovative Ansätze im Bereich der Reinraum
technik zu fördern. Drei ausgewählte Projekte – evaluiert durch eine interdisziplinäre Fachjury – stehen im Zentrum des Programms.

Es kann ein mutiger Geistesblitz sein oder die akribische Arbeit an einem klar strukturierten Projekt – alles im Februar beim «Reinraum Innovationsforums» der Hochschule Luzern. (Bild: Adpic)
Das Forum ist eine Initiative der Hochschule Luzern, der SwissCCS und von Willers, Zürich, mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart, als Partner. Es bietet eine Bühne für Reinraumprojekte mit Innovationscharakter. Wer sich stark fühlt, reicht jetzt selbst sein Vorreiter Projekt ein. Gefragt sind beim «Reinraum Innovationsforum» technologischer Mut, gestalterische Klarheit und hoher Effizienzanspruch – E Mail an: franziska.rosen
berg@hslu.ch
Ergänzt wird der Anlass durch ein Hauptreferat, sowie durch einen NetworkingApéro. – Jetzt online anmelden über: https://webapps.hslu.ch/weve/anlass/ 684305
Weitere Informationen
SwissCCS
CH 3001 Bern info@swissccs.org http://www.swissccs.org
19. Jahrgang. Erscheint 2× jährlich (und in Ergänzung alle 2 Monate der elektronische ccr Newsletter). Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGImedia AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Copyright 2025 by SIGImedia AG, CH 5610 Wohlen ISSN 16621786
Herausgeber / Verlag
Anzeigenverwaltung
SIGImedia AG
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH 5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.ccreport.com
Titelbild/Quelle: Shutterstock
Redaktion
SIGImedia AG
Dr. Christian Ehrensberger
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH 5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 52 52 c.ehrensberger@sigimedia.ch
Vorstufe
Triner Media + Print Schmiedgasse 7
CH 6431 Schwyz
Telefon +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch
Druck
merkur Medien ag
Gaswerkstrasse 56
CH 4900 Langenthal
Telefon +41 62 919 15 15 info@merkurmedien.ch www.merkurmedien.ch
Offizielles Publikationsorgan

Swiss Contamination Control Society
Schweizerische Gesellschaft für Reinraumtechnik
Société Suisse pour la prévention de la contamination www.swissccs.org
