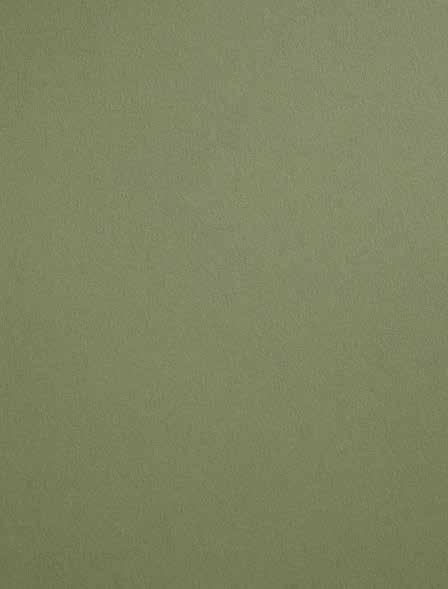


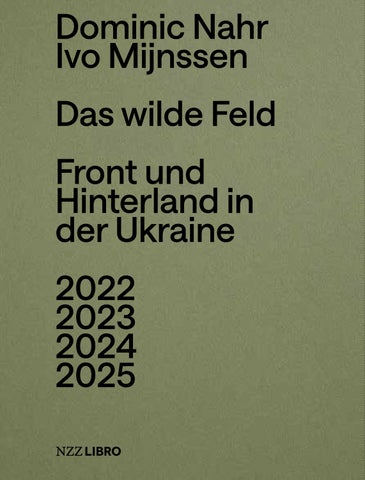
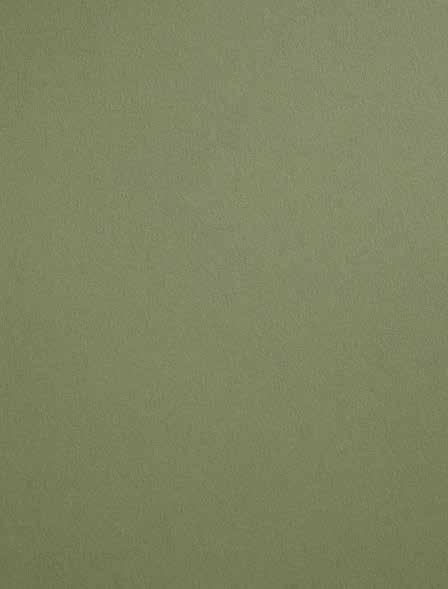


Mit Bildern von Dominic Nahr und Texten von Ivo Mijnssen
Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KISystemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Projektleitung und Bildredaktion: Barbara Stauss, Studio Stauss, Berlin Gestaltung, Layout & Satz: Jonas Herfurth, Ten Ten Team, Dortmund Korrektorat: Jens Stahlkopf, Berlin Produktion: Holger Schmirgalski
HS Printproduktion, Berlin Druck:
DZA Druckerei zu Altenburg GmbH, Altenburg Printed in Germany
Herstellerinformation:
Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro, St. AlbanVorstadt 76, CH4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN 9783039800513
www.nzzlibro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Die Autoren danken:
Daria Badior
Johann Bigler
Ruedi und Irene Bisang
Daniel Böhm
Sofia Dyak
Jaroslaw Halas
Daniela und Pete HemmiMijnssen
Kostiantyn Karnoza
Anna Mayumi Kerber
Jessica und Leandro Mijnssen
Remo Mijnssen
Maryna Moiseienko
Anita Nahr
Volker Pabst
Jonas Roth
Andreas Rüesch
Stefan Soder
Andrea Spalinger
Matthias Steinke
Gilles Steinmann
Mario Trutmann
Dario Veréb
Daniel Wechlin
Die Ukraine ist das Land der Felder. Sie erstrecken sich über Tausende von Kilometern, als Teil der riesigen Osteuropäischen Ebene: von den Karpaten bis zum Ural, von den Wäldern im Norden bis ans Schwarze Meer. Die Felder bedeuten Reichtum, Bodenschätze, fruchtbare Erde. Selbst in der Nationalflagge sind sie verewigt: Das Gelb steht für den blühenden Weizen. Das Blau für den Himmel darüber. Drei Jahre waren Dominic und ich in diesem flachen Land unterwegs. Über Landstrassen, am Ufer des Dnipro, in den Steppen des Donbass. Wenn die Sonne über den Sonnenblumenfeldern aufgeht, verteilt sich ihr Licht über den ganzen Horizont. Es ist ein Moment des vollkommenen Friedens. Bis das Donnergrollen der Artillerie den nächsten Sturmangriff ankündigt und in der Ferne Rauchwolken auftauchen.
Die ukrainische Steppe ist offenes, freies Land. «Wildes Feld» (Dike Polje) nennt man den Süden und Osten des osteuropäischen Staates. Die flache Ebene legt auch Invasoren kaum Hindernisse in den Weg. Hier prallten die Kulturen stets aufeinander: Nomaden und Sesshafte, Imperien und Rebellen. Christen, Heiden und Muslime. Die Gegensätze haben die Ukraine geformt. Und dafür gesorgt, dass sie nie zur Ruhe kam. Als Brotkorb Europas und RohstoffEldorado beflügelt sie seit Jahrhunderten die Fantasien von Kaisern, Abenteurern und Megalomanen.
Heute steckt die Ukraine im Krieg. Ihr friedfertiges Volk hat den Konflikt nicht gesucht. Doch Russlands Überfall zwingt die Menschen in den Widerstand. Der Überlebenskampf hat das Land geeint. In der Steppe stehen sich die zwei stärksten Armeen Europas gegenüber. Sie setzen die Felder in Brand, füllen sie mit Minen. Selbst auf Satellitenbildern lässt sich die Front als riesige Narbe in der Osteuropäischen Ebene erkennen.
Neu ist der Krieg für die Ukraine nicht. Sie kennt ihn, nicht erst seit Russlands Invasion im Februar 2022, nicht erst, seit Moskaus Truppen 2014 die Krim und den Donbass besetzten. Die Ukrainer kämpfen seit Jahrhunderten um Selbstbestimmung, ums Überleben. «Wie Tau in der Sonne werden unsere Feinde zugrunde gehen», lautet eine Strophe der Nationalhymne. «Brüder, wir werden im eigenen Lande herrschen. Seele und Leib opfern wir für unsere Freiheit.» Russlands Invasion ist Wladimir Putins Versuch, die Zukunft der Ukraine zu bestimmen. Die Wurzeln seines Fanatismus und des hartnäckigen Widerstands gegen seinen Imperialismus finden sich aber in der Vergangenheit.
Die Schicksale der beiden Staaten sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft. Ohne die Ukraine ist Russland kein Reich. Die Ukraine, übersetzt «Grenzland», bildet Moskaus Brücke nach Europa. Putin hat die Grenzen seines Landes nach 1991 nie
akzeptiert. Das Ende der Sowjetunion nannte er eine Katastrophe. Weil die UdSSR die gleiche «russische Welt» kontrollierte wie zuvor das Zarenreich. Dazu zählt Putin alle Ostslawen. Die Ukrainer sind für ihn kein eigenes Volk. Sie sind «Kleinrussen», die kleinen Brüder in der grossrussischen Familie. Die herablassende Sichtweise auf die Nachbarn teilt ein grosser Teil der russischen Gesellschaft. Viele nennen die Ukrainer «Chochli», übersetzt «Garbe». Der beleidigende Ausdruck soll zum Ausdruck bringen, wie unkultiviert und bäuerlich die «kleinen Brüder» sind.
Gegründet wurde die slawische «Familie» aber in Kiew – auf ukrainisch Kyjiw: Dort entsteht im 9. Jahrhundert die Kiewer Rus. Das mittelalterliche Grossreich beherrscht weite Teile der heutigen Ukraine, von Russland, Belarus und Polen. Russen und Ukrainer führen ihre Staatlichkeit darauf zurück, obschon die Gründer Wikinger aus Skandinavien waren. Der Dreizack, das nationale Symbol der Ukraine, ist schon auf Münzen der Kiewer Rus geprägt. Doch nur Moskau verfügt in der Neuzeit über die Macht, den Anspruch als Alleinerbe durchzusetzen. Aus dessen imperialer Perspektive gingen alleine die christlichen Grossrussen aus der Kiewer Rus hervor. Putin rechtfertigt die Annexion der Krim 2014 mit der Taufe, die Fürst Wladimir im Jahr 988 auf der Halbinsel erhielt. Mit dem Angriff auf Kiew im Februar 2022 will Russland die Geburtsstätte seiner angeblich tausendjährigen Staatlichkeit zurückholen.
Solche Kontinuitäten sind Propaganda. Formuliert werden sie erst im 18. Jahrhundert, als das russische Reich seine Expansion nach Westen ideologisch untermauern will. Dabei sind es massgeblich kirchliche Intellektuelle in der heutigen Ukraine, die Kiews Rolle hervorheben. Sie hoffen so auf einen höheren Status innerhalb des neuen Imperiums. Doch zwischen der Kiewer Rus und dem modernen russischen Staat liegen Jahrhunderte. Das mittelalterliche Grossreich fällt bereits 1240 dem Mongolensturm zum Opfer. Die Reiter kommen aus dem wilden Feld. Sie haben die Kriegsführung in der Steppe perfektioniert und bauen ein Staatswesen über Tausende von Kilometern auf.
Zwei Jahrhunderte lang herrschen die Mongolen, bevor ihr Reich auseinanderbricht. PolenLitauen steigt im Westen der Ukraine zur dominierenden Macht auf, Moskau im Osten. Der Süden kommt unter den Einfluss der Krimtataren. Die unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Rechtsgrundlagen der drei Reiche bringen eine Vielfalt in die Ukraine, die sie bis heute bereichert und spaltet.
Während der Fluss Dnipro im Norden Polens und Russlands Einflussbereiche trennt, bleibt die Steppe kaum kontrollierbar. Nur kleine Gruppen von slawischen Bauern können sich halten. Sie bauen befestigte Dörfer, schützen sich so gegen die Überfälle der Tataren. Sie adaptieren ihre Lebensweise ans wilde Feld. Aus ihnen bilden sich die Kosaken. Die Ukrainer sehen sie als Vorläufer ihrer Nation. Das Wort bedeutet «freier Krieger». Die Gemeinschaften wachsen, als Polen und Russland die Leibeigenschaft einführen. Entflohene Bauern, Sträflinge und Abenteurer zieht es in die Dörfer, in den Freiraum der Steppe. Einmal pro Jahr unternehmen die Männer auf Pferden und Booten Beutezüge. Den Gewinn verteilen sie untereinander. Der heutige Kosakenmythos zehrt von dieser basisdemokratischen, wehrhaften Gesellschaftsform. Dass Frauen und andere Gesellschaftsgruppen von den Entscheidungsprozessen ausgenommen waren, dass die Kosaken auch Sklavenhändler waren, wird in der heutigen Ukraine ignoriert. Die Soldaten an der Front sehen sich als Erben jener Krieger, die ihre Freiheit gegen Bedrohungen von aussen verteidigten.
Über Jahrhunderte besetzen die Kosaken einen Raum, auf den die Grossmächte keinen direkten Zugriff haben. Die Saporoger Kosaken, die mächtigste Gruppe, profitiert von der Wildheit des Dnipro. Ihre Festung auf der Insel Chortizja liegt unterhalb gefährlicher Stromschnellen. Erst die Sowjets zähmen sie unter Josef Stalin in den 1930er Jahren durch einen riesigen Staudamm. Davor sind die Kosaken die einzigen, die den Fluss mit ihren wendigen Booten befahren können. Ihr Verhältnis zu Polen, damals die dominante Macht in der Ukraine, ist angespannt. Teilweise sind die Kosaken in die gesellschaftlichen und militärischen Strukturen eingebunden. Doch ihre Führer, die Hetmane, kämpften stets um Anerkennung. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele. Der Bruch kommt 1648. Hetman Bohdan Chmelnizki führt die Kosaken in einem Aufstand an, der Polen verwüstet. Seine Truppen ermorden Zehntausende von Juden in einem schrecklichen Pogrom. Für eine kurze Zeit errichten die Kosaken einen eigenen Staat, auf den sich die Ukrainer heute berufen. Die Erinnerung ist nicht nur wegen der Judenverfolgung belastet. Die Kosaken verlieren den Krieg gegen Polen. Um ihre Unabhängigkeit zu erhalten, verbünden sie sich 1654 mit dem russischen Zarenreich. Den Vertrag von Perejaslaw werten die Kosaken als gleichberechtigte Partnerschaft. Die Russen interpretieren ihn als Unterwerfung, als Beweis, dass Russen und Ukrainer schon immer ein Volk waren. Noch 300 Jahre später präsentiert Moskau die Allianz als Beweis der immerwährenden Freundschaft zwischen den «Brudervölkern»: 1954 übergibt die Sowjetunion dem Nachbarland zur Feier die Krim. Es ist der Versuch, die rebellischen Ukrainer nach dem zerstörerischen
Zweiten Weltkrieg näher an sich zu binden. Der Wiederaufbau der versehrten Halbinsel soll aus Kiew effizienter gestaltet werden. Nun stellt Putin diese imperiale Geste des guten Willens als Willkürakt dar, den er mit der Annexion 2014 rückgängig machen will. Geschichtspolitik ist voller Widersprüche.
Anfang des 18. Jahrhunderts nutzt Moskau die Schwäche der Kosaken, um seinen Einfluss in der Ukraine auszudehnen. Die «freien Krieger» zerfallen in Gruppen mit wechselnden Allianzen. 1709 feiert Peter der Grosse den entscheidenden Sieg gegen Schweden und die Saporoger Kosaken. Moskau unterwirft die Steppe und monopolisiert den Weizenexport. Mit der Zerstörung des Krimkhanats 1783 wird das Zarenreich zum Herrscher über das wilde Feld. Katharina die Grosse nennt die eroberten Gebiete «Neurussland»: Neuland, unzivilisiert, unberührt, reif für die Kolonisierung. Sie lässt Städte bauen, siedelt Bauern an. Die russische Kultur und Sprache verdrängt jene der Kosaken, Ukrainer und Tataren. Auch Putin spricht heute von Neurussland. Für die Südukrainer bedeutet Moskaus Kolonialismus seit 2022 aber Besetzung und die Vernichtung ihrer Identität. Als erstes entfernen die Russen in den eroberten Orten alles Ukrainische – Sprache, Strassennamen, Schulprogramme.
Das russische Reich wird im 19. Jahrhundert erst durch die Kontrolle über die Ukraine zum modernen Imperium. Im Donbass findet es ein riesiges Kohlerevier, dessen Energie die Industrialisierung ermöglicht. In Donezk, Kriwi Rih und Odessa entstehen Minen, Fabriken und Häfen für den Export. Sie verbinden das Zarenreich mit Europa. Weizen, Metall und Öl bringen Geld. In die Städte strömen Arbeiter aus Russland. Die ukrainischen Bauern bleiben auf dem Land. Weil es besonders fruchtbar ist und vielen ein vergleichsweise wohlhabendes Leben ermöglicht. Russisch wird auch zur Sprache der Behörden, der Universitäten und Theater. Ukrainisch bleibt auf dem Land toleriert, als «kleinrussischer Dialekt» der Bauern. In Büchern und höheren Schulen wird die Sprache unterdrückt. Nur westlich des Dnipro kann sich eine Nationalbewegung entfalten. Galizien gehört zum Habsburger Reich, das gegenüber den Ukrainern toleranter ist. Lwiw, das damalige Lemberg, wird zu ihrem Zentrum.
Die riesigen Unterschiede zwischen Ost und West behindern die Entwicklung der ukrainischen Nation. Überwunden wird die Spaltung erst im 21. Jahrhundert, als Reaktion auf Russlands
Angriffe. Dennoch argumentieren Gegner der Ukraine, von Putin bis Viktor Orban, diese sei ein künstlicher Staat ohne eigene Identität, ein Objekt in einem geopolitischen Spiel. Doch als am Ende des Ersten Weltkriegs die Imperien zusammenbrechen, stehen die ukrainischen Nationalisten bereit. Sie rufen einen eigenen Staat aus. Die Welle der Gewalt, die ab 1918 über das wilde Feld hereinbricht, zwingt die Ukrainer aber erneut unter Fremdherrschaft. Die damaligen Besatzungsmächte Deutschland und ÖsterreichUngarn anerkennen den Staat zwar. Doch im Gegenzug fordern sie den Grossteil der Weizenernte. Als Donald Trump im Frühjahr 2025 seine Unterstützung von einem ausbeuterischen Rohstoffdeal abhängig macht, fühlen sich die Ukrainer an die Vergangenheit erinnert. Sie machen immer wieder die Erfahrung, dass Grossmächte weniger an ihrer Souveränität als an ihren Rohstoffen interessiert sind.
Die Ukraine wird bald in den Bürgerkrieg hineingezogen, den die Sowjetunion gewinnt. Er fordert Millionen von Menschenleben. Doch die Nationalbewegung bleibt. Patriotisch geprägte Kommunisten spielen in der Ukrainischen Sozialistischen Volksrepublik eine zentrale Rolle. In den 1920er Jahren blühen die Literatur und Kunst auf. Weil der Westen nun zu Polen gehört, wird die Metropole Charkiw im Osten zum kulturellen Zentrum des jungen Staates. Die Bauern erhalten Land, das die Sowjets den Grossgrundbesitzern weggenommen haben, und unterstützen den neuen Staat mehrheitlich. Ein Jahrzehnt lang toleriert und fördert Moskau die ukrainische Identität. Diese Politik ist für Lenin ein Mittel, die Massen geistig und kulturell von der grossrussischen Propaganda zu befreien.
Im Strudel der Gewalt
Mit Josef Stalins Machtübernahme kommt die Kehrtwende. Er forciert ab 1929 den Umbau der Landwirtschaft in staatlich kontrollierte Grossbetriebe. Die Kulaken – wohlhabende Bauern – erklärt er zu Volksfeinden. Der Staat erklärt ihnen den Krieg. In der Ukraine gibt es besonders viele von ihnen. Hungersnöte brechen aus. Hunderttausende kommen in Westrussland und Kasachstan ums Leben. Am schlimmsten betroffen ist aber der Brotkorb der Welt: In der Ukraine gehen während des Holodomor 4 Millionen Menschen zugrunde. Die Sowjets nehmen den Bauern das Getreide weg, das Saatgut, die Tiere. Den Weizen exportieren sie. Mit dem Geld bauen sie Fabriken, produzieren Stahl und Waffen für den Kampf gegen den Westen.
Für die Ukraine ist diese menschengemachte Hungersnot die Urkatastrophe schlechthin. Sie sehen den Holodomor als Genozid, weil er den Bauernstand vernichtet, das Rückgrat ihrer Nation, den
Hüter der Traditionen. Gleichzeitig lässt Stalin Schriftsteller, Künstlerinnen und Lehrer töten, oder er treibt sie in den Suizid. Als Hitler und Stalin 1939 gemeinsam Polen zerschlagen, weitet sich der Terror auf die Westukraine aus. Sie gehört nun zur Sowjetunion. Zwei Jahre später beginnt Deutschland seinen Vernichtungskrieg im Osten. Hitler sieht die Ukraine als «Lebensraum».
Einmal mehr wird das wilde Feld zum Objekt mörderischer Fantasien. Die örtliche Bevölkerung soll vollständig getötet und vertrieben werden. Um Platz zu machen für deutsche Kolonisten und die Ausbeutung der Rohstoffe. Die Nationalsozialisten rücken bis an die Stadtgrenzen von Moskau vor, im Süden werden sie erst in Stalingrad gestoppt. Nach mehr als zwei Jahren Besatzung wirft sie die Rote Armee über den Fluss Dnipro zurück. Die deutschen und ihre ukrainischen Helfer ermorden gegen 1,6 Millionen Juden auf dem heutigen Staatsgebiet. Etwa 2 Millionen Soldaten werden allein am Dnipro getötet und verwundet. Ein grosser Teil sind Ukrainer. Bei Kriegsende ist ein Viertel der Bevölkerung tot.
Heute erzählt Russland den Zweiten Weltkrieg als Heldensage. Überall hängen an Jahrestagen Plakate, die den grossen Sieg feiern. Stalins Verbrechen sind vergessen. Sie verschwinden hinter dem Bild des genialen «Generalissimus», der über die Deutschen triumphierte. Die Invasion der Ukraine stellt Putin als Weiterführung des Kampfs gegen die «Faschisten» dar. Für die Ukrainer ist eine solche Idealisierung unmöglich. Zwar thront über Kiew die MutterHeimatStatue, die das Kriegsende von 1945 verewigt. Die staatliche Geschichtspolitik will sie von einem sowjetischen in ein patriotisches System umdeuten; Hammer und Sichel auf dem Schild der Kämpferin wurden jüngst durch den ukrainischen Dreizack ersetzt. Alle, die in den Kämpfen umkamen, werden als Verteidiger des Vaterlands dargestellt.
Aber der Zweite Weltkrieg gleicht eher einem Bürgerkrieg ohne klare Fronten. Manche Ukrainer heissen die Wehrmacht 1941 nach dem sowjetischen Holodomor als Befreier willkommen. Nationalisten hoffen umsonst auf einen eigenen Staat mit deutscher Billigung. Tausende kollaborieren im Holocaust, gehen als Freiwillige zur SS. Der ukrainische Antisemitismus ist stark. Zudem töten Nationalisten 100’000 polnische Zivilisten. Die Ukrainer sind Täter und Opfer. Sie machen das, was sie müssen, um unter der Besatzung zu überleben. Heldenhaft ist das selten.
1945 stehen die Kämpfer für eine unabhängige Ukraine auf verlorenem Posten. Deutsche und Sowjets haben ihre Reihen dezimiert. Die Nationalisten führen trotzdem jahrelang einen Partisanenkrieg gegen die Rote Armee. Erneut werden Hunderttausende nach Sibirien geschickt oder getötet. Das wilde Feld bleibt ein Unruheherd.
Erst Stalins Nachfolger lockern den Terror. Die sowjetische Geschichtsschreibung verschweigt die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung, deren Gespaltenheit. Wer den Siegeskult mitträgt, darf ruhig leben. Die anderen sind verdächtig, vielleicht sogar Faschisten. Zu ihnen gehören die antisowjetischen Kräfte in der Ukraine. Das hat Russlands Blick auf das Nachbarland geprägt. Seit 2014 dient der Kampf gegen angebliche «Nazis» in Kiew der Legitimierung des Angriffskrieges. Dass Rechtsextreme in der Ukraine politisch bedeutungslos sind, spielt keine Rolle. Zwischentöne gibt es nicht. Jede kritische Betrachtung am sowjetischen Terror ist in Putins Polizeistaat unmöglich geworden.
Russlands heutige Aggressionen und der ukrainische Verteidigungskampf dagegen überdecken, dass die sowjetische Herrschaft für das Land eine widersprüchliche Zeit war. Die Ukrainer verlieren Millionen von Menschen. Ihre Sprache wird unterdrückt, und sie haben keine Souveränität. Doch erst Stalins Landraub an den Polen schafft 1939 den ukrainischen Staat in den heutigen Grenzen. Davon hätten zuvor nur hartgesottene Nationalisten geträumt, sagt der Historiker Timothy Snyder. Nach dem Krieg spielt die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik eine führende Rolle im Moskauer Machtgefüge. Das sozialistische System ermöglicht Millionen einen bescheidenen Wohlstand. Viele Ukrainer haben es mitgetragen und davon profitiert. Sie waren nicht einfach Opfer. Bis 2022 blickt ein Teil der Bevölkerung nostalgisch auf die späte Sowjetunion zurück. Noch 2017 glaubt ein Viertel der Ukrainer, dass Russland ihr Brudervolk ist. Heute sind es vier Prozent.
Die Ukraine gehört auch nicht zu den Republiken, die kompromisslos nach Unabhängigkeit streben. Dieser Impuls kommt von russischen Nationalisten, von den Balten. Zwar unterminieren die Wirtschaftskrise, der verlorene Krieg in Afghanistan und Tschernobyl den Glauben an den Sozialismus. Dass die politischen Anführer die Menschen 1986 kurz nach der Atomkatastrophe am Tag der Arbeit durch die radioaktiv kontaminierten Strassen marschieren lassen, schockiert die Leute. Neue politische Gruppen organisieren sich, fordern mehr nationale Selbstbestimmung. Einen Austritt aus der Sowjetunion wollen sie nicht. Erst nach dem gescheiterten Augustputsch in Moskau ist die UdSSR nicht mehr zu retten. Die Präsidenten der Ukraine, von Belarus und Russland beschliessen die Auflösung der Union. Neun von zehn Ukrainerinnen und Ukrainer stimmen am 1. Dezember 1991 für die Unabhängigkeit. Auch im Donbass und sogar auf der Krim gibt
es klare Mehrheiten. Dort haben die Sowjets in den Jahrzehnten davor besonders viele ethnische Russen angesiedelt. Zum ersten Mal sind die Ukrainer frei, ihren eigenen Staat aufzubauen. Es folgen enttäuschende Jahre. Die sozialistische Planwirtschaft kollabiert und reisst die Massen in die Armut. Parteibonzen, Mafiosi und schlaue Unternehmer teilen sich die Fabriken, Bergwerke und Häfen auf. Die Ukrainer erleben, wie ihre Rohstoffe zum Ziel von Raubtierkapitalisten werden. Die Marktwirtschaft ist ein wildes Feld, ohne Schutz und ohne Regeln. Unter Präsident Leonid Kutschma entsteht eine Oligarchie, die den Staat an sich reisst. Politisch herrscht aber eine liberale Atmosphäre. Die Debatten im Parlament sind laut, manchmal handgreiflich. Und die Medienlandschaft ist vielseitig, gerade weil verschiedene Oligarchen über ihre eigenen Sender miteinander um Macht ringen. Die Regierung fördert die ukrainische Sprache und Kultur, toleriert aber auch andere. Die Ukraine ist eine politische Nation, keine ethnische. Sie nähert sich Europa an, ohne die Beziehungen zu Moskau aufs Spiel zu setzen. 1994 gibt Kiew seine Atomwaffen ab. Russland ist eine der Garantiemächte, die im Budapester Memorandum die Unverwundbarkeit der ukrainischen Grenzen garantiert. 30 Jahre später bereut Kiew die frühere Naivität bitter.
Um die Jahrtausendwende nimmt die Repression im postsowjetischen Raum zu. Mit Putin übernimmt ein Mann der Sicherheitsdienste den Kreml. Er versteht die Ukraine als seinen geopolitischen Hinterhof. In Kiew brechen nach dem brutalen Mord am kritischen Journalisten Heorhi Gongadze Proteste aus. 2004 tritt Wiktor Janukowitsch bei der Präsidentschaftswahl gegen den prowestlichen Technokraten Wiktor Juschtschenko an. Der ehemalige Kleinkriminelle Janukowitsch vertritt die Interessen des Donbass, dessen korruptes System. Er pflegt enge politische und wirtschaftliche Beziehungen nach Moskau. Vor dem Urnengang wird Juschtschenko von der Gegenseite mit Dioxin vergiftet. Er überlebt. Aber sein Gesicht ist entstellt. Janukowitsch gewinnt eine Wahl voller Unregelmässigkeiten. Das treibt die Ukrainer zu Hunderttausenden auf die Strasse. Sie erzwingen in friedlichen Massenprotesten eine Wiederholung der Präsidentschaftswahl. Juschtschenko feiert einen klaren Sieg.
Für Putin ist das ein Alarmsignal. Im Nachbarland haben sich Bürger spontan organisiert und die Oligarchie in die Knie gezwungen. In Russland wären demokratisch herbeigeführte Änderungen undenkbar. Die Ukraine könnte zum Vorbild für die ganze Region werden, die Regeln der Politik neu schreiben. Moskaus Propaganda beginnt, die Orangene Revolution als CIAPutsch darzustellen, knebelt die eigene Zivilgesellschaft. Die Ukrainer aber mobilisiert
die Hoffnung auf ein besseres Leben, demokratische Teilhabe, ein Land ohne Korruption. Sie werden bitter enttäuscht. Juschtschenko zerstreitet sich mit seinen Verbündeten. Die Regierung geht faule Kompromisse mit Moskau ein. Grundlegende Reformen bleiben aus. Und der Westen weiss wenig mit den Demokratiebewegungen anzufangen. Europa ist mit der EUOsterweiterung beschäftigt und will keine weiteren armen Neumitglieder. Die USA konzentrierten sich auf die Terrorbekämpfung und den Irak. Bei der nächsten Wahl siegt wieder Janukowitsch.
Der neue Präsident erhält riesige Summen aus Moskau, lebt in Luxus und verschärft die Gesetze gegen die Zivilgesellschaft. Er lässt zu, dass Putins Geheimdienstler den ukrainischen Staatsapparat unterwandern. Janukowitsch stärkt 2012 russisch als Amtssprache, spricht selbst nur fehlerhaft ukrainisch. Am Ziel einer Annäherung an Europa rüttelt er offiziell nicht. Doch er ist sich mit Putin einig, dass die Ukraine zur russischen Welt gehört. Im November 2013 bricht er plötzlich die Verhandlungen mit der EU über ein Assoziierungsabkommen ab. Dann fliegt er nach Moskau und sichert sich im Kreml einen Kredit über 15 Milliarden Dollar. Die Kehrtwende löst eine präzedenzlose Protestwelle aus.
Auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan Nesaleschnosti in Kiew, demonstrieren über Monate bis zu einer Million Menschen. Sie bauen eine Zeltstadt, in der die verschiedensten Gruppen zusammenkommen, kochen und singen. Diese «Revolution der Würde», basisdemokratisch organisiert und breit abgestützt, wird für die Ukraine zu einem neuen Gründungsakt. Die Menschen gehen für ihre Selbstbestimmung auf die Strasse und für europäische Werte. Sie streiten offen, aber respektvoll. Sie wollen nicht zurück in Moskaus Orbit. Anfang 2014 eskalieren die Zusammenstösse zwischen Spezialeinheiten der Polizei und gewalttätigen Demonstranten. Nachdem Scharfschützen am 20. Februar 100 Menschen erschiessen, verliert Janukowitsch die Nerven. Er flieht nach Moskau, evakuiert durch Spezialeinheiten des russischen Militärs.
Die Ukrainer erinnern sich gut an diesen Moment der totalen Ungewissheit. Plötzlich ist alles möglich: Revolution, Zerfall, nationale Wiedergeburt. In Kiew versucht eine proeuropäische Regierung, das Chaos zu ordnen. Dann stösst Russland gnadenlos in das Machtvakuum. Als Vorwand nutzt Putin eine Entscheidung des ukrainischen Parlaments, den offiziellen Gebrauch des Russischen wieder einzuschränken. Er präsentiert sich als Retter der entrechteten
Russischsprachigen, spricht später sogar von einem drohenden Genozid. Auf der Krim tauchen Soldaten ohne Hoheitszeichen auf und umzingeln das Parlament. In einer Abstimmungsfarce stimmen die Menschen für den Anschluss an Russland.
Die patriotische Aufwallung in der russischen Gesellschaft verschafft Putin einen Popularitätsschub. Im Donbass zettelt er deshalb den nächsten Krieg an. Sogenannte Separatisten überfallen unter dem Kommando von russischen Geheimdienstagenten ostukrainische Städte. Sie versuchen, Marionettenregimes zu installieren. Die ukrainische Armee, jahrzehntelang heruntergewirtschaftet, reagiert nur langsam. Als sie die Oberhand gegen die Rebellen gewinnt und wichtige Städte zurückerobert, rollen Kolonnen von russischen Panzern über die Grenze. Putin bestreitet, Kriegsteilnehmer zu sein. Die Soldaten seien an der Donbassfront auf Urlaub, behauptet er. Der Ukraine droht nun eine katastrophale Niederlage. Sie ist 2015 gezwungen, die Minsker Abkommen zu unterzeichnen und die Kontrolle über die besetzten Gebiete faktisch aufzugeben. Der Krieg wird eingefroren.
Der Westen akzeptiert die Lüge, dass in der Ostukraine Bürgerkrieg herrscht. Er reagiert kaum auf die militärisch erzwungene Grenzverschiebung. Putin bleibt ein respektierter Partner. Das zeigt ihm, wie brüchig die europäische Nachkriegsordnung ist. Völkerrecht zählt wenig, wenn eine Atommacht ihre Einflusssphäre mit Gewalt durchsetzt. Die Ukrainer scheinen dem Kremlherrscher schwach und gespalten. Ernst nimmt er sie nicht. Sie stehen vor der riesigen Herausforderung, ihren schwachen Staat aufzurichten.
Der Maidan bringt Dynamik in die Politik, neue Parteien und Parlamentarierinnen. Die Regierung setzt Reformen um, stärkt die Korruptionsbekämpfung, die Armee, die Mitbestimmung in den Regionen. Regelmässig gibt es aber auch Rückschritte. Die Macht der Oligarchen bleibt unangetastet. Kiew verstärkt die Zusammenarbeit mit Europa. Die Aufhebung der Visumspflicht für Ukrainer wird gefeiert. Sie beschleunigt aber auch die Bevölkerungsabnahme. Von 52 Millionen Einwohnern am Ende der Sowjetunion sind 30 Jahre später ein Drittel weg. Sie leben unter russischer Besetzung oder im Ausland. Jedes Jahr sterben mehr Ukrainer als geboren werden. Putins unerklärter Krieg schafft Instabilität, Unsicherheit. Er hält die Ukraine davon ab, zu einem gefestigten Staat zu werden. Als die Bevölkerung 2019 den Komiker Wolodimir Selenski zum Präsidenten wählt, fürchten viele, der russischsprachige politische Neuling werde sein Land noch tiefer in die Krise stürzen. Manche sehen ihn zunächst gar als Agent Moskaus. Es kommt anders. Auch, weil Putin eines nicht bedenkt. Die Ukraine, in ihrer Geschichte oft zwischen Ost und West verloren, von vielen Seiten bedrängt, hat eine Wahl getroffen. Weil Moskau
die Regionen mit den grössten Sympathien für Russland besetzt, wendet sich der Rest des Landes nach Westen. Kaum mehr jemand in der Ukraine hat nach 2014 den Wunsch, zur russischen Welt zu gehören. Eine klare Mehrheit wünscht sich einen NatoBeitritt. Das war früher undenkbar.
Statt die Ukraine zurück in den eigenen Einflussbereich zu holen, hat Putin das Gegenteil erreicht. Die Grenzen, die jahrhundertelang galten, haben sich verschoben. Russland hat seine Brücke nach Europa zerstört. Dass dies die Folge seiner eigenen Politik ist, versteht der Kremlherr nicht. Er wittert eine noch grössere Verschwörung des Westens, fordert 2021 die Rückabwicklung der Nato Osterweiterung. Während er droht und Angriffspläne schmiedet, lässt er seine Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Selenski beruhigt die Menschen bis zuletzt, hofft, dass alles Provokation und Bluff ist. Doch seine Armee bereitet sich auf den Krieg vor. Sie will nicht noch einmal unvorbereitet getroffen werden.


↤ An der ostukrainischen Front bei Charkiw verdorren die Sonnenblumen. Viele Felder sind vermint.
↘ Eine Gruppe von Soldaten an der Gedenkfeier für ihre gefallenen Kameraden in der Jesuitenkirche von Lwiw.



